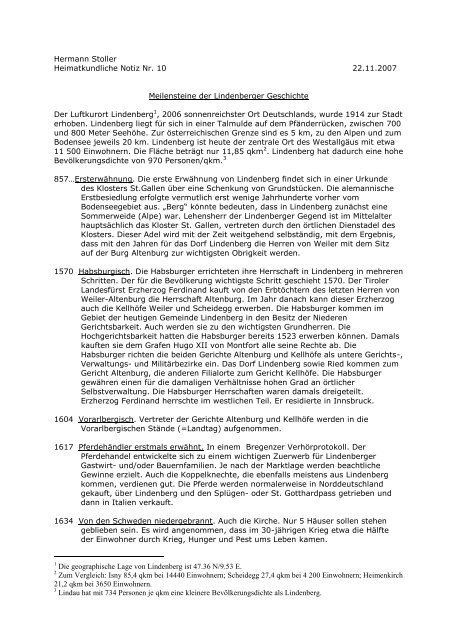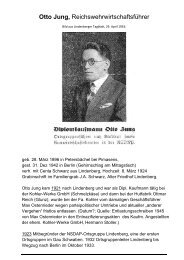(pdf) Meilensteine der Lindenberger Geschichte. - Gmv-lindenberg.de
(pdf) Meilensteine der Lindenberger Geschichte. - Gmv-lindenberg.de
(pdf) Meilensteine der Lindenberger Geschichte. - Gmv-lindenberg.de
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Hermann Stoller<br />
Heimatkundliche Notiz Nr. 10 22.11.2007<br />
<strong>Meilensteine</strong> <strong><strong>de</strong>r</strong> <strong>Lin<strong>de</strong>nberger</strong> <strong>Geschichte</strong><br />
Der Luftkurort Lin<strong>de</strong>nberg 1 , 2006 sonnenreichster Ort Deutschlands, wur<strong>de</strong> 1914 zur Stadt<br />
erhoben. Lin<strong>de</strong>nberg liegt für sich in einer Talmul<strong>de</strong> auf <strong>de</strong>m Pfän<strong><strong>de</strong>r</strong>rücken, zwischen 700<br />
und 800 Meter Seehöhe. Zur österreichischen Grenze sind es 5 km, zu <strong>de</strong>n Alpen und zum<br />
Bo<strong>de</strong>nsee jeweils 20 km. Lin<strong>de</strong>nberg ist heute <strong><strong>de</strong>r</strong> zentrale Ort <strong>de</strong>s Westallgäus mit etwa<br />
11 500 Einwohnern. Die Fläche beträgt nur 11,85 qkm 2 . Lin<strong>de</strong>nberg hat dadurch eine hohe<br />
Bevölkerungsdichte von 970 Personen/qkm. 3<br />
857…Ersterwähnung. Die erste Erwähnung von Lin<strong>de</strong>nberg fin<strong>de</strong>t sich in einer Urkun<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>s Klosters St.Gallen über eine Schenkung von Grundstücken. Die alemannische<br />
Erstbesiedlung erfolgte vermutlich erst wenige Jahrhun<strong><strong>de</strong>r</strong>te vorher vom<br />
Bo<strong>de</strong>nseegebiet aus. „Berg“ könnte be<strong>de</strong>uten, dass in Lin<strong>de</strong>nberg zunächst eine<br />
Sommerwei<strong>de</strong> (Alpe) war. Lehensherr <strong><strong>de</strong>r</strong> <strong>Lin<strong>de</strong>nberger</strong> Gegend ist im Mittelalter<br />
hauptsächlich das Kloster St. Gallen, vertreten durch <strong>de</strong>n örtlichen Diensta<strong>de</strong>l <strong>de</strong>s<br />
Klosters. Dieser A<strong>de</strong>l wird mit <strong><strong>de</strong>r</strong> Zeit weitgehend selbständig, mit <strong>de</strong>m Ergebnis,<br />
dass mit <strong>de</strong>n Jahren für das Dorf Lin<strong>de</strong>nberg die Herren von Weiler mit <strong>de</strong>m Sitz<br />
auf <strong><strong>de</strong>r</strong> Burg Altenburg zur wichtigsten Obrigkeit wer<strong>de</strong>n.<br />
1570 Habsburgisch. Die Habsburger errichteten ihre Herrschaft in Lin<strong>de</strong>nberg in mehreren<br />
Schritten. Der für die Bevölkerung wichtigste Schritt geschieht 1570. Der Tiroler<br />
Lan<strong>de</strong>sfürst Erzherzog Ferdinand kauft von <strong>de</strong>n Erbtöchtern <strong>de</strong>s letzten Herren von<br />
Weiler-Altenburg die Herrschaft Altenburg. Im Jahr danach kann dieser Erzherzog<br />
auch die Kellhöfe Weiler und Schei<strong>de</strong>gg erwerben. Die Habsburger kommen im<br />
Gebiet <strong><strong>de</strong>r</strong> heutigen Gemein<strong>de</strong> Lin<strong>de</strong>nberg in <strong>de</strong>n Besitz <strong><strong>de</strong>r</strong> Nie<strong><strong>de</strong>r</strong>en<br />
Gerichtsbarkeit. Auch wer<strong>de</strong>n sie zu <strong>de</strong>n wichtigsten Grundherren. Die<br />
Hochgerichtsbarkeit hatten die Habsburger bereits 1523 erwerben können. Damals<br />
kauften sie <strong>de</strong>m Grafen Hugo XII von Montfort alle seine Rechte ab. Die<br />
Habsburger richten die bei<strong>de</strong>n Gerichte Altenburg und Kellhöfe als untere Gerichts-,<br />
Verwaltungs- und Militärbezirke ein. Das Dorf Lin<strong>de</strong>nberg sowie Ried kommen zum<br />
Gericht Altenburg, die an<strong><strong>de</strong>r</strong>en Filialorte zum Gericht Kellhöfe. Die Habsburger<br />
gewähren einen für die damaligen Verhältnisse hohen Grad an örtlicher<br />
Selbstverwaltung. Die Habsburger Herrschaften waren damals dreigeteilt.<br />
Erzherzog Ferdinand herrschte im westlichen Teil. Er residierte in Innsbruck.<br />
1604 Vorarlbergisch. Vertreter <strong><strong>de</strong>r</strong> Gerichte Altenburg und Kellhöfe wer<strong>de</strong>n in die<br />
Vorarlbergischen Stän<strong>de</strong> (=Landtag) aufgenommen.<br />
1617 Pfer<strong>de</strong>händler erstmals erwähnt. In einem Bregenzer Verhörprotokoll. Der<br />
Pfer<strong>de</strong>han<strong>de</strong>l entwickelte sich zu einem wichtigen Zuerwerb für <strong>Lin<strong>de</strong>nberger</strong><br />
Gastwirt- und/o<strong><strong>de</strong>r</strong> Bauernfamilien. Je nach <strong><strong>de</strong>r</strong> Marktlage wer<strong>de</strong>n beachtliche<br />
Gewinne erzielt. Auch die Koppelknechte, die ebenfalls meistens aus Lin<strong>de</strong>nberg<br />
kommen, verdienen gut. Die Pfer<strong>de</strong> wer<strong>de</strong>n normalerweise in Nord<strong>de</strong>utschland<br />
gekauft, über Lin<strong>de</strong>nberg und <strong>de</strong>n Splügen- o<strong><strong>de</strong>r</strong> St. Gotthardpass getrieben und<br />
dann in Italien verkauft.<br />
1634 Von <strong>de</strong>n Schwe<strong>de</strong>n nie<strong><strong>de</strong>r</strong>gebrannt. Auch die Kirche. Nur 5 Häuser sollen stehen<br />
geblieben sein. Es wird angenommen, dass im 30-jährigen Krieg etwa die Hälfte<br />
<strong><strong>de</strong>r</strong> Einwohner durch Krieg, Hunger und Pest ums Leben kamen.<br />
1 Die geographische Lage von Lin<strong>de</strong>nberg ist 47.36 N/9.53 E.<br />
2 Zum Vergleich: Isny 85,4 qkm bei 14440 Einwohnern; Schei<strong>de</strong>gg 27,4 qkm bei 4 200 Einwohnern; Heimenkirch<br />
21,2 qkm bei 3650 Einwohnern.<br />
3 Lindau hat mit 734 Personen je qkm eine kleinere Bevölkerungsdichte als Lin<strong>de</strong>nberg.
2<br />
1665 Österreichisch. Leopold I beerbt die ausgestorbene Innsbrucker Linie <strong><strong>de</strong>r</strong><br />
Habsburger. Damit wer<strong>de</strong>n alle Habsburger Lan<strong>de</strong> und Rechte wie<strong><strong>de</strong>r</strong> unter einem<br />
Herrscher vereinigt.<br />
1674 Erster König heiratet nach Lin<strong>de</strong>nberg. Um 1674 heiratet Jörg König aus Heimhofen<br />
nach Lin<strong>de</strong>nberg. Er ist <strong><strong>de</strong>r</strong> erste Rösslewirt namens König. Er wird zum Urahnen<br />
vieler <strong>Lin<strong>de</strong>nberger</strong>. Er und mehrere seiner Nachkommen wer<strong>de</strong>n zu be<strong>de</strong>uten<strong>de</strong>n<br />
Pfer<strong>de</strong>händlern. Sie sind gleichzeitig Wirte und gehören zu <strong>de</strong>n größeren Bauern.<br />
En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s 17. Jahrhun<strong><strong>de</strong>r</strong>ts befin<strong>de</strong>n sich nicht weniger als drei <strong><strong>de</strong>r</strong> sechs<br />
<strong>Lin<strong>de</strong>nberger</strong> Wirtschaften im Besitz von König (Rössle, Krone, Kreuz).<br />
1755 Erstes Hutunternehmen. Drei Teilhaber grün<strong>de</strong>n die <strong>Lin<strong>de</strong>nberger</strong> „Hut-Compagnie“<br />
Lorenz Miller. In Lin<strong>de</strong>nberg wur<strong>de</strong>n schon lange vorher Hüte in Heimarbeit<br />
hergestellt. Das Unternehmen kauft geflochtene Strohbän<strong><strong>de</strong>r</strong> auf und lässt daraus<br />
– wie<strong><strong>de</strong>r</strong>um in Heimarbeit – Hüte nähen. Die Compagnie übernimmt dann die<br />
Vermarktung durch Hausieren und Beschickung auswärtiger Märkte.<br />
1771 Flurbereinigung. Die zersplitterten Fel<strong><strong>de</strong>r</strong> <strong><strong>de</strong>r</strong> verschie<strong>de</strong>nen Besitzer wer<strong>de</strong>n<br />
zusammengefasst. Von <strong>de</strong>n 58 Bauernhäuser <strong>de</strong>s Dorfes Lin<strong>de</strong>nberg wer<strong>de</strong>n nicht<br />
weniger als 34 „vereinö<strong>de</strong>t“. Sie wer<strong>de</strong>n abgebrochen und inmitten <strong><strong>de</strong>r</strong> neu<br />
zugeteilten Fel<strong><strong>de</strong>r</strong> wie<strong><strong>de</strong>r</strong> aufgebaut. Durch die nunmehr über die ganze Talmul<strong>de</strong><br />
verteilten Einzelhöfe wird Lin<strong>de</strong>nberg zur Streusiedlung. Auch die Filialorte wie<br />
Goßholz, Manzen etc. wer<strong>de</strong>n in diesen Jahren „vereinö<strong>de</strong>t“. Da die Fluren dieser<br />
Gemein<strong>de</strong>n kleiner sind, ist <strong><strong>de</strong>r</strong> Anteil <strong><strong>de</strong>r</strong> ausgesie<strong>de</strong>lten Bauernhäuser geringer.<br />
1774 Allgemeine Schulpflicht. Eingeführt unter <strong><strong>de</strong>r</strong> Kaiserin Maria Theresia in allen ihren<br />
Erblan<strong>de</strong>n. Es war eine Winterschule von St. Martin (11. November) bis St. Georg<br />
(23. April).<br />
1780 Beginn <strong><strong>de</strong>r</strong> späteren Käsestadt. Um 1780 eröffnete <strong><strong>de</strong>r</strong> Goßholzer „Han<strong>de</strong>lsmann“<br />
Franz Xaver Stadler das erste Allgäuer Käsegroßhan<strong>de</strong>lsunternehmen. Er betrieb<br />
<strong>de</strong>n Han<strong>de</strong>l von Ulm aus. Sein Teilhaber und Schwager Anton Rädler besorgte von<br />
Goßholz aus <strong>de</strong>n Einkauf, wohl hauptsächlich auf <strong>de</strong>n Oberstaufener Alpen. Obwohl<br />
die örtliche Käseproduktion in Lin<strong>de</strong>nberg wegen <strong><strong>de</strong>r</strong> begrenzten Flächen nie eine<br />
große Be<strong>de</strong>utung erlangen konnte, entstan<strong>de</strong>n im Ort im 19. und 20. Jahrhun<strong><strong>de</strong>r</strong>t<br />
doch mehrere be<strong>de</strong>uten<strong>de</strong> Unternehmen <strong>de</strong>s Käsegroßhan<strong>de</strong>ls und <strong><strong>de</strong>r</strong><br />
Käseproduktion. Heute gibt es noch das Bayernland-Käsewerk und die Firma<br />
Baldauf.<br />
1784 Markt Lin<strong>de</strong>nberg. Die Marktrechte erhält das Dorf Lin<strong>de</strong>nberg. Drei Viehmärkte im<br />
Jahr können abgehalten wer<strong>de</strong>n. Die Bevölkerung <strong><strong>de</strong>r</strong> Pfarrgemein<strong>de</strong> Lin<strong>de</strong>nberg,<br />
welche auch die Filialorte einschließt, erreicht 1000 Einwohner, eine Verdoppelung<br />
seit 1740. Möglich gemacht wur<strong>de</strong> das durch bessere Erträge <strong><strong>de</strong>r</strong> Landwirtschaft<br />
und durch die guten Verdienste aus Pfer<strong>de</strong>han<strong>de</strong>l und Hutproduktion.<br />
1785 Neuordnung <strong>de</strong>s Pfarrgebietes. Kaiser Joseph II möchte <strong>de</strong>n Kirchgängern zu lange<br />
Wege ersparen. Haus kommt zu Schei<strong>de</strong>gg und Geigersthal zu Heimenkirch.<br />
Lin<strong>de</strong>nberg erhält Ried und Kellershub. Die heutigen <strong>Lin<strong>de</strong>nberger</strong> Grenzen<br />
entsprechen <strong>de</strong>n damals festgelegten. Einzige Ausnahme ist Ratzenberg, das 1970<br />
von Opfenbach nach Lin<strong>de</strong>nberg kam. 4<br />
1805 Bayerisch. Im Preßburger Frie<strong>de</strong>n vom 26. Dezember 1805 wer<strong>de</strong>n Tirol und<br />
Vorarlberg (und damit Lin<strong>de</strong>nberg) Bayern zugeteilt. Die eigentliche Übergabe <strong><strong>de</strong>r</strong><br />
Macht an Bayern ist am 13. März 1806 in Bregenz.<br />
4 Obwohl bei <strong><strong>de</strong>r</strong> Gebietsreform die bayerischen Gemein<strong>de</strong>n von über 8500 auf gut 2000 verringert wur<strong>de</strong>n, blieb<br />
Lin<strong>de</strong>nberg fast gleich groß
3<br />
1808 Heutige Gemein<strong>de</strong> entsteht. Der erste bayerische Bürgermeister von Lin<strong>de</strong>nberg,<br />
wird ernannt: Franz Josef König. Die staatliche Gemein<strong>de</strong> entsteht in <strong>de</strong>n Grenzen<br />
<strong><strong>de</strong>r</strong> seit un<strong>de</strong>nklichen Zeiten bestehen<strong>de</strong>n Pfarrei. Goßholz, Manzen usw. waren in<br />
<strong><strong>de</strong>r</strong> österreichischen Zeit eigene Gemein<strong>de</strong>n. Ab 1808 sind diese Orte nur noch<br />
Ortsfilialen.<br />
1809 Aufstand <strong><strong>de</strong>r</strong> Vorarlberger gegen Bayern. Die wehrfähigen <strong>Lin<strong>de</strong>nberger</strong> nehmen<br />
geschlossen an <strong>de</strong>m Aufstand teil. Die Vorarlberger Milizeinheiten leben noch<br />
einmal auf. Der Aufstand wird durch württembergische und französische Truppen<br />
nie<strong><strong>de</strong>r</strong>geschlagen. Ein <strong>Lin<strong>de</strong>nberger</strong>, Franz Josef Milz, fällt am 15. 7. 1809 bei<br />
Eglofs auf Seiten <strong><strong>de</strong>r</strong> aufständischen Vorarlberger.<br />
1814 Von Vorarlberg getrennt. Im Pariser Frie<strong>de</strong>n vom 3.6.1814 kommt Vorarlberg<br />
wie<strong><strong>de</strong>r</strong> zu Österreich. Ausgenommen bleibt das damalige Landgericht Weiler und<br />
damit Lin<strong>de</strong>nberg. Eine Petition an <strong>de</strong>n Kaiser in Wien, wie<strong><strong>de</strong>r</strong> österreichisch zu<br />
wer<strong>de</strong>n, blieb erfolglos. Die Bayern hatten sich in <strong>de</strong>n Anfangsjahren durch<br />
Einschränkung <strong><strong>de</strong>r</strong> Selbstverwaltungsrechte, durch Korruption und durch die Toten<br />
<strong>de</strong>s Rußlandfeldzuges von 1812 unbeliebt gemacht.<br />
1848 Politische Unruhen. Im Allgäu entsteht politischer Unwille. Ein Volksverein mit<br />
liberaler Richtung wird gegrün<strong>de</strong>t. Zur „Beruhigung“ wird in einer Nacht- und<br />
Nebelaktion das Allgäu im Juli 1849 von Truppen aus <strong>de</strong>n bayerischen<br />
Stammlan<strong>de</strong>n besetzt. Auch Lin<strong>de</strong>nberg erhält eine Einquartierung.<br />
1853 Eisenbahn erreicht <strong>de</strong>n Bahnhof Röthenbach. Lin<strong>de</strong>nberg ist damit nur noch 6 km<br />
von <strong>de</strong>m sich rasch ausweiten<strong>de</strong>n Eisenbahnnetz entfernt.<br />
1868 En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s Pfer<strong>de</strong>han<strong>de</strong>ls. Der letzte Pfer<strong>de</strong>transport auf <strong><strong>de</strong>r</strong> Landstraße über<br />
Lin<strong>de</strong>nberg nach Norditalien fin<strong>de</strong>t statt. Fortan wer<strong>de</strong>n alle Pfer<strong>de</strong> mit <strong><strong>de</strong>r</strong><br />
Eisenbahn transportiert. Lin<strong>de</strong>nberg liegt damit außerhalb <strong><strong>de</strong>r</strong> Han<strong>de</strong>lswege. Durch<br />
<strong>de</strong>n Pfer<strong>de</strong>han<strong>de</strong>l hatten viele <strong>Lin<strong>de</strong>nberger</strong> als Kaufleute o<strong><strong>de</strong>r</strong> Koppelknechte<br />
Gelegenheit, aus <strong>de</strong>m Dorf herauszukommen und gutes Geld zu verdienen. Der<br />
Sinn für Risikobereitschaft, Unternehmertum und Weltoffenheit wur<strong>de</strong> geför<strong><strong>de</strong>r</strong>t.<br />
1869 Beginn <strong><strong>de</strong>r</strong> Industrialisierung. Die erste hydraulische Hutpresse wird in Betrieb<br />
genommen. 1873 folgen die ersten Strohhutnähmaschinen. Die große<br />
Entwicklungsperio<strong>de</strong> Lin<strong>de</strong>nbergs, die bis zum 1. Weltkrieg (1914) dauert, macht<br />
Lin<strong>de</strong>nberg vom Bauerndorf mit 1500 Einwohnern (1870) zur Industrie(klein)stadt<br />
mit 4500 Einwohnern. Träger <strong>de</strong>s Aufschwungs ist <strong><strong>de</strong>r</strong> Herrenstrohhut. In rascher<br />
Folge entstehen neue Hutfabriken. Fabrikkamine beginnen das Ortsbild zu<br />
beherrschen.1890 gab es schon 34 Strohhutbetriebe. Die Fabrikanten waren fast<br />
alle Einheimische. Die meisten hatten als Huthändler begonnen o<strong><strong>de</strong>r</strong> waren<br />
nachgeborene Bauernsöhne. Lin<strong>de</strong>nberg wird bevölkerungsmäßig zum größten Ort<br />
<strong>de</strong>s Westallgäus. Vorher war es kleiner als die Nachbarorte Weiler (mit<br />
Simmerberg), Schei<strong>de</strong>gg o<strong><strong>de</strong>r</strong> Heimenkirch. Die starke Bautätigkeit konzentriert<br />
sich entlang <strong><strong>de</strong>r</strong> Vicinalstraße (Ortsverbindungsstraße). Lin<strong>de</strong>nberg wird von einer<br />
Streusiedlung zum Straßendorf. Das 1907 gebaute Rathaus und die neubarocke<br />
Pfarrkirche verlagern <strong>de</strong>n Ortsmittelpunkt zu dieser Hauptstraße.<br />
1893 Elektrizität kommt. Der <strong>Lin<strong>de</strong>nberger</strong> Lorenz Rädler errichtet unterhalb <strong><strong>de</strong>r</strong><br />
Schei<strong>de</strong>gger Wasserfälle ein Elektrizitätswerk. Lin<strong>de</strong>nberg erhält damit zusammen<br />
mit Schei<strong>de</strong>gg als einer <strong><strong>de</strong>r</strong> ersten Orte eine elektrische Straßenbeleuchtung.<br />
1901 Eisenbahnanschluss. Der Versand <strong><strong>de</strong>r</strong> (sperrigen) Hüte sowie <strong><strong>de</strong>r</strong> Bezug von Kohlen<br />
wer<strong>de</strong>n kostengünstiger.
4<br />
1913 Hutproduktion erreicht Höhepunkt. Über 5 Millionen Herrenstrohhüte wer<strong>de</strong>n<br />
hergestellt im Wert von 8 Millionen Mark. Dazu kommen 2 Millionen Hüte in <strong>de</strong>n<br />
Fabriken <strong><strong>de</strong>r</strong> Nachbarorte. In Lin<strong>de</strong>nberg bestan<strong>de</strong>n damals einschließlich <strong><strong>de</strong>r</strong><br />
Heimarbeiter rund 3000 Arbeitsplätze.<br />
1914 Stadtpfarrkirche eingeweiht. Am 14. Mai 1914. Lin<strong>de</strong>nberg erhält seinen baulichen<br />
Mittelpunkt.<br />
1914 Zur Stadt erhoben. Am 11. August 1914. Am 1. August war <strong><strong>de</strong>r</strong> Krieg<br />
ausgebrochen. Im 1.Weltkrieg sind 172 <strong>Lin<strong>de</strong>nberger</strong> gefallen.<br />
1920 Beginn <strong><strong>de</strong>r</strong> Schulstadt. Die Stadt errichtet eine Realschule, Vorgängerschule <strong>de</strong>s<br />
heutigen Gymnasiums. Die Jugend <strong>de</strong>s Westallgäus erhält bessere Berufschancen.<br />
1925 wird die Schule staatlich. Sie umfasst bis 1945 sechs Klassen. 1947 wird zum<br />
ersten Mal das Abitur abgenommen. Heute hat Lin<strong>de</strong>nberg fünf verschie<strong>de</strong>ne<br />
Schulen.<br />
1925 Mo<strong><strong>de</strong>r</strong>nes Schmelzkäsewerk. Die „Kohlerwerke“ nehmen die Produktion auf. 1935<br />
übernimmt die amerikanische Firma KRAFT das Werk und 1984 die zum<br />
Genossenschaftssektor gehören<strong>de</strong> Molkereizentrale Süd (Markenname:<br />
Bayernland).<br />
1926 Nachkriegskrise <strong><strong>de</strong>r</strong> Hutindustrie erreicht Höhepunkt. Der Herrenstrohhut kommt<br />
seit 1924 immer stärker aus <strong><strong>de</strong>r</strong> Mo<strong>de</strong>. Im September 1926 sind 253 <strong>Lin<strong>de</strong>nberger</strong><br />
arbeitslos. Mehrere be<strong>de</strong>uten<strong>de</strong> Hutfabriken müssen aufgeben. In <strong>de</strong>n Folgejahren<br />
ging es durch Umstellung auf Filzhüte und Damenhüte wie<strong><strong>de</strong>r</strong> aufwärts.<br />
1933 Nationalsozialisten übernehmen Macht. Seit 1929 stellten die Nationalsozialisten 4<br />
von 20 Stadträten. Jetzt wur<strong>de</strong>n aufgrund eines Gesetzes vom 7. April 1933 die<br />
Stadtratsitze <strong><strong>de</strong>r</strong> Parteien nach <strong>de</strong>n Verhältniszahlen <strong><strong>de</strong>r</strong> Reichstagswahl vom März<br />
1933 neu verteilt. Da sich die Freien Wähler nicht an <strong><strong>de</strong>r</strong> Reichstagswahl beteiligen,<br />
schie<strong>de</strong>n <strong><strong>de</strong>r</strong>en Stadträte alle aus. Die Nationalsozialisten erhielten 9 von 15<br />
Stadträten. Im Juni 1933 wur<strong>de</strong>n die zwei Sozial<strong>de</strong>mokraten wegen <strong>de</strong>s<br />
reichsweiten Verbots ihrer Partei ausgeschlossen. Anfang August wur<strong>de</strong>n die vier<br />
verbleiben<strong>de</strong>n Stadträte <strong><strong>de</strong>r</strong> Bayerischen Volkspartei (heutige CSU) zum Verzicht<br />
gezwungen. Der damit rein nationalsozialistische Stadtrat „wählte“ schließlich am<br />
4. August 1933 <strong>de</strong>n örtlichen <strong>Lin<strong>de</strong>nberger</strong> Parteiführer Volksschullehrer Hans<br />
Vogel „einstimmig“ zum Bürgermeister.<br />
1939 Lazarettstadt. Mit Kriegsbeginn wer<strong>de</strong>n zwei große Lazarette eingerichtet: Das<br />
Tuberkulose-Lazarett in <strong><strong>de</strong>r</strong> heutigen Kurklinik Ried und ein allgemeines Lazarett<br />
im Reichsbahn-Waisenhort. Gegen Kriegsen<strong>de</strong> wur<strong>de</strong>n auch die Volksschule und die<br />
Berufsschule (heutige Antonio Huber Schule) zu Lazaretten.<br />
Lin<strong>de</strong>nberg kommt ohne nennenswerte Sachschä<strong>de</strong>n durch <strong>de</strong>n Krieg. Der Blutzoll<br />
war jedoch hoch: 420 Gefallene und Vermisste bei einer Bevölkerung von 5 400 bei<br />
Kriegsbeginn (=8%).<br />
1945 Französisch besetzt. Der Ort wird am 30.April von französischen Truppen besetzt.<br />
Die endgültigen Besatzungszonen wer<strong>de</strong>n im Juli 1945 zwischen <strong>de</strong>n Alliierten<br />
festgelegt. Der Kreis Lindau wird <strong><strong>de</strong>r</strong> einzig französisch besetzte Teil Bayerns. Er<br />
wird wie die drei späteren Bun<strong>de</strong>slän<strong><strong>de</strong>r</strong> <strong><strong>de</strong>r</strong> französischen Besatzungszone einem<br />
eigenen Militärgouverneur unterstellt. Diese Eigenständigkeit kommt auch<br />
Lin<strong>de</strong>nberg zugute. Mit Unterstützung <strong><strong>de</strong>r</strong> Kreisbehör<strong>de</strong>n gelingt es noch vor <strong><strong>de</strong>r</strong><br />
Währungsreform das Erz für das 1948 gegossene Kirchengeläute zu erwerben. Im<br />
Kreis Lindau gibt es wie<strong><strong>de</strong>r</strong>holt Son<strong><strong>de</strong>r</strong>zuteilungen an Lebensmitteln. In<br />
Zusammenarbeit zwischen <strong>de</strong>n <strong>de</strong>utschen und französischen Behör<strong>de</strong>n wird<br />
erreicht, dass am Kriegsen<strong>de</strong> kein Schuljahr verloren geht und dass 1947 zum<br />
ersten Mal das Abitur in Lin<strong>de</strong>nberg abgelegt wer<strong>de</strong>n kann.
5<br />
1948 Währungsreform. Die <strong>Lin<strong>de</strong>nberger</strong> Industrie kommt nach <strong>de</strong>m 20. Juni 1948 rasch<br />
voran, vor allem die Firma Kraft. Das Unternehmen profitiert mit seinem damaligen<br />
Hauptprodukt „Velveta“ von <strong><strong>de</strong>r</strong> „Freßwelle“. Der Stadt fließen beachtliche<br />
Gewerbesteuereinnahmen zu. Die Hutfabriken machen zunächst ebenfalls gute<br />
Geschäfte. Nach und nach kommt jedoch <strong><strong>de</strong>r</strong> Hut aus <strong><strong>de</strong>r</strong> Mo<strong>de</strong>.<br />
1948 Neue Kirchenglocken. Die Glocken <strong><strong>de</strong>r</strong> <strong>Lin<strong>de</strong>nberger</strong> Kirchen mussten während <strong>de</strong>s<br />
Krieges abgeliefert wer<strong>de</strong>n. Lin<strong>de</strong>nberg erhält bereits im November 1948 neue<br />
Glocken. Die sieben Glocken <strong><strong>de</strong>r</strong> Stadtpfarrkirche sind mit ihrem Gewicht von<br />
zusammen 17,9 Tonnen das größte Geläut <strong>de</strong>s Bistums Augsburg und eines <strong><strong>de</strong>r</strong><br />
größten in Deutschland.<br />
1956 Kraft verlagert Hauptverwaltung. Die Kraft-GmbH verlagert ihre Hauptverwaltung<br />
ins zentrale Frankfurt. Lin<strong>de</strong>nberg bekommt seine Randlage zu spüren.<br />
1959 Liebherr kommt. Liebherr baut in Lin<strong>de</strong>nberg ein Werk für Flugzeugteile. Viele<br />
ehemalige Hutarbeiter fin<strong>de</strong>n Arbeit. Die Struktur <strong><strong>de</strong>r</strong> <strong>Lin<strong>de</strong>nberger</strong> Industrie wird<br />
ausgefächert. Liebherr wird bald zum größten Arbeitgeber <strong><strong>de</strong>r</strong> Stadt.<br />
1967 10 000 Einwohner. Innerhalb von nur 20 Jahren hat sich die Bevölkerung<br />
verdoppelt. Die Zunahme <strong><strong>de</strong>r</strong> Einwohner und <strong><strong>de</strong>r</strong> steigen<strong>de</strong> Wohlstand führen zu<br />
einer starken Aus<strong>de</strong>hnung <strong><strong>de</strong>r</strong> Wohngebiete. Lin<strong>de</strong>nberg ist kein Straßendorf mehr.<br />
Es wächst in die Breite. Die Hänge <strong><strong>de</strong>r</strong> Talmul<strong>de</strong> wer<strong>de</strong>n fast vollständig bebaut.<br />
1976 Fabrikkamine fallen. Das in <strong><strong>de</strong>r</strong> Stadtmitte gelegene Fabrikgebäu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s ehemaligen<br />
Hutunternehmens Aurel Huber wird abgebrochen und durch einen Supermarkt<br />
ersetzt.<br />
1997 Reich geht in Konkurs. Das Hutunternehmen war früher das größte in Lin<strong>de</strong>nberg.<br />
Damit hat Lin<strong>de</strong>nberg mit Mayser nur noch eine Hutfabrik. 2004 wer<strong>de</strong>n in<br />
Lin<strong>de</strong>nberg nur noch etwa 80 Personen in <strong><strong>de</strong>r</strong> Hutfabrikation beschäftigt. Verglichen<br />
mit <strong><strong>de</strong>r</strong> Zeit vor <strong>de</strong>m 1.Weltkrieg sind von 30 Arbeitsplätzen 29 weggefallen. 2007<br />
erbrachten bei Mayser die Hüte nur noch etwa 15 % <strong>de</strong>s Umsatzes.<br />
2010 Mayser stellt die Hutproduktion in Lin<strong>de</strong>nberg ein, nur noch das Atelier und die<br />
Endkontrolle bleiben in Lin<strong>de</strong>nberg. Die Firma konzentriert sich in Lin<strong>de</strong>nberg auf<br />
ihre technologischen Schwerpunkte, nämlich Schaumstofftechnik,<br />
Verformungstechnik, Sicherheitstechnik.