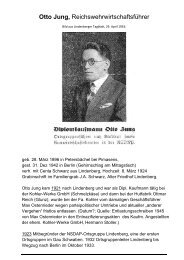Kapitelsbibliothek - Gmv-lindenberg.de
Kapitelsbibliothek - Gmv-lindenberg.de
Kapitelsbibliothek - Gmv-lindenberg.de
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Hermann Stoller 28. Mai 2004<br />
Heimatkundliche Notiz Nr. 15<br />
Über die <strong>Kapitelsbibliothek</strong> Weiler im Lin<strong>de</strong>nberger Pfarrhof<br />
Lin<strong>de</strong>nberg war noch in <strong>de</strong>r ersten Hälfte <strong>de</strong>s 19. Jahrhun<strong>de</strong>rt eine eher abgelegene und im<br />
Verhältnis zu <strong>de</strong>n Nachbargemein<strong>de</strong>n unbe<strong>de</strong>uten<strong>de</strong> Pfarrei. Trotz<strong>de</strong>m befand sich seit Pfarrer<br />
Wettach (Pfarrer von 1769-1815) im Pfarrhof eine für die damaligen Verhältnisse be<strong>de</strong>uten<strong>de</strong><br />
Bibliothek, die heute noch einen hohen kulturellen und materiellen Wert besitzt. Im<br />
Dezember 2001 wur<strong>de</strong> die Bibliothek bis auf einen kleinen Rest auf Weisung <strong>de</strong>r<br />
bischöflichen Behör<strong>de</strong>n nach Augsburg verbracht. 1<br />
Geschichte <strong>de</strong>r Bibliothek<br />
Meines Wissens war die erste Einrichtung zur För<strong>de</strong>rung <strong>de</strong>r Bildung <strong>de</strong>s Klerus im<br />
Landkapitels Weiler eine sog. Lesegesellschaft. Damals gehörte das Landkapitel zum Bistum<br />
Konstanz (bis 1821). In einem „Bischöflich Konstanzischen Ordinariats-Zirkular“ vom<br />
12.3.1808, gezeichnet durch Generalvikar Ignaz Heinrich Freyherr von Wessenberg 2 , wur<strong>de</strong><br />
vorgeschrieben, „dass in je<strong>de</strong>m Landkapitel ...ein wissenschaftlicher und literarischer<br />
Verband sämtlicher Geistlicher durch Errichtung zweckmäßiger Lesegesellschaften gegrün<strong>de</strong>t<br />
und befestiget wer<strong>de</strong>“. Je<strong>de</strong>r Pfarrer hatte 2 Gul<strong>de</strong>n und je<strong>de</strong>r Benefiziat 1 ½ Gul<strong>de</strong>n<br />
beizutragen. Nach einem Jahr sollten dann die gekauften Schriften meistbietend an die<br />
Kapitelsgeistlichen verkauft wer<strong>de</strong>n, damit man neue Gel<strong>de</strong>r für die Lesegesellschaft<br />
bekommt. Alle Dekanate wur<strong>de</strong>n angewiesen, an das bischöfliche Ordinariat zu berichten,<br />
„wie die Lesegesellschaft in Ausführung gebracht wor<strong>de</strong>n sei“. In <strong>de</strong>m Zirkular wird auch<br />
empfohlen, dass die Geistlichen ein Verzeichnis ihrer besten Bücher an das Dekanat<br />
einreichen. Dieses solle dann einen Katalog erstellen, damit einer <strong>de</strong>m an<strong>de</strong>ren mit seinen<br />
Büchern aushelfen möge.<br />
Es ist mir nicht bekannt, ob bereits damals eine <strong>Kapitelsbibliothek</strong> für das Dekanat Weiler<br />
angelegt wur<strong>de</strong>. Wie <strong>de</strong>m auch sei, entschei<strong>de</strong>nd für <strong>de</strong>n beson<strong>de</strong>ren Wert <strong>de</strong>r jetzigen<br />
Bibliothek waren die testamentarischen Überlassungen ihrer wertvollen privaten Bibliotheken<br />
durch die bei<strong>de</strong>n Lin<strong>de</strong>nberger Pfarrer Johann Joseph Wettach (1734-1819; Pfarrer in<br />
Lin<strong>de</strong>nberg von 1769-1815) und Josef Anton Hauber (1777-1840; Pfarrer in Lin<strong>de</strong>nberg von<br />
1815-40) an ihre Herren Nachfolger Pfarrer in Lin<strong>de</strong>nberg. Wettach und Hauber haben ihre<br />
Zuwendungen vermutlich miteinan<strong>de</strong>r abgesprochen. Die bei<strong>de</strong>n verband ein väterliches<br />
Verhältnis. Hauber war Lin<strong>de</strong>nberger. Wettach hatte ihn getauft und religiös erzogen. Als<br />
Wettach sein Amt altershalber ab 1815 nicht mehr ausüben konnte, wur<strong>de</strong> Hauber sein<br />
Nachfolger. Wettach hatte bis zu seinem Tod 1819 weiterhin ein Wohnrecht bei Hauber im<br />
Lin<strong>de</strong>nberger Pfarrhof. Außer<strong>de</strong>m erhielt er von Hauber 200 Gul<strong>de</strong>n jährlich. Wir wissen mit<br />
Sicherheit, dass bei<strong>de</strong> über Wettachs Testament gesprochen haben. Hauber berichtet, dass<br />
Wettach seinem Rat folgte, mit <strong>de</strong>m Hauptteil seines verbleiben<strong>de</strong>n Vermögens 3 eine<br />
Lin<strong>de</strong>nberger Kaplaneistiftung zu begrün<strong>de</strong>n.<br />
1 Das Archiv <strong>de</strong>s Bistums Augsburg verbringt seit 1999 die ehemaligen <strong>Kapitelsbibliothek</strong>en <strong>de</strong>s Bistums ins<br />
Priesterseminar Staufenbergstr. 8, 86161 Augsburg. 27 <strong>de</strong>r bisher festgestellten 32 Bibliotheken wur<strong>de</strong>n dort<br />
bereits konzentriert, aber als eigene Bestän<strong>de</strong> untergebracht (Stand 2003; Notiz im Internet).<br />
2 Sammlung bischöflicher Hirtenbriefe und Verordnungen von 1801 bis 1808, Konstanz, Nikolaus Waibel, 1808<br />
3 Wettach hat insgesamt etwa die Hälfte seiner (nicht allzu hohen) Amtsbezüge für verschie<strong>de</strong>ne Zuwendungen<br />
an seine Pfarrei verwen<strong>de</strong>t.
2<br />
Als Hauber 1815 die Pfarrei Lin<strong>de</strong>nberg übernahm und mit Wettach zusammen <strong>de</strong>n Pfarrhof<br />
bezog, brachte auch Hauber eine wertvolle Bibliothek mit in <strong>de</strong>n Pfarrhof, die sicherlich mit<br />
Wettachs Bibliothek räumlich vereinigt wur<strong>de</strong>. Ein wichtiger Teil seiner Bibliothek stammt<br />
von seinem Patenonkel Josef Hauber, <strong>de</strong>r zuletzt Pfarrer in Linz bei Pfullendorf war. Dieser<br />
hatte ihm 1813 seine Bibliothek und 64 Landkarten vererbt. 4<br />
Die Bestimmung in Wettachs Testament, seine Bibliothek <strong>de</strong>r Pfarrei zu vermachen, war<br />
folgen<strong>de</strong>:<br />
...“Ebenso sollen für alle Zeiten im Pfarrhofe als bleiben<strong>de</strong> Pfarrhof Bibliothek alle die bei meinem To<strong>de</strong><br />
verbleiben<strong>de</strong>n Bücher verbleiben. Meine Herren Nachfolger sollen über selbe ein genaues Verzeichnis im Pfarr-<br />
Archive immer erhalten, und die Bücher gewissenhaft besorgen.“ 5 ...<br />
Pfarrer Hauber machte sein Testament am 10. Juli 1840, vier Wochen vor seinem Tod vor<br />
einer Commission <strong>de</strong>s damaligen Landgerichts Weiler, zwar im Bette liegend, „aber bei voller<br />
Sinneskraft und Geistesgegenwart.“:<br />
“Meine große und schöne Bibliothek bestimme ich als Hausbibliothek <strong>de</strong>s Pfarrhofs Lin<strong>de</strong>nberg, mit <strong>de</strong>m<br />
Beifügen, daß <strong>de</strong>r jeweilige Pfarrer und Kaplan sie gemeinsam benützen können sollen;“... 6<br />
Am 18.Juli 1840, 17 Tage vor seinem Tod, hat Pfarrer Hauber in seinem wohl letzten<br />
handschriftlichen Dokument noch einen Zusatz zu seinem Testament gemacht. Er hat eine Art<br />
Bibliotheksordnung für die von ihm gestiftete Pfarrhofsbibliothek formuliert. Danach soll <strong>de</strong>r<br />
jeweilige Herr Pfarrer und Herr Kaplan zu Lin<strong>de</strong>nberg <strong>de</strong>r erste Nutznießer sein. Sie sollen<br />
sorgen, dass die Bücher im Pfarrhof Lin<strong>de</strong>nberg als ihrem Domizil ständig verbleiben und an<br />
Zahl und Unversehrtheit erhalten wer<strong>de</strong>n. Nur dann ist es ihnen erlaubt, ein o<strong>de</strong>r das an<strong>de</strong>re<br />
Werk auszutauschen, o<strong>de</strong>r zu veräußern, wenn sie statt <strong>de</strong>r min<strong>de</strong>r brauchbaren o<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r<br />
nützlichen, an<strong>de</strong>re Brauchbaren o<strong>de</strong>r Nützliche eintauschen o<strong>de</strong>r verkaufen können.<br />
Wünschen die an<strong>de</strong>ren Kapitelgeistlichen, „an diesem meinem Büchervermächtnis<br />
teilzunehmen, und selbe zu lesen,...so soll das Verlangte Je<strong>de</strong>m...mit <strong>de</strong>r Verbindlichkeit<br />
verabfolgt wer<strong>de</strong>n je<strong>de</strong>n Band... nach längstens einem o<strong>de</strong>r zwey Monaten gut conserviert ...<br />
zurückzustellen.“<br />
Sowohl Wettach wie auch Hauber vermachten ihre Bibliotheken <strong>de</strong>mnach nicht <strong>de</strong>m Kapitel<br />
Weiler, son<strong>de</strong>rn <strong>de</strong>r Pfarrei (Kirchenstiftung) Lin<strong>de</strong>nberg, unter <strong>de</strong>r Bedingung , dass sie im<br />
Pfarrhof zu verbleiben habe. Die Geistlichkeit <strong>de</strong>s Kapitels Weiler erhielt nur ein Ausleihe-,<br />
aber kein Eigentumsrecht. Testamente verjähren nicht, gelten also unbegrenzt.<br />
In seinem Testamentszusatz bestimmte Hauber auch, dass ein Verzeichnis <strong>de</strong>r Bücher<br />
angelegt wer<strong>de</strong>n muss, damit die Kapitelsangehörigen die Bücher kennen. Das dürfte <strong>de</strong>r<br />
Grund sein, warum das Verzeichnis <strong>de</strong>r <strong>Kapitelsbibliothek</strong> Weiler 1849 (vermutlich auf<br />
Kosten <strong>de</strong>s Nachlasses von Pfarrer Hauber) gedruckt wur<strong>de</strong>. 7 Meines Wissens ist es das erste<br />
und lange Zeit einzige gedruckte Bibliotheksverzeichnis <strong>de</strong>r damaligen 40 Landkapitel <strong>de</strong>s<br />
Bistums. Erst um 1889 wur<strong>de</strong>n die Verzeichnisse einiger weiterer <strong>Kapitelsbibliothek</strong>en<br />
gedruckt.<br />
4 Rascher, Jürgen, Pfarrer Joseph Anton Aurel Hauber, in: Jahrbuch 1996 <strong>de</strong>s Landkreises Lindau, S. 40<br />
5 Zeitgenössische Abschrift <strong>de</strong>s Testaments von Pfarrer Wettach, Ziffer 8. Staatsarchiv Augsburg, Bestand<br />
Bezirksamt Lindau, Akt 2339.<br />
6 Staatsarchiv Augsburg, Bestand Kreis- und Stadtgericht Kempten/Bezirksgericht Kempten, Nr. 388; Ziffer 9.<br />
7 Katalog <strong>de</strong>r Bibliothek <strong>de</strong>s Landkapitels Weiler, Kösel, Kempten, 1849. Der Katalog enthält auch die Statuten<br />
<strong>de</strong>r Bibliothek, oberhirtlich genehmigt vom Bischof von Augsburg am 20.10. 1847.
3<br />
Haubers Nachfolger als Pfarrer von Lin<strong>de</strong>nberg und als Dekan <strong>de</strong>s Kapitels Weiler wur<strong>de</strong><br />
nach seinem Tod Jakob Prinz. Er stammte aus <strong>de</strong>m benachbarten Grünenbach. Er war vorher<br />
einige Jahre Benefiziums-Kaplan in Lin<strong>de</strong>nberg gewesen. Während seiner Amtszeit wur<strong>de</strong> die<br />
Bibliothek <strong>de</strong>s Landkapitels Weiler organisiert. Es bestand wohl eine bischöfliche Anweisung<br />
o<strong>de</strong>r Anregung, eine solche Bibliothek einzurichten. Er richtete am 10.3.1843 ein Schreiben<br />
an die Geistlichen <strong>de</strong>s Kapitels. 8 Darin verwies er auf die Freigebigkeit seiner bei<strong>de</strong>n<br />
Vorgänger, durch die „eine nicht unbe<strong>de</strong>uten<strong>de</strong>“ <strong>Kapitelsbibliothek</strong> begrün<strong>de</strong>t wor<strong>de</strong>n sei.<br />
„Um auf die Vermehrung <strong>de</strong>rselben Bedacht zu nehmen“, wur<strong>de</strong>n alle Geistlichen <strong>de</strong>s<br />
Kapitels aufgefor<strong>de</strong>rt, schon zu Lebzeiten über ihren Büchernachlass im ganzen o<strong>de</strong>r<br />
teilweise zu Gunsten <strong>de</strong>r <strong>Kapitelsbibliothek</strong> zu disponieren. Er machte gleich Nägel mit<br />
Köpfen. Für je<strong>de</strong>n Geistlichen wur<strong>de</strong> eine Seite reserviert, auf <strong>de</strong>r er in rechtlich verbindlicher<br />
Form seine Verfügungen treffen konnte. Er selbst ging mit gutem Beispiel voran und<br />
bestimmte, dass seine sämtlichen Bücher nach seinem Ableben <strong>de</strong>r <strong>Kapitelsbibliothek</strong> „als<br />
volles Eigenthum angehören und einverleibt wer<strong>de</strong>n sollen“.<br />
Alle Pfarrer <strong>de</strong>s Kapitels folgten <strong>de</strong>m Beispiel ihres Dekans. Allerdings begrenzten einige ihre<br />
Schenkungsversprechen auf nur wenige einzelne Bücher. Auch versahen viele ihr<br />
Versprechen mit <strong>de</strong>r Bedingung, dass es nur dann gelten soll, falls sie als Kapitelsangehörige<br />
sterben sollten.<br />
Die Feststellung von Pfarrer Prinz, seine Vorgänger hätten <strong>de</strong>n Grundstock zur<br />
<strong>Kapitelsbibliothek</strong> gelegt, wi<strong>de</strong>rspricht klar <strong>de</strong>n bei<strong>de</strong>n Testamenten. Prinz musste diese<br />
gekannt haben. Er wird sich vor seinem Gewissen damit gerechtfertigt haben, dass er seine<br />
Aussage nicht juristisch, son<strong>de</strong>rn nur faktisch gemeint habe und dass er außer<strong>de</strong>m einen guten<br />
Zweck verfolge. Als er die Statuten <strong>de</strong>r neuen <strong>Kapitelsbibliothek</strong> Weiler formulierte, nahm er<br />
interessanterweise gleich als erste Vorschrift folgen<strong>de</strong> Klausel auf:<br />
„Die Bibliothek soll stets im Pfarrhause zu Lin<strong>de</strong>nberg aufbewahrt wer<strong>de</strong>n, wozu <strong>de</strong>r <strong>de</strong>rmalige Pfarrer seine<br />
Zustimmung gibt in <strong>de</strong>r sicheren Erwartung, es wer<strong>de</strong>n auch seine Nachfolger ein gleiches tun.“ 9<br />
Die Statuten wur<strong>de</strong>n am 20. Oktober 1847 vom bischöflichen Ordinariat oberhirtlich<br />
genehmigt. Bei <strong>de</strong>m Vertrauen, das man damals in <strong>de</strong>n Fortbestand bischöflicher<br />
Entscheidungen legte, nahm Prinz sicherlich an, dass damit <strong>de</strong>r Wille <strong>de</strong>r Stifter Wettach und<br />
Hauber für alle Zeiten gewahrt blieb.<br />
Nach diesen Statuten hatte je<strong>de</strong>r Pfarrer <strong>de</strong>s Kapitels einen Gul<strong>de</strong>n und je<strong>de</strong>r Benefiziat einen<br />
halben Gul<strong>de</strong>n (30 Kreuzer) an die <strong>Kapitelsbibliothek</strong> zu leisten, um „nach gemeinsamer<br />
Beratung ein Paar tüchtige Werke aus <strong>de</strong>r neueren Literatur anzuschaffen“.<br />
Mit so geringen Beträgen kam man nicht weit. Da außer<strong>de</strong>m die meisten <strong>de</strong>r 1843 gemachten<br />
Schenkungsversprechen <strong>de</strong>r Kapitelsgeistlichen noch nicht fällig wur<strong>de</strong>n (weil die Schenker<br />
noch lebten), dürften fast alle Bücher in <strong>de</strong>m 1849 gedruckten Verzeichnis aus <strong>de</strong>n<br />
Nachlässen <strong>de</strong>r Pfarrer Hauber und Wettach stammen.<br />
Von <strong>de</strong>n 2784 Büchern <strong>de</strong>s Katalogs von 1847 sind heute noch schätzungsweise 2 500<br />
vorhan<strong>de</strong>n. Die weiteren über 2000 Exemplare, die <strong>de</strong>r Bibliothek später hinzugefügt wur<strong>de</strong>n,<br />
sind weniger wertvoll. Ein großer Teil sind Zeitschriften aus <strong>de</strong>r 2.Hälfte <strong>de</strong>s 19. Jhts.<br />
8 Vorschlag die Vermehrung <strong>de</strong>r Kapitels-Bibliothek betreffend. Vom 10.6.1843. Pfarrarchiv Lin<strong>de</strong>nberg.<br />
9 §1 Buchstabe a <strong>de</strong>r Statuten, Fußnote 4
4<br />
Ein handschriftliches „Vollständiges Bücher-Verzeichnis <strong>de</strong>r <strong>Kapitelsbibliothek</strong> in<br />
Lin<strong>de</strong>nberg“ wur<strong>de</strong> 1887 und 1888 von Xaver Fischer aus Seeg angelegt. 10<br />
Eine be<strong>de</strong>uten<strong>de</strong> Schenkung von etwa 90 Büchern erhielt die <strong>Kapitelsbibliothek</strong> 1864 vom<br />
damaligen Dekan und Pfarrer von Opfenbach Johann Jakob Lau. 11<br />
Die Lin<strong>de</strong>nberger Bibliothek war ursprünglich im alten Pfarrhof bei <strong>de</strong>r Aureliuskirche<br />
untergebracht (heute Haus Bleif, Antoniusplatz 3). In einem Bericht von 1933, unterschrieben<br />
rg., berichtet <strong>de</strong>r Autor 12 , dass ihn <strong>de</strong>r damaligen Pfarrer Egger ca. 1908 auf die obere Diele<br />
<strong>de</strong>s damaligen Pfarrhofes führte. Auf <strong>de</strong>r einen Wand seien Dutzen<strong>de</strong> von Zigarrenkisten<br />
pyrami<strong>de</strong>nförmig aufgestapelt gewesen (Pfarrer Egger war als strenger Zigarrenraucher<br />
bekannt). Auf <strong>de</strong>r Gegenseite führte eine Türe in <strong>de</strong>n Raum <strong>de</strong>r <strong>Kapitelsbibliothek</strong>. Nach <strong>de</strong>m<br />
Umzug in <strong>de</strong>n Neuen Pfarrhof bei <strong>de</strong>r Stadtpfarrkirche 1914 wur<strong>de</strong> die Bibliothek dorthin<br />
gebracht. Sie hatte einen eigenen Raum.<br />
Als ca. 1976 die oberen Räume <strong>de</strong>s Pfarrhofes beim Dienstantritt von Pfarrer Raba gründlich<br />
renoviert wur<strong>de</strong>n, brachte man die Bibliothek in einem leicht beheizten Kellerraum unter, <strong>de</strong>r<br />
gleichzeitig als Pfarrarchiv und als Raum zum Drucken diente. An einigen Stellen sind<br />
wenige Bücher feucht gewor<strong>de</strong>n und auf ein Paar Le<strong>de</strong>reinbän<strong>de</strong>n hat sich leichter Schimmel<br />
gebil<strong>de</strong>t. Die Unterbringung war <strong>de</strong>mnach ab 1976 nicht mehr ganz i<strong>de</strong>al, weil die damaligen<br />
Pfarrer alle oberen Räume für sich nutzen wollten. Trotz<strong>de</strong>m ist kein Buch wesentlich in<br />
Mitlei<strong>de</strong>nschaft gezogen wor<strong>de</strong>n. Die Pfarrgemein<strong>de</strong> Lin<strong>de</strong>nberg kann es sich durchaus als<br />
ein kulturelles Verdienst anrechnen, dass sie die Bibliothek genau 180 Jahre lang mit einigen<br />
Mühen und Kosten erhalten hat.<br />
Die Bibliothek befin<strong>de</strong>t sich seit Dezember 2001 bis auf einen kleinen Rest von etwa 50<br />
Bän<strong>de</strong>n im Priesterseminar in Augsburg. 13 Das Bistum hat eine eigene Stelle<br />
„<strong>Kapitelsbibliothek</strong>en“ eingerichtet. Sie untersteht <strong>de</strong>m Leiter <strong>de</strong>s Archivs <strong>de</strong>s Bistums, Dr.<br />
Erwin Naimer. Für die Stelle wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Dipl. Theol. Christian Pluta eingestellt.<br />
Beschreibung <strong>de</strong>r Bibliothek<br />
Der Autor <strong>de</strong>s Artikels von 1933 beschreibt die Bibliothek wie folgt:<br />
„Diese birgt keineswegs eine ausgesprochene Fachbibliothek, wie man vermuten könnte, son<strong>de</strong>rn außer <strong>de</strong>n<br />
theologischen Disziplinen, welche damals etwa die Hälfte <strong>de</strong>r Bän<strong>de</strong>zahl ausmachten, sind auch fast alle an<strong>de</strong>ren<br />
Wissenszweige vertreten. Die umfangreichste Gruppe war XI. Kirchen- und Weltgeschichte mit 510 Bän<strong>de</strong>n.<br />
Darunter fin<strong>de</strong>n sich Werke wie <strong>de</strong>s berühmten Athanasius Kircher „Turris Babel sive Archontologia“,<br />
Amsterdam 1671; <strong>de</strong>s Martin Crusius „Schwäbische Chronik“, Frankfurt 1733; Stolbergs „Geschichte <strong>de</strong>r<br />
Religion Jesu Christi“ in 17 Bän<strong>de</strong>n; Merkles „Geschichte von Vorarlberg“, 1843, letzteres Werk kommt nur<br />
mehr selten auf <strong>de</strong>n Büchermarkt.<br />
Die nächst umfangreiche Gruppe bil<strong>de</strong>t die Gruppe VIII Predigten und homiletische Bücher, mit 493 Bän<strong>de</strong>n.<br />
Darin sind Werke von >Meistern auf diesem Gebiet vertreten, z.B. von J.M. Sailer (gest. 1832) und von<br />
Bardaloue (gest. 1704), welchen man <strong>de</strong>n König <strong>de</strong>r Kanzelredner und <strong>de</strong>n Kanzelredner <strong>de</strong>r Könige genannt<br />
hat. Die Ausgabe hat 14 Bän<strong>de</strong>, Kempten 1785. An merkwürdigen Titel, wie sie das 17. und um Teil auch das<br />
18. Jahrhun<strong>de</strong>rt liebte, fehlt es auch hier nicht. Als Beispiel sei aufgeführt: Nattenhausen, Homo simplex et<br />
rectus“ das ist <strong>de</strong>r alte redliche <strong>de</strong>utsche Michl o<strong>de</strong>r Sonn- und Festtagspredigten, Augsburg 1708, in drei Teilen.<br />
10 Pfarrarchiv Lin<strong>de</strong>nberg<br />
11 Liste aufgenommen im November 1864 von Pfarrer Meirhofer. Pfarrarchiv Lin<strong>de</strong>nberg.<br />
12 Von <strong>de</strong>r <strong>Kapitelsbibliothek</strong> in Lin<strong>de</strong>nberg, Heimatkun<strong>de</strong>, Beilage zum Lin<strong>de</strong>nberger Tagblatt vom 25.3.1933.<br />
Als Autor wird nur rg. angegeben.<br />
13 Grundlage ist ein Beschluss <strong>de</strong>s Bischöflichen Ordinariats vom 6. Oktober 1998, Amtsblatt <strong>de</strong>s Bistums vom<br />
4.11.1999, S. 394.
5<br />
Die Gruppe VII enthält u.a. Martin Luthers sämtliche Werke in <strong>de</strong>r Wittenberger Quartausgabe von 1569<br />
(scheint nicht vollständig zu sein); Abraham a Santa Clara sämtliche Werke in 12 Teilen, Gregor <strong>de</strong>s Großen<br />
Schriften übersetzt von <strong>de</strong>m Ottobeurer Geschichtsschreiber M. Feyerabend; die Christliche Mystic von Josef<br />
Görres.<br />
Sogar eine Inkunabel, also einen Frühdruck, fin<strong>de</strong>n wir in <strong>de</strong>m Werk <strong>de</strong>s „Leonardus <strong>de</strong> Utino, Sermones<br />
quadragesimales“ gedruckt zu Ulm 1478.<br />
Die Gruppe XIII: Geographie enthält u.a. die heute noch geschätzten Werke: Geographisch –statist.-topogr.<br />
Lexikon von Schwaben, 2 Bän<strong>de</strong>, Ulm 1800; <strong>de</strong>n Hamanschen Atlas in 17 Bän<strong>de</strong>n, Nürnberg 1762; Meisners<br />
Politico-Politica in Kupfer, 4 Bän<strong>de</strong>, Nürnberg 1700.<br />
Eines <strong>de</strong>r Werke, die im oben angeführten Artikel als selten erwähnt wer<strong>de</strong>n, ist Merkles<br />
„Geschichte von Vorarlberg“. Dieses Werk gehörte mit großer Wahrscheinlichkeit Hauber.<br />
Merkle war hier nur <strong>de</strong>r Bearbeiter. Der eigentliche Verfasser war Franz Joseph Weizenegger<br />
Ein Brief Weizeneggers im Pfarrarchiv Lin<strong>de</strong>nberg zur Frühgeschichte <strong>de</strong>s Ortes zeigt, dass<br />
Weizenegger und Hauber als Priesterkollegen <strong>de</strong>s ehemaligen Bistums Konstanz gut<br />
miteinan<strong>de</strong>r bekannt waren.