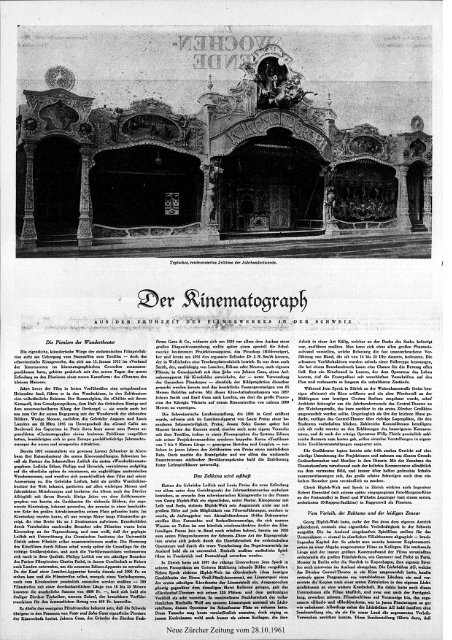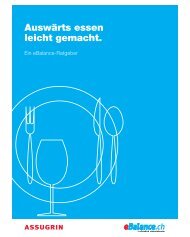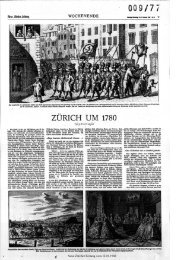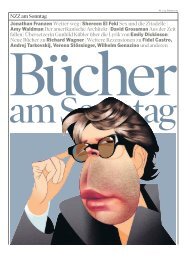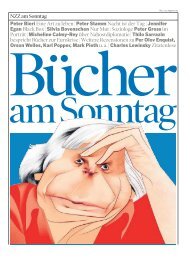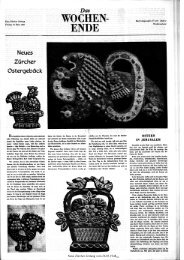WÜÄZBI'I D^S F. - Neue Zürcher Zeitung
WÜÄZBI'I D^S F. - Neue Zürcher Zeitung
WÜÄZBI'I D^S F. - Neue Zürcher Zeitung
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Typisches, reichverziertes Zeltkino der Jahrhundertwende.<br />
AUS >;DER <strong>WÜÄZBI'I</strong> <strong>D^S</strong> F. .MG E W E R B E IN »D E SCHWEIZ<br />
Die Pioniere der Wandertheater<br />
Die eigentliche, künstlerische Wiege der einheimischen Filmproduktion<br />
steht am Uebergang vom Stummfilm zum Tonfilm doch das<br />
schweizerische Kinogewerbe, das sich am 15. Januar 1915 im ; zusammengeschlossen<br />
hatte, gehörte praktisch seit den ersten<br />
Tagen der neuen<br />
Erfindung zu den Pionieren einer neuen Kunstform : des cTheaters des<br />
kleinen Mannes».<br />
Jahre bevor der Film in festen Vorführsälen eine ortsgebundene<br />
Heimstätte fand, führte er in den Wanderkinos, in den Zelttheatern<br />
eine volkstümliche Existenz. Der Rummelplatz, die «Chilbi» mit ihrem<br />
Karussell, dem Gruselpanoptikum, dem Duft des türkischen Honigs und<br />
dem unverwechselbaren Klang der Drehorgel sie wurde auch bei<br />
uns zum Ort der ersten Begegnung mit der Wunderwelt der «lebenden<br />
Bilder». Wenige Monate, nachdem die Gebrüder Auguste und Louis<br />
Lumiere am 22. März 1895 im Untergeschoß des «Grand Cafe» am<br />
Boulevard des Capucines in Paris ihren kurz zuvor zum Patent angemeldeten<br />
«Cinematographe» einem breiteren Publikum vorgeführt<br />
hatten, bemächtigten sich in ganz Europa geschäftstüchtige Jahrmarktsmanager<br />
der neuen und erregenden Attraktion.<br />
Bereits 1895 veranstaltete ein gewisser Lorenz Schweizer in Alsenhörn<br />
(bei Kaiserslautern) die ersten Kinovorstellungen. Schweizer besß<br />
a als Partner des Schaustellers Leilich die ersten «Wanderkinematographen».<br />
Leilichs Söhne, Philipp und Heinrieh, verzichteten endgültig<br />
auf die väterliche «piece de resistance», ein zugkräftiges anatomisches<br />
Wandermuseum, und wandten sich ausschließlich dem Film und seiner<br />
Auswertung zu. Die Gebrüder Leilich, bald als größte Wanderkinobesitzer<br />
der Welt bekannt, gastierten auf allen wichtigen Messen und<br />
Jahrmärkten Mitteleuropas und beehrten des öftern auch das <strong>Zürcher</strong><br />
Albisgütli mit ihrem Besuch. Einige Jahre vor dem Zcltkinematographen<br />
war bereits ein Guckkasten für «lebende Bilder», der sogenannte<br />
Kinetoskop, bekannt geworden, der zumeist in einer bescheidenen<br />
Ecke des großen Attraktionszeltes seinen Platz gefunden hatte. Im<br />
Kinetoskop wurden kurze, oft nur wenige Meter lange Filmstreifen gezeigt,<br />
die eine Breite bis zu 5 Zentimetern aufwiesen. Brandschäden<br />
durch Verschulden rauchender Besucher oder Filmrisse waren beim<br />
Kinetoskop an der Tagesordnung, und man weiß, daß der geplagte<br />
Leilich mit Unterstützung des Chemischen Institutes der Universität<br />
Zürich seinen Filmkitt selbst zusammenbrauen mußte. Die Normung<br />
des Kinofilmes durch Edison schuf wenig später die Grundlage für die<br />
richtige Großprojektion, und auch die Vorfühnnaschinen verbesserten<br />
sich rasch in ihrer Qualität. Philipp Leilich war ein ständiger Besucher<br />
des Pariser Filmpioniers Charles I'atliü, in dessen Gesellschaft er Reisen<br />
nach London unternahm, um die neuesten Edison-Apparate zu erwerben.<br />
Da der Kauf einer Lumiere-Apparatur bereits damals auf 2000 Fr. zu<br />
stehen kam und die Filmstreifen selbst, mangels eines Verleihsystems,<br />
noch vom Kinobesitzer persönlich erstanden werden mußten >;- 100<br />
Filmstreifen mit einer durchschnittlichen Länge von 18 bis 25 Metern<br />
kosteten die ansehnliche Summe von 4000 Fr. , fand sich bald ein<br />
findiger <strong>Zürcher</strong> Techniker, namens Zulauf, der brauchbare Vorführmaschinen<br />
für den erstaunlichen Betrag von 450 Fr. herstellte.<br />
firma<br />
Es dürfte den wenigsten Filmfreunden bekannt sein,' daß die übrigens Schweiz<br />
in den Personen von Vater und Sohn Ganz eigentliche Pioniere<br />
der Kinotechnik besitzt. Johann Ganz, der Gründer der <strong>Zürcher</strong> Fach»<br />
Ganz & Co., widmete sich um 1880 vor allem dem Ausbau einer<br />
großen Diapositivsammlung, stellte später einen speziell für Schulzwecke<br />
bestimmten Projektionsapparat, das Pinaskop (Bilderzeiger),<br />
her und lernte um 1895 den regsamen Erfinder Dr. J. H. Smith kennen,<br />
der in Wollishofen eine Trockenplattenfabrik betrieb. Es war denn auch<br />
Smith, der, unabhängig von Lumiere, Edison oder Messter, nach eigenen<br />
Plänen, in Gemeinschaft mit dem gohn von Johann Ganz, einen Aufnahmeapparat<br />
für Kinobilder entwickelte, der unter Verwendung<br />
des Ganzschen Pinaskopes ebenfalls der Bildprojektion dienstbar<br />
gemacht werden konnte und das beachtliche Fassungsvermögen von 65<br />
Metern Rohfilm aufwies. Mit dieser Kino-Aufnahmekamera von 1897<br />
fuhren Smith und Emil Ganz nach London, um dort die große Prozession<br />
der Königin Viktoria auf einem Riesenstreifen von nahezu 1000<br />
Metern zu verewigen.<br />
Die Schweizerische Landesausteilung, die 1896 in Genf eröffnet<br />
wurde, erfreute sich im Lumiere-Apparat von Louis Preis» einer besonderen<br />
Sehenswürdigkeit. Preiss, dessen Sohn Gustav später bei<br />
Messter hinter der Kamera stand, machte auch erste eigene Versuche<br />
mit dem Tonfilm, indem er einen<br />
Phonographen des Systems Edison<br />
mit seiner Projektionsmaschine synchron koppelte. Kurze «Tonfilme»<br />
von 7 bis 9 Metern Länge gesungene Sketches und Couplets verliehen<br />
in jenen Jahren den Zelttheatern von Preiss einen zusätzlichen<br />
Reiz. Doch machte die Brandgefahr und vor allem das wachsende<br />
Dauerinteresse städtischer<br />
Bevölkerungskreise bald die Etablierung<br />
fester Lichtspielhäuser notwendig.<br />
Das Zeltkino wird seßhaft<br />
Hatten die Gebrüder Leilich und Louis Preiss die neue Erfindung<br />
vor allem unter dem Gesichtspunkt der Jahrmarktssensation ambulant<br />
betrieben, so erwuchs dem schweizerischen<br />
Kinogewerbe in der Person<br />
von Georg Hipleh-Walt ein eigentlicher, erster Nestor. Kinopionier mit<br />
Leib und Seele, richtete Hipleh-Walt sein Augenmerk nicht nur mit<br />
großem Eifer auf jede Möglichkeit von Filmvorführungen, sondern er<br />
wurde, als Auftraggeber von Aktualitätsschauen (frühe Dokumentärstreifen<br />
über Fastnachts- und Sechseläutenumzüge, die sich unseres<br />
Wissens zu Teilen im erst kürzlich wiederentdeckten Archiv des filmfreudigen<br />
Paten Joie in- Basel noch erhalten haben), bereits um 1900<br />
zum ersten Filmproduzenten der Schweiz. Diese Art der Eigenproduktion<br />
erwies sich jedoch durch die Unerfahrenheit der einheimischen<br />
Operateure und durch die teure Verarbeitung des Negativmaterials im<br />
Ausland bald als zu unrentabel. Deshalb mußten zusätzliche Spielfilme<br />
in Frankreich und Deutschland erworben werden.<br />
In Zürich hatte seit 1897 der rührige Unternehmer Jean Speck in<br />
seinem Panoptikum am Unteren Mühlesteg lebende Bilder vorgeführt.<br />
Neben Speck richtete Hipleh-Walt im «<strong>Zürcher</strong>hof»<br />
(dem heutigen<br />
Geschäftsslti der Firma Orell Füssli-Annoncen), am Limmatquai eines<br />
der ersten ständigen Kinotheater der Limmatstadt ein.<br />
Ausgesprochen<br />
günstig gegenüber dem damaligen Hotel Bellevue gelegen, galt das<br />
«ZOrcherhof-Theater» mit seinen 120 Plätzen und dem geräumigen<br />
Vestibül als sehr vornehm. In unmittelbarer Nachbarschaft der volkstümlichen<br />
Bierhalle Wolf am unteren Limmatquai entstand ein Lichtspielhaus,<br />
dessen Operateur im Schaufenster Platz in nehmen hatte.<br />
Diese Tatsache mag heute vorsintflutlich anmuten, doch erging es<br />
jenem Kurbelmann wohl noch besser ab seinen<br />
Kollegen, die ihre<br />
<strong>Neue</strong> <strong>Zürcher</strong> <strong>Zeitung</strong> vom 28.10.1961<br />
Arbeit in einer Art Käfig, welcher an der Decke des Saales befestigt<br />
war, ausführen mußten. Man kann sich ohne allzu großen Phantasieaufwand<br />
vorstellen, welche Belastung die fast ununterbrochene Vorführung<br />
von Hand, die oft von 14 bis 23 Uhr dauerte, bedeutete. Die<br />
seltsamen Vorführkabinen wurden mittels einer Falltreppe bezwungen,<br />
die bei einem Brandausbruch kaum eine Chance für die Rettung offen<br />
ließ. Erst ein Kinobrand in Luzern, der dem Operateur das Leben<br />
kostete, rief die Feuerpolizei mit verschärften Vorschriften auf den<br />
Plan und verbesserte so langsam die unhaltbaren Zustände.<br />
Während Jean Speck in Zürich an der Waisenhausstraße (beim heutigen<br />
«Orient») ein Kino eröffnete und ein alter Pferdestall an der<br />
Mühlegasse zum heutigen Cinema Radium umgebaut wurde, schuf<br />
Architekt Schwegler um die Jahrhundertwende das Central-Theater an<br />
der Weinbergstraße, das kurz nachher in ein erstes <strong>Zürcher</strong> Großkino<br />
umgewandelt werden sollte. Ursprünglich als Ort der leichten Muse gedacht,<br />
verfügte dos Central-Theater über richtig e Logenplätze, die den<br />
Studenten vorbehalten blieben. Zahlreiche Kommilitonen beteiligten<br />
sich oft recht munter an den Erklärungen des hauseigenen Kommentators,<br />
und da auch der witzige Operateur Willy Thiele persönlich zahlreiche<br />
Bonmots zum besten gab, sollen einzelne Vorstellungen in eigentliche<br />
Tonfilmveranstaltungen ausgeurtet sein.<br />
Die Großtheater legten bereits sehr früh starkes Gewicht auf eine<br />
würdige Umrahmung der Projektionen und nahmen aus diesem Grunde<br />
Geräuschemacher nnd Musiker in ihre Dienste. Mit der Zunahme des<br />
Theaterkomforts verschwan<br />
d<br />
auch der beliebte Kommentator allmählich<br />
aus dem vertrauten Bild, und immer öfter halfen gedruckte Inhaltszusammenfassungen<br />
mit, das große schöne Schweigen auch dem einfachen<br />
Besucher ganz verständlich zu machen.<br />
Gleich Hipleh-Walt und Speck in Zürich wirkten auch Ingenieur<br />
Robert Rosenthal (mit seinem später eingegangenen Fata-Morgana-Kino<br />
an der Freiestraße) in Basel und Wilhelm Leuzinger (mit einem ersten,<br />
ambulanten 30-Rappen-Saalkino) in Rapperswil als Pioniere.<br />
Vom Verleih, der Reklame und der leidigen Zensur<br />
Georg Hipleh-Walt hatte, mehr der Not denn dem eigenen Antrieb<br />
gehorchend, erstmals eine eigentliche Verleihtätigkeit in der Schweiz<br />
ausgeübt Die im Ausland eingekauften Spielfilme stellten für das<br />
Unternehmen einmal in sämtlichen Filialtheatern abgespielt brachliegendes<br />
Kapital dar. So schritt man zwecks besserer Kopienamortisation<br />
zu einer Abgabe ausgewerteter Filme an Kollegen. Die wachsende<br />
Länge und der immer größere Kostenaufwand der Filme veranlaßten<br />
andererseits die großen Filmfabriken, wie Gaumont und Pnthc in Paris,<br />
Messter in Berlin oder die Nordisk in Kopenhagen, ihre eigenen Streifen<br />
auch mietweise ins Ausland abzugeben. Die Lichtbühne AG, welche<br />
das <strong>Zürcher</strong> Central-Theater in ein Kino umgewandelt hatte, kaufte<br />
erstmals ganze Programme aus verschiedenen Lindern ein nnd vermietete<br />
die Kopien nach einer ersten Zirkulation in den eigenen Lichtspielhäusern<br />
an eine weitere Kundschaft Bis dahin hatte auch dieses<br />
Unternehmen alle Filme käuflich, nnd zwar erst nach der Fertigstellung,<br />
erwerben müssen. Filmabschlüsse auf Voranzeige hin, du sogenannte<br />
«Blind-» nnd «Blockbuchen», war in jenen Pioniertagen so gut<br />
wie unbekannt. Allerdings nahm die Lichtbfihne AG bald Insofern eine<br />
Sonderstellung ein, als sie für unser Land die sogenannten Verleih-<br />
Vorwochen erwirken konnte. Diese Sonderstellung führte dazu, daß
Wanderkinematograph von W. Leuzinger (Rappcrswü<br />
) um 1915.<br />
unsere Kinotheater die deutschen Filme zwei Wochen vor ihrer Uraufführung<br />
im Herstellungslande selbst spielen konnten. In ähnlicher<br />
Weise wurde die vorzeitige Terminierung der beliebten Monumentalfilme<br />
der Firma Cines, Roma, und der Asta Nielsen-Filme von Urban<br />
Gad möglich.<br />
Als der Erste Weltkrieg ausbrach und die Filialen der großen ausländischen<br />
Produktionsfirmen unser Land mit vielen .minderwertigen<br />
oder tendenziösen Propagandastreifen überfluteten, setzten einmal molir<br />
Bestrebungen zur systematischen Eigenproduktion von Schweizer Filmen<br />
ein. Die Liegenschaft zum Schweizerhof an der Zollikerstraße verwandelte<br />
sich unter der Leitung des Filmkaufmanns Lang (des<br />
Josef<br />
späteren<br />
Sekretärs des Schweizerischen Lichtspieltheater-Verbandes) in ein<br />
behelfsmäßiges Atelier. Das Wagnis endete mit einer großen kommerziellen<br />
Katastrophe. Ueber die Unternehmen jener ausländischen Produzenten,<br />
die bis zur Gründung der Praesens-Film im Jahre 1924 einen<br />
importierten Schweizer Filmstil zu kreieren versuchten, möge sich heute<br />
ein milder Mantel des allgemeinen Vergessens ausbreiten.<br />
Wer die <strong>Zürcher</strong> Tageszeitungen der Jahre 1900 bis 1920 durchstöbert,<br />
wird selten genug auf Zeugnisse einer gesunden Kinoreklame<br />
stoßen. Es schien, als sollte mit Absicht der intellektuelle Zuschauer<br />
nach Möglichkeit vom dunklen Kinoraum ferngehalten werden. Die<br />
marktschreierischen Anpreisungen der Kinobranche richteten sich in<br />
den heroischen Zeiten des Kintopp ausgesprochen an ein geistig anspruchsloses<br />
Massenpublikum. Als bereits das Insertionswesen auch im<br />
Filmgewerbe Eingang gefunden hatte, verzichtete man noch nicht auf<br />
den Ausrufer vor dem Eingang und den Programmverteiler auf der<br />
Straße. Noch vor wenigen Jahren beschäftigte in Zürich das inzwischen<br />
verschwundene Olympia-Cinema an der Pelikanstraße diesen letzten<br />
unter den beliebten Reklamemännern, die eifrig bunte Handzettel den<br />
Passanten in die Hand drückten. Die Filmtitel wurden, bei ausländischen<br />
Werken, meist willkürlich verdeutscht, und einer englischen<br />
oder nordischen Diva als «Kellnerin vom Niederdorf» zu begegnen war<br />
nicht ausgeschlossen. Die Reklame überschlug sich in jenen heroischen<br />
Jahren und führte oftmals zu einer eigentlichen Schmutzkonkurrenz,<br />
da einzelne Theaterbesitzer auf eine Eintrittskarte gleich zwei Eintritte<br />
gewähren wollten. Man versuchte auch, Bürger die eher konservativen <strong>Zürcher</strong><br />
mit den Methoden des amerikanischen Zirkuskönigs Barnum<br />
für das Lichtspiel zu begeistern und führte riesige Plakatwagen, ja<br />
selbst das Modell eines Flugzeuges durch die Straßen der Stadt.<br />
Der Staat interessierte sich vorerst eher sekundär für die neue Jahrmarktssensation.<br />
Als die Schausteller «lebende Bilder» einer weiteren<br />
Oeffentlichkeit zugänglich machten, stützte man sich beim Eingreifen<br />
der Rechtsordnung jeweils auf die gültige polizeiliche Generalklausel.<br />
Eine dem Film angemessene Spezialregelung bestand allerdings in<br />
Zürich seit dem Erlaß vom 15. April 1909. Die behördliche Begutachtung<br />
von Filmen, die ja im Prinzip bei uns in die Kompetenz der<br />
Kantone fällt, erfreute sich schon früher keiner großen Beliebtheit.<br />
Wenngleich die intellektuellen Kreise in der Schweiz dem neuen<br />
Massenmedium lange Zeit eher verständnislos gegenüberstanden, setzten<br />
sich doch zahlreiche führende Köpfe unseres Landes, wie der Dichter<br />
Carl Spitteler (mit einem ausführlichen Beitrag im «Luzerner Tagblatt»<br />
im Jahre 1916) und Bundesrat Dr. HSberlin (in seiner Rede vor dem<br />
Nationalrat am 9. Dezember 1921), für eine liberale Handhabung der<br />
Zensur und die Filmmündigkeit des erwachsenen Menschen ein. Indem<br />
gerade solche geistige Führer immer wieder ein Bekenntnis zu den<br />
positiven Eigenschaften des verachteten Kinematographen ablegten,<br />
wurde das Kino über seine ursprüngliche Funktion eines «Theaters des<br />
kleinen Mannes» hinaus in die neue Sphäre der salonfähigen und gehobenen<br />
Unterhaltung ja der Kulturmanifestation emporgehoben.<br />
So vertritt ein verantwortungsbewußtes Kinogewerbe heute das Kunstmedium<br />
unseres Jahrhunderts<br />
, das seinen Platz unter den 'Musen zu<br />
Recht einnimmt.<br />
aHanspeter Manz<br />
Specks ^Panoptikum» auf der Gloous-Inscl am unteren Mühlestcg.<br />
(Wir rerwelun »uf dl* Quellen «H. Korger, Du lebende Bild. Bülaeh,<br />
1040», und «Filmklub/Clniclub Nummer 13: Sondernummer zum Schweber<br />
Film».).<br />
Das <strong>Zürcher</strong> «Central-Theater» an der Weinlergstraßo um 1900.<br />
<strong>Neue</strong> <strong>Zürcher</strong> <strong>Zeitung</strong> vom 28.10.1961