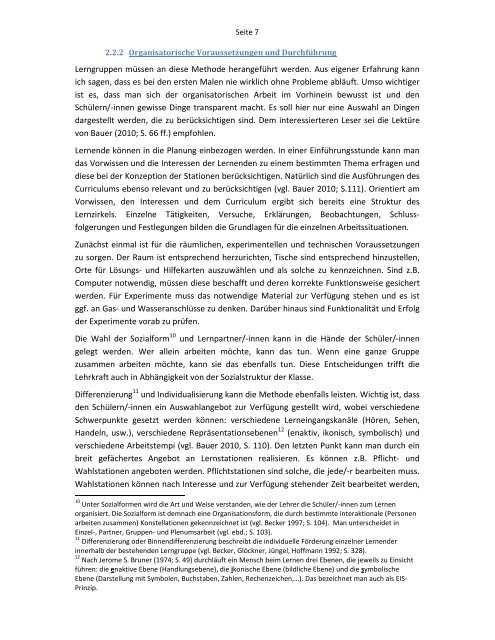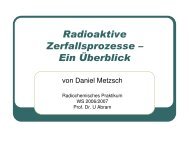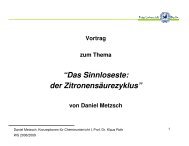Salzbildungsarten - Metzsch, Daniel
Salzbildungsarten - Metzsch, Daniel
Salzbildungsarten - Metzsch, Daniel
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Seite 7<br />
2.2.2 Organisatorische Voraussetzungen und Durchführung<br />
Lerngruppen müssen an diese Methode herangeführt werden. Aus eigener Erfahrung kann<br />
ich sagen, dass es bei den ersten Malen nie wirklich ohne Probleme abläuft. Umso wichtiger<br />
ist es, dass man sich der organisatorischen Arbeit im Vorhinein bewusst ist und den<br />
Schülern/-innen gewisse Dinge transparent macht. Es soll hier nur eine Auswahl an Dingen<br />
dargestellt werden, die zu berücksichtigen sind. Dem interessierteren Leser sei die Lektüre<br />
von Bauer (2010; S. 66 ff.) empfohlen.<br />
Lernende können in die Planung einbezogen werden. In einer Einführungsstunde kann man<br />
das Vorwissen und die Interessen der Lernenden zu einem bestimmten Thema erfragen und<br />
diese bei der Konzeption der Stationen berücksichtigen. Natürlich sind die Ausführungen des<br />
Curriculums ebenso relevant und zu berücksichtigen (vgl. Bauer 2010; S.111). Orientiert am<br />
Vorwissen, den Interessen und dem Curriculum ergibt sich bereits eine Struktur des<br />
Lernzirkels. Einzelne Tätigkeiten, Versuche, Erklärungen, Beobachtungen, Schlussfolgerungen<br />
und Festlegungen bilden die Grundlagen für die einzelnen Arbeitssituationen.<br />
Zunächst einmal ist für die räumlichen, experimentellen und technischen Voraussetzungen<br />
zu sorgen. Der Raum ist entsprechend herzurichten, Tische sind entsprechend hinzustellen,<br />
Orte für Lösungs- und Hilfekarten auszuwählen und als solche zu kennzeichnen. Sind z.B.<br />
Computer notwendig, müssen diese beschafft und deren korrekte Funktionsweise gesichert<br />
werden. Für Experimente muss das notwendige Material zur Verfügung stehen und es ist<br />
ggf. an Gas- und Wasseranschlüsse zu denken. Darüber hinaus sind Funktionalität und Erfolg<br />
der Experimente vorab zu prüfen.<br />
Die Wahl der Sozialform 10 und Lernpartner/-innen kann in die Hände der Schüler/-innen<br />
gelegt werden. Wer allein arbeiten möchte, kann das tun. Wenn eine ganze Gruppe<br />
zusammen arbeiten möchte, kann sie das ebenfalls tun. Diese Entscheidungen trifft die<br />
Lehrkraft auch in Abhängigkeit von der Sozialstruktur der Klasse.<br />
Differenzierung 11 und Individualisierung kann die Methode ebenfalls leisten. Wichtig ist, dass<br />
den Schülern/-innen ein Auswahlangebot zur Verfügung gestellt wird, wobei verschiedene<br />
Schwerpunkte gesetzt werden können: verschiedene Lerneingangskanäle (Hören, Sehen,<br />
Handeln, usw.), verschiedene Repräsentationsebenen 12 (enaktiv, ikonisch, symbolisch) und<br />
verschiedene Arbeitstempi (vgl. Bauer 2010, S. 110). Den letzten Punkt kann man durch ein<br />
breit gefächertes Angebot an Lernstationen realisieren. Es können z.B. Pflicht- und<br />
Wahlstationen angeboten werden. Pflichtstationen sind solche, die jede/-r bearbeiten muss.<br />
Wahlstationen können nach Interesse und zur Verfügung stehender Zeit bearbeitet werden,<br />
10 Unter Sozialformen wird die Art und Weise verstanden, wie der Lehrer die Schüler/-innen zum Lernen<br />
organisiert. Die Sozialform ist demnach eine Organisationsform, die durch bestimmte interaktionale (Personen<br />
arbeiten zusammen) Konstellationen gekennzeichnet ist (vgl. Becker 1997; S. 104). Man unterscheidet in<br />
Einzel-, Partner, Gruppen- und Plenumsarbeit (vgl. ebd.; S. 103).<br />
11 Differenzierung oder Binnendifferenzierung beschreibt die individuelle Förderung einzelner Lernender<br />
innerhalb der bestehenden Lerngruppe (vgl. Becker, Glöckner, Jüngel, Hoffmann 1992; S. 328).<br />
12 Nach Jerome S. Bruner (1974; S. 49) durchläuft ein Mensch beim Lernen drei Ebenen, die jeweils zu Einsicht<br />
führen: die enaktive Ebene (Handlungsebene), die ikonische Ebene (bildliche Ebene) und die symbolische<br />
Ebene (Darstellung mit Symbolen, Buchstaben, Zahlen, Rechenzeichen,…). Das bezeichnet man auch als EIS-<br />
Prinzip.