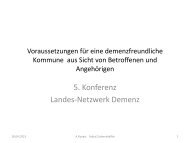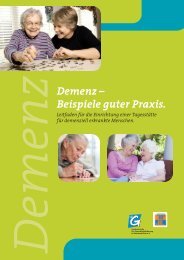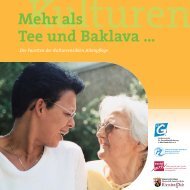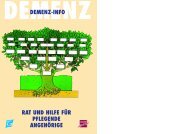Neuropsychologische Differenzialdiagnose der Demenzen
Neuropsychologische Differenzialdiagnose der Demenzen
Neuropsychologische Differenzialdiagnose der Demenzen
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Neuropsychologische</strong> <strong>Differenzialdiagnose</strong> <strong>der</strong> <strong>Demenzen</strong><br />
Prof.Dr.Claus-W.Wallesch<br />
BDH-Klinik Elzach<br />
Die Verdachtsdiagnose einer Demenz wird meist vom Hausarzt gestellt. In <strong>der</strong> Praxis genügen<br />
Anamnese, klinische Untersuchung und ein Screeningtest, um die Diagnose zu erhärten. Die weitere<br />
Abklärung und Betreuung erfolgt gemeinsam mit Neurologen bzw. Psychiatern, Spezialambulanzen,<br />
Kliniken und Beratungs- bzw. Hilfseinrichtungen. Die Frühdiagnose zielt vor allem darauf,<br />
behandelbare Erkrankungen auszuschließen. Eine genaue Diagnose ist die Grundlage für eine<br />
adäquate Therapie, Betreuung und Beratung.<br />
Der Begriff Demenz bezeichnet keine Krankheit. Er umfasst vielmehr Symptome, die zu einem<br />
definierten Maß an Behin<strong>der</strong>ung geführt haben. Definitionsgemäß handelt es sich um eine chronische<br />
und behin<strong>der</strong>nde Störung des Gedächtnisses und mindestens einer weiteren höheren Hirnleistung.<br />
Die Demenz kann von vielen Krankheiten verursacht werden.<br />
Epidemiologie<br />
In Deutschland haben <strong>der</strong>zeit etwa 1 Million Menschen eine Demenz. Es ist daher ein gravierendes<br />
sozialpolitisches und gesundheitsökonomisches Problem. Die Prävalenz steigt mit dem Alter. Bei den<br />
65-69-jährigen sind etwa 1,5% betroffen, bei über 90-jährigen 30%, bei über 100-Jährigen 60%. Die<br />
häufigsten <strong>Demenzen</strong> sind<br />
- die Alzheimer-Demenz (60%),<br />
- die vaskuläre Demenz (10-15%),<br />
- die Lewy-Körper-Demenz und Demenz bei M.Parkinson (10%) und<br />
- die frontotemporale Lobardegeneration (10%).<br />
Das Risiko für Frauen, an einer Alzheimer-Demenz zu erkranken ist etwa doppelt so hoch wie für<br />
gleichaltrige Männer. Dagegen ist das gesamte Lebenszeitrisiko für Männer, an einer vaskulären<br />
Demenz zu erkranken doppelt so hoch wie für Frauen.<br />
Klassifikation<br />
Grundlage <strong>der</strong> Demenz-Definition im ICD-10 und im DSM-IV ist die Alzheimer-Demenz (Tab. 1). Bei<br />
Morbus Alzheimer dominieren die Gedächtnisstörungen. Diese stehen aber nicht bei allen<br />
Demenzformen im Vor<strong>der</strong>grund. Daher wurden inzwischen weitere Kriterien aufgestellt, die aber noch<br />
nicht mit ICD und DSM abgestimmt sind. Eine grundlegende Revision sollte angestrebt werden.<br />
Derzeit kennen ICD-10 und DSM-IV nur die Alzheimer-Demenz, vaskuläre Demenz und die Demenz<br />
bei an<strong>der</strong>en Krankheiten. An<strong>der</strong>e Krankheiten sind z.B. Morbus Pick, Creutzfeldt-Jakob-Erkrankung,<br />
Chorea Huntington, Morbus Parkinson und HIV. Die Lewy-Körper-Demenz wurde mittlerweile in den<br />
ICD-10 aufgenommen (G 31.82). Die frontotemporale Demenz kann als „Pick-Krankheit“ klassifiziert<br />
werden(F 02.0).<br />
Für die Diagnose einer vaskulären Demenz wird im ICD-10 <strong>der</strong> Nachweis einer zerebrovaskulären<br />
Schädigung verlangt. Die Gefäßpathologie bei <strong>der</strong> Alzheimer-Demenz wird nicht thematisiert.<br />
ICD-10<br />
Demenzsyndrom<br />
G1.1.<br />
Abnahme des Gedächtnisses, am deutlichsten beim Lernen<br />
neuer Information.<br />
Die Beeinträchtigung betrifft verbales und nonverbales<br />
Material<br />
G1.2.<br />
Eine Abnahme an<strong>der</strong>er kognitiver Fähigkeiten, charakterisiert<br />
durch eine Vermin<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Urteilsfähigkeit und des<br />
Denkvermögens<br />
Ein Grad des Gedächtnisverlustes, <strong>der</strong> mindestens die<br />
täglichen Aktivitäten beeinträchtigt (zu G1.1) und/o<strong>der</strong> die<br />
Abnahme kognitiver Fähigkeiten beeinträchtigt die<br />
Leistungsfähigkeit im täglichen Leben (zu G1.2)<br />
DSM-IV<br />
Demenzkernsyndrom<br />
A1.<br />
Entwicklung multipler kognitiver Defizite, die sich zeigen in:<br />
einer Gedächtnisbeeinträchtigung (beeinträchtigte Fähigkeit,<br />
neue Informationen zu erlernen o<strong>der</strong> früher Gelerntes<br />
abzurufen)<br />
A2.<br />
Mindestens einer <strong>der</strong> folgenden kognitiven Störungen:<br />
Aphasie, Apraxie, Agnosie, Störung <strong>der</strong> Exekutivfunktionen<br />
B.<br />
Jedes <strong>der</strong> kognitiven Defizite aus A1 und A2 verursacht in<br />
bedeutsamer Weise Beeinträchtigungen in sozialen o<strong>der</strong><br />
beruflichen Funktionsbereichen und stellt eine deutliche
ICD-10<br />
Demenzsyndrom<br />
G2.<br />
Die Wahrnehmung <strong>der</strong> Umgebung muss ausreichend lange<br />
erhalten geblieben sein (z. B. Fehlen einer<br />
Bewusstseinsstörung). Bestehen gleichzeitig delirante<br />
Episoden, sollte die Diagnose einer Demenz aufgeschoben<br />
werden<br />
G3.<br />
Die Vermin<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Affektkontrolle, des Antriebs o<strong>der</strong> des<br />
Sozialverhaltens manifestiert sich in mindestens einem <strong>der</strong><br />
folgenden Merkmale: emotionale Labilität, Reizbarkeit,<br />
Apathie, Vergröberung des Sozialverhaltens<br />
G4.<br />
Für eine sichere klinische Diagnose sollte G1 mindestens<br />
6 Monate vorhanden sein<br />
Tab. 1<br />
Demenz-Kriterien in ICD-10 und DSM-IV<br />
DSM-IV<br />
Demenzkernsyndrom<br />
Verschlechterung gegenüber einem früheren Leistungsniveau<br />
dar<br />
Die Defizite treten nicht ausschließlich im Verlauf eines Delirs<br />
auf<br />
Die Störung kann nicht durch eine an<strong>der</strong>e Achse-1-Störung<br />
(z. B. Major-Depression, Schizophrenie) erklärt werden<br />
Diagnostik<br />
Die Diagnose Demenz ist vor allem in <strong>der</strong> Frühphase oft schwierig. In die hausärztliche Praxis<br />
kommen sowohl Patienten, die bei sich selbst eine beginnende Demenz befürchten, als auch<br />
Patienten, bei denen Angehörige bzw. <strong>der</strong> Arzt selbst Defizite bemerken. Eine möglichst frühe<br />
Diagnose ist wichtig, um behandelbare Grun<strong>der</strong>krankungen auszuschließen.<br />
<strong>Demenzen</strong> werden klinisch diagnostiziert. Die höchste Sensitivität und Spezifität, ob eine Demenz<br />
o<strong>der</strong> eine zur Demenz führende Erkrankung vorliegt, hat das Urteil eines erfahrenen Arztes.<br />
Untersuchungen sollten nach Möglichkeit ambulant erfolgen. Zur empfohlenen Basisdiagnostik<br />
gehören<br />
- Anamnese und Fremdanamnese,<br />
- neurologische und psychiatrische Beurteilung,<br />
- neuropsychologische Untersuchungen,<br />
- zerebrale Bildgebung,<br />
- Laborausschlussdiagnostik.<br />
Anamnese<br />
Typische Hinweise sind Gedächtnisstörungen und Antriebsschwäche. Häufig sind die Betroffenen<br />
wesensverän<strong>der</strong>t und ziehen sich zunehmend zurück. Gezielt sollte nach Problemen bei <strong>der</strong><br />
Alltagsbewältigung gefragt werden, aber auch nach Schwindel, Schlafstörungen, Erschöpfbarkeit und<br />
Gewichtsverlust. Die Patienten haben zunehmende Sprachprobleme, unter an<strong>der</strong>em bei <strong>der</strong><br />
Wortfindung und dem Sprachverständnis. Die Geschwindigkeit des Denkens nimmt ab.<br />
Differenzialdiagnostisch sind alle Hinweise auf neurologische, internistische o<strong>der</strong> allgemeine<br />
Beschwerden wichtig. Auch <strong>der</strong> Alkoholkonsum sollte erfragt werden, ebenso die regelmäßige<br />
Einnahme von Medikamenten.<br />
Klinische Untersuchung<br />
Bei vielen <strong>Demenzen</strong> treten neurologische Defizite auf, z.B. Inkontinenz, Myoklonien o<strong>der</strong> ein<br />
Parkinson-Syndrom. Bei <strong>der</strong> allgemeinen klinischen Untersuchung werden Symptome von Grundo<strong>der</strong><br />
Begleiterkrankungen erfasst. Im Rahmen <strong>der</strong> psychiatrischen Beurteilung sollte beson<strong>der</strong>s auf<br />
eine mögliche Depression geachtet werden.<br />
<strong>Neuropsychologische</strong> Untersuchungen<br />
<strong>Neuropsychologische</strong> Untersuchungen prüfen sehr sensitiv, ob eine Demenz vorliegt. Sie können aber<br />
die Ursache <strong>der</strong> Demenz nicht sicher identifizieren. Die Spezifität steigt erheblich, wenn die<br />
Fragestellung eingeengt wird. Es gibt valide Kriterien um z. B. bei diskreten kognitiven Defiziten die<br />
Progression zu einer Demenz vorherzusagen. Auch die Alzheimer-Demenz kann damit von einer<br />
vaskulären Demenz unterschieden werden.
In den meisten Fällen stellt <strong>der</strong> Hausarzt die Verdachtsdiagnose. Er kann selbst einen Screeningtest<br />
durchführen. Der Patient sollte aber möglichst bald von einem Facharzt für Neurologie/Psychiatrie<br />
mitbetreut werden. In <strong>der</strong> Praxis hat sich <strong>der</strong> Mini-Mental-Status-Test (MMST) bewährt.<br />
Bildgebung<br />
Bildgebende Verfahren sind in <strong>der</strong> Basisdiagnostik unverzichtbar. Die Magnetresonanztomografie<br />
(MRT) ist die Methode <strong>der</strong> ersten Wahl bei <strong>der</strong> Primärdiagnostik neuer, unklarer kognitiver Störungen<br />
und Demenz. Die zerebrale Computertomografie (cCT) ist ausreichend, wenn es keine Hinweise auf<br />
eine entzündliche, tumoröse o<strong>der</strong> metabolische Erkrankung gibt.<br />
Weitere Verfahren wie z.B. die Positronenemissionstomografie (PET), das Perfusions-SPECT (Single<br />
Photon Emission Computed Tomography) o<strong>der</strong> die Doppler-Sonografie sind nur im Einzelfall sinnvoll.<br />
Labor<br />
Als obligatorische Laborparameter gelten <strong>der</strong>zeit:<br />
- Blutbild, Differenzial-Blutbild,<br />
- Blutsenkungsgeschwindigkeit,<br />
- Serum-Elektrolyte (Na, K, Ca, Cl, Mg),<br />
- GOT, GPT, γGT, AP, Bilirubin,<br />
- Kreatinin, Harnstoff,<br />
- Glukose,<br />
- Cholesterin, Triglyzeride,<br />
- TSH,<br />
- Vitamin B12, Folsäure,<br />
- Lues- und Borreliosescreening,<br />
- Urinstatus.<br />
Weitere Diagnostik<br />
Weitere spezielle Untersuchungen wie z.B. die Liquordiagnostik o<strong>der</strong> ein EEG sollten nur in<br />
Einzelfällen erfolgen.<br />
<strong>Differenzialdiagnose</strong><br />
In erster Linie müssen behandelbare intrakranielle und internistische Erkrankungen ausgeschlossen<br />
werden, ebenso Depression o<strong>der</strong> ein Verwirrtheitszustand. Eine frühe <strong>Differenzialdiagnose</strong> <strong>der</strong><br />
degenerativen <strong>Demenzen</strong> selbst ist weniger wichtig, da es keine therapeutischen Konsequenzen gibt.<br />
Alzheimer-Demenz<br />
Die Diagnose einer Alzheimer-Demenz erfor<strong>der</strong>t eine Gedächtnisstörung plus mindestens eines <strong>der</strong><br />
folgenden Symptome:<br />
- Aphasie,<br />
- Apraxie,<br />
- Agnosie,<br />
- Störungen <strong>der</strong> Exekutivfunktionen.<br />
Klinik<br />
Die Alzheimer-Demenz beginnt schleichend. Zwischen Diagnosestellung und Tod vergehen 4-<br />
12 Jahre. Die Progression ist umso rascher, je jünger die Patienten bei Erkrankungsbeginn sind. Der<br />
Geruchssinn ist oft frühzeitig gestört. Dies trifft allerdings auch auf Patienten mit Morbus Parkinson zu.<br />
Anfänglich sind die Gedächtnis- und Wortfindungsstörungen noch diskret und können überspielt<br />
werden. Die Persönlichkeit, Emotionalität, Schwingungsfähigkeit und <strong>der</strong> Antrieb sind zunächst noch<br />
intakt. Häufig wird die Diagnose erst gestellt, wenn an<strong>der</strong>en die Gedächtnisdefizite,<br />
Orientierungsstörungen o<strong>der</strong> apraktische Handlungsstörungen auffallen. Die typische Symptom-Trias<br />
besteht aus<br />
- Neugedächtnisstörungen,<br />
- visuell-räumlichen Defiziten und<br />
- Benennstörungen.
Im fortgeschrittenen Stadium haben die Patienten oft eine visuelle Agnosie und ideatorische Apraxie.<br />
In selteneren Fällen besteht ein sogenanntes Capgras-Syndrom, bei dem die Betroffenen<br />
nahestehende Personen fälschlich als Doppelgänger mit üblen Absichten identifizieren. Die<br />
sogenannten „happy wan<strong>der</strong>er“ gehen wegen <strong>der</strong> Orientierungs- und Gedächtnisstörung öfter<br />
verloren. Der Schlaf-Wach-Rhythmus ist gestört. Daneben leiden viele unter Depressionen, Wahn,<br />
Angst und Agitiertheit.<br />
Eine Variante <strong>der</strong> Alzheimer-Demenz ist die posteriore kortikale Atrophie. Hier kommt es früh zu einer<br />
Prosopagnosie und visuellen Agnosie dar, bekannt als „Der Mann, <strong>der</strong> seine Frau mit einem Hut<br />
verwechselte“. Mehr als die Hälfte <strong>der</strong> Betroffenen entwickelt das Vollbild einer Alzheimer-Demenz.<br />
Diagnose<br />
In unkomplizierten Fällen genügt die Basisdiagnostik. In Zukunft werden voraussichtlich biologische<br />
Marker und spezielle Bildgebungsverfahren an Bedeutung zunehmen.<br />
Vaskuläre <strong>Demenzen</strong><br />
Die vaskuläre Demenz ist keine Erkrankung, son<strong>der</strong>n ein Oberbegriff. Sie wird durch Verän<strong>der</strong>ungen<br />
<strong>der</strong> kleinen und/o<strong>der</strong> großen Gefäße im Gehirn verursacht. Die Ursache dafür können zahlreiche<br />
Erkrankungen sein. Diese Definition berücksichtigt aber nicht, dass sich zerebrovaskuläre und<br />
degenerative Erkrankungen überschneiden, beson<strong>der</strong>s bei Morbus Alzheimer. Weniger als 10% aller<br />
<strong>Demenzen</strong> dürften ausschließlich zerebrovaskulär bedingt sein. Die wichtigsten Pathomechanismen<br />
sind<br />
- Multiinfarktsyndrome,<br />
- strategische Infarkte,<br />
- mikropangiopathische Läsionen o<strong>der</strong> konfluierende Marklagerverän<strong>der</strong>ungen,<br />
- Mikrogefäßverän<strong>der</strong>ungen mit Kapillarverlust.<br />
Im Vor<strong>der</strong>grund steht die diffuse Mikroangiopathie, die subkortikale arteriopathische Enzephalopathie<br />
(SAE). Sie wird auch als Morbus Binswanger bezeichnet und meist durch eine arterielle Hypertonie<br />
verursacht.<br />
Es ist umstritten, wie häufig sich eine Demenz nach einem ersten Schlaganfall entwickelt. Dies hängt<br />
auch vom verwendeten Diagnosesystem ab. Mehrfach wurden Prävalenzen von 1/3 berichtet.<br />
Teilweise ist dies aber auf Artefakte durch die ICD- und DSM-Definitionen zurückzuführen.<br />
Klinik<br />
Häufig ist <strong>der</strong> Verlauf schrittweise mit zeitweiligen unvollständigen Verbesserungen. Typische<br />
Symptome bei <strong>der</strong> subkortikalen arteriopathischen Enzephalopathie sind Gangapraxie, imperativer<br />
Harndrang und Pseudobulbärparalyse.<br />
Diagnose<br />
In den bildgebenden Verfahren stellen sich vaskuläre Läsionen häufig gut dar. Die Befunde können<br />
aber leicht überinterpretiert werden. Für die Diagnose müssen daher klinische und anamnestische<br />
Befunde unbedingt mit einbezogen werden.<br />
<strong>Differenzialdiagnose</strong><br />
Beson<strong>der</strong>s schwierig ist die <strong>Differenzialdiagnose</strong> zum Normaldruckhydrozephalus. Das klinische Bild<br />
ähnelt <strong>der</strong> Demenz bei subkortikaler arteriopathischer Enzephalopathie sehr. Möglicherweise ist diese<br />
selbst ein Risikofaktor für den Normaldruckhydrozephalus.<br />
Lewy-Körper-Demenz<br />
Lewy-Körperchen in <strong>der</strong> Substantia nigra sind ein Charakteristikum des Morbus Parkinson. Bei <strong>der</strong><br />
diffusen Lewy-Körper-Erkrankung treten sie dicht gepackt im Neokortex auf. Patienten mit Lewy-<br />
Körper-Demenz haben außerdem häufig Alzheimer-Plaques und Neurofibrillen. Es ist bis heute<br />
umstritten, ob sich die Lewy-Körper-Demenz von Morbus Alzheimer und Morbus Parkinson abgrenzen<br />
lässt. Möglicherweise ist sie nur ein Extrem eines Spektrums.<br />
Die Erkrankung betrifft sowohl das cholinerge als auch das dopaminerge System. Dies erklärt die<br />
hohe Sensitivität für Neuroleptika und die Wirksamkeit von Cholinesterasehemmern. Die Häufigkeit<br />
<strong>der</strong> Lewy-Körper-Demenz wird auf bis zu 5-10% <strong>der</strong> <strong>Demenzen</strong> geschätzt.
Klinik<br />
Der Verlauf geht über drei bis sechs Jahre, in Einzelfällen auch länger. Häufig treten Parkinson-<br />
Symptome auf. Im Gegensatz zur Alzheimer-Demenz haben Patienten mit Lewy-Körper-Demenz<br />
extrapyramidale Symptome, fluktuierende kognitive Defizite und visuelle o<strong>der</strong> akustische<br />
Halluzinationen. Sie neigen zu Stürzen und Synkopen. Geht über mehr als ein Jahr eine Parkinson-<br />
Symptomatik voraus, wird die Demenz als parkinsonassoziiert klassifiziert.<br />
Diagnose<br />
Die Erkrankung kann mit guter Spezifität klinisch diagnostiziert werden. In vielen Fällen wird die<br />
Diagnose aber erst nach unerwartet heftigen Reaktionen auf die Behandlung <strong>der</strong> Halluzinationen mit<br />
Haloperidol gestellt.<br />
Im Dopamin-Transporter-SPECT zeigt sich eine Hypoperfusion bzw. ein Hypometabolismus<br />
parietotemporookzipital.<br />
Frontotemporale Lobardegeneration<br />
Nach <strong>der</strong>zeitigem Wissen sind frontotemporale Lobaratrophien eine Gruppe neurodegenerativer<br />
Erkrankungen, die sowohl Gemeinsamkeiten als auch Unterschiede haben. Am häufigsten ist die<br />
frontotemporale Demenz mit 70-80%. Deutlich seltener sind die semantische Demenz mit 10-20% und<br />
die primär progressive Aphasie mit 5-10%. Insgesamt stellt die Gruppe mit über 10% <strong>der</strong> <strong>Demenzen</strong><br />
die zweithäufigste Ursache degenerativer Demenzerkrankung dar. Bei Patienten unter 65 Jahren sind<br />
frontotemporale Atrophien und Alzheimer-Demenz etwa gleich häufig. Frontotemporale<br />
Lobaratrophien können familiär gehäuft auftreten.<br />
Klinik<br />
Sehr frühzeitig verän<strong>der</strong>n die Patienten ihr Wesen und verhalten sich sozial inadäquat. Bei <strong>der</strong><br />
semantischen Demenz und <strong>der</strong> primär progressiven Aphasie treten bald Sprachprobleme auf.<br />
Diagnose<br />
Die Diagnose <strong>der</strong> frontotemporalen Atrophien wird durch die Konsenskriterien erleichtert (Tab. 2). In<br />
den bildgebenden Verfahren zeigt sich die charakteristische, oft asymmetrische frontotemporale<br />
Atrophie.<br />
Erkrankung Kernsymptome stützende Symptome<br />
frontotemporale<br />
Lobardegenerationen<br />
(gemeinsam)<br />
frontotemporale Demenz<br />
semantische Demenz<br />
primär progressive Aphasie<br />
Tab. 2<br />
schleichen<strong>der</strong> Beginn<br />
langsame Progredienz<br />
Verfall des Sozialverhaltens<br />
verflachter Affekt<br />
vermin<strong>der</strong>te Krankheitseinsicht<br />
flüssige inhaltsleere Spontansprache<br />
Benennstörung mit Verlust <strong>der</strong><br />
Wortbedeutungen<br />
semantische Paraphasien<br />
wenig beeinträchtigtes Nachsprechen<br />
unflüssige Spontansprache<br />
Agrammatismus<br />
phonematische Paraphasien<br />
Wortfindungsstörungen<br />
Beginn vor dem 65. Lebensjahr<br />
positive Familienanamnese<br />
Bulbärparalyse<br />
atrophische Paresen<br />
Faszikulationen<br />
Verhaltensstörungen<br />
Perseverationen<br />
Stereotypie<br />
Utilisationsverhalten<br />
Sprech- und Sprachstörungen (vermin<strong>der</strong>ter<br />
Sprachantrieb bis zum Mutismus,<br />
Rededrang, Stereotypie, Echolalie, Palilalie)<br />
Primitivreflexe<br />
Inkontinenz<br />
Akinese, Rigor, Tremor<br />
labile Hypertonie<br />
Rededrang<br />
Oberflächendyslexie und -dysgraphie (Lesen<br />
und Schreiben ohne semantische Route)<br />
weitgehend intaktes Rechnen<br />
Verhaltensstörungen<br />
Interesseneinengung<br />
Primitivreflexe<br />
Akinese, Rigor, Tremor<br />
Stottern<br />
Sprechapraxie<br />
Nachsprechen vermin<strong>der</strong>t<br />
Schriftsprache gestört<br />
initial ungestörtes Wortverständnis<br />
Mutismus erst spät
Kriterien <strong>der</strong> frontotemporalen Lobardegeneration<br />
Demenz bei degenerativen Systemerkrankungen<br />
Der idiopathische Morbus Parkinson ist regelhaft mit neuropsychologischen Auffälligkeiten asooziiert,<br />
z.B. mit Bradyphrenie und diskreten exekutiven Störungen. Die Patienten entwickeln im Vergleich zur<br />
gesunden Bevölkerung im Fünf-Jahres-Verlauf häufiger eine Demenz.<br />
Die progressive supranukleäre Blickparese (Steele-Richardson-Olszwewski-Syndrom) ist ebenfalls<br />
eine degenerative Gehirnerkrankung. Sie ähnelt dem Morbus Parkinson. Bei <strong>der</strong> möglichen Demenz<br />
stehen Antriebs- und Aufmerksamkeitsstörungen und eine verlangsamte psychomotorische<br />
Geschwindigkeit im Vor<strong>der</strong>grund. Die Erkrankung beginnt meist vor dem 40. Lebensjahr und schreitet<br />
schrittweise voran. Typische Symptome sind die supranukleäre Blicklähmung und verlangsamte<br />
vertikale Sakkaden. Die Patienten stürzen leicht.<br />
Symptomatische <strong>Demenzen</strong><br />
Unzählige Krankheiten, Stoffwechselstörungen und Substanzbelastungen können eine Demenz<br />
verursachen. In den meisten Fällen sind Anamnese und Befund richtungsweisend. Zur<br />
<strong>Differenzialdiagnose</strong> kann die Ableitung eines EEG hilfreich sein.<br />
Fazit<br />
Die <strong>Differenzialdiagnose</strong> <strong>der</strong> degenerativen <strong>Demenzen</strong> untereinan<strong>der</strong> ist wegen fehlen<strong>der</strong><br />
therapeutischer Alternativen noch wenig bedeutsam. Das wird sich ,it <strong>der</strong> Entwicklung spezifischer<br />
Behandlungen z.B. des M.Alzheimer än<strong>der</strong>n. Wichtig ist heute vor allem <strong>der</strong> frühe Ausschluss einer<br />
behandelbaren Demenzursache.