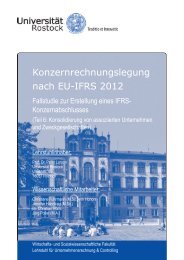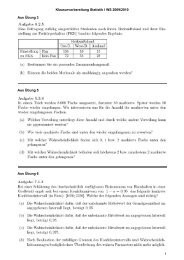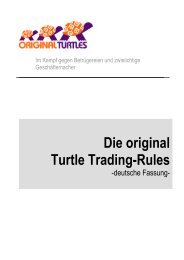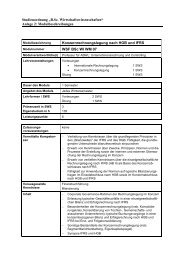Soziale Mobilität - Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät
Soziale Mobilität - Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät
Soziale Mobilität - Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Soziale</strong> <strong>Mobilität</strong> 5<br />
mit dem Übergang in die 80er Jahre wieder<br />
zum Stillstand zu kommen scheint (vgl. Geißler<br />
1996; Vester et al. 1992), brachte jedoch<br />
für ausländische Arbeitnehmer nur wenig verbesserte<br />
Aufstiegschancen mit sich: Auch aus<br />
der zweiten Ausländergeneration sind in den<br />
80er Jahren noch mehr als die Hälfte als unoder<br />
angelernte Arbeiter beschäftigt, während<br />
dies nur auf etwa ein Fünftel der gleichaltrigen<br />
Deutschen zutrifft. Schon fast die Hälfte<br />
der deutschen Erwerbstätigen (bis zum Alter<br />
von 25 Jahren) befindet sich dagegen in Angestelltenpositionen;<br />
bei der zweiten Ausländergeneration<br />
beträgt diese Quote jedoch nur<br />
r<strong>und</strong> 20% (Seifert 1995: 149).<br />
In der westdeutschen Bevölkerung hat die<br />
Bildungsexpansion auch zu einem tendenziellen<br />
Rückgang des Einflusses der sozialen<br />
Herkunft auf Bildungslaufbahnen <strong>und</strong> -abschlüsse<br />
<strong>und</strong> insofern zu etwas mehr Chancengleichheit<br />
im Bildungsbereich geführt<br />
(vgl. Henz/Maas 1995; Müller/Haun 1994; für<br />
einen europäischen Vergleich siehe: Müller<br />
u.a. 1997). Strittig ist jedoch, inwieweit sich<br />
dies auch in einer größeren Chancengleichheit<br />
beim Berufseintritt <strong>und</strong> in den Berufslaufbahnen,<br />
also im Erwerbsbereich, ausdrückt. International<br />
vergleichende Untersuchungen zeigen<br />
zudem, daß das Muster intergenerationeller<br />
<strong>Mobilität</strong> in der B<strong>und</strong>esrepublik in einigen<br />
Punkten deutlich von dem anderer westlicher<br />
Gesellschaften abweicht: Vor allem die in<br />
Deutschland seit dem frühen 20. Jahrh<strong>und</strong>ert<br />
besonders scharf gezogene „Kragenlinie“ zwischen<br />
Arbeitern <strong>und</strong> Angestellten <strong>und</strong> die hohe<br />
Statusvererbung in der Beamtenschaft hat<br />
hier – zumindest bis in die 70er Jahre hinein –<br />
zu einer vergleichsweise geringeren intergenerationellen<br />
<strong>Mobilität</strong> geführt (vgl. Müller<br />
1986).<br />
Im Unterschied zur B<strong>und</strong>esrepublik wiesen<br />
in der DDR insbesondere die sog.<br />
„Dienstklassen“ <strong>und</strong> die Selbständigen deutlich<br />
geringere Chancen der Positionsvererbung<br />
auf, was auf umfangreiche Abstiegsprozesse<br />
hinweist. Häufiger waren demgegenüber<br />
die intergenerationellen Aufstiege<br />
aus der geringer qualifizierten Arbeiterschaft.<br />
Für die Söhne von Facharbeitern erweist sich<br />
jedoch überraschenderweise die B<strong>und</strong>esrepublik<br />
als die „offenere“ Gesellschaft: Während<br />
in der DDR fast 60% der Facharbeitersöhne<br />
wiederum Facharbeiter wurden <strong>und</strong> nur etwa<br />
11% einen Aufstieg in die „obere Dienstklasse“<br />
erreichten, schafften dies in Westdeutschland<br />
etwa 17%, <strong>und</strong> lediglich 40% wurden erneut<br />
Facharbeiter (vgl. Mayer/Solga 1994).<br />
Im historischen Rückblick zeigt sich dabei<br />
in den beiden deutschen Staaten eine deutliche<br />
Auseinanderentwicklung der<br />
<strong>Mobilität</strong>smuster: Zwar hatte zunächst auch in<br />
der DDR die sog. „Aufbaugeneration“ der um<br />
1930 Geborenen besonders viele <strong>und</strong> gute<br />
Chancen des sozialen Aufstiegs. Zumindest<br />
bis zum Mauerbau trugen dazu auch die<br />
hohen Abwanderungsraten hochqualifizierter<br />
Personen nach Westdeutschland bei. Die<br />
folgenden Geburtsjahrgänge, insbesondere die<br />
um 1960 <strong>und</strong> danach Geborenen, fanden dann<br />
jedoch erheblich verschlechterte Aufstiegschancen<br />
vor: „Die Kinder der Intelligenz<br />
hatten elfmal beziehungsweise fünfzehnmal<br />
bessere Chancen als die Kinder von<br />
Facharbeitern beziehungsweise von un- <strong>und</strong><br />
angelernten Arbeitern <strong>und</strong><br />
Genossenschaftsbauern. Das heißt, daß sich<br />
diese relativen Chancen im Vergleich zur<br />
Aufbaugeneration um das Fünffache verschlechterten.“<br />
(Mayer/Solga 1994: 203f.; vgl.<br />
Solga 1995). Auf eine wachsende „Schließung“<br />
<strong>und</strong> eine zunehmende Selbstreproduktion<br />
einer „sozialistischen Dienstklasse“ deutet<br />
auch hin, daß z.B. um 1970 noch 75-82% der<br />
Angehörigen von DDR-Führungsschichten<br />
(Betriebsleiter, Staatsanwälte, Richter, Offiziere)<br />
der in der DDR ja sehr weit gefaßten<br />
„Arbeiterklasse“ entstammten, gegen Ende<br />
der 80er Jahre diese Quoten jedoch auf 64-<br />
76% gesunken waren (vgl. Geißler 1996:<br />
240ff.). Verstärkt wurde diese Blockade von<br />
Aufstiegskanälen in der DDR, mit der sich<br />
vor allem die jüngeren Generationen konfrontiert<br />
sahen, schließlich noch durch den politisch<br />
gesteuerten Ausleseprozeß.<br />
2.3 Intragenerationelle <strong>Mobilität</strong> in der<br />
BRD<br />
Konzentriert man sich auf die intragenerationelle<br />
<strong>Mobilität</strong> zwischen Berufseintrittspositionen<br />
<strong>und</strong> später erreichten Positionen,