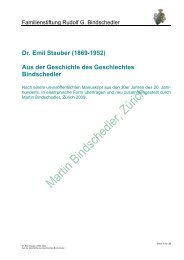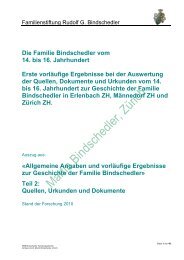Taufen, Hochzeiten und Begräbnisse - Bindschedler
Taufen, Hochzeiten und Begräbnisse - Bindschedler
Taufen, Hochzeiten und Begräbnisse - Bindschedler
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Familienstiftung Rudolf G. <strong>Bindschedler</strong><br />
der Stadt. Oft brachten diese die Pfarrer selbst auf das Land, da sie häufig selbst als Paten Kinder aus der<br />
Taufe hoben. Diese Namen fanden dann mit einer Verzögerung von 20 bis 40 Jahren auf dem Land<br />
Verbreitung. Hatte sich ein Name auf der Landschaft einmal eingebürgert, so blieb dieser in Gebrauch, auch<br />
wenn dieser in der Stadt bereits wieder verschw<strong>und</strong>en war (zum Beispiel Sara, Marx etc.). 9<br />
Nach der Reformation wurden die Knaben meist nach biblischen Vorbildern benannt. Die beliebtesten<br />
Namen waren Hans (Johannes, Hansli, Hensli etc.) <strong>und</strong> Jakob (Jaggli etc.), sowie deren Varianten. Mit<br />
Abstand folgten Andreas (Anderes), Peter (Petter), Stefan (Steffen), David etc. Alttestamentliche Namen wie<br />
Elias, Abraham, Isaac etc. wurden bereits im 17. Jahrh<strong>und</strong>ert kaum mehr verwendet. 10<br />
Von den unzähligen Heiligennamen konnten sich nur gerade Ulrich, der Vorname des Reformators Zwingli,<br />
Felix, der Name des Stadtheiligen, <strong>und</strong> Kaspar über längere Zeit halten. Andere Heiligennamen wie<br />
Joachim, Othmar etc. blieben meist auf ein bestimmtes Gebiet beschränkt, in welchem sie vorher verehrt<br />
wurden oder verbreitet gewesen sind. Ab dem 16. Jahrh<strong>und</strong>ert wurden dann, wie bereits erwähnt, zusammengesetzte<br />
Namen immer häufiger. Sie wurden manchmal öfter verwendet, als der Einzelname selbst. Um<br />
1700 stieg die Zahl der biblischen Namen, wohl unter dem Einfluss pietistischer Einflüsse nochmals stark an<br />
<strong>und</strong> Salomon, Cornelius, David <strong>und</strong> Daniel waren hoch im Kurs. 11 Zu den am häufigsten verwendeten<br />
Namen gehörten auch die deutschen Namen wie Heinrich (Heiri, Heini), Konrad (Churet), Rudolf (Ruedi,<br />
Ruedli) <strong>und</strong> deren Abwandlungen. 12 Unter den Top Ten vom 16. bis ins 18. Jahrh<strong>und</strong>ert finden sich nicht<br />
weniger als fünf kombinierte Namen, wie der Auswertung der von Erika Welti erfassten Namenlisten (siehe<br />
auch nachfolgende Tabellen) zu entnehmen ist.<br />
Bei den Mädchen schien man auf mehrsilbige, wohlklingende Namen Wert zu legen. So waren Anna<br />
(1. Platz), Elisabetha (2. Platz), Barbara (3. Platz), Verena (4. Platz) <strong>und</strong> Margaretha (5. Platz) die häufigsten<br />
Namen im Zeitraum vom 16. bis ins 18. Jahrh<strong>und</strong>ert.<br />
Während bei den Knaben über 20 biblische Namen auftraten, waren es bei den Mädchen nur gerade deren<br />
vier: Anna, Elisabetha, Magdalena <strong>und</strong> Susanna. Ebenso wurden oft Heiligennamen wie Barbara, Regula,<br />
Katharina, Margaretha <strong>und</strong> Verena verwendet. Agathe, Agnes, Dorothea, Küngold, Kleophea etc. wurden<br />
nur selten verwendet <strong>und</strong> traten zum Teil regional gehäuft auf. 13 Auffälligerweise fehlte der Name Maria unter<br />
den Top Ten. Nach der Reformation wurde der Name nur wenig verwendet. Erst im 17. <strong>und</strong> 18. Jahrh<strong>und</strong>ert<br />
schien man den Namen alleine oder in den aufkommenden Kombinationen (zum Beispiel Anna Maria)<br />
wieder zu verwenden. 14 Allerdings scheinen die kombinierten Namen bei der Namenwahl für Mädchen<br />
wesentlich weniger beliebt gewesen zu sein, als bei den Knaben. Nicht ein einziger kombinierter Name fand<br />
sich in den Top Ten, während es bei den Knaben fünf kombinierte Namen in die Rangliste schafften.<br />
Die Französische Revolution <strong>und</strong> der damit verb<strong>und</strong>ene Untergang der alten Ordnung <strong>und</strong> die danach<br />
folgende Franzosenzeit prägten die Namengebung besonders stark. Neue aufklärerische Namen wie Emil,<br />
Karl (Charles, Kari) oder französisierte Namen wie Schang oder Schangli aus Jean (Hans) oder Schaaggi<br />
aus Jacques (Jakob) ersetzten oder ergänzten die allgemein gebräuchlichen Hans <strong>und</strong> Jakob. 15 Französisch<br />
klingende Namen wie Louise, Henriette, Züsette (Susette) <strong>und</strong> andere waren auch bei den Mädchen in. 16<br />
Später dann folgten im Zuge deutscher Flüchtlinge deutsche Namen wie Edwin, Oskar, Otto etc. 17 , bei den<br />
Mädchen Friederike, Wilhelmine <strong>und</strong> Christiane. 18 Im Verlaufe des 19. Jahrh<strong>und</strong>erts fanden auch die Heiligennamen<br />
wie Klara, Therese <strong>und</strong> Franziska Verwendung oder aus Schillers «Willhelm Tell» entliehene Namen<br />
wie Walter, Werner, Arnold <strong>und</strong> Wilhelm bei den Knaben, Gertrud <strong>und</strong> Bertha bei den Mädchen. 19<br />
Der im 18. Jahrh<strong>und</strong>ert beginnende <strong>und</strong> sich im 19. Jahrh<strong>und</strong>ert durchsetzende Brauch, zwei, später drei<br />
oder sogar vier Vornamen zu geben, führte zu Kombinationen von alten <strong>und</strong> neuen Namen, wie beispielsweise<br />
Jakob Albert, mit Jakob als Rufname, beziehungsweise der Name des Paten oder später Ernst<br />
Kaspar, mit Ernst als Rufname <strong>und</strong> Kaspar als Name des Paten. Bei den Mädchen fanden sich Susanna<br />
Mathilde Gertrud oder Henriette Elisabetha. 20 Die Namen der Paten traten damit immer stärker in den<br />
9 Welti Erika: Taufbräuche im Kanton Zürich. Gotthelf-Verlag, Zürich 1967. S.105-106<br />
10 Welti Erika: Taufbräuche im Kanton Zürich. Gotthelf-Verlag, Zürich 1967. S.106-107<br />
11 Welti Erika: Taufbräuche im Kanton Zürich. Gotthelf-Verlag, Zürich 1967. S.106-107<br />
12 Welti Erika: Taufbräuche im Kanton Zürich. Gotthelf-Verlag, Zürich 1967. S.106<br />
13 Welti Erika: Taufbräuche im Kanton Zürich. Gotthelf-Verlag, Zürich 1967. S.108<br />
14 Welti Erika: Taufbräuche im Kanton Zürich. Gotthelf-Verlag, Zürich 1967. S.108-109<br />
15 Welti Erika: Taufbräuche im Kanton Zürich. Gotthelf-Verlag, Zürich 1967. S.107<br />
16 Welti Erika: Taufbräuche im Kanton Zürich. Gotthelf-Verlag, Zürich 1967. S.109<br />
17 Welti Erika: Taufbräuche im Kanton Zürich. Gotthelf-Verlag, Zürich 1967. S.107<br />
18 Welti Erika: Taufbräuche im Kanton Zürich. Gotthelf-Verlag, Zürich 1967. S.109<br />
19 Welti Erika: Taufbräuche im Kanton Zürich. Gotthelf-Verlag, Zürich 1967. S.109<br />
20 Welti Erika: Taufbräuche im Kanton Zürich. Gotthelf-Verlag, Zürich 1967. S.109<br />
HMB <strong>Bindschedler</strong> Familiengeschichte<br />
Verfasst durch: Martin <strong>Bindschedler</strong>, Zürich<br />
Seite 4 von 10