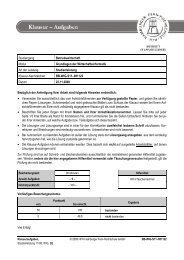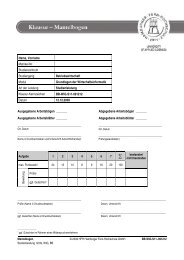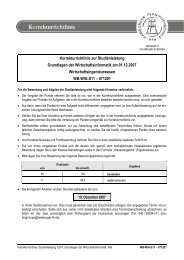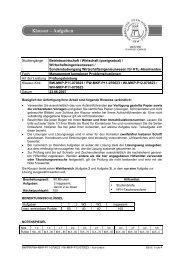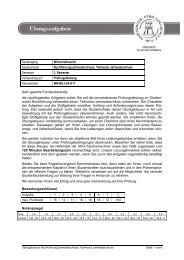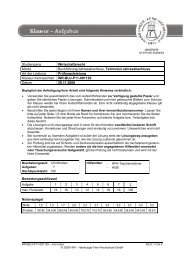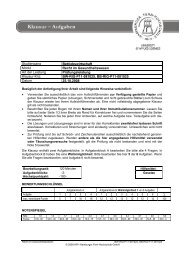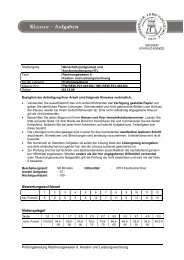20 Punkte - Klausurensammlung HFH Hamburger Fern Hochschule ...
20 Punkte - Klausurensammlung HFH Hamburger Fern Hochschule ...
20 Punkte - Klausurensammlung HFH Hamburger Fern Hochschule ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Name, Vorname<br />
Matrikel-Nr.<br />
Studienzentrum<br />
Studiengang<br />
Gesundheits- und Sozialmanagement<br />
Modul<br />
Einführung in das Gesundheitssystem<br />
und die Gesundheitswissenschaft<br />
Art der Leistung Prüfungsleistung<br />
Klausur-Kennzeichen BG-EGG-P11-091010<br />
Datum 10.10.<strong>20</strong>09<br />
Ausgegebene Arbeitsbögen<br />
__________<br />
Abgegebene Arbeitsbögen<br />
__________<br />
_______________________________________<br />
Ort, Datum<br />
_______________________________________<br />
Name in Druckbuchstaben und Unterschrift Aufsichtsführende(r)<br />
_______________________________________<br />
Ort, Datum<br />
_______________________________________<br />
Prüfungskandidat(in)<br />
Aufgabe 1 2 3 4 Σ Note<br />
max. Punktzahl <strong>20</strong> 30 <strong>20</strong> 30 100<br />
Bewertung<br />
Prüfer<br />
ggf. Gutachter 1<br />
_________________________________________<br />
Prüfer (Name in Druckbuchstaben)<br />
__________________________________<br />
Datum, Unterschrift<br />
_________________________________________<br />
ggf. Gutachter (Name in Druckbuchstaben)<br />
__________________________________<br />
Datum, Unterschrift<br />
1 Ggf. Gutachten im Rahmen eines Widerspruchverfahrens<br />
BG-EGG-P11-091010 © <strong>20</strong>09 <strong>HFH</strong> <strong>Hamburger</strong> <strong>Fern</strong>-<strong>Hochschule</strong> GmbH Seite 1
Mantelbogen<br />
<strong>HFH</strong> <strong>Hamburger</strong> <strong>Fern</strong>-<strong>Hochschule</strong><br />
Anmerkungen Prüfer:<br />
_________________________<br />
Datum, Unterschrift<br />
Anmerkungen Gutachter:<br />
_________________________<br />
Datum, Unterschrift<br />
Sonstige Anmerkungen:<br />
_________________________<br />
Datum, Unterschrift<br />
BG-EGG-P11-091010 © <strong>20</strong>09 <strong>HFH</strong> <strong>Hamburger</strong> <strong>Fern</strong>-<strong>Hochschule</strong> GmbH Seite 2
Studiengang<br />
Gesundheits- und Sozialmanagement<br />
Modul<br />
Einführung in das Gesundheitssystem<br />
und die Gesundheitswissenschaft<br />
Art der Leistung Prüfungsleistung<br />
Klausur-Kennzeichen BG-EGG-P11-091010<br />
Datum 10.10.<strong>20</strong>09<br />
Bezüglich der Anfertigung Ihrer Arbeit sind folgende Hinweise verbindlich:<br />
Verwenden Sie ausschließlich das vom Aufsichtsführenden zur Verfügung gestellte Papier, und geben Sie sämtliches<br />
Papier (Lösungen, Schmierzettel und nicht gebrauchte Blätter) zum Schluss der Klausur wieder bei Ihrem Aufsichtsführenden<br />
ab. Eine nicht vollständig abgegebene Klausur gilt als nicht bestanden.<br />
Beschriften Sie jeden Bogen mit Ihrem Namen und Ihrer Immatrikulationsnummer. Lassen Sie bitte auf jeder Seite<br />
1/3 ihrer Breite als Rand für Korrekturen frei, und nummerieren Sie die Seiten fortlaufend. Notieren Sie bei jeder<br />
Ihrer Antworten, auf welche Aufgabe bzw. Teilaufgabe sich diese bezieht.<br />
Die Lösungen und Lösungswege sind in einer für den Korrektanten zweifelsfrei lesbaren Schrift abzufassen (kein<br />
Bleistift). Korrekturen und Streichungen sind eindeutig vorzunehmen. Unleserliches wird nicht bewertet.<br />
Bei numerisch zu lösenden Aufgaben ist außer der Lösung stets der Lösungsweg anzugeben, aus dem eindeutig<br />
hervorzugehen hat, wie die Lösung zustande gekommen ist.<br />
Die Klausur-Aufgaben können einbehalten werden. Dies bezieht sich nicht auf ausgeteilte Arbeitsblätter, auf denen<br />
Lösungen einzutragen sind.<br />
Zur Prüfung sind bis auf Schreib- und Zeichenutensilien ausschließlich die nachstehend genannten Hilfsmittel zugelassen.<br />
Werden andere als die hier angegebenen Hilfsmittel verwendet oder Täuschungsversuche festgestellt, gilt die<br />
Prüfung als nicht bestanden und wird mit der Note 5 bewertet.<br />
Bearbeitungszeit:<br />
90 Minuten<br />
Anzahl der Aufgaben: 4<br />
Höchstpunktzahl: 100<br />
Hilfsmittel:<br />
keine<br />
Aufgabe 1 2 3 4 insg.<br />
max. Punktzahl <strong>20</strong> 30 <strong>20</strong> 30 100<br />
Viel Erfolg!<br />
BG-EGG-P11-091010 © <strong>20</strong>09 <strong>HFH</strong> <strong>Hamburger</strong> <strong>Fern</strong>-<strong>Hochschule</strong> GmbH Seite 1 von 2
Klausuraufgaben<br />
<strong>HFH</strong> <strong>Hamburger</strong> <strong>Fern</strong>-<strong>Hochschule</strong><br />
Aufgabe 1: Gesundheitskonzepte<br />
<strong>20</strong> <strong>Punkte</strong><br />
1.1 Worum geht es bei der Analyse von subjektiven Vorstellungen von Gesundheit durch<br />
Laien (Sie werden auch „Laienkonzepte von Gesundheit“, „subjektive Konzepte“ oder „Alltagskonzepte“<br />
genannt)?<br />
1.2 Antonovsky (1991) unterscheidet zwischen Verstehbarkeit, Handhabbarkeit und Sinnhaftigkeit.<br />
Erläutern Sie jeweils deren Bedeutung.<br />
1.3 Hunt (1988) hat sich ausführlich mit der Bedeutung „subjektiver Gesundheitsindikatoren“<br />
(oder Laiendefinitionen) befasst. Nennen Sie je drei Vor- und Nachteile der Heranziehung<br />
subjektiver Indikatoren zur Bestimmung von Gesundheit.<br />
5 <strong>Punkte</strong><br />
9 <strong>Punkte</strong><br />
6 <strong>Punkte</strong><br />
Aufgabe 2: Gesundheitsressourcen<br />
30 <strong>Punkte</strong><br />
2.1 Nennen Sie fünf Komponenten des Gesundheitsbewusstseins nach Faltermaier (1994). 5 <strong>Punkte</strong><br />
2.2 Verschiedene Untersuchungen haben gezeigt, dass sich das Gesundheitsverhalten bzw. <strong>20</strong> <strong>Punkte</strong><br />
Gesundheitshandeln von Männern und Frauen unterscheidet. Stellen Sie jeweils fünf Unterschiede<br />
kurz vor.<br />
2.3 Gesundheitsverhalten ist abhängig vom Bildungsniveau. Welche fünf Merkmale können 5 <strong>Punkte</strong><br />
sich unterschiedlich auswirken?<br />
Aufgabe 3: Gesundheitsrisiken<br />
3.1 Aus der Stressforschung lassen sich Erkenntnisse über Belastungsfaktoren gewinnen.<br />
Pearlin (1987) hat sie in drei Kategorien zusammengefasst. Stellen Sie diese kurz mit Beispielen<br />
vor.<br />
3.2 Gesundheitsrisiken im Arbeitsbereich: Nennen Sie acht der am häufigsten anerkannten<br />
Berufskrankheiten (Stand: <strong>20</strong>03).<br />
<strong>20</strong> <strong>Punkte</strong><br />
12 <strong>Punkte</strong><br />
8 <strong>Punkte</strong><br />
Aufgabe 4: Gesundheitssystem<br />
4.1 In der Privaten Krankenversicherung (PKV) dominiert das Kostenerstattungsprinzip. Was<br />
kennzeichnet dieses Prinzip?<br />
4.2 Im Bereich der Rehabilitation gewinnt das Case Management zunehmend an Bedeutung.<br />
Erläutern Sie sechs Arbeitsschritte beim Case Management.<br />
4.3 Welche Auswirkungen auf den Abrechnungs- und Dokumentationsverlauf haben die <strong>20</strong>03<br />
eingeführten diagnosebezogene Fallgruppen oder auch Diagnosis Related Groups<br />
(DRG)?<br />
30 <strong>Punkte</strong><br />
3 <strong>Punkte</strong><br />
18 <strong>Punkte</strong><br />
9 <strong>Punkte</strong><br />
BG-EGG-P11-091010 © <strong>20</strong>09 <strong>HFH</strong> <strong>Hamburger</strong> <strong>Fern</strong>-<strong>Hochschule</strong> GmbH Seite 2 von 2
Studiengang<br />
Gesundheits- und Sozialmanagement<br />
Modul<br />
Einführung in das Gesundheitssystem<br />
und die Gesundheitswissenschaft<br />
Art der Leistung Prüfungsleistung<br />
Klausur-Kennzeichen BG-EGG-P11-091010<br />
Datum 10.10.<strong>20</strong>09<br />
Für die Bewertung und Abgabe der Prüfungsleistung sind folgende Hinweise verbindlich:<br />
Die Vergabe der <strong>Punkte</strong> nehmen Sie bitte so vor, wie in der Korrekturrichtlinie ausgewiesen. Eine summarische Angabe<br />
von <strong>Punkte</strong>n für Aufgaben, die in der Korrekturrichtlinie detailliert bewertet worden sind, ist nicht gestattet.<br />
Nur dann, wenn die <strong>Punkte</strong> für eine Aufgabe nicht differenziert vorgegeben sind, ist ihre Aufschlüsselung auf die einzelnen<br />
Lösungsschritte Ihnen überlassen.<br />
Stoßen Sie bei Ihrer Korrektur auf einen anderen richtigen als den in der Korrekturrichtlinie angegebenen Lösungsweg,<br />
dann nehmen Sie bitte die Verteilung der <strong>Punkte</strong> sinngemäß zur Korrekturrichtlinie vor.<br />
Rechenfehler sollten grundsätzlich nur zur Abwertung des betreffenden Teilschrittes führen. Wurde mit einem falschen<br />
Zwischenergebnis richtig weitergerechnet, so erteilen Sie die hierfür vorgesehenen <strong>Punkte</strong> ohne weiteren Abzug.<br />
Ihre Korrekturhinweise und Punktbewertung nehmen Sie bitte in einer zweifelsfrei lesbaren roten Schrift vor.<br />
Die von Ihnen vergebenen <strong>Punkte</strong> und die daraus sich gemäß dem nachstehenden Notenschema ergebende Bewertung<br />
tragen Sie bitte in den Klausur-Mantelbogen ein. Unterzeichnen Sie bitte Ihre Notenfestlegung auf dem Mantelbogen.<br />
Gemäß der Prüfungsordnung ist Ihrer Bewertung das folgende Notenschema zu Grunde zu legen:<br />
Note 1,0 1,3 1,7 2,0 2,3 2,7 3,0 3,3 3,7 4,0 5,0<br />
Punktzahl 100-95 94,5-90 89,5-85 84,5-80 79,5-75 74,5-70 69,5-65 64,5-60 59,5-55 54,5-50 49,5-0<br />
Die korrigierten Arbeiten reichen Sie bitte spätestens bis zum<br />
28.10.<strong>20</strong>09<br />
bei Ihrem Studienzentrum ein. Dies muss persönlich oder per Einschreiben erfolgen. Der Abgabetermin ist unbedingt<br />
einzuhalten. Sollte sich aus vorher nicht absehbaren Gründen eine Terminüberschreitung abzeichnen, so bitten wir Sie,<br />
dies unverzüglich dem Prüfungsamt der <strong>Hochschule</strong> anzuzeigen (Tel. 040 / 35094-311 bzw. birgit.hupe@hamburgerfh.de).<br />
BG-EGG-P11-091010 © <strong>20</strong>09 <strong>HFH</strong> <strong>Hamburger</strong> <strong>Fern</strong>-<strong>Hochschule</strong> GmbH Seite 1 von 5
Korrekturrichtlinie<br />
<strong>HFH</strong> <strong>Hamburger</strong> <strong>Fern</strong>-<strong>Hochschule</strong><br />
Lösung 1 vgl. SB 1 <strong>20</strong> <strong>Punkte</strong><br />
1.1 Analyse von subjektiven Vorstellungen von Gesundheit durch Laien (S. 14f.)<br />
Mittels empirischer Messungen sollen die Vorstellungen in der Bevölkerung über Gesundheit,<br />
Gesunderhaltung und gesunde Lebensführung, differenziert nach sozialer Schichtzugehörigkeit,<br />
Geschlecht, ethnischer Herkunft und anderen wichtigen Merkmalen erfasst werden. So kommen<br />
verschiedene subjektive Konzepte und Modellvorstellungen von Gesundheit zum Ausdruck.<br />
5 <strong>Punkte</strong><br />
Freie Beantwortung<br />
Korrekturhinweis: -Antwortbeispiel- Auch andere zutreffende Erläuterungen sind mit <strong>Punkte</strong>n<br />
zu bewerten.<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
1.2 Verstehbarkeit, Handhabbarkeit und Sinnhaftigkeit nach Antonovsky (S. <strong>20</strong>)<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Verstehbarkeit: Umschreibt das Ausmaß, in dem Reize und Situationen, mit denen man<br />
täglich konfrontiert wird, Sinn machen und kognitiv als klare, geordnete Informationen verstanden<br />
werden können.<br />
Handhabbarkeit: Meint das Ausmaß, in dem man Anforderungen, die auf einen zukommen,<br />
mit den verfügbaren Ressourcen als bewältigbar wahrnimmt.<br />
Sinnhaftigkeit: Stellt das motivationale Moment dar und bezieht sich auf das Ausmaß, in<br />
dem Leben emotional Sinn macht, d. h. in dem Probleme und Anforderungen des Lebens<br />
als solche erlebt werden, für die es sich einzusetzen lohnt.<br />
1.3 Je drei Vor- und Nachteile bei der Heranziehung subjektiver Indikatoren zur Bestimmung<br />
von Gesundheit nach Hunt (S. 29f.)<br />
.<br />
Vorteil: Persönliche Vorstellungen und Bedürfnisse können in der eigenen Sprache (anstelle<br />
vorgegebener Kategorien) zum Ausdruck gebracht werden.<br />
Vorteil: Subjektive Definitionen sind auf natürliche Weise ganzheitlich, d.h. sie umfassen<br />
körperliche, psychische und soziale Aspekte von Gesundheit.<br />
Vorteil: Subjektive Definitionen beinhalten häufig Hinweise über die Prädikatoren (Bedingungen)<br />
für Gesundheit.<br />
Nachteil: Die sprachlichen Möglichkeiten, Gesundheit subjektiv zu beschreiben, sind begrenzt.<br />
Nachteil: Subjektive Definitionen sind stark altersabhängig.<br />
Nachteil: Probleme der Validität (Gültigkeit) und Reliabilität (Zuverlässigkeit) ergeben sich<br />
aufgrund der Tatsache, dass subjektive Definitionen häufig abhängig von aktuellen Einflüssen<br />
und wenig zeitstabil sind.<br />
max. 9 <strong>Punkte</strong><br />
je 3 <strong>Punkte</strong> pro korrekter<br />
Erläuterung<br />
max. 6 <strong>Punkte</strong><br />
je 1 Punkt pro korrekter<br />
Nennung<br />
BG-EGG-P11-091010 © <strong>20</strong>09 <strong>HFH</strong> <strong>Hamburger</strong> <strong>Fern</strong>-<strong>Hochschule</strong> GmbH Seite 2 von 5
Korrekturrichtlinie<br />
<strong>HFH</strong> <strong>Hamburger</strong> <strong>Fern</strong>-<strong>Hochschule</strong><br />
Lösung 2 vgl. SB 2 30 <strong>Punkte</strong><br />
2.1 Komponenten des Gesundheitsbewusstseins nach Faltermaier (S. 10)<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Die subjektive Bedeutung und der Stellenwert von Gesundheit im Leben eines Menschen.<br />
Das subjektive Konzept oder der Begriff von Gesundheit und von den Bedingungen, die sie<br />
beeinflussen.<br />
Die Wahrnehmung des Körpers und seiner Beschwerden, die Art wie der Körper im Verhältnis<br />
zur gesamten Person gesehen wird.<br />
Die Wahrnehmung von Risiken, Gefährdungen und Belastungen für die Gesundheit in der<br />
Umwelt und im eigenen Verhalten.<br />
Die Wahrnehmung von Ressourcen für die Gesundheit in der Umwelt und in der eigenen<br />
Person.<br />
Das subjektive Konzept von Krankheit, ihren Ursachen und ihrer Beziehung zur Gesundheit.<br />
Die Art, wie Gesundheit im sozialen Kontext definiert und abgestimmt wird.<br />
2.2 Unterschiedliches Gesundheitsverhalten bzw. Gesundheitshandeln von Männern<br />
und Frauen (S. 14)<br />
Frauen<br />
gesundheitsgerechtes Verhalten,<br />
ausgeprägtes Gesundheitsbewusstsein (d.h. eine bessere Kenntnis ihres Körpers, eine<br />
größere Symptomaufmerksamkeit, eine größeres Wissen über Gesundheitsbelange),<br />
besseres Vorsorgeverhalten, gesellschaftliche Rolle als „Gesundheitsexpertin“ in der Familie,<br />
frühe Auseinandersetzung mit dem eigenen Körper,<br />
frühe und selbstverständliche Arzt-Kontakte,<br />
Beschwerden mit Krankheitswert werden eher wahrgenommen,<br />
damit verbundene Arztbesuche werden anders als bei Männern nicht als „Niederlage“ empfunden.<br />
max. 5 <strong>Punkte</strong><br />
je 1 Punkt pro korrekter<br />
Nennung<br />
max. <strong>20</strong> <strong>Punkte</strong><br />
je 2 Punkt pro korrekter<br />
Nennung<br />
Männer<br />
gesundheitlich riskantes Verhalten,<br />
geringes bis mangelndes Gesundheitsbewusstsein,<br />
gemindertes Vorsorgeverhalten - Meidung von Gesundheitsversorgungsangeboten,<br />
relativ späte Auseinandersetzung mit dem eigenen Körper,<br />
späte Arzt-Kontakte - Krankheitsbewältigung zunächst auf eigene Faust,<br />
Beschwerden mit Krankheitswert werden eher übersehen,<br />
Arztbesuche werden öfter als „Niederlage“ empfunden.<br />
Korrekturhinweis: Es sollen jeweils fünf Unterschiede genannt werden.<br />
2.3 Gesundheitsverhalten in Abhängigkeit vom Bildungsniveau (S. 26)<br />
Gesundheitliche Belastungen durch Berufstätigkeit,<br />
Verhaltensmuster bei Inanspruchnahme gesundheitsbezogener Leistungen,<br />
Fähigkeiten zur Kommunikation mit Vertretern des Gesundheitswesens,<br />
Möglichkeiten der gesunden Lebensführung,<br />
Möglichkeiten im Umgang mit Krankheit..<br />
max. 5 <strong>Punkte</strong><br />
je 1 Punkt pro korrekter<br />
Nennung<br />
BG-EGG-P11-091010 © <strong>20</strong>09 <strong>HFH</strong> <strong>Hamburger</strong> <strong>Fern</strong>-<strong>Hochschule</strong> GmbH Seite 3 von 5
Korrekturrichtlinie<br />
<strong>HFH</strong> <strong>Hamburger</strong> <strong>Fern</strong>-<strong>Hochschule</strong><br />
Lösung 3 vgl. SB 3 <strong>20</strong> <strong>Punkte</strong><br />
3.1 Drei Kategorien von Belastungsfaktoren nach Pearlin (S. 11)<br />
<br />
<br />
<br />
Kritische Lebensereignisse: z.B. der unerwartete Verlust einer wichtigen Bezugsperson,<br />
Trennung oder Scheidung, das plötzliche Eintreten einer schweren Krankheit, Arbeitsplatzwechsel<br />
oder Verlust des Arbeitsplatzes.<br />
Chronische Belastungen: z.B. Doppelbelastungen durch Arbeit und Haushalt, körperliche<br />
und psychische Belastungen in der Arbeitswelt, lang andauernde Arbeitsüberlastungen,<br />
enttäuschte Karriereerwartungen, andauernde Konflikte mit dem (Ehe-)Partner, emotionale<br />
Spannungen mit den Kindern, lang andauernde Krankheiten.<br />
Schwierige Übergänge (Transitionen) im Lebenszyklus: z.B. von der Kindheit ins Erwachsenenalter,<br />
von der Schule in die Arbeitswelt, von der Arbeitswelt in das Rentnerleben.<br />
3.2 Acht der am häufigsten anerkannten Berufskrankheiten (Stand: <strong>20</strong>03) (S. 21)<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Lärmschwerhörigkeit,<br />
Asbestose,<br />
Hauterkrankungen,<br />
Rückenbeschwerden,<br />
Silikose,<br />
Mesotheliom/Asbest,<br />
Lungen-/Kehlkopfkrebs/Asbest,<br />
Allergische Atemwegserkrankungen,<br />
Infektionserkrankungen,<br />
Bronchitis/Emphysem der Bergleute.<br />
max. 12 <strong>Punkte</strong><br />
je 1 Punkt pro korrekter<br />
Nennung einer<br />
Kategorie,<br />
je 3 <strong>Punkte</strong> für die<br />
korrekte Angabe von<br />
Beispielen<br />
max. 8 <strong>Punkte</strong><br />
je 1 Punkt pro korrekter<br />
Nennung<br />
BG-EGG-P11-091010 © <strong>20</strong>09 <strong>HFH</strong> <strong>Hamburger</strong> <strong>Fern</strong>-<strong>Hochschule</strong> GmbH Seite 4 von 5
Korrekturrichtlinie<br />
<strong>HFH</strong> <strong>Hamburger</strong> <strong>Fern</strong>-<strong>Hochschule</strong><br />
Lösung 4 vgl. SB 4 30 <strong>Punkte</strong><br />
4.1 Kostenerstattungsprinzip in der PKV (SB 4, S. <strong>20</strong>)<br />
3 <strong>Punkte</strong><br />
Der Versicherte streckt in der Regel die Summen für Behandlungen, Medikamente u.a. vor, reicht<br />
die Rechnungen ein und bekommt dann die Kosten erstattet.<br />
4.2 Sechs Arbeitsschritte beim Case Management im Bereich der Rehabilitation (SB 4, S.<br />
26)<br />
Schritt 1: Methodisch organisierte Aufnahme des Patienten.<br />
Schritt 2: Ermittlung des medizinischen oder psycho-sozialen Reha-Bedarfes.<br />
Schritt 3: Planung der konkreten Maßnahme, z.B. Motivierung des Patienten, Aufklärung<br />
und Beratung über die beabsichtigte Therapie.<br />
Schritt 4: Einleitung und Durchführung der Maßnahme, z.B. regelmäßige medizinische Beratung,<br />
psycho-soziale Betreuung.<br />
Schritt 5: Bestandsaufnahme über bisherige Erfahrungen, z.B. Prüfen und Überwachen der<br />
Reha-Schritte, Ergänzung und ggf. Korrektur der eingeleiteten Therapie.<br />
Schritt 6: Auswertung der Maßnahme und Nachbetreuung des Patienten.<br />
4.3 Auswirkungen der fallbezogenen Kopfpauschalen oder auch diagnosis related<br />
groups (DRG) (S. 47)<br />
max. 18 <strong>Punkte</strong><br />
je 3 <strong>Punkte</strong> pro korrektem<br />
Arbeitsschritt<br />
9 <strong>Punkte</strong><br />
Freie Beantwortung<br />
Zur Behandlung der verschiedenen Krankheitsbilder werden Pauschalbeträge gezahlt, mit denen<br />
die Krankenhäuser auskommen müssen und evtl. sogar Gewinn machen können bei besonders<br />
kostengünstiger Vorgehensweise. Die Krankenhausfinanzierung wechselt von der Kostenerstattung<br />
zur leistungsbezogenen Finanzierung, bei der stärker mit Budgets nach betriebswirtschaftlichem<br />
Muster gearbeitet wird.<br />
Befürworter: Leistungen können genauer dokumentiert und angemessener vergütet werden.<br />
Preisunterschiede zwischen den Krankenhäusern treten stärker zutage. Krankenkassen können<br />
Druck auf „teure“ Krankenhäuser ausüben und damit den Wettbewerb im Sinne der Versicherten<br />
stärken.<br />
Kritiker: Eher Preis- als Qualitätswettbewerb, bei dem sich die billigsten, aber nicht die besten<br />
Anbieter durchsetzen. Abrechnungen der einzelnen Leistungen erhöhen den bürokratischen Aufwand<br />
und treiben die Kosten nach oben.<br />
Korrekturhinweis: -Antwortbeispiel- Auch andere zutreffende Erläuterungen sind mit <strong>Punkte</strong>n zu<br />
bewerten.<br />
BG-EGG-P11-091010 © <strong>20</strong>09 <strong>HFH</strong> <strong>Hamburger</strong> <strong>Fern</strong>-<strong>Hochschule</strong> GmbH Seite 5 von 5