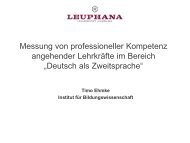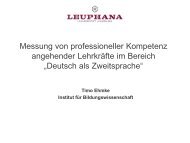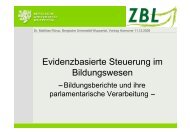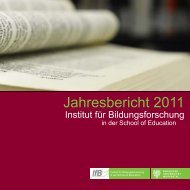wissenschaftlicher Originalliteratur - IfB
wissenschaftlicher Originalliteratur - IfB
wissenschaftlicher Originalliteratur - IfB
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Kompetenzen Studierender im Umgang mit <br />
wissenscha2licher <strong>Originalliteratur</strong> <br />
Sebas&an Schmid <br />
Universität Bielefeld
K O S W O <br />
Kompetenzen Studierender im Umgang mit <br />
wissenscha2licher <strong>Originalliteratur</strong> <br />
Sebas&an Schmid <br />
Universität Bielefeld <br />
Tobias Richter <br />
Universität Kassel <br />
Kirsten Berthold <br />
Universität Bielefeld <br />
Katherine Bruns <br />
Universität Bielefeld <br />
Sarah von der Mühlen <br />
Universität Kassel
• Wissenscha2liche <strong>Originalliteratur</strong>: <br />
Originäre wissenscha2liche Beiträge <br />
(empirisch oder theore?sch)
Wissenscha2liche <strong>Originalliteratur</strong> <br />
• Wissenscha2liche <strong>Originalliteratur</strong> (Primärliteratur): Genre mit dem Ziel <br />
der innerwissenscha2lichen Kommunika?on <br />
– Forma?v <br />
• Ar?kel in (begutachteten/nicht-‐begutachteten) Zeitchri2en <br />
• Buchkapitel in Herausgeberwerken, Monografien <br />
• Poster <br />
– Integra?v <br />
• Überblicksar?kel <br />
• Handbuchar?kel <br />
(Goldman & Biasnz, 2002)
• Lehrbuchtexte: <br />
Ziel: Bildung/Ausbildung
• Populärwissenscha2liche Texte <br />
Ziel: Popularisierung <br />
Ein Blick in die Zeitu
Kompetenter Umgang mit wissenscha2licher <br />
<strong>Originalliteratur</strong> als Bildungsziel <br />
• Wissenscha2sorien?erung Deutscher Hochschule <br />
• Wissenscha2liche Sozialisa?on durch Auseinandersetzung mit <br />
wissenscha2licher <strong>Originalliteratur</strong> <br />
– Lesen als integraler Bestandteil wissenscha2lichen Arbeitens (Norris & <br />
Phillips, 2008) <br />
– Wissenscha2stheorie: Diskurs als Erkenntniszugang <br />
• Sozialkonstruk?vis?sche und wissenssoziologische Ansätze <br />
(z.B. Latour & Woolgar, 1979) <br />
• Diskurstheorie der Wahrheit (Habermas, 2003) <br />
• Wissenscha2 aus erster Hand: Wissenscha2liche <strong>Originalliteratur</strong> als <br />
„the most authen?c and unretouched specimens of enquiry that we can <br />
obtain” (Schwab, 1962)
Kompetenter Umgang mit wissenscha2licher <br />
<strong>Originalliteratur</strong> als Bildungsziel <br />
• Kaum gezielte Vorbereitung auf den Umgang mit wissenscha2licher <br />
<strong>Originalliteratur</strong> <br />
• Wissenscha2liche <strong>Originalliteratur</strong> als Herausforderung: <br />
– Studierende als „unintended audience“ (Goldman & Bisanz, 2002) <br />
– Wissenscha2liche <strong>Originalliteratur</strong> für viele Studierende ein neues und <br />
daher vermutlich herausforderndes Genre
Überblick <br />
• Was macht wissenscha2licher <strong>Originalliteratur</strong> so schwierig? <br />
Genremerkmale wissenscha2licher <strong>Originalliteratur</strong> <br />
• Vorhandene Forschung zum Umgang Studierender mit wissenscha2licher <br />
<strong>Originalliteratur</strong> <br />
– Forschung zu Lern-‐ und Lesestrategien <br />
• Kompetenzmodell KOSWO <br />
– Exkurs: Genrewissen als Voraussetzung des kompetenten Umgangs <br />
mit wissenscha2licher <strong>Originalliteratur</strong> <br />
• Testaufgaben in KOSWO <br />
• Diskussion
Genremerkmale wissenscha2licher <strong>Originalliteratur</strong> <br />
• Hochkodifizierte strukturelle, lexikalische, seman?sche und syntak?sche <br />
Oberfächenmerkmale (z.B. Swales, 1990) <br />
– Makrostruktur <br />
– spezialisiertes Vokabular <br />
– Zitate <br />
– explizite Defini?onen <br />
• Argumenta?onsstruktur (z.B. Goldman & Bisanz, 2002; Myers, 1991; <br />
Suppe, 1998)
Argumenta?onsstruktur als Merkmal <br />
wissenscha2licher Texte <br />
• Metasprache, in der verschiedene argumenta?ve Opera?onen <br />
pragma?sch aufeinander bezogen sind (Norris & Phillips, 2007), z.B.: <br />
– Darstellung der Methode <br />
– Präsenta?on von Daten <br />
– Begründung ihrer Relevanz für die Forschungsziele der scien?fic <br />
community <br />
– Interpreta?on der Daten <br />
– Erwähnung/Widerlegung mögliche Alterna?verklärungen <br />
(Suppe, 1998)
Wissenscha2liche <strong>Originalliteratur</strong> versus <br />
Lehrbuchtexte <br />
• Lehrbuchanalysen (Myers, 1992; Penney, Norris, Phillips und Clark, 2003): <br />
– Präsenta?on wissenscha2licher Aussagen als Tatsachen <br />
– Verzicht auf einschränkende Modifikatoren (wie „vermutlich“ oder <br />
„wahrscheinlich“) <br />
– Verzicht auf argumenta?ve Begründungen
Wissenscha2liche <strong>Originalliteratur</strong> versus <br />
populärwissenscha2liche Texte <br />
• Analysen von Presseberichten (Einsiedel,1992; Mallow, 1991; Zimmerman, <br />
Bisanz, Bisanz, Klein & Klein, 2001): <br />
– Wissenscha2liche Forschung als „Erfolgsgeschichte“ <br />
– Konzentra?on auf Ergebnisse, nicht auf Methoden <br />
– kaum Grundsatzkri?k
Wissenscha2liche <strong>Originalliteratur</strong> als Herausforderung <br />
• Rezep?on erfordert <br />
– Konzeptuelles Wissen <br />
– Wissen über wissenscha2liche Diskursformen/Genrewissen (Goldman <br />
& Bisanz, 2002; Goldman & Rakestraw, 2000)
Rezep?onsprobleme bei der Lektüre wissenscha2licher <br />
<strong>Originalliteratur</strong> <br />
• mangelha2e Nutzung des Textauoaus zur Orien?erung (Armbruster, <br />
Anderson & Ostertag, 1989) <br />
• Probleme bei der Iden?fika?on wich?ger Textstellen (Dee-‐Lucas & Larkin, <br />
1986) <br />
• Schwierigkeiten bei der Iden?fika?on der argumenta?ven Funk?on von <br />
Textpassagen, z.B. als <br />
– Rechper?gung einer methodischen Entscheidung <br />
– empirischen Beleg für eine Schlussfolgerung <br />
– Schlussfolgerung aus empirischen Daten (Larson et al., 2009; Norris & <br />
Phillips, 1994; Norris, Phillips & Korpan, 2003) <br />
• Certainty bias <br />
• Verzicht auf die Nutzung text-‐externer Quelleninforma?onen wie <br />
Publika?onsorgan und Förderins?tu?on (Zimmerman et al., 2001)
Vorhandene Forschung zum Umgang Studierender mit <br />
wissenscha2licher <strong>Originalliteratur</strong> <br />
• Kompetenzmodelle zur „literacy component of scien?fic literacy“ (Yore, <br />
Bisanz, & Hand, 2003; z.B. Dole, Duffy, Roehler & Pearson, 1991; Pearson, <br />
Roehler, Dole &; Duffy, 1992; Yore, Pimm & Hsiao-‐Lin Tuan, 2007) <br />
Konzentra?on auf <br />
– Lehrbuchtexte <br />
– Schüler/innen <br />
– Naturwissenscha2liche Texte <br />
• Forschung zu Lern-‐ und Lesestrategien: Konzep?on von Lern-‐ und Lese-strategien<br />
im Studium in Anlehnung Lern-‐ und Lesestrategien in der <br />
Schule
Forschung zu Lern-‐ und Lesestrategien <br />
• Der „gute Student“/Die „gute Studen?n“... <br />
– versucht, neue Begriffe oder Theorien auf bereits bekannte Begriffe <br />
und Theorien zu beziehen <br />
– denkt sich konkrete Beispiele zu bes?mmten Lerninhalten aus <br />
– macht sich mir kurze Zusammenfassungen der wich?gsten Inhalte als <br />
Gedankenstütze <br />
– unterstreichet in Texten oder Mitschri2en die wich?gen Stellen <br />
– versucht, den Stoff so zu ordnen, dass er/sie ihn sich gut einprägen <br />
kann <br />
Organisieren, Elaborieren (vgl. LIST, Wild & Schiefele, 1994)
Forschung zu Lern-‐ und Lesestrategien <br />
• Theore?sche Erwartung: Verknüpfung der Lerninhalte miteinander und <br />
mit anderen Inhalten im LZG führt zu leichterem Abruf <br />
• Kogni?onspsychologische Experimente: Organisieren und Elaborieren <br />
verbessern die Behaltensleistung <br />
• Fragebogenuntersuchungen: Nur geringe Zusammenhänge zwischen <br />
Strategienutzung und Indikatoren des Studienerfolgs (z.B. Noten ) <br />
(zusammenfassend Wild, 2000; 2005)
Forschung zu Lern-‐ und Lesestrategien <br />
• Erklärungen für die geringe Vorhersagekra2 von Inventaren zu Lern-‐ und <br />
Lesestrategien: <br />
– Prüfungspraxis an Hochschulen belohnt qualita?v hochwer?ge <br />
Lernresultate nicht <br />
– Tatsächlicher und im Fragebogen berichteter Strategieeinsatz s?mmen <br />
nicht überein (z.B. Artelt, 1999)
Forschung zu Lern-‐ und Lesestrategien <br />
• Professionelle Leser/innen wissenscha2licher <strong>Originalliteratur</strong> (Bazerman, <br />
1985)... <br />
– lesen zielgerichtet <br />
– unterscheiden zwischen Kern-‐Lektüre („Muss man lesen“) und <br />
peripherer Lektüre <br />
– verwenden bei periphere Lektüre Strategien wie <br />
• Skimming: Gezielte Suche nach Schlüsselwörtern <br />
• Skanning: Überfliegen von Texten <br />
– nutzen Quelleninforma?onen als epistemische Heuris?ken, z.B. <br />
Autoren/innen-‐Namen: <br />
• „They are only redoing what they have been doing for the past five <br />
years. (...) I am sure the calcula?ons are right, but it is the wrong <br />
approach.“
Forschung zu Lern-‐ und Lesestrategien <br />
• Erklärungen für die geringe Vorhersagekra2 von Inventaren zu Lern-‐ und <br />
Lesestrategien: <br />
– Prüfungspraxis an Hochschulen belohnt qualita?v hochwer?ge <br />
Lernresultate nicht <br />
– Tatsächlicher und im Fragebogen berichteter Strategieeinsatz s?mmen <br />
nicht überein (Artelt, 1999) <br />
– Gängige Inventare zu Lern-‐ und Lesestrategien erfassen nicht alle <br />
Strategien, die zum kompetenten Umgang mit wissenscha2licher <br />
<strong>Originalliteratur</strong> nö?g sind. <br />
– Kontextabhängige Funk?onalität von Lesestrategien: Nicht jede <br />
Strategie ist in jeder Situa?on geeignet <br />
• Beispiel: Elaborieren und Organisieren in der Phase der <br />
Literaturrecherche
Kompetenzmodell KOSWO <br />
• Berücksich?gung eines breiten Spektrums poten?ell relevanter <br />
Teilkompetenzen <br />
– Heuris?sche Kompetenzen <br />
– Epistemische Kompetenzen <br />
• Berücksich?gung von condi?onal knowledge: Wissen über die <br />
Anwendungsbedingungen und Funk?onalität von Strategien
Kompetenzmodell KOSWO <br />
• Lesen als strategisch-‐zielgeleiteter Prozess (van Dijk & Kintsch, 1983) <br />
• Verarbeitungsziele <br />
– Rezep&ve Ziele: Tex?nhalte erfassen und behalten; <br />
Lernen als Wissensakkumula?on <br />
– Epistemische Ziele: Tex?nhalte auf ihren Wahrheitsgehalt/ihre <br />
Plausibilität überprüfen; Lernen als Erkenntnisgewinn (Richter, 2003) <br />
• Verarbeitungsstrategien <br />
– Systema&sche Strategien: Tiefenverarbeitung des Tex?nhalts <br />
– Heuris&s&sche Strategien: regelgeleitete Verarbeitung von <br />
Oberflächenmerkmalen (Pexy & Wegener, 1999)
Kompetenzmodell KOSWO <br />
Verarbeitungsziel <br />
Verarbeitungssxratregie Rezep&v Epistemisch <br />
Systema&sch <br />
Heuris&sch <br />
Rezep?v-‐systema?scher <br />
Kompetenzbereich <br />
(z.B. Organisieren) <br />
Rezep?v-‐heuris?scher <br />
Kompetenzbereich <br />
(z.B. „skimming“ zur <br />
Lokalisa?on bes?mmter <br />
Informa?on) <br />
+ Condi?onal knowledge <br />
Epistemisch-‐systema?scher <br />
Kompetenzbereich <br />
(z.B. Prüfung der <br />
argumenta?ven <br />
Konsistenz) <br />
Epistemisch-‐heuris?scher <br />
Kompetenzbereich <br />
(z.B. Nutzung von <br />
Quelleninforma?onen)
Kompetenzbereiche <br />
• Rezep&v-‐systema&sche Kompetenzen <br />
– Anreicherung oder Strukturierung von Informa?onen mit dem Ziel, sie <br />
später leicht abrufen zu können <br />
– Beispiele: Elaborieren, Organisieren <br />
– Kern der pädagogisch-‐psychologischen Forschung zu Lern-‐ und <br />
Lesestrategien (z.B. Wild & Schiefele, 1994)
Kompetenzbereiche <br />
• Rezep&v-‐heuris&sche Kompetenzen <br />
– Schnelle Sichtung des Tex?nhalts <br />
– Beispiel: „Skimming“, Überfliegen eines Texts zur Lokalisa?on <br />
bes?mmter Informa?on <br />
– Typischer Anwendungsfall: Literaturrecherche
Kompetenzbereiche <br />
• Epistemisch-‐systema&sche Kompetenzen <br />
– Prüfung der Argumenta?on des Texts auf seine S?chhal?gkeit <br />
– Iden?fika?on der funk?onalen Bestandteile der Argumente <br />
(Behauptung, Begründung; Toulmin, 1958); Beurteilung der <br />
Begründungen hinsichtlich ihrer Relevanz für die Behauptung <br />
(Larson, Brix & Kurby, 2009) <br />
– Voraussetuzung einer ra?onal begründeten Stellungnahme
Kompetenzbereiche <br />
• Epistemisch-‐heuris&sche Kompetenzen <br />
– Fällen eines schnellen (vorläufigen) Urteils über die Glaubwürdigkeit <br />
des Tex?nhalts <br />
– Beispiele: Nutzung von Quelleninforma?onen, z.B. Förderorganisa?on <br />
oder Publika?onsorgan (Korpan, Bisanz, Bisanz & Henderson, 1997) <br />
– wich?g, wenn wenn systema?sche Prozesse nicht angewendet <br />
werden können, weil <br />
• domänenspezifisches Vorwissen fehlt <br />
• mo?va?onale oder kogni?ve Ressourcen nicht zur Verfügung <br />
stehen (Richter, Schroeder & Wöhrmann, 2009).
Kompetenzbereiche <br />
• Condi&onal knowledge <br />
– Wissen darüber <br />
• Unter welchen Bedingungen und <br />
• bei welchen Ziel <br />
bes?mmte Strategien erfolgversprechend sind
Hohe Kompetenz <br />
• Studierende mit hohen Kompetenzen im Umgang mit wissenscha2licher <br />
<strong>Originalliteratur</strong> <br />
– verfügen über sämtliche Teilkompetenzen <br />
– Wissen, unter welchen Bedingungen welche Strategien <br />
erfolgversprechend sind
Kompetenzbegriff <br />
• Allgemein: Kompetenzen = (meta-‐) kogni?ve oder motorische Fähigkeiten <br />
und Fer?gkeiten (ähnlich Weinert, 2001) <br />
– mo?va?onale/emo?onale Disposi?onen nicht als eigenständige <br />
Kompetenzaspekte, sondern Moderatorvariablen für die Beziehung von <br />
Kompetenz und Performanz <br />
– Fähigkeiten und Fer?gkeiten sind durch Lernen und Training erlern-‐ bzw. <br />
verbesserbar. <br />
• Kogni?onspsychologischer Kompetenzbegriff: nicht nur psychometrische <br />
Messung individueller Unterschiede, sondern Untersuchung der <br />
zugrundeliegenden Wissensbestände und kogni?ven Prozesse (vgl. Renkl, <br />
2012)
Ziele des Projekts <br />
• Entwicklung einer elektronischen Testbaxerie, mit der mit denen die <br />
Kompetenzen Studierender in allen vier Kompetenzbereichen erfasst <br />
werden können. <br />
• Empirische Prüfung des Kompetenzmodells <br />
• Untersuchung von Genrewissen als Kompetenz-‐Voraussetzung
Genrewissenals Kompetenz-‐Voraussetzung <br />
• Genrewissen als Voraussetzung des kompetenten Umgangs mit <br />
wissenscha2licher <strong>Originalliteratur</strong> <br />
– Beispiele: <br />
Deklara?ves Wissen über <br />
die Makrostruktur wissen-scha2licher<br />
Ar?kel <br />
Skimming <br />
(analog zur Wirkung von Story Grammars beim Verstehen narra?ver <br />
Texte, Short & Ryan, 1984) <br />
„Sophis?zierte“ <br />
epistemologische <br />
Überzeugungen <br />
Prüfung der <br />
argumenta?ven <br />
Konsistenz <br />
(vgl. Richter & Schmid, 2010; Weinstock, Neuman & Glassner, 2006)
Exkurs: Genrewissen <br />
• Was wissen/vermuten Studierende über das Genre wissenscha2liche <br />
<strong>Originalliteratur</strong>? <br />
• Qualita?v-‐quan?ta?ve Studie (Schmid, Grund & Fries, in Vorbereitung) <br />
– Rekonstruk?on von Genrewissen <br />
• Fokus: Argumenta?on <br />
– Untersuchung von Zusammenhängen zwischen Genreschemata und <br />
epistemologischen Überzeugungen
Repräsenta?on von Genrewissen <br />
• Genre-‐Schemata: Erwartungen über die Merkmale von Texten eines <br />
bes?mmten Genres <br />
analog <br />
– Nachrichten-‐Superstruktur (van Dijk, 1984) <br />
– Geschichten-‐Schema (Mandler, 1985) <br />
• Funk?onen <br />
– Genre-‐Iden?fika?on <br />
– Beurteilung der Glaubwürdigkeit <br />
– Textverarbeitung <br />
– Textproduk?on
Ziele der Studie <br />
• Rekonstruk?on unterschiedlicher Genreschemata <br />
• Analyse von Zusammenhängen zwischen Genreschemata und <br />
epistemologischen Überzeugungen <br />
– Überzeugungen über Wissen und Erkenntnis <br />
(Hofer & Pintrich, 1997), z.B.: <br />
• sicheres vs. unsicheres Wissen <br />
• einfaches vs. komplexes Wissen
Genese unterschiedlicher Genreschemata <br />
• Entwicklung „sophis?zierter“ epistemologischer Überzeugungen im Lauf des <br />
Studiums (z.B. Perry, 1970) <br />
Entwicklung „sophis?zierter“ <br />
epistemologischer Überzeugungen <br />
Erwerb von Wissen über die Oberflächenmerkmale <br />
wissenscha2licher Texte <br />
Ra?onales Genreschema <br />
t
S?chprobe <br />
• 50 Studenten/innen (34 ♀, 16 ) unterschiedlicher Studiengänge <br />
• mixleres Alter: 24.3 Jahre (SD = 2.6) <br />
• Alle Teilnehmer/innen: Erfahrungen mit wissenscha2licher <br />
<strong>Originalliteratur</strong>
Ablauf <br />
• Generieren von Merkmalen <br />
• Klassifika?on der Merkmale <br />
• Erfassung epistemologischer Überzeugungen
I. Generieren von Merkmalen: Wissenscha2liche Texte <br />
• WissenschaLlicher Text <br />
z.B. theore?scher Ar?kel, empirischer Ar?kel/ <br />
Forschungsbericht, Forschungsüberblick (Review)
I. Generieren von Merkmalen: Kontrastgenres <br />
• Lehrbuchtext <br />
z.B. Schulbuchkapitel, Kapitel aus einem Universitäts-lehrbuch<br />
<br />
• PopulärwissenschaLlicher Text <br />
z.B. Ar?kel im Wissenscha2steil einer Tageszeitung, aus einem <br />
Magazin (der Spiegel, die Zeit, GEO, PM) <br />
• Poli&scher Text <br />
z.B. Leitar?kel, poli?scher Zeitungsar?kel, Kommentar <br />
signifikante Absenzen im Genreschema „wissenscha2licher Text“
I. Generieren von Merkmalen: wissenscha2liche Texte <br />
Wissenschaftlicher<br />
Text<br />
Merkmal 1<br />
Merkmal 2
I. Generieren von Merkmalen: Kontrastgenres <br />
Wissenschaftlicher<br />
Text<br />
Lehrbuchtext<br />
Populär<strong>wissenschaftlicher</strong><br />
Text<br />
Politischer<br />
Text<br />
Merkmal 1 Merkmal 3 Merkmal 6 Merkmal 8<br />
Merkmal 2 Merkmal 4 Merkmal 7<br />
Merkmal 5
I. Generieren von Merkmalen: Ergänzungen <br />
Wissenschaftlicher<br />
Text<br />
Lehrbuchtext<br />
Populär<strong>wissenschaftlicher</strong><br />
Text<br />
Politischer<br />
Text<br />
Merkmal 1 Merkmal 3 Merkmal 6 Merkmal 8<br />
Merkmal 2 Merkmal 4 Merkmal 7 Merkmal 10<br />
Merkmal 9 Merkmal 5
II. Klassifika?on der Merkmale <br />
• Ausschlussmerkmale: Merkmale, die den wissenscha2lichen Charakter des <br />
Texts in Frage stellen <br />
• Untypische Merkmale: Merkmale, die wissenscha2liche Texte selten <br />
haben, aber haben können <br />
• Typische Merkmale: Merkmale, die wissenscha2liche Texte meistens <br />
haben, aber nicht haben müssen <br />
• Kernmerkmale: Merkmale, die einen Text zu einem wissenscha2lichen <br />
Text machen
II. Klassifika?on der Merkmale <br />
Wissenschaftlicher<br />
Text<br />
Ausschlussmerkmale<br />
Untypische<br />
Merkmale<br />
Typische<br />
Merkmale<br />
Kernmerkmale<br />
Merkmal 8 Merkmal 5 Merkmal 1 Merkmal 7<br />
Merkmal 2 Merkmal 4 Merkmal 6 Merkmal 3
III. Erfassung epistemologischer Überzeugungen <br />
• Connota&ve Aspects of Epistemological Beliefs <br />
(CAEB, Stahl & Bromme, 2007) <br />
Polaritätsprofil, je 8 Items zu: <br />
– Einfaches Wissen <br />
z.B. einfach ― komplex <br />
– Sicheres Wissen <br />
z.B. sicher ― unsicher <br />
– Quelle <br />
z.B. konstruiert ― vorhanden <br />
• Bearbeitung im Hinblick auf „Wissenscha2 im Allgemeinen“ <br />
• Cronbachs α: .63 – .80.
Kategorien: Beispiele <br />
Kategorie <br />
Thema?k <br />
S?l <br />
Organisa?on <br />
Funk?on <br />
Grafische Merkmale <br />
(…) <br />
Argumenta?ve Begründung <br />
Anzahl <br />
Merkmale <br />
395 (17.4%) <br />
357 (15.7%) <br />
272 (12.0%) <br />
220 (9.7%)0 <br />
115 (5.1%)0 <br />
0 <br />
044 (1.9%)0 <br />
Anzahl <br />
Studierende <br />
49 <br />
50 <br />
43 <br />
47 <br />
43 <br />
25 <br />
Cohens κ = .86
Argumenta?ve Begründungen: Beispiele <br />
• „schlüssige Argumenta?on“ <br />
• „logische Argumenta?onskexen“ <br />
• „Belege werden genannt“ <br />
• „abwägend (Pro und Kontra)“
Argumenta?ve Begründungen <br />
N = 50<br />
25<br />
Keine Merkmale in der<br />
Kategorie argumentative<br />
Begründung<br />
25<br />
mindestens ein Merkmal<br />
in der Kategorie<br />
argumentative Begründung
Argumenta?ve Begründungen <br />
N = 50<br />
25<br />
Keine Merkmale in der<br />
Kategorie argumentative<br />
Begründung<br />
25<br />
mindestens ein Merkmal<br />
in der Kategorie<br />
argumentative Begründung<br />
11<br />
als typisches/<br />
untypisches Merkmal<br />
14<br />
Vorhandensein als Kernkriterium/<br />
Fehlen als Ausschlusskriterium
Argumenta?ve Begründungen <br />
N = 50<br />
25<br />
Keine Merkmale in der<br />
Kategorie argumentative<br />
Begründung<br />
25<br />
mindestens ein Merkmal<br />
in der Kategorie<br />
argumentative Begründung<br />
11<br />
als typisches/<br />
untypisches Merkmal<br />
Andere Genreschema (36)<br />
14<br />
Vorhandensein als Kernkriterium/<br />
Fehlen als Ausschlusskriterium<br />
Rationales Genreschema (14)
Anzahl Teilnehmern/innen, die Merkmale verschiedenen <br />
Kategorien zuordneten <br />
Kategorie <br />
Ausschluss-‐ <br />
merkmale <br />
Untypische <br />
Merkmale <br />
Typische <br />
Merkmale <br />
Kern-‐ <br />
merkmale <br />
S?l <br />
34 <br />
„Polemik“ <br />
39 <br />
„unterhaltsam“ <br />
35 <br />
„trocken“ <br />
20 <br />
„nüchterne <br />
Schreibweise“ <br />
Thema?k <br />
29 <br />
„Personen-‐ <br />
beschreibungen“ <br />
40 <br />
„Alltagsthemen“ <br />
40 <br />
„theore?sche <br />
Sachverhalte“ <br />
36 <br />
„Fakten“ <br />
Organisa?on <br />
18 <br />
„Headliner“ <br />
27 <br />
„Merkkästchen“ <br />
34 <br />
„Abstract“ <br />
17 <br />
„Ergebnisteil“
Übergreifende Themen <br />
• Wissenscha2liche <strong>Originalliteratur</strong> als empirischer Bericht <br />
– Kernmerkmale: Empirische Daten, Hypothesentests, Replizierbarkeit, <br />
Sta?s?sche Verfahren, Zahlen, Tabellen <br />
• Wissenscha2liche <strong>Originalliteratur</strong> als „Texte ohne Autor“ <br />
– Kernmerkmale: objek?v, sachlich, neutral, beschreibend <br />
– Ausschlussmerkmale: provoka?v, sarkas?sch, wertend, poli?sche <br />
Inhalte
Genreschemata und epistemologische Überzeugungen <br />
Unsicherheit<br />
(CAEB)<br />
Andere Rational<br />
Genreschmema<br />
t(48) = -2.40, p < .05, d = -0.75.
Genreschemata und epistemologische Überzeugungen <br />
Certainty/simplicity<br />
(DFEBQ)<br />
Andere Rational<br />
Genreschmema<br />
t(41.19) = 3.75, p < .001, d = 1.04.
Fazit <br />
• erster Hinweis auf die Vernachlässigung der Argumenta?onsstruktur <br />
wissenscha2licher <strong>Originalliteratur</strong> in den Genreschemata Studierender <br />
• Zusammenhänge zwischen Genreschemata und epistemologischen <br />
Überzeugungen: <br />
– Argumenta?ve Begründungen werden erst mit Einsicht in den <br />
ungewissen Charakter wissenscha2licher Erkenntnis zu einem <br />
Kernmerkmal wissenscha2licher Texte.
Einschränkungen <br />
Epistemologische Überzeugungen <br />
Genreschemata <br />
Umgang mit wissenscha2licher <strong>Originalliteratur</strong> <br />
( KOSWO)
KOSWO: Geplante Untersuchungen <br />
• Empirische Prüfung des Kompetenzmodells <br />
– Längsschnixstudie <br />
– Intensivstudie mit Experten-‐Novizen-‐Vergleich <br />
(Wissenscha2ler/innen als Experten/innen) <br />
– Trainingsexperimente
Längsschnixstudie <br />
• Studierende der Erziehungswissenscha2en, Psychologie, Soziologie und <br />
Wirtscha2swissenscha2en <br />
• 3 Messzeitpunkte <br />
– Untersuchung von Entwicklungstrends <br />
– Vorhersage von Studienleistung
Intensivstudie <br />
• Intensivstudie mit Experten-‐Novizen-‐Vergleich (Wissenscha2ler/innen als <br />
Experten/innen) <br />
– Untersuchung des prozeduralen und deklara?ven Wissens, das einer <br />
kompetenten Aufgabenbearbeitung zu Grunde liegt <br />
• Erfassung epistemologischer Überzeugungen <br />
• Erfassung von Wissen über die Makrostruktur epistemologischer <br />
Überzeugungen <br />
– Prozessanalyse mit Online-‐Indikatoren (Protokolle lauten Denkens, <br />
Reak?onszeitmessungen) und Offline-‐Indikatoren (Fragebogen und <br />
Kurzinterviews) <br />
– Validierung und kriteriale Beurteilung der Studierendenkompetenzen
Trainingsexperimente <br />
• Trainingsexperimente <br />
– Kausalanalysen zu den Wissensvoraussetzungen, die zum <br />
kompetenten Umgang mit wissenscha2licher <strong>Originalliteratur</strong> nö?g <br />
sind <br />
– Training von Kompetenzen, bei denen sich im Experten-‐Novizen-‐<br />
Vergleich Defizite auf Studierendenseite zeigen (kogni&ves <br />
Modelllernen, vgl. Jonassen, 1990) <br />
– Beispiele: <br />
• Förderung „reifer“ epistemologische Überzeugungen zum Training <br />
systema?sch-‐epistemischer Kompetenzen <br />
• Vermixlung von Wissen über den Auoau empirischer <br />
Originalarbeiten und Subgenres wissenscha2licher Original-literatur<br />
zum Training rezep?v-‐heuris?scher Kompetenzen
Konstruk?onsprinzipien <br />
• Ökologische Validität: Ähnlichkeit zwischen Testaufgaben und realer <br />
Lektüresitua?on <br />
• Kontextabhängiger Strategieeinsatz: Klare Zielvorgabe bei der Lektüre , <br />
z.T. durch Präsenta?on fik?ver Szenarien
Aufgabenbeispiele <br />
• Rezep?v-‐heuris?sche-‐Kompetenzen <br />
– Skimming <br />
– Scanning <br />
• Epistemisch-‐systema?sche-‐Kompetenzen <br />
– Erkennen von Argumenta?onsfehlern <br />
• Epistemische-‐heuris?sche-‐Kompetenzen <br />
– Nutzung von Oberflächenmerkmalen
Erfassung rezep?v-‐heuris?scher Kompetenzen: <br />
Skimming <br />
Situation<br />
Sicherlich kennen Sie die Situation, dass Sie einen Text bei einem Lerntreffen<br />
mit Kommilitonen diskutieren müssen. Aber Sie haben vergessen, den Text<br />
zu lesen und das Treffen findet in 5 Minuten statt. Deshalb haben Sie nur<br />
noch die Möglichkeit den Text zu überfliegen, um mitreden zu können.
Erfassung rezep?v-‐heuris?scher Kompetenzen: <br />
Skimming <br />
Instruktion<br />
Bitte überfliegen Sie den folgenden Text.<br />
Hierfür haben Sie 5 Minuten Zeit. Die ablaufende Zeit<br />
wird Ihnen am Bildschirm durch eine Uhr angezeigt.<br />
Nach 5 Minuten verschwindet der Text vom Bildschirm<br />
und Sie werden mehrere Fragen zu Textinhalten<br />
bekommen.<br />
Die Fragen beziehen sich auf die inhaltlichen<br />
Hauptaussagen und wichtigen Befunde im Text.
• Zeitschriftenartikel<br />
• 11 Seiten<br />
• 4 Hypothesen<br />
• Regressionsanalyse<br />
• Typische Struktur
Erfassung rezep?v-‐heuris?scher Kompetenzen: <br />
Skimming <br />
1. Das Hauptziel der Untersuchung war ... ! !!<br />
• herauszufinden, ob speziell transformationale Führung mit inspirierender<br />
Motivierung in Verbindung steht."<br />
• herauszufinden, ob speziell transformationale Führung mit individuellen<br />
Beiträgen der Mitarbeiter zum Erfolg des Ideenmanagements in Verbindung<br />
steht."<br />
• herauszufinden, ob speziell individuelle Beiträge der Mitarbeiter im<br />
Ideenmanagement mit der Verbesserungskultur einer Organisation in<br />
Verbindung steht."<br />
Bitte<br />
kreuze nur<br />
eines an!!<br />
☐"<br />
☐"<br />
☐"<br />
• Ich weiß nicht." ☐"
Erfassung rezep?v-‐heuris?scher Kompetenzen: <br />
Scanning <br />
Wie schnell finden Sie bestimmte Informationen im<br />
Text?<br />
Im Folgenden werden Sie gebeten bestimmte Informationen in einem Text zu<br />
suchen. Dieser Text wird Ihnen in Form von Hyperlinks zur Verfügung stehen.<br />
Die Hyperlinks sind gemäß der Struktur des Textes geordnet.<br />
Wenn Sie auf einen Hyperlink klicken, öffnet sich ein weiterer Link usw. Auf der<br />
Suche nach den Informationen können Sie sich also durch den Text „klicken“.
Erfassung rezep?v-‐heuris?scher Kompetenzen: <br />
Scanning <br />
Wie schnell finden Sie die Folgenden Informa8onen im Text? <br />
1. Erscheinungsjahr <br />
2. Was bedeutet „Romance of Leadership“? <br />
3. Hypothese 1b <br />
4. Geschlechterverhältnis der Führungskrä2e <br />
5. Interne Konsistenz (Cronbachs Alpha) der Skala zur Messung von RoL <br />
6. Ergebnis für Hypothese 1a <br />
7. F-‐Werte der ANOVA für die Szenarien der Ausgangssitua?on und der quan?ta?v <br />
objek?vierten Situa?on <br />
8. Limita?onen der Studie <br />
9. Rücklaufquote der Fragebögen <br />
10. Weitere Studien der Autoren Herrmann & Felfe
Erfassung rezep?v-‐heuris?scher Kompetenzen: <br />
Scanning <br />
Wichtig ist, dass Sie die Informationen so schnell wie möglich finden, das<br />
heißt, dass Sie den kürzesten Weg zu den Informationen gehen und dadurch<br />
möglichst wenige „Klicks“ brauchen.<br />
Sobald Sie die gesuchte Information gefunden haben, machen Sie einen<br />
Doppelklick auf das Wort bzw. die Textstelle mit Hilfe der Maus. Danach wird<br />
die nächste Information präsentiert, die Sie wieder so schnell wie möglich<br />
suchen und anklicken sollen.
Erfassung rezep?v-‐heuris?scher Kompetenzen: <br />
Scanning
Erfassung epistemisch-‐heuris?scher Kompetenzen: <br />
Skimming <br />
Situation<br />
Stellen Sie sich vor, Sie sollen eine wissenschaftliche Arbeit über transformationale<br />
Führung im Vergleich zu anderen Führungsstilen schreiben.<br />
Für diesen Zweck sollen Sie Literatur aussuchen, die Sie in Ihrer Arbeit<br />
verwenden können.
Erfassung epistemisch-‐heuris?scher Kompetenzen: <br />
Skimming <br />
Instruktion<br />
Im Folgenden werden Ihnen sieben Texte zum „Thema<br />
transformationale Führung“ präsentiert.<br />
Ihre Aufgabe besteht darin, so schnell wie möglich zu<br />
entscheiden, ob Sie die Texte für Vertrauenswürdig<br />
halten.<br />
Hierzu sollen Sie die Teste so schnell wie möglich<br />
überfliegen. Die Zeit reicht nicht aus, um den Text<br />
vollständig zu lesen. Sobald Sie zu einem Urteil gelangt<br />
sind, drücken Sie bitte die Leertaste. Auf der folgenden<br />
Seite können Sie Ihr Urteil abgeben:<br />
Achtung: Wenn Sie Ihre Entscheidung nach zwei<br />
Minuten nicht getroffen haben verschwindet der Text,<br />
und Sie werden um Ihre Einschätzung abzugeben.
Leertaste:<br />
Einschätzung<br />
abgeben
Für wie vertrauenswürdig halten Sie die Inhalte dieses Texts? <br />
überhaupt nicht<br />
vertrauenswürdig<br />
überhaupt nicht<br />
vertrauenswürdig
Leertaste:<br />
Einschätzung<br />
abgeben
Für wie vertrauenswürdig halten Sie die Inhalte dieses Texts? <br />
überhaupt nicht<br />
vertrauenswürdig<br />
überhaupt nicht<br />
vertrauenswürdig
Leertaste:<br />
Einschätzung<br />
abgeben
Für wie vertrauenswürdig halten Sie die Inhalte dieses Texts? <br />
überhaupt nicht<br />
vertrauenswürdig<br />
überhaupt nicht<br />
vertrauenswürdig
Leertaste:<br />
Einschätzung<br />
abgeben
Für wie vertrauenswürdig halten Sie die Inhalte dieses Texts? <br />
überhaupt nicht<br />
vertrauenswürdig<br />
überhaupt nicht<br />
vertrauenswürdig
Erfassung epistemisch-‐systema?scher Kompetenzen: <br />
Erkennen von Argumenta?onsfehlern <br />
Instruk8on <br />
Im Folgenden lesen Sie einen Text, der sich mit verschiedenen <br />
Erklärungsmodellen des Rauchens befasst. Lesen Sie den Text sorgfäl?g, um <br />
zu einer kri?sch fundierten Beurteilung über die Glaubwürdigkeit der <br />
vorgebrachten Argumente zu gelangen. Der Text wird Ihnen abschnixsweise <br />
präsen?ert. Nach jedem Textabschnix entscheiden Sie, ob Ihnen die <br />
Argumenta?onsweise dort plausibel erscheint oder ob Ihnen der jeweilige <br />
Abschnix ganz oder teilweise fragwürdig vorkommt .
Erfassung epistemisch-‐systema?scher Kompetenzen: <br />
Erkennen von Argumenta?onsfehlern <br />
Die Entwicklung zum Raucher und später ggf. auch zum Nicht-‐Mehr-‐Raucher <br />
basiert auf dem Zusammenwirken einer Vielzahl sozialer, psychologischer und <br />
biologischer Faktoren. Was die biologischen Faktoren anbelangt, so wird <br />
insbesondere durch Zwillingsstudien die Hypothese gestützt, dass sowohl bei <br />
der Ini?ierung als auch bei der Aufrechterhaltung des Rauchens gene?sche <br />
Faktoren eine nicht unerhebliche Bedeutung besitzen <br />
Leertaste: Weiter<br />
Q: Argumentationsweise nicht plausibel
Erfassung epistemisch-‐systema?scher Kompetenzen: <br />
Erkennen von Argumenta?onsfehlern <br />
Eine zentrale Rolle scheint dabei das Konstrukt der ererbten Niko?n-sensi?vität<br />
zu spielen. Dieses Konstrukt bezieht sich auf die Tatsache, dass <br />
manche Menschen sensi?ver auf Niko?n reagieren, weil sie sensibler auf <br />
Niko?n ansprechen. Mit ihm soll erklärt werden, warum manche Menschen – <br />
obwohl sie schon eine rela?v große Zahl von Zigarexen geraucht haben – <br />
nicht vom Niko?n abhängig werden und Gelegenheitsraucher bleiben bzw. <br />
wieder zum Nichtraucher werden, während andere aus der gleichen <br />
Ausgangssitua?on heraus eine hochgradige Niko?nabhängigkeit entwickeln. <br />
Leertaste: Weiter<br />
Q: Argumentationsweise nicht plausibel
Erfassung epistemisch-‐systema?scher Kompetenzen: <br />
Erkennen von Argumenta?onsfehlern <br />
Eine zentrale Rolle scheint dabei das Konstrukt der ererbten Niko?n-sensi?vität<br />
zu spielen. Dieses Konstrukt bezieht sich auf die Tatsache, dass <br />
manche Menschen sensi?ver auf Niko?n reagieren, weil sie sensibler auf <br />
Niko?n ansprechen. Mit ihm soll erklärt werden, warum manche Menschen – <br />
obwohl sie schon eine rela?v große Zahl von Zigarexen geraucht haben – <br />
nicht vom Niko?n abhängig werden und Gelegenheitsraucher bleiben bzw. <br />
wieder zum Nichtraucher werden, während andere aus der gleichen <br />
Ausgangssitua?on heraus eine hochgradige Niko?nabhängigkeit entwickeln. <br />
Leertaste: Weiter<br />
Q: Argumentationsweise nicht plausibel
Erfassung epistemisch-‐systema?scher Kompetenzen: <br />
Erkennen von Argumenta?onsfehlern <br />
Eine zentrale Rolle scheint dabei das Konstrukt der ererbten Niko?n-sensi?vität<br />
zu spielen. Dieses Konstrukt bezieht sich auf die Tatsache, dass <br />
manche Menschen sensi?ver auf Niko?n reagieren, weil sie sensibler auf <br />
Niko?n ansprechen. Mit ihm soll erklärt werden, warum manche Menschen – <br />
obwohl sie schon eine rela?v große Zahl von Zigarexen geraucht haben – <br />
nicht vom Niko?n abhängig werden und Gelegenheitsraucher bleiben bzw. <br />
wieder zum Nichtraucher werden, während andere aus der gleichen <br />
Ausgangssitua?on heraus eine hochgradige Niko?nabhängigkeit entwickeln. <br />
Bitte klicken Sie auf den Satz, den Sie unplausibel finden.
Erfassung epistemische-‐systema?scher Kompetenzen: <br />
Erkennen von Argumenta?onsfehlern <br />
• 2. Phase: Erläuterung unterschiedlicher Argumenta?onsfehler <br />
• Sie haxen folgenden Satz als nicht plausibel markiert: <br />
Dieses Konstrukt bezieht sich auf die Tatsache, dass manche Menschen <br />
sensi?ver auf Niko?n reagieren, weil sie sensibler auf Niko?n ansprechen. <br />
Welchen Argumenta?onsfehler finden Sie in diesem Satz? <br />
1. Zirkularität <br />
2. Übergeneralisierung <br />
3. Falsches Beispiel <br />
4. Kondi?onaler Schlussfehler
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! <br />
sebas?an.schmid@uni-‐bielefeld.de <br />
hxp://www.uni-‐bielefeld.de/psychologie/ae/AE12/forschung/ <br />
KOSWO/koswo.html