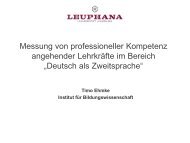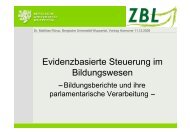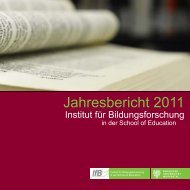DaZ-Kom - IfB
DaZ-Kom - IfB
DaZ-Kom - IfB
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Messung von professioneller <strong>Kom</strong>petenz<br />
angehender Lehrkräfte im Bereich<br />
„Deutsch als Zweitsprache“<br />
Timo Ehmke<br />
Institut für Bildungswissenschaft
Gliederung<br />
• Ausgangslage / Problemaufriss<br />
• Forschungsstand: <strong>Kom</strong>petenzen von Lehrkräften<br />
• Das BMBF-Projekt „<strong>DaZ</strong>-<strong>Kom</strong>“<br />
• Zielsetzung / Forschungsfragen<br />
• Rahmenkonzeption / Expertenbefragung<br />
• Vorgehen bei der Testentwicklung<br />
• Perspektiven<br />
2
Ausgangslage / Problemaufriss<br />
• Deutschland als Einwanderungsland für Arbeitsmigration<br />
und humanitäre Zuwanderung<br />
Zentrale Befunde aus Schulleistungsstudien:<br />
• Kinder mit Migrationshintergrund stellen einen<br />
nennenswerten Anteil der Schülerschaft an Schulen in<br />
Deutschland<br />
• Viele Kinder mit Migrationshintergrund sprechen Deutsch<br />
als Zweitsprache<br />
• Familiärer Sprachgebrauch (<strong>DaZ</strong>) ist ein<br />
erklärungsstarker Prädiktor für schulische Leistungen<br />
3
Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund<br />
in Deutschland (PISA 2009)<br />
Stanat, P., Rauch, D. & Segeritz, M. (2010): Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund. In: E. Klieme, C. Artelt, J. Hartig, N. Jude, O.<br />
Köller, M. Prenzel, W. Schneider und P. Stanat (Hrsg.), PISA 2009. Bilanz nach einem Jahrzehnt. Münster: Waxmann, S. 200-230.<br />
4
Prozentuale Anteile fünfzehnjähriger Schülerinnen und Schüler,<br />
die zu Hause Deutsch sprechen (PISA 2009)<br />
Stanat, P., Rauch, D. & Segeritz, M. (2010): Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund. In: E. Klieme, C. Artelt, J. Hartig, N. Jude, O.<br />
Köller, M. Prenzel, W. Schneider und P. Stanat (Hrsg.), PISA 2009. Bilanz nach einem Jahrzehnt. Münster: Waxmann, S. 200-230.<br />
5
Migrationsbezogenen Disparitäten in der Lesekompetenz<br />
Stanat, P., Rauch, D. & Segeritz, M. (2010): Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund. In: E. Klieme, C. Artelt, J. Hartig, N. Jude, O.<br />
Köller, M. Prenzel, W. Schneider und P. Stanat (Hrsg.), PISA 2009. Bilanz nach einem Jahrzehnt. Münster: Waxmann, S. 200-230.<br />
6
Ausgangslage / Problemaufriss<br />
• Schulische Förderung im Bereich „Deutsch als<br />
Zweitsprache“ Stiefkind der Bildungspolitik, der<br />
Wissenschaft, der Lehrerausbildung, der Schulen, …<br />
• Offenbarungseid der „additiven Förderung“?<br />
• Forderung: Sprachförderung als durchgängiges Prinzip in<br />
allen Unterrichtsfächern<br />
• Relevanz von „Bildungssprache“ im Unterricht beachten<br />
(vgl. Gogolin 2006; Ohm 2009)<br />
7
Sprache und Fachunterricht<br />
Bildungssprache<br />
Bildsprache<br />
Unterrichtssprache<br />
Fachsprache<br />
Symbolische<br />
Sprache<br />
Formalsprache<br />
„Bildungssprache ist die Sprache, die vorrangig im Bildungsbereich<br />
vorkommt und deren Beherrschung zur Teilhabe an der Bildung<br />
erforderlich ist.“ (Leisen, 2009)
Sprachsensibler Fachunterricht<br />
Sprachbezogenes Fachlernen:<br />
• Fachliches Lernen darf nicht durch (vermeidbare)<br />
sprachliche Schwierigkeiten behindert werden.<br />
Fachbezogenes Sprachlernen:<br />
• Sprachlernen im Fach ist untrennbar mit dem Fachlernen<br />
verbunden und ein eigenes Ziel an sich.<br />
Im Fachunterricht gleichermaßen und gleichzeitig die<br />
fachliche, sprachliche und kommunikative<br />
<strong>Kom</strong>petenzentwicklung der Lernenden im Blick behalten.<br />
Leisen, Josef (2011): Praktische Ansätze schulischer Sprachförderung – Der sprachsensible Fachunterricht.
Ausgangslage / Problemaufriss<br />
Forschungsdefizit im Bereich „<strong>DaZ</strong> in der Schule“:<br />
• Standards im Bereich <strong>DaZ</strong> fehlen<br />
• <strong>DaZ</strong>-Forschung bislang ausschließlich auf der Lernerund<br />
der curricularen Ebene<br />
• „Sprachsensibler Unterricht“ (Leisen 2009)<br />
fächerübergreifende professionelle <strong>DaZ</strong>-<strong>Kom</strong>petenz von<br />
LehrerInnen erforderlich<br />
13
Gliederung<br />
• Ausgangslage / Problemaufriss<br />
• Forschungsstand: <strong>Kom</strong>petenzen von Lehrkräften<br />
• Das BMBF-Projekt „<strong>DaZ</strong>-<strong>Kom</strong>“<br />
• Zielsetzung / Forschungsfragen<br />
• Rahmenkonzeption / Expertenbefragung<br />
• Vorgehen bei der Testentwicklung<br />
• Perspektiven<br />
14
Forschungsstand: <strong>Kom</strong>petenzen von<br />
LehrerInnen<br />
• Internationale Forschungen zur professionellen<br />
<strong>Kom</strong>petenzentwicklung von Lehramtsstudierenden und<br />
Referendaren<br />
Internationale Studien:<br />
• Mathematics Teaching in the 21th Century (MT 21)<br />
• Teacher Education and Development Study: Learning to<br />
Teach Mathematics (TEDS-M)<br />
• Teacher-Education and Development Study: Learning to<br />
Teach (TEDS-LT)<br />
15
Modell professioneller Handlungskompetenz<br />
Motivationale<br />
Orientierungen<br />
Überzeugungen/<br />
Werthaltungen<br />
Professionswissen<br />
Selbstregulative<br />
Fähigkeiten<br />
<strong>Kom</strong>petenzbereiche<br />
Pädagogisches<br />
Wissen<br />
Fachwissen<br />
Fachdidakt.<br />
Wisen<br />
Organisationswissen<br />
Beratungswissen<br />
<strong>Kom</strong>petenzfacetten<br />
Shulman 1985, Bromme 1992, Blömeke u.a. 2008, Krauss u. a. 2004, S. 35<br />
16
Professionelles Wissen in TEDS-LT<br />
bildungssprachlich<br />
geprägte<br />
Perspektive<br />
Blömeke u.a. (Hrsg.): <strong>Kom</strong>petenzen von Lehramtsstudierenden in gering strukturierten Domänen. Münster: Waxmann 2011.<br />
18
Beispiel-Item - TEDS-LT<br />
aus: Blömeke u.a. (Hrsg.): <strong>Kom</strong>petenzen von Lehramtsstudierenden in gering strukturierten Domänen. Münster 2011., S. 67.<br />
19
Beispiel-Item - TEDS-LT<br />
aus: Blömeke u.a. (Hrsg.): <strong>Kom</strong>petenzen von Lehramtsstudierenden in gering strukturierten Domänen. Münster 2011, S. 68.<br />
20
Leitfragen: Sprachlernen im Fachunterricht<br />
• Was sind die Merkmale der deutschen Sprache?<br />
• Wie werden Sprachen eigentlich gelernt?<br />
• Welche „Sprachen“ werden in meinem Fach benutzt?<br />
• Wie funktioniert das Sprachlernen im Fach?<br />
• Welche Sprachlernsituationen gibt es?<br />
• Welche Prinzipien muss ich unbedingt beachten?<br />
• Wie erstelle ich gute Aufgaben zum Sprachlernen?<br />
• Welche Methoden, Werkzeuge, Materialien gibt es denn?<br />
• Wie moderiere und diagnostiziere ich das Sprachlernen?<br />
• Wie mache ich Sprachförderung denn ganz konkret?<br />
• Wie integriere ich die Spracharbeit in den Fachunterricht?<br />
• Wie lerne ich das und wo nehme ich die Zeit bloß her?<br />
Leisen 2011<br />
22
<strong>Kom</strong>petenzbereiche<br />
Fragen von Fachlehrkräften zum Sprachlernen im Fachunterricht<br />
• Was sind die Merkmale der deutschen Sprache?<br />
• Wie werden Sprachen eigentlich gelernt?<br />
• Welche „Sprachen“ werden in meinem Fach benutzt?<br />
Sprach- und Spracherwerbstheorien<br />
• Wie funktioniert das Sprachlernen im Fach?<br />
• Welche Sprachlernsituationen gibt es?<br />
• Welche Prinzipien muss ich unbedingt beachten?<br />
Didaktik der Sprachbildung<br />
• Wie erstelle ich gute Aufgaben zum Sprachlernen?<br />
• Welche Methoden,<br />
Methodik<br />
Werkzeuge,<br />
der<br />
Materialien<br />
Sprachbildung<br />
gibt es denn?<br />
• Wie moderiere und diagnostiziere ich das Sprachlernen?<br />
• Wie mache ich Sprachförderung denn ganz konkret?<br />
• Wie integriere Pragmatik ich die Spracharbeit der Sprachbildung<br />
in den Fachunterricht?<br />
• Wie lerne ich das und wo nehme ich die Zeit bloß her?<br />
Leisen 2011<br />
26
Professionelles Wissen in TEDS-LT<br />
bildungssprachlich<br />
geprägte<br />
Perspektive<br />
<strong>DaZ</strong>: Erinnern &<br />
Abrufen<br />
<strong>DaZ</strong>: Verstehen<br />
und Können<br />
<strong>DaZ</strong>:<br />
Generieren von<br />
Handlungsopt. 28
Gliederung<br />
• Ausgangslage / Problemaufriss<br />
• Forschungsstand: <strong>Kom</strong>petenzen von Lehrkräften<br />
• Das BMBF-Projekt „<strong>DaZ</strong>-<strong>Kom</strong>“<br />
• Zielsetzung / Forschungsfragen<br />
• Rahmenkonzeption / Expertenbefragung<br />
• Vorgehen bei der Testentwicklung<br />
• Perspektiven<br />
29
Das BMBF-Projekt „<strong>DaZ</strong>-<strong>Kom</strong>“<br />
• BMBF-Förderschwerpunkt „<strong>Kom</strong>petenzmodellierung und<br />
<strong>Kom</strong>petenzmessung im Hochschulsektor“ (KoKoHs)<br />
• Professionelle <strong>Kom</strong>petenzen angehender LehrerInnen<br />
(Sek I) im Bereich Deutsch als Zweitsprache (<strong>DaZ</strong>-<strong>Kom</strong>)<br />
• Laufzeit: 2012 – 2015<br />
30
Projektbeteiligte<br />
• Prof. Dr. Barbara Koch-Priewe<br />
Fak. für Erziehungswissenschaft<br />
• Dr. Anne Köker<br />
Fak. für Erziehungswissenschaft<br />
• Prof. Dr. Udo Ohm<br />
Fak. für Linguistik und<br />
Literaturwissenschaft<br />
• Sonja Rosenbrock<br />
• Fak. für Linguistik und<br />
Literaturwissenschaft<br />
• Nazan Gültekin-Karakoc<br />
• Fak. für Erziehungswissenschaft<br />
• Prof. Dr. Timo Ehmke<br />
Institut für Bildungswissenschaft<br />
• Svenja Hammer<br />
Institut für Bildungswissenschaft<br />
31
Ziel der Studie<br />
• Konzeptualisierung der professionellen <strong>Kom</strong>petenzen,<br />
mit denen Lehrkräfte die <strong>DaZ</strong>-Anforderungen im<br />
fachunterrichtlichen Kontext erfolgreich bewältigen<br />
können (vgl. Blömeke/Suhl 2010)<br />
• Konzeption, Entwicklung, Überprüfung, Normierung eines<br />
<strong>Kom</strong>petenzstrukturmodells für <strong>DaZ</strong>-<strong>Kom</strong>petenzen bei<br />
(angehenden) Lehrkräften<br />
32
Forschungsfragen<br />
• Welche <strong>Kom</strong>petenzen brauchen angehende LehrerInnen, um den<br />
professionellen Anforderungen im Bereich Deutsch als Zweitsprache gerecht<br />
zu werden?<br />
• Wie kann ein Rahmenmodell von <strong>DaZ</strong>-<strong>Kom</strong>petenz beschrieben, wie kann<br />
dieses theoretisch begründet und empirisch überprüft werden?<br />
• Welche Besonderheiten ergeben sich durch die Anforderung der generischen<br />
<strong>Kom</strong>petenzmodellierung im Bereich <strong>DaZ</strong>?<br />
• Welche authentischen Fallbeispiele aus Unterrichtssituationen können in<br />
Form von Fallvignetten als Stimulusmaterial in Testaufgaben verwenden<br />
werden?<br />
Langfristige Fragestellung:<br />
• Wie müssen Lerngelegenheiten in der Lehrerausbildung beschaffen sein,<br />
damit fachlich begründbare und standardisierte <strong>DaZ</strong>-<strong>Kom</strong>petenzen erreicht<br />
werden können?<br />
33
Arbeitsplan - Übersicht<br />
Arbeitsschritte<br />
(AS)<br />
Zeitpunkt<br />
(Quartale)<br />
2/2012<br />
3/2012<br />
4/2012<br />
1/2013<br />
2/2013<br />
3/2013<br />
4/2013<br />
1/2014<br />
2/2014<br />
3/2014<br />
4/2014<br />
1/2015<br />
AS 1:<br />
Rahmenkonzeption<br />
AS 2:<br />
Item-Entwicklung<br />
AS 3:<br />
Pilotierung<br />
AS 4:<br />
Normierung<br />
AS 5:<br />
Standardisierung<br />
34
Arbeitsschritt 1.1: Dokumentenanalyse<br />
Identifizierung von relevanten Inhalten, Themen,<br />
Anforderungen für eine <strong>DaZ</strong>-Rahmenkonzeption anhand<br />
von Dokumentenanalysen:<br />
• 48 DaF/<strong>DaZ</strong>-Studiengänge (20 Bachelor-, 18 Masterund<br />
10 Zusatzstudiengänge)<br />
• Kern-/Rahmencurricula:<br />
• <strong>DaZ</strong>-Modul der Stiftung Mercator<br />
• EUCIM-TE (European Core Curriculum for Teacher<br />
Education and further Training)<br />
• BAMF (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge)<br />
• Empirische Untersuchungen <strong>DaZ</strong> im Fachunterricht<br />
35
Ergebnisse der Dokumentenanalyse<br />
Linguistik<br />
-Phonetik und Phonologie<br />
-Morphologie<br />
-Syntax<br />
-Semantik<br />
-Pragmatik<br />
-Textlinguistik<br />
-Mündlichkeit/ Schriftlichkeit<br />
-Fachsprachenlinguistik<br />
-Soziolinguistik<br />
-Kontrastive Linguistik<br />
-Kontrastsprache<br />
-Interkulturelle <strong>Kom</strong>munikation<br />
Dimensionen der<br />
Mehrsprachigkeit<br />
-Zweitspracherwerb<br />
-Individuelle Faktoren<br />
-Literacy<br />
-Migration und<br />
Mehrsprachigkeit<br />
Methodik/Didaktik<br />
-Grundlagen der Zweitsprachendidaktik<br />
-Übergang Linguistik->Didaktik<br />
-Wortschatzvermittlung<br />
-Fertigkeiten<br />
-Umgang mit Fehlern<br />
-Sprache und <strong>Kom</strong>munikation im<br />
Fachunterricht<br />
-Lehr- und Lernprozesse<br />
-Unterrichtsplanung, -gestaltung und<br />
-evaluation<br />
-Didaktisierung von Unterrichtsmaterial<br />
-Interkulturelle Didaktik<br />
-Sprachstandsdiagnostik<br />
-Praxis:<br />
Praktikum und/oder Fördermaßnahmen für<br />
SchülerInnen mit Migrationshintergrund<br />
36
Linguistik<br />
Phonetik und<br />
Phonologie<br />
- segmentale, prosodische, phonologische und phonetische Merkmale der<br />
deutschen Sprache (Standardaussprache und verschiedene Varietäten)<br />
Morphologie - Flexion<br />
- Wortbildung und Wortverbindungen<br />
- Wortschatz des Deutschen<br />
Syntax - Wortklassen<br />
- Phrasentypen und deren Aufbau<br />
- syntaktische Funktionen<br />
- Satzstrukturen<br />
- Stellungsphänomene<br />
Semantik - Wortfelder<br />
- Bedeutungs- bzw. Handlungsgehalt sprachlicher Zeichen<br />
- Sprachbedeutung von Wörtern (Lexik), Sätzen und Texten<br />
Pragmatik - Bedeutungsaushandlung<br />
- Sprechhandlungen<br />
- Sprechakttheorien<br />
- Normalitätserwartungen<br />
Textlinguistik - Textbegriff und Textualität, Textstruktur, Textthema, Textfunktion, Textsorten<br />
Interkulturelle<br />
<strong>Kom</strong>munikation<br />
- Merkmale von Interkulturalität, interkultureller <strong>Kom</strong>munikation und kulturelle<br />
Bedingungen des sprachlichen Handelns<br />
- Interkulturelle <strong>Kom</strong>munikation in Bezug auf Sprachkontakt/Kulturkontakt<br />
- sprachliche und kulturelle Normen – Einsichten in die Kulturbedingtheit<br />
kommunikativen Handelns in der Ziel- und in der Ausgangssprache<br />
- Analyse von <strong>Kom</strong>munikationssituationen zwischen Personen<br />
unterschiedlicher Kulturen<br />
37
Linguistik<br />
Mündlichkeit/Schriftlichkeit -<br />
Grundzüge der Besonderheiten gesprochener und geschriebener<br />
Sprache<br />
Fachsprachenlinguistik - Beschäftigung mit den sprachlichen Merkmalen und<br />
Besonderheiten von Fachsprachen<br />
- linguistische Aspekte fachsprachlicher <strong>Kom</strong>munikation<br />
Soziolinguistik - Fragestellungen, Theorien, Konzepte, Methoden der Soziolinguistik<br />
- Sprache in ihrer gesellschaftskonstitutiven Funktion<br />
- Sprache als Mittel der <strong>Kom</strong>munikation<br />
- Sprache unter dem Gesichtspunkt ihrer grundlegenden<br />
Existenzweisen und Erscheinungsformen (als regional, sozial,<br />
situativ bedingte Sprachgebrauchsformen)<br />
Kontrastive Linguistik - Kontrastierung und linguistische Analyse von Deutsch und<br />
- Migrantensprachen in den Bereichen Phonetik/Phonologie,<br />
Wortbildung, Syntax, Lexikologie, Pragmatik<br />
- grammatische Besonderheiten ausgewählter Herkunftssprachen im<br />
interlingualen Vergleich<br />
Kontrastsprache - Erwerb grundlegender <strong>Kom</strong>petenzen (A1) einer <strong>DaZ</strong>-relevanten<br />
Kontrastsprache, die aktuell für mehrsprachige Kinder in<br />
Deutschland Familiensprachen sind<br />
38
Dimensionen der Mehrsprachigkeit<br />
Zweitspracherwerb - Einführung in Theorien, Modelle und Hypothesen des Erst- und<br />
Zweitspracherwerbs<br />
- Lernbiologische Grundlagen<br />
- Unterschiede zwischen dem Erwerb von Erst-, Fremd- und Zweitsprachen<br />
- Erwerbsszenarien: ungesteuerter/natürlicher vs. gesteuerter Spracherwerb;<br />
simultan vs. sukzessiv und kindlich vs. erwachsen<br />
- Erwerbsparameter: Verlauf, Geschwindigkeit, Resultat, Variation<br />
- Erwerbstypische Spracherhebungsverfahren<br />
- Transferphänomene von L1 nach L2 unter Berücksichtigung der Herkunfts-<br />
/Migrantensprachen<br />
- entwicklungspsychologische Prozesse im (früh)kindlichen und<br />
erwachsenen Erst- und Zweitspracherwerb<br />
- Meilensteine sprachlicher Entwicklung<br />
- Analysen zu Lernersprachen<br />
- Zweitspracherwerb aus der Lernerperspektive<br />
Individuelle<br />
Faktoren<br />
- Inter- und intraindividuelle Unterschiede<br />
- Lernertypen<br />
- wesentliche Merkmale von Lernervarietäten<br />
39
Dimensionen der Mehrsprachigkeit<br />
Literacy - Literacymodelle<br />
- Lesesozialisation: Rechtsschreiben, Aufsatz-Unterricht, kreatives und<br />
funktionales Schreiben<br />
- Family literacy<br />
- Anbahnung von Literalität<br />
- Scaffolding Konzept<br />
Migration und<br />
Mehrsprachigkeit<br />
- Sensibilisierung für Mehrsprachigkeit und für das Leben in multikulturellen<br />
Gesellschaften<br />
- politische, gesellschaftliche und kulturelle Rahmenbedingungen des <strong>DaZ</strong>-<br />
Lernens/-Lehrens<br />
- Zusammenhänge zwischen Migration, kultureller Differenz,<br />
Fremdheitserfahrung und Integration<br />
- Dimensionen der Kulturbedingtheit von kommunikativem Handeln<br />
- soziopolitische Relevanz von <strong>DaZ</strong> und dessen Förderung im<br />
bildungspolitischen Kontext<br />
- sprachliche Vielfalt in Gesellschaft und Schule<br />
- Entwicklung des Deutschunterrichts im Rahmen der Zuwanderung<br />
40
Didaktik/Methodik<br />
Grundlagen der<br />
Zweitsprachendidaktik<br />
Übergang Linguistik-<br />
Didaktik<br />
- Theorien, Methoden und Konzepte der Methodik/ Didaktik des<br />
zweitsprachlichen Unterrichts<br />
- aktuelle, zukunftsweisende Tendenzen und Konzepte z. B.<br />
Mehrsprachigkeitsdidaktik<br />
- linguistische Teilgebiete unter didaktischer Perspektive<br />
- Beschreibung eines linguistische Gegenstandsbereichs und seines<br />
Erwerbs und die didaktischen Planung und Umsetzung von<br />
Förderinterventionen<br />
- Grundbegriffe der deutschen Grammatik sowie deren Vermittlung im<br />
Unterricht<br />
Wortschatzvermittlung - Wortschatzerwerb und -vermittlung<br />
- Vermittlungsprobleme der Wortschatzarbeit<br />
Fertigkeiten - spielerische und kreative Übungen sowie Förderungen zum Lesen,<br />
Schreiben, Sprechen in der Zweitsprache<br />
Umgang mit Fehlern - Fehler, Fehleranalyse und Fehlerkorrektur; Fehlerdiagnose und -<br />
therapie<br />
- angemessenes Korrekturverhalten im Hinblick auf sprachliche und<br />
fachliche Förderung<br />
41
Methodik/Didaktik<br />
Sprache und<br />
<strong>Kom</strong>munikation im<br />
Fachunterricht<br />
- Grundlagen der Vermittlung von Fachsprachen/ Didaktik der<br />
Fachsprachen<br />
- Spezifik der Schul- und Unterrichtssprache<br />
- Merkmale fachsprachlich geprägter Unterrichtskommunikation und die<br />
Verbindung von sprachlichem und fachlichem Lernen im Fachunterricht<br />
einschließlich der für die jeweiligen Unterrichtsfächer typischen<br />
fachsprachlichen Handlungen wie Beschreiben, Berichten, Erklären<br />
- Charakteristika institutioneller und fachsprachlicher <strong>Kom</strong>munikation in<br />
ein- und mehrsprachiger <strong>Kom</strong>munikation<br />
- sprachliche Fertigkeiten (Lesen, Hören, Schreiben, Sprechen,<br />
Interagieren) und ihre Förderung im Fachunterricht<br />
- fachsprachliche Handlungsfähigkeit von mehrsprachigen Schülern<br />
Lehr- und<br />
Lernprozesse<br />
- unterrichtliche und außerunterrichtliche Lehr- und Lernprozesse und<br />
Einfluss von internen und externen Faktoren<br />
- Reflexion eigener Lernprozesse, zum Beispiel Sprachlernerfahrung (als<br />
Lernende) und Reflexion der Konsequenzen für den späteren Unterricht<br />
(als Lehrkraft)<br />
- Faktoren im Lehr- und Lerngeschehen (z.B.: Autonomes Lernen,<br />
Binnendifferenzierung, Lehrmethoden, Lernstile, Motivation)<br />
42
Methodik/Didaktik<br />
Unterrichtsplanung,<br />
-gestaltung und -<br />
evaluation<br />
Didaktisierung von<br />
Unterrichtsmaterial<br />
- Einführung in Grundlagen der Unterrichtsbeobachtung<br />
- zentrale Faktoren und Konzepte zur Planung, Entwicklung, Durchführung<br />
und Reflexion von Unterricht „Deutsch als Zweitsprache“<br />
- Probleme der Unterrichtsgestaltung<br />
- Unterrichtsmethoden, Lehr-/Lernstile<br />
- didaktische Grundlagen des mediengestützten Zweitsprachenlernens<br />
- Unterrichtsinteraktion/Interaktionsverhalten<br />
- textsortenorientierte Didaktik<br />
- Einsatz und Analyse von Sachtexten<br />
- Schreiben von einfachen und inhaltlich komplexen Texten<br />
- Entwicklung von Unterrichtsmaterialien<br />
Interkulturelle Didaktik -<br />
Praxis:<br />
Praktikum und/oder<br />
Fördermaßnahmen für<br />
SchülerInnen mit<br />
Migrationshintergrund<br />
praktische Vorbereitung auf die mehrsprachige und multikulturelle Schulund<br />
Sprachlern-Realität<br />
- Umgang mit kultureller Heterogenität im Unterricht: interkulturelle<br />
<strong>Kom</strong>petenzen im Lehr- und Lernkontext<br />
- interkulturelle Aspekte und deren Auswirkungen auf den Unterricht sowie<br />
auf die Bildung und Ausbildung von Kindern und Jugendlichen mit<br />
Migrationshintergrund<br />
- berufspraktische Erfahrungen sowie die Einführung in die Förderpraxis<br />
und deren Reflexion: aktuelle Förderansätze werden in einer Praxisphase<br />
in Schule kennengelernt, indem Förderung selbst umgesetzt oder die<br />
Umsetzung durch Hospitationen beobachtet wird.<br />
- Sprachförderung im Sekundarbereich: entweder fachintegrative<br />
Sprachförderung oder reiner <strong>DaZ</strong>-Sprachunterricht mit Einzelpersonen<br />
oder in der Gruppe/Förderklasse<br />
- Förderunterricht und die Konsequenzen für die <strong>DaZ</strong>-Lehrerausbildung in<br />
allen Sachfächern<br />
43
Methodik/Didaktik<br />
Sprachstandsdiagnostik - Verfahren des Testens und Prüfens sowie der<br />
Sprachstandsfeststellung<br />
- Überblick über den internationalen Forschungsstand der<br />
Sprachstandsdiagnostik und der Zweisprachigkeitsdiagnostik<br />
- Standards und Planungsmodelle (z.B.: Nationale und internationale<br />
Curricula, Testen, Prüfen, Evaluieren)<br />
- einschlägige sprachbezogene Förder- und Integrationsmaßnahmen<br />
für Kinder, Jugendliche mit Migrationshintergrund<br />
- Auseinandersetzung mit dem aktuellen Stand der <strong>DaZ</strong>-<br />
Sprachförderung im Sekundarbereich<br />
- Einzelfallstudie: Individuelle Diagnose und Förderung<br />
- differenzierte Formen der Sprachförderung in heterogenen<br />
Lerngruppen: Zielkompetenzen/Standards,<br />
Diagnostik/Lernstandbestimmung, Entwicklungsphänomene/-<br />
prozesse, Vermittlungs-/Förderungsaspekte<br />
44
Arbeitsschritt 1.2: Expertenreview<br />
Review der Ergebnisse der Dokumentenanalyse durch <strong>DaZ</strong>-Experten<br />
Methode:<br />
• Interviews mit N = 7 <strong>DaZ</strong>-Expertinnen und -Experten<br />
• Offene Fragestellung: „Welche Bereiche gehören für Sie zur <strong>DaZ</strong>-<br />
<strong>Kom</strong>petenz angehender Lehrkräfte?“<br />
• Rating der Wichtigkeit für alle Themenbereiche:<br />
1 = sehr wichtig, 2 = eher wichtig, 3 = eher unwichtig, 4 = unwichtig<br />
Zielsetzung:<br />
• Auswahl von relevanten Inhalten und Themenbereichen für die <strong>DaZ</strong>-<br />
Rahmenkonzeption<br />
• Sammlung von Ideen für Testitems<br />
45
Bewertung der Wichtigkeit im Teilbereich „Linguistik“<br />
Linguistik<br />
MW SD Min Max<br />
Mündlichkeit/Schriftlichkeit 1.14 0.38 1 2<br />
Morphologie 1.29 0.76 1 3<br />
Syntax 1.29 0.76 1 3<br />
Semantik 1.43 0.53 1 2<br />
Pragmatik 1.57 0.79 1 3<br />
Textlinguistik 1.57 0.98 1 3<br />
Interkulturelle <strong>Kom</strong>munikation 2.00 0.82 1 3<br />
Fachsprachenlinguistik 2.29 1.11 1 4<br />
Konstrastive Linguistik 2.33 0.52 2 3<br />
Konstrastsprache 2.50 0.55 2 3<br />
Soziolinguistik 2.86 1.07 1 4<br />
Phonetik/Phonologie 3.29 0.49 3 4<br />
Globalbewertung 1.71 0.49 1 2<br />
1 = sehr wichtig, 2 = eher wichtig, 3 = eher unwichtig, 4 = unwichtig<br />
46
Bewertung der Wichtigkeit im Teilbereich<br />
„Didaktik & Methodik“<br />
Didaktik und Methodik<br />
MW SD Min Max<br />
Wortschatzvermittlung 1.00 0.00 1 1<br />
Sprache und <strong>Kom</strong>munikation im Fachunterricht 1.00 0.00 1 1<br />
Grundlagen Zweitsprachendidaktik 1.14 0.38 1 2<br />
Lehr- und Lernprozesse 1.14 0.38 1 2<br />
Didaktisierung von Unterrichtsmaterial 1.17 0.41 1 2<br />
Sprachstandsdiagnostik 1.17 0.41 1 2<br />
Unterrichtsplanung, -gestaltung, -evaluation 1.43 1.13 1 4<br />
Teilbereich Praxis 1.50 0.55 1 2<br />
Umgang mit Fehlern 1.71 1.11 1 4<br />
Interkulturelle Didaktik 2.17 0.75 1 3<br />
Fertigkeiten 2.33 1.37 1 4<br />
Übergang Linguistik-Didaktik 2.80 1.30 1 4<br />
Globalbewertung 1.00 0.00 1 1<br />
1 = sehr wichtig, 2 = eher wichtig, 3 = eher unwichtig, 4 = unwichtig<br />
47
Bewertung der Wichtigkeit im Teilbereich<br />
„Mehrsprachigkeit“<br />
Dimensionen der Mehrsprachigkeit MW SD Min Max<br />
Zweitspracherwerb 1.14 .38 1 2<br />
Literacy 1.29 .49 1 2<br />
Migration und Mehrsprachigkeit 1.43 .79 1 3<br />
Individuelle Faktoren 2.00 .71 1 3<br />
Globalbewertung 1.71 .76 1 3<br />
1 = sehr wichtig, 2 = eher wichtig, 3 = eher unwichtig, 4 = unwichtig<br />
48
Kodiererübereinstimmung / Bivariate Korrelationen<br />
Rater 1 Rater 2 Rater 3 Rater 4 Rater 5 Rater 6 Rater 7<br />
Rater 1 1 ,696 ** ,694 ** ,275 ,447 * ,540 ** ,366<br />
Rater 2 1 ,653 ** ,265 ,625 ** ,283 ,336<br />
Rater 3 1 ,432 * ,538 ** ,561 ** ,344<br />
Rater 4 1 ,458 * ,217 -,082<br />
Rater 5 1 ,316 ,202<br />
Rater 6 1 ,457 *<br />
Rater 7 1<br />
49
Arbeitsschritt 1.3: <strong>DaZ</strong>-Rahmenkonzeption<br />
(Arbeits-)Definition:<br />
<strong>DaZ</strong>-<strong>Kom</strong>petenz (in der Schule) beschreibt die Fähigkeit einer<br />
Lehrkraft,<br />
sprachliche wie auch kulturelle Eigenheiten der deutschen<br />
Sprache zu kennen.<br />
Auf Grundlage spracherwerbstheoretischen Wissens sind<br />
Lehrkräfte in der Lage, fachrelevante Materialien auf didaktischmethodischer<br />
Ebene für die Schüler_innen mit <strong>DaZ</strong> förderwirksam<br />
zu bearbeiten und einzusetzen.<br />
Zudem sind sie sich ihrer Aufgabe als Sprachförderlehrkraft im<br />
Fachunterricht bewusst und lassen sich in ihrem Handeln nicht von<br />
Vorurteilen leiten.<br />
50
Arbeitsschritt 1.3: <strong>DaZ</strong>-Rahmenkonzeption<br />
<strong>DaZ</strong>-<strong>Kom</strong>petenz<br />
Wissen<br />
erinnern und<br />
abrufen<br />
Verstehen<br />
und<br />
Anwenden<br />
Generieren von<br />
Handlungsoptionen<br />
Linguistik<br />
Didaktik /<br />
Methodik<br />
Mehrsprachigkeit<br />
Inhaltsbereiche<br />
50
<strong>DaZ</strong>-<strong>Kom</strong>petenz im Inhaltsbereich<br />
„Linguistik“<br />
Linguistik<br />
Morphologie Syntax Semantik Pragmatik<br />
Textlinguistik<br />
Mündlichkeit/<br />
Schriftlichkeit<br />
Fachsprachenlinguistik<br />
Kontrastive<br />
Linguistik<br />
Interkulturelle<br />
<strong>Kom</strong>munikation<br />
52
<strong>DaZ</strong>-<strong>Kom</strong>petenz im Inhaltsbereich<br />
„Linguistik“<br />
<strong>DaZ</strong>-<strong>Kom</strong>petenz im Bereich „Linguistik“ umfasst …<br />
• Sprache als omnipräsentes Zeichensystem wahrnehmen<br />
(Morphologie).<br />
• sprachliche Ausprägungen in Fachaufgaben und<br />
Fachtexten erkennen.<br />
• Gemeinsamkeiten und Unterschiede verschiedener<br />
Sprachen kennen<br />
• Merkmale interkultureller <strong>Kom</strong>munikation kennen<br />
53
<strong>DaZ</strong>-<strong>Kom</strong>petenz im Inhaltsbereich<br />
„Didaktik & Methodik“<br />
Didaktik & Methodik<br />
Wortschatzvermittlung<br />
Sprache und<br />
<strong>Kom</strong>munikation<br />
Grundlagen<br />
Zweitsprachendid.<br />
Lehr- und<br />
Lernprozesse<br />
Didaktisierung von<br />
Unterrichtsmaterial<br />
Sprachstandsdiagnostik<br />
Unterrichtsplanung,<br />
-gestaltung<br />
Teilbereich Praxis<br />
Umgang mit<br />
Fehlern<br />
Interkulturelle<br />
Didaktik<br />
Fertigkeiten<br />
54
<strong>DaZ</strong>-<strong>Kom</strong>petenz im Inhaltsbereich<br />
„Didaktik & Methodik“<br />
<strong>DaZ</strong>-<strong>Kom</strong>petenz im Bereich „Didaktik & Methodik“ umfasst<br />
…<br />
• …Fachtexte sprachförderwirksam bearbeiten bzw. geeignetes<br />
Unterrichtsmaterial unter Berücksichtigung der <strong>DaZ</strong>-Spezifik erstellen.<br />
• … im Unterricht angemessen mit Sprachfehlern von <strong>DaZ</strong>-Kindern<br />
umgehen können.<br />
• … Sprachschwierigkeit bei Schülerinnen und Schüler mit <strong>DaZ</strong><br />
diagnostizieren können.<br />
55
<strong>DaZ</strong>-<strong>Kom</strong>petenz im Inhaltsbereich<br />
„Mehrsprachigkeit“<br />
Mehrsprachigkeit<br />
Zweitspracherwerb<br />
Individuelle<br />
Faktoren<br />
Literacy<br />
Migration und<br />
Mehrsprachigkeit<br />
56
<strong>DaZ</strong>-<strong>Kom</strong>petenz im Inhaltsbereich<br />
„Mehrsprachigkeit“<br />
<strong>DaZ</strong>-<strong>Kom</strong>petenz im Bereich „Mehrsprachigkeit“ umfasst …<br />
• Merkmale des Zweitspracherwerbs (Transferphänomene,<br />
Unterschiede zum Erstspracherwerb, Erwerbssequenzen,<br />
Erwerbsverläufe) kennen.<br />
• Kulturbedingtheit von kommunikativen Handlungen kennen.<br />
• Unter Berücksichtigung der Merkmale des Zweitspracherwerbs<br />
förderwirksamen Unterricht gestalten und Kulturbedingtheiten von<br />
kommunikativen Handlungen ggf. thematisieren.<br />
57
Arbeitsschritt 2 – Item-Entwicklung<br />
Zielsetzung der Itementwicklung:<br />
• Finale Testdauer: 60 min<br />
• Bearbeitungszeit: ca. 2 Minuten pro Unit<br />
• 30 Units à 3 Items = 90 Items<br />
• Hohe Messgenauigkeit ausreichend viele leichte und<br />
schwere Items<br />
• Entwicklung der doppelten Itemzahl ca. 180 Items<br />
59
Schulbuchbeispiel: Aufgabe „Leiter“<br />
Beispielaufgabe<br />
Damit eine Leiter beim Besteigen nicht nach hinten umkippt, darf ihr Neigungswinkel<br />
nicht größer als 80° sein.<br />
a) Wie hoch reicht eine 6m lange Leiter, die an einer Mauer steht?<br />
b) Rapunzels Turmfenster befindet sich in einer Höhe von 9m über dem Boden. Die<br />
Leiter des Prinzen ist 10m lang. Kann der Prinz seine Liebste gefahrlos retten?<br />
c) Wie weit ist eine ordnungsgemäß aufgestellte, 2m lange Leiter maximal von der<br />
Wand entfernt?<br />
Homrighausen, Heike (2010): 200 Textaufgaben wie in der Schule. Stuttgart: Klett. S. 107.<br />
60
Schulbuchbeispiel: Aufgabe „Leiter“<br />
Beispielaufgabe<br />
Damit eine Leiter beim Besteigen nicht nach hinten umkippt, darf ihr Neigungswinkel<br />
nicht größer als 80° sein.<br />
a) Wie hoch reicht eine 6m lange Leiter, die an einer Mauer steht?<br />
b) Rapunzels Turmfenster befindet sich in einer Höhe von 9m über dem Boden. Die<br />
Leiter des Prinzen ist 10m lang. Kann der Prinz seine Liebste gefahrlos retten?<br />
c) Wie weit ist eine ordnungsgemäß aufgestellte, 2m lange Leiter maximal von der<br />
Wand entfernt?<br />
1. Welche Besonderheit ist in der Syntax des Einleitungssatzes erkennbar?<br />
a) Die Verbzweitstellung wurde nicht beachtet.<br />
b) Es handelt sich um 2 Nebensätze.<br />
c) Der Hauptsatz folgt dem Nebensatz.<br />
Homrighausen, Heike (2010): 200 Textaufgaben wie in der Schule. Stuttgart: Klett. S. 107.<br />
61
Schulbuchbeispiel: Aufgabe „Leiter“<br />
Beispielaufgabe<br />
Damit eine Leiter beim Besteigen nicht nach hinten umkippt, darf ihr Neigungswinkel<br />
nicht größer als 80° sein.<br />
a) Wie hoch reicht eine 6m lange Leiter, die an einer Mauer steht?<br />
b) Rapunzels Turmfenster befindet sich in einer Höhe von 9m über dem Boden. Die<br />
Leiter des Prinzen ist 10m lang. Kann der Prinz seine Liebste gefahrlos retten?<br />
c) Wie weit ist eine ordnungsgemäß aufgestellte, 2m lange Leiter maximal von der<br />
Wand entfernt?<br />
2. Welche mögliche Problematik ergibt sich für einen <strong>DaZ</strong>-Lerner beim Verb<br />
„reichen“?<br />
______________________________________________________________________<br />
______________________________________________________________________<br />
62
Beispielaufgabe<br />
Schulbuchbeispiel: Aufgabe „Leiter“<br />
Damit eine Leiter beim Besteigen nicht nach hinten umkippt, darf ihr Neigungswinkel<br />
nicht größer als 80° sein.<br />
a) Wie hoch reicht eine 6m lange Leiter, die an einer Mauer steht?<br />
b) Rapunzels Turmfenster befindet sich in einer Höhe von 9m über dem Boden. Die<br />
Leiter des Prinzen ist 10m lang. Kann der Prinz seine Liebste gefahrlos retten?<br />
c) Wie weit ist eine ordnungsgemäß aufgestellte, 2m lange Leiter maximal von der<br />
Wand entfernt?<br />
3. Welche Informationen bräuchte ein Lerner mit <strong>DaZ</strong>, um die<br />
Teilaufgabe b) inhaltlich verstehen zu können? Kreuzen Sie jeweils an.<br />
Die mathematische Formel <br />
Erklärung, dass Rapunzel ein Mensch ist <br />
Erklärung, dass es sich hierbei um ein Märchen handelt <br />
Erklärung, dass Rapunzel und die Liebste die selbe Person sind <br />
ja<br />
nein<br />
63
Schulbuchbeispiel: Aufgabe „Leiter“<br />
Beispielaufgabe<br />
Damit eine Leiter beim Besteigen nicht nach hinten umkippt, darf ihr Neigungswinkel<br />
nicht größer als 80° sein.<br />
a) Wie hoch reicht eine 6m lange Leiter, die an einer Mauer steht?<br />
b) Rapunzels Turmfenster befindet sich in einer Höhe von 9m über dem Boden. Die<br />
Leiter des Prinzen ist 10m lang. Kann der Prinz seine Liebste gefahrlos retten?<br />
c) Wie weit ist eine ordnungsgemäß aufgestellte, 2m lange Leiter maximal von der<br />
Wand entfernt?<br />
4. Wie könnte man die Frage in b) umformulieren, um eine klarere<br />
Aufgabenstellung zu erlangen?<br />
_______________________________________________________________<br />
_______________________________________________________________<br />
64
Arbeitsschritt 2 – Item-Entwicklung<br />
Arbeitsschritte bei der Testentwicklung:<br />
• Konstruktion und Sammlung von Fallvignetten<br />
• Aufgabenerstellung<br />
• Internes Aufgabenreview<br />
• Eliminierung bzw. Überarbeitung Items mit<br />
unzureichenden psychometrischen Kennwerten<br />
• Expertenrating: Passung der Items zur<br />
Rahmenkonzeption<br />
66
Arbeitsschritt 3: Pilotierung<br />
Cognitive Labs<br />
Überarbeitung der Items<br />
Weiteres Vorgehen<br />
Vorbereitung und Durchführung der Pilotstudie<br />
(N = 100 Personen pro Item)<br />
Bereinigung Aufgabenpool bzw. Überarbeitung Items<br />
Finale Item-Auswahl<br />
67
Arbeitsschritt 4: Normierung<br />
Weiteres Vorgehen<br />
Vorbereitung und Erhebung an einer „Normstichprobe“<br />
Auswertung und Skalierung der Items<br />
Arbeitsschritt 5: Standardisierung<br />
Standardsetting durch Expertengruppe<br />
Dokumentation der <strong>Kom</strong>petenzstandards und des<br />
Testinstrumentes<br />
68
Perspektiven<br />
Zweite Forschungsphase <strong>DaZ</strong>-<strong>Kom</strong> II:<br />
• Einsatz des Messinstrumentes und Validierung<br />
• Individuelle Bedingungsfaktoren und Lerngelegenheiten<br />
von <strong>DaZ</strong>-<strong>Kom</strong>petenz<br />
• Schlussfolgerungen für universitäre Lehre<br />
69
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!<br />
70