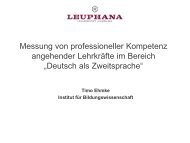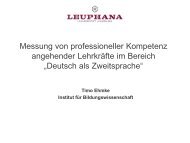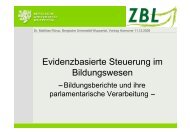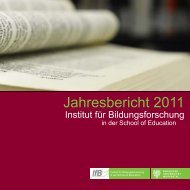Informationen zu Prüfungen im Rahmen von Modul 3 (EWS III ... - IfB
Informationen zu Prüfungen im Rahmen von Modul 3 (EWS III ... - IfB
Informationen zu Prüfungen im Rahmen von Modul 3 (EWS III ... - IfB
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Prof. Dr. Cornelia Gräsel<br />
Prof. Dr. Susanne Buch<br />
Dr. Sabine Backes (ehem. Franiek)<br />
Dr. Kerstin Göbel<br />
Dr. Judith Schellenbach-Zell<br />
Institut für Bildungsforschung in der<br />
School of Education<br />
<strong>Informationen</strong> <strong>zu</strong> <strong>Prüfungen</strong> <strong>im</strong> <strong>Rahmen</strong> <strong>von</strong> <strong>Modul</strong> 3 (<strong>EWS</strong> <strong>III</strong>) des MEd 07<br />
(Stand: SS 11)<br />
Insgesamt sind <strong>im</strong> dritten <strong>Modul</strong> 16 Leistungspunkte (LP) nach<strong>zu</strong>weisen. Das <strong>Modul</strong> 3 besteht aus<br />
zwei Teilbereichen (<strong>EWS</strong> <strong>III</strong>.1 und <strong>EWS</strong> <strong>III</strong>.2). In JEDEM Teilbereich sind 6 LP <strong>zu</strong> erwerben. Diese 6 LP<br />
werden in der Regel über den Besuch einer Vorlesung (2 LP, Pflichmodulteil, jeweils <strong>Modul</strong>teil a) und<br />
den Besuch eines Seminars (4 LP, Wahlpflichtbereich) in jedem Teilbereich erworben (<strong>im</strong> gesamten<br />
<strong>Modul</strong> also 4 Veranstaltungen). Die <strong>Modul</strong>abschlussprüfung (4 LP) wird nur in einem (wählbaren)<br />
Teilbereich (<strong>EWS</strong> <strong>III</strong>.1 oder <strong>EWS</strong> <strong>III</strong>.2) abgelegt (siehe <strong>Modul</strong>beschreibungen).<br />
Die folgenden Erläuterungen beziehen sich auf <strong>Prüfungen</strong> bei den o.g. Prüferinnen<br />
(Prüfungsberechtigte in <strong>Modul</strong> <strong>III</strong> finden Sie hier).<br />
Erwerb <strong>von</strong> Leistungspunkten. Die Bedingungen <strong>zu</strong>m Erwerb der Leistungspunkte in Seminaren<br />
werden <strong>von</strong> den jeweiligen Dozenten bzw. Dozentinnen <strong>zu</strong> Beginn jeder Lehrveranstaltung bekannt<br />
gegeben. Der Nachweis der an die Vorlesungen gebundenen Leistungspunkte wird ENTWEDER <strong>im</strong><br />
<strong>Rahmen</strong> einer schriftlichen Lernkontrolle <strong>im</strong> <strong>Rahmen</strong> der Vorlesung (Abschlussklausur) ODER <strong>im</strong><br />
<strong>Rahmen</strong> der <strong>Modul</strong>abschlussprüfung (MAP) erbracht. Das bedeutet: Sie müssen für den Teilbereich<br />
(<strong>III</strong>.1 oder <strong>III</strong>.2), in dem Sie die MAP ablegen, KEINE Abschlussklausur für die diesem Teilbereich<br />
<strong>zu</strong>geordnete Pflichtvorlesung schreiben. Dies sei noch einmal an einem Beispiel erläutert:<br />
Sie belegen die Vorlesungen <strong>III</strong>.1a (Lerntheoretische Grundlagen) und <strong>III</strong>.2a (Grundlagen der<br />
Pädagogischen Diagnostik). Zusätzlich erwerben Sie in einem Seminar in <strong>III</strong>.1 und einem Seminar in<br />
<strong>III</strong>.2 jeweils 4 Leistungspunkte. Sie entscheiden sich für eine MAP <strong>im</strong> Teilbereich <strong>III</strong>.1 – das bedeutet,<br />
dass Sie die Vorlesungsklausur <strong>zu</strong>r VL „Lerntheoretische Grundlagen“ nicht schreiben müssen (da die<br />
Inhalte in der MAP abgeprüft werden), sondern „nur“ die Klausur <strong>zu</strong>r VL „Grundlagen der<br />
Pädagogischen Diagnostik“.<br />
<strong>Modul</strong>abschlussprüfung (MAP). (Folgende Ausführungen gelten gleichermaßen für die MAP in <strong>III</strong>.1<br />
wie in <strong>III</strong>.2).Die MAP wird <strong>im</strong> <strong>Rahmen</strong> einer Klausur (120 min) abgelegt. Inhaltlich bezieht sich die<br />
MAP sowohl auf die Inhalte der jeweiligen Pflichtvorlesung des gewählten <strong>Modul</strong>teilbereichs<br />
(„Grundlagen“) als auch auf einen frei <strong>zu</strong> wählendes spezielleres Thema („Wahlthema“). Diese<br />
Wahlthemen sind in der Regel mit den Themen der angebotenen Seminare <strong>im</strong> jeweiligen Teilbereich<br />
verknüpft bzw. an diese Themen angelehnt. Eine Liste mit den Wahlthemen finden Sie <strong>im</strong> Anschluss<br />
an die allgemeinen <strong>Informationen</strong>. Die Klausur umfasst unterschiedliche Aufgabentypen (offene und<br />
geschlossene Antwortformate). Der Schwerpunkt liegt auf dem Grundlagenbereich (Gewichtung: 2/3<br />
Grundlagen <strong>zu</strong> 1/3 Wahlbereich).<br />
<strong>IfB</strong> / Wahlthemen <strong>Modul</strong> <strong>EWS</strong> <strong>III</strong> MEd07/ Stand: SS11 1
Sie haben die MAP insgesamt bestanden, wenn Sie in jedem Bereich („Grundlagen“ und<br />
„Wahlthema“) mindestens die Hälfte der Punkte erzielt haben (und damit insgesamt die Hälfte der<br />
Punktzahl). Die Note wird auf Grundlage der Gesamtleistung best<strong>im</strong>mt. Bei bestandener MAP wird<br />
Ihnen <strong>im</strong> Anschluss der erfolgreiche Besuch der Pflichtvorlesung in dem <strong>Modul</strong>strang (<strong>III</strong>.1 oder <strong>III</strong>.2),<br />
in dem Sie die MAP abgelegt haben, bescheinigt.<br />
Die Aufgaben für die MAP sowohl in <strong>Modul</strong> <strong>III</strong>.1 als auch in <strong>Modul</strong> <strong>III</strong>.2 werden <strong>von</strong> den o.g.<br />
Prüferinnen gemeinsam erstellt, d.h. alle, die sich für ein best<strong>im</strong>mtes Wahlthema entscheiden,<br />
erhalten die gleiche Aufgabenstellung für dieses Thema und alle erhalten <strong>im</strong> allgemeinen Teil<br />
(Grundlagen) des jeweiligen Teilbereichs <strong>III</strong>.1 bzw. <strong>III</strong>.2 die gleiche Aufgabenstellung. Eine spezielle<br />
Absprache mit den Prüferinnen über Themen ist daher nicht erforderlich. Auch bei der Korrektur<br />
werden wir uns die Arbeit nach inhaltlicher Kompetenz teilen – unabhängig da<strong>von</strong>, bei wem Sie sich<br />
<strong>zu</strong>r Prüfung angemeldet haben. Kurz: wir versuchen die Konzeption und Auswertung so <strong>zu</strong> gestalten,<br />
dass die Ergebnisse der MAP möglichst unabhängig da<strong>von</strong> sind, bei wem Sie sich <strong>zu</strong>r Prüfung<br />
gemeldet haben.<br />
Anmeldung <strong>zu</strong>r <strong>Modul</strong>abschlussprüfung. Die Anmeldung be<strong>im</strong> Prüfungsamt erfolgt über WUSEL.<br />
Eine vorherige Absprache mit den Prüferinnen ist nicht erforderlich. Die aktuellen Termine für die<br />
MAPs finden Sie auf den Seiten des <strong>IfB</strong>. Neben der Anmeldung be<strong>im</strong> Prüfungsamt ist eine Anmeldung<br />
(<strong>zu</strong>r Festlegung des Wahlthemas) be<strong>im</strong> <strong>IfB</strong> erforderlich: Die Entscheidung für ein Wahlthema erfolgt<br />
über eine Abst<strong>im</strong>mung <strong>im</strong> moodle-Kurs <strong>zu</strong>r MAP. Über diesen Kurs erfolgt auch eine<br />
Benachrichtigung, mit der Sie <strong>zu</strong>r Entscheidung für ein Wahlthema in einem best<strong>im</strong>mten Zeitraum<br />
aufgefordert werden Eine Liste mit Zuordnung Matrikelnummer / Wahlthema wird spätestens eine<br />
Woche vor der Prüfung <strong>im</strong> moodle-Kurs <strong>zu</strong>r MAP online sein, bitte kontrollieren Sie dort noch einmal,<br />
ob die Zuordnung st<strong>im</strong>mt bzw. ob Sie sich erfolgreich angemeldet haben und wenden sich ggfs. bei<br />
Problemen an Frau Schreiner (Sekretariat Prof. Buch). Bei Abgabe der Abst<strong>im</strong>mung sollten Sie sich für<br />
ein Wahlthema entschieden haben, ein Wechsel des Wahlthemas ist nach Abst<strong>im</strong>mung nur in<br />
Ausnahmefällen möglich. Sie sollten sich frühzeitig in diesem moodle-Kurs anmelden, um Zugang <strong>zu</strong><br />
Nachrichten, Literatur etc. <strong>zu</strong> haben. Das Passwort erhalten Sie in den Pflichtvorlesungen in <strong>Modul</strong> <strong>III</strong>,<br />
alternativ können Sie dieses auch bei den Mitarbeiter/innen in der Scheinausgabe erfragen. Den<br />
Kurs finden Sie in moodle <strong>im</strong> Kursbereich <strong>von</strong> Prof. Buch: „MAP <strong>Modul</strong> <strong>EWS</strong> <strong>III</strong> MEd 07“. (Dieser Kurs<br />
wird <strong>von</strong> allen Prüferinnen in <strong>Modul</strong> <strong>III</strong> genutzt). Die Einschreibung in den Kurs ist ab dem 25.05.11<br />
möglich.<br />
Literatur <strong>zu</strong> den Wahlthemen. Diese steht teilweise online <strong>zu</strong>r Verfügung, teilweise <strong>im</strong><br />
Semesterapparat bzw. <strong>im</strong> Präsenzbestand der UB. <strong>Informationen</strong> bzw. eingestellte Texte sind <strong>im</strong><br />
moodle-Kurs verfügbar.<br />
Literatur <strong>zu</strong>m allgemeinen Teil (Grundlagen). Geprüft werden die in der dem jeweiligen Teilbereich<br />
<strong>zu</strong>geordneten Pflichtvorlesung vermittelten Kenntnisse (bezogen auf die Inhalte und Lehrziele der<br />
Vorlesungen). Literaturempfehlungen werden <strong>im</strong> <strong>Rahmen</strong> der Vorlesung bekannt gegeben.<br />
Grundlage für die MAP sind jeweils die Inhalte der aktuellsten Vorlesung (die Vorlesungsinhalte<br />
ändern sich <strong>von</strong> Semester <strong>zu</strong> Semester nicht wesentlich, aber durch Terminverschiebungen etc.<br />
können sich leichte Änderungen ergeben). Wer sich über die aktuellsten Inhalte informieren möchte,<br />
kann <strong>im</strong> moodle-Kurs <strong>zu</strong>r MAP das Passwort für die aktuellen moodle-Kurse <strong>zu</strong> den Vorlesungen<br />
abrufen und sich dort einbuchen.<br />
<strong>IfB</strong> / Wahlthemen <strong>Modul</strong> <strong>EWS</strong> <strong>III</strong> MEd07/ Stand: SS11 2
Prüfungsergebnisse. Diese werden ebenfalls <strong>im</strong> moodle-Kurs <strong>zu</strong>r MAP veröffentlicht. Prinzipiell<br />
haben die Prüferinnen 8 Wochen Zeit <strong>zu</strong>r Bewertung der Klausuren. Wir sind <strong>im</strong>mer bemüht, diese<br />
Zeit nicht aus<strong>zu</strong>schöpfen, können dies aber nicht garantieren, da die Schnelligkeit der Korrektur u.a.<br />
<strong>von</strong> der allgemeinen Prüfungsbelastung (z.B. Anzahl der MAPn) abhängt. In Hinblick auf Ihre<br />
Studienplanung ist <strong>zu</strong> empfehlen, dass Sie mit den vollen 8 Wochen Korrekturzeit rechnen. Wenn die<br />
Ergebnisse feststehen werden Sie über moodle benachrichtigt. Sie können die Ergebnisse auch auf<br />
dem schwarzen Brett vor dem Sekretariat in S 15.01. einsehen.<br />
<strong>IfB</strong> / Wahlthemen <strong>Modul</strong> <strong>EWS</strong> <strong>III</strong> MEd07/ Stand: SS11 3
Wahlthemen und Literatur <strong>zu</strong> den Wahlthemen für die<br />
<strong>Modul</strong>abschlussprüfungen in <strong>Modul</strong> 3.1 des MEd 07: Lernen,<br />
Entwicklung, Interaktion (Stand SS 2011)<br />
A. Grundlagen des Lernens<br />
Was sollten Sie können?<br />
• Sie kennen die Grundzüge folgender Grundmodelle des Lernens:<br />
o Behavioristische Ansätze (operantes Konditionieren und seine Anwendung in der<br />
Schule),<br />
o Kognitivistische Ansätze (und Instructional Design),<br />
o Konstruktivistische Lerntheorien (und ihre Umset<strong>zu</strong>ng in Lernumgebungen).<br />
• Sie kennen Gedächtnismodelle und können Konsequenzen für die Gestaltung <strong>von</strong> Lehr- und<br />
Lernprozessen ziehen.<br />
• Sie können begründen, warum Vorwissen für das Lernen bedeutsam ist.<br />
• Sie kennen die wichtigsten Einflussfaktoren auf den Transfer/die Anwendung <strong>von</strong> Gelerntem<br />
und können daraus Konsequenzen für die Unterrichtsgestaltung ziehen.<br />
Literatur:<br />
Bransford, J. D., Brown, A. L. & Cocking, R. R. (2000). How people learn. Brain, mind, experience, and<br />
school. Washington: National Academy Press.<br />
Gruber, H. & Stamouli, E. (2009). Intelligenz und Vorwissen. In E. Wild & J. Möller (Hrsg.),<br />
Pädagogische Psychologie (S. 27-47). Heidelberg: Springer Medizin Verlag.<br />
Hasselhorn, M. & Gold, A. (2006). Pädagogische Psychologie. Erfolgreiches Lehren und Lernen.<br />
Stuttgart: Kohlhammer. (Daraus S. 35-65)<br />
Renkl, A. (2009). Wissenserwerb. In E. Wild & J. Möller (Hrsg.), Pädagogische Psychologie (S. 3-26).<br />
Heidelberg: Springer Medizin Verlag.<br />
Stern, E. (2006). Lernen. Was wissen wir über erfolgreiches Lernen in der Schule? Pädagogik, 58 (1),<br />
45-49.<br />
B. Selbstreguliertes Lernen (selbstgesteuertes Lernen)<br />
Was sollten Sie können?<br />
• Sie können den Begriff des selbstgesteuerten Lernens in Zusammenhang mit anderen<br />
Begriffen des Lernens definieren.<br />
• Sie kennen die wichtigen Vorausset<strong>zu</strong>ngen des selbstgesteuerten Lernen:<br />
o Kognitive Vorausset<strong>zu</strong>ngen,<br />
o Metakognitive Vorausset<strong>zu</strong>ngen,<br />
o Motivationale Vorausset<strong>zu</strong>ngen .<br />
• Sie wissen, wie man diese Vorausset<strong>zu</strong>ngen bei der Gestaltung <strong>von</strong> Lernumgebungen<br />
berücksichtigt.<br />
<strong>IfB</strong> / Wahlthemen <strong>Modul</strong> <strong>EWS</strong> <strong>III</strong> MEd07/ Stand: SS11 4
• Sie können Möglichkeiten der Förderung selbstgesteuerten Lernens auf den Unterricht<br />
anwenden.<br />
Literatur:<br />
Boekaerts, M. & Corno, L. (2005). Self-regulation in the classroom: A perspective on assessment and<br />
intervention. Applied Psychology: An international review, 54, 199–231.<br />
Brunstein, J. C. & Spörer, C. (2010). Selbstgesteuertes Lernen. In D. H. Rost (Hrsg.), Handwörterbuch<br />
Pädagogische Psychologie (S. 622-629). Weinhe<strong>im</strong>: Beltz.<br />
Landmann, M., Perels, F., Otto, B. & Schmitz, B. (2009). Selbstregulation. In E. Wild & J. Möller<br />
(Hrsg.), Pädagogische Psychologie (S. 49-72). Heidelberg: Springer Medizin Verlag.<br />
Leutner, D. & Leopold, C. (2006). Selbstregulation be<strong>im</strong> Lernen mit Sachtexten. In H. Mandl & H. F.<br />
Friedrich (Hrsg.), Handbuch Lernstrategien (S. 162-171). Göttingen: Hogrefe.<br />
Otto, B., Perels, F. & Schmitz, B. (2011). Selbstreguliertes Lernen. In H. Reinders, H. Ditton, C. Gräsel<br />
& B. Gniewosz (Hrsg.), Empirische Bildungsforschung: Gegenstandsbereiche (S. 33-44).<br />
Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.<br />
Schober, B. & Ziegler, A. (2001). Das Münchner Motivationstraining (MMT): Theoretischer<br />
Hintergrund, Förderziele und exemplarische Umset<strong>zu</strong>ng. Zeitschrift für Pädagogische<br />
Psychologie, 15, 168-180.<br />
C. Lehrer-Schüler-Interaktion<br />
Was sollten Sie können?<br />
• Sie kennen Problemfelder und Handlungsmöglichkeiten der Lehrer-Schüler-Interaktion<br />
(Schülerstereotype, Machthierarchie in der L-S-Beziehung).<br />
• Sie wissen, welche Merkmale die Lehrer-Schüler-Kommunikation auszeichnet.<br />
• Sie kennen die Bedeutung <strong>von</strong> Peerbeziehungen für Kinder und Jugendliche.<br />
• Sie kennen die Funktion und die möglichen Probleme (z.B. Außenseitertum, Bullying) <strong>von</strong><br />
Peerbeziehungen in der Schule.<br />
• Sie können soziale Kompetenz definieren.<br />
Literatur:<br />
Fend, H. (2006). Neue Theorie der Schule. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften. [Daraus: S. 56-<br />
96]<br />
Kessels, U. & Hannover, B. (2009). In E. Wild & J. Möller (Hrsg.), Pädagogische Psychologie (S. 283-<br />
304). Heidelberg: Springer Medizin Verlag.<br />
Schweer, M. (2008) (Hrsg.). Lehrer-Schüler-Interaktion, Inhaltsfelder, Forschungsperspektiven und<br />
methodische Zugänge. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften. [Daraus: Teil 1.1, 1.4, 1.5,<br />
1.7, 1.8 und Kapitel 2]<br />
Ulich, K. (2001). Sozialpsychologie der Schule. Weinhe<strong>im</strong>: Beltz.<br />
<strong>IfB</strong> / Wahlthemen <strong>Modul</strong> <strong>EWS</strong> <strong>III</strong> MEd07/ Stand: SS11 5
D. Fähigkeitsselbstkonzept und Attributionen<br />
Was sollten Sie können?<br />
• Sie können zentrale Begriffe des Themenkomplexes definieren.<br />
• Sie können die Grundprinzipien zentraler Attributionstheorien und attributionale Theorien<br />
darstellen und kritisch bewerten.<br />
• Sie können Beziehungen zwischen den Konstrukten „Fähigkeitsselbstkonzept“ und<br />
„Attribution“ <strong>zu</strong> anderen relevanten Konstrukten der Lern und Leistungsmotivation <strong>im</strong><br />
<strong>Rahmen</strong> allgemeiner Theorien der Lernmotivation herstellen.<br />
• Sie können theoretische Annahmen/empirische Befunde <strong>zu</strong> Faktoren und Prozessen, die die<br />
Genese <strong>von</strong> Kausalattributionen beeinflussen, darstellen und kritisch bewerten.<br />
• Sie können Auswirkungen <strong>von</strong> Fähigkeitsselbstkonzepten und Attributionen auf Lern- und<br />
Leistungsverhalten beschreiben.<br />
• Sie können Erkenntnisse der Forschung <strong>zu</strong> Fähigkeitsselbstkonzepten und Attributionen auf<br />
Probleme der Förderung <strong>von</strong> Lern und Leistungsmotivation <strong>im</strong> Unterricht anwenden.<br />
Literatur:<br />
Meyer, W.-U. (2003). Einige grundlegende Annahmen und Konzepte der Attributionstheorie.<br />
Universität Bielefeld: Zugriff am 3.5.2011 http://www.unibielefeld.de/psychologie/ae/AE02/LEHRE/Attributionstheorie.pdf<br />
Möller, J. (2008). Lernmotivation. In A. Renkl (Hrsg.), Lehrbuch Pädagogische Psychologie (S. 263-<br />
298). Bern: Huber.<br />
Möller, J. (2010). Attributionen. In D.H. Rost (Hrsg.), Handwörterbuch Pädagogische Psychologie (4.<br />
Aufl., S. 38-45). Beltz: PVU.<br />
Möller, J. & Trautwein, U. (2009). Selbstkonzept. In E. Wild & J. Möller (Hrsg.). Pädagogische<br />
Psychologie (S. 179- 204). Berlin: Springer.<br />
Moschner, B. & Dickhäuser, O. (2010). Selbstkonzept. In D.H. Rost (Hrsg.), Handwörterbuch<br />
Pädagogische Psychologie (4. Aufl., S. 760–767). Weinhe<strong>im</strong>: Beltz.<br />
Ziegler, A. & Schober, B. (2001). Theoretische Grundlagen und praktische Anwendungen <strong>von</strong><br />
Reattributionstrainings. Regensburg: Roderer.<br />
E. Intrinsische Motivation und Interesse<br />
Was sollten Sie können?<br />
• Sie können zentrale Begriffe des Themenkomplexes definieren.<br />
• Sie können Beziehungen zwischen dem Konstrukt „Interesse“ und anderen relevanten<br />
Konstrukten der Lern und Leistungsmotivation <strong>im</strong> <strong>Rahmen</strong> allgmeiner Theorien der<br />
Lernmotivation herstellen.<br />
• Sie können die Grundprinzipien zentraler Theorien <strong>zu</strong>r intrinsischen Motivation darstellen<br />
und kritisch bewerten.<br />
• Sie können theoretische Annahmen und empirische Befunde <strong>zu</strong> Faktoren und Prozessen, die<br />
die Genese intrinsischer Motivation / die Genese <strong>von</strong> Interesse beeinflussen darstellen und<br />
kritisch bewerten.<br />
<strong>IfB</strong> / Wahlthemen <strong>Modul</strong> <strong>EWS</strong> <strong>III</strong> MEd07/ Stand: SS11 6
• Sie können Erkenntnisse der Forschung <strong>zu</strong> intrinsischer Motivation /<strong>zu</strong> schulischen Interessen<br />
auf Probleme der Förderung <strong>von</strong> Lernmotivation <strong>im</strong> Unterricht anwenden.<br />
Literatur:<br />
Deci, E. & Ryan, R. (1993). Die Selbstbest<strong>im</strong>mungstheorie der Motivation und ihre Bedeutung für die<br />
Pädagogik. Zeitschrift für Pädagogik, 39, 223-238.<br />
Krapp, A. (1998). Entwicklung und Förderung <strong>von</strong> Interessen <strong>im</strong> Unterricht. Psychologie in Erziehung<br />
und Unterricht, 45, 186-203.<br />
Krapp, A. (2010). Interesse. In D.H. Rost (Hrsg.), Handwörterbuch Pädagogische Psychologie (4. Aufl.,<br />
S. 311–323). Weinhe<strong>im</strong>: Beltz.<br />
Rheinberg, F. (2010). Intrinsische Motivation und Flow-Erleben. In J. Heckhausen & H. Heckhausen<br />
(Hrsg.), Motivation und Handeln (4. Aufl., S. 365-387). Heidelberg: Springer.<br />
Schiefele, U. & Köller, O. (2010). Intrinsische und Extrinsische Motivation. In D.H. Rost (Hrsg.),<br />
Handwörterbuch Pädagogische Psychologie (4. Aufl., S. 336–344). Weinhe<strong>im</strong>: Beltz.<br />
Schiefele, U. & Streblow, L. (2005). Intrinsische Motivation - Theorien und Befunde. In R. Vollmeyer &<br />
J. C. Brunstein (Hrsg.), Motivationspsychologie und ihre Anwendung (S. 39-58). Stuttgart:<br />
Kohlhammer.<br />
F. Aggression und Gewalt in der Schule<br />
Was sollten Sie können?<br />
• Sie können zentrale Begriffe des Themenkomplexes definieren.<br />
• Sie können die Grundprinzipien zentraler (sozial-)psychologischer Aggressionstheorien<br />
darstellen und diese theoretischen Ansätze kritisch bewerten.<br />
• Sie können personale, situative und soziale Faktoren beschreiben, die aggressives Verhalten<br />
beeinflussen.<br />
• Sie können Möglichkeiten der Prävention und Intervention bei Problemen mit Gewalt <strong>im</strong><br />
schulischen Kontext darstellen und bezüglich des theoretischen Hintergrunds und der<br />
empirischen Bewährung kritisch bewerten.<br />
Literatur:<br />
Busch, L. & Todt, E. (2010). Aggression in der Schule. In D. H. Rost (Hrsg.), Handwörterbuch<br />
Pädagogische Psychologie (4. Aufl., S. 1-8). Weinhe<strong>im</strong>: Beltz: PVU.<br />
Nolting, H. P. (1997). Lernfall Aggression. Wie sie entsteht, wie sie <strong>zu</strong> vermindern ist. Reinbek:<br />
Rowohlt.<br />
Nolting, H. P. & Knopf, H. (1998). Gewaltverminderung in der Schule: Viele Vorschläge – wenig<br />
Studien. Psychologie in Erziehung und Unterricht, 45, 249-260.<br />
Olweus, D. (1999). Täter-Opfer-Probleme in der Schule: Erkenntnisstand und<br />
Interventionsprogramm. In H. G. Holtappels, W. Heitmeyer, W. Melzer & K.-J. Tillmann (Hrsg.),<br />
Forschung über Gewalt an Schulen (S. 281-298). Weinhe<strong>im</strong>: Juventa.<br />
<strong>IfB</strong> / Wahlthemen <strong>Modul</strong> <strong>EWS</strong> <strong>III</strong> MEd07/ Stand: SS11 7
Petermann F. & Natzke, H. (2008). Aggressives Verhalten in der Schule. Zeitschrift für Pädagogik, 54,<br />
532-554.<br />
Schubarth, W. (2010). Gewalt und Mobbing an Schulen: Möglichkeiten der Prävention und<br />
Intervention. Stuttgart: Kohlhammer.<br />
G. Entwicklungspsychologie des Jugendalters: Eltern, Peers und schulischer<br />
Kontext<br />
Was sollten Sie können?<br />
• Sie können zentrale Begriffe des Themenkomplexes definieren.<br />
• Sie können Grundprinzipien und –annahmen relevanter psychologischer Theorien der<br />
Adoleszenz darstellen und kritisch bewerten.<br />
• Sie können das Konzept der Entwicklungsaufgabe erklären und können zentrale<br />
Entwicklungsaufgaben des Jugendalters darstellen.<br />
• Sie können charakteristische Entwicklungen <strong>im</strong> Jugendalter (z.B. Umbau sozialer<br />
Beziehungen) vor dem Hintergrund empirischer Befunde und relevanter Theorien<br />
beschreiben.<br />
• Sie können Faktoren und Prozesse beschreiben, die die Persönlichkeitsentwicklung und die<br />
Entwicklung sozialer Beziehungen in der Adoleszenz (soziale Beziehungen <strong>zu</strong> Eltern und<br />
Peers, Identität, schulische Leistungsbereitschaft) beeinflussen.<br />
• Sie kennen die Bedeutung des schulischen Kontextes für die Entwicklung <strong>im</strong> Jugendalter.<br />
• Sie können Ihre Kenntnisse <strong>zu</strong>r Entwicklungspsychologie des Jugendalters auf Probleme des<br />
Unterrichts in der Sekundarstufe anwenden.<br />
Literatur:<br />
Cortina, K. S. & Köller, O. (2008). Kontext: Schule. In R. Silbereisen & M. Hasselhorn (Hrsg.),<br />
Entwicklungspsychologie des Jugendalters (S. 229-254). Göttingen: Hogrefe.<br />
Fend, H. (2003). Entwicklungspsychologie des Jugendalters (3. Aufl.). Heidelberg: VS Verlag für<br />
Sozialwissenschaften. (→daraus Kap.3.5)<br />
Flammer, A., & Alsaker, F. D. (2002). Entwicklungspsychologie der Adoleszenz: Die Erschließung<br />
innerer und äußerer Welten <strong>im</strong> Jugendalter. Bern.: Huber. (→daraus Teil I und Teil <strong>III</strong>)<br />
Oerter, R. & Dreher, E. (2008). Jugendalter. In R. Oerter & L. Montada (Hrsg.),<br />
Entwicklungspsychologie (6. Aufl., S. 271-332). Weinhe<strong>im</strong>: BeltzPVU.<br />
H. Kommunikation<br />
Was sollten Sie können?<br />
• Sie können zentrale Begriffe des Themenkomplexes definieren.<br />
• Sie können die Grundprinzipien ausgewählter allgemeiner und psychologischer<br />
Kommunikationstheorien darstellen und diese kritisch bewerten.<br />
• Sie können gelungene und nicht gelungene interpersonale Kommunikationen vor dem<br />
Hintergrund psychologischer Kommunikationstheorien analysieren.<br />
• Sie können Formen der interpersonalen Kommunikation und deren Funktion unterscheiden.<br />
<strong>IfB</strong> / Wahlthemen <strong>Modul</strong> <strong>EWS</strong> <strong>III</strong> MEd07/ Stand: SS11 8
• Sie können Faktoren beschreiben, die die Kommunikation zwischen Personen und Gruppen<br />
beeinflussen.<br />
Literatur:<br />
Flammer, A. (2001). Einführung in die Gesprächspsychologie. Bern: Huber. (→daraus Kapitel 6)<br />
Forgas, J.P. (1999). Soziale Interaktion und Kommunikation.(4. Aufl.) Weinhe<strong>im</strong>: PVU. (→daraus<br />
Kap.7, 8, 9)<br />
Frindte, W. (2001). Einführung in die Kommunikationspsychologie. Weinhe<strong>im</strong>: Beltz.<br />
Retter, H. (2002). Studienbuch Pädagogische Kommunikation (2. Aufl.). Bad Heilbrunn / Obb.<br />
Klinkhardt. (→daraus Kap.4.1 – 4.4; 5.7)<br />
<strong>IfB</strong> / Wahlthemen <strong>Modul</strong> <strong>EWS</strong> <strong>III</strong> MEd07/ Stand: SS11 9
Wahlthemen und Literatur <strong>zu</strong> den Wahlthemen für die<br />
<strong>Modul</strong>abschlussprüfungen in <strong>Modul</strong> 3.2 des MEd 07: Pädagogische<br />
Diagnostik (Stand SS 2011)<br />
A. Assessment for Learning: Portfolio und Lerntagebuch<br />
Was sollten Sie können?<br />
Sie sollten…<br />
� zentrale Begriffe des Themenkomplexes definieren können;<br />
� Funktionen formativer Leistungsbeurteilung kennen;<br />
� verschieden Formen <strong>von</strong> Portfolioaufgaben einordnen können;<br />
� Portfolioaufgaben und Lerntagebücher in Hinblick auf ihren Nutzen für die formative<br />
Leistungsbeurteilung kritisch bewerten können;<br />
� Nutzen und Grenzen <strong>von</strong> Portfolioaufgaben und Lerntagebüchern für die Förderung und<br />
Beurteilung selbstregulierten Lernens diskutieren können;<br />
� Portfolioaufgaben und Lerntagebücher in Be<strong>zu</strong>g auf diagnostische Gütekriterien kritisch<br />
bewerten können;<br />
� Aufgabenbeispiele in Be<strong>zu</strong>g auf ihren Nutzen für formative Leistungsbeurteilung kritisch<br />
bewerten können.<br />
Literatur:<br />
Häcker, Th. & Lissmann, U. (2007). Möglichkeiten und Spannungsfelder der Portfolioarbeit -<br />
Perspektiven für Forschung und Praxis. Empirische Pädagogik, 21 (2), 209-239.<br />
Hübner, S., Nückles, M., & Renkl A. (2007). Lerntagebücher als Medium selbstgesteuerten Lernens:<br />
Wie viel instruktionale Unterstüt<strong>zu</strong>ng ist sinnvoll? Empirische Pädagogik, 21, 119 - 137.<br />
Jäger, R.S. (2007). Beobachten, beurteilen und fördern! Lehrbuch für die Aus-, Fort- und<br />
Weiterbildung. Landau: Verlag Empirische Pädagogik (→daraus Kap. 7.4 und 7.5)<br />
Lissmann, U. (2007). Beurteilungsraster und Portfoliobeurteilung. In M. Gläser-Zikuda & T. Hascher<br />
(Hrsg.), Lernprozesse dokumentieren, reflektieren und beurteilen. Lerntagebuch und Portfolio in<br />
Bildungsforschung und Bildungspraxis (S. 87-108). Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.<br />
Maier, U. (2010). Formative Assessment - Ein erfolgversprechendes Konzept <strong>zu</strong>r Reform <strong>von</strong><br />
Unterricht und Leistungsmessung?. Zeitschrift für Erziehungswissenschaft, 13(2), 293-308.<br />
Winter, F. (2004). Leistungsbewertung: Eine neue Lernkultur braucht einen anderen Umgang mit den<br />
Schülerleistungen. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren. (→daraus Kap. 4.1, 4.5)<br />
<strong>IfB</strong> / Wahlthemen <strong>Modul</strong> <strong>EWS</strong> <strong>III</strong> MEd07/ Stand: SS11 10
B. Aufgaben <strong>zu</strong>r Leistungsüberprüfung<br />
Was sollten Sie können?<br />
Sie sollten…<br />
� zentrale Begriffe des Themenkomplexes definieren können;<br />
� Vor- und Nachteile geschlossener und offener Antwortformate <strong>zu</strong>r Erfassung <strong>von</strong> Lehrzielen<br />
diskutieren können;<br />
� Aufgabentypen mit geschlossenem und offenem Antwortformat in be<strong>zu</strong>g auf die<br />
diagnostischen Gütekriterien kritisch bewerten können;<br />
� Ihre Kenntnisse auf die Bewertung der Konstruktionsgüte <strong>von</strong> Prüfaufgaben anwenden<br />
können.<br />
Literatur:<br />
Jäger, R.S. (2007). Beobachten, beurteilen und fördern! Lehrbuch für die Aus-, Fort- und<br />
Weiterbildung. Landau: Verlag Empirische Pädagogik (→daraus Kap. 7.2)<br />
Klauer, K.-J. (2001). Wie misst man Schulleistungen? In F.-E. Weinert (Hrsg.), Leistungsmessungen in<br />
Schulen (S. 103-115). Weinhe<strong>im</strong>: Beltz.<br />
Popham, W. J. (2010). Classroom assessment: What teachers need to know (6 th ed.). Boston, MA:<br />
Allyn & Bacon. (→daraus Kap. 6,7,8).<br />
Sacher, W. (2004). Leistungen entwickeln, überprüfen und beurteilen (4., überab. u. erw. Aufl.). Bad<br />
Heilbrunn: Klinkhardt. (→daraus Kap. 3)<br />
C. Standardisierte Schulleistungstests<br />
Was sollten Sie können?<br />
Sie sollten…<br />
� zentrale Begriffe des Themenkomplexes definieren können;<br />
� Nutzen und Grenzen standardisierter Schulleistungstests <strong>zu</strong>r Schulleistungsüberprüfung<br />
darstellen können;<br />
� Konstruktionsprinzipien standardisierter Schulleistungstests beschreiben können;<br />
� Ergebnisse standardisierter Schulleistungstests interpretieren können;<br />
� Ihre Kenntnisse auf die Beurteilung <strong>von</strong> einzelnen Testverfahren anwenden können.<br />
Literatur:<br />
Heller, K.A. & Hany, E.A. (2001). Standardisierte Schulleistungsmessungen. In F.E. Weinert (Hrsg.),<br />
Leistungsmessungen in Schulen (S. 87-101). Weinhe<strong>im</strong>: Beltz.<br />
Jäger, R.S. (2007). Beobachten, beurteilen und fördern! Lehrbuch für die Aus-, Fort- und<br />
Weiterbildung. Landau: Verlag Empirische Pädagogik (→daraus Kap. 7.3)<br />
<strong>IfB</strong> / Wahlthemen <strong>Modul</strong> <strong>EWS</strong> <strong>III</strong> MEd07/ Stand: SS11 11
Langfeldt, H.-P. (1984). Die klassische Testtheorie als Grundlage normorientierter (standardisierter)<br />
Schulleistungstests. In K.A. Heller (Hrsg.), Leistungsdiagnostik in der Schule (4. neub. Aufl., S. 65-98).<br />
Bern: Huber.<br />
Lissmann, U. (2010). Schultests. In D.H. Rost (Hrsg.), Handwörterbuch Pädagogische Psychologie (4.<br />
Aufl., S. 737-750). Weinhe<strong>im</strong>: BeltzPVU.<br />
Lukesch, H. (1998). Einführung in die pädagogisch-psychologische Diagnostik.. Regensburg: Roderer.<br />
(→daraus Kap. 13)<br />
D. Evaluation <strong>von</strong> Unterricht<br />
Was sollten Sie können?<br />
Sie sollten…<br />
� zentrale Begriffe des Themenkomplexes definieren können;<br />
� unterschiedliche Methoden <strong>zu</strong>r Erfassung der Unterrichtsqualität darstellen und kritisch<br />
bewerten können;<br />
� die diagnostische Güte unterschiedlicher Methoden <strong>zu</strong>r Erfassung der Unterrichtsqualität<br />
kritisch bewerten können;<br />
� Nutzen und Grenzen der unterschiedlichen Methoden in be<strong>zu</strong>g auf unterschiedliche<br />
diagnostische Ziele (z.B. Verbesserung des Unterrichts) diskutieren können.<br />
Literatur:<br />
Büchter, A., & Leuder, T. (2005). Zentrale Tests und Unterrichtsentwicklung. Bei guten Aufgaben und<br />
gehaltvollen Rückmeldungen kein Widerspruch. Pädagogik, 57(5),S. 14-18.<br />
Ditton, H. (2002). Lehrkräfte und Unterricht aus Schülersicht. Zeitschrift für Pädagogik, 48 (2), S. 262–<br />
286.<br />
Ditton, H., & Arnoldt, B. (2004). Feedback aus Schülerbefragungen <strong>zu</strong>m Fachunterricht. Empirische<br />
Pädagogik, 18 (1), S. 115 – 139.<br />
Ditton, H. (2010). Evaluation und Qualitätssicherung. In: R. Tippelt & R. Schmidt (Hrsg.), Handbuch<br />
Bildungsforschung (S. 607 – 623). Berlin: Springer.<br />
Dobbelstein, P., Peek, R., & Schmalor, H. (2004). An Ergebnissen orientieren. Ein Paradigma für alle<br />
Fächer und Lernbereiche? Forum Schule, 1, S. 18-26.<br />
Helmke, A. (2009). Unterrichtsqualität und Lehrerprofessionalität. Diagnose, Evaluation und<br />
Verbesserung des Unterrichts. Seelze, Kallmeyersche Verlagsbuchhandlung<br />
Kempfert, G. & Rolff, H.G. (2005). Qualität und Evaluation. Weinhe<strong>im</strong>: Beltz Verlag<br />
Krammer, K. & Reusser, K. (2005). Unterrichtsvideos als Medium der Aus- und Weiterbildung <strong>von</strong><br />
Lehrpersonen. Beiträge <strong>zu</strong>r Lehrerbildung, 23(1), 35-50.<br />
Reusser, K. (2005). Situiertes Lernen mit Unterrichtsvideos – Unterrichtsvideografie als Medium des<br />
situierten beruflichen Lernens. Journal für Lehrerinnen- und Lehrerbildung, 5(2), 8-18.<br />
<strong>IfB</strong> / Wahlthemen <strong>Modul</strong> <strong>EWS</strong> <strong>III</strong> MEd07/ Stand: SS11 12
E. Beratung<br />
Was sollten Sie können?<br />
Sie sollten…<br />
� zentrale Begriffe des Themenkomplexes definieren können;<br />
� Handlungsfelder pädagogisch-psychologischer Beratung darstellen können;<br />
� Handlungsfelder <strong>von</strong> Beratung <strong>im</strong> schulischen Kontext darstellen können;<br />
� Probleme und Möglichkeiten der Beratung durch Lehrkräfte <strong>im</strong> schulischen Kontext<br />
diskutieren können;<br />
� zentrale Elemente des Beratungsprozesses darstellen können;<br />
� darstellen können, was sich hinter dem Konstrukt „Beratungskompetenz“ verbirgt und<br />
Möglichkeiten diskutieren, wie die Beratungskompetenz <strong>von</strong> Lehrkräften verbessert werden<br />
kann.<br />
Literatur:<br />
Grewe, N. (2005). Der Beratungsalltag des Lehrers. Pädagogik, 57(6),.10-13.<br />
Hertel, S. (2009). Beratungskompetenz <strong>von</strong> Lehrern: Kompetenzdiagnostik, Kompetenzförderung,<br />
Kompetenzmodellierung. Münster: Waxmann. (→daraus Kap. 1, 2)<br />
Nußbeck, S. (2006). Einführung in die Beratungspsychologie. München: Reinhardt UTB. (→daraus<br />
Kap. 2,3)<br />
Schnebel, S. (2007). Professionell beraten: Beratungskompetenz in der Schule. Weinhe<strong>im</strong>: Beltz.<br />
Schwarzer, C. & Buchwald, P. (2006). Beratung in Familie, Schule und Beruf. In A. Krapp & B.<br />
Weidenmann (Hrsg.), Pädagogische Psychologie (5. Aufl., S. 575-612). Weinhe<strong>im</strong>: Beltz.<br />
Warschburger, P. (2009). Beratungspsychologie. Heidelberg: Springer. (→daraus Kap. „Theoretischer<br />
Hintergrund“, S. 11-35).<br />
F. Methoden <strong>zu</strong>r Erfassung und Beurteilung schulischer Leistungen<br />
Was sollten Sie können?<br />
Sie sollten…<br />
� zentrale Begriffe des Themenkomplexes definieren können;<br />
� unterschiedliche Verfahren <strong>zu</strong>r Erfassung und Beurteilung <strong>von</strong> Leistungen darstellen<br />
und kritisch bewerten können;<br />
� die diagnostische Güte unterschiedlicher Methoden <strong>zu</strong>r Erfassung <strong>von</strong> Leistungen<br />
kritisch bewerten können;<br />
� Vor- und Nachteile unterschiedlicher Methoden <strong>zu</strong>r Leistungsbeurteilung vor dem<br />
Hintergrund empirischer Befunde diskutieren können;<br />
<strong>IfB</strong> / Wahlthemen <strong>Modul</strong> <strong>EWS</strong> <strong>III</strong> MEd07/ Stand: SS11 13
� den Nutzen der mit den unterschiedlichen Methoden gewonnenen Daten für eine<br />
Literatur:<br />
individuelle Förderung ableiten können.<br />
Ingenkamp, K. & Lissmann, U. (2008). Lehrbuch der pädagogischen Diagnostik (6. Aufl.).<br />
Weinhe<strong>im</strong>: Beltz. (> daraus Kapitel 3 Schulleistungsdiagnostik, S. 130-201)<br />
Jäger, R. S. (2007). Beobachten, beurteilen und fördern! Lehrbuch für die Aus-, Fort- und<br />
Weiterbildung. Landau: Verlag Empirische Pädagogik. (> daraus Kapitel 7 Methoden <strong>zu</strong>r<br />
Erfassung <strong>von</strong> Leistungen – Probleme der Beurteilung, S. 177-346)<br />
G. Diagnostik und Förderung sozial-emotionaler und motivationaler<br />
Merkmale<br />
Was sollten Sie können?<br />
Sie sollten…<br />
� zentrale Begriffe des Themenkomplexes definieren können;<br />
� unterschiedliche Verfahren <strong>zu</strong>r Erfassung sozial-emotionaler und motivationaler<br />
Merkmale, die <strong>im</strong> schulischen Kontext <strong>von</strong> Bedeutung sind, darstellen und kritisch<br />
bewerten können;<br />
� die unterschiedliche Verfahren in Be<strong>zu</strong>g auf diagnostische Gütekriterien kritisch<br />
bewerten können;<br />
� Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Verfahren diskutieren können;<br />
� Möglichkeiten der Förderung sozial-emotionaler und motivationaler Merkmale<br />
Literatur:<br />
kennen.<br />
Hesse, I. & Latzko, B. (2009). Diagnostik für Lehrkräfte. Opladen & Farmington Hills: Verlag<br />
Barbara Budrich, UTB. (> daraus Abschnitt 3.1.1.3 Diagnostik der Lernmotivation, S. 135-<br />
158, und Abschnitt 3.1.1.4 Diagnostik lernrelevanter Emotionen, S. 159-166)<br />
Ingenkamp, K. & Lissmann, U. (2008). Lehrbuch der pädagogischen Diagnostik (6. Aufl.).<br />
Weinhe<strong>im</strong>: Beltz. (> daraus Kapitel 5 Diagnostik sozialer und kognitiv-emotionaler<br />
Merkmale, S. 272-312)<br />
<strong>IfB</strong> / Wahlthemen <strong>Modul</strong> <strong>EWS</strong> <strong>III</strong> MEd07/ Stand: SS11 14
Jerusalem, M. & Klein-Heßling, J. (2002). Soziale Kompetenz. Entwicklungstrends und<br />
Förderung in der Schule. Zeitschrift für Psychologie, 210, 164-174.<br />
Rheinberg, F. (2002). Motivationsförderung <strong>im</strong> Unterrichtsalltag: Probleme,<br />
Untersuchungen, Ergebnisse. Pädagogik, 9, 8-13.<br />
Rost, D. H. & Schermer, F. J. (2010). Leistungsängstlichkeit. In D. H. Rost (Hrsg.),<br />
Handwörterbuch Pädagogische Psychologie (4. Aufl., S. 451-465). Weinhe<strong>im</strong>: Beltz PVU.<br />
H. LargeScaleAssessments, Vergleichsarbeiten, zentrale <strong>Prüfungen</strong><br />
Was sollten Sie können?<br />
Sie können…<br />
� zentrale Begriffe des Themenkomplexes definieren;<br />
� unterschiedliche Zielset<strong>zu</strong>ngen auf den Ebenen Schulsystem, Schule, Unterricht und<br />
Schüler abgrenzen;<br />
� relevante aktuelle und ältere Large Scale Assessments kurz beschreiben und zentrale<br />
Ergebnisse aus deutscher Sicht benennen;<br />
� Hintergrund und rechtliche Regelungen der Vergleichsarbeiten in den Bundesländern<br />
beschreiben;<br />
� Nutzen und Grenzen <strong>von</strong> Vergleichsarbeiten für Evaluationszwecke kritisch<br />
bewerten;<br />
� Hintergründe und Einsatzgebiete zentraler Abschlussprüfungen <strong>im</strong> Schulwesen in<br />
Verbindung mit Bildungsstandards benennen und bewerten;<br />
� Unterschiede in den deutschen Bundesländern in Be<strong>zu</strong>g auf Vergleichsarbeiten und<br />
zentrale <strong>Prüfungen</strong> kennen und kritisch reflektieren;<br />
� Grenzen und Chancen des Einsatzes und der Nut<strong>zu</strong>ng <strong>von</strong> LargeScaleAssessments,<br />
Vergleichsarbeiten und zentralen <strong>Prüfungen</strong> kritisch reflektieren und diskutieren.<br />
Grundlagenliteratur:<br />
Bellenberg, G. (2008) Zur Nut<strong>zu</strong>ng <strong>von</strong> zentralen Abschlussprüfungen als Bausteine eines<br />
umfassenden Qualitätssicherungs- und -entwicklungskonzepts. Ein Baustellenbericht. In<br />
W. Böttcher, W. Bos, H. Döbert & H.G. Holtappels (Hrsg.), Bildungsmonitoring und<br />
Bildungscontrolling in nationaler und internationaler Perspektive (S. 223-233). Münster:<br />
Waxmann .<br />
<strong>IfB</strong> / Wahlthemen <strong>Modul</strong> <strong>EWS</strong> <strong>III</strong> MEd07/ Stand: SS11 15
Goy, M., I, van Ackeren, I. et al. (2008). Ein halbes Jahrhundert internationale<br />
Schulleistungsstudien. Eine systematisierende Übersicht. Tertium Comparationis. Journal<br />
für International und Interkulturell Vergleichende Erziehungswissenschaft, 14(1), 77-107.<br />
Klein, E. D.; Kühn, S. M.; van Ackeren, I.; Block, R. (2009): Wie zentral sind zentrale<br />
<strong>Prüfungen</strong>? Abschlussprüfungen am Ende der Sekundarstufe II <strong>im</strong> nationalen und<br />
internationalen Vergleich. Zeitschrift für Pädagogik, 55 (4), 596-621.<br />
Peek, R. (2007): Wie aussagekräftig sind zentrale Tests? Über den Umgang mit<br />
Individualergebnissen aus Schulleistungsstudien, Lernstandserhebungen und zentralen<br />
<strong>Prüfungen</strong>. Forum Schule(1), 8-11.<br />
Petilliot-Becker, I.; Müller-Rosigkeit, E. (2010): Diagnose- und Vergleichsarbeiten -<br />
Zielset<strong>zu</strong>ngen und Konzeption. Welche Zielset<strong>zu</strong>ngen verfolgen die Diagnose - und<br />
Vergleichsarbeiten? Welche konzeptionellen Anforderungen ergeben sich daraus?<br />
Schulverwaltung. Baden-Württemberg, 19 (6), 122-124.<br />
Radisch, F. (2008): Von FIMS bis PIRLS und PISA - Deutschlands Abschneiden bei<br />
internationalen Schulleistungsvergleichen. In W. Böttcher, W. Bos, H. Döbert & H.G.<br />
Holtappels (Hrsg.), Bildungsmonitoring und Bildungscontrolling in nationaler und<br />
internationaler Perspektive (S. 183-194). Münster: Waxmann.<br />
van Ackeren, I. Klemm, K. (2000). TIMSS, PISA, LAU, Markus und so weiter. Ein aktueller<br />
Überblick über Typen und Varianten <strong>von</strong> Schulleistungsstudien. Pädagogik, 52 (12), 10-15.<br />
<strong>IfB</strong> / Wahlthemen <strong>Modul</strong> <strong>EWS</strong> <strong>III</strong> MEd07/ Stand: SS11 16