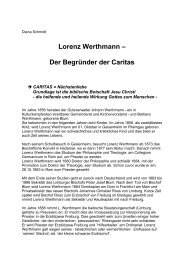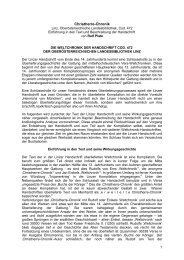Die Geschichte der Fröndenberger Straßennamen
Die Geschichte der Fröndenberger Straßennamen
Die Geschichte der Fröndenberger Straßennamen
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Fachhochschule Potsdam<br />
(University of Applied Sciences)<br />
Fachbereich Informationswissenschaften<br />
Graduale berufsbegleitende Weiterbildung<br />
zur Vorbereitung auf die Externenprüfung zum<br />
Diplomarchivar/Diplomarchivarin (FH)<br />
<strong>Die</strong> <strong>Geschichte</strong> <strong>der</strong> <strong>Fröndenberger</strong> <strong>Straßennamen</strong><br />
dargestellt auf <strong>der</strong> Basis <strong>der</strong> städtischen Aktenüberlieferung und <strong>der</strong> kommunalen<br />
Ergänzungsüberlieferung<br />
Diplomarbeit<br />
Zur Vorlage an den Prüfungsausschuss des FB Informationswissenschaften<br />
Erstgutachter Prof. Dr. Hartwig Walberg, Fachhochschule Potsdam<br />
Zweitgutachter Dr. Gunnar Teske, Westfälisches Archivamt Münster<br />
Jochen Engelhard von Nathusius<br />
Zum Holze 9<br />
59872 Meschede - Remblinghausen<br />
archiv@froendenberg.de<br />
Bearbeitungszeitraum 22.November 2004 bis 22. März 2005 (mit einmonatiger genehmigter Unterbrechung)
1<br />
Inhaltsverzeichnis<br />
Seiten<br />
Vorwort 2<br />
Einleitung 4<br />
Hauptteil<br />
A. Zur <strong>Geschichte</strong> des <strong>Fröndenberger</strong> Raumes<br />
1. Lage, Größe und naturräumliche Glie<strong>der</strong>ung 7<br />
2. Politische Zuordnung und Verwaltung bis zur Gegenwart 7<br />
3. <strong>Geschichte</strong> des Raumes bis 1811 8<br />
4. Bevölkerung und Wirtschaft im 19. und 20. Jahrhun<strong>der</strong>t 10<br />
B. <strong>Die</strong> Entwicklung des Straßen- und Wegenetzes bis 1906<br />
1. Vom ältesten Plan des Stiftsbezirks zum Bebauungsplan <strong>der</strong> 13<br />
Jahrhun<strong>der</strong>twende<br />
2. Alphabetisches Verzeichnis <strong>der</strong> benannten Straßen 15<br />
bis zum Jahr 1906 in <strong>der</strong> Gemeinde Fröndenberg mit Plan<br />
C. <strong>Geschichte</strong> <strong>der</strong> Straßenbenennung bis zum 31.3.1933 18<br />
Exkurs 1 <strong>Die</strong> Hengstenbergstraße 25<br />
Exkurs 2 Der "Wohnplatz" Hohenheide und seine Straßen 29<br />
D. Straßenbenennungen und Umbenennungen vom 1.April 1933<br />
bis zum Kriegsende 1945 in <strong>der</strong> Gemeinde Fröndenberg 31<br />
Exkurs 3 Straßenumbenennungen in an<strong>der</strong>en Kommunen 38<br />
des Regierungsbezirks Arnsberg 1933-1934<br />
E. Straßenbenennungen und Umbenennungen in <strong>der</strong> Gemeinde<br />
(seit 1952 Titularstadt) Fröndenberg von Juli 1945- Dez. 1967 41<br />
Exkurs 4 Straßenbenennungen und die Heimatvertriebenen 50<br />
F. <strong>Geschichte</strong> <strong>der</strong> <strong>Straßennamen</strong> in den amtsangehörigen 54<br />
Gemeinden bis 1967<br />
G. Das große <strong>Straßennamen</strong>-Revirement ab Januar 1968 64<br />
Exkurs 5 Straßenbenennungen und <strong>der</strong> deutsche Wi<strong>der</strong>stand 81<br />
Exkurs 6 Der "Storchenweg" o<strong>der</strong> die Straßenbenennung im 84<br />
Spannungsfeld zwischen bürgerlicher Moral und<br />
bürgerschaftlichem Engagement<br />
H. Straßenbenennungen in <strong>der</strong> Kernstadt Fröndenberg 1971-2004 87<br />
I. Straßenbenennungen in den Stadtteilen ab 1971 94<br />
J. Verzeichnis <strong>der</strong> <strong>Straßennamen</strong> nach Sachgruppen (Auswahl) 96<br />
K. Straßenverzeichnis <strong>der</strong> Stadt Fröndenberg vom 31.12.2004 mit 102<br />
Darstellung <strong>der</strong> "Benennungsepoche" in Farbe<br />
Exkurs 7 Anmerkungen zur Deutung mundartlich benannter Fluren und 109<br />
Gemarkungen im Zusammenhang mit ihrer Verwendung<br />
als <strong>Straßennamen</strong><br />
Schluss Zusammenfassung des Forschungsergebnisses 114<br />
Anhang<br />
1. Ausgewählte Quellen und Dokumente<br />
2. Register sämtlicher <strong>Straßennamen</strong> mit Angaben zur Erstbenennung,<br />
früherer Bennenung und/o<strong>der</strong> späterer Benennung<br />
3. Literatur- und Quellenverzeichnis
2<br />
Vorwort<br />
<strong>Die</strong> vorliegende Arbeit widmet sich einem auf den ersten Blick trockenen und abseitige<br />
Aspekt kommunaler <strong>Geschichte</strong>; dem <strong>der</strong> <strong>Straßennamen</strong>geschichte.<br />
Auf den zweiten Blick jedoch zeigt sich hier ein interessantes und vielschichtiges Stück lokaler<br />
<strong>Geschichte</strong>, das im Horizontalschnitt entlang dieses Themas Paradigmen und Identitätssuche,<br />
wie Identitätsfindung, Brüche und Kontinuitäten <strong>der</strong> letzten einhun<strong>der</strong>t Jahre in<br />
einer Kleinstadt zeigen kann.<br />
Auch wenn spektakuläre Funde hierbei nicht zu Tage traten, wird hierdurch eine Lücke <strong>der</strong><br />
kommunaler Alltagsgeschichte geschlossen.<br />
An Hand <strong>der</strong> <strong>Straßennamen</strong>geschichte wird die städtebaulichen Entwicklung eines Gemeinwesens<br />
von einer kleinen Ansiedlung rings um ein spätmittelalterliches Kloster hin zu einer<br />
expandierenden Industriegemeinde bis zum <strong>der</strong>zeitigen Endpunkt als Kleinstadt am Rande<br />
des Kreises Unna auf <strong>der</strong> Suche nach neuen Perspektiven und Arbeitsplätzen nachgezeichnet.<br />
Am Beispiel <strong>der</strong> <strong>Straßennamen</strong> und <strong>der</strong> diesen zu Grunde liegenden Straßen wurde <strong>der</strong><br />
räumliche Bereich des von 1843 bis 1968 existierenden Amtes Fröndenberg, des in etwa <strong>der</strong><br />
Ausdehnung <strong>der</strong> heutigen „neuen“ Stadt Fröndenberg entsprach in die Arbeit einbezogen und<br />
<strong>der</strong>en Entwicklung bis heute weiter verfolgt, wenngleich <strong>der</strong> Schwerpunkt <strong>der</strong> Darstellung im<br />
Bereich <strong>der</strong> Kernstadt liegt.<br />
<strong>Die</strong>ser o.a. „zweite Blick“ kann aber nur deutlich werden, wenn über das Maß einer reinen<br />
Dokumentation <strong>der</strong> vorhandenen und ehemaligen <strong>Straßennamen</strong> von A-Z hinaus, wie für<br />
an<strong>der</strong>e vergleichbare Kommunen bereits vorliegend, auch eingegangen wird auf den administrativen<br />
wie zeitgeschichtlichen Hintergrund <strong>der</strong> Namensvergabe.<br />
<strong>Die</strong>ser Hintergrund kann, wie in <strong>der</strong> Arbeit dargestellt, ein zeitgeschichtlicher sein, wie die<br />
Benennung von Straßen nach Persönlichkeiten des NS-Staates ab 1933, kann zeithistorisch<br />
groteske Formen annehmen, wenn die gleichen Gemeindeväter in einem Atemzug Adolf<br />
Hitler und Gotthold Ephraim Lessing als Namenspaten auswählten o<strong>der</strong> kann sogar humoristische<br />
Züge annehmen, wenn ein Anlieger Ende <strong>der</strong> 60er Jahre verbissen gegen die ihrer<br />
Ansicht nach diskriminierende Benennung eines „Storchenweges“ ankämpften.<br />
<strong>Die</strong> vorliegende Arbeit hat einerseits einen vorwiegend kommunalhistorischen Charakter und<br />
nimmt an<strong>der</strong>erseits Bezug auf viele Aspekte und Inhalte <strong>der</strong> berufsbegleitenden Weiterbildung<br />
zum Diplom-Archivar, dem gradualen Fernkurs am FB Informationswissenschaften<br />
<strong>der</strong> FH Potsdam. Historische, archivische und allgemeine Grundlagen vermittelnde Teilbereiche<br />
dieses Fernkurses konnten in diese Arbeit einfließen.<br />
Der Verfasser möchte daher die Gelegenheit nutzen, den Professoren und Gastdozenten zu<br />
danken, die diese Grundlagen vermittelt haben, um das vorliegende Thema archivisch,<br />
historisch und paläographisch bearbeiten zu können. namentlich den Herren Reimann,<br />
Schockenhoff, Schuler, Walberg und Wippermann.<br />
Mein Dank gilt beson<strong>der</strong>s Herrn Prof. Dr. Hartwig Walberg, FH Potsdam, sowie Herrn Dr.<br />
Gunnar Teske vom Westfälischen Archivamt in Münster, die beide bereit waren, die Arbeit<br />
<strong>der</strong> Korrektur und Co-Korrektur zu übernehmen.<br />
Herrn Dr. Teske gilt darüber hinaus mein Dank für seinen Einsatz für eine personelle Besetzung<br />
des Stadtarchivs Fröndenberg, meines <strong>der</strong>zeitigen Arbeitsplatzes und damit Voraussetzung<br />
<strong>der</strong> Teilnahme am genannten berufsbegleitenden Fernkurs.
3<br />
Wie in an<strong>der</strong>en ähnlich gelagerten Fällen auch, bildet die beratende Tätigkeit und <strong>der</strong> Wille<br />
des Westfälischen Archivamtes „dicke Bretter hartnäckig zu bohren“ die Voraussetzung für<br />
die konkrete und nicht nur per Archivgesetz auf dem Papier stehende Archivarbeit beson<strong>der</strong>s<br />
in kleineren und mittleren Kommunen und schafft so erst die Voraussetzungen für die fachgerechte<br />
und dauerhafte Sicherung <strong>der</strong> Überlieferung und die gesicherte Grundlage örtlicher<br />
wie anteilig auch <strong>der</strong> landeskundlicher Geschichtsforschung.<br />
Obwohl es seit fast nunmehr 15 Jahren zur bundesdeutschen Realität gehört, vom Wohnort<br />
des Verfassers, in <strong>der</strong> ehemaligen preußischen Provinz Westfalen gelegen, nach Potsdam und<br />
Berlin, den ehemals administrativen Zentren Preußens zu reisen und das quer durch Hessen,<br />
Thüringen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg, ist es dem Verfasser ein Bedürfnis, an dieser<br />
Stelle hervor zu heben, wie sehr die Möglichkeit eines wissenschaftlichen (Fern)Studiums<br />
gerade an diesem historischen Ort Potsdam nicht nur eine reizvolle Aufgabe war, son<strong>der</strong>n<br />
eine Herausfor<strong>der</strong>ung und Befriedigung ganz beson<strong>der</strong>er Art.<br />
Aufgewachsen im geteilten Deutschland mit willkürlich gekappten familiären Bindungen, mit<br />
Interzonenzügen und nicht immer unproblematischen Grenzübertritten von Deutschland nach<br />
Deutschland, von und nach West- wie Ostberlin waren für den Verfasser die Verän<strong>der</strong>ungen,<br />
die sich seit 1989/90 in Deutschland und Europa vollzogen haben, auch und gerade durch die<br />
Zivilcourage und den Mut <strong>der</strong> Bürgerinnen und Bürger in <strong>der</strong> ehemaligen DDR, eine Voraussetzung<br />
für diese noch vor 15 Jahren an diesem Ort undenkbare Weiterbildungsmöglichkeit.<br />
<strong>Die</strong> neuen Kontakte und Freundschaften mit vielen Menschen in und durch „Potsdam“ und<br />
viele vorher nicht mögliche Einblicke in den geschichtlichen Zusammenhang zwischen<br />
Westfalen und dem Raum Potsdam/Berlin sind dem Verfasser als Archivar eines seit 1609<br />
nicht nur aber auch preußisch geprägten Raumes wie <strong>der</strong> Grafschaft Mark im heutigen<br />
Bundesland NRW Stütze und Hilfe seiner archivischen Tätigkeit und waren prägend für das<br />
Geschichts- und Archivverständnis im täglichen Umgang mit „preußischen“ Verwaltungsakten.<br />
Widmen möchte ich die vorliegende Arbeit den Personen, die ideell und materiell die Grundlagen<br />
zur Teilnahme am gradualen Fernkurs <strong>der</strong> FH Potsdam, beson<strong>der</strong>s aber für die<br />
notwendigen wie erlebnisreichen Präsenztage in Potsdam geschaffen haben,<br />
meiner Frau Elsbeth v.Nathusius<br />
meiner Mutter Almut v. Nathusius, Hofgeismar<br />
und Frau Christa Haebler, Berlin sowie dem Ehepaar Regine und Jürgen deHaas, Berlin.<br />
Ihnen wie meinen Kin<strong>der</strong>n, die an manchen Abenden, Wochenenden und Präsenztagen auf<br />
die Anwesenheit ihres Vaters verzichtet haben, gilt mein beson<strong>der</strong>er Dank!<br />
Ebenso gilt mein Dank für vielfältige Unterstützung meinem Arbeitgeber, <strong>der</strong> Stadtverwaltung<br />
Fröndenberg, sowie Berufskolleginnen und Kollegen in an<strong>der</strong>en Archiven des Kreises<br />
Unna für ihre Mithilfe bei <strong>der</strong> Recherche in ihren Beständen.
4<br />
Einleitung<br />
1. Forschungsgegenstand – Forschungszeitraum –<br />
Forschungs- und Quellenstand – Forschungsziel<br />
Forschungsgegenstand sind die <strong>der</strong>zeitig gültigen <strong>Straßennamen</strong>, sowie die <strong>Geschichte</strong> und<br />
Hintergründe ihrer Benennung und (fallweise) zeitgeschichtlicher Bedeutung in <strong>der</strong> heutigen<br />
Stadt Fröndenberg/Ruhr im Kreis Unna, Reg.Bz. Arnsberg, Bundesland NRW, sowie analog<br />
dazu ehemals vergebene <strong>Straßennamen</strong>, die heute keine Gültigkeit mehr haben.<br />
<strong>Die</strong>s betrifft die räumliche Ausdehnung <strong>der</strong> ehemaligen politischen Gemeinde Fröndenberg<br />
(ab 1.11.1953 Titularstadt) einschließlich <strong>der</strong> Wohnplätze Westick und Hohenheide in den<br />
Grenzen bis zum 31.12.1967 als auch die zum 1.1.1968 neu hinzugekommenen Stadtteile, die<br />
zuvor selbständige politische Gemeinden waren und seit 1843 den Amtsbezirk Fröndenberg<br />
bildeten. <strong>Die</strong> nach Auflösung des Amtes zum 1.1.1968 <strong>der</strong> Stadt Unna als Stadtteile zugeordneten<br />
amtsangehörigen Gemeinden Billmerich und Kessebüren im Nord-Westen des<br />
ehemaligen Amtsbezirks werden nicht berücksichtigt.<br />
Der Forschungszeitraum endet mit dem Jahr 2004 und beginnt mit <strong>der</strong> zunächst mündlichen<br />
und ab des letzten Drittels des 19. Jh. amtlichen Überlieferung von Straßenbenennungen,<br />
wobei auch auf frühere Zeiträume in <strong>der</strong> notwendigen Ausführlichkeit eingegangen wird,<br />
wobei die Bearbeitung des Zeitraum vor 1870 auch notwendigerweise den Charakter einer<br />
Bau- und Siedlungsgeschichte trägt, auf <strong>der</strong>en Basis sich das weitere organische Wachstum<br />
<strong>der</strong> bebauten und mit Straßen durchzogene Gemeinde- und Stadtgebiet entwickelte.<br />
Analog dazu bleibt auch die Bau- und Siedlungsgeschichte des 20. Jh. ein steter Begleiter <strong>der</strong><br />
<strong>Straßennamen</strong>geschichte, ist die Existenz bebauter o<strong>der</strong> zu bebauen<strong>der</strong> Straßen doch die<br />
fundamentale Voraussetzung für <strong>der</strong>en Benennung.<br />
Forschungs- und Quellenstand: Über die <strong>Geschichte</strong> <strong>der</strong> <strong>Straßennamen</strong> im Raum Fröndenberg<br />
gibt es bisher eine eigenständige sowie drei das Thema u.a. tangierende<br />
Veröffentlichungen unterschiedlicher Art.<br />
Zum einen eine Dokumentation über die Biographien <strong>der</strong> Persönlichkeiten des deutschen<br />
Wi<strong>der</strong>standes gegen das NS-Regime, die durch <strong>Straßennamen</strong> im Wohngebiet Mühlenberg<br />
<strong>der</strong> Kernstadt Fröndenberg geehrt wurden. 1 Hierbei handelt es sich um eine rein biographischlexikalische<br />
Dokumentation, die auf die <strong>Geschichte</strong> und Hintergründe <strong>der</strong> kontrovers<br />
diskutierten <strong>Straßennamen</strong>vergabe nicht eingeht.<br />
Erwähnung finden die Umbenennungen von Straßen zu Beginn <strong>der</strong> NS-Diktatur, sowie <strong>der</strong>en<br />
Neu-, bzw. Rückbenennung zwischen 1945 und 1949 in zwei Veröffentlichungen von Stefan<br />
Klemp. 2<br />
Eine weitere Erwähnung <strong>der</strong> im Jahr 1850 mündlich tradierten <strong>Straßennamen</strong> in <strong>der</strong> Kernstadt<br />
Fröndenberg findet sich im Heimatbuch von Fritz Klute 3 aus dem Jahr 1925, wobei auf<br />
<strong>Geschichte</strong> und/o<strong>der</strong> Bedeutung dieser <strong>Straßennamen</strong> nicht eingegangen wird; Klute<br />
verwendete seine Auflistung zur Verifizierung <strong>der</strong> 1850, bzw. 1925 dort ansässigen Familien.<br />
<strong>Die</strong> <strong>Straßennamen</strong> in den heutigen Stadtteilen sind bisher kein Gegenstand <strong>der</strong> heimatkundlichen<br />
o<strong>der</strong> zeitgeschichtlichen Forschung gewesen.<br />
1 Friedhelm Niggemeier, Menschen im Wi<strong>der</strong>stand – aufgezeigt an <strong>Straßennamen</strong> in einem <strong>Fröndenberger</strong><br />
Wohngebiet, Fröndenberg 1991<br />
2 Stefan Klemp, Richtige Nazis hat es hier nicht gegeben..., Münster 2.A.2000, S.106, sowie vom gleichen<br />
Autor: Nachkriegszeit – die Jahre 1945 bis 1949 in Fröndenberg – Neubeginn o<strong>der</strong> Restauration, Fröndenberg<br />
1990, S. 87-88<br />
3 Fritz Klute, Fröndenberg einst & jetzt – ein <strong>Fröndenberger</strong> Heimatbuch, Fröndenberg 1925, S.264-268
5<br />
<strong>Die</strong> vorgefundene und ausgewerteten Quellen beruhen demnach im Wesentlichen auf <strong>der</strong><br />
Aktenüberlieferung <strong>der</strong> Gemeinde-, Amts- und Stadtverwaltung Fröndenberg, sowie <strong>der</strong> im<br />
Stadtarchiv vorhandenen Akten <strong>der</strong> ehemaligen Gemeindeverwaltungen <strong>der</strong> heutigen<br />
Stadtteile.. Ebenso wurden Akten aus dem Bestand <strong>der</strong> laufenden Verwaltungstätigkeit ausgewertet.<br />
Eine weitere wichtige Quelle für die letzten 50 Jahre stellt <strong>der</strong> (lei<strong>der</strong> nicht vollständige)<br />
Bestand an Tageszeitungen ab dem Spätherbst 1959 im Stadtarchiv Fröndenberg dar.<br />
<strong>Die</strong> Vertreter <strong>der</strong> örtlichen Heimat- und Geschichtsvereine konnten keine auswertbaren<br />
Quellen zur Verfügung stellen, in manchen Fällen aber bei <strong>der</strong> mundartlichen Deutung von<br />
Flurnamen, bzw. Straßenbenennungen behilflich sein.<br />
Bestehende Forschungen über die <strong>Straßennamen</strong>geschichte in an<strong>der</strong>en Kommunen wurden<br />
hinzugezogen, jedoch ist ein konkreter Vergleich für den gesamten Forschungszeitraum nicht<br />
Gegenstand <strong>der</strong> Arbeit. Lediglich für den Zeitraum 1933-1934 wurde eine dem Vergleich<br />
dienende <strong>Geschichte</strong> <strong>der</strong> Straßenumbenennungen in an<strong>der</strong>en Kommunen des Regierungsbezirks<br />
Arnsberg in die vorliegende Arbeit einbezogen.<br />
<strong>Die</strong> Rücksprache mit zahlreichen Stadt- und Gemeindearchiven ergab das den Verfasser sehr<br />
überraschende Ergebnis, dass bisher das „Amtsblatt <strong>der</strong> Preußischen Regierung für den<br />
Regierungsbezirk Arnsberg“ nicht für die <strong>Straßennamen</strong>erforschung o<strong>der</strong> für eine vergleichende<br />
Forschungsarbeit von an<strong>der</strong>en Archiven ausgewertet wurde.<br />
Wie bereits im Vorwort angedeutet, beschränkt sich die Forschung in an<strong>der</strong>en Kommunen in<br />
den meisten Fällen auf die alphabetisch-lexikalische Auflistung <strong>der</strong> vorgefundenen<br />
<strong>Straßennamen</strong>, bezieht jedoch den Vorgang und die Hintergründe <strong>der</strong> Benennungen kaum in<br />
die Veröffentlichungen mit ein. Je älteren Datums diese Veröffentlichungen sind, um so<br />
weniger wird kritisch Bezug genommen auf die kulturgeschichtlichen o<strong>der</strong> politischzeitgeschichtlichen<br />
Hintergründe von Straßenbenennungen.<br />
Forschungsziel <strong>der</strong> vorliegenden Arbeit war es, neben einer vollständigen Dokumentation<br />
aller <strong>Straßennamen</strong> im Raum Fröndenberg, <strong>der</strong>en Benennungszeitpunkt und die Hintergründe<br />
<strong>der</strong> Benennung einzuordnen in die kommunale <strong>Geschichte</strong> und soweit nötig auch in den<br />
Kontext <strong>der</strong> allgemeinen Landes- und Nationalgeschichte.<br />
Ein weiteres Ziel war es, den administrativen Vorgang <strong>der</strong> Benennungen als Akt verwaltungstechnischen<br />
und verwaltungspolitischen Handelns in ausgewählten Fällen transparent zu<br />
machen.<br />
Zur kritischen Einschätzung des Forschungsergebnisses siehe das Schlusskapitel <strong>der</strong> vorliegenden<br />
Arbeit.
6<br />
2. Erläuterungen zum äußeren Aufbau <strong>der</strong> vorliegenden Arbeit<br />
<strong>Die</strong> <strong>Straßennamen</strong> werden in <strong>der</strong> <strong>der</strong>zeit gültigen Schreibweise wie<strong>der</strong>gegeben, nicht mehr<br />
vorhandene <strong>Straßennamen</strong> in <strong>der</strong> jeweils letztgenannten überlieferten Form.<br />
Grundsätzlich wird übergreifend und verallgemeinernd <strong>der</strong> Begriff „Straße“ (mit „ß“) verwendet,<br />
auch wenn im Einzelfall die Benennung einer Bundesstraße, einer Kreisstraße, einer<br />
Landstraße, einer Ortsstraße o<strong>der</strong> nur eines Weges Gegenstand <strong>der</strong> Erörterung ist.<br />
Alle genannten <strong>Straßennamen</strong>, gültige wie nicht mehr gültige Namen, sind im Anhang 2 in<br />
einem Verzeichnis alphabetisch zusammengefasst.<br />
<strong>Die</strong> ursprüngliche Absicht, dieses „Verzeichnis“ zu einem „Register“ aufzuwerten mit Verweisung<br />
auf die jeweilig für die <strong>Straßennamen</strong>benennung relevante Seite <strong>der</strong> Arbeit konnte<br />
aus zeitlichen Gründen nicht verwirklicht werden.<br />
Ein nach historischen und ortsgeschichtlichen Zusammenhängen geglie<strong>der</strong>tes Verzeichnis im<br />
Kapitel J erleichtert mit biographischen Anmerkungen die Zuordnung <strong>der</strong> namensgebenden<br />
Personen in den Kontext <strong>der</strong> kommunalen <strong>Geschichte</strong>.<br />
Auf ähnliche thematisch zusammenfassende Verzeichnisse und Erklärungen beispielsweise<br />
für die Gruppe <strong>der</strong> nach Pflanzen, Blumen und Bäumen benannten Straßen ist verzichtet<br />
worden, eine Relevanz für die kommunale <strong>Geschichte</strong> durch Erläuterungen zu Fauna und<br />
Flora ist nicht erkennbar und erscheint daher überflüssig.<br />
Bei einer eventuellen späteren Veröffentlichung für einen breiteren Leserkreis wären jedoch<br />
biographisch-lexikalische Anmerkungen beispielsweise für die geehrten „Dichter und<br />
Denker“, Politiker und Industriellen durchaus erwägenswert und sicher sinnvoll.<br />
Anmerkungen in Fußnoten erscheinen auf <strong>der</strong> jeweiligen Seite <strong>der</strong> Arbeit und sind fortlaufend<br />
in jedem Einzelkapitel des Hauptteiles <strong>der</strong> Arbeit neu mit „1“ beginnend durchnummeriert.<br />
Einige ausgewählte Dokumente finden sich im Anhang 1; im laufenden Text wird jeweils im<br />
Zusammenhang auf diese Dokumente verwiesen.<br />
In sieben eingeschobenen Exkursen werden einige beson<strong>der</strong>e Schwerpunkte geson<strong>der</strong>t und<br />
ausführlich behandelt, die zeigen sollen, dass <strong>Straßennamen</strong> und beson<strong>der</strong>s die Vorgeschichte,<br />
teilweise auch die Nachgeschichte ihrer Benennung über den bloßen administrativen Akt<br />
hinaus, wichtige Aspekte <strong>der</strong> kommunalen Identität sowohl <strong>der</strong> Bürger, ihrer Vertretung in<br />
den kommunalen Gremien und Ausschüssen als auch <strong>der</strong> Verwaltung in einer bestimmten<br />
Situation, eingebunden in die Zeitgeschichte, wi<strong>der</strong>spiegeln.<br />
Exkurs sieben geht, wenn auch nicht linguistisch erschöpfend, so doch ansatzweise auf die<br />
Deutung mundartlich tradierter und später in Flur- und Gemarkungskarten wie auch in<br />
<strong>Straßennamen</strong> schriftlich festgehaltener Namen ein, die Rückschlüsse zulässt auf die große<br />
Bedeutung die ehemals <strong>der</strong> Bodenformation, <strong>der</strong> Bodenqualität, Bodenbeschaffenheit und des<br />
ehemaligen Bewuchses in landwirtschaftlich genutzten Räumen zukam.
7<br />
A. Der Raum Fröndenberg<br />
1. Lage, Größe und naturräumliche Glie<strong>der</strong>ung<br />
2. Politische Zuordnung und Verwaltung bis zur Gegenwart<br />
3. <strong>Geschichte</strong> des Raum bis 1811<br />
4. Bevölkerung, Wirtschafts- und Sozialstruktur<br />
1. Lage, Größe und naturräumliche Glie<strong>der</strong>ung<br />
Fröndenberg erstreckt sich auf einer Fläche von reichlich 56 qkm nördlich <strong>der</strong> mittleren Ruhr<br />
auf halber Strecke zwischen Arnsberg im Osten und Schwerte im Westen.<br />
Der Hauptort liegt am südlichen Rand des Stadtgebietes im Ruhrtal auf <strong>der</strong> Höhe des<br />
Zusammenflusses von Ruhr und Hönne und erstreckt sich bis auf die mittlere Höhe des westlichen<br />
Haarstrangs, eines Höhenzuges, <strong>der</strong> das Ruhrtal im Süden von <strong>der</strong> Hellwegregion im<br />
Norden trennt. Das Ruhrtal bildet den nördlichen Abschluss des unteren Sauerlandes.<br />
Westlich des Hauptortes liegen entlang <strong>der</strong> Ruhr die Stadtteile Langschede, Dellwig und<br />
Altendorf, sowie auf halber Haarstranghöhe die Stadtteile Ardey und Strickherdicke. Östlich<br />
des Hauptortes liegen entlang des Ruhrtals die Stadtteile Neimen, Frohnhausen und Warmen,<br />
wie<strong>der</strong>um auf halber Höhe die Stadtteile Bausenhagen, Stentrop und Bentrop.<br />
Auf dem Kamm des Haarstrangs bilden die Stadtteile Frömern, Ostbüren den nördlichen<br />
Abschluss des Stadtgebietes.<br />
Höchste Erhebung ist die Kuppe des Henrichsknübel mit 245 Metern ü.d.M., <strong>der</strong> tiefste Punkt<br />
liegt mit etwa 120 Metern ü.d.M. im westlichen Stadtrand im Ruhrtal.<br />
Mittlere bis gute Bodenqualität für Viehhaltung und Ackerbau im Ruhrtal wandelt sich in eher<br />
kargen und steinreichen Boden im nördlichen Stadtgebiet, <strong>der</strong> auch durch seinen hügeligen<br />
Charakter nur schwer landwirtschaftlich zu nutzen war.<br />
Versuche in <strong>der</strong> früher Neuzeit und nochmals am Anfang des 20. Jahrhun<strong>der</strong>ts Kohle und<br />
Erze abzubauen, erwiesen sich als wenig ertrag- und erfolgreich.<br />
2. Politische Zuordnung und Verwaltung bis zur Gegenwart<br />
Der Raum Fröndenberg nördlich <strong>der</strong> Ruhr gehörte zur Grafschaft Mark, seit 1609 eine <strong>der</strong><br />
westlichen Territorien des Kurfürstentums Brandenburg, ab 1701 Königreich Preußen.<br />
Bis 1808 Teil des „alten Amt“ Unna, bildete <strong>der</strong> Raum erstmals unter napoleonischer Herrschaft<br />
als Teilgebiet des Großherzogtums Berg eine eigenständige Verwaltungseinheit als<br />
Kirchspielsmarie Fröndenberg, dem die Kirchspiele Dellwig, Frömern und Bausenhagen<br />
angeglie<strong>der</strong>t waren, 1 wobei interessant ist, dass sich die nach napoleonisch-französischem<br />
Vorbild arbeitende Verwaltung des Großherzogtums in Dortmund am <strong>Die</strong>nstort des<br />
Praefekten des Ruhr-Departements Gisbert vom Romberg an den evangelischen Kirchspielsgrenzen<br />
orientierte. <strong>Die</strong>ser nunmehr verwaltungsorganisatorisch erstmals eigenständige Raum<br />
blieb in seiner Struktur erhalten, als 1843 die Ämter des bereits 1815 gebildeten Landkreises<br />
1 Bei den hier genannten Kirchspielen handelt es sich um die evangelisch-lutherischen Kirchspiele Dellwig,<br />
Frömern, Fröndenberg und Bausenhagen; katholische Kirchspiele existierten zu dieser Zeit für Fröndenberg<br />
und für den gesamten Ostteil des späteren Amtes in Bausenhagen, wobei bis Ende des 19. Jahrhun<strong>der</strong>ts die<br />
Grenzen des kath. Kirchspiels Bausenhagen bis in die Gemeinde Wickede hinein ragten. Erst 1930 kam es zu<br />
einer weiteren Aufteilung dieses katholischen Kirchspiels durch die Abpfarrung <strong>der</strong> südlichen Gemeinden<br />
Frohnhausen, Neimen und Warmen, die seither das eigenständige Kirchspiel Warmen bilden. <strong>Die</strong> wenigen<br />
katho-lischen Christen des evangelischen Kirchspiels Frömern wurden in damaliger Zeit dem Kirchspiel<br />
Fröndenberg zugerechnet, die Katholiken im westlichen Amtsbezirk orientierten sich ebenso o<strong>der</strong> zum<br />
Kirchspiel Opherdicke, das in <strong>der</strong> westlich angrenzenden Kirchspielsmarie Holzwickede lag.
8<br />
Hamm (ab 1930 Unna) neu aufgeteilt wurden und das Amt Fröndenberg als kleinstes Amt des<br />
Kreises Unna gebildet wurde und bis 1967 Bestand hatte. 2<br />
<strong>Die</strong> Grafschaft Mark wurde ab 1815 im Zuge <strong>der</strong> territorialen Neuglie<strong>der</strong>ung des preussischen<br />
Königreichs Teilgebiet <strong>der</strong> preußischen Provinz Westfalen und innerhalb dieser Provinz<br />
Teilgebiet des Regierungsbezirks Arnsberg, <strong>der</strong> bis heute mit den Regierungsbezirken<br />
Münster und Detmold den westfälisch-lippischen Teil des Bundeslandes NRW bildet.<br />
Seit 1922 gehört das Amt dem Siedlungsverband „Ruhrkohlenbezirk“ an, dem späteren<br />
„Kommunalverband Ruhrgebiet“ und bildet dessen östlichsten Bestandteil.<br />
1952 erhielt <strong>der</strong> Hauptort den Rang einer Titularstadt zugesprochen und zum 1.1.1968 wurde<br />
im Rahmen <strong>der</strong> kommunalen Neuglie<strong>der</strong>ung des Kreises Unna die „neue“ Stadt Fröndenberg/Ruhr<br />
aus dem Hauptort und den amtsangehörigen Gemeinden gebildet unter Ausschluss<br />
<strong>der</strong> amtsangehörigen Gemeinden Kessebüren und Billmerich, die politisch <strong>der</strong> Stadt Unna als<br />
<strong>der</strong>en Stadtteile angeglie<strong>der</strong>t wurden. Damit endete die bisherige Kongruenz <strong>der</strong> kirchlichen<br />
mit den staatlichen Verwaltungsgrenzen, denn nach wie vor gehört Billmerich dem ev.<br />
Kirchspiel Dellwig und Kessebüren dem ev. Kirchspiel Frömern an.<br />
<strong>Die</strong> amtsangehörige Gemeinde Bentrop im Osten des Amtes gelegen, tendierte zunächst<br />
1967/68 hin zur nähergelegenen Industriegemeinde Wickede/Ruhr im südlichen Bereich des<br />
Kreises Soest, entschied sich aber dann doch bis 1969, weiterhin dem <strong>Fröndenberger</strong> Raum<br />
als Stadtteil anzugehören, wobei historisch irreführend <strong>der</strong> Bereich des zur Gemarkung<br />
Bentrop gehörenden Klostergutes Scheda ausgeklammert und dem Kreis Soest zugeordnet<br />
wurde.<br />
Hier wurde willkürlich ein geschichtlicher Zusammenhang zerrissen, <strong>der</strong> das ehemalige<br />
Kloster mit dem ehemaligen Kloster und Stift Fröndenberg, sowie <strong>der</strong> Burg Ardey für den<br />
<strong>Fröndenberger</strong> Raum verbindet und mit dem im Kreis Unna liegenden ehemaligen Kloster<br />
Cappenberg bis heute auf das Engste verbunden ist.<br />
Im Süden bildet die Ruhr nicht nur die Stadtgrenze zwischen Fröndenberg und dem<br />
benachbarten Menden son<strong>der</strong>n auch die Grenze zum Märkischen Kreis. Der Raum Menden,<br />
ehemals Territorium des Kölner Kurstaates, wurde ab 1815 dem Kreis Iserlohn angeglie<strong>der</strong>t.<br />
Im Norden markiert die <strong>Fröndenberger</strong> Stadtgrenze die Grenze zur Kreisstadt Unna, im<br />
Westen grenzt das Stadtgebiet an die zum Kreis Unna gehörende Gemeinde Holzwickede und<br />
im Osten, wie bereits erwähnt an den Kreis Soest mit <strong>der</strong> Gemeinde Wickede/Ruhr.<br />
3. <strong>Geschichte</strong> des Raum bis 1811 3<br />
<strong>Die</strong> ältere <strong>Geschichte</strong> des Raumes Fröndenberg soll an dieser Stelle kurz 4 gestreift werden,<br />
da sie mit dem Thema <strong>der</strong> <strong>Straßennamen</strong> insofern verbunden ist, dass einige <strong>Straßennamen</strong> in<br />
2 Zur Verwaltungsglie<strong>der</strong>ung siehe die Karten im Anhang 1 unter <strong>der</strong> lfd. Nummer 1<br />
3 Um diesen Abschnitt nicht mit Quellenangaben zu überfrachten, sei verwiesen auf zwei zusammenfassende<br />
Quelle, in <strong>der</strong> aller hier genannten Daten und Namen enthalten sind: Auf Franz Lueg, „Fröndenbergs<br />
<strong>Geschichte</strong> ist geprägt von Kloster und Stift“, Aufsatz in: Werner Keßler (Hrsg.), Festschrift 750 Jahre (1230-<br />
1980) Stiftskirche Fröndenberg, Fröndenberg 1980, sowie hinsichtlich <strong>der</strong> urkundlichen Ersterwähnung <strong>der</strong><br />
Orte auf Willy Timm, <strong>Die</strong> Ortschaften <strong>der</strong> Grafschaft Mark, Unna 1991.<br />
4 <strong>Die</strong> <strong>Geschichte</strong> Fröndenbergs von 1193 bis 1811, die hier thematisch bedingt nur in wenigen Stichworten und<br />
auf das Thema <strong>der</strong> Straßenbenennung hinauslaufend enthalten ist, hatte in <strong>der</strong> bisherigen Geschichtsbetrachtung<br />
bis in die 1980er Jahre eine zentrale Stellung, die alle seither ebenfalls ereignisreichen Jahre vollkommen<br />
überdeckte. <strong>Die</strong> Entwicklung verläuft inzwischen genau umgekehrt und kaum noch ein <strong>Fröndenberger</strong> Bürger<br />
unter 50 Jahren hat auch nur ansatzweise Kenntnisse über die Kloster- und Stiftsgeschichte. Ein Grund dafür ist<br />
<strong>der</strong> 1964 bis 1966 abrupt verlaufende Schulsystemwechsel gewesen von den alten klassischen Volksschulen<br />
und ihrer Lehrerschaft hin zur aufbruchsbegeisterten und reformfreudigen jüngeren Lehrergeneration in <strong>der</strong><br />
neuen Gesamtschule. Fühlten sich alle bisherigen Lehrkräfte <strong>der</strong> Vermittlung <strong>der</strong> <strong>Fröndenberger</strong> Ortshistorie<br />
verpflichtet, so stammten kurz nach Begründung <strong>der</strong> neuen Gesamtschule kaum noch Lehrkräfte aus dem<br />
hiesigen Raum, bzw. verbannten Orts- und Heimatkunde in die Mottenkiste nicht mehr zeitgemäßer<br />
Lehrinhalte.
9<br />
ihrer Benennung zurückgehen auf die <strong>Geschichte</strong> Fröndenbergs vor 1811, dem Jahr <strong>der</strong> Aufhebung<br />
des „freiweltlich-adeligen Damenstifts“. Auch fast alle mit den jeweiligen Ortsnamen<br />
bezeichneten Verbindungswege zwischen den Stadtteilen haben ihren Namen in <strong>der</strong> Zeit des<br />
späten Mittelalters bis hin zur frühen Neuzeit erhalten.<br />
Geprägt wurde <strong>der</strong> Raum, <strong>der</strong>en Orte zwischen dem Jahr 1101 Bausenhagen, Ardey 1147,<br />
Bentrop 1175, Fröndenberg 1197, Frömern 1210, Neimen 1219, Frohnhausen 1223, Altendorf<br />
1241, Warmen 1244, Westick 1246, Strickherdicke 1250, Dellwig 1269, Stentrop 1294,<br />
Ostbüren 1298 und Langschede 1300 erstmals urkundlich erwähnt werden, durch die Grenze<br />
im Osten und Süden zum kurkölnischen Herrschaftsgebiet und <strong>der</strong> eigenen Zugehörigkeit zur<br />
Grafschaft Mark, die sich etwa ab 1200 festigte, nachdem die bisher den Raum<br />
dominierenden Edelherren von Ardey zu dieser Zeit an Einfluss gegenüber den Grafen von<br />
<strong>der</strong> Mark verloren. <strong>Die</strong> Ardeyer hatten den Raum, <strong>der</strong> etwa dem heutigen Stadtgebiet<br />
entspricht durch zwei Burgen gesichert, eine zwischen dem heutigen Stadtteil Ardey und<br />
Fröndenberg gelegen und eine im äußersten Osten an <strong>der</strong> Grenze zu Kurköln gelegen mit<br />
Namen „Sceitha“ o<strong>der</strong> „Scethen“ (Grenzscheide), aus dem sich <strong>der</strong> Namen Scheda<br />
entwickelte. Unterhalb dieser heute kaum noch wahrnehmbaren Burg entwickelte sich ab<br />
Mitte des 12. Jahrhun<strong>der</strong>ts (erstmals 1143 genannt) ein Praemonstratenserkloster, dessen<br />
Besitz in einer Papsturkunde des Jahres 1197 erwähnt wird; in dieser Urkunde wird auch<br />
erstmals Fröndenberg als Ansiedlung „Frundeberg“ im Besitz des Klosters genannt.<br />
Von diesem bis 1809 existierenden Kloster spaltete sich unter Führung des Kanonikers<br />
Bertholdus eine zisterziensisch orientierte „Reformgruppe“ ab, <strong>der</strong> Sage nach unterstützt<br />
durch seinen als Domherrn in Lübeck tätigen Bru<strong>der</strong> Menricus, <strong>der</strong> nach dem Tod von Bertholdus<br />
die Klostergründung eines Frauenklosters auf dem <strong>Fröndenberger</strong> Haßleiberg voran<br />
trieb und in dieser Zeit in einer Einsiedelei, einer Klause (Kluse) unweit des späteren Klosters<br />
wohnte. Unterstützt wurde Menricus dabei vom Kölner Erzbischof Heinrich von Molenark,<br />
einem Sohn des Grafen Adolf III. von <strong>der</strong> Mark und Bru<strong>der</strong> des Grafen Otto von Altena.<br />
Raumübergreifend steht diese Klostergründung in einem engeren Zusammenhang mit zahlreichen<br />
an<strong>der</strong>en Klostergründungen dieser Jahre, die als „Sühneklöster“ von direkt o<strong>der</strong> indirekt<br />
an <strong>der</strong> Ermordung des Kölner Erzbischofs Engelbert I. 1225 beteiligten Adelsfamilien<br />
gestiftet wurden. Am 21.Oktober 1230 entsandte <strong>der</strong> Kölner Erzbischof Heinrich von<br />
Mollenark eine Äbtissin mit 12 Nonnen aus dem Jülicher Kloster Hoven nach Fröndenberg.<br />
In diesem Jahr wird <strong>der</strong> Baubeginn <strong>der</strong> Klosterkirche und <strong>der</strong> Klostergebäude vermutet.<br />
<strong>Die</strong> Kirche wurde nach zisterziensischer Tradition <strong>der</strong> heiligen Jungfrau Maria geweiht.<br />
Zweitpatron wurde <strong>der</strong> heilige Märtyrer Mauritius .Von 1293-1391 war die Klosterkirche die<br />
Grablege <strong>der</strong> regierenden Grafen von <strong>der</strong> Mark, darunter Graf Eberhard II., <strong>der</strong> an <strong>der</strong> Seite<br />
seiner ersten 1293 verstorbenen Ehefrau Irmgard, geb. Gräfin von Berg 1308 in einem<br />
Hochgrab in <strong>der</strong> Stiftskirche beigesetzt wurde. Ebenso dessen Sohn, Enkel und Urenkel, die<br />
Grafen Engelbert II., Adolf II. und Engelbert III. 5<br />
So verläuft heute eine tiefe Kluft zwischen den Generationen, so in den Heimat- und Geschichtsvereinen im<br />
Stadtgebiet, für <strong>der</strong>en eine Hälfte <strong>der</strong> Mitglie<strong>der</strong> die interessanten Aspekte <strong>Fröndenberger</strong> <strong>Geschichte</strong> 1812<br />
enden und <strong>der</strong>en an<strong>der</strong>e Hälfte bereits mit dem rudimentären Begriff „Mark“ kaum noch etwas anzufangen<br />
wissen und in <strong>der</strong> Aufarbeitung <strong>der</strong> Industriegeschichte o<strong>der</strong> des Nationalsozialismus ihr vorrangiges<br />
Aufgabenfeld erkennen.<br />
5 <strong>Die</strong> fettgedruckten Namen <strong>der</strong> Klostergrün<strong>der</strong> und <strong>der</strong> in <strong>der</strong> Klosterkirche beigesetzten Herren <strong>der</strong> Grafschaft<br />
Mark sowie <strong>der</strong> des Schutzpatrons <strong>der</strong> Kirche (und später im Wappenbild <strong>der</strong> Stadt eingesetzten) Mauritius<br />
entsprechen den <strong>Straßennamen</strong> in <strong>der</strong> Kernstadt Fröndenberg, die zwischen 1924 (Graf-Adolf-Straße) und 1970<br />
(Eberhardstraße) in Erinnerung an die <strong>Geschichte</strong> <strong>der</strong> Stadt Verwendung gefunden haben. <strong>Die</strong> im Stadtteil<br />
Bausenhagen liegende „Graf-Ezzo-Straße“ ist nach dem Pfalzgrafen Ezzo (Ehrenfried) benannt, Ehemann <strong>der</strong><br />
jüngsten Tochter von Kaiser Otto II. und um das Jahr 991 Lehnsherr im nördlichen Haarstranggebiet. Auf ihn<br />
und seine Gemahlin, die in <strong>der</strong> Reichsabtei Werden aufwuchs, geht vermutlich die Begründung <strong>der</strong><br />
Bausenhagener Kirche zurück und in diesem Zusammenhang wird Bausenhagen 1101 als „Busenhagen“<br />
urkundlich erwähnt. Graz Ezzo und seine Gemahlin Mathilde sind in <strong>der</strong> Abtei Brauweiler beigesetzt. Aus dem<br />
Titel des „Pfalzgrafen“ leitet sich die mundartliche Benennung „Palz“ für das gesamte östliche Stadtgebiet ab,
10<br />
In <strong>der</strong> Nach-Reformationszeit wandelt sich das Zisterzienserinnenkloster bis Mitte des 16.<br />
Jahrhun<strong>der</strong>ts in ein „adeliges freiweltliches Damenstift“ als Versorgungsstätte des westfälischen<br />
Adels für unverheiratete weibliche Nachkommen.<br />
Entscheidend für die kirchliche Entwicklung <strong>der</strong> Region ist hierbei, dass sich die Unentschiedenheit<br />
<strong>der</strong> konfessionellen Ausrichtung des Herrscherhauses Mark, sowie die<br />
religionspolitische Toleranz <strong>der</strong> brandenburgischen Herrscherhauses auch im adeligen Damenstift<br />
wie<strong>der</strong>spiegelte und Adelige bei<strong>der</strong> Konfessionen in den Konvent aufgenommen<br />
wurden. Eine „Stiftsordnung“ (Religionsvergleich von 1672) legte fest, dass einschließlich<br />
<strong>der</strong> Äbtissin <strong>der</strong> Konvent des Stifts aus 22 adeligen Damen auf Grund <strong>der</strong> Aufteilung <strong>der</strong><br />
vorhandenen Präbenden zu bestehen hatte. Mindestens jede vierte Äbtissin hatte <strong>der</strong> katholischen<br />
Konfession anzugehören, ebenso jede vierte Kapitularin. Als dritte Konfession, wenn<br />
auch zahlenmäßig in geringeren Umfang kam noch die evangelisch-reformierte hinzu, bedingt<br />
durch die Konvertierung des Herrscherhauses Brandenburg in <strong>der</strong> Regierungszeit des Großen<br />
Kurfürsten. Jede Konfession wählte ihren eigenen Geistlichen ohne Genehmigung <strong>der</strong><br />
Äbtissin, wenn diese einer an<strong>der</strong>en Konfession angehörte. <strong>Die</strong> frühere Klosterkirche wurde<br />
zur Simultan-Stiftskirche, die nach <strong>der</strong> Säkularisation des Stifts in Staatsbesitz zunächst des<br />
Großherzogtums Berg überging, danach in den des preußischen Staates und als dessen<br />
Rechtsnachfolger in den Besitz des Landes NRW. Beide Eigenschaften, das Simultaneum wie<br />
auch das Besitzverhältnis sind bis heute dem als evangelische Pfarrkirche dienenden Gotteshaus<br />
erhalten geblieben.<br />
Bis in die ersten Jahre des 19. Jahrhun<strong>der</strong>ts bestimmte fortan das adelige Damenstift den<br />
Lebensrhythmus (und nicht zuletzt auch die Finanzkraft) des Ortes und setzte Akzente hinsichtlich<br />
<strong>der</strong> baulichen, schulischen und handwerklichen Entwicklung, die noch lange nach<br />
Aufhebung des Stiftes nachwirkten und erst mit Beginn des Industriezeitalters, auf das im<br />
folgenden Abschnitt näher eingegangen wird, in den Hintergrund traten.<br />
4. Bevölkerung und Wirtschaft im 19. und 20. Jahrhun<strong>der</strong>t<br />
<strong>Die</strong> Stadt Fröndenberg/Ruhr zählt heute knapp 24.000 Einwohner mit leicht abnehmen<strong>der</strong><br />
Tendenz. <strong>Die</strong> meisten Einwohner wohnen in <strong>der</strong> sogenannten Kernstadt Fröndenberg und<br />
ihren Wohnplätzen Westick und Hohenheide. Einen weiterer Siedlungsschwerpunkt bilden<br />
die nahezu zusammengewachsenen Stadtteile Ardey, Dellwig und Langschede, sowie <strong>der</strong> in<br />
Richtung Unna verkehrsgünstig gelegene Stadtteil Frömern. <strong>Die</strong> Siedlungsdichte nimmt in<br />
Richtung Osten stark ab. Traditionell ist <strong>der</strong> Osten <strong>der</strong> Stadt katholisch, <strong>der</strong> Westen eher<br />
evangelisch ausgerichtet, insgesamt herrscht zwischen den Konfessionen ein ausgeglichenes<br />
Verhältnis; jede hält etwa 30% <strong>der</strong> Einwohnerschaft, während die übrigen 40 % an<strong>der</strong>en Religionsgemeinschaften<br />
o<strong>der</strong> gar keiner Religionsgemeinschaft angehören.<br />
Seit 1870/71 6 durchzieht längs <strong>der</strong> Ruhr die Eisenbahnhauptstrecke (Hagen)-Schwerte-Fröndenberg-Wickede-Neheim-Meschede-Warburg-(Kassel)<br />
das heutige Stadtgebiet. Seit 1899 ist<br />
Fröndenberg zudem durch eine eingleisige Nebenstrecke mit Haltepunkten in Ardey und<br />
Frömern mit <strong>der</strong> Kreisstadt Unna verbunden und seit 1872 in südlicher Richtung mit Menden;<br />
diese Strecke wurde sukzessive bis 1912 nach Neuenrade, bzw. Iserlohn verlängert.<br />
Der seit den 1880er Jahren erbaute Bahnhof Langschede, sowie <strong>der</strong> Haltepunkt Warmen auf<br />
<strong>der</strong> erwähnten Hauptbahnlinie werden seit den 1990er Jahren nicht mehr bedient.<br />
identisch mit dem alten katholischen Kirchspiel Bausenhagen.<br />
<strong>Die</strong> o.a. Benennung <strong>der</strong> Engelbertstraße nach Engelbert III. und nicht nach Engelbert II. ist den entsprechenden<br />
Gemein<strong>der</strong>atsprotokollen nicht zu entnehmen, son<strong>der</strong>n bezieht sich auf die Angabe des zeitnah <strong>der</strong> Benennung<br />
erschienene Ortsgeschichte von Zeitzeuge Fritz Klute, dessen Heimatbuch nur wenige Monate nach <strong>der</strong><br />
Benennung im August 1924 erschienen ist und <strong>der</strong> Engelbert III. als <strong>Straßennamen</strong>patron nennt.<br />
6 Damalige Bevölkerungszahl im Amtsbezirk einschl. <strong>der</strong> später an Unna gekommenen Gemeinden ca. 6.500
11<br />
Nach dem Ende des Stifts Fröndenberg (siehe dazu Abschnitt 3 dieses Kapitels) sank die<br />
Bedeutung des Hauptortes Fröndenberg stark herab, ebenso verlor die Gemeinde Langschede<br />
schon lange vorher an Bedeutung durch die 1801 eingestellte Ruhrschifffahrt. Vormals war<br />
Langschede <strong>der</strong> „Verschiffungshafen“ des in Königsborn bei Unna gewonnenen Salinensalzes<br />
und des im Raum Fröndenberg angebauten Korns. Im Gegensatz zu Fröndenberg besaß Langschede<br />
ein, wenn auch eingeschränktes, Marktrecht.<br />
Erst durch die Inbetriebnahme eines Walzwerkes südlich <strong>der</strong> Ruhr in Bösperde und <strong>der</strong><br />
Funktion <strong>der</strong> <strong>Fröndenberger</strong> Heimschmiedeproduktion als Zulieferer dieses Werkes, <strong>der</strong> Entstehung<br />
einer Papierindustrie nördlich <strong>der</strong> Ruhr und schließlich durch den Bau <strong>der</strong> Eisenbahn<br />
entwickelte sich Fröndenberg zu einer Industriegemeinde. <strong>Die</strong> Schließung des Walzwerkes<br />
konnte durch die Industrialisierung <strong>der</strong> Heimschmiedestätten zu leistungsfähigen Kettenfabriken<br />
kompensiert werden und Fröndenberg entwickelte sich zu einem Zentrum <strong>der</strong><br />
deutschen Kettenindustrie und Dank <strong>der</strong> Gründung <strong>der</strong> Firma UNION aus <strong>der</strong> Tradition <strong>der</strong><br />
märkischen Drahtindustrie heraus zu einem <strong>der</strong> wichtigsten Lieferanten für Fahrradteile<br />
(Speichen, Nippel, Radreifen) in Deutschland. Ein Isolierrohrwerk, gummiverarbeitende<br />
Industrie und eine stetig an Bedeutung gewinnende Blech- und Leichtmetallprodukte in<br />
Langschede sorgten für ein ständiges Wachstum <strong>der</strong> Industrie. Darüber hinaus bot die Steinbruchindustrie<br />
und Ziegelherstellung entlang <strong>der</strong> Steilufer hin zur Ruhr und auch die Landwirtschaft<br />
den Menschen Arbeit und Verdienstmöglichkeiten.<br />
Arbeitskräftemangel in Folge Mangel an Wohnraum rief die Industriebetriebe auf den Plan,<br />
zahlreiche firmeneigene Siedlungen anzulegen und bedingte eine stürmische Bauentwicklung<br />
zwischen 1890 und 1914 7 , sowie ab den dreißiger Jahren bis in die frühen 1960er Jahre, <strong>der</strong>en<br />
Resultate neben <strong>der</strong> bäuerlich-dörflichen Altbausubstanz und Bauten aus stiftischer Zeit das<br />
Bild <strong>der</strong> Kernstadt (Alleestraße, Bahnhofstraße, Bismarckstraße), aber auch den Ortskern in<br />
Langschede bis heute prägen.<br />
<strong>Die</strong> frühe Entscheidung, die Wasserkräfte <strong>der</strong> Ruhr zur Elektrizitätsgewinnung zu nutzen,<br />
sowie bereits relativ früh ein Wasserversorgungsnetz für Industrie, Handel und<br />
Privathaushalte anzulegen, begünstigte die Entwicklung des Amtsbezirks.<br />
Auch die Stadtflucht aus dem nahen Ruhrgebiet in ländlichere Regionen (rege Bautätigkeit<br />
z.B. in Frömern und Ostbüren) beeinflusste noch bis in die 1970er Jahre die positive<br />
Bevölkerungsentwicklung, konnte aber den Stillstand und Rückgang durch zahlreiche<br />
Firmenschließungen und dadurch bedingte Wegzüge vieler Familien nicht mehr wett machen.<br />
So sank die Belegschaft <strong>der</strong> Firma UNION bis zur Schließung <strong>der</strong> Werke von etwa 1.000<br />
Mitarbeitern nach dem Wie<strong>der</strong>aufbau und Beseitigung <strong>der</strong> Kriegsschäden um 1950-55 in den<br />
<strong>Fröndenberger</strong> Stammwerken bis auf zuletzt weniger als 100 Belegschaftsangehörige.<br />
<strong>Die</strong> Langsche<strong>der</strong> Metallindustrie, seit <strong>der</strong> Arisierung <strong>der</strong> Wolff, Netter & Jacobi-Werke 1938<br />
im Besitz von Mannesmann und später Thyssen hat mittlerweile diesen Standort aufgegeben,<br />
die Bahn als zeitweise drittgrößter Arbeitgeber vor Ort mit einer Belegschaft von etwa 280<br />
Personen im gesamten Bahnhofsbereich ist auf zwei Stellwerksbedienstete zurückgegangen;<br />
<strong>der</strong> Güterverkehr ruht seit den 1990er Jahren völlig.<br />
War somit einst die Industrie Anziehungspunkt <strong>der</strong> Stadt, so ist es heute zunehmend <strong>der</strong><br />
Tourismus, Wan<strong>der</strong>wege entlang des Haarstrangs und <strong>der</strong> Pferde- und Golfsport, die Fröndenberg<br />
zu einem Anziehungspunkt des nahen Ruhrgebiets machen. Dem zu Folge pendeln<br />
mehr als zwei Drittel aller Arbeitnehmer jeden Tag in Richtung Unna, Menden-Iserlohn,<br />
Hagen o<strong>der</strong> Dortmund. <strong>Die</strong> große Flexibilität <strong>der</strong> Arbeitnehmerschaft hat die Arbeitslosenzahlen<br />
in Fröndenberg bisher nicht stärker anwachsen lassen als in vergleichbaren<br />
Kommunen ähnlicher Größenordnung und Struktur.<br />
Auch die traditionsreiche Papierindustrie mit den Firmen Casack und Himmelmann hat ihre<br />
Produktion aufgegeben und das riesige Firmengelände Himmelmann entlang <strong>der</strong> Ruhr hat<br />
7 Allein im Sommer 1904 übersiedelten 50 Familien aus dem ostpreußischen Insterburg nach Fröndenberg.
12<br />
sich in eine Grünzone mit Tennisplätzen 8 verwandelt, nachdem die Industriebrache letztmalig<br />
Anfang <strong>der</strong> 90er Jahre <strong>der</strong> „Bavaria“ als gespenstische Kulisse für einen Film <strong>der</strong> 1945er<br />
Jahre diente.<br />
Gewahrt hat Fröndenberg hingegen seine zentrale Bedeutung als Schulort durch den richtungsweisenden<br />
Bau einer Gesamtschule, die heute 1.400 Schüler unterrichtet, wenngleich ein<br />
Teil <strong>der</strong> Elternschaft aus grundsätzlicher Überzeugung heraus die traditionellen Gymnasien in<br />
Unna und Menden für das gymnasiale Fortkommen ihrer Kin<strong>der</strong> bevorzugt.<br />
Neben <strong>der</strong> Gesamtschule existieren noch drei Grundschulen 9 in Fröndenberg, Langschede und<br />
Dellwig, dazu eine Son<strong>der</strong>schule in <strong>der</strong> Kernstadt. Eine kleine Berufsschule wurde bereits in<br />
den 1950er Jahren zugunsten zentraler Ausbildungsorte in Neheim-Hüsten und Unna<br />
aufgegeben; ein völlig neu erbautes Krankenhaus erwies sich in städtischer Regie, an<strong>der</strong>s als<br />
die Gesamtschule, als großer Fehlschlag und die Stadt kam mit <strong>der</strong> Übernahme des Hauses<br />
durch das NRW-Justizministerium als Justizvollzugskrankenhaus mit einem finanziell<br />
„blauen Auge“ davon; heute ist die kurz „Justizklink“ genannte Einrichtung Fröndenbergs<br />
größter Arbeitgeber. Zwei bis zu diesem Neubau existierende konfessionelle Krankenhäuser<br />
hatten seit den 1880er Jahren die stationäre ärztliche Versorgung <strong>der</strong> Bürger sichergestellt.<br />
Bis heute haben lediglich <strong>der</strong> Stadtteile Strickherdicke und Langschede einen Anschluss an<br />
das Bundesfernstraßennetz durch ihre direkte Lage an <strong>der</strong> Bundesstraße Unna-Iserlohn, die<br />
das westliche Stadtgebiet von Norden nach Süden durchzieht und in Langschede über die<br />
Ruhr in den Märkischen Kreis wechselt. <strong>Die</strong>s ist zugleich <strong>der</strong> älteste feste Ruhrübergang für<br />
Fahrzeuge und Fußgänger, <strong>der</strong> auf persönliche Anordnung 10 von König Friedrich II. erbaut<br />
wurde, nachdem eine entsprechende Bitte <strong>der</strong> KDK Hamm an ihn herangetragen worden war.<br />
Ein eigener Autobahnanschluss an die A-44 (Dortmund-Kassel) konnte nicht verwirklicht<br />
werden und so wan<strong>der</strong>ten einige Firmen in die <strong>der</strong> Autobahn näherliegenden Unnaer<br />
Industriegebiete ab. Ein in den 1960er Jahren entstandenes Industriegebiet zwischen <strong>der</strong><br />
Kernstadt und dem Stadtteil Warmen blieb bis heute wegen <strong>der</strong> schlechten Anbindung an das<br />
Autobahnnetz Stückwerk und wurde lediglich von ausgesiedelten Firmen <strong>der</strong> Kernstadt als<br />
Standpunkt gewählt. Es fehlt eine Straßenverbindung, die das gesamte Stadtgebiet von Ost<br />
nach West im Ruhrtal verbinden würde und Anschluss fände an die Industrieregion Neheim-<br />
Hüsten im Osten wie Schwerte im Westen. Dem gegenüber steht die Bedeutung <strong>der</strong><br />
Ruhrwiesen als Wassergewinnungsgebiet für einen Großraum, <strong>der</strong> bis Hagen und Hamm<br />
reicht sowie <strong>der</strong>en Bedeutung als natürliche Überflutungsgebiete <strong>der</strong> Ruhr und Standort<br />
zahlreicher Biotope.<br />
An den werbepsychologisch gewählten Bezeichnungen „Stadt mit Aussicht“ (nicht auf<br />
Arbeitsplätze son<strong>der</strong>n auf die umliegende Landschaft) und „Stadt im Grünen“ wird sich in<br />
absehbarer Zeit strukturell nichts än<strong>der</strong>n. Der Spagat zwischen Lebensqualität und<br />
Gewerbesteuerverluste bestimmt seit Jahren und auf Jahre hinaus das verwaltungspolitische<br />
Handeln <strong>der</strong> Stadt.<br />
8 Erhalten geblieben ist allerdings ein Nebengebäude, welches dem Kettenschmiedemuseum als Domizil dient,<br />
sowie <strong>der</strong> sogenannte „<strong>Fröndenberger</strong> Trichter“, ein riesiger etwa fünfzehn Meter hoher Einlauftrichter aus<br />
dem Papierproduktionsablauf <strong>der</strong> Firma Himmelmann, <strong>der</strong> an die Bedeutung <strong>der</strong> Papierindustrie erinnert.<br />
9 Kurz vor Ausbruch des ersten Weltkrieges gab es im Amtsbezirk 12 Volksschulen in den 15 Gemeinden des<br />
Amtes, darunter 2 in Fröndenberg (evangelisch und katholisch) und zwei (evangelisch und katholisch) in den<br />
beiden Kirchspielen Bausenhagens. <strong>Die</strong> wenigen katholischen Kin<strong>der</strong> <strong>der</strong> westlichen Amtsgemeinden<br />
besuchten überwiegend die katholische Volksschule im benachbarten Opherdicke (heute zur Gemeinde<br />
Holzwickede gehörend), die jüdischen Kin<strong>der</strong> aus Dellwig und Fröndenberg die jeweils evangelischen<br />
Volksschulen. Weiterführende Schulen gab es bis zur Gründung <strong>der</strong> Gesamtschule nicht, besucht wurden die<br />
Gymnasien in Schwerte, Menden und Unna, bzw. im Falle <strong>der</strong> Mädchen bis 1945 die höheren Töchterschulen<br />
in Menden und Schwerte, ab 1945 die bereits genannten Gymnasien.<br />
10 Das bisher älteste Originalschriftstück im Besitz des Stadtarchivs; ältere Urkunden Kirche und Kloster wie<br />
Stift betreffend, befinden sich im Staatsarchiv Münster und in kirchlichem Archivbesitz, das Stadtarchiv<br />
besitzt aber eine Sammlung von Abschriften bzw. Kopien.
13<br />
B. <strong>Die</strong> Entwicklung des Straßen- und Wegenetzes bis 1906<br />
1. Vom ältesten Plan des Stiftsbezirks zum Bebauungsplan <strong>der</strong><br />
Jahrhun<strong>der</strong>twende<br />
<strong>Die</strong> älteste überlieferte Darstellung eines Plans <strong>der</strong> <strong>Fröndenberger</strong> „Innenstadt“ ist ein rekonstruierter<br />
Situationsplan des Kloster- und Stiftsbezirks, <strong>der</strong> die vorhandenen Bausubstanz und<br />
Wege für die Zeit vor 1812 darstellt. 1<br />
<strong>Die</strong>ser Plan macht deutlich, dass <strong>der</strong> Siedlungskern <strong>der</strong> Gemeinde „Stift Fröndenberg“ aus<br />
einem abgeschlossenen, wahrscheinlich mit einer niedrigen Umgrenzungsmauer umgebenen<br />
Bezirk bestand, <strong>der</strong> nicht von Straßen durchzogen wurde; auch aus topographischen Gründen<br />
bedingt durch die Steilhanglage südlich <strong>der</strong> Klostergebäude.<br />
Der heutige Innenstadtkern aus Markt und <strong>der</strong> Kreuzung Alleestraße/Markt/Eulenstraße/<br />
Unionstraße entstand erst nach Aufhebung des Stiftes 1812 ab den 1830er Jahren.. Trotzdem<br />
ist bereits auf diesem Plan <strong>der</strong> Verlauf einiger Straßen rings um das Stiftsgelände sichtbar und<br />
die Flurbezeichnungen „Auf dem Sodenkamp“, „Auf <strong>der</strong> Freiheit“ und „Im Stift“ weisen<br />
hin auf die spätere Benennung von Straßen in diesen Bereichen.<br />
Zum 1. April 1902 wurden die bis dahin selbständigen Gemeinden des <strong>Fröndenberger</strong><br />
Kirchspiels „Stift Fröndenberg“, „Dorf (o<strong>der</strong> Dorfschaft) Fröndenberg“ und „Westick“ zu<br />
einer politischen Gemeinde Fröndenberg vereinigt.<br />
Der Flächengröße nach war die ehemalige Gemeinde Westick mit 545 Hektar die größte<br />
dieser drei Gemeinden, während die Gemeinde Stift Fröndenberg mit nur 71 Hektar die<br />
kleinste Flächengröße in die neue Gemeinde einbrachte.<br />
Allerdings wohnten auf diesen 71 Hektar die meisten <strong>der</strong> 1895 gezählten Einwohnerschaft,<br />
nämlich 1029 Bewohner; in Westick hingegen nur 274 Bewohner und im 483 Hektar<br />
umfassenden Dorf Fröndenberg 1012 Einwohner. 2<br />
Dem zur Folge gab es damals auch im Stift Fröndenberg und im Bereich des Dorfs<br />
Fröndenberg die meisten ausgebauten Wege und Straßen, die bereits seit langer Zeit<br />
traditionelle Namen führten, <strong>der</strong>en amtliche Benennung aber nicht nachgewiesen werden<br />
kann, da sich keine Gemein<strong>der</strong>atsprotokolle <strong>der</strong> drei „Altgemeinden“ erhalten haben. 3<br />
Es ist zudem nach Durchsicht aller erreichbaren Unterlagen anzunehmen, dass es für den in<br />
diesem Kapitel genannten Kernbestand <strong>der</strong> <strong>Fröndenberger</strong> Straßen kein aktenkundlich<br />
festgehaltenes Benennungsverfahren gegeben hat.<br />
Der Übergang von <strong>der</strong> Nummerierung <strong>der</strong> bestehenden Hof- und Wohngebäude unabhängig<br />
von ihrer topographischen Lage hin zu einer einheitlichen Nummerierung entlang mit Namen<br />
versehener Straßen erfolgte mit hoher Wahrscheinlichkeit erst im Anschluss an den 1898 4<br />
entstandenen Fluchtlinien- und Bebauungsplanes bis hin zum ersten schriftlich fixierten<br />
„Ortsstatut“, verbunden mit <strong>der</strong> „Polizeiverordnung“ vom 16. März 1906. 5<br />
Im genannten Fluchtlinien- und Bebauungsplan sind lediglich zwei Straßen konkret mit einem<br />
Namen versehen, nämlich die ab 1871 entstandene „Bahnhofstraße“ und <strong>der</strong>en östliche<br />
Verlängerung als „Parallelweg“ (zur Bahn), letztere bis zur endgültigen Bebauung ab etwa<br />
1905/06 im Besitz <strong>der</strong> Eisenbahnverwaltung.<br />
1 Erstellt durch J.B.Nordhoff für den Band „<strong>Die</strong> Kunst- und Geschichtsdenkmäler des Kreises Hamm, Münster<br />
1880“ und seither in zahlreichen an<strong>der</strong>en Veröffentlichungen weiterverwendet, so auch von Fritz Klute in<br />
seinem 1925 entstandenen Heimatbuch „Fröndenberg Einst & Jetzt“, siehe dazu Anhang 1 lfd. Nr. 2<br />
2 Hellweger Anzeiger vom 1.4.1967, Artikel von Karlheinz Ligges zum 65.Jubiläum <strong>der</strong> Zusammenlegung <strong>der</strong><br />
drei Gemeinden Stift, Dorf und Westick, basierend auf den Angaben von Fritz Klute in seinem 1925<br />
entstandenen Heimatbuch „Fröndenberg, Einst & Jetzt“, Anhang 1, lfd. Nr.3<br />
3 <strong>Die</strong> Überlieferung beginnt mit dem 28.1.1906, StaF A 1890<br />
4 Titelblatt und ein Beispiel für den Bereich rund um die Stiftskirche siehe Anhang 1 unter <strong>der</strong> lfd. Nr.4<br />
5 Siehe dazu Anhang 1 die lfd. Nr. 5
14<br />
Ausgehend von den beiden ältesten Kreuzungsbereichen am „Markt“ und auf halber Höhe<br />
<strong>der</strong> nach Norden führenden „Eulenstraße“ sind die folgenden Straßen in Richtung <strong>der</strong><br />
Nachbarkommunen zu nennen, die entsprechend ihres Ziels ihre Namen erhielten.<br />
Der untere Teil <strong>der</strong> nach Norden führenden Eulenstraße ab dem Markt führte den Namen<br />
„Schulstraße“.<br />
Vom Markt aus die „Ardeyer Straße“ nach Westen, die „Westicker Straße“ nach Osten,<br />
die „Ruhrstraße“ nach Süden in Richtung Menden, sowie nach Nordwesten, bzw. Nordosten<br />
die „Unnaer Straße“ und die „Ostbürener Straße“, die ihren Verlauf ab halber Höhe <strong>der</strong><br />
heutigen Eulenstraße beginnen. Östlich <strong>der</strong> Unnaer Straße sowie <strong>der</strong> gesamte Bereich links<br />
und rechts <strong>der</strong> Ostbürener Straße war <strong>der</strong> Siedlungskern des „Dorf Fröndenberg“, westlich<br />
und südlich davon auf dem Sodenkamp, auf dem Haßleiberg und im Ruhrtal lagen die<br />
wichtigsten Bereiche <strong>der</strong> Gemeinde „Stift Fröndenberg“.<br />
<strong>Die</strong> Haßleistraße begrenzte im 19. Jahrhun<strong>der</strong>t den nördlichen Teil <strong>der</strong> Gemeinde „Stift<br />
Fröndenberg“, zu dessen Siedlungskern des weiteren die „Schroerstraße“, die „Freiheitstrasse“,<br />
die Straßen „Auf <strong>der</strong> Freiheit“ und „Auf dem Sodenkamp“, <strong>der</strong> „Kirchplatz“<br />
und <strong>der</strong> zwischen Markt und Berg liegende zentrale Bereich „Im Stift“ gehören.<br />
Hinzugerechnet werden kann für den Bereich „Schroestraße“ bereits <strong>der</strong> vor 1900 bebaute<br />
Weg „Fischerssiepen“, <strong>der</strong> aber erst 1926 offiziell diesen Namen per Ratsbeschluss erhielt.<br />
<strong>Die</strong> um die Jahrhun<strong>der</strong>twende jüngsten Straßen waren die ab Vollendung des Bahnbaus<br />
1870/71 südlich <strong>der</strong> Bahn angelegte und bereits erwähnte „Bahnhofstraße“ bis zu ihrer<br />
Einmündung in die Ruhrstraße, <strong>der</strong> ebenfalls bereits erwähnte dem weiteren Bahnverlauf<br />
folgende „Parallelweg“, die sich bis in die ersten Jahre des 20. Jh. im Besitz <strong>der</strong><br />
Eisenbahnverwaltung befand, sowie die im neu entstandenen Industrieviertel nördlich des<br />
Bahnhofs angelegte „Parkstraße“ und die in west-östliche Richtung nördlich <strong>der</strong> Bahn und<br />
nördlich <strong>der</strong> Industrie verlaufende „Bergstraße“, die aus Richtung Ardey unter Umgehung<br />
des Marktes den Bereich des Sodenkampberges erschloss. Nach <strong>der</strong> Einmündung <strong>der</strong><br />
Bergstraße in die Parkstraße führt <strong>der</strong> weitere Verlauf als Fußweg entlang <strong>der</strong> alten<br />
Klosterumwehrung bis zur katholischen Marienkirche und führt den Namen „Am Steinufer“<br />
(in manchen Quellen auch nur „Steinufer“)wobei zu beachten ist, dass aus topographischen<br />
Gründen an diesem Weg zu keiner Zeit eine Bebauung erfolgte und daher die Bezeichnung<br />
„Am Steinufer“ niemals offizieller Straßenname war, aber doch sporadisch in einige Stadtpläne<br />
und Straßenregister bis in die 60er Jahre Aufnahme fand. Der Weg existiert heute noch<br />
in leicht verän<strong>der</strong>ter Führung und in gültigen Stadtplänen nicht mit Namen versehen.<br />
Ab 1906 begann die planmäßige Bebauung <strong>der</strong> „Friedhofstraße“, des bisher nur als Zugangsweg<br />
zum 1866 erstbelegten Friedhofs von <strong>der</strong> Kreuzung Eulenstraße/Haßleistraße/<br />
Ostbürener Straße aus benutzten Weges. 6<br />
Damit sind alle die Straßen berücksichtigt, die bereits Fritz Klute als „Kernbestand“ <strong>der</strong> Jahre<br />
vor und nach 1850 in seinem Heimatbuch 7 genannt hat, sowie die bis 1906 hinzugekommenen<br />
Straßen, <strong>der</strong>en Bebauung bis 1906 erfolgte o<strong>der</strong> zu diesem Zeitpunkt planmäßig<br />
begonnen worden war.<br />
Für keine dieser vor 1906 genannten und nachweislich bestehenden Straßen ist ein<br />
Gemein<strong>der</strong>atsbeschluss für eine Benennung nachweisbar.<br />
Eine Beschil<strong>der</strong>ung ist ebenso nicht nachzuweisen; diese ist erst ab 1933 vorgenommen<br />
worden, worauf im Kapitel D <strong>der</strong> vorliegenden Arbeit näher eingegangen wird.<br />
Wichtig ist zu beachten, dass die Hausnummerierung entlang dieser Straßen, so wie bei Klute<br />
angegeben, <strong>der</strong> Nummerierung des 20. Jahrhun<strong>der</strong>ts entspricht und keinesfalls auf das Jahr<br />
6 Gemein<strong>der</strong>atsprotokoll vom 14.9.1909, StaF, A 1890<br />
7 Fritz Klute, Fröndenberg Einst & Jetzt, Fröndenberg 1925, Seite 264-268
15<br />
1850 rückübertragen werden darf. <strong>Die</strong> Nummerierung diente Klute lediglich für die Verifizierung<br />
<strong>der</strong> Bewohnern und Besitzern 1850 und 1925.<br />
<strong>Die</strong> Nummerierung bis in das 20. Jahrhun<strong>der</strong>t hinein entsprach <strong>der</strong> ab Mitte des 18. Jahrhun<strong>der</strong>ts<br />
begonnenen Durchnummerierung vor dem Hintergrund <strong>der</strong> Steuergesetzgebung<br />
ohne Rücksicht auf die Lage <strong>der</strong> bebauten Grundstücke an Straßen o<strong>der</strong> Wegen.<br />
2. Alphabetisches Verzeichnis <strong>der</strong> benannten Straßen bis zum Jahr 1906 in<br />
<strong>der</strong> Gemeinde Fröndenberg<br />
(mit Nennung späterer Umbenennungen, auf die in den folgenden Kapiteln <strong>der</strong> Arbeit näher<br />
eingegangen wird)<br />
(Am) Steinufer, Klute vor 1850, unbebauter Fußweg unterhalb <strong>der</strong> südlichen ehemaligen<br />
Klosterumwehrung<br />
Ardeyer Straße, Klute vor 1850, Richtungsstraße vom Ortsmittelpunkt (Markt) nach Westen,<br />
in ihrem östlichen Teil zwischen Markt und Einmündung <strong>der</strong> Parkstraße ab 1933 bis heute in<br />
„Wilhelm-Feuerhake-Straße“ umbenannt.<br />
Auf dem Sodenkamp, Klute vor 1850, nach <strong>der</strong> Gemarkung nördlich-westlich <strong>der</strong><br />
Stiftskirche<br />
Auf <strong>der</strong> Freiheit, Klute vor 1850, Gelände nördlich (außerhalb) des Stiftsbezirks und<br />
traditioneller Gerichtsplatz für die Bewohner <strong>der</strong> Dorfschaft Fröndenberg außerhalb <strong>der</strong><br />
Jurisdiktion des Stiftes<br />
Bahnhofstraße, bebaut ab Fertigstellung <strong>der</strong> Eisenbahn Schwerte-Arnsberg(Kassel) 1870/71<br />
Bergstraße, Parallelstraße <strong>der</strong> Ardeyer Straße auf halber Hanghöhe und weiter ansteigend<br />
Richtung Sodenkamp, Nachweisung im Gemein<strong>der</strong>atsprotokoll vom 10.6.1908<br />
Eulenstraße, Klute vor 1850, östliche Begrenzung des Stiftsbezirk, in einer „Schlucht“<br />
zwischen Haßleiberg und Sümberg. Mittlerer Teil <strong>der</strong> Unnaer Straße vom Ortsmittelpunkt<br />
ansteigend in Richtung Norden verlaufend; Anlieger im 19.Jahrhun<strong>der</strong>t war ein Hofbesitzer<br />
„Uhlenbrock“, ab 1933 bis 1945 „Horst-Wessel-Straße“.<br />
Haßleistraße, Klute vor 1850, Begrenzung des Haßleibergs auf dem ab 1230 die<br />
Klosterkirche (später Stiftskirche) erbaut wurde. Der Name „Haßlei“ konnte bisher<br />
etymologisch nicht geklärt werden.<br />
Freiheitstrasse, nördlich des Stiftsbezirks, siehe „Auf <strong>der</strong> Freiheit“.<br />
Friedhofstraße, Zuwegung ab 1866 zum neuen Friedhof, ab 1906 Wohnbebauung.<br />
Im Stift, Klute vor 1850, traditionell <strong>der</strong> gesamte Stiftsbezirk südlich unterhalb des Haßleiberges.<br />
Kirchplatz, Klute vor 1850, Bebauung rund um die Stiftskirche (Klosterkirche).<br />
Markt, Klute vor 1850, Ortsmittelpunkt nach Aufhebung des Stifts 1812, zunächst als östliche<br />
Begrenzung des Stiftsbezirks nur auf <strong>der</strong> Westseite bebaut; die Bebauung auf <strong>der</strong> Ostund<br />
Südseite des nahezu dreieckigen Platzes erfolgte bis etwa 1910, 1933-1945 umbenannt in<br />
„Adolf-Hitler-Platz“.<br />
Ostbürener Straße, Klute vor 1850, Richtungsstraße in nordöstlicher Richtung, 1933-1945<br />
zusammen mit <strong>der</strong> „Eulenstraße“ die „Horst-Wessel-Straße“ bildend.<br />
Parallelstraße, Verlängerung <strong>der</strong> „Bahnhofstraße“ nach Querung <strong>der</strong> „Ruhrstraße“ in<br />
Richtung Osten bis zum Bahnübergang „Westicker Straße“, ab 1907 „Löhnbachstraße“, ab<br />
1933 „Bismarckstraße“.<br />
Parkstraße, Straße in nördlicher Richtung von <strong>der</strong> Ardeyer Straße abzweigend, kreuzt die<br />
Bergstraße und war Zuwegung des um 1900 wichtigen „Volksparks“, heute eine eher<br />
unbedeutende Grünanlage nördlich des Sodenkamps. Erschloss in ihrem südlichen Verlauf<br />
das Industriegebiet zwischen Haßleiberg und Bahngelände, ab 1933 bis heute „von-Tirpitz-<br />
Straße“.
16<br />
Ruhrstraße, Klute vor 1850, Richtungsstraße vom Ortsmittelpunkt nach Süden zur Ruhr<br />
(und über die Ruhr hinweg weiter über Bösperde nach Menden führend; dort <strong>Fröndenberger</strong><br />
Straße).<br />
Schroerstrasse, Klute vor 1850, Straße nordöstlich vom Stiftsbezirk.<br />
Schulstraße, Klute vor 1850, südlicher Teil <strong>der</strong> „Unnaer Straße“ und Standort <strong>der</strong><br />
Schulneubauten des 19. Jahrhun<strong>der</strong>ts, von 1933-1945 „Schlageter-Straße“, 1945 kurzfristig<br />
„Lutherstraße“, dann wie<strong>der</strong> „Schulstraße“ und ab 1971 in die „Eulenstraße“ einbezogen.<br />
Unnaer Straße, Klute vor 1850, Richtungsstraße vom Ortsmittelpunkt (zunächst als<br />
Schulstraße und Eulenstraße) nach Nord-Nordwest über Frömern nach Unna führend. 1971<br />
einbezogen in die „Eulenstraße“.<br />
Westicker Straße, Klute vor 1850, Richtungsstraße vom Ortsmittelpunkt nach Osten in<br />
Richtung Wickede/Ruhr. 1933 bis 1945 in ihrem westlichen Verlauf zwischen Markt und<br />
Bahnübergang „Hermann-Göring-Straße“, nach 1945 in diesem Teilbereich in „Alleestraße“<br />
umbenannt.
17<br />
Schematischer Übersichtsplan <strong>der</strong> Gemeinde Fröndenberg (Kernbereich) mit den bis<br />
1906 bestehenden Straßen und <strong>der</strong>en Namen<br />
Maßstab 1:8ooo auf <strong>der</strong> Basis des Stadtplans (Innenstadtbereich) aus dem Jahr 1940
18<br />
C. <strong>Geschichte</strong> <strong>der</strong> Straßenbenennungen von 1906 bis zum 31.3.1933<br />
Bewusst wurde im vorigen Kapitel das Ende des Jahres 1905 als Endpunkt <strong>der</strong> ersten Phase<br />
<strong>der</strong> Straßenbenennung gewählt, da für diesen Zeitraum ab dem 19. Jahrhun<strong>der</strong>t keine<br />
schriftliche Überlieferung vorliegt und Zeitpunkte für eine Benennung nur auf <strong>der</strong> Basis von<br />
zeitlich bekannter Bebauung vermutet werden können, bzw. als Verwaltungsakt mit hoher<br />
Wahrscheinlichkeit für die überwiegende Zahl <strong>der</strong> damals vorhandenen Straßen auch gar<br />
nicht vorgenommen wurden.<br />
Für die in diesem Kapitel beginnende Zeit <strong>der</strong> Jahre vor dem 1. Weltkrieg, <strong>der</strong> Zeit des 1.<br />
Weltkriegs selber und <strong>der</strong> Epoche <strong>der</strong> Weimarer Republik kann zurückgegriffen werden auf<br />
die Gemein<strong>der</strong>atsprotokolle und die Überlieferung des Bauamtes.<br />
<strong>Die</strong> genannten Protokolle liegen allerdings nur als Ergebnisprotokolle vor und so können die<br />
Entscheidungsprozesse und Überlegungen hin zu bestimmten <strong>Straßennamen</strong> nicht konkret<br />
dargestellt werden und sind daher aus dem Kontext <strong>der</strong> Zeitgeschichte heraus zu beschreiben.<br />
Für die Weimarer Jahre hilfreich ist hierbei <strong>der</strong> Rückgriff auf die Arbeit von Josefa Redzepi,<br />
sowie das für diese Arbeit 1 von ihr angelegte Zeitungsausschnittarchiv für die Jahre 1918-<br />
1933, das Abschriften von Artikeln des „Hellweger Anzeiger“ und <strong>der</strong> „<strong>Fröndenberger</strong><br />
Zeitung“ enthält. So ist ein Rückblick auf diesen Zeitraum möglich, wenngleich natürlich die<br />
Autorin ganz an<strong>der</strong>e Schwerpunkte zu setzen hatte, als etwa die Berücksichtigung vergebener<br />
<strong>Straßennamen</strong>!<br />
Zunächst aber geht es um die letzten Jahre des Kaiserreichs und die Jahre des 1. Weltkriegs:<br />
Bis zum Oktober des Jahres 1912 werden keine Straßenbenennungen in den Protokollen<br />
erwähnt, <strong>Straßennamen</strong> aber im Zusammenhang mit Bebauungsplanungen genannt, so im<br />
September 1906 die „Friedhofsstraße“ und im Dezember 1907 die „Löhnbachstraße“, wobei<br />
eine Umwidmung dieser Straße von „Parallelweg“ in „Löhnbachstraße“ keine Erwähnung<br />
findet, <strong>der</strong> Name Parallelweg also mit großer Wahrscheinlichkeit nie eine offizielle<br />
Benennung erfahren hat, son<strong>der</strong>n in <strong>der</strong> Tradition <strong>der</strong> preußischen Eisenbahnverwaltung als<br />
parallel zur Bahn verlaufen<strong>der</strong> Weg diesen Namen führte.<br />
Am 25. Januar 1910 wird <strong>der</strong> planmäßige Ausbau <strong>der</strong> „Karlstraße“ beschlossen, ein bereits<br />
teilweise vor 1906 bebauter Weg in östlicher Richtung vom Marktplatz verlaufend, <strong>der</strong> das<br />
damals als Gartenland genutzte Gelände zwischen <strong>der</strong> Bahnlinie Schwerte-Warburg und <strong>der</strong><br />
„Westicker Straße“. Anzunehmen ist die Herkunft dieses Namens vom Besitzer <strong>der</strong><br />
wichtigsten Baugrundstücke an diesem Weg, dem Hotelier und alteingesessenen Honoratior<br />
<strong>der</strong> Gemeinde Karl Wildschütz. 2<br />
1 Josefa Redzepi, Amt und Gemeinde Fröndenberg während <strong>der</strong> Weimarer Republik, Fröndenberg 1986,<br />
Beiträge zur Ortsgeschichte, Band 1, sowie Sammlung von Abschriften aus diversen Tageszeitungen von 1918-<br />
1933, Sammlung in fünf Ordnern im Stadtarchiv Fröndenberg.<br />
Frau Redzepi wurde im Jahr 1985 im Rahmen einer ABM-Maßnahme von <strong>der</strong> Stadtverwaltung mit <strong>der</strong><br />
Aufgabe betraut, als „Stadtschreiberin“ die „Chronik <strong>der</strong> Stadt Fröndenberg“ (so wurde und wird das<br />
Heimatbuch von Fritz Klute aus dem Jahr 1925 damals und heute verstanden) für die Zeit ab Ende des 1.<br />
Weltkrieges fortzuschreiben, wobei die Ereignisse des 1.Weltkrieges, die bereits bei Klute weitgehend<br />
ausgespart blieben, auch in diesem Falle ausgespart bleiben sollten. Nach Fertigstellung des ersten Bandes<br />
wurde <strong>der</strong> Arbeitsvertrag mit Frau Redzepi lei<strong>der</strong> nicht verlängert, obwohl dieser Band als durchaus gelungen<br />
anzusehen ist und auch entsprechend gelobt wurde. Den damals Verantwortlichen kam es aber wohl nicht ganz<br />
ungelegen, dass es aus finanziellen Gründen nicht zu einer Weiterbeschäftigung kam und somit die Zeit ab<br />
1933 zunächst weiterhin unbeschrieben blieb und erst durch die Studien von Stefan Klemp erarbeitet wurde.<br />
Wenn auch Ende <strong>der</strong> 90er Jahren dessen Arbeiten über die Judenverfolgung und über die Zwangsarbeit im<br />
Dritten reich Betsandteile <strong>der</strong> „Beiträge zur Ortsgeschichte“ wurden, erschien die große Dokumentation über<br />
die gesamte Zeit 1933-1945 nicht unter Regie des städtischen Kulturamtes, son<strong>der</strong>n 1998 als Monografie in<br />
einem Verlag in Münster. Seine Arbeit über die Jahre 1945-49 erschien jedoch 1990 in <strong>der</strong> genannten Reihe <strong>der</strong><br />
„Beiträge zur Ortsgeschichte“, die Kapitel D und E <strong>der</strong> vorliegenden Arbeit bassiern nicht zuletzt auf dieser<br />
Forschungsarbeit<br />
2 1933 wird diese Straße folgerichtig in „Karl-Wildschütz-Straße“ umbenannt.
19<br />
Der 26. Oktober 1912 ist <strong>der</strong> Tag, für dem zum ersten Mal ein Gemein<strong>der</strong>atsbeschluss für die<br />
Benennung einer Straße nachgewiesen werden kann. An diesem Tag erhält die „Sümbergstraße“<br />
offiziell ihren Namen und erschließt in den folgenden Jahren von Süden her das<br />
Baugebiet auf dem Gelände des Sümbergs, in <strong>der</strong> Folgezeit neben <strong>der</strong> Erstbebauung des<br />
Mühlenberg und <strong>der</strong> Bebauung des Wiesengeländes zwischen <strong>der</strong> Ruhrstraße im Westen und<br />
<strong>der</strong> ehemaligen Gemeinde Westick im Osten eines <strong>der</strong> drei wichtigen Bebauungsgebiete<br />
innerhalb <strong>der</strong> Gemeinde Fröndenberg.<br />
Ihr Name leitet sich ab von dem Besitzer <strong>der</strong> meisten Baugrundstücke in diesem Bereich <strong>der</strong><br />
Gemeinde, dem Bauern Sümmermann, in einer Teilungskarte für die „Dorfschaft Fröndenberg“<br />
aus dem Jahr 1778 „Sümersberg“ bezeichnet.<br />
Im bereits genannten Neubaugebiet zwischen Westick und <strong>der</strong> damaligen Ostgrenze <strong>der</strong> ehemaligen<br />
Gemeinde „Stift Fröndenberg“ 3 erhält noch vor Ausbruch des 1. Weltkrieges mindestens<br />
eine von drei zu bebauenden Wohnstraßen einen Namen. Nachzuweisen im Gemein<strong>der</strong>atsprotokoll<br />
vom 6.Juni 1914 ist die Benennung <strong>der</strong> „Friedrichstraße“, nicht nachgewiesen<br />
werden kann hingegen die Benennung <strong>der</strong> „Antoniusstraße“ und <strong>der</strong> „Gartenstraße“;<br />
hier ist eine Benennung für die Jahre nach 1918 anzunehmen aber nicht exakt<br />
nachzuweisen.<br />
Hinsichtlich <strong>der</strong> „Friedrichstraße“ verhält es sich hinsichtlich <strong>der</strong> Namensgebung ähnlich wie<br />
bei <strong>der</strong> bereits erwähnten „Karlstraße“. In <strong>der</strong> Friedrichstraße entstehen gemeindeeigene<br />
Wohnhäuser des Gemeinnützigen Bauvereins, dem zu dieser Zeit <strong>der</strong> angesehenen Arzt<br />
Dr. Friedrich Bering vorsteht.<br />
Damit endet die Benennung von Straßen während <strong>der</strong> Kaiserzeit mit einer Ausnahme, die<br />
jedoch erst rückwirkend durch einen Verweis im Gemein<strong>der</strong>atsprotokoll vom 13. Juni 1921<br />
zeitlich eingeordnet werden kann. An diesem Tag wird dem Schwiegersohn des 1918 verstorbenen<br />
Fabrikanten Wilhelm Himmelmann, Paul Leesemann, für die Ausgestaltung des<br />
„zu Ehren seines Vaters am 28. Mai 1918 benannten Marktplatzes im Stift“ gedankt. 4 Es ist<br />
dies <strong>der</strong> „zweite“ und eigentlich ältere <strong>der</strong> beiden Marktplätze in Fröndenberg, ein im<br />
Stiftsbezirk liegen<strong>der</strong> freier Platz umgeben von ehemaligen Funktionsgebäuden <strong>der</strong> wirtschaftlich<br />
autarken Stiftsverwaltung, dem Kornhaus, dem Brau- und Backhaus und an<strong>der</strong>en<br />
Gebäuden. An diesem Platz lagen durch Neubau o<strong>der</strong> Umbau ehemals stiftischer Gebäude die<br />
Wohnhäuser <strong>der</strong> Fabrikantenfamilien Leesemann und Himmelmann<br />
Eine Benennung dieses „Wilhelmplatzes“ im Protokollbuch <strong>der</strong> Gemeindeverwaltung kann<br />
jedoch für den Mai 1918 nicht nachgewiesen werden. Der Name „Wilhelmplatz“ und nicht<br />
„Wilhelm-Himmelmann-Platz“ wird deutlich an <strong>der</strong> Entscheidung des Gemein<strong>der</strong>ates im Juli<br />
1933, als <strong>der</strong> „Wilhelmplatz“ offiziell in „Wilhelm-Himmelmann-Platz“ umbenannt wird;<br />
zum gleichen Zeitpunkt wurden auch die bereits erwähnten Straßen „Karlstraße“ und „Friedrichstraße“<br />
durch den Zusatz <strong>der</strong> Familiennamen Wildschütz und Bering namentlich „vervollständigt“.<br />
In den Jahren nach dem 1. Weltkrieg wurden die bereits in Teilbereichen vor 1914 aufgeschlossenen<br />
Baugebiete weiterbebaut und entsprechende Straßen eingerichtet und benannt.<br />
Der zeitliche Rahmen liegt dabei genau in den Jahren <strong>der</strong> politischen und wirtschaftlichen<br />
Stabilitätsphase <strong>der</strong> Weimarer Republik zwischen 1924 und 1928. Somit deckt sich die allgemeine<br />
Situation im Deutschen Reich mit <strong>der</strong> Situation in <strong>der</strong> Industriegemeinde Fröndenberg.<br />
3 <strong>Die</strong>ses große Baugebiet, das bis Mitte <strong>der</strong> 60er Jahre des 20. Jahrhun<strong>der</strong>ts flächendeckend bebaut wurde,<br />
verdankt seine Entstehung <strong>der</strong> Begradigung des Ruhrverlaufs im Zuge <strong>der</strong> Entstehung des Wasserwerks (1897)<br />
und des Elektrizitätswerks (1907) und <strong>der</strong> Zuschüttung des Mühlengrabens auf dem Firmengelände <strong>der</strong><br />
Papierfabrik Himmelmann, als diese Dampf und Elektrizität anstatt <strong>der</strong> bisherig genutzten Wasserkraft als<br />
Energiequelle einsetzte.<br />
4 Wilhelm Himmelmann (1841-1918) war <strong>der</strong> Mitbegrün<strong>der</strong> und später alleinige Besitzer <strong>der</strong> ab 1854<br />
entstandenen Papierfabrik Himmelmann, noch vor <strong>der</strong> Firma UNION die erste große Industriegründung in<br />
Fröndenberg, die bis in die 1970er Jahre für die Stadt von großer Bedeutung als Arbeitgeber und<br />
Gewerbesteuerzahler war. <strong>Die</strong> 1921 erwähnte Benennung des Wilhelmplatzes im Jahre 1918 dürfte kurz nach<br />
dem Tod des Firmengrün<strong>der</strong>s erfolgt sein.
20<br />
Zwischen 1924 und 1929 entstanden 55 Wohnhäuser mit 150 Wohnungen. 5<br />
Nicht zeitlich in den Gemein<strong>der</strong>atsprotokollen nachzuweisen ist die namentliche Benennung<br />
<strong>der</strong> Verbindungsstraße zwischen <strong>der</strong> Westicker Straße und dem Wohnplatz Hohenheide.<br />
<strong>Die</strong>se Straße erhielt wahrscheinlich mit Inbetriebnahme des katholischen Marienkrankenhauses<br />
Ende <strong>der</strong> 1920er Jahre auf dem Hirschberg und <strong>der</strong> in ihrem südlichen Verlauf<br />
beginnende Wohnbebauung die Bezeichnung „Am Hirschberg“ .<br />
In zeitlicher Reihenfolge wurden ab 1924 folgende Straßen benannt:<br />
19.08.1924 „Bertholdusstraße“ (Baugebiet Sümberg)<br />
19.08.1924 „Engelbertstraße“ (Baugebiet Sümberg)<br />
19.08.1924 „Graf-Adolf-Straße“ (Baugebiet Fröndenberg-Ost/Westick)<br />
19.08.1924 „Irmgardstraße“ (Baugebiet Sümberg)<br />
03.10.1924 „Klusenweg“ (Baugebiet östlicher Mühlenberg)<br />
03.10.1924 „Mühlenbergstraße“ (Baugebiet östlicher Mühlenberg)<br />
03.10.1924 „Wasserwerkstraße“ (Baugebiet Fröndenberg-Ost/Westick)<br />
05.01.1926 „Westickerfeldweg“ (nachgewiesen ist hier nicht die Benennung, son<strong>der</strong>n die<br />
Planung <strong>der</strong> Bebauung an einem bereits lange bestehenden Feldweg)<br />
10.08.1926 „Auf dem Beisen“ (Baugebiet Fröndenberg-Ost/Westick)<br />
10.08.1926 „Fischerssiepen“ (Altbestand nördlich des Stifts auf <strong>der</strong> Freiheit, bisher aber<br />
noch ohne Namen gewesen)<br />
10.08.1926 „Zwischen den Wegen“ (Baugebiet Fröndenberg/Ost/Westick)<br />
10.08.1926 „Hengstenbergstraße“ (Baugebiet Fröndenberg-Ost/Westick)<br />
10.08.1926 „Münzenfundstraße“ (Baugebiet Fröndenberg-Ost/Westick)<br />
Herbst 1928, wahrscheinlich mit Fertigstellung des Neubaus <strong>der</strong> gleichnamigen katholischen<br />
Volksschule „Overbergschule“, die „Overbergstraße“, wobei hierzu die Umwidmung<br />
eines Teils <strong>der</strong> Sümbergstraße notwendig war.<br />
<strong>Die</strong> Straßen im Baugebiet Fröndenberg-Ost/Westick bildeten ab 1933 die Basis für die Entstehung<br />
eines „Dichter- und Denkerviertels“, 6 während ihre ursprüngliche Benennung den<br />
alten Flurbezeichnungen folgte mit Ausnahme <strong>der</strong> „Münzenfundstraße“, die nach einem hier<br />
Ende des 19. Jahrhun<strong>der</strong>ts entdeckten Münzschatzes benannt wurde.<br />
Zwischen Ende 1928 und März 1933 kamen keine neuen <strong>Straßennamen</strong> hinzu; entwe<strong>der</strong> wurden<br />
an bereits mit Namen versehenen Straßen noch bestehende Baulücken geschlossen o<strong>der</strong><br />
die heraufziehende Weltwirtschaftskrise verhin<strong>der</strong>te weitere Bau- und Ausbaumaßnahmen.<br />
Hinsichtlich <strong>der</strong> Namensgebung sind für diese Zeit zwei neue Tendenzen sichtbar. Zum einen<br />
wird erstmals 1926 mit <strong>der</strong> „Hengstenbergstraße“ eine überregional bekannte Persönlichkeit<br />
geehrt, die in Fröndenberg geboren wurde; Näheres dazu im Exkurs 1 <strong>der</strong> vorliegenden<br />
Arbeit. Zwar wurden bereits vorher etwas verklausuliert an<strong>der</strong>e bekannte <strong>Fröndenberger</strong><br />
Persönlichkeiten in dieser Form geehrt, aber erstens waren diese nicht überregional bekannt<br />
und zweitens wurden (zunächst) nur die Vornamen verwendet, wobei <strong>der</strong> nicht mit <strong>der</strong><br />
Ortsgeschichte vertraute Betrachter auch auf die Idee hätte kommen können, dass hier Straßen<br />
nach bekannten Vornamen von Landesherren, preussischen Herrschergestalten etc. benannt<br />
wurden (z.B. Karl nach Karl dem Großen, Friedrich nach Friedrich dem Großen o<strong>der</strong><br />
Wilhelm nach dem 1888 verstorbenen Kaiser Wilhelm, um nur einige wenige mögliche<br />
Gestalten <strong>der</strong> <strong>Geschichte</strong> zu nennen).<br />
5 „Hellweger Anzeiger“ vom 19.11.1929<br />
6 Siehe dazu Kapitel D <strong>der</strong> vorliegenden Arbeit
21<br />
Zum an<strong>der</strong>en besann man sich in den 20er Jahren auf die für die Ortsgeschichte in<br />
Fröndenberg entscheidenden Persönlichkeiten <strong>der</strong> Kirchengeschichte und <strong>der</strong> Märkischen<br />
Landes- und Territorialgeschichte. 7 Der Kanoniker des Klosters Scheda Bertholdus gilt als<br />
Begrün<strong>der</strong> des <strong>Fröndenberger</strong> Zisterzienserinnenklosters und die Landesherren Adolf und<br />
Engelbert, sowie Engelberts erste Ehefrau Irmgard wurden in <strong>der</strong> Klosterkirche des Ortes<br />
beigesetzt. 8<br />
In diesen Zusammenhang gehört wahrscheinlich auch die Benennung <strong>der</strong> „Antoniusstraße“<br />
im Baugebiet Fröndenberg-Ost /Westick, wobei lei<strong>der</strong> we<strong>der</strong> ein genaues Benennungsdatum<br />
bekannt ist, noch <strong>der</strong> eigentliche Zusammenhang mit <strong>der</strong> Figur des hiermit geehrten Kirchenheiligen<br />
Antonius mit <strong>der</strong> <strong>Fröndenberger</strong> Kircheng- und Klostergeschichte. 9<br />
Ein sehr wichtiges Detail für die Frage <strong>der</strong> Straßenbeschil<strong>der</strong>ung und <strong>der</strong> Hausnummerierung<br />
enthält das Gemein<strong>der</strong>atsprotokoll vom 29. August 1930. Hier heißt es: „Wegen <strong>der</strong> schlechten<br />
Finanzlage <strong>der</strong> Gemeinde wird die Beschaffung <strong>der</strong> neuen Hausnummern und <strong>der</strong> Strassenschil<strong>der</strong><br />
bis auf Weiteres zurückgestellt“ und weiter: „<strong>Die</strong> neue Hausnummerierung soll<br />
aber schon jetzt in Kraft treten“,<br />
Zwei wichtige Schlussfolgerungen ergeben sich daraus.<br />
1. vor 1930 gab es keine Straßenbeschil<strong>der</strong>ung<br />
2. 1930 wurde ein neues Schema <strong>der</strong> Hausnummerierung entwickelt und sollte die<br />
alte durcheinan<strong>der</strong> laufende Hausnummerierung ersetzen.<br />
Beide Projekte wurden ab 1934 angegangen und im Zuge <strong>der</strong> Umbenennung von Straßen<br />
verwirklicht. Aus <strong>der</strong> Tatsache, dass 1934 auch Schil<strong>der</strong> für bereits vor 1914 existierende<br />
Straßen bestellt wurden, kann gefolgert werden, dass sich <strong>der</strong> Sparbeschluss des Gemein<strong>der</strong>ates<br />
von 1930 auf die Beschaffung von Schil<strong>der</strong>n für alle <strong>Straßennamen</strong> bezog und<br />
nicht alleine auf die zwischen 1924 und 1928 neu entstandenen <strong>Straßennamen</strong>.<br />
Alle neuen <strong>Straßennamen</strong> von 1906 bis März 1933 im Überblick:<br />
Zu den Benennungsdaten siehe die Tabelle auf Seite 20.<br />
Am Hirschberg<br />
Antoniusstraße, im Juli 1933 umbenannt in „Goethestraße“<br />
Auf dem Beisen, vor 1930 bereits einbezogen in den Westickerfeldweg, siehe dort<br />
Bertholdusstraße<br />
Engelbertstraße<br />
Fischerssiepen<br />
Gartenstraße, zum 1.1.1971 umbenannt in „Blumenstraße“ wegen Namensdoppelung im<br />
Zuge <strong>der</strong> Umbenennungen nach <strong>der</strong> kommunalen Neuglie<strong>der</strong>ung ab 1.1.1968.<br />
Graf-Adolf-Straße<br />
Hengstenbergstraße<br />
7 Nach dem 2. Weltkrieg und wie<strong>der</strong> einsetzen<strong>der</strong> Bautätigkeit fand diese „Rückbesinnung“ ihre logische<br />
Fortsetzung mit Straßenbenennungen nach Menricus, Eberhard (Everhardus) und Mauritius.<br />
8 Nähere Erläuterungen zu diesen Persönlichkeiten im Teil A3 und J <strong>der</strong> vorliegenden Arbeit<br />
9 Zwar kommen als Namenspatrone theoretisch beide Heilige mit Namen Antonius in Frage, zu vermuten ist<br />
aber die Benennung nach „Antonius dem Großen“, auch „Antonius Abbas“ o<strong>der</strong> „Antonius <strong>der</strong> Einsiedler“<br />
(251-156), <strong>der</strong> in <strong>der</strong> kirchlichen Tradition Schutzheiliger <strong>der</strong> Eremiten und Einsiedler ist und dem eine<br />
führende geistliche Rolle bei <strong>der</strong> Bildung erster klösterlicher Lebensformen zukam. So ergäbe sich eine<br />
Verbindung zu den Eremiten Bertholdus und Menricus, die vor und während <strong>der</strong> unermüdlichen För<strong>der</strong>ung<br />
des Baus <strong>der</strong> <strong>Fröndenberger</strong> Kirche und des Klosters oberhalb des späteren Klostergeländes in einer Klause<br />
(Klusenweg!) gelebt haben sollen. Zudem gilt Antonius als einer <strong>der</strong> beson<strong>der</strong>s im Sauerland verehrten<br />
Schutzheiligen („Fickeltünnes“). Mehr als heute rechnete sich Fröndenberg bis Mitte des 20. Jh. dem<br />
Sauerland zugehörig; wenn nicht politisch, so doch landschaftlich und kirchlich.<br />
Quelle: Artikel in <strong>der</strong> „Westfalenpost“ vom 19.6.1993 und Theodosius Briemle, „Unsere Heiligen“, Stuttgart<br />
1954
22<br />
Irmgardstraße<br />
Klusenweg<br />
Löhnbachstraße, 1933 umbenannt in Bismarckstraße 10<br />
Mühlenbergstraße<br />
Münzfundstraße (in einigen Akten auch mit „Zum Münzenfund“ bezeichnet“), im Juli 1933<br />
anteilig umbenannt in „Hermann-Löns-Straße“<br />
Ein weiterer Teil wurde in „Lessingstraße“ umbenannt, nicht identisch mit <strong>der</strong> heutigen<br />
Lessingstraße, einer Neubaustraße nach dem 2. Weltkrieg weiter westlich im gleichen Siedlungsgebiet.<br />
<strong>Die</strong> „alte“ Lessingstraße wurde später einbezogen in <strong>der</strong> Verlauf <strong>der</strong> „Hermann-<br />
Löns-Straße“.<br />
Overbergstraße, benannt nach dem kath. Reformpädagogen Bernhard Overberg (1754-1826)<br />
Wasserwerkstraße, Zuwegung von <strong>der</strong> Löhnbachstraße zum Wasser- u. Elektrizitätswerk<br />
Westickerfeldweg, im Juli 1933 umbenannt in „Annette-von-Droste-Hülshoff-Straße“<br />
Zwischen den Wegen, im Juli 1933 umbenannt in „Vom-Stein-Straße“, 1971 wegen<br />
Verwechslungsgefahr mit <strong>der</strong> in Frömern liegenden Von-Steinen-Straße in Erinnerung an den<br />
Verfasser <strong>der</strong> „Westfälischen <strong>Geschichte</strong>“ in „Hardenbergstraße“ umbenannt.<br />
Seit Juli 1906 gab es für die Gemeinde Fröndenberg ein Ortsstatut und eine Polizeiverordnung,<br />
die mit Wirkung vom 25. November 1924 abgeän<strong>der</strong>t, 1931 abermals überarbeitet<br />
wurde.<br />
Im Vorfeld dieses neuen Ortsstatut erstellte das Bauamt eine Liste <strong>der</strong> vorhandenen Straßen,<br />
zunächst unabhängig ihres Ausbauzustandes. Ausgehend von dieser Liste wurden für eine<br />
amtliche Bekanntmachung diejenigen Straßen ausgewählt, <strong>der</strong>en Ausbauzustand so weit<br />
fortgeschritten war, dass das Ortsstatut zur Reinigung <strong>der</strong> Bürgersteige und Rinnsteine zur<br />
Anwendung kommen konnte. 11<br />
Beide Listen ergeben somit einen erstens Überblick über alle 12 zu diesem Zeitpunkt existierenden<br />
Straßen und zweitens einen Überblick über <strong>der</strong>en (teilweise auch erst anteiligen)<br />
Ausbauzustand hinsichtlich Straßenpflasterung, Rinnsteine und Bürgersteige.<br />
Im Folgenden sind beide Listen wie<strong>der</strong>gegeben, auch weil diese den letzten amtlichen<br />
Bestand an <strong>Straßennamen</strong> vor den Umbenennungen <strong>der</strong> NS-Zeit im Überblick zeigen. Auch<br />
wird dadurch deutlich, dass für den Wohnplatz Hohenheide bereits zu diesem Zeitpunkt<br />
<strong>Straßennamen</strong> vergeben waren, auch wenn diese Anfang <strong>der</strong> dreißiger Jahre laut Aussage<br />
älterer Anwohner eher ausgefahrenen Feldwegen glichen ohne feste Fahrbahn, geschweige<br />
denn mit Rinnsteinen o<strong>der</strong> Bürgersteigen versehen waren. 13<br />
10 Ab Dezember 1936 gab es wie<strong>der</strong> eine von <strong>der</strong> Bismarckstraße nach Süden abzweigende Löhnbachstraße;<br />
siehe dazu Seite 34 <strong>der</strong> vorliegenden Arbeit, Teil D<br />
11 StaF, Bestand A 6318, siehe dazu im Anhang 1 die lfd. Nr. 6<br />
12 Es fehlt auf dieser Liste <strong>der</strong> Wilhelmplatz (späterer „Wilhelm-Himmelmann-Platz“), <strong>der</strong> allerdings um 1930<br />
trotz seiner Benennung noch keinen „Platzcharakter“ o<strong>der</strong> Pflasterung besaß und zudem ringsum eingerahmt<br />
wurde von dem Wohnbezirk „Stift“, so dass dieser Bereich in <strong>der</strong> Liste abgedeckt ist, was auch aus <strong>der</strong><br />
Erwähnung des Platzes in <strong>der</strong> zweiten Liste <strong>der</strong> von den Anliegern zu reinigenden Straßen hervorgeht.<br />
Nur in dieser Liste wird <strong>der</strong> Name „Westick“ als Straßenname geführt, was irreführend ist, da sich dahinter<br />
<strong>der</strong> Wohnplatz „Westick“ verbirgt, (Kern <strong>der</strong> ehemals selbständigen Gemeinde Westick bestehend aus einigen<br />
Höfen) <strong>der</strong> an keiner einzelnen Straßenführung gelegen war und somit im engeren Sinne keine Straße war.<br />
13 Näheres dazu siehe Exkurs „Hohenheide“, Seite 29ff
Straßenverzeichnis <strong>der</strong> Gemeinde Fröndenberg (Stand Juni 1931)<br />
nach heute amtlicher Schreibweise<br />
Am Hirschberg<br />
Am Steinbruch (Hohenheide)<br />
Auf dem Sodenkamp<br />
Auf <strong>der</strong> Freiheit<br />
Auf dem Krittenschlag<br />
Antoniusstraße<br />
Ardeyer Straße<br />
Bahnhofstraße<br />
Bertholdusstraße<br />
Bergstraße<br />
Karlstraße<br />
Engelbertstraße<br />
Eulenstraße<br />
Fischerssiepen<br />
Freiheitstraße<br />
Friedhofstraße<br />
Friedrichstraße<br />
Gartenstraße<br />
Graf-Adolf-Straße<br />
Haßleistraße<br />
Hengstenbergstraße<br />
Hohenheide (Hohenheide)<br />
Im Schelk (Hohenheide)<br />
Im Stift<br />
In den Telgen (Hohenheide)<br />
In den Wächelten (Hohenheide)<br />
In <strong>der</strong> Waldemey (Hohenheide)<br />
Irmgardstraße<br />
Kirchplatz<br />
Klusenweg<br />
Löhnbachstraße<br />
(Am) Markt<br />
Mühlenbergstraße<br />
Münzenfundstraße<br />
Ostbürener Straße<br />
Overbergstraße<br />
Parkstraße<br />
Querweg (Hohenheide)<br />
Ruhrstraße<br />
Schroerstraße<br />
Schulstraße<br />
Unnaer Straße<br />
Wasserwerkstraße<br />
Westick<br />
Westickerstraße<br />
Westickerfeldweg<br />
Westicker Heide (Hohenheide)<br />
Zwischen den Wegen<br />
23
24<br />
Aus dieser Liste entwickelte die Wegebaukommission, nach Rücksprache mit <strong>der</strong> Polizeiverwaltung<br />
eine Liste <strong>der</strong> Straßen, an denen die Anlieger ihren Reinigungspflichten gemäss des<br />
neuen Ortsstatut nachzukommen hatten.<br />
Mit Bekanntmachung, ausgehängt im „Gitterkasten“ vom 23.2.1932 bis 8.3.1932, waren hier<br />
folgende Straßen (zum Teil wegen ihres noch nicht durchgehend befestigten Ausbauzustand<br />
nur anteilig) aufgeführt:<br />
(wie<strong>der</strong>gegeben wie im Original nicht nach Alphabet)<br />
Karlstraße,<br />
Am Markt,<br />
Ardeyer Straße, vom Markt bis zum Grundstück (...),<br />
Ruhrstraße,<br />
Westickerstraße vom Markt bis zum Bahnübergang,<br />
Bahnhofstraße,<br />
Schulstraße,<br />
Eulenstraße,<br />
Ostbürener Straße bis zum Hof Wiehage Nr. 15,<br />
Friedhofstraße von <strong>der</strong> Eulenstraße bis zum Schulplatz <strong>der</strong> evangelischen Schule und<br />
vom Friedhof bis zur Sümbergstraße,<br />
Sümbergstraße,<br />
Bertholdusstraße,<br />
Friedrichstraße,<br />
Graf-Adolf-Straße,<br />
Auf <strong>der</strong> Freiheit von <strong>der</strong> Parkstraße bis einschl. evangelisches Krankenhaus,<br />
Haßleistraße vor den Grundstücken Prünte Nr. 42 und 46,<br />
Parkstraße von <strong>der</strong> Ardeyer Straße bis zur Bergstraße und vor den Grundstücken (...),<br />
Löhnbachstraße vor dem Grundstück Himmelmann,<br />
Im Stift vom Markt bis Wilhelmplatz (...)<br />
Aus dem Vergleich <strong>der</strong> Listen geht hervor, dass beson<strong>der</strong>s in den angeführten Neubaugebieten<br />
<strong>der</strong> 20er Jahre im Baugebiet Fröndenberg-Ost/Westick einige Straßen zwar angelegt<br />
und mit Namen versehen worden waren, jedoch noch teilweise unbebaut waren, bzw. sich<br />
eventuell noch im Rohbau befanden, so dass noch keine endgültige Straßenfertigstellung<br />
erfolgt war (Antoniusstraße, Hengstenbergstraße, Westickerfeldweg, Münzenfundstraße,<br />
Zwischen den Wegen).
25<br />
Exkurs I<br />
Hintergründe <strong>der</strong> Benennung <strong>der</strong> „Hengstenbergstraße“ und <strong>der</strong>en<br />
gesellschaftspolitische Auswirkung bis in die Gegenwart<br />
Mit dem Gemein<strong>der</strong>atsbeschluss <strong>der</strong> Gemeinde Fröndenberg vom 10.8.1926, eine Neubaustraße<br />
nach dem in Fröndenberg geborenen Theologen Ernst Wilhelm Hengstenberg im<br />
Wohngebiet Fröndenberg-Ost/Westick zu benennen, betrat <strong>der</strong> Gemein<strong>der</strong>at Neuland. 1<br />
Zum ersten Mal wurde eine Straße nicht nur nach einer in Fröndenberg geborenen Person,<br />
son<strong>der</strong>n nach einer Person <strong>der</strong> deutschen Geistesgeschichte benannt.<br />
Lei<strong>der</strong> hat sich außer dem üblichen Ergebnisprotokoll <strong>der</strong> Gemein<strong>der</strong>atssitzung kein weiterer<br />
Schriftverkehr o<strong>der</strong> sonstiges Material in den Gemeindeakten darüber erhalten.<br />
In einen Artikel im „Hellweger Anzeiger“ vom 18.8.1926 heißt es zum Thema <strong>der</strong> neuen<br />
<strong>Straßennamen</strong> 2 u.a.<br />
„Bekanntlich wurden in <strong>der</strong> letzten Gemein<strong>der</strong>atssitzung neue <strong>Straßennamen</strong> beschlossen. Es<br />
dürfte wohl Jeden interessieren, die Erklärung hierfür zu erhalten (...)die Hengstenbergstraße<br />
hat ihren Namen erhalten zum Gedächtnis an den in Fröndenberg im früheren Abteigebäude<br />
(jetzigen Bernsteinschen Hause) am 20. Oktober 1802 als Sohn des Pfarrers Hengstenberg geborenen<br />
und am 28. Mai 1869 in Berlin gestorbenen Professors <strong>der</strong> Theologie Ernst Wilhelm<br />
Hengstenberg. Derselbe war Begrün<strong>der</strong> und Leiter <strong>der</strong> evangelischen Kirchenzeitung und<br />
Verfasser mehrerer bedeuten<strong>der</strong> Werke wie „Christologie des Alten Testamentes“, „<strong>Die</strong><br />
Freimaurerei und das evangelische Pfarramt“, „<strong>Die</strong> Juden und die christliche Kirche“ usw.“<br />
Soweit die wörtliche Wie<strong>der</strong>gabe aus <strong>der</strong> Tagespresse, wobei <strong>der</strong>en Informationen zu<br />
Hengstenbergs Leben und zu seinen Werken mit hoher Wahrscheinlichkeit dem gerade vor<br />
einem Jahr (1925) erschienenen „<strong>Fröndenberger</strong> Heimatbuch“ von Fritz Klute 3 entnommen<br />
wurden, <strong>der</strong> gleich 15 Werke des Theologen nennt.<br />
Warum die Tagespresse gerade diese drei Werke über Christologie, Juden und Freimaurer<br />
erwähnte, kann aus heutiger Sicht nur dahingehend vermutet werden, dass es schon immer die<br />
exotischen Titel und Themen waren, die zu je<strong>der</strong> Zeit jeden Zeitungsleser ansprechen und die<br />
Beschäftigung mit Freimaurern und Juden, skeptisch beobachteten Randgruppen über die man<br />
mehr redete als wusste, erschienen dem Redakteur wohl deshalb beson<strong>der</strong>s erwähnenswert.<br />
Nicht nachzuweisen ist, ob <strong>der</strong> Gemein<strong>der</strong>at von sich aus die Benennung vornahm, o<strong>der</strong> ob<br />
ein entsprechen<strong>der</strong> Antrag <strong>der</strong> Gemein<strong>der</strong>atsfraktion <strong>der</strong> „Evangelischen Volksliste“ o<strong>der</strong><br />
auch einer an<strong>der</strong>en im Gemein<strong>der</strong>at vertretenen Partei vorlag o<strong>der</strong> eventuell ein Schreiben <strong>der</strong><br />
evangelischen Kirchengemeinde als Empfehlung o<strong>der</strong> Bitte um Benennung vorlag.<br />
Hengstenberg war ein bereits zu Lebzeiten umstrittener und streitbarer Theologe, dessen<br />
Werke zwei entscheidende Kernthemen enthalten. Zum ersten einen militanten Antijudaismus<br />
im Sinne des Spätwerkes von Martin Luther und zum zweiten ein vehementes Eintreten<br />
für die preußische Einheit von Thron und Altar, Gottesgnadentum des Königs und Kampf<br />
gegen die Volksbildung beson<strong>der</strong>s auf dem Lande. Themen also, die eigentlich im Jahr 1925<br />
in einem demokratischen Staat nicht unbedingt auf <strong>der</strong> Agenda standen, o<strong>der</strong> doch?<br />
1 Siehe dazu Kopie aus dem Gemein<strong>der</strong>atsprotokoll vom 10.8.1926 im Anhang 1 lfd. Nr.7<br />
2 Auf <strong>der</strong> gleichen Ratssitzung wurden auch die Straßen „Zum Münzenfund“, „Auf den Beisen“, „Zwischen den<br />
Wegen“ und „Fischerssiepen“ benannt.<br />
3 Fritz Klute, Fröndenberg einst und jetzt, Fröndenberg 1925 (unverän<strong>der</strong>ter Nachdruck Fröndenberg 1981),<br />
Seite 198 im Zusammenhang mit noch bestehenden Bauwerken aus stiftisch-klösterlicher Zeit. Hengstenberg<br />
wurde in einem ehemaligen Abteigebäude geboren, das vom preussischen Domänenfiskus dem reformierten<br />
Pastor als Wohnung zugewiesen worden war. 1827 kaufte <strong>der</strong> jüdische Bürger Kusel Bernstein dieses heute<br />
älteste erhaltene Profangebäude <strong>der</strong> Stadt, das aus dem Jahr 1607 stammt.
26<br />
Dazu jeweils ein Zitat aus seinen Werken, zunächst zum Antijudaismus:<br />
„Luther hat das Wesen <strong>der</strong> Juden tief und ernst erkannt“. Mit diesen Worten kommentiert<br />
Hengstenberg Luthers Postulat gegenüber den Juden, die sich „verstockt“ und immun gegenüber<br />
dem Übertritt zum Protestantismus zeigten. Weiter heißt es:<br />
„Man verbrenne ihre Hütten und Synagogen und treibe sie unbarmherzig zur Arbeit an“ 4<br />
Zur Allgemeinbildung auf dem Lande äußert sich Hengstenberg wie folgt:<br />
„Ein Landschullehrer braucht nicht beson<strong>der</strong>s gelehrt zu sein; ja eine gewisse Unwissenheit<br />
und Selbstbescheidenheit wird ihm prächtig zustatten kommen“ 5 und weiter:<br />
„Landschullehrer in unseren Tagen sind nichts als unchristliche Buben und Mietlinge“ o<strong>der</strong><br />
„wie viel Gottesfurcht, Pietät gegen König, Beugung unter Autorität möchte heutzutage in<br />
den unteren Schichten <strong>der</strong> Bevölkerung vorgefunden werden, wenn sie nicht lesen könnten“ 6<br />
Waren diese Äußerungen im „Jahr Sieben“ <strong>der</strong> Weimarer Republik dem Gemein<strong>der</strong>at bekannt,<br />
<strong>der</strong> nur wenig später unter Ausnutzung letzter finanzieller Rücklagen <strong>der</strong> Gemeinde<br />
den Bau <strong>der</strong> katholische Volksschule (Overbergschule) beschloss?<br />
Es darf nicht verkannt werden, dass die „Evangelische Volksliste“ in Fröndenberg die stärkste<br />
Fraktion vor <strong>der</strong> Fraktion <strong>der</strong> Zentrumspartei im Gemein<strong>der</strong>at dieser Jahre war und in ihrer<br />
Grundausrichtung <strong>der</strong> Monarchie ebenso verhaftet gebliebe war, wie einem kleinbürgerlichen<br />
Antisemitismus, <strong>der</strong> in breiten Kreisen „zum guten Ton gehörte“.<br />
Ohne den militanten Antijudaismus Hengstenbergs zu verharmlosen, muss vermutet werden,<br />
dass die Straßenbenennung auf Grund des Stolzes erfolgte, einen Professor als gebürtigen<br />
<strong>Fröndenberger</strong> als Sohn <strong>der</strong> Gemeinde ehren zu dürfen.<br />
<strong>Die</strong> Vermutung liegt sehr nahe, dass inhaltliche Aussagen in Hengstenbergs Werken zumindest<br />
nicht auf ihre Übereinstimmung mit den Werten <strong>der</strong> Weimarer Verfassung hin überprüft<br />
wurden, so sie (die Schriften Hengstenbergs) denn inhaltlich den Entscheidungsträgern, über<br />
ihre bloße Existenz hinaus, überhaupt inhaltlich bekannt gewesen sind.<br />
Für eine Landgemeinde, die stets Wert darauf legte, Schulmittelpunkt des Amtes zu sein und<br />
großen Wert auf eine qualitative Besetzung <strong>der</strong> Lehrerstellen legte (aus dem jeweiligen<br />
Kontext <strong>der</strong> Zeit heraus, wie Qualität definiert wurde), war die Benennung nach Ernst<br />
Wilhelm Hengstenberg jedenfalls ein Fehlgriff, wenn die Problematik denn überhaupt erkannt<br />
worden wäre!<br />
1945 jedenfalls, nachdem <strong>der</strong> seinerzeit salonfähige Antisemitismus in den zurückliegenden<br />
12 Jahren zum Holocaust mutiert war, wurde die Problematik <strong>der</strong> Straßenbenennung nach<br />
dem antijudaistischen Professors vom Gemein<strong>der</strong>at nicht erkannt, denn <strong>der</strong> seit 1926<br />
bestehende Straßenname stand nicht auf <strong>der</strong> Liste <strong>der</strong> umzubenennenden Straßen, die dieser<br />
zumindest von alten Kämpfern und bekennenden wie tätigen Nationalsozialisten gesäuberte<br />
Gemein<strong>der</strong>at im Juli 1945 beriet. Geän<strong>der</strong>t wurden nur die ganz offensichtlich nach Nazi-<br />
4 Zitiert nach: Ernst Wilhelm Hengstenberg, <strong>Die</strong> Opfer <strong>der</strong> heiligen Schrift - <strong>Die</strong> Juden und die christliche<br />
Kirche, Berlin 1859<br />
5 Noch Hengstenbergs Vater, <strong>der</strong> reformierte Pfarrer in Fröndenberg, versuchte im Jahr 1805 einen karitativen<br />
Fonds zur Verbesserung <strong>der</strong> Lehrergehälter einzurichten, denn „schwerlich wird sich nach dem Absterben <strong>der</strong><br />
gegenwärtigen Lehrperson ein Mann von Kenntnissen und pädagogischen Fähigkeiten entschließen, diese<br />
ärmliche Stelle anzunehmen“, zitiert nach Klaus Basner, <strong>Geschichte</strong> <strong>der</strong> Schulen im Raum Fröndenberg,<br />
Fröndenberg1991, Beiträge zur Ortsgeschichte, Band 7, Seite 154<br />
6 Zitiert nach: Wilhelm Schulte, Westfälische Köpfe, 300 Lebensbil<strong>der</strong> bedeuten<strong>der</strong> Westfalen, Münster 1963,<br />
2.A. 1977, S.111ff. Der eher konservative Wilhelm Schulte widmet Hengstenberg einen Artikel in seinen<br />
Buch, lässt aber keinen Zweifel an <strong>der</strong> Umstrittenheit <strong>der</strong> Person Hengstenberg und vermutet sicher nicht zu<br />
Unrecht „Demokraten und Sozialisten wurden somit dem Christentum entfremdet“
27<br />
Größen benannten <strong>Straßennamen</strong>. <strong>Die</strong> diese Entscheidungen kontrollierende britische Militärregierung<br />
muss hier als überfor<strong>der</strong>t angesehen werden, sich <strong>der</strong> Brisanz (aus <strong>der</strong> Sicht nach<br />
Bekanntwerden <strong>der</strong> Shoah) dieses Namenspatron bewusst zu sein, entging ihnen doch auch,<br />
dass auch die Ostmarkstraße, benannt kurz nach dem „Anschluss“ <strong>der</strong> Republik Österreich an<br />
das Deutsche Reich 1938, keineswegs zur Umbenennung vorgesehen war.<br />
Das die Brisanz bis heute nicht erkannt wurde, davon zeugen die verwaltungsseitigen<br />
Reaktionen voller Unverständnis und Ratlosigkeit auf Umbenennungsanträge Anfang <strong>der</strong><br />
90er Jahre von Seiten engagierter Bürger, die es allerdings auch versäumten, Aufklärungsarbeit<br />
bei den im Rat vertretenen Parteien und den betroffenen Anliegern <strong>der</strong> zur<br />
Umbenennung gewünschten Straße zu leisten und die verkannten, welche Wi<strong>der</strong>stände aus<br />
rein pragmatischer Überlegung heraus die Anlieger dazu bewog, Umbenennungsplänen eine<br />
klare Absage zu erteilen.<br />
Pragmatische und verwaltungstechnische Gründe, die eventuell bei <strong>der</strong> Umbenennung einer<br />
nach NS-Größen benannten Straße hintangestellt worden wären, aber im Falle <strong>der</strong> Hengstenbergstraße,<br />
gerade wegen <strong>der</strong> Unkenntnis <strong>der</strong> Anwohner um die Hintergründe und die Biographie<br />
des Namensgebers überwogen.<br />
Als „linke Krawallmacher“ und „Wichtigtuer“, die einen verdienten „Sohn <strong>der</strong> Gemeinde“<br />
um seinen Ruhm bringen wollen, wurden die Antragsteller in <strong>der</strong> Öffentlichkeit diffamiert<br />
und eine mögliche Umbenennung als „Wiehern des Amtsschimmels“ <strong>der</strong> verhin<strong>der</strong>t werden<br />
müsse.<br />
<strong>Die</strong> aufgeschreckten und auch sachlich über die Person des Theologieprofessors<br />
uninformierten und überfor<strong>der</strong>ten Ratsmitglie<strong>der</strong> die sich mit dem Bürgerantrag zur Umbenennung<br />
zu befassen hatten, ließen sehr schnell die Finger davon und schmetterten ihn auf<br />
Grund von formalen Fehlern seitens <strong>der</strong> Antragsteller ab. Auch die evangelische Kirchengemeinde<br />
reagierte empört und beleidigt, dass einer <strong>der</strong> ihren und dazu noch ein geborener<br />
<strong>Fröndenberger</strong> hier um sein Ansehen gebracht werden sollte.<br />
<strong>Die</strong> noch immer „Unentwegten“ denen nach wie vor <strong>der</strong> Name des Theologen unangenehm<br />
aufstößt, können sich bislang nur damit trösten, dass wohl kein <strong>Fröndenberger</strong> Bürger<br />
ernsthaft den Theorien des Theologieprofessors anhängt; einfach deswegen, weil ihn keiner<br />
mehr kennt, geschweige denn seine Werke gelesen hätte und aller Wahrscheinlichkeit nach<br />
den meisten <strong>Fröndenberger</strong>n als erste Assoziation bei <strong>der</strong> Nennung des Namens „Hengstenberg“<br />
eher das gleichnamige Sauerkraut einfallen dürfte.<br />
Das Stadtarchiv, 2004 betraut mit <strong>der</strong> Neufassung <strong>der</strong> historischen Angaben zur<br />
Ortsgeschichte auf den Internetseiten im Web hat erfolgreich, aber still und leise ohne großes<br />
Aufheben den Namen Hengstenberg aus <strong>der</strong> Liste <strong>der</strong> „berühmten <strong>Fröndenberger</strong>“<br />
Persönlichkeiten ersatzlos streichen lassen, ohne dass deswegen Erklärungen und Diskussionen<br />
in <strong>der</strong> Verwaltung nötig gewesen wären.<br />
<strong>Die</strong> Än<strong>der</strong>ung von Internetseiten war, an<strong>der</strong>s als eine Straßenumbenennung mit allen ihren<br />
Folgen, eben ein nahezu kostenloser Akt <strong>der</strong> Verwaltung, ging geräuschlos über die Bühne<br />
und befriedigte so wenigstens teilweise die Gegner des Theologieprofessors, die mit diesem<br />
Teilerfolg <strong>der</strong> Eliminierung aus <strong>der</strong> Ortsgeschichte nun recht gut leben können.<br />
<strong>Die</strong> Existenz <strong>der</strong> Hengstenbergstraße aber wird auf absehbare Zeit eine bestehen bleibende<br />
Episode <strong>der</strong> <strong>Straßennamen</strong>geschichte bleiben, zumal sich die Gegner Hengstenbergs in<br />
Jüngster Zeit im Zusammenhang einer Ausstellung über die Spuren jüdischen Lebens in<br />
Fröndenberg, selber nicht mehr einig sind in ihrer Protestfront und sich nicht dahingehend<br />
verständigen können, ob Hengstenberg nun wirklich Antisemit im heutigen Sinne o<strong>der</strong> „nur“
28<br />
Antijudaist im theologischen Sinn <strong>der</strong> Erweckungsbewegung Mitte des 19. Jahrhun<strong>der</strong>ts<br />
gewesen ist.<br />
<strong>Die</strong> Erfolglosigkeit bei <strong>der</strong> Bekämpfung <strong>der</strong> Erinnerung an den vor mehr als 130 Jahren<br />
verstorbenen Theologieprofessors sollte aber niemanden entmutigen sich weiterhin aktiv<br />
dafür einzusetzen, dass bei neu zu benennende Straßen die Möglichkeiten besteht, an bisher<br />
nicht geehrte Persönlichkeiten auch des Wi<strong>der</strong>standes o<strong>der</strong> <strong>der</strong> demokratischen Kultur- und<br />
Geistesgeschichte zu erinnern.<br />
Anbieten würde sich hier <strong>der</strong> Name des aus Fröndenberg stammenden Juristen Wilhelm zur<br />
Nieden, auch er ein Sohn eines Pfarrerehepaars, <strong>der</strong> auf Grund seiner Beteiligung an den<br />
Umsturzplänen gegen Hitler 1944 von den Nationalsozialisten in den letzten Kriegstagen am<br />
23.April im Gestapogefängnis an <strong>der</strong> Lehrter Straße in Berlin gehängt wurde.<br />
Wenn auch noch keine Straße nach ihm benannt wurde, so vervollständigt er doch nun ab<br />
2005 würdig die Reihe <strong>der</strong> im Internet genannten verdienten Bürger <strong>der</strong> Stadt. Übrigens war<br />
seitens <strong>der</strong> Verwaltung bisher dieser Namen nahezu unbekannt; auch ein Zeichen des<br />
Vertrauens gegenüber dem Archiv, dem bekundet wurde, zum Glück habe man ja jetzt<br />
jemand, <strong>der</strong> sich mit solchem Kram auskenne...!<br />
Auch zukünftige Generationen, wenn sie sich denn dafür überhaupt interessieren, werden mit<br />
<strong>der</strong> Hengstenbergstraße und damit mit den Brüchen <strong>der</strong> deutschen <strong>Geschichte</strong> leben lernen<br />
müssen.<br />
Immerhin aber ist dies ein interessantes Beispiel <strong>der</strong> <strong>Fröndenberger</strong> <strong>Straßennamen</strong>geschichte,<br />
das deutlich macht, wie problematisch die Benennung von Straßen nach „berühmten“ Persönlichkeiten<br />
ist und wie bei Paradigmenwechsel <strong>der</strong> Zeitgeschichtsbetrachtung Entscheidungen<br />
diesbezüglich zu Recht in das Zwielicht <strong>der</strong> nachfolgenden Generationen geraten können.<br />
Dass es durchaus im Bereich des Möglichen liegt, einmal beschlossene und durchgeführte<br />
<strong>Straßennamen</strong>gebungen wie<strong>der</strong> zu än<strong>der</strong>n, wenn denn die betroffenen Anwohner die nötige<br />
Geduld, Härte und Überzeugungskraft in die Sache investieren, zeigt ein an<strong>der</strong>es eher kurios<br />
humoristisches Beispiel im Exkurs 4 <strong>der</strong> vorliegenden Arbeit.
29<br />
Exkurs 2<br />
Der „Wohnplatz“ Hohenheide und seine Straßen<br />
Das Wohngebiet <strong>der</strong> Hohenheide liegt im Nordosten <strong>der</strong> Stadt Fröndenberg und gehörte seit<br />
seiner Wohnbauung ab den 1840er Jahren zum Gebiet <strong>der</strong> ehemals selbständigen Gemeinde<br />
Dorf Fröndenberg, sowie zu einem kleineren Teil zur ehemals selbständigen Gemeinde<br />
Westick (betrifft „Westicker Heide“ siehe Auflistung weiter unten)<br />
<strong>Die</strong> in diesen Jahren ab 1835/36 endgültig festgelegten Grenzen <strong>der</strong> politischen Gemeinden<br />
im späteren Amtsbezirk Fröndenberg beruhen auf zahlreichen Separationsverfahren, so u.a.<br />
dem Verfahren, in dessen Verlauf ein großes Nie<strong>der</strong>wald- und Hudegebiet im Nordosten<br />
Fröndenbergs liegend, endgültig unter den Gemeinden Bausenhagen, Frömern, Dorf Fröndenberg<br />
und Neimen im südlichen Bereich des Haarstrangs, sowie den Gemeinden Dreihausen<br />
und Hemmerde im nördlichen Haarstrangebiet „auf Weisung königlich-preußischen Generalkommission<br />
in Münster 1 aufgeteilt“ wurde. Hierbei ging es nicht nur um die Aufteilung <strong>der</strong><br />
Besitzrechte son<strong>der</strong>n auch um die aus stiftischer Zeit stammende Servitutsordnung.<br />
Aufgeteilt wurde das Gebiet in 53 „Distrikte“ (Stücke), von denen zehn <strong>der</strong> Gemeinde Dorf<br />
Fröndenberg zugeteilt wurden 2 und mit seit langer Zeit tradierten Gemarkungsnamen versehen<br />
wurden. Hier entstanden ab den 1840er Jahren <strong>der</strong> zunächst aus allein stehenden Höfen<br />
und Kotten und erst im Lauf des späten 19. Jahrhun<strong>der</strong>ts enger bebauter Wohnplatz<br />
Hohenheide.<br />
Obwohl auf diesem Wohnplatz eine eigenständige katholische Kirche erbaut wurde und auch<br />
seit den 1920er Jahren bis in die 1960er Jahre eine gemischtkonfessionelle Schulgemeinde<br />
gebildet worden war, erreichte <strong>der</strong> Wohnplatz Hohenheide nie den Status einer<br />
eigenständigen politischen Gemeinde trotz einer höheren Bevölkerungszahl als manche <strong>der</strong><br />
umliegenden amtszugehörigen aber selbständigen Gemeinden.<br />
<strong>Die</strong> Namen <strong>der</strong> zehn o.g. genannten Distrikte bildeten teilweise in späteren Jahren den<br />
Grundbestand <strong>der</strong> tradierten und nicht per Gemein<strong>der</strong>atsbeschlüsse vergebenen Wege- und<br />
<strong>Straßennamen</strong>, die diese Distrikte umgrenzten o<strong>der</strong> als Hauptwegedurchzogen.<br />
Genannt werden u.a. die Distrikte „Brandheide“ 3 , „In den Wächelten“, „In den Telgen“,<br />
„Auf <strong>der</strong> Heide“ und „Krittenschlag“.<br />
Beim Vergleich mit den bis Ende des 2. Weltkrieges mit einem Namen versehenen Straßen<br />
auf <strong>der</strong> Basis des 1940 herausgegebenen Stadtplans wird dies deutlich.<br />
Für das Jahr 1940 werden im Wohngebiet Hohenheide genannt:<br />
Am Steinbruch<br />
Auf dem Krittenschlag<br />
Hohenheide<br />
Im Schelk<br />
In den Telgen<br />
In den Wächelten<br />
In <strong>der</strong> Waldemey<br />
Querweg und Westicker Heide<br />
1 Fritz Klute, Fröndenberg Einst & Jetzt, Fröndenberg 1925, Seite 285; hiermit ist die durch Gesetz vom<br />
25.9.1820 <strong>der</strong> „Generalkommission zur Regulierung <strong>der</strong> gutsherrlich - bäuerlichen Verhältnisse“ in Münster<br />
übertragene Aufgabe <strong>der</strong> „Gemeinheitsteilungen“ gemeint, <strong>der</strong>en Aufgaben bei Wolfgang Leesch,<br />
„<strong>Die</strong> Verwaltung <strong>der</strong> preussischen Provinz Westfalen 1815-1945, Münster 1993, Seite 132ff näher beschrieben<br />
wird.<br />
2 Fritz Klute, a.a.O. , Seite 285ff<br />
3 Nach diesem tradierten Flurnamen „Brandheide“ wurde 1974 eine Straße auf <strong>der</strong> Hohenheide benannt.
30<br />
Der Tradition <strong>der</strong> Namensgebung nach Gemarkungs- und Flurnamen folgend, wurden und<br />
werden bis heute auch alle weiteren Straßen mit Gemarkungs- o<strong>der</strong> Flurnamen, wenigstens<br />
aber mit landschafts- und naturorientierten Namen versehen.<br />
Auf Befragung älterer Bürger <strong>der</strong> Hohenheide blieb es bis in die 1960er Jahre bei einer nicht<br />
fortlaufend o<strong>der</strong> an Straßen orientierten Hausnummerierung. Straßenschil<strong>der</strong> mit Nennung <strong>der</strong><br />
tradierten Namen seien erst Ende <strong>der</strong> 1960er Jahren, wahrscheinlich zusammen mit <strong>der</strong><br />
Neuorganisation des <strong>Straßennamen</strong>wesens durch die kommunale Neuglie<strong>der</strong>ung ab 1968<br />
aufgestellt worden.<br />
Gleichwohl werden die o.a. <strong>Straßennamen</strong> bereits in einem offiziellen Straßenverzeichnis<br />
vom Juni 1931 4 genannt, jedoch hinsichtlich ihrer Eignung zur Anwendung des seinerzeit neu<br />
verabschiedeten Ortsstatut nicht berücksichtigt.<br />
Aussagen, denen nicht wi<strong>der</strong>sprochen werden soll, da an<strong>der</strong>e Informationen o<strong>der</strong> früherer<br />
Zeitpunkte in den Gemein<strong>der</strong>atsprotokollen Fröndenbergs o<strong>der</strong> den Akten <strong>der</strong> Bauverwaltung<br />
nicht nachgewiesen werden können.<br />
Des öfteren wird in den Gemein<strong>der</strong>atssitzungen, ab 1952 Stadtratssitzungen, bis in die 1960er<br />
Jahre des öfteren über den desolaten Zustand <strong>der</strong> Hohenhei<strong>der</strong> Straßen debattiert, jedoch nur<br />
in seltenen Fällen Ausbesserungsarbeiten beschlossen<br />
<strong>Die</strong>s deckt sich mit den Aussagen <strong>der</strong> Bürger, die bei je<strong>der</strong> sich bietenden Gelegenheit in<br />
solchen Fällen stets zum Ausdruck bringen, dass sie „sowieso“ immer benachteiligt worden<br />
wären und von <strong>der</strong> Gemeindeverwaltung und/o<strong>der</strong> <strong>der</strong> Amtsverwaltung „hier oben“ nicht<br />
genügend Aufmerksamkeit bekommen hätten.<br />
Ein Lebensgefühl, dass auch an<strong>der</strong>e Aspekte des öffentlichen Lebens einschloss; so wurde die<br />
ausschließlich in Eigenleistung Anfang <strong>der</strong> 1920er Jahre errichtete katholische Kirche vom<br />
Pa<strong>der</strong>borner Bistum erst Jahrzehnte später offiziell wahrgenommen und anerkannt, da dieses<br />
den Bau seinerzeit nicht direkt verboten, aber doch sehr kritisch gesehen hatte.<br />
4 Siehe dazu Seite 23 <strong>der</strong> vorliegenden Arbeit
31<br />
D. Straßenbenennungen und Umbenennungen vom 1.April 1933 bis zum<br />
Kriegsende 1945 in <strong>der</strong> Gemeinde Fröndenberg<br />
Nach <strong>der</strong> Neubildung <strong>der</strong> Reichsregierung „<strong>der</strong> nationalen Konzentration“ am 30.1.1933 unter<br />
dem neuen Reichskanzler Adolf Hitler und lediglich zweier an<strong>der</strong>er Minister, die <strong>der</strong> NSDAP<br />
angehörten, erfolgte am 1.2.1933 die Auflösung des Reichstags und mit <strong>der</strong> sogenannten<br />
„Reichstagsbrandverordnung“ zum „Schutz von Volk und Staat“ begann die eigentliche<br />
„Machtübernahme“ <strong>der</strong> Nationalsozialisten mit <strong>der</strong> scheinlegalen Ausschaltung oppositioneller<br />
Kräfte, Verhaftungen, Beschlagnahmungen, Wohnungsdurchsuchungen etc.<br />
So war bereits nach wenigen Wochen <strong>der</strong> Versuch kläglich gescheitert, Hitler und seine Partei<br />
von bürgerlich-nationalen Kräften „einzurahmen“, o<strong>der</strong> wie es Vizekanzler von Papen ausdrückte<br />
„an die Wand zu drücken bis er quietscht“.<br />
Genau das Gegenteil war <strong>der</strong> Fall und am 6.2. wurden in Preußen sämtliche kommunalen<br />
Vertretungen, Gemeindeparlamente und Stadträte durch die preußische Regierung unter ihrem<br />
Ministerpräsidenten Hermann Göring aufgelöst.<br />
Es kam zu Neuwahlen des Reichstages am 5.3.1933 und <strong>der</strong> Gemeindevertretungen am<br />
12.3.1933; beide bereits nahezu unter Ausschluss <strong>der</strong> KPD, bzw. unter massiver Behin<strong>der</strong>ung<br />
<strong>der</strong> SPD.<br />
Erstmals trat in Fröndenberg die NSDAP auf Gemeinde- und Amtsebene zu einer Wahl an 1<br />
und erreichte im Amt 49,1 % und in <strong>der</strong> Gemeinde Fröndenberg 35,7 % aller Stimmen. Mit<br />
den Stimmen <strong>der</strong> deutschnationalen Parteien verfügte sie auf Anhieb über die absolute<br />
Mehrheit im Raum Fröndenberg. Während die Deutschnationalen sogar in Fröndenberg noch<br />
zulegen konnten, ergab sich <strong>der</strong> hohe Stimmenanteil für die NSDAP aus dem Verzicht <strong>der</strong><br />
vorher hier sehr einflussreichen „Evangelischen Volksliste“, die zu diesen Kommunalwahlen<br />
nicht mehr antrat. Zentrum und SDP hatten nur leichte Verluste zu verzeichnen und die im<br />
Prinzip bereits nicht mehr funktionsfähige KPD hielt ihren bisherigen Stimmenanteil von 3%<br />
bei.<br />
Ähnlich sahen die Ergebnisse bei <strong>der</strong> Wahl zum Reichstag aus, hier erhielt die NSDAP in <strong>der</strong><br />
Gemeinde etwa 10% mehr Stimmen als bei <strong>der</strong> Wahl zum Gemeindeparlament. <strong>Die</strong>s spricht<br />
für die Beliebtheit <strong>der</strong> NSDAP und ihrer Führer auf Reichsebene gegenüber einer gewissen<br />
Zurückhaltung auf Ortsebene, was damit zu erklären ist, dass es vor 1930 lediglich 10 „PGs“<br />
gab, <strong>der</strong>en Zahl sich zwar bis Ende 1932 auf 105 Mitglie<strong>der</strong> erhöhte, aber bekannte und „gestandene“<br />
Kommunalpolitiker konnte die NSDAP <strong>der</strong> Wählerschaft nicht präsentieren.<br />
Als Gemeindevorsteher fungierte bis zu seinem Tod 1932 Wilhelm Kortmann, <strong>der</strong> von<br />
Gemeindesekretär Heinrich Feldmann abgelöst wurde. Am 13. 4. trat erstmals <strong>der</strong> neue Gemein<strong>der</strong>at<br />
zusammen und neuer Gemein<strong>der</strong>atsvorsitzen<strong>der</strong> wurde Prokurist Heinrich Robbert,<br />
<strong>der</strong> nach seiner „Wahl“ mit einem dreifachen „Sieg-Heil“ aller Anwesenden beglückwünscht<br />
wurde. Der einzige noch verbliebene SPD-Abgeordnete blieb <strong>der</strong> Wahl fern, die in das neue<br />
Gemeindeparlament gewählten Mitglie<strong>der</strong> von DNVP, Zentrum und KFSWR (Kampffront<br />
Schwarz-Weiß-Rot) stimmten für den Vorschlag <strong>der</strong> NSDAP.<br />
Anwesend waren bei dieser konstituierenden Sitzung auch NSDAP Landrat Klosterkemper,<br />
sowie <strong>der</strong> parteilose (noch bis September 1933 im Amt befindliche) Amtmann des Amtes<br />
Fröndenberg, Dr.Villaret, <strong>der</strong> anschließend in den Vorruhestand entlassen wurde.<br />
Auf Reichsebene war durch die Annahme des Ermächtigungsgesetzes am 23.3. durch alle<br />
Parteien mit Ausnahme <strong>der</strong> SPD, 2 die Verfassung <strong>der</strong> Weimarer Republik, <strong>der</strong> „Systemzeit“<br />
wie es fortan hieß, faktisch außer Kraft gesetzt worden und die „Machtergreifung“ o<strong>der</strong><br />
1 <strong>Die</strong> folgenden Angaben bis zur Gemein<strong>der</strong>atssitzung vom 13.4.1933 nach Stefan Klemp, „Richtige Nazis hat<br />
es hier nicht gegeben...“, Münster 2.A. 2000, Seite 74ff<br />
2 <strong>Die</strong> KPD war auf Grund <strong>der</strong> Reichstagsbrandverordnung vom Februar bei dieser Abstimmung gar nicht mehr<br />
zur Mitabstimmung zugelassen und <strong>der</strong>en gewählte Abgeordnete bereits verhaftet, unter Hausarrest gestellt<br />
o<strong>der</strong> bereits untergetaucht.
32<br />
Machterschleichung unter tatkräftiger bürgerlich-nationaler Kräfte mehr o<strong>der</strong> weniger abgeschlossen,<br />
kurz darauf wurde die SPD verboten und die Gewerkschaften zwangsaufgelöst.<br />
Im Protokollbuch des <strong>Fröndenberger</strong> Gemein<strong>der</strong>ats ist unter dem 25.7.1933 zu lesen:<br />
„Gemeindevorsteher-Stellvertreter Nolte wies darauf hin, dass, nachdem nun endlich alle<br />
Parteien aufgelöst seien, nur noch <strong>der</strong> eine Wille und Befehl gelte, <strong>der</strong> des Nationalsozialismus.<br />
Auf das von ihm auf den Volkskanzler Adolf Hitler (...) ausgebrachte dreifache<br />
Sieg-Heil stimmten Gemeindevertreter und Zuhörer begeistert ein. Anschließend trat das<br />
Kollegium in die Beratung <strong>der</strong> Tagesordnung ein“. Soweit zum Stimmungsbild des „nationalen<br />
Aufbruchs“ in Fröndenberg, vor dessen Hintergrund sich auch Verän<strong>der</strong>ungen hinsichtlich<br />
<strong>der</strong> <strong>Straßennamen</strong> zwangsläufig ergaben.<br />
Bereits auf <strong>der</strong> Gemein<strong>der</strong>atssitzung am Abend des 19. April 1933, dem Vorabend des ersten<br />
„Führergeburtstags“ kam es unter Punkt 1 <strong>der</strong> Tagesordnung zu drei Umbenennungen:<br />
„<strong>Die</strong> Polizeiverwaltung wird ersucht, folgende Umbenennungen vorzunehmen“<br />
1. den jetzigen Marktplatz in „Adolf-Hitler-Platz“<br />
2. den Ruhrpark neben dem Elektrizitätswerk in „Hindenburghain“<br />
3. die Ardeyer Straße vom Markt bis zum Eingang Bergstraße in<br />
„Wilhelm-Feuerhake-Straße“<br />
Eine dieser Umbenennungen hatte bereist eine Vorgeschichte, die bis in das Jahr 1930<br />
zurückreicht. Im Sommer 1930 feierte die Gemeinde ihre 700-Jahr-Feier (1230 urkundliche<br />
Erwähnung Fröndenbergs im Zusammenhang mit <strong>der</strong> Stiftung des Klosters und Bau <strong>der</strong><br />
Stiftskirche). <strong>Die</strong> Feierlichkeiten wurden 1930 begonnen mit <strong>der</strong> festlichen Einweihung eines<br />
Ehrenmals an <strong>der</strong> Schulstraße zum Gedenken an die im 1. Weltkrieg gefallenen Soldaten <strong>der</strong><br />
Gemeinde. Zwar existierte (bis 1956) ein Kriegerehrenmal mitten auf dem Marktplatz auf<br />
dem, geschmückt mit einem Reichsadler, <strong>der</strong> gefallenen Soldaten <strong>der</strong> Einigungskriege<br />
1864/1866 und 1870/71 gedacht wurde, aber die hier noch vorhandene Beschriftungsfläche<br />
reichte bei weitem für die mehr als zweihun<strong>der</strong>t Namen <strong>der</strong> Gefallenen des 1. Weltkrieges<br />
nicht aus und mehrere Jahre wurde um den Bau eines neuen Ehrenmals gerungen. Wobei sich<br />
das „Ringen“ eher auf die Finanzierung bezieht als auf die parlamentarische Zustimmung im<br />
Gemein<strong>der</strong>at, die mit Ausnahme <strong>der</strong> SPD selbstverständlich für den kostspieligen Neubau am<br />
Hang zum Friedhof an <strong>der</strong> Schulstraße plädierte.<br />
Bereits zu diesem Zeitpunkt wurde eine Umbenennung <strong>der</strong> Schulstraße erwogen und<br />
endgültig dem Gemein<strong>der</strong>at zur Beschlussfassung am 24.6.1932 zur Abstimmung vorgelegt.<br />
<strong>Die</strong> „Schulstraße“ sollte in „Hindenburgstraße“ umbenannt werden und <strong>der</strong> an <strong>der</strong> Ruhr<br />
gelegene Park den Namen „Hindenburg-Park“ erhalten. Weiter heißt es dazu im<br />
Protokollbuch: „Der Punkt 4 <strong>der</strong> Sitzung wegen Benennung (...) wurde von <strong>der</strong> Tagesordnung<br />
abgesetzt“. Lei<strong>der</strong> geht aus dem Protokoll nicht hervor, warum <strong>der</strong> Punkt und auf wessen<br />
Veranlassung er von <strong>der</strong> Tagesordnung gestrichen wurde. <strong>Die</strong> Tageszeitungen gingen auf den<br />
Verlauf dieser Sitzung nicht ein.<br />
1933 war es dann aber soweit und <strong>der</strong> (heute vollkommen bedeutungslose und ohne konzeptionelle<br />
Nutzung vor sich hin grünende) Ruhrpark, damals aber beliebter Treffpunkt für<br />
sonntägliche Spaziergänge und als Beweis für das wenigstens kleinstädtische Ambiente <strong>der</strong><br />
Industriegemeinde von großer ideeller Bedeutung, wurde nach dem wenig später verstorbenen<br />
greisen Reichspräsidenten benannt, <strong>der</strong> Symbolfigur für „Recht und Ordnung“ und Held des<br />
im „Felde unbesiegten“ kaiserlichen Heeres des 1. Weltkriegs (Schlacht von Tannenberg).<br />
<strong>Die</strong> Benennung des Marktes zu Ehren und zum Geburtstag des neuen Volkskanzlers bedarf<br />
hier keines Kommentars, interessanter für die kommunale <strong>Geschichte</strong> ist hingegen die Ehrung
33<br />
von Wilhelm Feuerhake, dem Begrün<strong>der</strong> <strong>der</strong> größten ansässigen Industriefirma, <strong>der</strong> weit über<br />
Fröndenberg hinaus bekannten Firma UNION, damals einer <strong>der</strong> namhaftesten Hersteller von<br />
Fahrradteilen.<br />
Interessant deswegen, weil eben dieser Industrielle kurz vor dem als sicher anzunehmenden<br />
Konkurs 3 seiner Firma 1925 Selbstmord verübte und damit den bereits in den Startlöchern<br />
lauernden „Vereinigten Stahlwerken“ im Besitz des Hugenbergkonzerns <strong>der</strong> Weg geebnet<br />
war, die kurz vorher noch vor dem Konkurs stehende Firma zu übernehmen. Hauptgesellschafter<br />
wurde <strong>der</strong> Schwerindustrielle Albert Vögler, <strong>der</strong> den Geschäftsführer Fritz Sils<br />
mit <strong>der</strong> kaufmännischen Führung des Betriebes beauftragte.<br />
Sowohl <strong>der</strong> Hugenbergkonzern als auch Vögler selbst waren nicht unbeteiligt an <strong>der</strong> finanziellen<br />
Unterstützung <strong>der</strong> NSDAP gewesen, ihrer Wahlkämpfe und damit <strong>der</strong>en Aufstieg.<br />
Zwar waren die Arbeitsplätze in <strong>der</strong> <strong>Fröndenberger</strong> UNION 1925 gerettet worden, aber es<br />
bleib ein schaler Beigeschmack an <strong>der</strong> neuen Geschäftsführung haften, was den Freitod des<br />
Firmengrün<strong>der</strong>s und das weitere Schicksal seiner Familie in Fröndenberg anbelangte.<br />
1933 nun wurde er posthum mit <strong>der</strong> Benennung <strong>der</strong> am Werk vorbeiführenden Straße geehrt<br />
und in Veröffentlichungen <strong>der</strong> Werksleitung wie<strong>der</strong> an vor<strong>der</strong>ster Stelle als Firmengrün<strong>der</strong><br />
hervorgehoben. Somit wurde eine Kontinuität hergestellt, die es so nie gegeben hatte, <strong>der</strong><br />
Firma UNION aber eine „Historie“ verliehen, die nun bis 1895 zurückreichte und das Proze<strong>der</strong>e<br />
<strong>der</strong> Übernahme und <strong>der</strong>en Umstände im Jahr 1925 in den Hintergrund rückte.<br />
Außerdem wurde <strong>der</strong> Sohn von Wilhelm Feuerhake im Frühjahr 1933 zu einem <strong>der</strong> fünf<br />
Prokuristen <strong>der</strong> UNION ernannt, führte aber nach Aussage von Firmenangehörigen ein<br />
Dasein im Windschatten <strong>der</strong> eigentlich Mächtigen.<br />
Wie<strong>der</strong>um nicht alleine unter nationalsozialistischer Flagge stand die nächste Straßenumbenennungsphase,<br />
die per Gemein<strong>der</strong>atsbeschluss unter Punkt 8 in <strong>der</strong> Sitzung vom 27. Juni<br />
1933 eingeleitet wurde. 4<br />
Gleich 15 Straßen erhielten neue Namen und die Zusammensetzung des Gemein<strong>der</strong>ates aus<br />
Nationalsozialisten und national konservativ eingestellten Kräften wird erkennbar.<br />
Einstimmig beschloss das euphemistisch „Kollegium“ genannte Gremium die Beauftragung<br />
<strong>der</strong> Polizeiverwaltung mit <strong>der</strong> Umbenennung folgen<strong>der</strong> Straßen:<br />
1. „Antoniusstraße“ in „Goethestraße“<br />
2. “Karlstraße” in “Karl-Wildschützstraße”<br />
3. „Friedrichstraße“ in „Friedrich-Beringstraße“<br />
4. „Himmelssiepen“ 5 in „Jägertal“<br />
5. „Löhnbachstraße“ in „Bismarckstraße“<br />
6. „Münzenfundstraße“(anteilig, d.V.) in „Hermann-Lönsstraße“<br />
7. „Eulenstraße“ und „Ostbürener Straße“ bis Abzweig nach Hohenheide in<br />
„Horst-Wessel-Straße“<br />
8. „Parkstraße“ in „von-Tirpitz-Straße“<br />
9. „Schulstraße“ in „Schlageterstraße“<br />
10. „Westickerstraße“ vom Markt bis Bahnübergang in „Hermann-Göringstraße“<br />
11. „Westickerfeldweg“ in „Schillerstraße“<br />
12. „Zwischen den Wegen“ in „Vom-Stein-Straße“<br />
3 <strong>Die</strong> Produktion <strong>der</strong> Firma war während des Weltkrieges auf Rüstungsgüter umgestellt worden und war durch<br />
die Neuorientierung auf Produktion ziviler Güter und auf Grund niedriger Binnennachfrage und in Folge <strong>der</strong><br />
Inflation 1923 in Existenzschwierigkeiten geraten.<br />
4 Kopie aus dem Protokollbuch <strong>der</strong> Gemein<strong>der</strong>atssitzungen siehe Anhang 1 lfd. Nr.8<br />
5 <strong>Die</strong> Bezeichnung „Himmelssiepen“ als Straßenname ist vor 1933 nicht nachzuweisen. Es handelt sich um die<br />
mündlich tradierte Bezeichnung eines bisherigen Feldweges parallel zur Straße „Am Hirschberg“, an dessen<br />
Ende ein Schießstand <strong>der</strong> <strong>Fröndenberger</strong> Bürgerschützen und des <strong>Fröndenberger</strong> Schützenbundes lag. In dieser<br />
Tradition ist die Umbenennung, bzw. die erste offizielle Benennung dieses Weges zu sehen.
34<br />
13. „Wilhelmplatz“ in „Wilhelm-Himmelmann-Platz“<br />
14. „Westickerfeldweg“ in „Annette-von-Droste-Hülshoff-Straße“<br />
15. (ein weiterer Teil, d.V.) <strong>der</strong> „Münzenfundstraße“ in „Lessingstraße“<br />
Somit waren nicht nur die beiden „Märtyrer <strong>der</strong> Bewegung“ Horst Wessel und Albert-Leo<br />
Schlageter son<strong>der</strong>n auch <strong>der</strong> preußische Ministerpräsident zu Ehren gekommen, wie auch <strong>der</strong><br />
Reichsgrün<strong>der</strong> Otto von Bismarck, in nationalsozialistischer Deutung als Reichskanzler ein<br />
Vorgänger des neuen Reichskanzlers Adolf Hitler.<br />
Zu Ehren kam auch <strong>der</strong> Tradition <strong>der</strong> <strong>Fröndenberger</strong> Schiffs- und Ankerkettenproduktion<br />
folgend, <strong>der</strong> Initiator <strong>der</strong> kaiserlichen Schlachtflotte, Alfred von Tirpitz. Immerhin kam um<br />
die Jahrhun<strong>der</strong>twende mehr als jede zweite Schiffs- und Ankerkette deutscher Produktion aus<br />
<strong>der</strong> Industriegemeinde an <strong>der</strong> Ruhr.<br />
Ebenso wurden die bisher nur „verschlüsselt“ geehrten <strong>Fröndenberger</strong> Bürger, <strong>der</strong> Industrielle<br />
Wilhelm Himmelmann, <strong>der</strong> Arzt Friedrich Bering und <strong>der</strong> Kaufmann Karl Wildschütz zu<br />
<strong>Straßennamen</strong>trägern.<br />
Geschickt eingewoben wurden in diese Phalanx die deutschen „Dichter und Denker“, wobei<br />
es äußerst kurios ist und ein Schlaglicht auf das Bildungsniveau <strong>der</strong> Gemein<strong>der</strong>äte wirft, dass<br />
ausgerechnet <strong>der</strong> Dichter des „Nathan <strong>der</strong> Weise“ im Juni 1933 und damit bereits in <strong>der</strong><br />
Anfangsphase <strong>der</strong> Ausgrenzung jüdischer Bürger mit dem Ziel <strong>der</strong> Ausgrenzung und<br />
Umkehrung ihrer Emanzipation als Staatsbürger zum Träger eines <strong>Straßennamen</strong>s wird.<br />
Zum antisemitischen Essayist und „Heidedichter“ Hermann Löns hätte sicherlich Ernst-<br />
Moritz Arndt besser gepasst als <strong>der</strong> Begrün<strong>der</strong> <strong>der</strong> bürgerlichen Literatur und Lichtgestalt <strong>der</strong><br />
Aufklärung und Judenemanzipation.<br />
Unter <strong>der</strong> laufenden Nummer 536 wurden diese Namensän<strong>der</strong>ungen im Amtsblatt <strong>der</strong><br />
preußischen Regierung zu Arnsberg veröffentlicht, unterzeichnet von Amtsbürgermeister<br />
Villaret als Ortspolizeibehörde.<br />
Ein in <strong>der</strong> Nachbetrachtung tragische Randbemerkung ist im Protokollbuch <strong>der</strong> Gemeindeverwaltung<br />
am 25.8.1933 zu lesen: „<strong>Die</strong> Danksagung des Deutschen Botschafters in Rom,<br />
Herrn Dr. von Hassel, über die Benennung einer Straße nach seinem Schwiegervater Großadmiral<br />
von Tirpitz wurde dankend zur Kenntnis genommen“ 6<br />
Im Zusammenhang mit den Ereignissen des 20. Juli 1944 wurde <strong>der</strong> ehemalige deutsche<br />
Botschafter in Rom, Ulrich von Hassel, Schwiegersohn des Alfred von Tirpitz und seit 1933<br />
Mitglied <strong>der</strong> NSDAP, wegen seiner Verbindungen zu General Beck, Karl Goerdeler und<br />
an<strong>der</strong>en Oppositionellen vom Volksgerichtshof zum Tode verurteilt und in Berlin-Plötzensee<br />
erhängt.<br />
Am 28.9.1934 wurde das „Dichter- und Denkerviertel“ mit <strong>der</strong> Benennung <strong>der</strong> „Körnerstraße“<br />
erweitert. Der Gemein<strong>der</strong>at beschloss die Benennung einer zwischenzeitlich bebauten<br />
Parzelle an einem noch unbenannten Weg, die beim Katasteramt des Kreises Unna noch unter<br />
<strong>der</strong> Verwendung als Acker verzeichnet war, nach dem Dichter <strong>der</strong> deutschen<br />
Befreiungskriege gegen Napoleon, <strong>der</strong> als Kriegsfreiwilliger im Freikorps Lützow 1815 tödlich<br />
verwundet wurde.<br />
<strong>Die</strong> nächsten Neubenennungen datieren vom Dezember 1936 im gleichen Baugebiet Fröndenberg-Ost/Westick.;<br />
dieses Mal etwas weiter westlich zwischen <strong>der</strong> Bismarckstraße im Norden<br />
und <strong>der</strong> Graf-Adolf-Straße im Süden. Als Parallelstraße zur Wasserwerkstraße entsteht die<br />
neue „Löhnbachstraße“ im rechten Winkel nach Süden abzweigend von <strong>der</strong> Bismarckstraße,<br />
6 Kopie aus dem Protokollbuch <strong>der</strong> Gemein<strong>der</strong>atssitzungen siehe Anhang 1 lfd. Nr.9
35<br />
die bis Juni 1933 diesen Namen Löhnbachstraße führte. <strong>Die</strong> „neue“ Löhnbachstraße verlauft<br />
nun parallel zu diesem Bach, ihre Vorgängerin hatte ihn gekreuzt.<br />
<strong>Die</strong> zweite neu Straße in diesem Wohngebiet, die „Hans-Schemm-Straße“, verbindet die<br />
beiden parallel verlaufenden Straßen Löhnbachstraße und Wasserwerkstraße auf halber<br />
Strecke zwischen Bismarckstraße und Graf-Adolf-Straße.<br />
Sie wurde benannt nach dem im März 1935 bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommenen<br />
Gauleiter <strong>der</strong> ostbayerischen Gaue Oberfranken und Oberpfalz-Nie<strong>der</strong>bayern. In dieser<br />
Funktion in Westfalen relativ unbekannt, erreichte er reichsweit in Lehrer- und Schulkreisen<br />
einen größeren Bekanntheitsgrad als Begrün<strong>der</strong> des NS-Lehrerbundes, dessen „Reichswalter“<br />
er bis zu seinem Tode war.<br />
Im Jahr 1939 wurden die evangelische Lutherschule und die katholische Overbergschule auf<br />
dem Sümberg an <strong>der</strong> Overberg- und Friedhofsstraße gelegen, in Hans-Schemm-Schule I und<br />
II umbenannt. Auch dieses eine Ehrung des NS-Schulpolitikers und Manifestation <strong>der</strong> bereits<br />
einige Jahre vorher vollzogenen strickten Trennung <strong>der</strong> Schul- und Kirchenangelegenheiten in<br />
finanzieller und verwaltungstechnischer Hinsicht und Ausschaltung <strong>der</strong> Kirchen als Träger<br />
allgemeinbilden<strong>der</strong> Volksschulen.<br />
Beide neuen Straßenbenennungen wurden im Amtsblatt <strong>der</strong> preußischen Regierung zu<br />
Arnsberg im Stück 97 vom 9.12.1936 unter <strong>der</strong> lfd. Nummer 702 7 veröffentlicht, unterzeichnet<br />
vom Landrat als Genehmigungsbehörde auf Vorschlag des <strong>Fröndenberger</strong> Bürgermeisters.<br />
Berechtigt scheint die Frage, warum trotz aller „Verdienste“ des Nationalsozialisten Hans<br />
Schemm nicht an<strong>der</strong>e <strong>Straßennamen</strong>patrone aus <strong>der</strong> NS-Führungsriege zum Zuge gekommen<br />
sind, die auf höherer Ebene den „neuen Staat“ verkörperten, wie beispielsweise Heinrich<br />
Himmler o<strong>der</strong> Joseph Göbbels?<br />
<strong>Die</strong>s ist damit zu erklären, dass Hitler selber in einem in <strong>der</strong> Presse lancierten Aufruf vom<br />
27.4.1933 8 zur Zurückhaltung bei <strong>der</strong> Umbenennung historischer <strong>Straßennamen</strong> aufrief,<br />
soweit davon nicht <strong>Straßennamen</strong> nach Marxisten, Juden und Sozialdemokraten betroffen<br />
seien, was in Fröndenberg nicht <strong>der</strong> Fall war; nicht einmal <strong>der</strong> erste Präsident <strong>der</strong> Weimarer<br />
Republik Friedrich Ebert war nach seinem Tod mit einem <strong>Straßennamen</strong> geehrt worden.<br />
Bestätigt wurde Hitlers Haltung, nach <strong>der</strong> „nur das, was die nationale Revolution für die<br />
Zukunft selber aufbaut, darf sie mit ihren und dem Namen ihrer führenden Männer<br />
verbinden“, durch einen wenige Wochen später veröffentlichten Aufruf <strong>der</strong> Münchner Parteizentrale,<br />
unterzeichnet vom „Stellvertreter des Führers“ Rudolf Heß.<br />
<strong>Die</strong>se Aufrufe, wenn sie denn in Fröndenberg wahrgenommen wurden, verhin<strong>der</strong>ten zwar<br />
nicht mehr die Umbenennungen im Juni/Juli dieses Jahres, Ministerpräsident Göring<br />
betreffend, aber wenn schon <strong>der</strong> oberste Führer zur Zurückhaltung mahnte, dann war Vorsicht<br />
geboten hinsichtlich <strong>der</strong> zukünftigen Ehrung seiner Paladine.<br />
Beispiele in an<strong>der</strong>en Städten und Gemeinden zeigten den Verantwortlichen darüber hinaus in<br />
den folgenden Jahren die Richtigkeit <strong>der</strong> Zurückhaltung vor Ort; so wird die Stadt Unna über<br />
ihre schnelle Entscheidung, Hugenberg und Vizekanzler v.Papen mit <strong>Straßennamen</strong> zu ehren,<br />
einiges Kopfzerbrechen bereitet haben, nachdem beide wenig später in Ungnade fielen. 9<br />
Ein weiterer Grund ist die in vielen Biographien, Tagebüchern etc. dieser Jahre nachgewiesene<br />
Unbeliebtheit gerade solcher Männer wie Himmler und Göbbels, was sich zwar nicht<br />
in oppositioneller Haltung nie<strong>der</strong>schlug, aber vielen „Volksgenossen“ waren diese immer<br />
7 <strong>Die</strong> Rechnung über die Kosten dieser Veröffentlichung hat sich im Stadtarchiv in <strong>der</strong> Akte A 5305 erhalten;<br />
<strong>der</strong> Rechnungsbetrag betrug 4,70 Reichsmark und war binnen 5 Tage auf das Reichsbankgirokonto <strong>der</strong><br />
Regierungshauptkasse zu Arnsberg zu entrichten.<br />
8 Zitiert nach: Bernd Leupold, „Ehre wem Ehre gebührt – <strong>Straßennamen</strong> als Spiegel des Zeitgeistes. Bayreuth<br />
und Bamberg im Vergleich“, recherchiert im Internet unter<br />
http://www.ini-bayreuth.de/departements/neueste/ZeitgeistLeupold.htm (22.09.2004)<br />
9 Mehr zur <strong>Straßennamen</strong>entwicklung dieser Zeit in an<strong>der</strong>en Städten des Regierungsbezirk Arnsberg siehe im<br />
Exkurs 3 <strong>der</strong> vorliegenden Arbeit.
36<br />
mächtiger werdenden Politiker doch in gewisser Weise unheimlicher o<strong>der</strong> unnahbarer als die<br />
Person des volkstümlichen und beliebten Göring (wenigstens bis 1941, dem Zeitpunkt <strong>der</strong><br />
verlorenen Luftschlacht um England und <strong>der</strong> beginnenden Bombardierung deutscher Städte)<br />
o<strong>der</strong> die Person des Führers, die nahezu bis Kriegsende unantastbar in <strong>der</strong> breiten Bevölkerung<br />
geblieben ist gemäss dem Sprichwort bei allen Misshelligkeiten <strong>der</strong> Zeit: „wenn das<br />
<strong>der</strong> Führer wüsste!“<br />
Letzten Endes machte <strong>der</strong> Personenkult <strong>der</strong> NS-Zeit auch Halt bei dem zwar nicht festgeschriebenen,<br />
aber doch tradierten Grundsatz (Monarchen, Kronprinzen o<strong>der</strong> Präsidenten ausgenommen),<br />
Straßen nicht nach noch lebenden Persönlichkeiten zu benennen.<br />
Auch in den Ausführungsanweisungen zur Verordnung über die Benennung von Straßen,<br />
Plätzen und Brücken vom 1.4.1939 10 wird die Benennung nach noch lebenden Personen nicht<br />
ausdrücklich verboten. <strong>Die</strong>s wird als Grundsatz <strong>der</strong> Straßenbenennungen erst nach dem<br />
Zweiten Weltkrieg in vielen Städten und Gemeinden schriftlich fixiert.<br />
Abgeschlossen wurde die nationalsozialistisch geprägte Epoche <strong>der</strong> Straßenbenennungen 11 in<br />
Fröndenberg mit <strong>der</strong> Bennennung <strong>der</strong> „Ostmarkstraße“ im August 1938, wenige Monate<br />
nach dem „Anschluss“ <strong>der</strong> österreichischen Republik an das Deutsche Reich im März 1938<br />
und fortan Ostmark genannt. Ostmarkstraßen entstanden auch in den amtsangehörigen Gemeinden<br />
Ardey und Langschede, für Langschede nachgewiesen im Amtsblatt <strong>der</strong> Preußischen<br />
Regierung zu Arnsberg 1938 unter <strong>der</strong> lfd. Nummer 678 vom 9.6.1938, zwei Monate vor <strong>der</strong><br />
<strong>Fröndenberger</strong> Benennung. Für Ardey bestätigte <strong>der</strong> Landrat die Benennung in <strong>der</strong><br />
Veröffentlichung im Amtsblatt <strong>der</strong> Preußischen Regierung zu Arnsberg mit Datum vom<br />
1.10.1938. 12<br />
Eine Ende <strong>der</strong> dreißiger Jahre geplante Bebauung des „Freisenhagen“ im Norden <strong>der</strong> Gemeinde<br />
rechts <strong>der</strong> Straße nach Unna kam wegen <strong>der</strong> Kriegsereignisse nicht mehr zu Stande.<br />
<strong>Die</strong> dieses Baugebiet erschließende Straße erhielt aber von Seiten des Bauamtes noch vor<br />
1940 den Namen „Springstraße“, nachgewiesen im Stadtplan von 1940, erstellt vom Amtsbauamt.<br />
Eine offizielle Benennung durch den Bürgermeister o<strong>der</strong> den Gemein<strong>der</strong>at o<strong>der</strong> eine<br />
Bestätigung durch den Landrat in Unna als Genehmigungsbehörde konnte bisher nicht nachgewiesen<br />
werden. Bis zum Ende des Krieges blieb die Springstraße weitgehend unbebaut; an<br />
ihr (damals ein unbefestigter Feldweg) lag und liegt bis heute <strong>der</strong> im Flucht-linienplan des<br />
Jahres 1898 nachgewiesene „Begräbnisplatz <strong>der</strong> israelitischen Gemeinde“.<br />
Nach Deportation <strong>der</strong> letzten jüdischen Bürger im Sommer 1942 und dem letzten<br />
durchgeführten jüdischen Begräbnisses im Jahr 1935 diente <strong>der</strong> jüdische Friedhof bis<br />
Kriegsende als Begräbnisplatz für verstorbene Zwangsarbeiter.<br />
Hätte bereits ab 1939 die Wohnbebauung in diesem Bereich begonnen, wäre <strong>der</strong> jüdische<br />
Friedhof mit Sicherheit dem Erdboden gleichgemacht worden und in das Baugelände einbezogen<br />
worden.<br />
Im Verwaltungsbericht <strong>der</strong> Gemeindeverwaltung für die Haushaltsjahre 1939 bis 1941 heißt<br />
es dazu: „Es ist die Errichtung von ca. 200 Arbeiterwohnungen auf dem sogenannten<br />
Freisenhagen vorgesehen, woran sich die Firma UNION mit 150 Wohnungen beteiligen wird.<br />
Da das erfor<strong>der</strong>liche Gelände für die Siedlung durch freihändigen Kauf nicht zu erwerben<br />
war, ist für die betreffenden Grundstücke das Enteignungsverfahren beim Siedlungsverband<br />
Ruhrkohlenbezirk beantragt. Ein Gutachter hat bereits im Auftrag des Verbandspräsidenten<br />
Richtpreise für die zu enteignenden Grundstücke festgelegt“.<br />
10 Reichsgesetzblatt Teil 1, Nr.64 vom 3.4.1939 und Ministerialblatt des Reichs- und Preußischen Ministeriums<br />
des Inneren Nr. 30 vom 26.7.1939; wie<strong>der</strong>gegeben im Anhang 1 lfd. Nr.11<br />
11 Zur Orientierung siehe als Anhang Nr. 10 zwei Kopien des 1940er Stadtplan aus dem Bereich Baugebiet<br />
Fröndenberg-Ost/Westick und dem Innenstadtbereich.<br />
12 Ausführlicher wird auf die Situation in den amtsangehörigen Gemeinden im Teil G eingegangen.
37<br />
Insgesamt wird aus Sicht <strong>der</strong> Amts- und Gemeindeverwaltung für die Jahre vor dem Zweiten<br />
Weltkrieg im Verwaltungsbericht für die Jahre April 1936 - März 1939 eine positive Bilanz<br />
gezogen: „Auf dem Gebiet des Straßenbaus ist ganz Außergewöhnliches geleistet worden. (...)<br />
In verhältnismäßig kurzer Zeit wurde das Stadtbild grundlegend verän<strong>der</strong>t. Aus einem<br />
schmutzigen und unansehnlichen Dorf wurde eine städtebaulich hoch kultivierte Gemeinde“<br />
Dazu gehörte ab 1934 die Beschil<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> vorhandenen und <strong>der</strong> neu benannten Straßen wie<br />
bereits in den frühen 1930er geplant, sowie die einheitliche Hausnummerierung und eine<br />
entsprechende Hausnummernbeschil<strong>der</strong>ung.<br />
Es wurden zahlreiche Angebote für die benötigten 260 einstelligen, 420 zweistelligen und 20<br />
dreistelligen Hausnummernschil<strong>der</strong> eingeholt; die dann endgültige Rechnungssumme dafür<br />
belief sich auf 198,- Reichsmark. 13<br />
Im nächsten Bericht für das abgelaufene Jahr 1939 (April 1939- März 1940) heißt es dann<br />
etwas nüchterner: „In Folge <strong>der</strong> Bausperre war die Errichtung von neuen Wohnungen ganz<br />
eingestellt. Der Wohnungsmangel ist deshalb weiter gestiegen und baldige Abhilfe ist dringend<br />
notwendig“<br />
Zu dieser nötigen Abhilfe ist es bis Kriegsende nicht mehr gekommen, ganz im Gegenteil.<br />
Durch die Zerstörungen im Verlauf <strong>der</strong> Möhnekatastrophe 14 , mehrere Bombenangriffe bis<br />
März 1945, Schäden durch die Bodenkämpfe Anfang April 1945 und beson<strong>der</strong>s durch die<br />
Zunahme <strong>der</strong> Bevölkerung durch Evakuierte aus dem Ruhrgebiet und Zuzug von Vertriebenen<br />
und Flüchtlingen 15 ab 1946 spitzte sich die Lage dramatisch zu. Nicht zu vergessen<br />
sind hierbei die 1944 etwa zweitausend verzeichneten Zwangsarbeiter und Kriegsgefangenen<br />
in Lagern, Baracken, Bauernhöfen, Gastwirtschaften, Sälen und sonstigen Notunterkünften.<br />
Kam es also wegen des Krieges und dessen Verlauf nicht mehr zu Neubenennungen von<br />
Straßen, so sind auch keine Umbenennungen mehr nachgewiesen. Grund dafür war nicht<br />
zuletzt ein Run<strong>der</strong>lass des Innenministeriums vom 30.8.1939 betreffend die Vereinfachung<br />
<strong>der</strong> Verwaltung im gemeindlichen Bereich. Es wurde verfügt, „...dass Straßenumbenennungen<br />
völlig einzustellen sind, da sie zu den Aufgaben gehören, <strong>der</strong>en laufende Fortführung nicht<br />
aus Gründen <strong>der</strong> Landesverteidigung geboten ist“ und weiter heißt es in einem vertraulichen<br />
Rundschreiben des Reichsinnenministeriums vom 19.10.1940: „(...) Straßenbenennungen<br />
nach verdienten Offizieren o<strong>der</strong> Ehrungen ähnlicher Art sind bis Kriegsende zurückzustellen“<br />
16<br />
Zusammenfassend sind in <strong>der</strong> Gemeinde Fröndenberg in <strong>der</strong> Zeit vom 1.4.1933 bis zum<br />
2.8.1938 siebzehn Straßen umbenannt worden und fünf neue Straßen benannt worden. 17<br />
Der Wohnbezirk Hohenheide war von diesen Verän<strong>der</strong>ungen nicht betroffen, <strong>der</strong> Schwerpunkt<br />
lag im Zentrum <strong>der</strong> Gemeinde sowie im Baugebiet Fröndenberg-Ost/Westick<br />
13 StaF, Bestand B 5305<br />
14 In <strong>der</strong> Nacht vom 16. auf den 17.Mai 1943 bombardierte die britische Luftwaffe die Staudämme von Möhne,<br />
E<strong>der</strong> und Sorpe. <strong>Die</strong> durch den Bruch <strong>der</strong> Möhneseemauer ausgelöste Flutwelle richtet an <strong>der</strong> mittleren Ruhr<br />
verheerende Zerstörungen an. Etwa 1.200 Menschen (vornehmlich Zwangsarbeiter) kamen ums Leben,<br />
zahlreiche Wohnhäuser im mittleren Ruhrtal zwischen Neheim und Herdecke wurden zerstört o<strong>der</strong><br />
beschädigt. Für den Raum Fröndenberg erarbeitete <strong>der</strong> Verfasser im Jahr 2003 eine Dokumentation über<br />
Ursache, verlauf und Folgen dieser Katastrophe mit kommentierten Dokumenten aus dem Stadtarchiv für die<br />
Reihe „Beiträge zur Ortsgeschichte“<br />
15 Siehe dazu mehr im Exkurs 4 <strong>der</strong> vorliegenden Arbeit.<br />
16 zitiert nach: Aloyis Molter, „<strong>Die</strong> Benennung <strong>der</strong> Straßen, Plätze und Brücken in <strong>der</strong> Stadt Frankfurt a.M.“,<br />
Frankfurt 2001, Seite 10ff<br />
17 ohne Berücksichtigung des „Hindenburghains“ und mit Berücksichtigung <strong>der</strong> Neuverwendung des Namen<br />
„Löhnbachstraße“
38<br />
Exkurs 3<br />
Straßenumbenennungen in an<strong>der</strong>en Kommunen des Regierungsbezirks Arnsberg von<br />
Januar 1933 bis 1934<br />
<strong>Die</strong> Suche nach Bestätigung von Straßenumbenennungen in <strong>der</strong> Gemeinde Fröndenberg ab<br />
1933 und den amtsangehörigen Gemeinden im „Amtsblatt <strong>der</strong> Preußischen Regierung zu<br />
Arnsberg“ führte hin zu einer Fülle von Veröffentlichungen an<strong>der</strong>er Kommunen im Regierungsbezirk,<br />
die gleich Fröndenberg, Langschede und Ardey ab 1933 Umbenennungen,<br />
teils auch Neubenennungen, zahlreicher Straßen vorgenommen haben.<br />
Wenn diese im Folgenden tabellarisch wi<strong>der</strong>gegeben werden, so entspricht die Summe <strong>der</strong><br />
genannten Vorgänge keineswegs <strong>der</strong> Summe <strong>der</strong> tatsächlich vorgenommenen Än<strong>der</strong>ungen, da<br />
es keine Veröffentlichungspflicht im genannten Amtsblatt gegeben hat, es gleichwohl zum<br />
„guten Ton“ und zur Selbstdarstellung <strong>der</strong> Kommunen gehörte, den „nationalen Aufbruch“<br />
nach dem Amtsantritt des neuen Reichskanzlers Hitler auch nach außen hin gegenüber<br />
an<strong>der</strong>en Kommunen und natürlich auch gegenüber <strong>der</strong> Bezirksregierung zu dokumentieren.<br />
<strong>Die</strong> Auflistung macht deutlich, dass es keineswegs nur stereotypische Benennungen nach<br />
Hitler und Göring, Schlageter und Wessel gab, son<strong>der</strong>n eine große Bandbreite von <strong>Straßennamen</strong>paten<br />
und einen, keineswegs nur nationalsozialistisch geprägten, Konsens des gesamten<br />
nationalkonservativen öffentlichen Spektrums mit dem die neue Regierung <strong>der</strong> „nationalen<br />
Konzentration“ von breitesten Bevölkerungsschichten als Erlösung vom als Chaos wahrgenommenen<br />
„System von Weimar“ begrüßt und mitgetragen wurde.<br />
<strong>Die</strong> Sicht auf den Regierungsbezirk Arnsberg mit seiner Bandbreite an ländlich wie industriell<br />
geprägten Regionen, dazu konfessionell ausgeglichen bietet einen guten Querschnitt 1<br />
hinsichtlich des Themas <strong>der</strong> Straßenumbenennungen nach 1933 für das Gebiet des heutigen<br />
Bundeslandes NRW, ohne dass dieses Thema auf diesen wenigen Seiten erschöpfend dargestellt<br />
werden kann.<br />
Chronologisch sind folgende Benennungen von April 1933- Ende 1934 nachweisbar:<br />
(Genannt sind in gedrängter Form Ort, Datum und namensgebende Persönlichkeit, nicht weitere<br />
Straßenbenennungen ohne Bezug auf den „30. Januar 1933“ )<br />
Iserlohn, 28.3.33: Hitler<br />
Herne, 8.4.33: Josef Wagner<br />
Holzwickede, 12.4.33: Hindenburg, Hitler, Göring, Wessel und Schlageter<br />
Heeren-Werwe, 12.4.33: Bismarck, Moltke, Roon, Hitler, Göring, Goebbels, Wessel<br />
Schwelm, 15.4.33: Josef Wagner<br />
Castrop-Rauxel, 18.4.33: Hitler<br />
Lippstadt, 19.4.33: Hitler(Straße)<br />
Voerde, 20.4.33: Hitler<br />
Arnsberg, 20.4.33: Hitler<br />
Fröndenberg, 20.4.33: Hitler, Hindenburg<br />
Halver, 26.4.33, Hindenburg, Hitler<br />
Heggen, 28.4.33: Hitler<br />
Unna, 27.4.33: Hitler, Göring, Wessel, Seldte, Hugenberg<br />
Wanne-Eickel, 27.4. Hitler, Göring, Schlageter, Wessel, Frick, Josef Wagner<br />
Hamm, 28.4.1933: Hitler, Göring, Goebbels, Wessel<br />
Herdecke, 28.4.33: Hitler<br />
1 Zu berücksichtigen ist hier allerdings das Fehlen <strong>der</strong> großen Städte wie Dortmund, Hagen o<strong>der</strong> Bochum, die<br />
ihre zweifelsohne ebenfalls vorgenommenen Umbenennungen nicht im Amtsblatt veröffentlichten.
39<br />
Fröndenberg, 3.7.33: Bismarck, v.Tirpitz, vom Stein, Wessel, Schlageter<br />
Meinerzhagen, 1.5.33: Hitler<br />
Wetter, 2.5.33: Hitler<br />
Berleburg, 9.5.33: Hitler, Hindenburg<br />
Lippstadt, 9.5.33: Hitler (Platz), Hindenburg, v.Papen<br />
Werl, 12.5.33: Hitler, Hindenburg, v.Papen<br />
Witten, 18.5.33: Seldte<br />
Altena, 20.5.33: Schlageter<br />
Vosswinkel (b.Arnsberg), 29.5.33: Hitler<br />
Kreuztal, 31.5.33: Hitler, Göring, Wessel, Hindenburg<br />
Herne, 27.6.33: Schlageter<br />
Kann (b.Weidenau), 14.8.33: Wessel, Schlageter<br />
Olpe, 26.8.33: Hitler<br />
Nachrodt, 22.9.33: Schlageter, bereits früher ohne Datum: Hitler, Göring, Hindenburg<br />
Dahl (b.Breckerfeld), 3.10.33: Wessel<br />
Herne, 5.10.33: Seldte<br />
(von Mitte Oktober 1933 bis September 1933 vermeldet das Amtsblatt keine Neubenennungen)<br />
Olpe, 5.9.34: Hindenburg, Schlageter, Wessel<br />
74 Umbenennungen nach Personen sind im Amtsblatt nachzuweisen, ohne Berücksichtigung<br />
<strong>der</strong> nach nationalgeschichtlichen Orten (Tannenberg etc.) o<strong>der</strong> Parteiorganisationen (SA) benannten<br />
Straßen.<br />
Vorherrschend sind es die kleineren Kommunen, die ihre Umbenennungen veröffentlichen<br />
ließen. Hier nicht berücksichtigt werden konnte die Sicht auf die vorhergegangenen ehemaligen<br />
Namen, die ab 1933 eliminiert wurden. Umbenannt wurden Straßen, die nach<br />
republikanischen Politikern <strong>der</strong> „Systemzeit“ wie Ebert, Erzberger, Rathenau benannt waren,<br />
nach jüdischen Dichtern wie Heinrich Heine ebenso wie <strong>Straßennamen</strong> aus <strong>der</strong> Frühzeit <strong>der</strong><br />
Sozialdemokratie; <strong>der</strong>artige Umbenennungen blieben aber auf die größeren und ehemals<br />
sozialdemokratisch regierten Städte beschränkt, selbstverständlich gab es in kleineren Orten<br />
keine „Walter Rathenau-Straße.<br />
Neue Namensträger waren nahezu flächendeckend <strong>der</strong> neue Reichskanzler Hitler und <strong>der</strong><br />
preußische Ministerpräsident und Präsident des Reichstages Göring, wie fast durchgehend die<br />
beiden „Märtyrer <strong>der</strong> Bewegung“ Albert Leo Schlageter und dem in Berliner Straßenkämpfen<br />
ermordeten SA-Mann Horst Wessel, wobei Ersterer im engeren Sinne kein Nationalsozialist<br />
gewesen war, son<strong>der</strong>n auf Grund seiner terroristischen Anschläge gegen die französische<br />
Rheinlandbesetzung und damit gegen die „Schmach von Versailles“ sowie Freikorpsführer<br />
1919/20 gegen die „Rote Ruhrarmee“ kämpfend, von den Nationalsozialisten posthum, erst<br />
Jahre nach seiner Hinrichtung durch die französische Besatzungsmacht 1923, für <strong>der</strong>en Ziele<br />
als „Märtyrer <strong>der</strong> Bewegung“ vereinnahmt wurde.<br />
Auffällig ist die Häufigkeit <strong>der</strong> Berücksichtigung des 1882 in Magdeburg geborenen nationalkonservativen<br />
Politikers, Mitbegrün<strong>der</strong> des „Stahlhelm“ und <strong>der</strong> „Harzburger Front“ Franz<br />
Seldte gerade in den Industriestädten Unna, Witten und Herne, wahrscheinlich auf in<br />
Dortmund, Bochum und Hagen. Seldte war zur Zeit <strong>der</strong> Straßenumbenennungsphase parteiloses<br />
Mitglied <strong>der</strong> Reichsregierung Arbeitsminister, später wurde er mehr o<strong>der</strong> weniger als<br />
Führer des zunächst freiwilligen Reichsarbeitsdienstes politisch kaltgestellt.<br />
Seine zunächst häufige Ehrung erklärt sich aus <strong>der</strong> großen Bedeutung, die <strong>der</strong> Arbeitsmarkt<br />
und damit die Bekämpfung <strong>der</strong> Arbeitslosigkeit in den ersten Regierungsjahren <strong>der</strong> NS-Zeit<br />
hatte und welche Hoffnungen gerade in diesem Sektor mit dem Regierungswechsel 2 verbunden<br />
waren.<br />
2 Ungeachtet <strong>der</strong> späteren Folgen und <strong>der</strong> Geschwindigkeit <strong>der</strong> Machtkonsolidierung <strong>der</strong> NSDAP war es<br />
zunächst äußerlich keine Machtergreifung im Sinne <strong>der</strong> späteren NS-Geschichtsschreibung, waren doch neben
40<br />
Selten sind Straßenbenennungen nach an<strong>der</strong>en Nationalsozialisten, die zu dieser Zeit (wie<br />
etwa Himmler) noch nicht im Rampenlicht <strong>der</strong> Öffentlichkeit standen, bzw. denen doch zunächst<br />
mit einer gewissen Zurückhaltung und nur eingeschränkter Begeisterung begegnet<br />
wurde, wie Joseph Goebbels. Vizekanzler von Papen wurde natürlich in seiner Heimatstadt<br />
Werl und <strong>der</strong> näheren Umgebung (Lippstadt) berücksichtigt du auch Gauleiter Joseph Wagner<br />
wurde mit <strong>Straßennamen</strong> geehrt.<br />
Auffällig ist jedoch auch die uneingeschränkte Hochachtung, die dem noch amtierenden<br />
Reichspräsidenten von Hindenburg zuteil wurde, eine Hochachtung gegenüber dem Repräsentanten<br />
des „alten Deutschland“ und des Militärs, den Hitler selber nur noch zweimal nach<br />
Antritt seiner Kanzlerschaft im März am „Tag von Potsdam“ und zur Unterzeichnung <strong>der</strong><br />
Reichstagsbrandverordnung im Februar 1933 vor seinem Tod 1934 als Marionette benötigte.<br />
Bereits 1934, auch begründet mit entsprechenden Äußerungen Hitlers und Verlautbarungen<br />
<strong>der</strong> Münchner Parteizentrale, ebbte die Benennung und Umbenennung von Straßen ab und es<br />
kam im weiteren Verlauf <strong>der</strong> NS-Zeit, wie im Kapitel D am Beispiel von Fröndenberg<br />
aufgezeigt, nur noch zur Ehrung von verstorbenen Partei- und Staatsgrößen. Orte, die „zu<br />
spät“ gekommen waren, wie etwa Meschede im Sauerland, mussten sich Anfang 1938 zum 5.<br />
Jahrestag <strong>der</strong> „Machtergreifung“ mit Wilhelm Gustloff, Herbert Norkus o<strong>der</strong> <strong>Die</strong>trich Eckart<br />
begnügen; verstorbenen (o<strong>der</strong> ermordeten) Randfiguren <strong>der</strong> NS-Bewegung.<br />
In <strong>der</strong> Kürze <strong>der</strong> zur Verfügung stehenden Zeit konnte nicht weiter verfolgt werden, was die<br />
betroffenen Kommunen in den Fällen taten, wenn <strong>Straßennamen</strong>paten in Ungnade gefallen<br />
waren, wie etwa (zeitweise) v.Papen o<strong>der</strong> Hugenberg, später auch Joseph Wagner.<br />
Gemessen an an<strong>der</strong>en wichtigen und wichtigeren Verän<strong>der</strong>ungen in Deutschland seit 1933 ist<br />
die <strong>Straßennamen</strong>gebung natürlich nur von marginaler Bedeutung; die Schnelligkeit <strong>der</strong><br />
Durchführung ist jedoch ein seismographisch für die Messung <strong>der</strong> Zeitstimmung und Zeitströmung<br />
interessantes Faktum für die insgesamt gesehen reibungslose und schnelle Wandlung<br />
einer noch 1929 nahezu bedeutungslosen „Bewegung“ hin zu einer staatstragenden<br />
Körperschaft des öffentlichen Rechts, die scheinbar mühelos alles Sehnsüchte und Wunschvorstellungen<br />
<strong>der</strong> breiten Masse <strong>der</strong> Bevölkerung zu adaptieren in <strong>der</strong> Lage war.<br />
So markiert das Ende <strong>der</strong> Straßenumbenennungsphase gleichsam den Beginn des vollkommen<br />
gleichgeschalteten totalitären Staates und den Beginn <strong>der</strong> heute noch in <strong>der</strong> Erinnerung vieler<br />
Zeitzeugen fatal als „goldene Jahre“ <strong>der</strong> NS-Zeit wahrgenommenen Jahre von 1935 bis Ende<br />
1938.<br />
Hitler selbst nur zwei NSDAP-Minister im ersten Kabinett Hitler neben sieben Ministern, die (zunächst o<strong>der</strong><br />
auch dauerhaft zeit ihrer Kabinettszugehörigkeit) nicht <strong>der</strong> NSDAP angehörten.
41<br />
E. Straßenbenennungen und Umbenennungen in <strong>der</strong> Gemeinde<br />
Fröndenberg (ab 1952 Titularstadt) von 1945 bis 1967<br />
In <strong>der</strong> ersten Aprilwoche wurde Fröndenberg von amerikanischen Truppen eingenommen,<br />
nachdem ein Bombenangriff am 12. März 1945 den Bahnhof, das Industriegebiet am Fuß des<br />
Haßleiberges nördlich <strong>der</strong> Bahn, die katholische Marienkirche und auch einige Wohn- und<br />
Geschäftsgebäude zerstört hatte. Hinzu kamen Schäden durch Artilleriebeschuss in den<br />
letzten Kampftagen, als die amerikanischen Truppen von Norden und Osten her vorrückten<br />
und letzte deutsche Wehrmachts- und Volkssturmeinheiten erst vom <strong>Fröndenberger</strong> Ruhrnordufer<br />
und noch später vom südlichen Ruhrufer her Wi<strong>der</strong>stand leisteten.<br />
Bereits Anfang Mai endete die amerikanische Besetzung und die britische Armee übernahm<br />
die militärische und zivile Verwaltung des <strong>Fröndenberger</strong> Raumes.<br />
Ab dem Juli des Jahres 1945 wurden <strong>der</strong> personell neugebildeten deutschen Verwaltung des<br />
Amtes und <strong>der</strong> Gemeinde sukzessive Aufgaben wie<strong>der</strong> o<strong>der</strong> neu übertragen.<br />
Dazu gehörte auch die Umsetzung britischer Befehle und Weisungen, u.a. die Weisung,<br />
nationalsozialistisch benannte Straßen und Plätze um- o<strong>der</strong> rückzubenennen. Verschwinden<br />
sollten auch <strong>Straßennamen</strong> <strong>der</strong> Militärgeschichte nach 1914.<br />
Sozialdemokratisch bzw. kommunistisch orientierte Gemeindegremien <strong>der</strong> unmittelbaren<br />
Nachkriegszeit legten diese Weisung dahingehend aus, freiwillig auch <strong>Straßennamen</strong> <strong>der</strong><br />
militärischen preußischen <strong>Geschichte</strong> ab 1871 zu beseitigen.<br />
In Fröndenberg gab es dazu mit Ausnahme <strong>der</strong> „von-Tirpitz-Straße“ keine Veranlassung und<br />
Amtsbürgermeister Clemens (parteilos) und Gemeindevorsteher Richard Fohs (Zentrum)<br />
beschränkten sich auf die wörtliche Durchführung <strong>der</strong> britischen Weisung, nationalsozialistische<br />
<strong>Straßennamen</strong> zu än<strong>der</strong>n, die ihrerseits zwischen 1933 und 1945 vergeben worden<br />
waren.<br />
Von den im Kapitel D genannten zweiundzwanzig um- o<strong>der</strong> neubenannten Straßen wurden<br />
auf Beschluss <strong>der</strong> Gemein<strong>der</strong>atssitzung vom 31. Juli 1945, Tagesordnungspunkt 6, fünf<br />
Straßen umbenannt, sowie eine weitere Straße, die gar nicht in diesem Zusammenhang <strong>der</strong><br />
„Straßenentnazifizierung“ hätte umbenannt werden brauchen und ihren Namen seit 1924 trug,<br />
allerdings mit dem 1945 belasteten Mittelstück „Adolf“ im Namen; ein eher komisch anmutendes<br />
Kuriosum <strong>der</strong> Zeitgeschichte:<br />
1. <strong>der</strong> „Adolf-Hitler-Platz“ zurück in „Marktplatz“<br />
2. die „Hermann-Göringstraße“ in „Alleestraße“ (alte Bezeichnung war „Westicker<br />
Straße“ gewesen)<br />
3. die Hans-Schemm-Straße“ in „Magdalenenstraße“ (Neubaustraße nach 1933)<br />
4. die „Schlageter-Straße“ in „Marienstraße“ (alte Bezeichnung war „Schulstraße“)<br />
5. die „Horst-Wessel-Straße“ in „Lutherstraße“ (alte Bezeichnung „Eulenstraße),<br />
bzw. zurück in „Ostbürener Straße“ (wie vor 1933)<br />
6. die „Graf-Adolf-Straße“ in „Moellerstraße“<br />
Unter dem gleichen Tagesordnungspunkt wurden die Schulen in „Lutherschule“ und „Overbergschule“<br />
zurückbenannt. Unangetastet blieben die Namen „Ostmarkstraße“, „Hindenburghain“<br />
und „von-Tirpitz-Straße“, ebenso wie die „Bismarckstraße“ und die politisch<br />
unbelasteten Dichter und Denker- Straßen wie auch die „Springstraße“, benannt nach einer<br />
Bachquelle im Umfeld, ebenso die Bezeichnung „Jägertal“.<br />
Im Prinzip richtig war die Beibehaltung <strong>der</strong> zwei Straßen und des einen Platzes nach den<br />
<strong>Fröndenberger</strong> Honoratioren Bering, Himmelmann und Wildschütz.<br />
<strong>Die</strong> Umbenennung <strong>der</strong> „Graf-Adolf-Straße“ in „Moellerstraße“ erfolgte allerdings nicht<br />
nur wegen des kompromittierenden Vornamen des märkischen Adeligen, son<strong>der</strong>n auch um<br />
die Verdienste des Chefs des Wasser- und Elektrizitätswerks zu würdigen, <strong>der</strong> zunächst 1933
42<br />
aus dem Amt gejagt worden war, wegen erwiesener Unfähigkeit seiner Nachfolger (und<br />
Parteigenossen <strong>der</strong> ersten Stunde), dann aber reumütig wie<strong>der</strong> eingestellt wurde und sich<br />
große Verdienste erworben hatte nicht nur beim Bau <strong>der</strong> Werke nach <strong>der</strong> Jahrhun<strong>der</strong>twende<br />
son<strong>der</strong>n auch beim Wie<strong>der</strong>aufbau <strong>der</strong> <strong>Fröndenberger</strong> Strom- und Wasserversorgung nach den<br />
Zerstörungen <strong>der</strong> Möhnekatastrophe 1943 und dem Bombenangriff 1945.<br />
<strong>Die</strong> genannte „Moellerstraße“ führt von <strong>der</strong> Kreuzung Ruhr-, Bahnhofs- und Bismarckstraße<br />
abzweigend zum Wasserwerk, ebenso wie die bereits in den 1920er Jahren benannte<br />
gleichnamige „Wasserwerkstraße“.<br />
Somit hätte es sein Bewenden haben können, wenngleich es aus heutiger Sicht sinnvoller und<br />
richtungsweisend gewesen wäre, ebenfalls die Ostmarkstraße umzubenennen Das „Dichterund<br />
Denkerviertel“ hätte ohne weiteres um eine Kleist-, Her<strong>der</strong>- o<strong>der</strong> Heinestraße erweitert<br />
werden können. Wenn <strong>der</strong> Jude Heinrich Heine dem einen o<strong>der</strong> an<strong>der</strong>en Gemeindevertreter<br />
unbekannt o<strong>der</strong> suspekt gewesen wäre, hätten ja auch noch die Herren Raabe, Storm, Fontane,<br />
Keller o<strong>der</strong> Hauptmann in Reserve gestanden.<br />
Auch die Benennung <strong>der</strong> Magdalenenstraße, ebenfalls eine Straße am Rande des „Dichterund<br />
Denkerviertels“ ohne jeden Bezug zur <strong>Fröndenberger</strong> Kirchen- und Klostergeschichte<br />
zeugt nicht von großer Phantasie <strong>der</strong> Entscheidungsträger.<br />
Es kam aber an<strong>der</strong>s. Auf <strong>der</strong> Gemein<strong>der</strong>atssitzung vom 16. Mai 1946, fast ein Jahr später,<br />
wurden drei <strong>der</strong> neu in den <strong>Straßennamen</strong>kanon aufgenommene Namen des Jahres 1945<br />
wie<strong>der</strong> eliminiert:<br />
1. aus <strong>der</strong> „Moellerstraße“ wurde wie<strong>der</strong> die „Graf-Adolf-Straße“<br />
2. aus <strong>der</strong> „Marienstraße wurde wie<strong>der</strong> die „Schulstraße“<br />
3. aus <strong>der</strong> „Lutherstraße“ wurde wie<strong>der</strong> die „Eulenstraße“<br />
Aus <strong>der</strong> Aktenüberlieferung geht keine Begründung für diesen Sinneswandel hervor. Allerdings<br />
reagierte Direktor Moeller, <strong>der</strong> sich auch bereits in den vergangenen Jahrzehnten ohne<br />
Furcht mit fast allen Gemeindegremien und Bürgermeistern gleich welcher politischen<br />
Ausrichtung angelegt hatte, mit Empörung und schrieb einen (inhaltlich lei<strong>der</strong> unbekannten)<br />
Brief an den Gemein<strong>der</strong>at, den dieser beschwichtigend beantwortete und versicherte, die<br />
Rücknahme des Beschlusses vom Juli 1945 bedeute keine Beeinträchtigung seiner Verdienste<br />
um die Gemeinde.<br />
Anzunehmen ist, dass einem Mitarbeiter <strong>der</strong> Verwaltung aufgefallen war, dass eine Benennung<br />
einer Straße nach einer noch lebenden Person (Direktor Moeller verstarb im Jahr 1955)<br />
üblicherweise nicht hätte vorgenommen werden sollen.<br />
Ob sich die britische Militärverwaltung des Falles angenommen hatte, muss offen bleiben; in<br />
den Protokollen des Gemein<strong>der</strong>ates und in <strong>der</strong> Überlieferung des Bauamtes als <strong>der</strong> diese<br />
Beschlüsse des Gemein<strong>der</strong>ates umsetzende Behörde finden sich darüber keine Hinweise.<br />
Übereinstimmend berichteten ältere Zeitzeugen, Namenschil<strong>der</strong> mit den Namen Moellerstraße,<br />
Marienstraße o<strong>der</strong> Lutherstraße habe es nie gegeben, was angesichts <strong>der</strong> Zeitumstände,<br />
Materialknappheit und Wichtigkeit an<strong>der</strong>er Aufgaben sicher <strong>der</strong> Wahrheit entsprechen dürfte.<br />
So ergibt sich folgen<strong>der</strong> <strong>Straßennamen</strong>bestand ab Sommer 1946 bis zur ersten Neubenennung<br />
einer Straße nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und Beginn neuer Bautätigkeit mit Verweis<br />
auf die Än<strong>der</strong>ungen zwischen Juli 1945 und dem 16.Mai 1946 in Fettdruck.<br />
<strong>Die</strong>se Liste kennt in <strong>der</strong> Aktenüberlieferung keine amtliches Gegenstück, son<strong>der</strong>n entstand<br />
durch Zugrundelegung <strong>der</strong> ersten überlieferten Nachkriegsliste aus dem Januar 1953, erstellt<br />
auf Anfrage <strong>der</strong> „Privatärztlichen Verrechnungsstelle“ in Plettenberg, die von <strong>der</strong> Gemeinde-
43<br />
verwaltung eine komplette Liste aller Straßen erbeten hatte. Von dieser Liste 1 wurden die<br />
Straßen abgezogen, die vor 1953 , bzw. nach 1946 einen Namen erhalten hatten.<br />
Alleestraße, per Ratsbeschluss vom 31.7.1945 umbenannt (1933-1945<br />
Hermann-Göringstraße)<br />
Am Steinbruch<br />
Annette-von-Droste-Hülshoff-Straße<br />
Ardeyer Straße<br />
Auf dem Krittenschlag<br />
Auf dem Sodenkamp<br />
Auf <strong>der</strong> Freiheit<br />
Bahnhofstraße<br />
Bergstraße<br />
Bertholdusstraße<br />
Bismarckstraße<br />
Engelbertstraße<br />
Eulenstraße, per Ratsbeschluss vom 16.5.1946 zurückbenannt in den Zustand vor 1933<br />
(von 1933-1945 Horst-Wessel-Straße, vom 31.7.1945-16.5.1946 Lutherstraße)<br />
Fischerssiepen<br />
Freiheitstrasse<br />
Friedhofstraße<br />
Friedrich-Bering-Straße<br />
Gartenstraße<br />
Goethestraße<br />
Graf-Adolf-Straße, per Ratsbeschluss vom 16.5.1946 zurückbenannt (war per Ratsbeschluss<br />
vom 31.7.1945 in Moellerstraße umbenannte worden)<br />
Haßleistraße<br />
Hengstenbergstraße<br />
Hermann-Löns-Straße<br />
(Am) Hirschberg<br />
Hohenheide<br />
Im Schelk<br />
Im Stift<br />
In den Telgen<br />
In den Wächelten<br />
In <strong>der</strong> Waldemey<br />
Irmgardstraße<br />
Jägertal<br />
Karl-Wildschütz-Straße<br />
Kirchplatz<br />
Klusenweg<br />
Körnerstraße<br />
Lessingstraße<br />
Löhnbachstraße<br />
Magdalenenstraße, per Ratsbeschluss vom 31.7.1945 umbenannt<br />
(ab Erstbenennung 1936 bis 1945 Hans-Schemm-Straße)<br />
Markt, per Ratsbeschluss vom 31.7.1945 zurückbenannt (1933-1945 Adolf-Hitler-Platz)<br />
Mühlenbergstraße<br />
1 Siehe Kopie aus StaF Bestand A 3659 in Anhang 1 lfd. Nr. 12
44<br />
Ostbürener Straße, per Ratsbeschluss vom 31.7.1945 zurückbenannt<br />
(1933-1945 Teil <strong>der</strong> Horst-Wessel-Straße)<br />
Ostmarkstraße<br />
Overbergstraße<br />
Querweg<br />
Ruhrstraße<br />
Schillerstraße<br />
Schroerstraße<br />
Schulstraße, per Ratsbeschluss vom 16.5.1946 zurückbenannt in den Zustand vor 1933<br />
(1933-1945 Schlageterstraße, 31.7.1945-16.5.1946 Marienstraße)<br />
Springstraße<br />
(Am) Steinufer<br />
Sümbergstraße<br />
Unnaer Straße<br />
Vom-Stein-Straße<br />
Von-Tirpitz-Straße<br />
Wasserwerkstraße<br />
Westick<br />
Westicker Heide<br />
Westicker Straße<br />
Wilhelm-Feuerhake-Straße<br />
Wilhelm-Himmelmann-Platz<br />
<strong>Die</strong> Neubenennung von Straßen begann am 3.11.1949 mit dem Gemein<strong>der</strong>atsbeschluss, die<br />
Straßen „Flie<strong>der</strong>weg“, „Rosenweg“ und „Südstraße“ zu benennen und endete vor <strong>der</strong> kommunalen<br />
Neuglie<strong>der</strong>ung zum 1.1.1968 mit <strong>der</strong> Benennung <strong>der</strong> Straßen „Gladiolenweg“ und<br />
„Nelkenweg“ am 12.10.1967 genau in dem Baugebiet, in dem 1949 <strong>der</strong> Flie<strong>der</strong>weg und<br />
Rosenweg ihre Namen erhalten hatten.<br />
Insgesamt 31 Neubenennungen wurden in diesem Zeitraum vorgenommen, nicht eingerechnet<br />
die vom Gemein<strong>der</strong>at beschlossenen Umlegungen bereits vorhandener und mit Namen versehener<br />
Straßen, wenn diese weitgehend ihrem bisherigen Verlauf beibehielten.<br />
Ebenso hier nicht mitgezählt aber erwähnenswert ist die Verlegung des Namens <strong>der</strong><br />
„Lessingstraße“. <strong>Die</strong>ser Name wurde neu vergeben für die Benennung einer Neubaustraße<br />
nur wenige hun<strong>der</strong>t Meter entfernt gelegen von ihrem bisherigen Standort. Der Name <strong>der</strong><br />
„alten“ Lessingstraße wurde eingezogen und <strong>der</strong>en Verlauf <strong>der</strong> Hermann-Löns-Straße zugeordnet.<br />
Schwerpunkte hinsichtlich <strong>der</strong> Lage <strong>der</strong> neuen Straßen waren das bereits im Kapitel D kurz<br />
vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges geplante Baugebiet in <strong>der</strong> Gemarkung „Freisenhagen“<br />
östlich <strong>der</strong> Unnaer Straße, die weitere Komplettierung des Wohngebiets Fröndenberg-Ost/<br />
Westick, <strong>der</strong> östliche Bereich des Mühlenbergs und die endgültig flächendeckende Bebauung<br />
des Sümberg.<br />
Daneben wurden einige bereits vorhandene Wege und Straßen in an<strong>der</strong>en Wohngebieten mit<br />
<strong>Straßennamen</strong> versehen.<br />
Hinsichtlich <strong>der</strong> Namensgebung standen Bäume und Blumen ganz oben auf <strong>der</strong> Favoritenliste<br />
und einige Flurnamen wurden als <strong>Straßennamen</strong> weiter verwendet.<br />
<strong>Die</strong> bereits angedeutete Phantasie- und/o<strong>der</strong> Entschlusslosigkeit im „Dichter- und Denkerviertel“<br />
erreichte 1949 mit <strong>der</strong> Benennung <strong>der</strong> „Südstraße“ ihren traurigen Höhepunkt.<br />
Ab Anfang <strong>der</strong> 1960er Jahre wurde ein Neubaugebiet am neuen Friedhof und auf <strong>der</strong> Westicker<br />
Heide im nördlichen Bereich zwischen Fröndenberg und Hohenheide erschlossen; hier<br />
kamen Vogelnamen als Namensgeber für die Straßen zum Zuge.
45<br />
In historischer und historiographischer Sicht positiv entwickelte sich die <strong>Straßennamen</strong>gebung<br />
auf dem Sümberg. Das hier bereits entstandene Ensemble aus Irmgard-, Engelbert-<br />
und Bertholdusstraße wurde bis 1967 um die <strong>Straßennamen</strong> „Am Sachsenwald“,<br />
„Menricusstraße“ und „Mauritiusstraße“ erweitert.<br />
Aufschlussreich für die Benennung von Straßen ist ein Auszug aus <strong>der</strong> Nie<strong>der</strong>schrift des<br />
Wegebau- und Friedhofsausschusses von <strong>der</strong> Sitzung am 21.2.1955, betreffs Punkt 2 „Benennung<br />
des Weges von <strong>der</strong> Alleestraße bis zum Fabrikgelände Frömag (<strong>Fröndenberger</strong> Maschinenbaugesellschaft).<br />
Hier heißt es u.a.:<br />
„Der Amtsbaumeister gab bekannt, dass <strong>der</strong> öffentliche Weg von <strong>der</strong> Alleestraße bis zum<br />
Fabrikgelände Frömag noch ohne Bezeichnung sei. Verwaltungsseitig würde die Bezeichnung<br />
„Talstraße“ o<strong>der</strong> „Klingelbachtal“ vorgeschlagen. Der Vorsitzende sprach sich für den Vorschlag<br />
„Klingelbachtal“ aus, weil dieser Name den meisten Einwohnern Fröndenbergs bekannt<br />
sei. Das Mitglied (...) meldete sich zu Wort und schlug vor, dem Weg die Bezeichnung<br />
„Frömag-Straße“ zu geben (...) Der Bürgermeister trat diesem Vorschlag entgegen und betonte,<br />
dass es nicht richtig sei, eine Straße nach einer Firma zu bezeichnen. Im übrigen könne<br />
die Firma UNION denselben Anspruch stellen. Nach seiner Ansicht müsse das Bestreben sein,<br />
überhaupt den Straßen solche Namen zu geben. <strong>Die</strong> auch den Kin<strong>der</strong>n etwas bedeuten. Er<br />
war <strong>der</strong> Meinung, dass die Bezeichnung „Am Klingelbach“ wohl die richtige sei. Das<br />
Mitglied (...) unterstützte diesen Vorschlag und betonte, dass seitens des Katasteramtes immer<br />
wie<strong>der</strong> darauf gedrängt würde, die alten Flurbezeichnungen nicht untergehen zu lassen. (...)<br />
Es entschieden sich acht Mitglie<strong>der</strong> für die Bezeichnung „Am Klingelbach“, das Mitglied (...)<br />
entschied sich dagegen. Nach diesem Beschluss wird also <strong>der</strong> Stadtvertretung vorgeschlagen,<br />
dem Weg die Bezeichnung „Am Klingelbach“ zu geben.<br />
<strong>Die</strong>ses Schriftstück verdeutlicht die übliche Vorgehensweise <strong>der</strong> Straßenbenennungen <strong>der</strong><br />
Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg bis in die jüngste Vergangenheit. Das Bauamt <strong>der</strong> Stadt<br />
(des Amtes o<strong>der</strong> <strong>der</strong> Gemeinde o<strong>der</strong> in an<strong>der</strong>en Fällen das Bauamt des Kreises o<strong>der</strong> das<br />
Katasteramt) sieht eine Notwendigkeit einer Benennung wegen noch bestehen<strong>der</strong> Namenlosigkeit<br />
einer bereits bebauten o<strong>der</strong> in Bebauung befindlichen Straße o<strong>der</strong> eine gerade im<br />
Entstehen begriffenen Straße und unterbreitet dem Wegebau- und Friedhofsausschuss entsprechende<br />
Vorschläge. <strong>Die</strong>se werden beraten o<strong>der</strong> durch eigene Vorschläge ergänzt und <strong>der</strong><br />
mehrheitlich getragene Beschluss wird dem Gemein<strong>der</strong>at o<strong>der</strong> dem Stadtrat zur end-gültigen<br />
Beschlussfassung zugeleitet. <strong>Die</strong>ser stimmt i.d.R. dem Vorschlag des Ausschusses zu und <strong>der</strong><br />
Gemeinde- o<strong>der</strong> Stadtratsbeschluss geht zurück an das Bauamt zur Veranlassung des<br />
Benennungsproze<strong>der</strong>e, Beschaffung <strong>der</strong> Schil<strong>der</strong>, Benachrichtigung des Einwohnermeldeamtes,<br />
heute Bürgeramt 2 . In seltenen Fällen verweist <strong>der</strong> Gemeinde- o<strong>der</strong> Stadtrat die Entscheidung<br />
an den Ausschuss zur weiteren Bearbeitung zurück o<strong>der</strong> er stellt aus an<strong>der</strong>en,<br />
eventuell auch wahltaktischen Gründen (dazu später in einem an<strong>der</strong>en Zusammenhang mehr)<br />
eine endgültige Entscheidung zurück, ohne damit die Empfehlung des Ausschusses sachlich<br />
in Frage gestellt zu haben.<br />
<strong>Die</strong> letztgenannten Son<strong>der</strong>fälle trafen zwar nicht auf die Benennung <strong>der</strong> Straße „Am Klingelbach“<br />
zu, sollen aber bereits hier als Thema <strong>der</strong> folgenden frühen 70er Jahre angedeutet<br />
werden.<br />
Ebenfalls deutlich werden an diesem Beispiel zwei For<strong>der</strong>ungen an den Ausschuss und vom<br />
Ausschuss selber formuliert:<br />
2 Wegen <strong>der</strong> hier gegebenen Überschaubarkeit (lediglich die Benennung einer Straße mit wenigen Anliegern)<br />
sind im Anhang 1 lfd. Nr. 13 drei aufeinan<strong>der</strong> folgenden Schriftstücke <strong>der</strong> Verwaltungstätigkeit in Kopie<br />
wie<strong>der</strong>gegeben. Quelle: StaF, Bestand A 6879/8
46<br />
<br />
<br />
<strong>Die</strong> Benennung möglichst orientiert nach alten Flur- und Gemarkungsnamen und...<br />
<strong>Die</strong> Wahl eines Namens, <strong>der</strong> <strong>der</strong> <strong>Fröndenberger</strong> Bevölkerung nach Möglichkeit<br />
„bekannt und geläufig“ sein soll.<br />
<strong>Die</strong> Einhaltung dieser For<strong>der</strong>ungen , bzw. Prämissen des Ausschusses selber hatte allerdings,<br />
so positiv und „bevölkerungsnah“ sie zunächst klingen mögen, einen Pferdefuß.<br />
Experimente bezüglich bislang nicht verwendeter Namen o<strong>der</strong> Themengruppen, seien es zum<br />
Beispiel Musiker o<strong>der</strong> Maler o<strong>der</strong> seien es nationalgeschichtlich bedeutsame Namensträger<br />
aus Zeitgeschichte und Politik konnten so nicht zum Tragen kommen, wenigstens nicht bis in<br />
die letzten 1960er Jahre.<br />
Bedacht wurde hierbei nicht, dass es ja eventuell von Nutzen sein könne, <strong>der</strong> Bevölkerung<br />
bislang unbekannte aber deswegen noch lange nicht unbedeutende Namensträger gerade<br />
durch ihre Verwendung als Träger eines <strong>Straßennamen</strong>s bekannt zu machen.<br />
Auch diese Überlegungen charakterisieren den wenige Jahre später sichtbaren Wertewandel<br />
<strong>der</strong> bundesdeutschen Gesellschaft auch in <strong>der</strong> Kleinstadt Fröndenberg.<br />
Bis dahin jedoch bestimmen Bäume, Blumen und Vögel auf den Straßenschil<strong>der</strong>n weitgehend<br />
die heile Welt <strong>der</strong> Wirtschaftswun<strong>der</strong>zeit.<br />
Wenigstens die heimatliche Geschichtsforschung bringt wie bereits erwähnt ein wenig Niveau<br />
in das eintönige Bild, wenngleich, die Schreckensjahre <strong>der</strong> Blut- und Boden Mystifizierung<br />
und Fehldeutungen <strong>der</strong> deutschen <strong>Geschichte</strong> liegen erst wenige Jahre zurück, die Geschichtsvermittlung<br />
im vermeintlich ruhigem Fahrwasser des späten Mittelalters verharrt. Mit dem<br />
Klostergrün<strong>der</strong> Menricus, dem Schutzheiligen Mauritius und dem fernen Raunen im Sachsenwald<br />
bewegt man sich auf sicherem Terrain; Ausflüge in die frühe Neuzeit, die preußische<br />
Zeit ab 1609 o<strong>der</strong> gar <strong>der</strong> Sprung in das kalte Wasser des 19. o<strong>der</strong> 20. Jahrhun-<strong>der</strong>ts wird über<br />
fünfundzwanzig Jahre lang nach Ende Nationalsozialismus hinsichtlich <strong>der</strong> Straßenbenennungen<br />
tunlichst vermieden.<br />
<strong>Die</strong> Wichtigkeit <strong>der</strong> Wohnraumbeschaffung in den Nachkriegsjahren verdeutlicht eine Zahl<br />
aus dem Verwaltungsbericht <strong>der</strong> Amtsverwaltung für die Berichtsjahre 1950 bis 1955.<br />
In diesem Zeitraum wurden im gesamten Amtsbezirk (Billmerich und Kessebüren wurden<br />
hier vom Verfasser herausgerechnet, 302 Wohnungsbauten mit 763 Wohnungen errichtet!<br />
Lei<strong>der</strong> enden die Verwaltungsberichte, wie in an<strong>der</strong>en Kommunen des Kreises Unna, ,mit<br />
dem Berichtsjahr 1955, weswegen keine Zahlen für die folgenden Jahre genannt werden<br />
können.<br />
Der Wohnsiedlungsbau als notwendige Voraussetzung für die Existenz neuer Straßen und<br />
damit auch <strong>Straßennamen</strong> sollte aber nicht unbeachtet bleiben; Straßenbenennungen waren<br />
und sind kein Selbstzweck, auch wenn sich über die gewählten Namen trefflich streiten lässt.<br />
Den Kapiteln über die vorhergehenden Epochen entsprechend, folgt eine<br />
Auflistung <strong>der</strong> zwischen 1949 und 1967 vergebenen <strong>Straßennamen</strong> geordnet nach dem<br />
Datum <strong>der</strong> Benennungsbeschlüsse und daran anschließend wie<strong>der</strong> die Kumulierung aller<br />
zum Zeitpunkt 31.12.1967 in <strong>der</strong> Gemeinde (ab 1952 Titularstadt) Fröndenberg existierenden<br />
<strong>Straßennamen</strong>. Straßenumbenennungen hat es in diesem Zeitraum, abgesehen vom erwähnten<br />
Fall <strong>der</strong> „Lessingstraße“ nicht gegeben, 3 wobei es sich in diesem speziellen Fall eher um<br />
3 Einen interessanten Zwischenstand dieses Zeitraumes gibt <strong>der</strong> erste nach dem Zweiten Weltkrieg 1963<br />
veröffentliche kommerzielle Stadtplan des Heimat- und Verkehrsvereins wie<strong>der</strong>.<br />
Er zeigt (ohne den Wohnbereich Hohenheide) den Stand <strong>der</strong> <strong>Straßennamen</strong> zum Sommer 1958, da <strong>der</strong><br />
„Ulmenweg“ im Baugebiet Mühlenberg eingezeichnet ist, <strong>der</strong> im September benannte „Lerchenweg“ als<br />
Zuwegung zum Friedhof hingegen noch nicht. Siehe dazu Kopie im Anhang 1 lfd. Nr. 14
47<br />
eine Umlegung handelte, denn beide betroffenen Straßen, Lessing-, wie Hermann-Löns-<br />
Straße behielten ihre Namen bei.<br />
03.11.1949 Flie<strong>der</strong>weg<br />
03.11.1949 Rosenweg<br />
03.11.1949 Südstraße<br />
15.08.1950 Margueritenweg<br />
23.10.1951 Am Sonnenhang<br />
23.10.1951 Asternweg<br />
23.10.1951 Birkenweg<br />
23.10.1951 Tulpenweg<br />
19.06.1953 Grüner Weg<br />
19.06.1953 Im Wiesengrund<br />
01.07.1954 Akazienweg<br />
01.07.1954 Lindenweg<br />
01.07.1954 Nordstraße<br />
08.03.1955 Am Klingelbach<br />
27.09.1957 Amselweg<br />
27.09.1957 Dahlienweg<br />
27.09.1957 Elsternweg<br />
27.09.1957 Finkenweg<br />
22.04.1958 Ulmenweg<br />
27.09.1958 Lerchenweg<br />
05.04.1960 Mauritiusstraße<br />
02.11.1960 Drosselweg<br />
02.11.1960 Wachtelweg<br />
02.11.1960 Starenweg<br />
21.10.1963 Ahornweg<br />
21.10.1963 Fichtenweg<br />
20.04.1965 Am Sachsenwald<br />
20.04.1965 Menricusstraße<br />
12.10.1967 Gladiolenweg<br />
12.10.1967 Nelkenweg<br />
12.10.1967 Schlehweg<br />
<strong>Straßennamen</strong>verzeichnis für die Gemeinde (ab 1952 Titularstadt) Fröndenberg ohne<br />
die amtsangehörigen Gemeinden Stand 31.12.1967, fett hervorgehoben die neu<br />
benannten Straßen zwischen 1949 und 1967:<br />
(in Klammern die Überlieferung in den Akten des Bauamtes, ansonsten Datum des Gemein<strong>der</strong>ates/Stadtrates)<br />
Ahornweg (F), Ratsbeschluss vom 21.10.1963<br />
Akazienweg (F), Ratsbeschluss vom 1.7.1954 (A 6879/8)<br />
Alleestraße (F)<br />
Am Klingelbach (F), Ratsbeschluss vom 8.3.1955 (A 6879/8)<br />
Am Sachsenwald (F), Ratsbeschluss vom 20.4.1965 (A 3659)<br />
Am Sonnenhang (F), Ratsbeschluss vom 23.10.1951 (A 6879/8)<br />
Am Steinbruch (F)<br />
Amselweg (F), Ratsbeschluss vom 27.9.1957 (A 6879/8)<br />
Annette-von-Droste-Hülshoff-Straße (F)<br />
Ardeyer Straße (F)<br />
Asternweg (F), Ratsbeschluss vom 23.10.1951 (A 6879/8)<br />
Auf dem Krittenschlag (F)
48<br />
Auf dem Sodenkamp (F)<br />
Auf <strong>der</strong> Freiheit (F)<br />
B<br />
Bahnhofstraße (F)<br />
Bergstraße (F)<br />
Bertholdusstraße (F)<br />
Birkenweg (F), Ratsbeschluss vom 23.10.1951 (A 6879/8)<br />
Bismarckstraße (F)<br />
D<br />
Dahlienweg (F), Ratsbeschluss vom 27.9.1957 (A 6879/8)<br />
Drosselweg (F), Ratsbeschluss vom 2.11.1960 (A 3659) Hohenheide<br />
E<br />
Elsternweg (F), Ratsbeschluss vom 27.9.1957 (A 6879/8)<br />
Engelbertstraße (F)<br />
Eulenstraße (F)<br />
F<br />
Fichtenweg (F), Ratsbeschluss vom 21.10.1963<br />
Finkenweg (F), Ratsbeschluss vom 27.9.1957 (A 6879/8)<br />
Fischerssiepen (F)<br />
Flie<strong>der</strong>weg (F), Ratsbeschluss vom 3.11.1949 (A 6879/8)<br />
Freiheitstrasse (F)<br />
Friedhofstraße (F)<br />
Friedrich-Bering-Straße (F)<br />
G<br />
Gartenstraße (F)<br />
Gladiolenweg (F), Ratsbeschluss vom 12.10.1967 (A 3659)<br />
Goethestraße (F)<br />
Graf-Adolf-Straße (F)<br />
Grüner Weg (F), Ratsbeschluss vom 19.6.1953 (A 6879/8)<br />
H<br />
Haßleistrasse (F)<br />
Hengstenbergstraße (F)<br />
Hermann-Löns-Straße (F), erweitert um die „alte“ Lessingstra0e<br />
(Am ) Hirschberg (F)<br />
Hohenheide (F)<br />
I, J<br />
Im Schelk (F)<br />
Im Stift (F)<br />
Im Wiesengrund (F), Ratsbeschluss vom 19.6.1953, bis dahin Teil <strong>der</strong> Overbergstraße, die<br />
mit gleichem Datum verlegt wurde (A 6879/8)<br />
In den Telgen (F)<br />
In den Wächelten (F)<br />
In <strong>der</strong> Waldemey (F)<br />
Irmgardstraße (F)<br />
Jägertal (F), teilweise Umlegung laut Ratsbeschluss vom 19.6.1953 (A 6879/8) und<br />
Verlängerung nach Norden laut Ratsbeschluss vom 27.9.1957 (A 6879/8)<br />
K<br />
Karl-Wildschütz-Straße (F)<br />
Kirchplatz (F)
49<br />
Klusenweg (F) Umbenennung in Teilbereichen 1954 geplant, aber abgelehnt mit <strong>der</strong><br />
Begründung, dass „dies einer <strong>der</strong> ältesten Wege in Fröndenberg sei“ und<br />
daher keinesfalls umbenannt o<strong>der</strong> neubenannt werden dürfe (A 6879/8)<br />
Körnerstraße (F)<br />
L<br />
Lerchenweg (F), Ratsbeschluss vom 2.9.1958 (A 6879/8)<br />
Lessingstraße (F), neuer Verlauf, etwa zweihun<strong>der</strong>t Meter weiter westlich<br />
Lindenweg (F), Ratsbeschluss vom 1.7.1954 (A 6879/8)<br />
Löhnbachstraße (F)<br />
M<br />
Magdalenenstraße (F)<br />
Margueritenweg (F), Ratsbeschluss vom 15.8.1950 (A 3659)<br />
Markt (F)<br />
Mauritiusstraße (F), Ratsbeschluss vom 5.4.1960 (A 6879/8)<br />
Menricusstraße (F), Ratsbeschluss vom 20.4.1965 (A 3659)<br />
Mühlenbergstraße (F)<br />
N, O<br />
Nelkenweg (F), Ratsbeschluss vom 12.10.1967<br />
Nordstraße (F), Ratsbeschluss vom 1.7.1954 (A6879/8)<br />
Ostbürener Straße (F)<br />
Ostmarkstraße (F)<br />
Overbergstraße (F), abgeän<strong>der</strong>ter Verlauf laut Ratsbeschluss vom 19.6.1953 (A 6879/8)<br />
Q, R<br />
Querweg (F)<br />
Rosenweg (F), Ratsbeschluss vom 3.11.1949 (A 6879/8)<br />
Ruhrstraße (F)<br />
S, Sch<br />
Schillerstraße (F)<br />
Schlehweg (F) Ratsbeschluss vom 12.10.1967<br />
Schröerstraße (F)<br />
Schulstraße (F)<br />
Springstraße (F)<br />
Starenweg (F), Ratsbeschluss vom 2.11.1960 (A 3659) Hohenheide<br />
(Am) Steinufer (F)<br />
Südstraße (F), Ratsbeschluss vom 3.11.1949 (A 6879/8)<br />
Sümbergstraße (F), teilweise neuer Verlauf laut Ratsbeschluss vom 19.6.1953 (A 6879/8)<br />
T, U, V<br />
Tulpenweg (F), Ratsbeschluss vom 23.10.1951 (A6879/8)<br />
Ulmenweg (F), Ratsbeschluss vom 22.4.1958 (A 6879/8)<br />
Unnaer Straße (F)<br />
Vom-Stein-Straße (F)<br />
Von-Tirpitz-Straße (F)<br />
W<br />
Wachtelweg (F), Ratsbeschluss vom 2.11. 1960 (A 3659) Hohenheide<br />
Wasserwerkstraße (F)<br />
Westick (F)<br />
Westicker Heide (F)<br />
Westicker Straße (F)<br />
Wilhelm-Feuerhake-Straße (F)<br />
Wilhelm-Himmelmann-Platz (F)
50<br />
Exkurs 4<br />
Straßenbenennungen und die Heimatvertriebenen<br />
Im Folgenden geht es um <strong>Straßennamen</strong> im Zusammenhang mit <strong>der</strong> Zuzugswelle <strong>der</strong> Heimatvertriebenen<br />
aus den deutschen Ostgebieten o<strong>der</strong> von Deutschstämmigen bewohnten Siedlungsgebieten<br />
in Polen, <strong>der</strong> Tschechoslowakei, Ungarn, Rumänien, Jugoslawien und an<strong>der</strong>en<br />
Gebieten, die massiv ab Frühjahr 1946 im Kreisgebiet Unna einsetzte, nachdem zunächst <strong>der</strong><br />
Ruhrkohlenbezirk und direkt angrenzende Regionen für Zuzüge jeglicher Art gesperrt worden<br />
waren.<br />
Nach unterschiedlich hoch ausgefallenen Schätzungen und Berechnungen wurden zwischen<br />
10 und 15 Mio. Menschen aus ihren angestammten Wohngebieten zwischen Ende 1944 und<br />
Ende 1949 vertrieben, von denen etwa 2,5 Mio. während <strong>der</strong> Flucht starben, ermordet<br />
wurden o<strong>der</strong> bereits an ihren angestammten Wohnsitzen ermordet o<strong>der</strong> von dort in die<br />
UDSSR verschleppt wurden. Während etwa ¼ <strong>der</strong> Heimatvertriebenen in Mitteldeutschland<br />
untergebracht wurde, gelangten ¾ in die britische und amerikanische Besatzungszone, später<br />
auch in die französische Zone. 1<br />
Manche Transporte kamen direkt nach Westfalen, an<strong>der</strong>e Personengruppen hatten vorher in<br />
Bayern, Nie<strong>der</strong>sachsen und beson<strong>der</strong>s in Schleswig-Holstein Aufnahme gefunden, wurden<br />
aber „weitergeleitet“, da die genannten Aufnahmeräume bereits hoffnungslos durch Flüchtlinge<br />
übervölkert waren und die Versorgung <strong>der</strong> Heimatvertriebenen wie auch <strong>der</strong>en dauerhafte<br />
Integrierung, Bereitstellung von Arbeitsplätzen etc. nicht zu bewältigen war. 2<br />
Zwischen 1950 und 1961 flüchtete mindestens ein Drittel <strong>der</strong> auf dem Gebiet <strong>der</strong> DDR zunächst<br />
untergekommnene Heimatvertriebenen weiter in Richtung Bundesrepublik o<strong>der</strong> West-<br />
Berlin. 3<br />
Bereits ab 1947 sind im Kreisgebiet Unna Straßenbenennungen mit diesem Bezugsrahmen<br />
nachweisbar. 4 Dokumentiert werden sollte damit die Verbundenheit <strong>der</strong> Städte mit ihren<br />
Neubürgern und ihrem Schicksal, dienten aber auch <strong>der</strong> manifestierten Erinnerung zur Aufrechterhaltung<br />
des Anspruchs auf Rückkehr und im Kalten Krieg als bleibende Erinnerung an<br />
die völkerrechtswidrige Vertreibung aus den seit 1945/46 kommunistisch regierten Län<strong>der</strong>n<br />
Osteuropas.<br />
Auch die einheimische Bevölkerung sollte durch diese <strong>Straßennamen</strong> an die Herkunft <strong>der</strong><br />
neuen Mitbürger dauerhaft erinnert werden, wie auch in <strong>der</strong> Gesamtbevölkerung <strong>der</strong> Gedanke<br />
an eine Wie<strong>der</strong>vereinigung in den Grenzen von 1937 und ein „gesamtdeutsches Denken“<br />
wachgehalten werden sollte, was sich jedoch mit den Jahren durch die gewachsenen<br />
Realitäten und <strong>der</strong> europäischen Nachkriegsordnung zunehmend als illusorisch und<br />
wirklichkeitsfremd erwies.<br />
1 Erst relativ spät, im Frühjahr 1948, begann auch <strong>der</strong> Zuzug von Heimatvertriebenen in die französische<br />
Besatzungszone, die sich bis dahin unter manchen Vorwänden aber auch wegen massiver<br />
Versorgungsprobleme in den ihnen zugewiesenen südwestdeutschen Regionen strikt geweigert hatte,<br />
Flüchtlinge aufzunehmen. In die späteren Bundeslän<strong>der</strong> Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz wurden<br />
mehrheitlich aus Ungarn, Jugoslawien und den südlichen sudetendeutschen Siedlungsgebieten stammende<br />
Personen eingewiesen, die oft bereits aus ihrer Heimat ausgewiesen, in österreichischen Übergangslagern<br />
untergebracht worden waren. In den fünfziger Jahren wan<strong>der</strong>ten aber auch in geringer Zahl Pommern, Schlesier<br />
und Ostpreußen zu, die zuvor in Nordwestdeutschland Aufnahme gefunden hatten.<br />
2 Beson<strong>der</strong>s gravierend im landwirtschaftlich strukturierten Schleswig-Holstein, wo beson<strong>der</strong>s viele Vertriebene<br />
durch die Schiffsevakuierungen <strong>der</strong> letzten Kriegsmonate aus dem Memelgebiet, aus Ostpreußen und Pommern<br />
gelandet waren.<br />
3 Wobei es hier oft schwierig ist zu differenzieren zwischen den zwangsweise Ausgesiedelten und Vertriebenen<br />
und den mehr o<strong>der</strong> weniger freiwillig aus <strong>der</strong> Sowjetzone geflüchteten Menschen, die aus eigenem Willen<br />
wegen vermeintlicher o<strong>der</strong> echter politischer Verfolgung und/o<strong>der</strong> wirtschaftlichen Gründen flüchteten.<br />
4 Breslau und Danzig, I. Kant und G. Hauptmann traten an die Stelle von York und Roon, des König und des<br />
Kronprinzen. Quelle: Amtliche Bekanntmachungen <strong>der</strong> Militärregierung vom 18.1.1947
51<br />
Heute, 60 Jahre nach <strong>der</strong> Vertreibung, beginnt eine Neubewertung <strong>der</strong> Vertriebenenfrage<br />
beson<strong>der</strong>s hinsichtlich <strong>der</strong> seelischen und psychologischen Beschädigungen, die <strong>der</strong> einzelne<br />
Mensch o<strong>der</strong> ganze Gruppen durch Flucht und Vertreibung erlitten haben. Dabei geht es auch<br />
oft um „Verletzungen“, die den vertriebenen Menschen erst nach <strong>der</strong> Flucht in <strong>der</strong> „neuen<br />
Heimat“ zugefügt wurden durch Unverständnis, Ablehnung und Hartherzigkeit angesichts <strong>der</strong><br />
eigenen schwierigen Situation seitens <strong>der</strong> Eingesessenen in den ersten Nachkriegsjahren.<br />
Vielfach wird Rückschau gehalten und dabei ist auch die <strong>Geschichte</strong> <strong>der</strong> Straßenbenennungen<br />
o<strong>der</strong> <strong>der</strong>en Verhin<strong>der</strong>ung ein kleiner Mosaikstein hin zu einer Gesamtbewertung.<br />
<strong>Die</strong> Entwicklung in Fröndenberg<br />
Der Heimatvertreibung wurde bis 1958 mit nur einer Straße, <strong>der</strong> Schlesierstraße im heutigen<br />
Stadtteil Ardey, gedacht. 5 Allerdings gab es an<strong>der</strong>e Vorstellungen und Planungen wie im Folgenden<br />
aufgezeigt werden soll.<br />
Erstaunlich ist, dass bis 1958 zunächst einmal gar nichts passierte, obwohl <strong>der</strong> Amtsbezirk<br />
Fröndenberg 1949 mit nahezu 28 % Anteil von Heimatvertriebenen an <strong>der</strong> Gesamtbevölkerung<br />
die Spitzenposition im Kreis Unna einnahm. Wie unterschiedlich die Verteilung <strong>der</strong><br />
Heimatvertriebenen auf das Gebiet <strong>der</strong> drei westlichen Besatzungszonen war, wird deutlich,<br />
wenn man die Zahlen aus <strong>der</strong> französischen Zone betrachtet, <strong>der</strong>en Militärregierung sich bis<br />
1947 strikt weigerte überhaupt Heimatvertriebene aufzunehmen. Erst ab Spätherbst 1947<br />
wurden hier in den späteren Bundeslän<strong>der</strong>n Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz auf<br />
Drängen <strong>der</strong> übrigen Besatzungsmächte die Heimatvertriebenen aus Südosteuropa (Ungarn,<br />
Rumänien und Jugoslawien) aufgenommen, die zu diesem Zeitpunkt zumeist in Auffanglagern<br />
Österreichs Zuflucht gefunden hatten. Hier lag <strong>der</strong> prozentuale Anteil <strong>der</strong> Heimatvertriebenen<br />
in Ämtern mit vergleichbarer Bevölkerungsdichte bei höchstens 7 %, in <strong>der</strong><br />
Regel unter 5 % <strong>der</strong> Gesamtbevölkerung. 6<br />
Eine Schlesierstraße in Ardey<br />
Grund für die zögerliche Straßenbenennung war im Amt Fröndenberg <strong>der</strong> relativ späte Beginn<br />
von Neubausiedlungen und die zunächst schnelle Unterbringung <strong>der</strong> Heimatvertriebenen in<br />
privaten Wohnungen und später in eigenen meist kommunalen Häusern über den gesamten<br />
Amtsbezirk verteilt, so dass erst spät eine Siedlerbewegung <strong>der</strong> Heimatvertriebenen entstand,<br />
bzw. mit <strong>der</strong> Ausnahme von Ardey keine Siedlungstätigkeit <strong>der</strong> Heimatvertriebenen in<br />
geschlossenen Neubau-Siedlungsgebieten erfolgte, die eine Namensgebung nach ihrer Herkunft<br />
logisch zur Folge hätte haben können.<br />
Am Rande erwähnt, dass von Seiten <strong>der</strong> Gemeinde- und Amtsverwaltung in <strong>der</strong> heutigen<br />
Kernstadt auch nach Aussage von Zeitzeugen eine solche Siedlungspolitik bis in die 60er<br />
Jahre nicht unbedingt geför<strong>der</strong>t worden sei. „Man solle froh sein, überhaupt ein Dach über<br />
dem Kopf bekommen zu haben“, so die kolportierte Aussage einer Amtsperson, die sich nicht<br />
schriftlich in den Akten wie<strong>der</strong>findet, aber als im Gedächtnis haften gebliebene Kernaussage<br />
zur sozialen Situation <strong>der</strong> Heimatvertriebenen an dieser Stelle Erwähnung finden soll. 7<br />
In einem handschriftlichen Brief, unterzeichnet von Alfred Schreiber und Fritz Langner, vom<br />
9.September 1958 wird die Gemeindeverwaltung in Ardey gebeten, auf Wunsch aller<br />
5 Hinsichtlich <strong>der</strong> in Dellwig benannten Eichendorffstraße ist kein direkter Bezug zur Ansiedlung von<br />
Ostvertriebenen nachzuweisen; eher <strong>der</strong> Wunsch, zusammen mit <strong>der</strong> Nennung von H.Löns ein wenn auch<br />
kleines eigenes „Dichterviertel“ im Gemeindegebiet als Zeichen <strong>der</strong> Kulturverbundenheit zu besitzen.<br />
6 Ohne das heute gute Verhältnis zu Frankreich damit unnötig belasten zu wollen, muss deutlich gesagt werden,<br />
dass es zunächst die Franzosen waren, die eine Gesamtregierung <strong>der</strong> vier Siegermächte über Deutschland im<br />
alliierten Kontrollrat ständig torpedierte, Son<strong>der</strong>recht beanspruchte und gemeinsame Entscheidungen<br />
behin<strong>der</strong>te. Erst ab 1948 übernahm die Sowjetunion diese Rolle des „Störfaktors“ mit dem sich abzeichnenden<br />
Ost-West-Konflikt und Frankreichs Annäherung an die amerikanisch-britischen Positionen.<br />
7 Gespräch mit <strong>der</strong> Vorsitzenden des Bundes <strong>der</strong> Heimatvertriebenen in Fröndenberg, Frau M.Janotta aus<br />
Schlesien stammend.
52<br />
unterzeichnenden Neusiedler, die Straße an <strong>der</strong> Nebenerwerbssiedlung vom Heideweg nach<br />
Süden abzweigend, „Schlesierstraße“ zu benennen.<br />
<strong>Die</strong> Gemeindevertretung entsprach auf ihrer Sitzung vom 16. September 1958 dem vorgetragenen<br />
Wunsch und verkündete mit öffentlichem Aushang vom 28. Januar 1959 diese<br />
Benennung <strong>der</strong> Flurstücke 7 und 248 <strong>der</strong> Ardeyer Flur Nummer 2. 8<br />
Jahre später, im ersten Halbjahr 1969 stand die Benennung <strong>der</strong> Straßen im Baugebiet<br />
Mühlenberg-West in Fröndenberg im Mittelpunkt <strong>der</strong> Beratungen des Wegebau- und<br />
Friedhofsausschusses und beschäftigte auch die gebildete Son<strong>der</strong>kommission dieses<br />
Ausschusses, <strong>der</strong> sich intensiv um einen Konsens <strong>der</strong> Um- und Neubenennungen im Zuge <strong>der</strong><br />
kommunalen Gebietsreform bemühte. Vorgeschlagen wurde die Benennung nach Personen<br />
<strong>der</strong> deutschen Wi<strong>der</strong>standsbewegung gegen das NS-Regime.<br />
In einer Stellungnahme <strong>der</strong> CDU-Ratsfraktion vom 18.6.1969 heißt es zum Vorschlag des o.g.<br />
Son<strong>der</strong>ausschusses: 9<br />
„Es ist jedoch eine Tatsache, dass die meisten <strong>der</strong> genannten Namen <strong>der</strong> Masse <strong>der</strong> Bevölkerung<br />
nicht bekannt sind (...) <strong>Die</strong> CDU-Fraktion (...) beantragt, die Straßen nach Orten zu<br />
benennen, die hinter dem eisernen Vorhang bzw. hinter <strong>der</strong> O<strong>der</strong>-Neiße-Grenze liegen. Damit<br />
würde man Namen wählen, die Je<strong>der</strong>mann bekannt sind (...) Zum an<strong>der</strong>en könnte damit<br />
erreicht werden, dass auch in den jungen Menschen unserer Stadt die Erinnerung an diese<br />
alten deutschen Städte wachgehalten wird. Im übrigen würden es sicherlich alle Heimatvertriebenen<br />
begrüßen, wenn man durch diese Straßenbenennungen ihrer alte Heimat<br />
gedenken würde.“<br />
Für die Hauptstraße durch das neue Wohngebiet schlug die CDU-Fraktion den Namen „Berliner<br />
Straße“ vor und für die übrigen Straßen eine Benennung nach den Städten Königsberg,<br />
Breslau, Danzig, Stettin, Oppeln und Liegnitz.<br />
Dem Antrag lag ein Schreiben des „Wochendienstes des Gemeindetages Westfalen-Lippe“<br />
vom 24.Juni 1963 bei, in dem die Städte und Gemeinden durch den Bundesminister für<br />
gesamtdeutsche Fragen gebeten werden, auf Grund des 10jährigen Gedenkens an den<br />
Volksaufstand in <strong>der</strong> Sowjetzone im Juni 1953 in je<strong>der</strong> Stadt und Gemeinde eine Straße nach<br />
„<strong>der</strong> alten Reichshauptstadt“ zu benennen, sowie mittel- und ostdeutsche Städte bei <strong>der</strong><br />
Straßenbenennung angemessen zu berücksichtigen. 10<br />
Trotzdem beschloss die Ratsversammlung noch am gleichen Tag (18.6.1969) einstimmig,<br />
(also auch mit den Stimmen <strong>der</strong> CDU!) die Benennung nach dem Vorschlag <strong>der</strong> Son<strong>der</strong>kommission.<br />
Mit Einstimmigkeit wurde aber auch beschlossen, in <strong>der</strong> nächsten zu bauenden<br />
geschlossenen Siedlung im Stadtgebiet Namen ostdeutscher Städte zu berücksichtigen.<br />
<strong>Die</strong>ser zweite Teil des Ratsbeschluss vom 18.6.1969 wurde konkret aktuell, als in <strong>der</strong> Sitzung<br />
des Wegebau- und Friedhofsausschusse am 20.August 1973 die Beratung über die Benennung<br />
<strong>der</strong> Neubaustraßen im Bereich <strong>der</strong> Bebauungspläne 15 und 16 (Hohenheide Ost und Mitte)<br />
anstand. Der Ausschuss schlug <strong>der</strong> Verwaltung auf <strong>der</strong> Basis eigener Vorschläge und damit<br />
mittelbar auch dem politischen Gremium des Stadtrates die Benennung <strong>der</strong> Straßenzüge im<br />
Bebauungsplan 17 nach Namen ostpreußischer Städte und dazu analog für die Benennung <strong>der</strong><br />
Straßen im Bereich des Bebauungsplans 16 mit Namen schlesischer Städte vor.<br />
Königsberg, Tilsit, Lötzen, Angerburg, Memel, Allenstein und Tannenberg, Breslau,<br />
Waldenburg, Glatz, Leobschütz, Annaberg, Gleiwitz, Reichenberg, Kreisau, Brieg,<br />
Oppeln und Bunzlau standen zur Auswahl.<br />
Nach, wie es im Protokoll heißt, kurzer Beratung befürwortete <strong>der</strong> Ausschuss einstimmig die<br />
von <strong>der</strong> Verwaltung in ihrer Vorlage dem Ausschuss vorgeschlagene Straßenbezeichnungen<br />
nach den Städten Königsberg, Memel und Tannenberg, sowie Breslau, Waldenburg,<br />
Glatz und Gleiwitz.<br />
8<br />
9<br />
Antrag und Gemein<strong>der</strong>atsbeschluss siehe Anhang 1 lfd. Nr. 15<br />
Siehe in Kopie Anlage 1 lfd. Nr. 16<br />
10 Siehe in Kopie Anlage 1 lfd. Nr. 17
53<br />
Damit hätte es sein Bewenden haben können, wäre da nicht eine Initiative <strong>der</strong> Anwohner<br />
unter Fe<strong>der</strong>führung von Gerhard Ramme auf den Plan getreten, die mit Schreiben vom<br />
12.September 1973 ihrerseits Vorschläge unterbreitete. Naturkundliche Benennungen sollten<br />
Berücksichtigung finden, ohne dass Ramme in seinem Brief zunächst konkret die Benennung<br />
nach ostdeutschen Städten kritisierte o<strong>der</strong> in Frage stellte.<br />
In <strong>der</strong> Stadtratssitzung vom 24.9.1973 wurde dem „Eingang neuer Anregungen“ statt gegeben<br />
und die Vorlage <strong>der</strong> Verwaltung auf Benennung nach ostdeutschen Städtenamen von <strong>der</strong><br />
Tagesordnung abgesetzt und zur weiteren Beratung an die Ausschüsse und Fraktionen zurück<br />
verwiesen.<br />
Am 19.12.1973 beschloss jedoch <strong>der</strong> Wegebau- und Friedhofsausschuss nach Rücksprache<br />
mit den Fraktionen die Beibehaltung ihres ursprünglichen Vorschlages, „da die von Herrn<br />
Ramme unterbreiteten Vorschläge bei <strong>der</strong> Bevölkerung keinen Anklang finden würden...“ 11<br />
Doch die Anwohner ließen sich nicht einschüchtern und untermauerten ihre Gegenvorschläge<br />
mit Schreiben vom 6. Februar 1974 „im vollen Verständnis dafür, dass man die Erinnerung an<br />
die ehemaligen Ostgebiete aufrecht erhalten wolle“ aber die Benennung gerade dieser Straßen<br />
für vollkommen ungeeignet halte. „<strong>Die</strong> beabsichtigten (ostdeutschen) <strong>Straßennamen</strong> haben<br />
keinen Bezug zur Örtlichkeit. Kulturgeschichte, Geografie und Natur dieses (<strong>Fröndenberger</strong>)<br />
Raumes bieten dagegen viele Möglichkeiten für eine Namensgebung.“<br />
Der erneute Vorstoß schließt mit <strong>der</strong> Bemerkung, doch in Zukunft sachverständige und<br />
ortskundige Bürger in die Straßenbenennungskommissionen zu berufen.“ Kulturhistorisch für<br />
den Raum bedeutsame <strong>Straßennamen</strong> seien schon aus dem Stadtplan ohne Möglichkeit <strong>der</strong><br />
Einflussnahme durch die Bürger und Anwohner verschwunden. Konkret wird Bezug<br />
genommen auf die 1933 umbenannte „Münzfundstraße“ in Westick.<br />
Ortsbezug statt Ostbezug<br />
Unter dieser Überschrift vermeldete die „Westfälische Rundschau“ vom 10.4.1974 den<br />
erfolgreichen Einspruch <strong>der</strong> Anwohner bei <strong>der</strong> neuen Erarbeitung einer Beschlussvorlage für<br />
den Rat im Wegebau- und Friedhofsausschuss und entsprechend wurde auf <strong>der</strong> Ratssitzung<br />
vom 5.6.1974 die Benennung <strong>der</strong> Straßen nach den Vorschlägen <strong>der</strong> Anwohner beschlossen.<br />
Hasensprung und Dachsleite, In <strong>der</strong> Sasse, Erlengrund und Löhnquelle behielten gegenüber<br />
Königsberg und Breslau die Oberhand.<br />
Ein bislang letzten Vorstoß unternahm am 28. Februar 1984 die Sprecherin des Gemeindebeirats<br />
für Vertriebene- und Flüchtlingsfragen Frau Margarete Janotta, selber eine<br />
Heimatvertriebene aus Schlesien. Sie bat Stadtdirektor Rebbert um Genehmigung und<br />
Befürwortung einer Reihe von Vorschlägen und Anträgen zur angemessenen Berücksichtigung<br />
<strong>der</strong> <strong>Geschichte</strong> <strong>der</strong> Heimatvertriebenen in <strong>der</strong> Stadt Fröndenberg, so u.a. den<br />
Antrag auf „Benennung von Straßen, Plätzen und Gebäuden in <strong>der</strong> Stadt mit Namen, welche<br />
in Beziehung zu bringen sind mit den Provinzen, Städten und Personen in Ost- und Mitteldeutschland.“<br />
Obwohl ein gleichfalls beantragtes Faltblatt mit Informationen über die Herkunft<br />
und die <strong>Geschichte</strong> <strong>der</strong> Heimatvertriebenen verwirklicht wurde, blieb <strong>der</strong> weitere<br />
Wunsch nach Benennung von Straßen und Wegen nach Herkunftsorten <strong>der</strong> Heimatvertriebenen<br />
in Fröndenberg unverwirklicht.<br />
Ausblick<br />
Der Rückgang <strong>der</strong> Bevölkerung und <strong>der</strong> damit einhergehende Rückgang von Neubausiedlungen,<br />
die inzwischen als abgeschlossen zu betrachtende Integration <strong>der</strong> Heimatvertriebenen<br />
sowie die nach <strong>der</strong> deutschen Wie<strong>der</strong>vereinigung von West- und Mitteldeutschland völkerrechtlich<br />
endgültig anerkannte Westgrenze Polens sind Gründe dafür, dass es auch in Zukunft<br />
in Fröndenberg bei dieser Situation bleiben wird Allerdings könnten Städtepartnerschaften<br />
mit Osteuropa und ein gesamteuropäisches Zusammengehörigkeitsgefühl hier neue Akzente<br />
setzen, dann aber unter gänzlich an<strong>der</strong>en Voraussetzungen als in den Jahren nach 1945<br />
11 Eine Begründung für diese Annahme wurde nicht mitgeliefert, bzw. ist nicht in den Akten auffindbar
54<br />
F. <strong>Geschichte</strong> <strong>der</strong> <strong>Straßennamen</strong> in den amtsangehörigen<br />
Gemeinden bis 1967<br />
Bis zum 31.12.1967 bestand <strong>der</strong> Amtsverbund zwischen dem Hauptort Fröndenberg und vier<br />
zehn amtsangehörigen Gemeinden.<br />
Zum 01.01.1968 wurde dieser Amtsverbund aufgelöst, die Gemeinden Billmerich und Kessebüren<br />
<strong>der</strong> Stadt Unna zugeordnet.<br />
Somit verblieben <strong>der</strong> neu gebildeten Stadt Fröndenberg zwölf ehemals selbständige<br />
Gemeinden als zukünftige Stadtteile, wobei Langschede, Dellwig und Ardey sich bereits im<br />
Jahr 1966 zu einer Großgemeinde Langschede zusammengeschlossen hatten. <strong>Die</strong>ser Verbund<br />
wurde mit <strong>der</strong> Neubildung <strong>der</strong> Stadt zum 1.1.1968 wie<strong>der</strong> aufgelöst.<br />
Wie im Hauptteil G <strong>der</strong> vorliegenden Arbeit aufgezeigt wird, gab es bis zum 31.12.1967 in<br />
den Gemeinden:<br />
Altendorf<br />
Bausenhagen<br />
Bentrop<br />
Ostbüren<br />
Stentrop<br />
und Warmen<br />
keine mit Namen benannten Straßen. <strong>Die</strong> <strong>Geschichte</strong> <strong>der</strong> <strong>Straßennamen</strong> dieser Gemeinden<br />
(Stadtteile) beginnt also erst am 1.1.1968 mit dem Planungsbeginn <strong>der</strong> Umbenennungs- und<br />
Benennungsphase, die im o.a. Hauptteil G beschrieben wird und mit Inkrafttreten aller<br />
Än<strong>der</strong>ungen und Neuerungen zum 1.1.1971 beendet wurde.<br />
Das vorliegenden Kapitel widmet sich somit <strong>der</strong> <strong>Geschichte</strong> <strong>der</strong> <strong>Straßennamen</strong> in den übrigen<br />
Amtsgemeinden:<br />
Ardey<br />
Dellwig<br />
Frömern<br />
Frohnhausen<br />
Langschede<br />
und Strickherdicke<br />
Mit Ausnahme des ganz im Westen des Stadtgebietes liegenden Stadtteils Altendorf ergibt<br />
sich bei <strong>der</strong> chronologischen <strong>Straßennamen</strong>geschichte eine klare West-Ost-Teilung des<br />
Stadtgebietes. Alle östlich liegenden Gemeinden, mit Ausnahme von Frohnhausen<br />
unmittelbar in <strong>der</strong> Nachbarschaft des Hauptortes Fröndenberg gelegen, hatten bis 1967 keine<br />
<strong>Straßennamen</strong>, alle Gemeinden im stärker von <strong>der</strong> In-dustrie geprägten 1 westlichen Amtsbezirk<br />
einschließlich <strong>der</strong> genau nördlich von Fröndenberg liegenden Gemeinde Frömern,<br />
weisen ab den 1920er Jahren bzw. mit den Jahren zwischen 1945 beginnend und 1960<br />
endend, Straßenbenennungen auf.<br />
Im Gegensatz zum Hauptort Fröndenberg ist die Ausgangs- und Quellenlage hinsichtlich <strong>der</strong><br />
amtsangehörigen Gemeinden schlechter, da im Stadtarchiv Fröndenberg die Überlieferung <strong>der</strong><br />
Gemein<strong>der</strong>atsprotokolle lückenhaft o<strong>der</strong> nur teilweise in Abschrift überliefert ist.<br />
Zurückgegriffen werden kann auf die Überlieferung des Bauamtes und des Einwohnermeldeamtes<br />
<strong>der</strong> Amtsverwaltung in Fröndenberg und die Ergänzungsüberlieferung, wie auch auf<br />
1 Siehe dazu auch Teil A4 <strong>der</strong> vorliegenden Arbeit; hingewiesen sei in diesem Zusammenhang auf die im<br />
westlichen Amtsgebiet verlaufende einzige Straße von überörtlicher Bedeutung, sowie auf den höheren<br />
Erschließungsgrad mittels <strong>der</strong> Eisenbahn ab dem Ende des 19. Jahrhun<strong>der</strong>ts, sowie auf die räumliche Nähe zum<br />
Ballungsraum Schwerte-Hagen-Unna des westlichen Amtsbezirks gegenüber seinem östlichen Teil.
55<br />
die sporadischen Veröffentlichungen von Straßenbe- und Umbenennungen im Amtsblatt <strong>der</strong><br />
preußischen Regierung zu Arnsberg.<br />
Auf Unterlagen aus dem Kreisarchiv in Unna (Katasteramt und Bauamt), die zudem für die<br />
Zeit vor 1945 im Staatsarchiv Münster liegt, konnte aus zeitlichen Gründen für diese Arbeit<br />
nicht zurückgegriffen werden.<br />
Für die vollständige Ausnutzung aller eventuell noch nicht erschlossenen Quellen ergibt sich<br />
auch nach Abschluss dieser Arbeit für das Thema <strong>der</strong> <strong>Fröndenberger</strong> <strong>Straßennamen</strong> noch<br />
weiterer Forschungsbedarf.<br />
In zeitlicher Reihenfolge kann auf Grund des vorliegenden Quellenmaterials für die o.a. Gemeinden<br />
die <strong>Geschichte</strong> <strong>der</strong> <strong>Straßennamen</strong> wie folgt dargestellt werden:<br />
Gemeinde Langschede vor 1968<br />
<strong>Die</strong> Überlieferung von <strong>Straßennamen</strong> in dieser Gemeinde beginnt mit <strong>der</strong> Erwähnungen im<br />
Zusammenhang mit Straßenbauarbeiten in den Protokollen des Gemein<strong>der</strong>ates 2 1927 mit <strong>der</strong><br />
„Oststraße“ und <strong>der</strong> „Bahnhofsstraße“, sowie 1930 mit <strong>der</strong> „Mühlenstraße“ und<br />
„Gartenstraße“. Ein Datum für die Erstbenennung kann in den Protokollen nicht ermittelt<br />
werden, eine Benennung vor 1918 erscheint jedoch unwahrscheinlich.<br />
Im Amtsblatt <strong>der</strong> Preußischen Regierung zu Arnsberg wird die Benennung <strong>der</strong> „Ostmarkstraße“<br />
per 9.Juni 1938 bekannt gegeben. Hierbei handelte es sich um die Benennung einer<br />
noch unbebauten Straße, die im Mai 1937 in den Gemein<strong>der</strong>atsprotokollen im Zuge <strong>der</strong><br />
Erschließungsarbeiten noch mit „Feldstraße“ bezeichnet wird.<br />
Im Zeitraum 1936 und 1938 ist vom Ausbau <strong>der</strong> Bahnhofsstraße und <strong>der</strong> Gartenstraße die<br />
Rede; hier ist die Zwangsenteignung o<strong>der</strong> <strong>der</strong> Tausch von Grindstücken zwecks „Erbreiterung“<br />
dieser Straßen nachgewiesen. 3<br />
In einer Liste <strong>der</strong> durch das Hochwasser <strong>der</strong> Möhnekatastrophe geschädigten Familien mit<br />
Angabe <strong>der</strong> Namen, des Alters und <strong>der</strong> Anschrift vom Mai 1943 werden die Oststraße, die<br />
Mühlenstraße, die Bahnhofsstraße und <strong>der</strong> „Markt“ genannt. Alle Geschädigten mit Ausnahme<br />
eines Geschädigten in einem einzelnen Gebäude an <strong>der</strong> Ruhr wohnten an benannten<br />
Straßen.<br />
<strong>Die</strong> Oststraße steht auch im Zusammenhang mit <strong>der</strong> ersten Nachkriegsüberlieferung zu den<br />
Langsche<strong>der</strong> <strong>Straßennamen</strong> in einer Akte 4 des Einwohnermeldeamtes. Am 19. August 1949<br />
wird <strong>der</strong> Kreisverwaltung und dem Langsche<strong>der</strong> Postamt die Umbenennung eines Teils <strong>der</strong><br />
„Oststraße“ in „Kreisstraße“ für das Jahr 1949 5 gemeldet. <strong>Die</strong> gleiche Akte gibt Auskunft<br />
über die Benennung <strong>der</strong> drei ersten Straßen im Neubaugebiet <strong>der</strong> Mannesmann-Siedlung im<br />
Dezember 1952. Der Gemein<strong>der</strong>at vergibt am 12.12.1952 die <strong>Straßennamen</strong> „Ruhrblick“,<br />
„Im Heimgarten“ und „Sonnenstraße“.<br />
Für den Jahresbeginn 1963 gibt es eine Nachweisung aller <strong>Straßennamen</strong> im Amtsbezirk für<br />
eine Anfrage <strong>der</strong> „Westfälischen-Provinzial-Feuerversicherung“ vom 2.11.1962. Reichlich<br />
einen Monat später schickte Amtsdirektor Klammer die angefor<strong>der</strong>te Liste nach Münster.<br />
Für Langschede werden hier die folgenden <strong>Straßennamen</strong> gemeldet (in Klammern die nachgewiesenen<br />
o<strong>der</strong> vermuteten Daten <strong>der</strong> Erstbenennung)<br />
Bahnhofstraße (vor 1927)<br />
Gartenstraße (vor 1930)<br />
Im Heimgarten (1952)<br />
Kreisstraße (ab 1949 für einen Teil <strong>der</strong> Oststraße)<br />
Markt (im Prinzip seit seines Bestehens im 18. Jahrhun<strong>der</strong>t)<br />
2 StaF, Bestand A 240<br />
3 StaF, Bestand A 5434 und A 5839<br />
4 StaF, Bestand A 3659<br />
5 StaF, Bestand A 6879-9; auch <strong>der</strong> übrige Teil <strong>der</strong> Oststraße muss bereits vor 1968 umbenannt worden sein, da<br />
dieser Name, <strong>der</strong> nicht wegen einer etwaigen Doppelbesetzung hätte 1968-1970 geän<strong>der</strong>t werden müssen, in<br />
<strong>der</strong> kompletten <strong>Straßennamen</strong>liste vom Dezember 1970 nicht mehr vertreten ist.
56<br />
Mühlenstraße (vor 1930)<br />
Nordstraße (wahrscheinlich vor 1930)<br />
Ostmarkstraße (1938)<br />
Oststraße (teilweise 1949, zu einem späteren Zeitpunkt komplett in „Kreisstraße“ umbenannt)<br />
Ruhrblick (1952)<br />
Schulstraße (wahrscheinlich vor 1930)<br />
Sonnenstraße (1952)<br />
und Unnaer Straße (Bundesstraße 233 Unna-Iserlohn vom Ortseingang bis zur Ruhrbrücke)<br />
Im Jahr 1961 wurde die Hausnummerierung in <strong>der</strong> „Bahnhofstraße“. <strong>der</strong> „Unnaer Straße“<br />
neu geregelt und vereinheitlicht; bereits in <strong>der</strong> Gemein<strong>der</strong>atssitzung vom 6.11.1953 war dies<br />
für die „Gartenstraße“ beschlossen worden und für 1965 ist die Benennung <strong>der</strong> Straße „Auf<br />
<strong>der</strong> Kisse“ nachgewiesen.<br />
In <strong>der</strong> kurzen Zeit <strong>der</strong> Existenz <strong>der</strong> Großgemeinde Langschede (Langschede, Ardey und<br />
Dellwig) ab dem 1.8.1964 wurden keine Straßen umbenannt, obwohl es doppelte, teils sogar<br />
dreifache <strong>Straßennamen</strong> gegeben hat. Wohl wurden im Gemein<strong>der</strong>at und im neu gebildeten<br />
Wegebauausschuss <strong>der</strong> „Großgemeinde“ entsprechende Überlegungen angestellt und bereits<br />
Vorschläge erarbeitet, aber Bürgermeister Göbel setzte sich damit durch, dass im Postverkehr<br />
und bei an<strong>der</strong>weitig notwendigen Adressangaben die Ortsnamen Langschede, Langschede-<br />
Dellwig o<strong>der</strong> Langschede-Ardey zu verwenden seien.<br />
So behielten die gleichlautenden Straßen <strong>der</strong> Großgemeinde bis zur Umbenennungsphase<br />
1968-1970 ihre Namen bei.<br />
Neu hinzu kamen noch vor 1968 6 fünf <strong>Straßennamen</strong> in einem neuen Wohngebiet nördlich<br />
<strong>der</strong> Schule; „Drosselstiege“, „Amselweg“ „Finkenweg“ und „Am Ufer“, sowie die diese<br />
vier Straßen erschließende Wohnstraße „Zur Haar“.<br />
Somit ergibt sich ein Gesamtbestand zum 31.12.1967 vor Einglie<strong>der</strong>ung in die neue Stadt<br />
Fröndenberg von 18 <strong>Straßennamen</strong>:<br />
Am Ufer<br />
Amselweg<br />
Auf <strong>der</strong> Kisse<br />
Bahnhofstraße<br />
Drosselstiege<br />
Finkenweg<br />
Gartenstraße<br />
Im Heimgarten<br />
Kreisstraße<br />
Markt<br />
Mühlenstraße<br />
Nordstraße<br />
Ostmarkstraße<br />
Ruhrblick<br />
Schulstraße<br />
Sonnenstraße<br />
Unnaer Straße<br />
Zur Haar<br />
Zur weiteren Entwicklung 1968 bis 1970 in Langschede siehe Hauptteil G <strong>der</strong> vorliegenden<br />
Arbeit, ab 1971 im Hauptteil I.<br />
6 Trotz intensiver Suche in den Gemein<strong>der</strong>atsprotokollen und <strong>der</strong> Überlieferung des Amtsbauamtes ist ein<br />
Erstbenennungsdatum für diese geschlossene Neubausiedlung nicht zu ermitteln.
57<br />
Gemeinde Ardey vor 1968<br />
<strong>Die</strong> Gemeinde Ardey nördlich <strong>der</strong> Industriegemeinde Langschede gelegen, ist nach dieser die<br />
zweite Gemeinde, die in chronologischer Folge mit <strong>der</strong> Vergabe von <strong>Straßennamen</strong> begonnen<br />
hatte. Nachgewiesen ist dies durch eine Veröffentlichung im Amtsblatt <strong>der</strong> Preußischen<br />
Regierung zu Arnsberg aus dem Jahr 1938. Hier heißt es unter <strong>der</strong> laufenden Nummer 1237:<br />
„Auf Vorschlag des Gemeindebürgermeisters in Ardey gebe ich hiermit dem „Schwarzen<br />
Weg“ in Ardey den Namen „Ostmarkstraße“, Unna, den 1.10.1938, Der Landrat als<br />
Kreispolizeibehörde“. Ob auf „Vorschlag“ gemäss dem Führerprinzip <strong>der</strong> Ortsbürgermeister<br />
auch die vor 1949 nachgewiesenen an<strong>der</strong>en <strong>Straßennamen</strong> bereits vor 1945 vergeben hat,<br />
kann nicht nachgewiesen werden, da die Gemein<strong>der</strong>atsprotokolle <strong>der</strong> Gemeinde zwischen<br />
1934 und 1946 nicht überliefert sind; auch die Überlieferung im Amtsbauamt <strong>der</strong> <strong>Fröndenberger</strong><br />
Verwaltung enthält dazu keinen Hinweis.<br />
Zumindest eine Ausschil<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Straßen wird es vor 1959 nicht gegeben haben, da erst<br />
nach Bekanntgabe eines Gemein<strong>der</strong>atsbeschlusses vom 16.7.1959 „die Umbenennung und<br />
Neubenennung von Straßen und Wohngrundstücken“ betreffend 7 beim Handwerksbetrieb<br />
Holtmann in Fröndenberg 8 am 30.12.1960 eine aufgegebene Bestellung 9 von Schil<strong>der</strong>n mit<br />
Rechnung an die Amtsverwaltung erfolgt, die auch ein Schild „Ostmarkstraße“ enthält. Eine<br />
Beschil<strong>der</strong>ung vor 1959/60 erscheint deswegen sehr unwahrscheinlich. Erst im März 1961<br />
bestätigt Bürgermeister Oelker die endgültige Befestigung <strong>der</strong> Schil<strong>der</strong> nach mehrmaliger<br />
Rückfrage des Amtsbaumeisters aus Fröndenberg.<br />
Der genannte Gemein<strong>der</strong>atsbeschluss vom 16.7.1959 beinhaltet folgende <strong>Straßennamen</strong>:<br />
Feldstraße<br />
Gartenstraße<br />
Hilkenhohl<br />
Im Rottland (Fabrikgebäude Severin und Berkenhoff)<br />
Kreisstraße<br />
Ostmarkstraße<br />
Schulstraße<br />
Sonnebachstraße<br />
<strong>Die</strong> Benennung <strong>der</strong> Straßen „Sonnebachstraße“ und „Im Rottland“ erfolgte per Gemein<strong>der</strong>atsbeschluss<br />
vom 16.7.1959 als Erstbenennung, so dass <strong>der</strong> Altbestand an <strong>Straßennamen</strong> vor<br />
1959 mit lediglich 6 <strong>Straßennamen</strong> dieser Liste gering ausfällt. Allerdings waren diese<br />
Straßen recht dicht bebaut und zogen sich teilweise (Kreisstraße) durch den gesamten Ort.<br />
Hinzugerechnet werden muss noch die „Dorfstraße“, die nicht Bestandteil <strong>der</strong> Liste ist, die<br />
aber auf jeden Fall dem Altbestand <strong>der</strong> <strong>Straßennamen</strong> vor 1952 zugerechnet werden kann.<br />
Noch zeitlich vor Erstellung <strong>der</strong> Liste wurde mit Gemein<strong>der</strong>atsbeschluss vom 5.12.1952 <strong>der</strong><br />
„Grenzweg“ benannt und mit Gemein<strong>der</strong>atsbeschluss vom 10.9.1958 eine Wohnneubaustraße<br />
„Schlesierstraße“. 10<br />
Am 29.11.1965 erfolgte die Benennung <strong>der</strong> Straßen „Bilstein“, „Buchenacker“, „Burland“(Bauernland)<br />
und „Schwarzer Kamp“, am 20.10.1967 folgten die Benennungen<br />
„Hainbach“, „Kaarweg“, „Zum Siepen“ und am 14.12.1967 die „Schäferstraße“.<br />
Somit ergibt sich ein Gesamtbestand zum 31.12.1967 vor Einglie<strong>der</strong>ung in die neue Stadt<br />
Fröndenberg von 18 <strong>Straßennamen</strong>:<br />
Bilstein<br />
Buchenacker<br />
Burland<br />
Dorfstraße<br />
Feldstraße<br />
7<br />
8<br />
9<br />
StaF Bestand A 6879-1<br />
Siehe dazu die Anmerkungen im gleichen Kapitel zur Gemeinde Dellwig<br />
StaF Bestand A 6879-1<br />
10 Siehe dazu Exkurs 4 <strong>der</strong> vorliegenden Arbeit
58<br />
Gartenstraße<br />
Hainbach<br />
Hilkenhohl<br />
Im Rottland<br />
Kaarweg<br />
Kreisstraße<br />
Ostmarkstraße<br />
Schäferstraße<br />
Schlesierstraße<br />
Schulstraße<br />
Schwarzer Kamp<br />
Sonnebachstraße<br />
Zum Siepen<br />
Zur weiteren Entwicklung 1968 bis 1970 in Ardey siehe Hauptteil G <strong>der</strong> vorliegenden Arbeit,<br />
ab 1971 im Hauptteil I.<br />
Gemeinde Dellwig vor 1968<br />
Ein Verzeichnis aus dem Jahr 1943 11 <strong>der</strong> „durch das Hochwasser geschädigten Haushalte“ in<br />
<strong>der</strong> Gemeinde Dellwig führt keine <strong>Straßennamen</strong> auf son<strong>der</strong>n lediglich Hausnummern; ein<br />
Beweis dafür, dass es vor 1945 in dieser Gemeinde offiziell keine Straßenbezeichnungen<br />
gegeben hat, tradiert war lediglich die Bezeichnung „Kreisstraße“, an <strong>der</strong> die meisten Häuser<br />
standen. <strong>Die</strong> Kreisstraße verbindet noch heute als „Hauptstraße“ die Stadtteile Langschede,<br />
Dellwig und Altendorf und führt weiter in Richtung Schwerte.<br />
In <strong>der</strong> Gemein<strong>der</strong>atsversammlung am 9.Januar 1950 unter Vorsitz von Bürgermeister Goebel<br />
wird dann unter Punkt 6 12 beschlossen: „<strong>Die</strong> Gemeindevertretung beschloss einstimmig, die<br />
Straßen und Wege <strong>der</strong> Gemeinde Dellwig folgen<strong>der</strong>maßen zu bezeichnen“:<br />
Am Brauck<br />
Bachstraße<br />
Gartenweg<br />
Hauptstraße<br />
Hintere Straße<br />
Im Höfchen<br />
In <strong>der</strong> Liethe<br />
Kirchplatz<br />
Ohlweg<br />
Ruhrstraße<br />
Schulstraße<br />
Strickherdicker Weg<br />
Wasserwerkstraße<br />
<strong>Die</strong>ser Bestand wurde handschriftlich ergänzt durch die Straßen „Schäferstraße“ und „Am<br />
Schwimmbad“. Der <strong>Fröndenberger</strong> Handwerksbetrieb Josef Schulte gen. Holtmann<br />
„Hufbeschlag-Wagenbau-Eisenwaren“ wird von <strong>der</strong> Amtsverwaltung am 7.2.1950<br />
aufgefor<strong>der</strong>t, einen Kostenvoranschlag für die Lieferung von 15 Straßenschil<strong>der</strong>n und 120<br />
emaillierte Hausnummernschil<strong>der</strong> abzugeben. Dem Angebot ist zu entnehmen, dass ein<br />
einstelliges Hausnummernschild -,88 DM und ein zweistelliges Schild -,99 DM kosten sollte,<br />
<strong>der</strong> Preis für die <strong>Straßennamen</strong>schil<strong>der</strong> liegt bei -,67 DM pro Quadratdezimeter. Der<br />
Kostenvoranschlag wurde noch etwas heruntergehandelt auf die Hausnummernpreise von -,69<br />
11 Ergänzung zum amtlichen Bericht <strong>der</strong> Amtsverwaltung vom Juni 1943 über die „Gesamtschadensbilanz des<br />
Hochwassers in Folge <strong>der</strong> Möhnekatastrophe“ in: Jochen von Nathusius, „<strong>Die</strong> Möhnekatastrophe, Ursachen-<br />
Verlauf-Folgen, Dokumente aus dem Stadtarchiv“, Fröndenberg 2003<br />
12 StaF Bestand A 6879-7 und analog dazu Bestand A 1837 „Gemein<strong>der</strong>atsprotokolle“
59<br />
und -,88 DM je Stück und am 9.3.1950 erging <strong>der</strong> Auftrag des Amtes an den Handwerksbetrieb<br />
mit Rechnungsanschrift an die Gemeinde Dellwig. Etwa 200,- DM wurden dafür<br />
im Haushaltsplan veranschlagt. Am 2. Oktober 1950 erhielten <strong>der</strong> Schornsteinfegermeister<br />
Hartmann, die „VEW“ in Dortmund als Stromlieferant und das Zweigwerk <strong>der</strong> „Gelsenwasser<br />
AG“ in Unna als Wasserlieferant ein Verzeichnis <strong>der</strong> Dellwiger <strong>Straßennamen</strong> „zur gefl.<br />
Kenntnisnahme“. Auch das Katasteramt in Unna erhielt eine Aufstellung, denn mit Datum<br />
vom 16.11.1950 erbat dieses Amt eine Beschreibung <strong>der</strong> Häuser in den Straßen „Am<br />
Schwimmbad“ und „In <strong>der</strong> Liethe“, da „hierseits keine Bebauung dieser benannten Straßen<br />
bekannt ist“.<br />
Man witterte wohl Unrat und vermutete eine ungenehmigte Bebauung. <strong>Die</strong>se Bedenken konnten<br />
jedoch zerstreut werden, da es sich in einem Falle um eine demnächst abzureißende<br />
Notunterkunftsbaracke und im an<strong>der</strong>en Fall um ein <strong>Die</strong>nstgebäude <strong>der</strong> Bundesbahn handelte;<br />
in beiden Fällen waren dem Katasteramt beim seinerzeitigen Bau keine Unterlagen<br />
eingereicht worden, wofür aber die Gemeinde jede Verantwortung von sich wies.<br />
Am 4.1.1951 lieferte die damals zuständige Bundesbahndirektion Wuppertal eine<br />
Gebäudezeichnung an die Bauverwaltung des Amtes zur Weiterleitung an das Katasteramt <strong>der</strong><br />
Kreisverwaltung in Unna.<br />
Bereits 1952 zur Bebauung vorgesehen und bis 1961 bebaut wurden einige Grundstücke,<br />
<strong>der</strong>en Zuwegung den Namen „Rosenweg“ erhielt. Bei einer Ortsbegehung am 19.7.1961<br />
wurde das Fehlen eines Straßenschildes bemängelt; das Datum <strong>der</strong> offiziellen Benennung ist<br />
dem vorhandenen Quellenmaterial lei<strong>der</strong> nicht zu entnehmen.<br />
Im Frühherbst 1956 wurden die Neubaustraßen unterhalb des Schwimmbades per Gemein<strong>der</strong>atsbeschluss<br />
mit den Namen „Bodelschwinghstraße“, „Lönsstraße“<br />
und „Eichendorffstraße“ benannt. 13<br />
Als benachbarte Straße zur Bachstraße erhielt die „Binnerstraße“ am 28.10.1960 per Gemein<strong>der</strong>atsbeschluss<br />
ihre Benennung. An beiden Bauvorhaben, dem im Baugebiet „In <strong>der</strong><br />
Lehmkuhle“ unterhalb des Schwimmbades wie dem <strong>der</strong> Bebauung <strong>der</strong> Bach- und<br />
Binnerstraße war die in Langschede ansässige Firma „Mannesmann“ als Bauträger für ihre<br />
Werksangehörigen maßgeblich beteiligt. Am 1.10.1961 bekamen die „Nordstraße“ und die<br />
„Friedrich-Ebert-Straße“ ihre Namen, am 20.10.1967 die „Bethelstraße“.<br />
Somit ergibt sich ein Gesamtbestand zum 31.12.1967 vor Einglie<strong>der</strong>ung in die neue Stadt<br />
Fröndenberg von 23 <strong>Straßennamen</strong>:<br />
Am Brauck<br />
Bachstraße<br />
Bethelstraße<br />
Binnerstraße<br />
Bodelschwinghstraße<br />
Eichendorffstraße<br />
Friedrich-Ebert-Straße<br />
Gartenweg<br />
Hauptstraße<br />
Hintere Straße<br />
Im Höfchen<br />
In <strong>der</strong> Liethe<br />
Kirchplatz<br />
Lönsstraße<br />
Nordstraße<br />
Ohlweg<br />
13 Zum Hintergrund “Eichendorffstraße” siehe Exkurs 4 und zur “Bodelschwinghstraße“, wie zur später<br />
benannten „Bethelstraße“ siehe Teil J <strong>der</strong> vorliegenden Arbeit.
60<br />
Ruhrstraße<br />
Schulstraße<br />
Strickherdicker Weg<br />
Wasserwerkstraße<br />
Zur weiteren Entwicklung 1968 bis 1970 in Dellwig siehe Hauptteil G <strong>der</strong> vorliegenden<br />
Arbeit, ab 1971 im Hauptteil I<br />
Gemeinde Frohnhausen vor 1968<br />
In <strong>der</strong> östlich von Fröndenberg gelegenen Gemeinde Frohnhausen wurden erstaunlicherweise<br />
bereits im Jahr 1956 neue Hausnummerierungen und <strong>Straßennamen</strong> festgelegt; dafür wurde<br />
sogar auf eine Dringlichkeitssitzung des Gemein<strong>der</strong>ates am 25. Januar dieses Jahres<br />
anberaumt. Wegen Einführung eines neuen Einwohnerverzeichnisses auf Amtsebene war<br />
Bürgermeister Höppe dazu aufgefor<strong>der</strong>t worden.<br />
Im Protokoll 14 heißt es dazu: „Da durch Neubauten die Hausnummerierung in <strong>der</strong> Gemeinde<br />
unübersichtlich geworden ist, wurden folgende Straßen- und Hausnummernbezeichnungen<br />
eingeführt (...)“ Warum die Amtsverwaltung die Einführung eines neuen Einwohnerverzeichnisses<br />
nicht bei allen Gemeinden zum Anlass nahm, Straßenbenennungen durchzusetzen,<br />
ist <strong>der</strong> Aktenüberlieferung nicht zu entnehmen, verwun<strong>der</strong>t jedoch gerade in Bezug auf die<br />
erst reichlich zehn Jahre später erfolgte Vergabe von <strong>Straßennamen</strong> in den übrigen östlichen<br />
amtsangehörigen Gemeinden.<br />
Eingeführt wurden folgende Straßenbezeichnungen:<br />
Feldweg<br />
Dorf (entlang <strong>der</strong> späteren „Palzstraße“<br />
Hohenheide<br />
Landstraße<br />
Lehmke<br />
Merschstraße<br />
Tummelplatz (Platz <strong>der</strong> ersten gemeinsamen Volksschule für die östlichen Gemeinden)<br />
Da bis 1967 keine weiteren <strong>Straßennamen</strong> vergeben wurden, ergibt sich ein Gesamtbestand<br />
zum 31.12.1967 vor Einglie<strong>der</strong>ung in die neue Stadt Fröndenberg von 7 <strong>Straßennamen</strong>:<br />
Zur weiteren Entwicklung 1968 bis 1970 in Frohnhausen siehe Hauptteil G <strong>der</strong> vorliegenden<br />
Arbeit, ab 1971 im Hauptteil I.<br />
Gemeinde Strickherdicke vor 1968<br />
Chronologisch gesehen war die Gemeinde Strickherdicke, nördlich von Dellwig und<br />
Langschede an <strong>der</strong> Bundesstraße 233 gelegen, die vorletzte Gemeinde im Amtsbezirk, die vor<br />
1968 Straßenbenennungen vornahm. Wie in an<strong>der</strong>en Gemeinden auch, war ein an den Gemeindebürgermeister<br />
verschickter Abdruck eines Auszuges <strong>der</strong> Nie<strong>der</strong>schrift über die Sitzung<br />
<strong>der</strong> Stadt- und Amtsdirektoren des Kreises Unna am 18.6.1957. Hier wurde Klage über die<br />
unsystematische Hausnummerierung und fehlenden <strong>Straßennamen</strong> geführt, die in einem nicht<br />
näher präzisierten Fall in jüngster Vergangenheit dazu geführt hätte, dass ein Krankenwagenfahrer<br />
„unverrichteter Dinge“ habe zurückkehren müssen, da „in dem angegebenen<br />
Haus die Kranke nicht gefunden“ worden sei. <strong>Die</strong>ser Abdruck 15 , <strong>der</strong> auch allen an<strong>der</strong>en<br />
Gemeinden zugeschickt wurde, veranlasste die Gemeindeverwaltung in ihrer Sitzung am<br />
13.1.1958 auf Anregung von Amtsdirektor Klammer, die Gemein<strong>der</strong>atsvertreter Ernst und<br />
Hunke mit <strong>der</strong> Aufgabe zu betrauen, einen Plan für eine einheitliche Hausnummerierung und<br />
für die Vergabe von <strong>Straßennamen</strong> zu erstellen. In <strong>der</strong> Gemein<strong>der</strong>atssitzung vom 22.9.1958<br />
14 StaF, Bestand A 6879-6<br />
15 StaF Bestand A 6041, siehe dazu Kopie im Anhang 1 lfd. Nr. 18
61<br />
wurde <strong>der</strong> Beschluss gefasst, die Vorschläge dieser beiden Herren als Gemein<strong>der</strong>atsbeschluss<br />
anzunehmen.<br />
<strong>Die</strong> Erstbenennung <strong>der</strong> Strickherdicker Straßen mit diesem Datum zu verknüpfen mag<br />
quellenkritisch anfechtbar sein, da es im Gemein<strong>der</strong>atsprotokoll heißt: „ <strong>Die</strong> Gemeindevertretung<br />
<strong>der</strong> Gemeinde Strickherdicke hat in ihrer Sitzung (...) die Hausnummerierung straßenweise<br />
neu geordnet und verschiedene, bisher unbenannte Straßen, benannt und vorhandene<br />
Straßen umbenannt“. Eine Umbenennung impliziert natürlich das Vorhandensein bisheriger<br />
Namen. Allerdings konnte trotz intensiver Recherche <strong>der</strong> Gemein<strong>der</strong>atsprotokolle ab 1946<br />
(die Protokolle von 1934 bis 1945 sind nicht o<strong>der</strong> nicht mehr vorhanden) kleine<br />
vorausgegangene offizielle Benennung von Straßen nachgewiesen werden. Nach Rücksprache<br />
mit dem Ortsheimatpfleger, <strong>der</strong> seinerseits auf Bitte des Verfassers mehrere Gemein<strong>der</strong>atsmitglie<strong>der</strong><br />
<strong>der</strong> 1950er Jahre befragte, wurde übereinstimmend die Meinung vertreten, dass<br />
diese Formulierung im Gemein<strong>der</strong>atsprotokoll missverständlich sei. Offizielle <strong>Straßennamen</strong><br />
habe es vor 1958 nicht gegeben, bei <strong>der</strong> „Umbenennung“ könne es sich nur um mündlich<br />
tradierte Namen handeln wie „Provinzialstraße“ o<strong>der</strong> „Siedlung“ (für die ersten Neubauten<br />
nach 1945, später „Rosenweg“ benannt). Auf Grund dieser Aussagen und <strong>der</strong> fehlenden<br />
Erwähnung in den Gemein<strong>der</strong>atsprotokollen zu diesem Thema wird das Datum 13.1.1958 für<br />
alle hier genannten Straßen als Datum <strong>der</strong> amtlichen Erstbenennung angenommen.<br />
Folgende <strong>Straßennamen</strong> 16 werden angegeben:<br />
Alte Kreisstraße<br />
Alter Weg<br />
Auf <strong>der</strong> Höhe<br />
Brauck<br />
Dellwiger Weg<br />
Dorfstraße<br />
Heide<br />
Heideweg<br />
Hellweg<br />
Im Loh<br />
Kassberg<br />
Kuhstraße<br />
Landwehr<br />
Natte<br />
Rosenweg (nicht amtlich tradiert früher „Siedlung“)<br />
Schulweg<br />
Thabrauck<br />
Unnaer Straße (nicht amtlich tradiert früher „Provinzialstraße“)<br />
Bis zum 31.12.1967 kamen noch folgende drei Straßen hinzu:<br />
„Böckelmannsweg“ (20.1.1960), „Simonweg“ (20.1.1960)und „Sonnenhang“ (20.1.1960)<br />
Somit ergibt sich ein Gesamtbestand zum 31.12.1967 vor Einglie<strong>der</strong>ung in die neue Stadt<br />
Fröndenberg von 21 <strong>Straßennamen</strong>:<br />
Alte Kreisstraße<br />
Alter Weg<br />
Auf <strong>der</strong> Höhe<br />
Böckelsmannsweg<br />
Brauck<br />
Dellwiger Weg<br />
Dorfstraße<br />
Heide<br />
16 StaF Bestand A 3659
62<br />
Heideweg<br />
Hellweg<br />
Im Loh<br />
Kassberg<br />
Kuhstraße<br />
Landwehr<br />
Natte<br />
Rosenweg<br />
Schulweg<br />
Simonweg (benannt nach dem vormaligen Besitzer <strong>der</strong> hier liegenden Bauplätze)<br />
Sonnenhang<br />
Thabrauck<br />
Unnaer Straße<br />
Zur weiteren Entwicklung 1968 bis 1970 in Strickherdicke siehe Hauptteil G <strong>der</strong> vorliegenden<br />
Arbeit, ab 1971 im Hauptteil I<br />
Gemeinde Frömern vor 1968<br />
Als letzte Gemeinde vor 1967 hielte die amtliche Straßenbenennung Einzug in diese nördlich<br />
von Fröndenberg gelegene Kirchspielsgemeinde.<br />
In Beantwortung des bereits bei Behandlung <strong>der</strong> Gemeinde Strickherdicke erwähnten Schriftstücks<br />
wegen <strong>der</strong> oft mangelhaften Hausnummerierung und fehlenden <strong>Straßennamen</strong> vom<br />
Juni 1957, das auch Bürgermeister Willi Kettmann in Frömern erreichte heißt es 17 : „<strong>Die</strong><br />
Hausnummerierung in <strong>der</strong> Gemeinde ist in Ordnung. Eine Straßenbeschil<strong>der</strong>ung gab es bisher<br />
nicht und ist für unseren kleinen Ort auch wohl nicht erfor<strong>der</strong>lich“. Aber die Mahnung des<br />
Amtsdirektors vom 24.7.1957, „überall dort, wo eine geordnete Straßenbezeichnung (...) noch<br />
nicht besteht, diese baldigst einzuführen“, bewog den Gemein<strong>der</strong>at im Laufe <strong>der</strong> nächsten<br />
zwei Jahre zu handeln. Unter Punkt 4 <strong>der</strong> Gemein<strong>der</strong>atssitzung vom 10.Mai 1950 wurde das<br />
Thema abschließend behandelt und folgende <strong>Straßennamen</strong> festgelegt, <strong>der</strong>en Namen ab<br />
4.11.1960 für die Bürger in Verbindung mit festgelegten Hausnummern verbindlich wurden:<br />
Am Birnbaum<br />
Auf dem Bohnekamp (wenig später wurde daraus Bonekamp)<br />
Auf dem Spitt<br />
Bachstraße<br />
Backenberg<br />
Bahnhofstraße<br />
Brauerstraße (ohne Bezug auf den Beruf des „Bierbrauers“, son<strong>der</strong>n wahrscheinlich<br />
zurückgehend auf eine mundartlich verformte Bezeichnung „Brü<strong>der</strong>straße“<br />
wegen Ansiedlung dreier Brü<strong>der</strong> und <strong>der</strong>en Höfen)<br />
Im Schelk<br />
Kirchplatz<br />
Kleine Bahnhofstraße<br />
Landwehr<br />
Lindenstraße<br />
Mühlenweg (in Frömern gab es keine Kornmühle; so bezeichnet dieser Name den Verlauf<br />
<strong>der</strong> Wegstrecke auf Frömerner Grund Richtung <strong>der</strong> Langsche<strong>der</strong> Mühle)<br />
Ostbürener Straße<br />
Schulstraße<br />
Von-Steinen-Straße(benannt nach dem Geschichtsforscher und Pastor <strong>der</strong> Gemeinde Johann<br />
<strong>Die</strong><strong>der</strong>ich von Steinen (1699-1759), <strong>der</strong> 1750 als erster gebürtige<br />
Westfale zum Konsistorialrat <strong>der</strong> evang. Kirche ernannt wurde)<br />
17<br />
StaF Bestand A 6879-7
63<br />
Damit wurden <strong>Straßennamen</strong> ausgewählt, die zum Teil <strong>der</strong> tradierten mündlichen<br />
Überlieferung entsprachen aber auch bereits im Urkataster des Jahres 1828 und im Kataster<br />
des Umlegungsverfahrens 1938/39 schriftlich 18 festgehalten worden waren.<br />
Während <strong>der</strong> folgenden Jahre bis zur Einglie<strong>der</strong>ung Frömerns in das <strong>Fröndenberger</strong> Stadtgebiet<br />
erfolgte keine weitere amtliche Straßenbenennung durch den Gemein<strong>der</strong>at.<br />
Somit ergibt sich ein Gesamtbestand zum 31.12.1967 vor Einglie<strong>der</strong>ung in die neue Stadt<br />
Fröndenberg von 16 <strong>Straßennamen</strong> wie oben bereits aufgelistet.<br />
Zur weiteren Entwicklung 1968 bis 1970 in Frömern siehe Hauptteil G <strong>der</strong> vorliegenden<br />
Arbeit, ab 1971 im Hauptteil I<br />
Kurz zusammengefasst existierten am 31.12.1967 in den westlichen amtsangehörigen Gemeinden<br />
mit Ausnahme von Altendorf, in <strong>der</strong> nördlichen Gemeinde Frömern und in <strong>der</strong><br />
östlichen Gemeinde Frohnhausen 103 <strong>Straßennamen</strong>, <strong>der</strong>en Benennungsgeschichte in <strong>der</strong><br />
Industriegemeinde Langschede während <strong>der</strong> Weimarer Republik einsetzt und in <strong>der</strong> Gemeinde<br />
Frömern hinsichtlich <strong>der</strong> Erstbenennungen beendet ist.<br />
<strong>Die</strong> Zahl 103 verteilt sich wie folgt:<br />
Dellwig 23<br />
Strickherdicke 21<br />
Langschede und Ardey je 18<br />
Frömern 16<br />
und Frohnhausen 7 <strong>Straßennamen</strong>.<br />
Während im Fall von Ardey viele Erstbenennungen zeitlich nicht exakt eingeordnet werden<br />
können und auch die Zahl <strong>der</strong> benannten Straßen vor 1945 unklar bleibt, beginnt die Benennung<br />
in den Gemeinden Strickherdicke und Dellwig 1949/50 und in Frohnhausen 1956. In<br />
den 1960er Jahren sind in Ardey und Dellwig die meisten Neubenennungen verzeichnet;<br />
Kapitel I wird zeigen, dass sich <strong>der</strong> Schwerpunkt ab den 1970er Jahren nach Norden in<br />
Richtung Frömern verlagert. <strong>Die</strong> Strukturkrise <strong>der</strong> Langsche<strong>der</strong> Industrie wie Ansiedlung von<br />
Neubürgern aus dem Ruhrgebiet auf den Höhen des Haarstrangs sind hier gleichermaßen als<br />
Ursache zu nennen.<br />
Negativ für die Erforschung <strong>der</strong> Benennungsdaten erweist sich das Fehlen <strong>der</strong> originalen<br />
Gemein<strong>der</strong>atsbücher <strong>der</strong> Vorkriegszeit wie das Fehlen <strong>der</strong> Originalakten <strong>der</strong> Gemeindeverwaltungen<br />
nach 1945. Lediglich die Ergebnisprotokolle als Zweitschrift für die Amtsverwaltung<br />
in Fröndenberg sind hier nahezu lückenlos vorhanden. Gerne aber würde man<br />
genauer wissen wie die Entscheidungsprozesse in den Gemeinden zwischen den Eckpunkten<br />
„Ostmarkstraße“ 1938 und „Friedrich-Ebert-Straße“ 1961 abliefen.<br />
18 Mündliche Auskunft des Heimatvereins Frömern durch Herrn Grasse
64<br />
G. Das große <strong>Straßennamen</strong>-Revirement seit dem 1.1.1968<br />
Zum 1.1.1968 entstand durch die Umsetzung des sogenannten „Unna-Gesetzes“ unter<br />
Ausglie<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> bisherigen amtsangehörigen Gemeinden Kessebüren und Billmerich aus<br />
dem übrigen Amtsbezirk die „neue“ Stadt Fröndenberg/Ruhr mit <strong>der</strong> Kernstadt (bisherige<br />
Gemeinde Fröndenberg, 1952 zur Titularstadt ernannt) und den 12 Stadtteilen (bisherigen<br />
amtsangehörigen Gemeinden) Altendorf, Ardey, Bausenhagen, Dellwig, Frohnhausen,<br />
Frömern, Langschede, Neimen, Ostbüren, Stentrop, Strickherdicke und Warmen. <strong>Die</strong><br />
amtsangehörige Gemeinde Bentrop wurde zunächst auf eigenen Wunsch des Gemein<strong>der</strong>ates<br />
mit knapper Mehrheit <strong>der</strong> Nachbargemeinde Wickede/Ruhr zugeschlagen, entschied sich aber<br />
im Laufe des Jahres 1969 letztlich doch auf sanftem Druck des Landes und des Kreises für<br />
den Anschluss nach Fröndenberg. Land und Kreis befürchteten ansonsten umfangreiche<br />
Folgekosten und Komplikationen hinsichtlich <strong>der</strong> mit dem Anschluss an Wickede sonst<br />
notwendig gewordenen neuen Grenzziehung des Kreises Unna, da Wickede Bestandteil des<br />
Kreises Soest war, bzw. auch heute noch ist.<br />
Somit bestand also die Stadt Fröndenberg/Ruhr seit dem 1.1.1969 aus <strong>der</strong> Kernstadt<br />
einschließlich <strong>der</strong> Wohnplätze Hohenheide und Westick und aus 13 Stadtteilen.<br />
<strong>Die</strong> Mitte <strong>der</strong> 60er Jahre im Vorgriff auf die kommunale Gebietsreform etwas voreilig aus<br />
den Gemeinden Ardey, Dellwig und Langschede gebildete Großgemeinde Langschede, <strong>der</strong>en<br />
Gemeindeparlament einen Anschluss an die Stadt Unna favorisiert hatte, wurde damit faktisch<br />
wie<strong>der</strong> aufgelöst und die Gebietseinheit zwischen altem Amt und neuer Stadt mit Ausnahme<br />
<strong>der</strong> o.g. beiden Gemeinden Billmerich und Kessebüren beibehalten.<br />
Folge <strong>der</strong> Neubildung war, dass es zahlreiche doppelte o<strong>der</strong> ähnlich klingende <strong>Straßennamen</strong><br />
in den nunmehr zu Stadtteilen umgebildeten ehemaligen Gemeinden innerhalb <strong>der</strong> Stadt gab,<br />
was zu einem umfangreichen und langwierigen Um- und Neubenennungsprozess führte, <strong>der</strong><br />
erst zu Beginn <strong>der</strong> 70er Jahre abgeschlossen war und Gegenstand <strong>der</strong> folgenden Ausführungen<br />
ist.<br />
Zum 1.1.1968 existierten 190 <strong>Straßennamen</strong>, von denen ein Anteil von etwa 30 % zur<br />
Diskussion standen, um neubenannt zu werden o<strong>der</strong> ihren alten Namen zu behalten.<br />
Folgende Probleme gab es hierbei zu überwinden:<br />
<strong>Die</strong> auf <strong>der</strong> einen Seite entmachteten Gemeindeparlamente, die aber an<strong>der</strong>erseits über<br />
die nötige Sach- und Fachkompetenz und auch über die notwendige Überzeugungskraft<br />
gegenüber ihren Bürgern verfügten, mussten von <strong>der</strong> neuen Stadtverwaltung<br />
und ihren beschlussfassenden Gremien und Ausschüssen „bei Laune“ gehalten<br />
werden.<br />
Sollte die doppelte Namensgebung beendet werden, musste eine <strong>der</strong> betroffenen<br />
Namen geän<strong>der</strong>t werden, nur welche sollte ihren Namen behalten, welche ihn<br />
abgeben? Hier waren historische, landschaftliche und kulturell-traditionelle Belange<br />
ebenso zu berücksichtigen, wie die Zahl <strong>der</strong> Anwohner. Es sollten möglichst wenige<br />
Anwohner durch die Umbenennungen gezwungen sein, ihre Anschriften zu än<strong>der</strong>n.<br />
Es mussten „Ersatznamen“ und neue Namen gefunden werden, die sich in die<br />
bisherige Struktur einpassen ließen, wollte man nicht die durch Namenfamilien ganzer<br />
Siedlungsgebiete entstandene Geschlossenheit und/o<strong>der</strong> gewachsene Traditionen<br />
zerreißen.<br />
In den bisherigen Gemeinden Altendorf, Bausenhagen, Bentrop, Ostbüren, Stentrop<br />
und Warmen gab es bisher überhaupt keine <strong>Straßennamen</strong>, in <strong>der</strong> Gemeinde Neimen<br />
waren die Häuser drei Wohnplätzen (Unterdorf, Oberdorf und Hohenheide) zugeteilt<br />
ohne Benennung <strong>der</strong> dortigen Wege und Straßen. <strong>Die</strong> hier notwendigen Erstbenennungen<br />
sollten mit <strong>der</strong> Beseitigung <strong>der</strong> bestehenden Doppelbenennungen<br />
durchgeführt werden, wobei die neuen Erstbenennungen nicht zu neuen Namensdoppelungen<br />
führen durften!
65<br />
Es wurde mit Datum vom 6.März 1968 nach Rücksprache mit den ehemaligen Gemeindebürgermeistern<br />
(und Gemeindeparlamentariern) ein Vorschlag des Bauamtes vorgelegt, <strong>der</strong><br />
folgende Än<strong>der</strong>ungen vorsah und dem Wegebau- und Friedhofsausschuss zur Beratung vorgelegt<br />
wurde: (nach Alphabet <strong>der</strong> zu än<strong>der</strong>nden Straßen)<br />
<strong>Die</strong> Anmerkungen in Klammern wurden <strong>der</strong> Akte 1 entnommen, weitere Anmerkungen des<br />
Verfassers zum Textverständnis, die nicht <strong>der</strong> Akte entstammen sind kursiv gesetzt.<br />
1. Umbenennung gleichlauten<strong>der</strong> <strong>Straßennamen</strong><br />
„Amselweg“<br />
„Amselweg“ in Langschede bleibt<br />
„Amselweg“ in Fröndenberg wird zum „Nachtigallenweg“<br />
„Bachstraße“<br />
„Bachstraße“ in Dellwig bleibt<br />
„Bachstraße“ in Frömern wird „In <strong>der</strong> Twiete“ benannt (Flurname)<br />
„Bahnhofstraße“<br />
„Bahnhofstraße“ in Fröndenberg bleibt<br />
„Bahnhofstraße“ in Frömern wird zur „Brückenstraße“ (Straße liegt zwischen zwei<br />
Eisenbahnbrücken)<br />
„Kleine Bahnhofstraße“ (ebenfalls in Frömern) wird zur „Kampstraße“<br />
„Bahnhofstraße“ in Langschede wird zur „Hauptstraße“<br />
„Dorfstraße2<br />
„Dorfstraße“ in Ardey bleibt<br />
„Dorfstraße“ in Strickherdicke wird umbenannt in „Kleibusch“ (Flurname)<br />
„Finkenweg“<br />
„Finkenweg“ in Langschede bleibt<br />
„Finkenweg“ in Fröndenberg wird zum „Schwalbenweg“<br />
„Gartenstraße“ (Fröndenberg, Langschede und Ardey) und „Gartenweg“ (Dellwig)<br />
„Gartenstraße“ in Langschede bleibt<br />
„Gartenstraße“ in Ardey wird zur „Talstraße“<br />
„Gartenstraße“ in Fröndenberg wird zur „Blumenstraße“<br />
„Gartenweg“ in Dellwig wird „Weidenweg“<br />
„Hohenheide“ (nicht <strong>der</strong> Wohnplatz insgesamt, son<strong>der</strong>n die so genannte Straße)<br />
„Hohenheide“ in Fröndenberg und Neimen bleibt, da eine gemeinsame Straße<br />
„Heideweg“<br />
„Heideweg“ in Ardey und Strickherdicke bleiben beide, da eine durchgehende Straße<br />
„Im Schelk“<br />
„Im Schelk“ in Frömern bleibt<br />
„Im Schelk“ in Fröndenberg wird mit dem bestehenden „Querweg“ verbunden<br />
„Kirchplatz“<br />
„Kirchplatz“ in Fröndenberg bleibt<br />
„Kirchplatz“ in Dellwig wird „Ahlinger Berg“ (alte Bezeichnung des Berges auf dem die<br />
Kirche steht), ursprüngliche Planung war „Auf dem Ahlinger Berg“<br />
„Kirchplatz“ in Frömern wird zum „Sybrecht-Platz“ (Name eines ehem. Pfarrers)<br />
die ursprüngliche Planung sah die Bezeichnung „Wilhelm-Sybrecht-Platz“ vor.<br />
1 Sämtliche Angaben entstammen den Akten aus <strong>der</strong> Sachbearbeiterablage <strong>der</strong> laufenden Verwaltung<br />
„Straßenbenennungen, Umbenennungen“ des Bauamtes <strong>der</strong> Stadt.
66<br />
„Kreisstraße“<br />
„Kreisstraße“ in Langschede und „Kreisstraße“ in Ardey werden in die „Ardeyer Straße“<br />
einbezogen (von Fröndenberg bis einschließlich Einmündung in die B-233 in Langschede<br />
„Landwehr“<br />
„Landwehr“ in Frömern bleibt<br />
„Landwehr“ in Strickherdicke wird zum „Hellweg“<br />
„Markt“<br />
„Mark“ in Fröndenberg bleibt<br />
„Markt“ in Langschede sollte zum „Kornmarkt“ werden (in Erinnerung an den lange<br />
Jahrzehnte bis 1858 hier abgehaltenen Kornmarkt, da ab hier die Ruhr ehemals schiffbar war)<br />
Der Markt in Langschede wurde aber entgegen <strong>der</strong> Planung in die den Markt berührenden<br />
Straßen einbezogen.<br />
„Merschstraße“ (bisher nur tradierter Name, keine amtliche Bezeichnung)<br />
„Merschstraße“ bleibt weiterhin die Verbindungsstraße zwischen den Orten Warmen und<br />
Frohnhausen, kann also auf beiden Gemeindegebieten beibehalten werden.<br />
„Mühlenstraße“<br />
Eine Mühlenstraße gab (und gibt es weiterhin) im Stadtteil Frömern und letztmalig nachgewiesen<br />
im November 1962 auch in <strong>der</strong> Gemeinde Langschede. In <strong>der</strong> Umbenennungsphase<br />
1968-1970 wird auf diese Namensdoppelung nicht eingegangen. Es ist möglich, aber<br />
nicht nachzuweisen, dass die Langsche<strong>der</strong> Mühlenstraße zwischen 1963 und 1967 entwidmet<br />
wurde o<strong>der</strong> einer an<strong>der</strong>en Straße zugeordnet wurde; möglich ist auch die Einbeziehung in das<br />
Firmengelände „Mannesmann“ an <strong>der</strong> Ruhr.<br />
„Nordstraße“<br />
„Nordstraße“ in Fröndenberg bleibt<br />
„Nordstraße“ in Langschede wird <strong>der</strong> „Ardeyer Straße“ zugeordnet<br />
„Nordstraße“ in Dellwig wird zu „Schörweken“ (Flurname)<br />
„Ostbürener Straße“<br />
„Ostbürener“ Straße in Fröndenberg bleibt<br />
„Ostbürener“ Straße in Frömern wird zu „Ibbingsen“ (Flurname nach dem Besitzer Ibbing)<br />
„Ostmarkstraße“<br />
„Ostmarkstraße“ in Fröndenberg bleibt<br />
„Ostmarkstraße“ in Ardey wird umbenannt in „Thabrauck“<br />
„Ostmarkstraße“ in Langschede wird „Im Gründken“<br />
„Rosenweg“<br />
„Rosenweg“ in Dellwig bleibt<br />
„Rosenweg“ in Strickherdicke wird Am Hang<br />
„Rosenweg“ in Fröndenberg wird „Veilchenweg“<br />
„Ruhrstraße“<br />
„Ruhrstraße“ in Fröndenberg bleibt<br />
„Ruhrstraße“ in Dellwig wird dem unmittelbar angrenzenden „Ohlweg“ zugewiesen<br />
„Schäferstraße“<br />
„Schäferstraße“ in Dellwig bleibt<br />
„Schäferstraße“ in Ardey wird „Ostholz“<br />
„Schulstraße“ (Dellwig, Ardey, Frömern, Langschede und Fröndenberg) und<br />
„Schulweg“ (Strickherdicke)<br />
„Schulstraße“ in Dellwig bleibt<br />
„Schulstraße“ in Ardey und Langschede wird in Westfeld umbenannt (Verbindungsstraße)<br />
„Schulstraße“ in Frömern wird „Mutterkamp“ (orthographisch falscher Vorschlag, da dieses<br />
Flur in Frömern als „Muttenkamp“ bekannt ist; Mutten sind Mutterschweine, die dort auf<br />
dem Kamp (einem Stück Land) vom Schweinehirten <strong>der</strong> Gemeinde gehütet wurden)<br />
„Schulweg“ in Strickherdicke wird in „Beisenbrauck“ umbenannt
67<br />
„Schulstraße“ in Fröndenberg wird in die bisherige „Eulenstraße“ einbezogen<br />
„Unnaer Straße“<br />
„Unnaer Straße“ in Fröndenberg wird in die „Eulenstraße“ einbezogen<br />
„Unnaer Straße“ in Langschede und Strickherdicke bleibt (Verbindungsstraße, B-233)<br />
„Wasserwerkstraße“<br />
„Wasserwerkstraße“ in Fröndenberg bleibt<br />
„Wasserwerkstraße“ in Dellwig wird <strong>der</strong> neugebildeten „Hauptstraße“ zugeordnet<br />
2. Umbenennung fast gleichlauten<strong>der</strong> Namen, um Verwechselungen zu vermeiden:<br />
„Am Brauck“ (Dellwig) und „Brauck“ (Strickherdicke)<br />
„Am Brauck“ in Dellwig bleibt<br />
„Brauck“ in Strickherdicke wird geän<strong>der</strong>t in „Zur Düke“<br />
„Auf <strong>der</strong> Höhe“ (vorgesehen für Ostbüren) und „Auf <strong>der</strong> Höhe“ (Strickherdicke)<br />
„Auf <strong>der</strong> Höhe“ in Ostbüren wird so benannt<br />
„Auf <strong>der</strong> Höhe“ in Strickherdicke wird „Hubert-Biernat-Straße“<br />
„Drosselweg“ (Fröndenberg) und „Drosselstiege“ (Langschede)<br />
„Drosselweg“ in Fröndenberg bleibt<br />
„Drosselstiege“ in Langschede wird zum „Storchenweg“ (viele kin<strong>der</strong>reiche Familien)<br />
(So steht es tatsächlich wortwörtlich in <strong>der</strong> Akte; dieser geplante und auch zunächst<br />
umgesetzte Vorschlag wurde in den nächsten Jahren zum Politikum und zur Lokalsatire; siehe<br />
dazu Exkurs 6 <strong>der</strong> vorliegenden Arbeit)<br />
„Karrenweg“ und „Kaarweg“<br />
„Karrenweg“ in Stentrop wird als Neubenennung beibehalten<br />
„Kaarweg“ in Ardey wir zu „Bredde“ (Flurbezeichnung)<br />
„Lindenstraße“ (Frömern) und „Lindenweg“ (Fröndenberg)<br />
„Lindenweg“ in Fröndenberg bleibt<br />
„Lindenstraße“ in Frömern wird zur „Brinkstraße“ (Auf Protest <strong>der</strong> Anwohner in einer<br />
neueren Vorschlagsliste abgeän<strong>der</strong>t in „Lindenhofstraße“)<br />
„Hermann-Löns Straße“ (Fröndenberg) und „Lönsstraße“ (Dellwig)<br />
„Hermann-Löns-Straße“ in Fröndenberg bleibt<br />
„Lönsstraße“ in Dellwig wird zur „Wibbelt-Straße“ (nach dem Dichter Augustin Wibbelt)<br />
„Vom Stein-Straße“ (Fröndenberg) und „von-Steinen-Straße“ (Frömern)<br />
Von-Steinen-Straße“ in Frömern bleibt in Anerkennung <strong>der</strong> großen Verdienste des Verfassers<br />
<strong>der</strong> „Westfälischen <strong>Geschichte</strong>“ <strong>Die</strong><strong>der</strong>ich von Steinen bestehen, <strong>der</strong> Pfarrer in Frömern war,<br />
die Umbenennung <strong>der</strong> „Vom-Stein-Straße“ in Fröndenberg in „Hardenbergstraße“ wird<br />
empfohlen<br />
„Sonnebachstraße“ (Ardey), „Sonnenbergstraße“ (Langschede), „Am Sonnenhang<br />
(Fröndenberg) und „Sonnenhang“ (Strickherdicke)<br />
„Sonnebachstraße“ in Ardey wird <strong>der</strong> neu zu bildenden Straße „Westfeld“ zugeordnet<br />
„Sonnenbergstraße“ in Langschede bleibt.<br />
„Am Sonnenhang“ in Fröndenberg wird zur „Eberhardstraße“<br />
„Sonnenhang“ in Strickherdicke wird zu „Wulfesweide“<br />
(Ein späterer Protest <strong>der</strong> Anwohner wegen „Wertmin<strong>der</strong>ung“ ihrer Grundstücke und Häuser<br />
wird von <strong>der</strong> Verwaltung zurückgewiesen; Wulfesweide = von Wildschweinen durchwühlte<br />
Weide)<br />
Soweit <strong>der</strong> erste Gesamtvorschlages des Bauamtes <strong>der</strong> Stadt Fröndenberg, <strong>der</strong> in<br />
leicht abgeän<strong>der</strong>ter 2 Form Ausschüsse und Stadtrat bis Mitte 1970 beschäftigte.<br />
2 Leichte Verän<strong>der</strong>ungen, hauptsächlich die Schreibweise betreffend, zwischen dem Vorschlag vom 6.3 1968<br />
und dem 9.12.1968 wurden <strong>der</strong> Übersichtlichkeit wegen hier einan<strong>der</strong> angeglichen, ebenso sind einige wenige<br />
<strong>Straßennamen</strong>, <strong>der</strong>en Än<strong>der</strong>ungswürdigkeit erst ab 1970 aufgefallen war, hier bereits eingearbeitet.
68<br />
Des weiteren wurde dieser Vorschlag ergänzt durch <strong>Straßennamen</strong> für die o.a. Gemeinden,<br />
die bisher keine <strong>Straßennamen</strong>, son<strong>der</strong>n lediglich Hausnummerierungen hatten, 3 wobei zu<br />
unterscheiden ist nach Gemeinden in denen bereits die Hausnummerierung dem Straßenverlauf<br />
folgte und Ge-meinden, die noch „querbeet“ genummert waren. Näheres dazu siehe<br />
im Teil F <strong>der</strong> vorliegenden Arbeit.<br />
3. Das Ergebnis <strong>der</strong> Erstbenennungen für die Stadtteile, die bisher keine <strong>Straßennamen</strong><br />
hatten:<br />
für den Stadtteil (ehemalige Gemeinde) Altendorf:<br />
Schwerter Straße<br />
Altendorfer Straße (ursprünglich war „Opherdicker Straße“ vorgesehen)<br />
Ringstraße<br />
Feuerwehrstraße<br />
Ostfeld<br />
Billmericher Weg<br />
Pappelallee<br />
Fuhrweg<br />
für den Stadtteil (ehemalige Gemeinde) Ostbüren:<br />
Am Obsthof<br />
Bockenweg (ursprünglich war „Ziegeleiweg“ vorgesehen)<br />
Poststraße<br />
Frömerner Straße<br />
Bauernbrücke<br />
Burgstraße<br />
Waldweg<br />
Bauernkamp<br />
Heckenweg<br />
Wilhelmstraße<br />
Zur Mark<br />
Auf <strong>der</strong> Höhe<br />
(Boselbahn)<br />
Kessebürener Weg<br />
Am Sportplatz<br />
In <strong>der</strong> Wahne<br />
Brameck<br />
(umgesetzt mit Ausnahme <strong>der</strong> Boselbahn, die den Namen Bausenhagener Straße erhielt )<br />
für den Stadtteil (ehemalige Gemeinde) Warmen<br />
Stentroper Weg<br />
Ölmühlenweg<br />
Landstraße<br />
Warmer Löhn (benannt aber nicht im Stadtplan eingezeichnet und mit Schil<strong>der</strong>n versehen, da<br />
nicht bebaut)<br />
Schlotstraße<br />
Am Kraftwerk<br />
Zur Tigge<br />
Schmiedestraße (alle komplett umgesetzt)<br />
3 In <strong>der</strong> Vorlage vom 9.12.1968 ist zu je<strong>der</strong> hier vorgeschlagenen Straße noch eine genaue Ortsangabe auf Basis<br />
<strong>der</strong> Flurpläne beigefügt; auf die Wie<strong>der</strong>gabe dieser katasterüblichen Beschreibung wurde hier verzichtet.
69<br />
für den Stadtteil (ehemalige Gemeinde) Neimen<br />
Königsweg (bisheriges Unterdorf südlich <strong>der</strong> Bahn; zunächst vorgesehener Name<br />
„Stoppelacker“, <strong>der</strong> auf Protest <strong>der</strong> Bevölkerung nicht vergeben wurde.<br />
Neimener Weg (bisher bereits übliche Bezeichnung <strong>der</strong> Verbindung Oberdorf nördlich <strong>der</strong><br />
Bahn und dem Neimen angehörigen östlichen Teil <strong>der</strong> Hohenheide)<br />
für den Stadtteil (ehemalige Gemeinde) Stentrop<br />
Karrenweg<br />
Henrichsknübel<br />
Eichholz<br />
Tannengarten<br />
(Boselbahn)<br />
Palzstraße<br />
Stentroper Weg<br />
(umgesetzt mit Ausnahme <strong>der</strong> Boselbahn, die den Namen Bausenhagener Straße erhielt )<br />
für den Stadtteil (ehemalige Gemeinde) Bausenhagen:<br />
Palzstraße<br />
Steinkuhle<br />
Zur Dorfwäsche<br />
Zur Tränke<br />
Hellkammer<br />
Priorsheide<br />
Birkei<br />
Pastoratswald<br />
Holtkamp<br />
(Boselbahn)<br />
Im Schelk<br />
Im Sun<strong>der</strong>n<br />
(umgesetzt mit Ausnahme <strong>der</strong> Boselbahn, die den Namen Bausenhagener Straße erhielt )<br />
Kirchweg (Neubaugebiet Birkei, zusätzlich am 20.11.1970 neu in die Liste aufgenommen)<br />
4. Der weitere Prozess <strong>der</strong> Entscheidungsfindung<br />
Am 23.August 1968 wurde diese Liste vom Wegebau- und Friedhofsausschuss dem Stadtrat<br />
zur Beratung vorgelegt unter Punkt 12 „Straßenumbenennungen“.<br />
In <strong>der</strong> Begründung zu dieser Vorlage heißt es u.a.: „Auf Veranlassung des früheren<br />
kommissarischen Bürgermeisters 4 hatte die Verwaltung im Februar dieses Jahres mit den ehemaligen<br />
Bürgermeistern (...) Überlegungen angestellt, um bei <strong>der</strong> Umbenennung von Straßenbezeichnungen<br />
möglichst solche Namen zu wählen, die aus dem Sprachgebrauch, nach<br />
Persönlichkeiten (...) aus <strong>der</strong> Flurbezeichnung usw. ergeben.“<br />
Am Schluss <strong>der</strong> Vorlage heißt es wohlweislich im warnenden Ton <strong>der</strong> Kommissionsmitglie<strong>der</strong><br />
gegenüber den debatier- und än<strong>der</strong>ungsfreudigen Stadtrat: „ Es ist damit<br />
zu rechnen, dass rund 70 neue Straßenschil<strong>der</strong> beschafft werden müssen. An Kosten werden<br />
einschließlich Beschaffung <strong>der</strong> Schil<strong>der</strong>, Rohrpfosten und Montage ca. 4.000,- DM entstehen,<br />
4 Gemäss des Gesetzes zur kommunalen Neuglie<strong>der</strong>ung blieb <strong>der</strong> bisherige Bürgermeister <strong>der</strong> Gemeinde<br />
Fröndenberg ab 1.1.1968 kommissarisch bis zur Neuwahl im Amt. <strong>Die</strong> Neuwahl hatte inzwischen bis zum 23.<br />
August statt gefunden, so dass in dieser Vorlage vom „früheren kommissarischen Bürgermeister“ die Rede ist.
70<br />
wenn Aluminiumschil<strong>der</strong> verwendet würden. Bei Verwendung eines höherwertigen Materials<br />
werden sich die Kosten auf insgesamt 6.000,- DM erhöhen.“<br />
Auf <strong>der</strong> Sitzung vom 2.10.1968 wurde dieser wichtige Tagesordnungspunkt dann jedoch „auf<br />
eine <strong>der</strong> nächsten Sitzungen“ verschoben. Zur nächsten Sitzung am 26.11.1968 wurde <strong>der</strong><br />
Stadtrat von Stadtdirektor Klammer ernstlich daran erinnert, „dass nunmehr die Angelegenheit<br />
so dringlich geworden sei, dass sich <strong>der</strong> Rat nunmehr darüber Gedanken machen<br />
muss, wie die (...) <strong>Straßennamen</strong> abgeän<strong>der</strong>t und neu vergeben werden sollen.“ Immerhin<br />
wurde daraufhin ein „erweiterter Son<strong>der</strong>ausschuss“ des Wegebau- und Friedhofsausschusses<br />
gebildet, <strong>der</strong> am 9.12.1968 „erstmalig“ (man rechnete also bereits im Vorfeld mit mehreren<br />
Sitzungen) tagen sollte. Zusätzlich hatte sich dieser Son<strong>der</strong>ausschuss auch noch den heiklen<br />
Punkt <strong>der</strong> Straßenbenennung im Baugebiet „Mühlenberg-Nord-West“ selbst auf die Tagesordnung<br />
gesetzt. 5 Am 3. Januar 1969 wurden die Vorschläge des erweiterten Son<strong>der</strong>ausschusses<br />
grundsätzlich angenommen und zur Erarbeitung einer Vorlage für den Stadtrat an<br />
die Verwaltung (Bauamt) zurückgereicht.<br />
Der Son<strong>der</strong>ausschuss bestand aus drei ehemaligen Gemeindebürgermeistern und nunmehrigen<br />
Ortsvorstehern, aus zwei Ratsmitglie<strong>der</strong>n, dem Stadtdirektor, dem Stadtbaumeister Heymann,<br />
einem Stadtamtmann und einem Schriftführer.<br />
Unter Tagesordnungspunkt 16 wurde die Vorlage des Bauamtes (auf <strong>der</strong> Basis des erarbeiteten<br />
Vorschlags des erweiterten Son<strong>der</strong>ausschusses) dem Stadtrat in <strong>der</strong> Sitzung vom<br />
18.6.1969 vorgelegt, jedoch lediglich die Benennung <strong>der</strong> Mühlenberg-Siedlung und die Benennung<br />
<strong>der</strong> „Unionstraße“ im Sanierungsgebiet <strong>der</strong> Kernstadt zum Abschluss gebracht. „Mit<br />
Rücksicht auf die anstehenden Bundestags- und Kommunalwahlen“ wurde <strong>der</strong> gesamte Komplex<br />
<strong>der</strong> Straßenumbenennungen und Neubenennungen in den Stadtteilen auf Antrag <strong>der</strong><br />
SPD-Fraktion (die zu diesem Zeitpunkt über die absolute Mehrheit im Stadtrat verfügte) von<br />
<strong>der</strong> Tagesordnung gestrichen und erneut an die Ausschüsse überwiesen nachdem zuvor<br />
beschlossen worden war, den Son<strong>der</strong>ausschuss personell nochmals aufzustocken.<br />
<strong>Die</strong>ses Vorgehen erwies sich als taktische Meisterleistung <strong>der</strong> SPD, da die kommunale<br />
Neuordnung bei den Bürgern wenn nicht auf Ablehnung, so doch auf große Skepsis gestoßen<br />
war und als „leidiges Thema“ die Bürger seit Mitte <strong>der</strong> 60er Jahre beschäftigte, bzw. auch<br />
beunruhigte. Gegenüber den eher konservativen Parteien zuneigenden Stadtteilen wurde somit<br />
Geduld und Entgegenkommen signalisiert, in aller Ruhe über die anstehenden Verän<strong>der</strong>ungen<br />
nachzudenken und zu entscheiden, während <strong>der</strong> eher „progressiven Wählerschaft“ in <strong>der</strong><br />
Kernstadt mit <strong>der</strong> Verabschiedung <strong>der</strong> Straßenbenennung auf dem Mühlenberg mo<strong>der</strong>nes<br />
Denken und historische Sensibilität signalisiert wurde. Sicher nicht nur aus diesem Grunde,<br />
aber auch deswegen wurden die anstehenden Kommunalwahlen tatsächlich mehrheitlich von<br />
<strong>der</strong> SPD gewonnen, während <strong>der</strong> bürgerlichen Opposition <strong>der</strong> Wind aus den Segeln<br />
genommen wurde, bzw. die gegenteilige Ansicht hinsichtlich des Mühlenbergs ihr in <strong>der</strong><br />
Kernstadt als hoffnungslos rückständiges o<strong>der</strong> gar revanchistisches Denken verübelt wurde.<br />
Bis in das Jahr 1970 hinein zogen sich nun zunächst die Debatten um die personelle<br />
Besetzung des vom Stadtparlament aufgestockten Son<strong>der</strong>ausschusses und man gewinnt den<br />
Eindruck, dass die <strong>Straßennamen</strong>benennung wohl doch nicht die Priorität besaß, die <strong>der</strong><br />
(inzwischen abgewählte) Stadtdirektor Klammer ihr Ende 1968 beigemessen hatte. Sichtlich<br />
unlustig machte sich die erweiterte Son<strong>der</strong>kommission des Wegebau- und Friedhofsausschusses<br />
sowie dieser selbst erneut an die Arbeit. Allerdings wurden noch einige<br />
Ergänzungen hinsichtlich Doppelnennungen und/o<strong>der</strong> Namensähnlichkeiten mit in die<br />
Beratungen aufgenommen.(z.B. „Lindenweg“, „Lindenstraße“, „Kaarweg“ und „Karrenweg“,<br />
2x „Feldweg“), die vorher nicht beachtet worden waren.<br />
5 <strong>Die</strong>ser Punkt betrifft die Exkurse 4 und 5 <strong>der</strong> vorliegenden Arbeit und wird dort ausführlich dargestellt.
71<br />
Neu hinzu kam, dass sich mittlerweile auch die bereits genannte bisher straßennamenlose<br />
Gemeinde Bentrop doch endgültig <strong>der</strong> Stadt Fröndenberg zugewandt hatte und somit die<br />
Benennung von Straßen in dieser Gemeinde Gegenstand <strong>der</strong> Beratungen wurde.<br />
Folgende <strong>Straßennamen</strong> wurden für Bentrop in Vorschlag gebracht:<br />
für den Stadtteil (ehemalige Gemeinde) Bentrop<br />
Landstraße<br />
Neuenkamp<br />
Hellkammer<br />
Öhlmühlenweg<br />
Windgatt<br />
Kaiserstraße<br />
Bentroper Weg (ursprünglich war die Bezeichnung Grabenweg geplant)<br />
Warmer Löhn<br />
Wie unschwer im Vergleich mit den Vorschlägen für die bisher ebenfalls namenlosen<br />
angrenzenden Stadtteilen Warmen, Bausenhagen und Stentrop zu erkennen ist, verlängerte<br />
<strong>der</strong> Ausschuss scheinbar wenig phantasievoll die für diese Stadtteile vorgesehenen <strong>Straßennamen</strong><br />
bis in den Stadtteil Bentrop hinein. Grundlage für diese Entscheidung war jedoch, dass<br />
<strong>der</strong> Wegebau- und Friedhofsausschuss bereits im Vorfeld <strong>der</strong> großen Umbenennungs- und<br />
Benennungsaktion 1968 darin überein gekommen war, durchgehende Straßen nach Möglichkeit<br />
mit einem einheitlich durchgehenden Namen zu bezeichnen. Der Blick auf den<br />
Stadtplan macht deutlich, dass die überwiegende Zahl <strong>der</strong> Bentroper Straßen ihren Ausgang<br />
bereits in Warmen, Bausenhagen und Stentrop nimmt.<br />
So wurde auch in an<strong>der</strong>en Stadtteilen entschieden und zum Beispiel aus den beiden<br />
Bezeichnungen „Dellwiger Weg“ (von Strickherdicke ausgehend) und „Strickherdicker Weg“<br />
(von Dellwig ausgehend) ein und <strong>der</strong>selben Straße die einheitliche Bezeichnung „Strickherdicker“<br />
Weg für den gesamten Verlauf beschlossen.<br />
Am 1.Juli 1970 war es dann soweit. Der Stadtrat stimmte <strong>der</strong> Vorschlagsliste des Bauamtes<br />
auf <strong>der</strong> Grundlage <strong>der</strong> von dessen Son<strong>der</strong>ausschuss entwickelten Liste auf „Umbenennung<br />
und Neubenennung <strong>der</strong> Straßen innerhalb <strong>der</strong> „neuen“ Stadt Fröndenberg“ zu; 2 ½ Jahre nach<br />
ihrer Bildung.<br />
In einer Sitzung vom 13.August 1970 brachte <strong>der</strong> Wegebau- und Friedhofsausschuss noch<br />
einige Verbesserungsvorschläge aus dem Kreis <strong>der</strong> Anwohner auf den Weg in den Stadtrat, da<br />
kurz vor <strong>der</strong> Beschlussfassung des Rates vom 1.7.1970 mehrere Protestschreiben von betroffenen<br />
Anliegern eingegangen waren. Zwei Umbenennungen waren daraufhin vom Rat am<br />
1. Juli erst gar nicht entschieden worden, son<strong>der</strong>n nochmals an den Wegebau- und Friedhofsausschuss<br />
zurück überwiesen worden.<br />
So wurde auf die geplante Umbenennung <strong>der</strong> Frömerner „Lindenstraße“ in „Bonekampstraße“<br />
unter Einbeziehung <strong>der</strong> sich anschließenden und erst im Dezember 1968 benannten<br />
Straße „Bonekamp“ verzichtet und <strong>der</strong> Vorschlag an den Rat vorbereitet, die „Lindenstraße“<br />
in „Lindenhofstraße“ umzubenennen. <strong>Die</strong> Bezeichnung Bonekamp blieb erhalten.<br />
<strong>Die</strong> geplante Namensän<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> im Stadtteil Neimen gelegenen Straße „Unterdorf“ in<br />
„Stoppelacker“ erschien den Anwohnern aus einleuchtenden Gründen wenig vorteilhaft und<br />
diskriminierend. Deren schriftlich eingereichter Eingabe vom 27.Juni 1970 wurde<br />
entsprochen und auf Vorschlag <strong>der</strong> Bürger für diese Straße den Namen „Königsweg“ gewählt.<br />
Am 20.11.1970 wurde diesen beiden Än<strong>der</strong>ungsvorschlägen vom Stadtrat zugestimmt.
72<br />
Bemerkenswert ist es, dass für den Stadtteil Frömern am 27.12.1968, also mitten im Prozess<br />
<strong>der</strong> Um- und Neubenennungen und nicht in diesen Prozess inhaltlich einbezogen, drei neue<br />
<strong>Straßennamen</strong> vergeben wurden: „Bonekamp“, „Tharloh“ und „Bielenbusch“.<br />
Zum 1.12.1970, also nunmehr 3 Jahre nach <strong>der</strong> Bildung <strong>der</strong> „neuen“ Stadt Fröndenberg wurde<br />
durch das Bauamt ein neues amtliches Straßenverzeichnis 6 erstellt, das alle Än<strong>der</strong>ungen erfasste.<br />
<strong>Die</strong> Hausbesitzer umbenannter Straßen erhielten entsprechende Post von <strong>der</strong> Verwaltung<br />
im Falle, dass Hausnummern neu angebracht o<strong>der</strong> verän<strong>der</strong>t werden mussten mit <strong>der</strong><br />
Auffor<strong>der</strong>ung ggf. ihre Mieter zu verständigen. Alte Hausnummern mussten durchgestrichen<br />
noch ein Jahr lang sichtbar angebracht bleiben.<br />
Alle Än<strong>der</strong>ungen traten mit Wirkung vom 1.1.1971 gesetzlich in Kraft.<br />
Aus <strong>der</strong> Sicht <strong>der</strong> Kernstadt und <strong>der</strong> neuen Stadtteile (ehemalige Gemeinden, bzw. Großgemeinde<br />
Langschede), <strong>der</strong>en Straßen bereits vor 1968 Namen führten ergaben sich somit folgende<br />
Neubenennungen bzw. Umbenennungen von 1968-1970:<br />
Kernstadt Fröndenberg (Umbenennungen)<br />
„Am Sonnenhang“ in „Eberhardstraße“<br />
„Amselweg in Nachtigallenweg“<br />
„Finkenweg“ in „Schwalbenweg“<br />
„Gartenstraße“ in „Blumenstraße“<br />
„Im Schelk“ wird einbezogen in den bestehenden „Querweg“<br />
„Rosenweg“ in „Veilchenweg“<br />
„Schulstraße“ wird einbezogen in die „Eulenstraße“<br />
„Unnaer Straße“ wird einbezogen in die „Eulenstraße“<br />
„Vom-Stein-Straße“ in „Hardenbergstraße“<br />
dazu in <strong>der</strong> Kernstadt Fröndenberg folgende Neubenennungen<br />
„Unionstraße“<br />
„Bonhoefferstraße“<br />
„Julius-Leber-Straße“<br />
„Ludwig-Steil-Straße“<br />
„Otto-Wels-Straße“<br />
“Pastor-Delp-Straße”<br />
“Paul-Löbe-Straße” und<br />
“Von-Galen-Straße”<br />
Ardey<br />
„Gartenstraße“ in „Talstraße“<br />
“Karrenweg” in “Bredde”<br />
„Kreisstraße“ wird einbezogen in die bereits bestehende „Ardeyer Straße“<br />
„Ostmarkstraße“ in „Thabrauck“<br />
„Schäferstraße“ in „Ostholz“<br />
„Schulstraße“ in „Westfeld“<br />
„Sonnebachstraße“ wird in die neugebildete Straße „Westfeld“ einbezogen<br />
Dellwig<br />
Gartenweg“ in „Weidenweg“<br />
„Kirchplatz“ in „Ahlinger Berg“<br />
„Lönsstraße“ in „Wibbelstraße“<br />
„Nordstraße“ in „Schörweken“<br />
6 <strong>Die</strong>ses Verzeichnis ist am Ende des Kapitels angefügt
73<br />
„Ruhrstraße“ wird dem bestehenden „Ohlweg“ zugewiesen<br />
„Wasserwerkstraße“ wird einbezogen in die „Hauptstraße“<br />
Frohnhausen<br />
„Dorf“ wurde einbezogen in die neu benannte Verbindungsstraße zwischen<br />
den Stadtteilen Bausenhagen, Stentrop und Frohnhausen „Palzstraße“<br />
„Feldweg“ einbezogen in die Verlängerung <strong>der</strong> Wicke<strong>der</strong> Straße, die jedoch nicht durchgehend<br />
als Straße bis Wickede führt, Hauptverbindung nach Wickede<br />
ist ab Frohnhausen die „Landstraße“ links <strong>der</strong> Bahnlinie.<br />
Frömern<br />
„Bachstraße“ in „In <strong>der</strong> Twiete“<br />
„Bahnhofstraße“ in „Brückenstraße“<br />
„Kirchplatz“ in „Sybrechtplatz“<br />
Ein Brief mit einem Gegenvorschlag <strong>der</strong> Evangelischen Kirchengemeinde in Frömern vom<br />
15.1.1969, den geplanten „Wilhelm-Sybrecht-Platz“ nach dem Kirchenpatron Johannes d.<br />
Täufers zu benennen, ist in den Akten mit Eingangsstempel 16. Januar 1969 versehen worden,<br />
hätte demnach Gegenstand <strong>der</strong> Beratungen werden können, wurde jedoch (absichtlich?) erst<br />
nach energischer Nachfrage <strong>der</strong> Kirchengemeinde Mitte 1970 nach Beendigung <strong>der</strong><br />
Findungsdebatte dem Gemeindevorstand abschlägig beschieden.<br />
„Kleine Bahnhofstraße“ in „Kampstraße“<br />
„Lindenstraße“ in „Lindenhofstraße“<br />
„Ostbürener Straße“ in „Ibbingsen“<br />
„Schulstraße“ in „Mutterkamp“, sowie die neuen Erstbenennungen<br />
„Bonekamp“<br />
„Tharloh“ und<br />
„Bielenbusch“<br />
Langschede<br />
„Bahnhofstraße“ in „Hauptstraße“<br />
„Drosselstiege“ in „Storchenweg“ (später in „Meisenweg“)<br />
„Kreisstraße“ wird einbezogen in die bereits bestehende „Ardeyer Straße“<br />
„Markt“ entfällt<br />
„Nordstraße“ wird <strong>der</strong> aus Ardey/Fröndenberg kommenden „Ardeyer Straße“ zugeordnet<br />
„Ostmarkstraße“ in „Im Gründken“<br />
„Schulstraße“ in „Westfeld“<br />
Neimen<br />
Der Wohnplatz Unterdorf wird umbenannt in „Königsweg“<br />
Der Wohnplatz Oberdorf und <strong>der</strong> Neimener Teil <strong>der</strong> Hohenheide wird zum „Neimener Weg“<br />
Strickherdicke<br />
„Auf <strong>der</strong> Höhe“ in „Hubert-Biernat-Straße“<br />
„Brauck“ in „Zur Düke“<br />
„Dorfstraße“ in „Kleibusch“<br />
„Landwehr“ in „Hellweg“<br />
„Rosenweg“ in „Am Hang“<br />
„Schulweg“ in „Beisenbrauck“ und „Sonnenhang“ in „Wulfesweide“<br />
Neu hinzu kam in Strickherdicke <strong>der</strong> offizielle Straßenname „Iserlohner Straße“, da einige<br />
wenige Wohnhäuser an dieser nördlichen Verlängerung <strong>der</strong> Unnaer Straße in Richtung Unna
74<br />
zwischen Wilhelmshöhe und Autobahnzubringer auf <strong>Fröndenberger</strong> (Strickherdicker Gebiet)<br />
liegen.<br />
5. Fazit dieser großen Umbenennungsphase:<br />
Auch wenn die Dauer des Prozesses <strong>der</strong> Neu- und Umbenennung im nachhinein als sehr lang<br />
erscheint, so hatten sich doch alle Beteiligten bemüht, Nägel mit Köpfen zu machen und allen<br />
Beteiligten gerecht zu werden, auch wenn <strong>der</strong> Exkurs 6 deutlich macht, dass es nicht allen<br />
Anwohnern recht gemacht werden konnte, bzw. die Verwaltung erkennen musste, dass über<br />
den Kopf <strong>der</strong> Anwohner unpopuläre Maßnahmen nicht durchsetzbar waren.<br />
34 bereits vor 1967 benannte Straßen wurden umbenannt, 11 Straßenbezeichnungen wurden<br />
aufgehoben und <strong>der</strong> Verlauf dieser Straßen einbezogen in an<strong>der</strong>e Straßen. 65 <strong>Straßennamen</strong><br />
wurden für die bisher straßennamenlosen Stadtteile, sowie in Erstbenennung für Fröndenberg<br />
(Mühlenbergsiedlung und Unionstraße), sowie für drei Erstbenennungen in Frömern und eine<br />
Erstbenennung in Strickherdicke (Iserlohner Straße) neu vergeben 7 .<br />
Ging die Verwaltung ursprünglich von einer Anzahl von 70 neu zu beschaffenden Schil<strong>der</strong>n<br />
aus, ergab sich nun eine Zahl von 87 neuen Namen, was die Anschaffung von mindestens ca.<br />
150 neuen Schil<strong>der</strong>n nach sich zog, da nicht alle neu- und umbenannten Straßen Stichstraßen<br />
waren und demnach die Anschaffung von mehr als einem neuen Schild für viele Straßen nötig<br />
wurde o<strong>der</strong> im Fall von Verbindungsstraßen, die mehr als zwei Orte miteinan<strong>der</strong> verbanden,<br />
auch in drei- o<strong>der</strong> vierfacher Ausfertigung.<br />
Jedes Haus, bzw. jedes bebaute Grundstück <strong>der</strong> neuen Stadt Fröndenberg lag nun an einer mit<br />
Namen versehenen Straße und hatte eine dem Straßenverlauf entsprechende fortlaufende<br />
Hausnummer.<br />
Gegenüber dem vorherigen Zustand ein deutlicher Fortschritt für die Auffindbarkeit und<br />
Zuordnung <strong>der</strong> Gebäude und ihrer Bewohner, aber auch ein Zeichen dafür, dass <strong>der</strong> dörfliche<br />
Charakter vieler Stadtteile sich bis Ende <strong>der</strong> 60er Jahre des 20. Jahrhun<strong>der</strong>ts dahingehend<br />
geän<strong>der</strong>t hatte, dass nicht mehr nach den Grundsätzen „Je<strong>der</strong> kennt Jeden“ o<strong>der</strong> „nur Einheimische<br />
wohnen hier seit Generationen, die sich sowieso (aus)kennen“ verfahren werden<br />
konnte.<br />
<strong>Die</strong> lange Dauer dieses Umbenennungsprozesses ist auch bedingt gewesen durch taktisches<br />
Verhalten <strong>der</strong> Beteiligten in den Stadtteilen und in <strong>der</strong> Verwaltung.<br />
Dem Wunsch nach einem Höchstmaß an eigenständiger erhaltenswerter Identität <strong>der</strong><br />
einzelnen Stadtteile stand <strong>der</strong> Wunsch <strong>der</strong> Verwaltung nach einheitlicher Vorgehensweise,<br />
Vermeidung von Namensdoppelungen und Vermeidung von Verwechselungsgefahr bei<br />
gleichklingenden Namen in vielen Fällen gegenüber.<br />
Bei <strong>der</strong> Erforschung dieser Zeitspanne wird beson<strong>der</strong>s deutlich, dass Straßenbenennungen ab<br />
Ende <strong>der</strong> 1960er Jahre auch auf dem „platten Lande“ kein bloßer Verwaltungsakt des<br />
Bauamtes, <strong>der</strong> Ausschüsse und <strong>der</strong> Stadt- und Gemeindeparlamente mehr waren, die sich<br />
problemlos mit Schreibmaschine, Papier, Schippe, Spaten und bemaltem Blech hätten<br />
durchführen lassen.<br />
Emanzipationsbestrebungen <strong>der</strong> Bürger gegenüber <strong>der</strong> Verwaltung und Beharrungsvermögen<br />
gegenüber „von oben“ als oktroyiert empfundene Verän<strong>der</strong>ungen galt es zu berücksichtigen<br />
Zum 31.12.1967 gab es im Amtsbezirk (ohne Kessebüren und Billmerich) 190 mit Namen<br />
versehende Straßen incl. Doppelnennungen; zum 1.1.1971 waren es folgende 238 Straßen, die<br />
verwaltungsseitig und damit amtlich mit einem Namen versehen waren:<br />
.<br />
7 Bei dieser Zählung sind benannte Verbindungsstraßen zwischen bisher straßennamenlosen Stadtteilen nur<br />
einmal gezählt (Beispiel: „Bausenhagener Straße“ o<strong>der</strong> „Palzstraße“)
75<br />
Straßenverzeichnis <strong>der</strong> Stadt Fröndenberg mit Datum 1.1.1971<br />
nach dem Ende <strong>der</strong> Umbenennungsphase 1968/1970 einschl. <strong>der</strong> unabhängig davon neu<br />
benannten Straßen.<br />
Verän<strong>der</strong>ungen seit dem 1.1.1968 mit Benennungsdatum;<br />
seit dem 1.1.1968 in Fortfall gekommene Straßen sind nicht mehr aufgeführt<br />
Al = Stadtteil Altendorf<br />
Ar = Stadtteil Ardey<br />
Ba = Stadtteil Bausenhagen<br />
Be = Stadtteil Bentrop<br />
De = Stadtteil Dellwig<br />
F = Kernstadt Fröndenberg mit Westick und Hohenheide<br />
Fr = Stadtteil Frömern<br />
Fro = Stadtteil Frohnhausen<br />
La = Stadtteil Langschede<br />
Ne = Stadtteil Neimen<br />
Ost = Stadtteil Ostbüren<br />
St = Stadtteil Stentrop<br />
Str = Stadtteil Strickherdicke<br />
Wa = Stadtteil Warmen<br />
A<br />
Ahlinger Berg (De), Ratsbeschluss vom 1.7.1970<br />
Ahornweg (F)<br />
Akazienweg (F)<br />
Alleestraße (F)<br />
Alte Kreisstraße (Str)<br />
Altendorfer Straße (Al), Ratsbeschluss vom 1.7.1970<br />
Alter Mühlenweg (Fr)<br />
Alter Weg (Str)<br />
Am Backenberg (Fr)<br />
Am Birnbaum (Fr)<br />
Am Brauck (De)<br />
Am Hang (Str), Ratsbeschluss vom 1.7.1970<br />
Am Klingelbach (F)<br />
Am Kraftwerk (Wa), Ratsbeschluss vom 1.7.1970<br />
Am Obsthof (Ost), Ratsbeschluss vom 1.7.1970<br />
Am Sachsenwald (F)<br />
Am Schwimmbad (De)<br />
Am Sportplatz (Ost), Ratsbeschluss vom 1.7.1970<br />
Am Steinbruch (F)<br />
Am Ufer (La)<br />
Amselweg (La)<br />
Annette-von-Droste-Hülshoff-Straße (F)<br />
Ardeyer Straße (Durchgangsstraße F, Ar, La), für Ar und La neu per Ratsbeschluss<br />
vom 1.7.1970, für Fröndenberg alte Bezeichnung<br />
Asternweg (F)<br />
Auf dem Krittenschlag (F)<br />
Auf dem Sodenkamp (F)
Auf dem Spitt (Fr)<br />
Auf <strong>der</strong> Freiheit (F)<br />
Auf <strong>der</strong> Höhe (Ost), Ratsbeschluss vom 1.7.1970<br />
Auf <strong>der</strong> Kisse (La)<br />
B<br />
Bachstraße (De)<br />
Bahnhofstraße (F)<br />
Bauernbrücke (Ost), Ratsbeschluss vom 1.7.1970<br />
Bauernkamp (Ost), Ratsbeschluss vom 1.7.1970<br />
Bausenhagener Straße (Durchgangsstraße Ost, Ba, St, Be), Ratsbeschluss vom 1.7.1970<br />
Beisenbrauck (Str), Ratsbeschluss vom 1.7.1970<br />
Bentroper Weg (Be), Ratsbeschluss vom 1.7.1970<br />
Bergstraße (F)<br />
Bertholdusstraße (F)<br />
Bethelstraße (De)<br />
Bielenbusch (Fr), Ratsbeschluss vom 27.12.1968<br />
Billmericher Weg (Al), Ratsbeschluss vom 1.7.1970<br />
Bilstein (Ar)<br />
Binnerstraße (De)<br />
Birkei (Ba), Ratsbeschluss vom 1.7.1970<br />
Birkenweg (F)<br />
Bismarckstraße (F)<br />
Blumenstraße (F), Ratsbeschluss vom 1.7.1970<br />
Böckelmannweg (Str)<br />
Bockenweg (Ost), Ratsbeschluss vom 1.7.1970<br />
Bodelschwinghstraße (De)<br />
Bonekamp (Fr), Ratsbeschluss vom 27.12.1968<br />
Bonhoeffer Straße (F), Ratsbeschluss vom 18.6.1969<br />
Brameck (Ost), Ratsbeschluss vom 1.7.1970<br />
Brauerstraße (Fr)<br />
Bredde (Ar), Ratsbeschluss vom 1.7.1970<br />
Brückenstraße (Fr), Ratsbeschluss vom 1.7.1970<br />
Buchenacker (Ar)<br />
Burgstraße (Ost), Ratsbeschluss vom 1.7.1970<br />
Burland (Ar)<br />
C, D<br />
Dahlienweg (F)<br />
Dorfstraße (Ar)<br />
Drosselweg (F)<br />
E<br />
Eberhardstraße (F), Ratsbeschluss vom 1.7.1970<br />
Eichendorffstraße (De)<br />
Eichholz (St), Ratsbeschluss vom 1.7.1970<br />
Elsternweg (F)<br />
Engelbertstraße (F)<br />
Eulenstraße (F)<br />
F<br />
Feldstraße (Ar)<br />
Feuerwehrstraße (Al), Ratsbeschluss vom 1.7.1970<br />
Fichtenweg (F)<br />
Finkenweg (La)<br />
76
Fischerssiepen (F)<br />
Flie<strong>der</strong>weg (F)<br />
Freiheitstrasse (F)<br />
Friedhofstraße (F)<br />
Friedrich-Bering-Straße (F)<br />
Friedrich-Ebert-Straße (De)<br />
Frömerner Straße (Ost), Ratsbeschluss vom 1.7.1970<br />
Fuhrweg (Al), Ratsbeschluss vom 1.7.1970<br />
G<br />
Gartenstraße (La)<br />
Gladiolenweg (F)<br />
Goethestraße (F)<br />
Graf-Adolf-Straße (F)<br />
Grüner Weg (F)<br />
H<br />
Hainbach (Ar)<br />
Hardenbergstraße (F), Ratsbeschluss vom 1.7.1970<br />
Haßleistrasse (F)<br />
Hauptstraße (Durchgangsstraße De, La), Ratsbeschluss vom 1.7.1970<br />
Heckenweg (Ost), Ratsbeschluss vom 1.7.1970<br />
Heideweg (Durchgangsstraße Str,Ar)<br />
Hellkammer (Durchgangsstraße Ba, Be), Ratsbeschluss vom 1.7.1970<br />
Hellweg (Str), Ratsbeschluss vom 1.7.1970<br />
Hengstenbergstraße (F)<br />
Henrichsknübel (St), Ratsbeschluss vom 1.7.1970<br />
Hermann-Löns-Straße (F)<br />
Hilkenhohl (Ar)<br />
Hintere Straße (De)<br />
Hirschberg (F)<br />
Hohenheide (Durchgangsstraße F, Ne, Fro)<br />
Holtkamp (Ba), Ratsbeschluss vom 1.7.1970<br />
Hubert-Biernat-Straße (Str), Ratsbeschluss vom 1.7.1970<br />
I<br />
Ibbingsen (Fr), Ratsbeschluss vom 1.7.1970<br />
Im Gründken (La), Ratsbeschluss vom 1.7.1970<br />
Im Heimgarten (La)<br />
Im Höfchen (De)<br />
Im Loh (Str)<br />
Im Rottland (Ar)<br />
Im Schelk (Durchgangsstraße Ba, Fr), Ratsbeschluss vom 1.7.1970<br />
Im Stift (F)<br />
Im Sun<strong>der</strong>n (Ba), Ratsbeschluss vom 1.7.1970<br />
Im Wiesengrund (F)<br />
In den Telgen (F)<br />
In den Wächelten (F)<br />
In <strong>der</strong> Liethe (De)<br />
In <strong>der</strong> Twiete (Fr), Ratsbeschluss vom 1.7.1970<br />
In <strong>der</strong> Wahne (Ost), Ratsbeschluss vom 1.7.1970<br />
In <strong>der</strong> Waldemey (F)<br />
Irmgardstraße (F)<br />
Iserlohner Straße (Str)<br />
77
J<br />
Jägertal (F)<br />
Julius-Leber-Straße (F), Ratsbeschluss vom 18.6.1969<br />
K<br />
Kaiserstraße (Be), Ratsbeschluss vom 1.7.1970<br />
Kampstraße (Fr), Ratsbeschluss vom 1.7.1970<br />
Karl-Wildschütz-Straße (F)<br />
Karrenweg (St), Ratsbeschluss vom 1.7.1970<br />
Kassberg (Str)<br />
Kesseborn (Fr)<br />
Kessebürener Weg (Ost), Ratsbeschluss vom 1.7.1970<br />
Kirchplatz (F)<br />
Kirchweg (Ba), Ratsbeschluss vom 20.11.1970<br />
Kleibusch (Str), Ratsbeschluss vom 1.7.1970<br />
Klusenweg (F)<br />
Königsweg (Ne), Ratsbeschluss vom 20.11.1970<br />
Körnerstraße (F)<br />
Kuhstraße (Str)<br />
L<br />
Landstraße (Durchgangsstraße Fro, Wa, Be), Ratsbeschluss vom 1.7.1970<br />
Landwehr (Fr)<br />
Lehmke (Fro)<br />
Lerchenweg (F)<br />
Lessingstraße (F)<br />
Lindenhofstraße (Fr), Ratsbeschluss vom 20.11.1969<br />
Lindenweg (F)<br />
Löhnbachstraße (F)<br />
Ludwig-Steil-Straße (F), Ratsbeschluss vom 18.6.1969<br />
M<br />
Magdalenenstraße (F)<br />
Margueritenweg (F)<br />
Markt (F)<br />
Mauritiusstraße (F)<br />
Menricusstraße (F)<br />
Merschstraße (Durchgangsstraße Fro, Wa), Ratsbeschluss vom 1.7.1970,<br />
in Frohnhausen bereits bestehen<strong>der</strong> Name<br />
Mühlenbergstraße (F)<br />
Mühlenweg (Fr)<br />
Mutterkamp (Fr), Ratsbeschluss vom 1.7.1970<br />
N<br />
Nachtigallenweg (F), Ratsbeschluss vom 1.7.1970<br />
Natte (Str)<br />
Neimener Weg (Ne)<br />
Nelkenweg (F)<br />
Neuenkamp (Be), Ratsbeschluss vom 1.7.1970<br />
Nordstraße (F)<br />
O<br />
Ohlweg (De)<br />
Ölmühlenweg (Durchgangsstraße Wa, Be), Ratsbeschluss vom 1.7.1970<br />
Ostbürener Straße (Durchgangsstraße F, Ost), Ostbüren Ratsbeschluss vom 1.7.1970<br />
78
Ostfeld (Al), Ratsbeschluss vom 1.7.1970<br />
Ostholz (Ar), Ratsbeschluss vom 1.7.1970<br />
Ostmarkstraße (F)<br />
Otto-Wels-Straße (F), Ratsbeschluss vom 18.6.1969<br />
Overbergstraße (F)<br />
P<br />
Palzstraße (Durchgangsstraße Ba, St, Fro), Ratsbeschluss vom 1.7.1979<br />
Pappelallee (Al), Ratsbeschluss vom 1.7.1970<br />
Pastoratswald (Ba), Ratsbeschluss vom 1.7.1970<br />
Pater-Delp-Straße (F), Ratsbeschluss vom 18.6.1969<br />
Paul-Löbe-Straße (F), Ratsbeschluss vom 18.6.1969<br />
Poststraße (Ost), Ratsbeschluss vom 1.7.1970<br />
Priorsheide (Ba), Ratsbeschluss vom 1.7.1970<br />
Q<br />
Querweg (F)<br />
R<br />
Ringstraße (Al), Ratsbeschluss vom 1.7.1970<br />
Rosenweg (De)<br />
Ruhrblick (La)<br />
Ruhrstraße (F)<br />
Sch<br />
Schäferstraße (De)<br />
Schillerstraße (F)<br />
Schlehweg (F)<br />
Schlesierstraße (Ar)<br />
Schlotstraße (Wa), Ratsbeschluss vom 1.7.1970<br />
Schmiedestraße (Wa), Ratsbeschluss vom 1.7.1970<br />
Schörweken (De), Ratsbeschluss vom 1.7.1970<br />
Schröerstraße (F)<br />
Schulstraße (De)<br />
Schwalbenweg (F), Ratsbeschluss vom 1.7.1970<br />
Schwarzer Kamp (Ar)<br />
Schwerter Straße (Al), Ratsbeschluss vom 1.7.1970<br />
S<br />
Simonweg (Str)<br />
Sonnenbergstraße (La)<br />
Springstraße (F)<br />
Starenweg (F)<br />
Steinkuhle (Ba), Ratsbeschluss vom 1.7.1970<br />
Stentroper Weg (Durchgangsstraße St, Wa), Ratsbeschluss vom 1.7.1970<br />
Storchenweg (La), Ratsbeschluss vom 1.7.1970)<br />
Strickherdicker Weg (De)<br />
Südstraße (F)<br />
Sümbergstraße (F)<br />
Sybrechtplatz (Fr), Ratsbeschluss vom 1.7.1970<br />
T<br />
Talstraße (Ar), Ratsbeschluss vom 1.7.1970<br />
Tannengarten (St), Ratsbeschluss vom 1.7.1970<br />
Thabrauck (Durchgangsstraße Ar, Str), Ratsbeschluss vom 1.7.1970<br />
Tharloh (Fr), Ratsbeschluss vom 27.12.1968<br />
79
Tulpenweg (F)<br />
Tummelplatz (Fro)<br />
U<br />
Ulmenweg (F)<br />
Unnaer Straße (La, Str)<br />
Unionstraße (F), Ratsbeschluss vom 18.6.1969<br />
V<br />
Veilchenweg (F), Ratsbeschluss vom 1.7.1970<br />
Von-Galen-Straße (F), Ratsbeschluss vom 18.6.1969<br />
Von-Steinen-Straße (Fr)<br />
Von-Tirpitz-Straße (F)<br />
W<br />
Wachtelweg (F)<br />
Waldweg (Ost), Ratsbeschluss vom 1.7.1970<br />
Wasserwerkstraße (F)<br />
Weidenweg (De), Ratsbeschluss vom 1.7.1970<br />
Westfeld (Durchgangsstraße Ar, La), Ratsbeschluss vom 1.7.1970<br />
Westick (F)<br />
Westicker Heide (F)<br />
Westicker Straße (Durchgangsstraße F, Ne)<br />
Wibbeltstraße (De), Ratsbeschluss vom 1.7.1970<br />
Wicke<strong>der</strong> Straße (Durchgangsstraße Wa, Fro, Ne, Be), Ratsbeschluss vom 1.7.1970<br />
Wilhelm-Feuerhake-Straße (F)<br />
Wilhelm-Himmelmann-Platz (F)<br />
Wilhelmstraße (Ost), Ratsbeschluss vom 1.7.1970<br />
Windgatt (Be), Ratsbeschluss vom 1.7.1970<br />
Wulfesweide (Str), Ratsbeschluss vom 1.7.1970<br />
Z<br />
Zum Siepen (Ar)<br />
Zur Dorfwäsche (Ba), Ratsbeschluss vom 1.7.1970<br />
Zur Düke (Str), Ratsbeschluss vom 1.7.1970<br />
Zur Haar (La)<br />
Zur Mark (Ost), Ratsbeschluss vom 1.7.1970<br />
Zur Tigge (Wa), Ratsbeschluss vom 1.7.1970<br />
Zur Tränke (Ba), Ratsbeschluss vom 1.7.1970<br />
80
81<br />
Exkurs 5<br />
Straßenbenennungen und <strong>der</strong> deutsche Wi<strong>der</strong>stand<br />
<strong>Die</strong> Thematik <strong>der</strong> Benennung von Straßen im Neubaugebiet des westlichen Mühlenberges<br />
nach verschiedenen Vertretern und damit auch stellvertretend für die verschiedenen<br />
Ausrichtungen, Zielsetzungen Motiven des deutschen Wi<strong>der</strong>standes gegen das NS-Regime<br />
wurde bereits in Exkurs 4 gestreift, da es im Stadtrat zwischen <strong>der</strong> CDU- und <strong>der</strong> SPD-<br />
Fraktion verschiedene Ansichten gab, diese Straßen zu benennen.<br />
Der Vorschlag <strong>der</strong> CDU-Fraktion, die Straßen nach ostdeutschen Städtenamen 1 zu benennen,<br />
scheiterte zu Gunsten des SPD-Vorschlags.<br />
Trotzdem war man 1969, 24 Jahre nach Kriegsende noch vorsichtig und behutsam und fand<br />
einen Konsens, dem auch die CDU ihre Zustimmung nicht versagen konnte. Kein Vertreter<br />
des kommunistischen Wi<strong>der</strong>standes wurde berücksichtigt und zunächst auch kein Militär, <strong>der</strong><br />
Hauptattentäter Claus Graf Schenk von Stauffenberg wurde erst in <strong>der</strong> zweiten Phase <strong>der</strong><br />
Mühlenberg-Benennung 1972 berücksichtigt. Bürgerliche und kirchliche Vertreter des Wi<strong>der</strong>standes<br />
fanden Berücksichtigung.<br />
<strong>Die</strong>s macht deutlich, dass beson<strong>der</strong>s <strong>der</strong> militärische Wi<strong>der</strong>stand zu dieser Zeit noch nicht<br />
befreit war vom Geruch des „Vaterlandsverrates“ und erst recht <strong>der</strong> kommunistische<br />
Wi<strong>der</strong>stand durch die Realität des ideologischen Kalten Krieges zwischen Ost und West nicht<br />
nur keine Würdigung erfuhr, son<strong>der</strong>n schlichtweg nicht wahrgenommen wurde o<strong>der</strong> nicht<br />
wahrgenommen werden sollte.<br />
1969 (Ratssitzung vom 18.6.1969) wurden folgende Personen mit <strong>Straßennamen</strong> geehrt:<br />
Paul Löbe<br />
Julius Leber<br />
Otto Wels<br />
Carl Friedrich Goerdeler<br />
Clemens August Graf von Galen<br />
Pater Alfred Delp<br />
<strong>Die</strong>trich Bonhoeffer und<br />
Ludwig Steil<br />
1972 (Ratssitzung vom20.12.1972) wurden die nächsten fertig gestellten Straßen auf dem<br />
Mühlenberg nach folgenden weiteren Personen des Wi<strong>der</strong>standes benannt:<br />
Carlo Mierdendorf<br />
Sophie und Hans Scholl<br />
Kurt Schumacher und<br />
Claus Graf Schenk von Stauffenberg.<br />
1 Der Begriff „Ostdeutsche Städte“ muss im damaligen Kontext <strong>der</strong> Zeitgeschichte gesehen werden. Gemeint<br />
waren damit nicht Städte in „Mitteldeutschland“, des damals noch mit SBZ (Sowjetische Besatzungszone), o<strong>der</strong><br />
mit dem Namen <strong>der</strong> „sogenannten DDR“ bezeichneten Staatsgebietes <strong>der</strong> von <strong>der</strong> Bundesrepublik<br />
völkerrechtlich nicht anerkannten DDR gemeint, son<strong>der</strong>n Städte die in Pommern, Schlesien, Ostbrandenburg<br />
und Ostpreußen liegen; den gebieten die nach den Beschlüssen <strong>der</strong> Potsdamer Konferenz aus <strong>der</strong> Vier-Mächte-<br />
Verantwortung für Gesamtdeutschland herausgelöst worden waren und seitdem unter „polnischer o<strong>der</strong><br />
sowjetischer Verwaltung“ standen, bzw. realpolitisch dem polnischen Staat und dem Staatsgebiet <strong>der</strong> UDSSR<br />
zugeordnet wurden. Mit zunehmen<strong>der</strong> Anerkennung <strong>der</strong> realpolitischen Lage trat die Unterteilung des deutschen<br />
Staatsgebietes in den Grenzen von 1937 in West-, Mittel- und Ostdeutschland in den Hintergrund und spielte<br />
spätestens nach Abschluss <strong>der</strong> Warschauer und Moskauer Verträge 1972 nur noch eine Rolle im Wortschatz <strong>der</strong><br />
Vertriebenenfunktionäre. Somit ist, wenn heute von „Ostdeutschland“ die Rede ist, eindeutig das Gebiet <strong>der</strong><br />
ehemaligen DDR gemeint. Auch <strong>der</strong> Begriff „Ostgebiete“ für die genannten 1937 noch zum Deutschen Reich<br />
gehörenden Provinzen verschwindet langsam aus dem Bewusstsein <strong>der</strong> Bevölkerung, wenngleich auch für die<br />
jüngere Generation diese Regionen selber durchaus nicht ganz „entschwunden“ sind, son<strong>der</strong>n zunehmend als<br />
Reiseziele, Handelspartner und/o<strong>der</strong> ganz normale Bestandteile ihrer heutigen Staaten betrachtet werden.
82<br />
Keine Berücksichtigung fanden an<strong>der</strong>e ebenfalls vorgeschlagenen Persönlichkeiten:<br />
Adolf Reichwein<br />
Bernhard Lichtenberg<br />
Wilhelm Thews<br />
Nikolaus Groß<br />
Albrecht Haushofer<br />
Ulrich von Hassel<br />
Hans Oster<br />
Ernst von Harnack<br />
Paul Schnei<strong>der</strong> und<br />
Heinz Strelow<br />
Im Ganzen gesehen wurde eine repräsentative Auswahl getroffen, wenn man die neuen 1972<br />
hinzu gekommenen Straßen einrechnet; es bleibt jedoch das Fehlen <strong>der</strong> Würdigung des kommunistischen<br />
Wi<strong>der</strong>standes zu konstatieren.<br />
Lei<strong>der</strong> unberücksichtigt blieben natürlich auch die vielen Helfer und Helferinnen im Umfeld<br />
<strong>der</strong> verschiedensten Wi<strong>der</strong>standsgruppen, die unbekannt gebliebenen Helfer und Helferinnen<br />
untergetauchter jüdischer Familien und Einzelpersonen und die wegen Wehrkraftzersetzung<br />
hingerichteten Soldaten; auch diese müssen dem Wi<strong>der</strong>stand zugerechnet werden.<br />
<strong>Die</strong>ses Problem war auch <strong>der</strong> Bürgerinitiative „Mühlsteine e.V“ bewusst, die beson<strong>der</strong>s zu<br />
Beginn <strong>der</strong> 1980er Jahre eine große Stadtteilaktivität entwickelte, eine eigene Zeitschrift,<br />
„Mühlsteine“ herausgab und die große Mehrheit <strong>der</strong> Bewohner des Mühlenberges einzubeziehen<br />
vermochte in vielfältige kulturelle, infrastrukturelle und verkehrspolitische<br />
Belange, die speziell im Wohngebiet „Mühlenberg“ zur Lösung anstanden, war es doch das<br />
erste Mal, dass in Fröndenberg eine Art von „Sattelitenstadt“ mit ganz eigener Dynamik, aber<br />
auch ganz spezifischen Problemstellungen entstanden war, die teilweise auch heute noch nicht<br />
gelöst sind o<strong>der</strong> sich teilweise auch noch verschärft haben.<br />
Auslän<strong>der</strong>problematik, Jugendkriminalität, eine hohe Arbeitslosenquote stehen auf <strong>der</strong> Sollseite,<br />
aber dem gegenüber stehen Jugendprojekte, För<strong>der</strong>angebote, gelebte Auslän<strong>der</strong>integration<br />
und Seniorenbetreuung auf <strong>der</strong> Habenseite dieses Viertels und seiner Bewohner.<br />
Einen Höhepunkt <strong>der</strong> „Mühlstein-Aktivitäten“ bildete deshalb die Einweihung eines zentralen<br />
Denkmals für ALLE Opfer des NS-Regimes, sowohl des aktiven wie passiven Wi<strong>der</strong>standes<br />
wie auch generell für alle Opfer <strong>der</strong> NS-Diktatur. 1985, vierzig Jahre nach Kriegsende wurde<br />
eine Skulptur aus drei ineinan<strong>der</strong> verwobenen Mühlsteine eingeweiht, die symbolisch das<br />
„Zwischen die Mühlsteine geraten“ verkörpert und ein prinzipiell bedeutendes Kunst- und<br />
Mahnmal <strong>der</strong> Stadt sein könnte, lei<strong>der</strong> aber von großen teilen <strong>der</strong> Bevölkerung nicht<br />
akzeptiert und verstanden wurde, wozu auch die abseitige Lage weg vom Stadtzentrum eine<br />
Rolle spielen mag. Zentrale Kundgebungen, die zwar nach dem gut gemeinten Willen <strong>der</strong><br />
Veranstalter alle „Opfer von Krieg und Gewalt“ einbeziehen soll, finden wie eh und je am<br />
Kriegerehrenmal statt und verdeutlichen die Problematik <strong>der</strong> verschieden möglichen<br />
Sichtweise hinsichtlich „Opfern“ und „Tätern“ und die schwierige und kaum mögliche<br />
Zusammenführung des Erinnerns an gefallene Soldaten, ermordete Wi<strong>der</strong>standskämpfer, aus<br />
rassistischen Gründen Ermordete Menschen o<strong>der</strong> auf Flucht und Vertreibung ums Leben<br />
gekommene Personen.<br />
Trotz aller angeführten Schwierigkeiten, auch trotz des Ende <strong>der</strong> 1980er Jahre eingestellten<br />
Aktivitäten <strong>der</strong> Bürgerinitiative, war und ist <strong>der</strong> Gedanke an die wachzuhaltende Erinnerung<br />
an den deutschen Wi<strong>der</strong>stand gegen das NS-Regime durch die Vergabe von <strong>Straßennamen</strong> ein
83<br />
Erfolg, denn immer wie<strong>der</strong> geben die Namen einen Anstoß des Nachdenkens, einen<br />
willkommenen Anlass für Schulprojekte.<br />
Der Vorbehalt <strong>der</strong> CDU-Fraktion im Jahr 1969, keine <strong>Straßennamen</strong> mit „<strong>der</strong> Bevölkerung<br />
gänzlich unbekannte Personen“ zumuten zu wollen, ist hinsichtlich <strong>der</strong> tatsächlichen<br />
Unbekanntheit etwa eines Ludwig Steil o<strong>der</strong> eines Carlo Mierendorf zwar nicht von <strong>der</strong> Hand<br />
zu weisen, war jedoch im Ansatz aufklärungspädagogisch falsch, denn es war und ist doch<br />
gerade das Ziel dieser Benennung gewesen, damals noch o<strong>der</strong> heute wie<strong>der</strong> zu Unrecht in<br />
Vergessenheit geratene Menschen mit Vorbildfunktion bekannt und populär zu machen.<br />
1989 gab es noch einen interessanten Vorstoß einer 10. Klasse <strong>der</strong> Gesamtschule, einen bisher<br />
unbenannten Weg zwischen <strong>der</strong> „Paul-Löbe-Straße“ und dem alten Ziegeleigelände nach<br />
einem Vertreter des Jugendwi<strong>der</strong>standes gegen das NS-Regime zu benennen. <strong>Die</strong><br />
Jugendlichen dachten dabei an einen Vertreter <strong>der</strong> Kölner „Edelweißpiraten“, den im Alter<br />
von 16 Jahren gehängten Bartholomäus Schink.<br />
<strong>Die</strong> Anwohner des Weges, <strong>der</strong>en Häuser seit ihrem Bestehen <strong>der</strong> „Mühlenbergstraße“ zugeordnet<br />
waren, sprachen sich jedoch gegen eine Umbenennung aus wegen <strong>der</strong> damit<br />
verbundenen Kosten und Unannehmlichkeiten, zumal da <strong>der</strong> Name des Bartholomäus Schink<br />
gänzlich unbekannt sei. Auch mangels Interesse <strong>der</strong> Verwaltung und des (von einer SPD-<br />
Mehrheit getragenen) Rates wurde diesem Vorschlag genau das bereits 1969 von <strong>der</strong> CDU<br />
angeführten Arguments zum Verhängnis. Inzwischen war nämlich das in Kapitel H näher<br />
erläuterte Proce<strong>der</strong>e bei Straßenbe- und Umbenennungen in Kraft getreten, das eine<br />
unbedingte Beteiligung <strong>der</strong> Anwohner vorsieht. Ein basisdemokratisch orientiertes Vorgehen,<br />
aber trotzdem erst dann zu Ende gedacht, wenn alle Beteiligten sachinformiert ihre<br />
Entscheidung treffen würden und die Verwaltung nicht nur „verwaltend“ son<strong>der</strong>n mo<strong>der</strong>ierend<br />
in den Entscheidungsprozess eingreifen würde, bzw. hier eingegriffen hätte. Vielleicht<br />
wäre es dann zu einer die Jugendlichen weniger enttäuschenden Lösung gekommen.<br />
Ein Son<strong>der</strong>band <strong>der</strong> „Beiträge zur <strong>Fröndenberger</strong> Ortsgeschichte“ fasste 1991 nochmals alle<br />
Lebenswege <strong>der</strong> 13 mit einem <strong>Straßennamen</strong> geehrten Personen zusammen, verbunden mit<br />
einem Rückblick auf Entstehung und Sinn <strong>der</strong> „Mühlensteindenkmals“ aus dem Jahr 1985. 2<br />
Bis heute ist lei<strong>der</strong> die Person und damit auch <strong>der</strong> Name des einzigen bekannten Vertreter des<br />
Wi<strong>der</strong>standes, <strong>der</strong> in Fröndenberg geboren wurde, Wilhelm zur Nieden 3 nicht öffentlich mit<br />
einem <strong>Straßennamen</strong> o<strong>der</strong> einer Gedenktafel gewürdigt worden.<br />
Seinen Namen anstatt <strong>der</strong> Namen Hengstenberg o<strong>der</strong> v.Tirpitz geehrt zu sehen, wird wahrscheinlich<br />
in absehbarer Zeit kaum zu verwirklichen sein; eine Gedenktafel am Geburtshaus,<br />
dem ältesten Profangebäude <strong>der</strong> Stadt, zumal das gleiche Haus, in dem auch Hengstenberg<br />
geboren wurde und die jüdische Familie Bernstein bis zu ihrer Deportation lebte, ist ein zu<br />
verwirklichendes Ziel des Heimatvereins, das bisher aber noch scheitert an den Besitzverhältnissen<br />
des Hauses im Eigentum <strong>der</strong> Familie, die seinerzeit dafür sorgte, dass „Juden<br />
keineswegs in solch exponierter Lage wohnen und die arische Bevölkerungsmehrheit damit<br />
provozieren dürfe.“<br />
Somit ist es entschieden einfacher und unproblematischer, die gängigen Wi<strong>der</strong>standskämpfer,<br />
bekannt- aber auch weit genug entfernt vom örtlichen Geschehen, mit <strong>Straßennamen</strong> zu<br />
ehren. Erfreulich, dass wenigstens dies möglich war und so schnell (s.o.) kann keine Straße in<br />
Fröndenberg umbenannt werden, auch nicht die positiv besetzten <strong>Straßennamen</strong>; immerhin<br />
ein Trost<br />
2 Siehe dazu und zur Ratssitzung vom 18.06.1969 Presseartikel im Anhang 1 lfd. Nummer 19<br />
3 Der Jurist und Sohn eines <strong>Fröndenberger</strong> Pastors Wilhelm Zur Nieden gehörte zum Kreis um Karl Goerdeler,<br />
wurde im Zusammenhang mit den Ereignissen des 20. Juli 1944 verhaftet und kurz vor Kriegsende im Berliner<br />
Gefängnis an <strong>der</strong> Lehrter Straße erschossen.
84<br />
Exkurs 6<br />
Der „Storchenweg“ o<strong>der</strong> die Straßenbenennung im Spannungsfeld zwischen<br />
bürgerlicher Moral und bürgerschaftlichem Engagement.<br />
Zur Vorgeschichte: Am 2.11.1960 wurde in <strong>der</strong> Stadt Fröndenberg (spätere Kernstadt) eine<br />
Neubaustraße mit dem Namen „Drosselweg“ benannt.<br />
Zwischen 1963 und 1967 wurde in <strong>der</strong> amtsangehörigen Gemeinde Langschede (später<br />
Großgemeinde Langschede-Ardey-Dellwig) ein ganzes Straßengeviert nach Singvögeln benannt,<br />
so u.a. eine Straße als „Drosselstiege“.<br />
Zum 1.1.1968 wurde die 2neue“ Stadt Fröndenberg begründet und die ehemals amtsangehörigen<br />
Gemeinden als Stadtteile eines nunmehr gemeinsamen Stadtgebietes verloren ihre<br />
kommunalpolitische Selbständigkeit.<br />
Seit spätestens März 1968 bis Juli 1970 1 waren das Bauamt, verschiedene Ausschüsse und <strong>der</strong><br />
neugebildete Stadtrat u.a. damit beschäftigt nach Lösungen für doppelt o<strong>der</strong> ähnlich benannte<br />
Straßen zu suchen, um in Zukunft Verwechselungen für Polizei, Krankenwagen und Feuerwehr,<br />
Fehlsendung von Post etc. zu vermeiden.<br />
Ins Visier <strong>der</strong> Ausschüsse geriet auch die Ähnlichkeit zwischen „Drosselweg“ und „Drosselstiege“.<br />
Nach dem Grundsatz, diejenige Straße mit den wenigsten Anwohnern umzubenennen,<br />
wurde in Vorschlag gebracht, die in Langschede gelegene „Drosselstiege“ in „Storchenweg“<br />
umzubenennen. So wurde verfahren.<br />
Bereits die Umbenennung als solche rief den Unwillen <strong>der</strong> Anwohner hervor, war doch nach<br />
<strong>der</strong>en Meinung eine „Drosselstiege“ mit einem „Drosselweg“ nicht zu verwechseln.<br />
Richtiggehend erbost und empört aber waren die Anwohner, dass <strong>der</strong> ihrer Meinung nach<br />
diskriminierende Name „Storchenweg“ gewählt worden war; zu dieser Zeit Anfang <strong>der</strong><br />
1970er Jahre gerade auf dem noch nicht von <strong>der</strong> „Aufklärungswelle“ überschwemmten Land<br />
noch ganz eindeutig mit <strong>der</strong> Symbolik des „Kin<strong>der</strong>bringers“ behaftet, <strong>der</strong> den Familienzuwachs<br />
im Schnabel, diesen zu gegebener Zeit zur „Überraschung“ <strong>der</strong> älteren Geschwister<br />
vor <strong>der</strong> Haustüre abzulegen pflegte.<br />
So heißt es in einem Protestschreiben einer im „Storchenweg“ ansässigen Familie D. vom<br />
31.10.1970 u.a: 2 „Wir Einwohner <strong>der</strong> Drosselstiege möchten nicht (...) als allgemeine Belustigung<br />
dastehen (...)“. Hintergrund dieses Protestes war die Tatsache, dass in <strong>der</strong> ehemaligen<br />
„Drosselstiege“ immerhin 26 Kin<strong>der</strong> wohnten, u.a. die zehn Kin<strong>der</strong> <strong>der</strong> Familie D.<br />
Was Familie D. und die an<strong>der</strong>en betroffenen Familien nicht wussten und ansonsten noch viel<br />
mehr in Harnisch gebracht hätte, war ein Zusatz im Protokoll des Son<strong>der</strong>ausschusses <strong>der</strong><br />
Wegebau- und Friedhofskommission aus dem Jahr 1969, in dem es neben dem Vorschlag<br />
„Storchenweg“ wörtlich heißt: „...weil dort soviel kin<strong>der</strong>reiche Familien wohnen“<br />
Stadtdirektor Rebbert (SPD) beantwortete die Proteste <strong>der</strong> Anwohner in einem Brief vom<br />
13.11.1970 in dem es u.a. heißt: „Der Grund für die Auswahl <strong>der</strong> neuen Straßenbezeichnung<br />
hat mit <strong>der</strong> rein zufällig in <strong>der</strong> Drosselstiege wohnenden Kin<strong>der</strong>zahl nichts zu tun (...) und ich<br />
bin auch <strong>der</strong> Meinung, dass die Reaktion Außenstehen<strong>der</strong> nach einer gewissen Zeit verflachen<br />
wird, so dass Ihnen durch die gewählte Bezeichnung Nachteile nicht entstehen dürften“.<br />
Damit gaben sich jedoch die Anwohner keineswegs zufrieden, son<strong>der</strong>n wandten sich erneut<br />
am 28.1.1971 an die Stadt, dieses Mal direkt an die Adresse des Bürgermeisters, mit <strong>der</strong><br />
dringenden Bitte um Umbenennung, da es „doch so viele an<strong>der</strong>e Vögel gibt“!<br />
1 Siehe dazu ausführlich das vorangegangene Kapitel G <strong>der</strong> vorliegenden Arbeit<br />
2 Alle hier und im folgenden Text des Exkurses wie<strong>der</strong>gegebenen Zitate entstammen <strong>der</strong> Überlieferung in den<br />
Verwaltungsakten des Bauamtes <strong>der</strong> laufenden Verwaltung, die im Quellenverzeichnis unter Punkt C, Absatz<br />
d aufgeführt sind.
85<br />
Immerhin wurde über die Angelegenheit im Rat 3 am 23.2.1971 debattiert und <strong>der</strong> Antrag<br />
„von Familie D. und An<strong>der</strong>en“ zurückgewiesen.<br />
Zunächst im Ton leicht verstimmt, äußerte sich <strong>der</strong> Stadtdirektor am 4.3.1971 („Ihr Schreiben<br />
wurde mir zuständigkeitshalber zur weiteren Bearbeitung zugeleitet“) dahingehend, dass <strong>der</strong><br />
Bürgermeister selbst in geeigneter Weise sich <strong>der</strong> Sache angenommen habe und weiter<br />
sinngemäß, dass im Übrigen nach altdeutschem Volksglauben <strong>der</strong> Storch nicht nur Kin<strong>der</strong><br />
(bringt) son<strong>der</strong>n auch Glücksbringer und Beschützer vor Feuer und Blitzschlag sei.<br />
„So gesehen hoffe ich, dass auch Sie den Ratsbeschluss 4 nunmehr akzeptieren.“<br />
Abschließend heißt es dann triumphierend ohne jede Erläuterung des nachfolgenden abschließenden<br />
Satzes: „Im übrigen ist <strong>der</strong> Beschluss des Rates <strong>der</strong> Stadt Fröndenberg begründet<br />
in § 14 des Ordnungsbehördengesetzes in <strong>der</strong> Fassung vom 28.10.1969 in Verbindung<br />
mit § 2 <strong>der</strong> Gemeindeordnung in <strong>der</strong> Fassung vom 11.8.1969 und ich betrachte<br />
hiermit die Angelegenheit als erledigt.“ Soweit <strong>der</strong> Stadtdirektor in seiner Antwort.<br />
Was hatte nun <strong>der</strong> Bürgermeister Droste (SPD) „in geeigneter Weise“ zur Sache beigetragen?<br />
Einen offenen Brief, <strong>der</strong> in <strong>der</strong> Presse entwe<strong>der</strong> als Leserbrief o<strong>der</strong> Bestandteil eines dem<br />
Thema gewidmeten Artikels erschienen war. In seinem Beitrag bemerkt <strong>der</strong> Bürgermeister<br />
u.a.: „Der Gemein<strong>der</strong>at von Ubbedissen bei Bielefeld beschloss, die Straßen einer Neubausiedlung<br />
nach Vogelarten zu benennen. Ratsmitglied B (CDU) schlug vor, das ganze<br />
Vögelviertel Oswald-Kolle-Siedlung zu nennen, ohne allerdings näher zu erläutern, was <strong>der</strong><br />
bekannte Volksaufklärer mit Befie<strong>der</strong>ten zu tun hat“ Mit diesen und ähnlichen „Anmerkungen“<br />
hatte <strong>der</strong> Bürgermeister sicherlich in den nächsten Tagen und Wochen viele<br />
Lacher auf seiner Seite, diese mehr einer Büttenrede (die Debatte entspann sich sinnigerweise<br />
in <strong>der</strong> Karnevalszeit) gleichkommende Sichtweise <strong>der</strong> Dinge als „geeignete Weise“ zu<br />
interpretieren, wie es <strong>der</strong> Stadtdirektor in seinem Brief tat, dürfte den Bewohnern des<br />
„Storchenweges“ nicht ganz leicht gefallen sein.<br />
Wohl, um nicht noch mehr zum Gespött <strong>der</strong> Stadt zu werden und auch hilflos gegenüber den<br />
angegebenen und nicht einmal zitierten, geschweige denn erläuterten Paragraphen,<br />
verstummten die Anlieger, ohne jedoch ihren grundsätzlichen Groll deswegen begraben zu<br />
haben.<br />
Nicht unklug, wandten sie sich in <strong>der</strong> Folgezeit an den letzten ehemaligen Gemeindebürgermeister<br />
Langschedes, Haslinde (ebenfalls SPD), und brachten die Angelegenheit erneut<br />
im April 1974 (nach <strong>der</strong> Karnevalszeit) auf die Tagesordnung <strong>der</strong> <strong>Fröndenberger</strong> Ratsversammlung.<br />
In <strong>der</strong> Vorlage <strong>der</strong> Verwaltung an den Rat heißt es u.a.: „(...) wurde die<br />
Angelegenheit zunächst durch ein persönlich vom Stadtdirektor unterschriebenen Brief<br />
beigelegt. <strong>Die</strong>s ist aber offensichtlich nicht <strong>der</strong> Fall, denn, wie Herr Haslinde in einer Sitzung<br />
des Wegebau- und Friedhofsausschusses vorbrachte, haben sich die Anlieger bis heute noch<br />
nicht an diesen Namen gewöhnt und er wie die Anlieger würden eine Än<strong>der</strong>ung sehr<br />
begrüßen.“ Dessen ungeachtet schlug die Verwaltung aber eine erneute Ablehnung des<br />
Antrages vor, um einen Präzedenzfall und umfangreiche Verwaltungskosten zu vermeiden. In<br />
diesem Zusammenhang wird auf die Ablehnung des Rates im Fall <strong>der</strong> Anliegerproteste wegen<br />
<strong>der</strong> Umbenennung <strong>der</strong> Straße „Sonnenhang“ in „Wulfesweide“ in Ardey erinnert. 5<br />
Der von <strong>der</strong> SPD dominierte Stadtrat beschloss daraufhin, „auf Empfehlung des Wegebauund<br />
Friedhofsausschusses“ die Umbenennung von „Storchenweg“ in „Meisenweg“. Schließlich<br />
standen ja wie<strong>der</strong> die 1974er Kommunalwahlen vor <strong>der</strong> Tür...<br />
Das Beispiel zeigt, jenseits <strong>der</strong> heute eventuell als etwas moralinsauer empfundenen Empfindlichkeit<br />
<strong>der</strong> Anwohner des „Storchenwegs“ die zunächst unsensible Handhabung des Pro-<br />
3 Auf Veranlassung einer Vorlage durch die Verwaltung (also von Seiten des Stadtdirektors)<br />
4 Gemeint ist hier <strong>der</strong> Ratsbeschluss vom 23.2.1971 in dem es heißt: „Zur Vermeidung von Präzedenzfällen<br />
beschließt die Ratsversammlung: Auf Grund des § 14 des Ordnungsbehördengesetzes in Verbindung mit § 2<br />
<strong>der</strong> GO wird eine erneute Namensän<strong>der</strong>ung abgelehnt.<br />
5 Auf diesen Fall wird in kurzer Form im Hauptteil G <strong>der</strong> vorliegenden Arbeit eingegangen
86<br />
blems, das sicher noch höhere Wellen geschlagen hätte, wenn die o.a. Randbemerkung des<br />
Son<strong>der</strong>ausschusses in <strong>der</strong> Öffentlichkeit bekannt geworden wäre. Ob sie es dem Stadtdirektor<br />
war und damit dessen Scheinheiligkeit in seinem ersten Antwortschreiben offenbaren würde,<br />
geht aus <strong>der</strong> Aktenüberlieferung und den seinerzeitigen Zeitungsberichten nicht hervor.<br />
Den „übrigen“ ca. 19.000 Bewohnern gab Bürgermeister Droste mit seinem offenen Brief<br />
sicher etwas zu lachen, in <strong>der</strong> heutigen Zeit des „Political Correctness“ könnte dessen<br />
Beispielfindung ein Grund für eine Beleidigungsklage abgeben.<br />
Als „Typisch bürokratisch“ und „von oben herab“ ist jedoch noch viel negativer die<br />
kommentar- und erläuterungslose Zitierung <strong>der</strong> Paragraphen im zweiten Brief des Stadtdirektors<br />
zu bewerten, beson<strong>der</strong>s bei <strong>der</strong> aufmerksamen Betrachtung <strong>der</strong> Briefe <strong>der</strong><br />
Betroffenen. Aus <strong>der</strong>en Stil, Grammatik wie Rechtschreibung ist eindeutig zu erkennen, dass<br />
es sich hier um Bürger mit einem niedrigen Schulabschluss handelte, denen angesichts <strong>der</strong><br />
Konfrontation mit Paragraphennennungen keineswegs geholfen war, was wohl auch gar nicht<br />
im Sinne des Stadtdirektors gelegen haben mag, dem es darum gegangen sein dürfte, die nach<br />
seiner Ansicht unsinnige und lästige Debatte ad Acta zu legen.<br />
Der Betrachter von heute freut sich, um beim Thema <strong>der</strong> Vogelnamen zu bleiben, wie eine<br />
„diebische Elster“, dass letzten Endes die Anwohner doch noch zu ihrer Umbenennung<br />
kamen, allerdings wie<strong>der</strong> ohne <strong>der</strong>en Einbeziehung in den Entscheidungsprozess, denn sie<br />
erfuhren vom Erfolg ihrer Bemühungen und beson<strong>der</strong>s vom letztendlich gewählten Namen<br />
erst aus <strong>der</strong> Zeitung. Ob sie sich wohl überlegt haben, dass Meisen im Volksmund keine überragende<br />
Intelligenz zugewiesen wird analog des Sprichwortes „Du hast ja wohl eine Meise?“<br />
ist nicht überliefert. Eine erneute Debatte jedenfalls blieb aus und die Umbenennung war <strong>der</strong><br />
Tagespresse nicht mal mehr eine Meldung wert. Den Stadtdirektor wird´s gefreut haben. 6<br />
6 Eine ausgewählte Sammlung von Zeitungsberichten zum Thema „Storchenweg“ siehe Anlage 1 lfd. Nr. 22
87<br />
H. Straßenbenennungen in <strong>der</strong> Kernstadt Fröndenberg 1971-2004<br />
(incl. Wohnplatz Hohenheide)<br />
Nachdem die Um- und Neubenennungen im Zuge <strong>der</strong> kommunalen Neuordnung zum Januar<br />
1971 in Kraft getreten waren 1 , dauerte es bis Dezember des folgenden Jahres, ehe wie<strong>der</strong><br />
Bewegung in die <strong>Straßennamen</strong>gebung kam.<br />
Der zweite Ausbauabschnitt <strong>der</strong> Paul-Löbe-Siedlung auf dem Mühlenberg stand zur Namensvergabe<br />
an, sowie die Benennung <strong>der</strong> zunächst letzten beiden Neubaustraßen im Baugebiet<br />
Freisenhagen, womit dieses letztgenannte Projekt einer geschlossenen Wohnbebauung, dessen<br />
Planung bis in die Zeit <strong>der</strong> dreißiger Jahre zurückreichte, zu einem Abschluss kam.<br />
Auf dem Mühlenberg wurden wie bereits für den ersten Bauabschnitt Namensträger aus dem<br />
Kreis <strong>der</strong> Wi<strong>der</strong>standskämpfer gegen den Nationalsozialismus ausgewählt.<br />
Carlo Mierendorf, die Geschwister Hans und Sophie Scholl, Kurt Schumacher und Claus<br />
Schenk Graf von Stauffenberg wurden hierdurch posthum geehrte; im August 1984 wurde die<br />
Paul-Löbe-Siedlung mit <strong>der</strong> Bebauung <strong>der</strong> „Karl-Goerdeler-Straße“ abgeschlossen.<br />
Im Baugebiet Freisenhagen wurde dieser Gemarkungsname selber als Straßenname „Zum<br />
Freisenhagen“ ausgewählt und die umliegende Benennung nach Bäumen mit dem „Kiefernweg“<br />
vervollständigt.<br />
1974 wurden die Straßen in einem Neubaugebiet auf <strong>der</strong> Hohenheide östlich und westlich <strong>der</strong><br />
Durchgangsstraße nach naturkundlichen Gesichtspunkten benannt 2 und damit den Wünschen<br />
<strong>der</strong> Anlieger entsprochen. Mit „Brandheide“, „Dachsleite“, „Hasensprung“, „In <strong>der</strong><br />
Sasse“ und „Löhnquelle“ wurden diese neuen Straßen benannt.<br />
Im November 1976 wurde mit dem „Fasanenweg“ eine zweite Zuwegung zum bereits<br />
fertiggestellten Wohngebiet auf <strong>der</strong> Westicker Heide unterhalb <strong>der</strong> Gemarkung „Wächelten“<br />
geschaffen.<br />
Zwischen 1978 und 1986 entstand auf Westicker (und damit <strong>Fröndenberger</strong>) sowie Neimener<br />
und Frohnhauser Gemarkungen im Osten <strong>der</strong> Kernstadt zwischen Ruhr und Eisenbahn ein<br />
Gewerbegebiet, dessen Straßen nach Vertretern <strong>der</strong> Technik- und Industriegeschichte benannt<br />
wurden. Der ermordete Arbeitgeberpräsident Hanns Martin Schleyer, <strong>der</strong> Industriegrün<strong>der</strong><br />
Werner von Siemens und <strong>der</strong> Pionier <strong>der</strong> Raketentechnik Wernher von Braun 3 waren die<br />
ersten Geehrten, 1982 folgte <strong>der</strong> Erfin<strong>der</strong> Rudolf <strong>Die</strong>sel und 1986 auf Antrag <strong>der</strong> CDU-<br />
Fraktion im Stadtrat <strong>der</strong> Gewerkschaftler Hans Böckler. 4<br />
Im Frühjahr 1981 erhielt eine Anliegerstraße im Bereich <strong>der</strong> alten <strong>Fröndenberger</strong> Kernstadt<br />
den Namen „Schürmanns Kamp“, eine bei den Anliegern nicht unbedingt wegen des Namens,<br />
son<strong>der</strong>n <strong>der</strong> verwaltungsseitigen Vorgehensweise umstrittene Entscheidung, die für<br />
einigen Wirbel sorgte. <strong>Die</strong> Straße war in finanzieller Eigenleistung durch die Anwohner gebaut<br />
worden, die nun auch ein Mitspracherecht bei <strong>der</strong> Benennung beanspruchten.<br />
<strong>Die</strong> vorgenommene Benennung wurde zurückgenommen, dann aber mit Datum 14.7.1982<br />
endgültig festgelegt. Von den Anwohnern waren die Vorschläge Buschweg, Am Hang, Haselberg<br />
und Fischers Kamp eingebracht worden.<br />
1 Verabschiedung im Rat per 1.7.1970; während <strong>der</strong> Umbenennungsphase 1968-1970 sind lediglich per<br />
Ratsbeschluss vom 18.6.1969 die Straßen des ersten Ausbauabschnitts <strong>der</strong> Paul-Löbe-Siedlung auf dem<br />
Mühlenberg nach Wi<strong>der</strong>standskämpfern gegen das NS-Regime benannt worden, siehe dazu ggf. Exkurs 5 <strong>der</strong><br />
vorliegenden Arbeit.<br />
2 Siehe dazu auch Exkurs 4 <strong>der</strong> vorliegenden Arbeit<br />
3 <strong>Die</strong>s geschah ungeachtet seiner umstrittenen Rolle bei <strong>der</strong> Entwicklung <strong>der</strong> deutschen „V-Waffen“, bei <strong>der</strong>en<br />
unterirdischer Produktion Tausende von Zwangsarbeitern und KZ-Gefangenen zu Tode kamen. Geehrt wurde<br />
hier die „zweite Biographie“ des 1977 verstorbenen Ingenieurs und Cheftechniker <strong>der</strong> NASA, „Vater <strong>der</strong><br />
Apollo-Rakete“, mit <strong>der</strong>en Hilfe den US-Amerikanern erstmals die Landung von Menschen auf dem Mond<br />
gelang. Mit 18 zu 16 Stimmen bei einer Enthaltung fiel die Entscheidung zugunsten von Brauns sehr knapp<br />
aus.<br />
4 Siehe dazu Kopie des Antrages im Anhang 1 lfd. Nr. 20
88<br />
Im Herbst 1981 wurden <strong>der</strong> katholische Sozialreformer Emanuel Ketteler und <strong>der</strong> „Vater <strong>der</strong><br />
katholischen Gesellenbewegung“ Adolph Kolping mit <strong>Straßennamen</strong> im Baugebiet Untere<br />
Westicker Heide gegenüber des Friedhofs geehrt.<br />
In diesem Zusammenhang ergingen zwei wichtige Beschlüsse des Wegebau- und<br />
Verkehrsausschusses (Nachfolger des Wegebau- und Friedhofsausschuss) vom 18.8.1981 und<br />
vom Beschwerdeausschuss datiert mit dem 25.5.1982.<br />
Übereinstimmend heißt es hier sinngemäß:<br />
„<strong>Die</strong> Bürger sind vor einer endgültigen Benennung von Straßen zu befragen, was auch für<br />
Umbenennungen bereits vorhandener Straßen zu gelten hat“<br />
Mitte <strong>der</strong> 1980er Jahre ging die Innenstadtsanierung mit <strong>der</strong> Aussiedlung <strong>der</strong> dort ansässigen<br />
Industriefirmen und anschließen<strong>der</strong> Geschäfts- und Wohnhausbebauung ihrem Ende entgegen.<br />
Bei dieser Gelegenheit wurden die Straßenführung „Im Stift“ und westlich angrenzen<strong>der</strong><br />
Flächen neu geordnet. Der „Wilhelm-Himmelmann-Platz“ wurde entwidmet und die beiden<br />
Städtepartnerschaften nach Frankreich und Holland mit den <strong>Straßennamen</strong> „Bruayplatz“<br />
(1989 zum 25.Jubiläumsjahr <strong>der</strong> Städtepartnerschaft) und „Winschotener Straße“ (1986)<br />
hervorgehoben.<br />
In diesem Bereich wäre noch Raum gewesen, einen weiteren <strong>Straßennamen</strong> zu vergeben;<br />
entsprechend reichte <strong>der</strong> stellv. Bürgermeister Josef Schmidt den Antrag ein, eine Straße nach<br />
dem beson<strong>der</strong>s hinsichtlich <strong>der</strong> Städtepartnerschaften verdienten Altbürgermeister Hubert<br />
Schmidt 5 zu benennen. <strong>Die</strong>ser Antrag wurde aber lei<strong>der</strong> (aus historiographischer Sicht) abgelehnt<br />
und die Wegefläche <strong>der</strong> vorhandenen Berg- und Friedrich-Feuerhake-Straße zugeordnet.<br />
<strong>Die</strong> Begründung einer Ehrung des Alt-Bürgermeisters allerdings wurde anerkannt und „sollte<br />
demnächst bei Gelegenheit berücksichtigt werden“, d.h. <strong>der</strong> Vorschlag landete in <strong>der</strong> Schublade.<br />
1983 und 1985 entstanden zwei weiteren Wohnstraßen im Wohngebiet Hohenheide, die<br />
Straßen „Am Hahnebusch“ und „Vogelrute“. Ein bisher namenloser Verbindungsweg ohne<br />
Wohnbebauung zwischen <strong>der</strong> Eulenstraße in Höhe des Hofgutes Veuhof und <strong>der</strong> Ostbürener<br />
Straße in Richtung Hohenheide erhielt im April 1988 den Namen „Schwarzer Weg“.<br />
Für die 1990er Jahre sind lediglich drei Benennungen zu verzeichnen. „Rehwinkel“ und<br />
„Fuchskaute“ auf <strong>der</strong> Hohenheide und im Innenstadtbereich die neue Verbindungsstraße<br />
zwischen <strong>der</strong> Ruhrbrücke und <strong>der</strong> v.Tirpitz-Straße, die als „Mendener Straße“ in Form eines<br />
Rampenbauwerks und Brücke ohne Wohnbebauung im Zuge <strong>der</strong> Stadtkernsanierung das<br />
Bahnhofsgelände überbrückt und damit den ehemaligen Bahnübergang Ruhrstraße überflüssig<br />
macht. Seit ihrer Fertigstellung und dem Ausbau <strong>der</strong> „Unionstraße“ konnte <strong>der</strong> Bereich Markt<br />
als verkehrsberuhigte Zone neu gestaltet werden und dient dem Autoverkehr nur noch den<br />
Anliegern und dem Parksuchverkehr als Verkehrsfläche.<br />
Mitte <strong>der</strong> 1990er Jahre kam nochmals Bewegung in die Frage <strong>der</strong> Daseinsberechtigung <strong>der</strong><br />
„Von-Tirpitz-Straße“ und <strong>der</strong> „Ostmarkstraße“. Seitens <strong>der</strong> FDP-Fraktion und des Ehepaars<br />
Roemheld; Frau Dr. Roemheld war zu dieser Zeit Vorsitzende <strong>der</strong> Freien Wählergemeinschaft<br />
und für kurze Zeit stellvertretende Bürgermeisterin wurden „entpolitisierende“<br />
Vorschläge unterbreitet, wie z.B. „Äbtissinnensteige“ als Ersatz für den Flottenadmiral o<strong>der</strong><br />
Namen von Alt-Bundespräsidenten. 6<br />
Obwohl <strong>der</strong> Rat eventuellen Än<strong>der</strong>ungen gegenüber aufgeschlossen reagierte, wandten sich<br />
nahezu alle befragten Anlieger (geregelt durch die o.a. Beschlussfassung <strong>der</strong> Ausschüsse,<br />
nach <strong>der</strong> alle Anlieger schriftlich zu befragen waren) vehement gegen eine Umbenennung<br />
„ihrer“ Straßen, zum Teil mit aus heutiger Sicht nahezu unfassbaren nationalistischen Begründungen<br />
und Geschichtsverdrehungen, die teilweise auch in beleidigen<strong>der</strong> Art und Weise<br />
die Initiatoren angriffen, die als Nestbeschmutzer und Ruhestörer beschimpft wurden.<br />
5 Beide „Schmidts“ gehör(t)en zwar <strong>der</strong> gleichen Partei an, sind aber nicht miteinan<strong>der</strong> verwandt!<br />
6 Siehe dazu Kopien eines Anschreiben und einer Beschlussvorlage im Anhang 1 lfd. Nr. 21
89<br />
Ein zeitgeschichtlicher Zusammenhang <strong>der</strong> Benennung <strong>der</strong> Ostmarkstraße mit dem Anschluss<br />
Österreichs 1938 wurde in seitenlangen Abhandlungen rundweg bestritten und die „Würde<br />
<strong>der</strong> Ostmark“ schriftlich bis in das frühe Mittelalter dargelegt und verteidigt.<br />
Damit scheiterte <strong>der</strong> bislang letzte Versuch, die Versäumnisse <strong>der</strong> Gemein<strong>der</strong>äte aus dem Jahr<br />
1945 und 1946 nachzuholen, bzw. die Entscheidungen des nationalsozialistisch geprägten Gemein<strong>der</strong>ates<br />
vom Juni 1933 (v.Tirpitz) und vom August 1938 (Ostmark) zu revidieren.<br />
Vom Oktober 1994 bis zum 31.12.2004 wurde im Kernstadtbereich einschließlich Hohenheide<br />
nur noch zwei Straßen neu gebaut, bzw. ausgebaut und benannt.<br />
<strong>Die</strong> „Von-Nell-Breuning-Straße“ im Juni 2001 nach dem katholischen Sozialreformer<br />
Oswald von Nell-Breuning als Zubringerstraße für das Gelände des Altenwohnzentrums<br />
„Schmallenbachhaus“ auf dem Hirschberg und die Straße „Fingers Kamp“ auf <strong>der</strong> Hohenheide<br />
im März 2000.<br />
<strong>Die</strong> geringe Zahl neu gebauter und benannter Straßen ab den 1980er Jahren macht den<br />
Strukturwandel <strong>der</strong> Stadt deutlich, <strong>der</strong> bereits im Kapitel A4 <strong>der</strong> vorliegenden Arbeit angedeutet<br />
ist. In den umliegenden Stadtteilen wie <strong>der</strong> ehemaligen Großgemeinde Langschede mit<br />
Langschede, Dellwig und Ardey o<strong>der</strong> auch im Stadtteil Frömern hingegen wurden im<br />
gleichen Zeitraum relativ viele private Bauvorhaben durchgeführt und neue <strong>Straßennamen</strong><br />
kamen hinzu, was im folgenden Kapitel J deutlich wird.<br />
31 neue <strong>Straßennamen</strong> wurden im Bereich <strong>der</strong> Kernstadt 1971-2004 neu vergeben. Eine<br />
Straße, <strong>der</strong> Wilhelm-Himelmann-Platz, wurde eingezogen; Umbenennungen gab es im hier<br />
bearbeiteten Zeitraum nicht.<br />
Nachfolgend eine Auflistung aller zwischen 1971 und 2001 neu benannten Straßen nach Datum<br />
ihrer Benennung sortiert und daran anschließend ein sich daraus ergebendes Verzeichnis<br />
aller <strong>der</strong>zeitig mit Stand 31.12.2004 vorhandenen <strong>Straßennamen</strong> im Kernstadtbereich einschließlich<br />
Hohenheide; ein Verzeichnis, das amtlicherseits nicht (mehr) erstellt worden ist,<br />
da ab 1971 nur noch kernstadtübergreifende Straßenverzeichnisse erstellt wurden, die alle<br />
Stadtteile zusammenfassen.<br />
20.12.1972 Carlo-Mierendorf-Straße<br />
20.12.1972 Geschwister-Scholl-Straße<br />
20.12.1972 Kurt-Schumacher-Straße<br />
20.12.1972 Von-Stauffenberg-Straße<br />
20.12.1972 Kiefernweg<br />
20.12.1972 Zum Freisenhagen<br />
05.06.1974 Brandheide, Wohngebiet Hohenheide<br />
05.06.1974 Dachsleite, Wohngebiet Hohenheide<br />
05.06.1974 Hasensprung, Wohngebiet Hohenheide<br />
05.06.1974 In <strong>der</strong> Sasse, Wohngebiet Hohenheide<br />
05.06.1974 Löhnquelle<br />
10.11.1976 Fasanenweg<br />
04.10.1978 Hanns-Martin-Schleyer-Straße<br />
04.10.1978 Werner-von-Siemens-Straße<br />
04.10.1978 Wernher-von-Braun-Straße<br />
18.03.1981 Schürmanns Kamp<br />
09.12.1981 Ketteler-Straße<br />
09.12.1981 Kolpingstraße<br />
14.07.1982 Rudolf-<strong>Die</strong>sel-Straße<br />
13.04.1983 Vogelrute, Wohngebiet Hohenheide<br />
29.08.1984 Karl-Goerdeler-Straße
90<br />
20.08.1985 Am Hahnenbusch, Wohngebiet Hohenheide<br />
05.06.1986 Winschotener Straße<br />
20.10.1986 Hans-Böckler-Straße<br />
30.06.1988 Schwarzer Weg<br />
02.09.1989 Bruayplatz<br />
13.05.1993 Mendener Straße<br />
08.09.1994 Fuchskaute, Wohngebiet Hohenheide<br />
08.09.1994 Rehwinkel, Wohngebiet Hohenheide<br />
04.03.2000 Fingers Kamp, Wohngebiet Hohenheide<br />
12.06.2001 Von-Nell-Breuning-Straße<br />
Verzeichnis aller mit Stand 31.12.2004 vorhandenen <strong>Straßennamen</strong> im Kernstadtbereich<br />
Fröndenberg einschließlich Hohenheide<br />
A<br />
Ahornweg<br />
Akazienweg<br />
Alleestraße<br />
Am Hahnenbusch<br />
Am Klingelbach<br />
Am Sachsenwald<br />
Am Steinbruch<br />
Annette-von-Droste-Hülshoff-Straße<br />
Ardeyer Straße<br />
Asternweg<br />
Auf dem Krittenschlag<br />
Auf dem Sodenkamp<br />
Auf <strong>der</strong> Freiheit<br />
B<br />
Bahnhofstraße<br />
Bergstraße<br />
Bertholdusstraße<br />
Birkenweg<br />
Bismarckstraße<br />
Blumenstraße<br />
Bonhoefferstraße<br />
Brandheide<br />
Bruayplatz<br />
C<br />
Carlo-Mierdendorf-Straße<br />
D<br />
Dachsleite<br />
Dahlienweg<br />
Drosselweg<br />
E<br />
Elsternweg<br />
Eberhardstraße<br />
Engelbertstraße<br />
Eulenstraße
F<br />
Fasanenweg<br />
Fichtenweg<br />
Fingers Kamp<br />
Fischerssiepen<br />
Flie<strong>der</strong>weg<br />
Freiheitstrasse<br />
Friedhofstraße<br />
Friedrich-Bering-Straße<br />
Fuchskaute, Hohenheide<br />
G<br />
Geschwister-Scholl-Straße<br />
Gladiolenweg<br />
Goethestraße<br />
Graf-Adolf-Straße<br />
Grüner Weg<br />
H<br />
Hanns-Martin-Schleyer-Straße<br />
Hans-Böckler-Straße<br />
Hardenbergstraße<br />
Hasensprung<br />
Haßleistrasse<br />
Hengstenbergstraße<br />
Hermann-Löns-Straße<br />
(Am ) Hirschberg<br />
Hohenheide<br />
I<br />
Im Stift<br />
Im Wiesengrund<br />
In den Telgen<br />
In den Wächelten<br />
In <strong>der</strong> Sasse<br />
In <strong>der</strong> Waldemey<br />
Irmgardstraße<br />
J<br />
Jägertal<br />
Julius-Leber-Straße<br />
K<br />
Karl-Goerdeler-Straße<br />
Karl-Wildschütz-Straße<br />
Kettelerstraße<br />
Kiefernweg<br />
Kirchplatz<br />
Klusenweg<br />
Kolpingstraße<br />
Körnerstraße<br />
Kurt-Schumacher-Straße<br />
L<br />
Lerchenweg<br />
Lessingstraße<br />
91
Lindenweg<br />
Löhnbachstraße<br />
Löhnquelle<br />
Ludwig-Steil-Straße<br />
M<br />
Magdalenenstraße<br />
Margueritenweg<br />
Markt<br />
Mauritiusstraße<br />
Mendener Straße<br />
Menricusstraße<br />
Mühlenbergstraße<br />
N<br />
Nachtigallenweg<br />
Nelkenweg<br />
Nordstraße<br />
O<br />
Ostbürener Straße<br />
Ostmarkstraße<br />
Otto-Wels-Straße<br />
Overbergstraße<br />
P<br />
Pastor-Delp-Straße<br />
Paul-Löbe-Straße<br />
Q<br />
Querweg<br />
R<br />
Rehwinkel<br />
Rudolf-<strong>Die</strong>sel-Straße<br />
Ruhrstraße<br />
S, Sch<br />
Schillerstraße<br />
Schlehweg<br />
Schröerstraße<br />
Schürmanns Kamp<br />
Schwalbenweg<br />
Schwarzer Weg<br />
Springstraße<br />
Starenweg<br />
Südstraße<br />
Sümbergstraße<br />
T, U, V<br />
Tulpenweg<br />
Ulmenweg<br />
Unionstraße<br />
Veilchenweg<br />
Vogelrute<br />
Von-Galen-Straße<br />
Von-Nell-Breuning-Straße<br />
Von-Stauffenberg-Straße<br />
92
Von-Tirpitz-Straße<br />
W<br />
Wachtelweg<br />
Wasserwerkstraße<br />
Werner-von-Siemens-Straße<br />
Wernher-von-Braun-Straße<br />
Westick<br />
Westicker Heide<br />
Westicker Straße<br />
Wilhelm-Feuerhake-Straße<br />
Winschotener Straße<br />
Z<br />
Zum Freisenhagen<br />
93
94<br />
I. <strong>Geschichte</strong> <strong>der</strong> <strong>Straßennamen</strong> in den Stadtteilen ab 1971 (ohne Kernstadt)<br />
Ausgehend von <strong>der</strong> Basis <strong>der</strong> das Kapitel G abschließenden <strong>Straßennamen</strong>liste verlief die<br />
weitere Entwicklung in den Stadtteilen wie folgt in chronologischer Reihenfolge:<br />
Auf dem Brennen (Wa) 20.12.1972<br />
Meisenweg (La) 05.06.74 (Umbenennung des „Storchenweg“)<br />
Am Graben (Ost) 05.06.1974<br />
Am Versstück (Ar) 05.06.1974<br />
Am Baumgarten (Ost) 19.07.1974 (Umbenennung <strong>der</strong> Straße „Am Graben“)<br />
Kornweg (Fr) 19.07.1974<br />
Herdicker Kamp (Str) 18.02.1976<br />
Am Haarstrang (Fr) 12.12.1979<br />
Hinter den Kämpen (Fr) 12.12.1979<br />
Bauerngarten (Ar) 15.07.1981<br />
Nie<strong>der</strong>heide (Ar) 15.07.1981<br />
Auf <strong>der</strong> Hege (Fr) 15.12.1982<br />
Willi-Kettmann-Straße (Fr) 20.10.1982<br />
Goldbreite (Ar) 09.02.1989<br />
Dörssiepen (De) 11.05.1989<br />
Neimener Kirchweg (Ne) 08.11.1990<br />
Graf-Ezzo-Weg (Ba) 04.07.1991<br />
Am Rodbusch (Ost) 22.02.1995<br />
Kirschbaumliethe (De) 02.09.1998 (gegen den Vorschlag aus dem Stadtteil, die Straße nach<br />
den Lehrern und Heimatforschern Karl Wimpelberg<br />
o<strong>der</strong> Alfred Reichenbach zu benennen)<br />
Gerstenkamp (Fr) 09.06.1999<br />
Weißes Feld (Fr) 09.06.1999<br />
Auf <strong>der</strong> Linde (Str) 07.12.1999<br />
Roggenweg (Fr) 22.08.2000<br />
Am Walnussbaum (Ba) 12.06.2001<br />
Penningheuers Kamp (De) 12.06.2001<br />
Prozessionsweg (Ba) 30.09.2002<br />
Bahnhofsallee (La) 04.02.2003<br />
Somit wurden innerhalb von 34 Jahren in den Stadtteilen außerhalb <strong>der</strong> Kernstadt 27 neue<br />
<strong>Straßennamen</strong> vergeben; durch Umbenennung fiel ein Name aus dieser Auflistung wie<strong>der</strong><br />
weg (Am Graben) und ein Name, <strong>der</strong> bereits 1970 vergeben wurde (Storchenweg), wurde<br />
durch einen neuen Namen (Meisenweg) ersetzt.<br />
8 Neubenennungen entfielen auf den Stadtteil Frömern, 4 auf Ardey und je 3 auf Bausenhagen<br />
und Dellwig. Je 2 Neubenennungen fielen auf Langschede, Strickherdicke und<br />
Ostbüren (ohne Berücksichtigung <strong>der</strong> Straße „Am Graben“) und je 1 Name auf Neimen und<br />
Warmen. Von 1971 bis 2004 wurden in Bentrop, Altendorf, Frohnhausen und Stentrop keine<br />
neuen <strong>Straßennamen</strong> vergeben.<br />
Überwiegend wurden Flur- und Gemarkungsnahmen verwendet, lediglich in Bausenhagen<br />
wurde namentlich und personenbezogen an die sehr alte <strong>Geschichte</strong> des Stadtteils erinnert<br />
(Graf-Ezzo-Weg) und in Frömern wurde des verstorbenen Altbürgermeisters Willi Kettmann<br />
gedacht.<br />
In Langschede wurde an die Tradition des in den 1980er Jahren geschlossenen Bahnhofs<br />
angeknüpft; verbunden mit <strong>der</strong> bisher nicht eingelösten Hoffnung, hier wie<strong>der</strong> einen Haltepunkt<br />
<strong>der</strong> Bahn zu bekommen und auch eine Verbeugung vor dem finanziellen Kraftakt des
95<br />
Investors und <strong>der</strong> architektonischen Sorgfalt im Umgang mit einem denkmalgeschützen<br />
Gebäude. Durch diese Bemühungen wurde das wertvolle Bahnhofsgebäude aus den 1880er<br />
Jahren vor dem endgültigen Verfall gerettet.<br />
Einige weitere Neubenennungen schlossen im Prinzip nur Lücken im Netz <strong>der</strong> übrigen bereits<br />
benannten Straßen und Wege (Neimener Kirchweg o<strong>der</strong> Prozessionsweg, beide ohne<br />
Benauung), an<strong>der</strong>e Straßen sind Zuwegungen zu Ein- o<strong>der</strong> Zweifamilienhäusern in Dorfrandlagen<br />
und Neubaugebieten. Größere Baugebiete, wie etwa in <strong>der</strong> Kernstadt <strong>der</strong> Mühlenberg<br />
mit seiner mehrgeschossigen Bauweise wurden seit 1971 nicht mehr erschlossen.<br />
Entsprechend <strong>der</strong> rückläufigen Zahl an Arbeitsplätzen ging auch die Neubebauung zurück.<br />
Lediglich in einigen Stadtteilen wie Frömern (bis heute) und Ardey (bis Ende <strong>der</strong> 1980er<br />
Jahre) kam es zu nennenswerten Neubebauungen.
96<br />
J. Anmerkungen zu <strong>Straßennamen</strong>gruppen in <strong>der</strong> Stadt Fröndenberg und<br />
zu einzelnen Personen aus <strong>der</strong> Ortshistorie nach denen Straßen benannt<br />
wurden<br />
Seit dem es auch auf dem „platten Lande“ und nicht nur in den historischen Städten und den<br />
industriellen Ballungsräumen seit Beginn des 20. Jahrhun<strong>der</strong>ts Fluchtlinien- und<br />
Bebauungspläne gibt, entstanden zusammenhängende Wohnstraßen o<strong>der</strong> Straßen zur Erschließung<br />
industriell geprägter Stadtteile, die zusammenhängend und im gleichen Zeitraum<br />
ihre Namen erhielten.<br />
Dabei bot es sich natürlich an, neben Flur- und Gemarkungsnamen auch gruppenweise<br />
<strong>Straßennamen</strong> nach bestimmten Sachgruppen zu wählen.<br />
In <strong>der</strong> Gemeinde Fröndenberg begann diese Entwicklung mit <strong>der</strong> Wohnbebauung auf dem<br />
Sümberg mit <strong>der</strong> Benennung von Straßen nach Gestalten <strong>der</strong> märkischen <strong>Geschichte</strong> und <strong>der</strong><br />
<strong>Fröndenberger</strong> Klostergeschichte, ergänzt durch einen <strong>Straßennamen</strong> im südlichen<br />
Gemeindegebiet zwischen Ruhr und Bahnlinie. <strong>Die</strong> märkischen Grafen Engelbert und Adolf,<br />
die Gemahlin von Graf Eberhard III, Irmgard und <strong>der</strong> Klosterbegrün<strong>der</strong> Bertholdus<br />
wurden mit <strong>Straßennamen</strong> geehrt. Das Wohnviertel auf dem Sümberg wurde später in den<br />
1960er Jahren durch Erst- und Umbenennungen nach dem Schutzpatron <strong>der</strong> Kloster- und<br />
Stiftskirche und Wappenträger <strong>der</strong> Stadt, dem Heiligen Mauritius, nach dem Mönch<br />
Menricus und nach Irmgards Ehemann Eberhard komplettiert.<br />
Fortgesetzt wurde die gruppenweise <strong>Straßennamen</strong>gebung in den 1930er Jahren im Baugebiet<br />
Westick. Während im benachbarten Baugebiet Fröndenberg-Ost nationalsozialistisch geprägten<br />
Benennungen (Hans Schemm und Ostmark) und bereits bestehenden Bezeichnungen<br />
vorherrschen, kamen weiter östlich die Vertreter <strong>der</strong> klassischen deutschen Literatur zum<br />
Zuge. Goethe und Schiller, Lessing und, neben Sophie Scholl die bisher einzige weibliche<br />
<strong>Straßennamen</strong>patin, das Freifräulein von Droste-Hülshoff, ergänzt durch Hermann Löns 1<br />
und Theodor Körner 2 neben Ernst Moritz Arndt <strong>der</strong> bekannteste Dichter <strong>der</strong> Zeit <strong>der</strong> Befreiungskriege<br />
1813-15, sind hier vertreten.<br />
Nach dem Zweiten Weltkrieg und <strong>der</strong> bewussten Abkehr von Nationalstolz und Pathos waren<br />
es dann die unverfänglichen Blumennamen im Baugebiet Springstraße und die Baumnamen<br />
auf dem östlichen und nördlichen Mühlenberg, die zu Namenspaten wurden.<br />
<strong>Die</strong> Gruppe <strong>der</strong> Singvögel kam ab 1957 bis hinein in die 1970er Jahre zu Ehren im Baugebiet<br />
Westicker Heide und eine breite Gruppe allgemein naturkundlicher Namen 3 im Wohngebiet<br />
Hohenheide.<br />
Historiographisches Neuland wurde mutig Ende <strong>der</strong> 1960er Jahre auf dem westlichen<br />
Mühlenberg beschritten mit <strong>der</strong> Ehrung von Vertretern des deutschen Wi<strong>der</strong>standes gegen die<br />
NS-Diktatur. 4<br />
<strong>Die</strong> bislang letzte inhaltlich zusammenhängende Gruppe von <strong>Straßennamen</strong> wurde im Industriegebiet<br />
Westick- Frohnhausen- Neimen verwirklicht mit <strong>der</strong> Vergabe von <strong>Straßennamen</strong> zu<br />
1 Einschränkend gilt Hermann Löns sicher nicht (mehr) als wichtiger Vertreter <strong>der</strong> deutschen<br />
Literaturgeschichte, gleichwohl seine „Heidedichtungen“ noch heute manchen kleinbürgerlichen<br />
Bücherschrank zieren, was aber immer noch positiver zu bewerten ist als seine antisemitischen und<br />
nationalistischen Hasstiraden <strong>der</strong> späten Kaiserzeit, die zu Recht gänzlich vergessen sind<br />
2 Es ehrt im Nachhinein den Gemein<strong>der</strong>at, Körner und nicht den Antisemiten Arndt gewählt zu haben; letzterer<br />
stand in <strong>der</strong> Erinnerung wahrscheinlich zu nahe <strong>der</strong> verpönten 1848er Revolution. Von Theodor Körner, <strong>der</strong><br />
als Zweiundzwanzigjähriger Freiwilliger im „Freikorps Lützow“ 1813 fiel, stammt die von Joseph Goebbels in<br />
seiner berühmten Sportpalastrede des Jahres 1944 missbrauchte Gedichtzeile „nun Volk steh auf und Sturm<br />
brich los“, mit <strong>der</strong> Goebbels den „Volkssturm“ bewusst in die Tradition <strong>der</strong> Befreiungskriege zu stellen<br />
versuchte: Theodor Körner, „Leier und Schwert“ posthum 1814 veröffentlichte Sammlung <strong>der</strong> Gedichte.<br />
3 Siehe dazu Exkurs 4 <strong>der</strong> vorliegenden Arbeit<br />
4 Siehe dazu Exkurs 5 <strong>der</strong> vorliegenden Arbeit
97<br />
Ehrung von Pionieren <strong>der</strong> Industriegeschichte wie Werner von Siemens, Wernherr von<br />
Braun, Rudolf <strong>Die</strong>sel, <strong>der</strong> Gewerkschaftsbewegung in Person von Hans Böckler und zur<br />
Erinnerung an den 1977 von RAF-Terroristen ermordeten Arbeitgeberpräsidenten Schleyer.<br />
Selbstverständlich kann eine Verwaltung nur so viele Straßen benennen, wie vorhanden sind;<br />
trotzdem fällt auf, welche Namengruppen bisher nicht zu <strong>Straßennamen</strong>ehren gekommen<br />
sind: <strong>Die</strong>s sind ganz allgemein sämtliche Vertreter <strong>der</strong> Musikgeschichte, wie auch aus dem<br />
Bereich <strong>der</strong> Philosophie, sowie <strong>der</strong> mo<strong>der</strong>nen Literatur <strong>der</strong> zweiten Hälfte des 19. 5 und des<br />
gesamten 20. Jahrhun<strong>der</strong>ts. We<strong>der</strong> Mozart noch Bach, we<strong>der</strong> Kant o<strong>der</strong> Hegel, we<strong>der</strong> Heinrich<br />
Heine, Theodor Fontane noch Thomas Mann sind bisher geehrt worden.<br />
Was die Kloster- und Stiftsgeschichte anbelangt, ist es zeittypisch gewesen, nur die Gemahlin<br />
eines Grafen von <strong>der</strong> Mark zu einer <strong>Straßennamen</strong>patin zu erwählen, weil diese in <strong>der</strong><br />
Stiftskirche ihre letzte Ruhestätte gefunden hat. Hingegen sind die für die <strong>Geschichte</strong><br />
Fröndenbergs viel wesentlicheren Frauen, nämlich die diversen Äbtissinnen <strong>der</strong> Stiftszeit,<br />
bisher nicht bedacht worden. <strong>Die</strong> adeligen Damen <strong>der</strong> Familien von Plettenberg, von<br />
Boeselager, von <strong>der</strong> Recke u.a., die mit ihren, ihnen von ihren Familien zugestandenen<br />
Gel<strong>der</strong>n in kulturgeschichtlicher und baugeschichtlicher Hinsicht wesentlich das Bild<br />
Fröndenbergs vom 16. – frühen 19. Jahrhun<strong>der</strong>ts prägten, hätten eine diesbezügliche Ehrung<br />
mehr als verdient, ohne die Verdienste <strong>der</strong> „Männer“ Bertholdus und Menricus dadurch zu<br />
schmälern. Eindeutig beherrscht(e) hier das männlich orientierte Geschichtsbild und Denken<br />
des bürgerlichen 19. Jahrhun<strong>der</strong>ts die Entscheidungen auch in einem so marginalen Punkt <strong>der</strong><br />
kommunalen Identität, wie dem <strong>der</strong> Straßenbenennung. 6<br />
Auffällig ist auch die Zurückhaltung hinsichtlich <strong>der</strong> Ehrung von Staatsmännern und<br />
Politikern <strong>der</strong> Neuzeit. Wenn auch von Tirpitz, vom Stein (später in dessen Nachfolge<br />
Staatskanzler Hardenberg) und Bismarck mit <strong>Straßennamen</strong> geehrt wurden und nach wie<br />
vor <strong>der</strong> Hindenburghain vor sich hin grünt, 7 so fehlt doch je<strong>der</strong> Hinweis auf verstorbene<br />
Bundespräsidenten o<strong>der</strong> auch Bundeskanzler wie Theodor Heuss, Konrad Adenauer o<strong>der</strong><br />
Willy Brandt, um nur die drei bis heute populärsten Namen zu nennen.<br />
Der einzige mit einem <strong>Straßennamen</strong> geehrte Politiker, <strong>der</strong> über den Kreis Unna hinaus nach<br />
dem Zweiten Weltkrieg eine gewisse Bedeutung hatte, war <strong>der</strong> Landrat und zeitweise<br />
Innenminister des Landes NRW und Arnsberger Regierungspräsident Hubert Biernat, <strong>der</strong><br />
zwar nicht aus Fröndenberg stammte, jedoch in seinen letzten Lebensjahren an <strong>der</strong> später<br />
nach ihm benannten Straße entlang des Höhenrückens des Haarstrangs wohnte.<br />
Demokratische Politiker <strong>der</strong> Weimarer Zeit sind da schon besser vertreten, was mit ihrer späteren<br />
oppositionellen Haltung gegenüber dem NS-Regime zusammenhängt o<strong>der</strong> als Einzelfall<br />
mit <strong>der</strong> Sympathie des Dellwiger SPD-Bürgermeisters Goebel für die Person von<br />
Reichspräsident Friedrich Ebert, <strong>der</strong> dort mit einem <strong>Straßennamen</strong> geehrt wurde.<br />
Damit zu den heutigen Stadtteilen, den ehemaligen amtsangehörigen Gemeinden.<br />
Gemäss <strong>der</strong> städtebaulichen Entwicklung waren es die Gemeinden Langschede und Dellwig,<br />
in denen, wenn auch kleine, <strong>Straßennamen</strong>gruppen gebildet wurden.<br />
In Dellwig kamen die Dichter Eichendorff und Hermann Löns (in dessen Nachfolge <strong>der</strong><br />
münsterländische Dichter Augustin Wibbelt) zusammen mit dem ehemaligen Ortsgeistlichen<br />
Friedrich von Bodelschwingh (dazu im weiteren Verlauf dieses Kapitels mehr) in einer<br />
Siedlung zusammen zu <strong>Straßennamen</strong>ehren; in Langschede entstand in den 1960er Jahren ein<br />
5 Abgesehen von Hermann Löns<br />
6 Erst kürzlich wurde die große nicht nur kulturelle, son<strong>der</strong>n auch politische Bedeutung <strong>der</strong> weiblichen Klöster<br />
und Stifte in einem Themenheft <strong>der</strong> Zeitschrift „Damals“ (Heft März 2005) von verschiedenen Autoren(innen)<br />
gut und allgemeinverständlich herausgearbeitet.<br />
7 <strong>Die</strong>ser Name taucht nur im Stadtplan auf, Schil<strong>der</strong> o<strong>der</strong> Hinweise im Stadtgebiet und im o<strong>der</strong> am Park<br />
selber fehlen; so verschwindet <strong>der</strong> Name zusehends zusammen mit <strong>der</strong> Notwendigkeit seiner Umbenennung<br />
aus dem Bewusstsein <strong>der</strong> Bürger, gleichfalls lei<strong>der</strong> aber auch die schön gelegene, wenngleich momentan<br />
langweilig aufgeteilte Parkanlage selbst, die mit wenigen finanziellen Mitteln aufgewertet werden könnte.
98<br />
kleines zusammenhängendes Straßenviertel mit Benennung nach Singvögeln, denen sich für<br />
kurze Zeit (siehe Exkurs 6) <strong>der</strong> Storch zugesellte, ehe er <strong>der</strong> Meise Platz machen musste.<br />
Erwähnung finden sollte noch das Neubaugebiet in <strong>der</strong> unteren Westicker Heide und am<br />
Hirschberg; dank unermüdlichen Einsatzes <strong>der</strong> katholischen Verbände und Gruppierungen<br />
wurde hier an das Wirken <strong>der</strong> katholischen Sozialreformer Adolph Kolping, Emanuel von<br />
Ketteler und Oswald von Nell-Breuning mit <strong>der</strong> Vergabe von <strong>Straßennamen</strong> erinnert. Als<br />
evangelisches Pendant steht dem die bereits erwähnte von-Bodelschwingh-Straße in Dellwig<br />
zusammen mit <strong>der</strong> dortigen Bethelstraße gegenüber; dies allerdings aus ortsbezogenen<br />
Gründen wie im Folgenden darzustellen ist.<br />
Nach diesem, dem vorhandenen Bestand entsprechend kurzem Blick auf die „Gruppenbenennungen“,<br />
ist es angebracht, näher auf die <strong>Straßennamen</strong>paten <strong>der</strong> <strong>Fröndenberger</strong> Ortshistorie<br />
des 19. und 20. Jahrhun<strong>der</strong>t einzugehen, die überörtlich über den Kreis Unna und die<br />
Grafschaft Mark hinaus relativ unbekannt sein dürften, wobei lei<strong>der</strong> zu konstatieren ist, dass<br />
auch die meisten Bürgerinnen und Bürger von Fröndenberg kaum mit dem einen o<strong>der</strong> an<strong>der</strong>en<br />
Namen heute etwas anzufangen wissen.<br />
Daher folgt eine Kurzfassung ihrer Vitae und Anmerkungen zu ihrer Bedeutung für die Ortshistorie.<br />
8<br />
Verzichtet wird an dieser Stelle bewusst auf ein nochmaliges Eingehen auf die Personen <strong>der</strong><br />
Kloster- und Stiftsgeschichte, <strong>der</strong>en Bedeutung für die <strong>Geschichte</strong> Fröndenbergs bereits im<br />
Kapitel A <strong>der</strong> vorliegenden Arbeit beschrieben wurde. Auch wenn die Beschreibung dort<br />
nicht er-schöpfend ausgefallen ist, sollte in <strong>der</strong> vorliegenden Arbeit zur Thematik <strong>der</strong><br />
<strong>Straßennamen</strong> nicht <strong>der</strong> Versuch gesehen werden, die gesamte <strong>Geschichte</strong> <strong>der</strong> Stadt in aller<br />
Breite darzustellen. Hier muss beson<strong>der</strong>s verwiesen werden auf die ausführlichen Arbeiten<br />
von Franz Lueg, die im Quellen- und Literaturverzeichnis aufgeführt sind.<br />
Friedrich Bering (1851-1915)<br />
Gebürtig aus dem Mendener Raum und lange Jahre <strong>der</strong> einzige praktizierende Arzt in Fröndenberg,<br />
<strong>der</strong> als „Sanitätsrat“ großes Ansehen genoss, lange Jahre als Vorsitzen<strong>der</strong> des Turnvereins<br />
„Jahn“ wirkte, maßgeblich den Bau des evangelischen Krankenhauses för<strong>der</strong>te wie<br />
auch den sozialen Wohnungsbau des „Gemeinnützigen Bauvereins“ durch die Gemeinde<br />
Fröndenberg. Sein Vater, ebenfalls Mediziner mit dem Vornamen Friedrich, war aktiv am<br />
politischen Leben im Kreis Iserlohn beteiligt, zu dem ab 1815 auch <strong>der</strong> Mendener Raum<br />
gehörte. Während <strong>der</strong> 1848er Kämpfe in Iserlohn verhaftet, wurde er wegen seiner „sonstigen<br />
Verdienste“ als Arzt später im Namen des Königs Friedrich Wilhelm IV. „begnadigt“ und<br />
wirkte noch lange Jahre im Mendener Raum. Dessen Enkel, <strong>der</strong> Sohn des <strong>Fröndenberger</strong><br />
Arztes, ebenfalls mit Namen Friedrich, war ebenfalls Arzt und politisch tätig, allerdings<br />
weniger im Sinne seines Großvaters, son<strong>der</strong>n eher im Sine des gesellschaftsfähig werdenden<br />
Nationalsozialismus <strong>der</strong> frühen 1930er Jahre. Als Redner in Fröndenberg for<strong>der</strong>te er schon<br />
1930/31 einen starken „Führerstaat“ und die „Auslöschung des Versailler Schanddiktats“.<br />
Später nach Köln verzogen, wurde er 1942 Rektor <strong>der</strong> dortigen Universität, „welche einstmals<br />
meinen Namen tragen wird“ wie er selbstbewusst anlässlich seiner Ernennung bemerkte.<br />
Dazu kam es allerdings nicht mehr; als hochgeehrter Spezialist für Dermatologie verstarb er<br />
Anfang <strong>der</strong> 1950er Jahre in Köln-Lindenthal, wo er einer Spezialklinik seines Fachgebietes<br />
vorstand.<br />
8 So reizvoll (und seitenfüllend) es auch an dieser Stelle wäre, das Leben von Goethe, Schiller, Bismarck und<br />
von Tirpitz, Hardenberg o<strong>der</strong> Lessing näher zu beleuchten, soll hierauf verzichtet werden; <strong>der</strong>en<br />
Biographien finden sich in jedem guten Nachschlagewerk und auf die beson<strong>der</strong>en Umstände, die eventuell<br />
einen Bezug auf Fröndenberg haben, wurde bereits in <strong>der</strong> Chronologie <strong>der</strong> Benennungszeit hingewiesen.
99<br />
Dreimal Friedrich Bering; ganz eindeutig aber wurde die „Friedrichstraße“ noch vor dem<br />
Ersten Weltkrieg und später in „Friedrich Beringstraße“ umbenannt, nach Friedrich Bering,<br />
dem Mittleren benannt. 9<br />
Friedrich von Bodelschwingh (1831-1910) 10<br />
Entstammte einer alten westfälischen Adelsfamilie (Haus Velmede bei Methler) und wurde in<br />
Lengerich, Kreis Tecklenburg geboren, wo sein Vater zu dieser Landrat war. Zunächst in <strong>der</strong><br />
Landwirtschaft und Gutsverwaltung in Schlesien und Pommern tätig, ehe er Theologie studierte<br />
und ab April 1858 die deutsche evangelische Gemeinde in Paris seelsorgerisch betreute.<br />
Von 1864-1872 war er Gemeindepfarrer in <strong>der</strong> amtsangehörigen Gemeinde Dellwig, Kirchort<br />
des gleichnamigen Kirchspiels und mit zwei Amtskollegen zuständig für die Dörfer<br />
Billmerich, Ardey, Dellwig, Langschede und Strickherdicke. Durch seine landwirtschaftliche<br />
Ausbildung den Problemen <strong>der</strong> Landwirte aufgeschlossen, war er im Kirchspiel sehr beliebt<br />
und angesehen, schlichtete manchen Streit auf unkonventionelle Weise und konnte die Lücke,<br />
die <strong>der</strong> Tod des Amtmannes Schulze-Dellwig im Dorf hinterlassen hatte, wenn auch aus einer<br />
an<strong>der</strong>er Warte gesehen, gut schließen. Nach seinem von <strong>der</strong> Bevölkerung sehr bedauerten<br />
Weggang aus Dellwig blieb er bis heute in <strong>der</strong> Erinnerung <strong>der</strong> Gemeinde, da während seiner<br />
Amtszeit im Januar 1869 innerhalb von drei Wochen die vier ältesten Kin<strong>der</strong> des<br />
Pfarrerehepaars an Lungenentzündung und Stickhusten starben. <strong>Die</strong> Kin<strong>der</strong>gräber werden<br />
noch heute von <strong>der</strong> Kirchengemeinde gepflegt. An den Gemeindepfarrer und sein späteres<br />
Wirken als Begrün<strong>der</strong> <strong>der</strong> Bethel´schen Anstalten bei Bielefeld erinnern die zwei Dellwiger<br />
<strong>Straßennamen</strong> „Von-Bodelschwingh-Straße“ und „Bethelstraße.“<br />
Wilhelm Feuerhake (1873-1925)<br />
Gebürtiger <strong>Fröndenberger</strong>, absolvierte eine kaufmännische Ausbildung in <strong>der</strong> Iserlohner<br />
Draht- und Nadelfabrikation und gründete zusammen mit Friedrich Köper in Fröndenberg<br />
1898 die Firma W.Feuerhake & Co., die Keimzelle <strong>der</strong> später größten Industriefirma am Ort,<br />
<strong>der</strong> Firma UNION. <strong>Die</strong> Produktion, die zunächst traditionell mit <strong>der</strong> Kettenfertigung begann,<br />
wurde schnell und innovativ auf die Produktion von Fahrradteilen (Nippel und Speichen)<br />
umgestellt und um ein eigens Drahtwerk erweitert.<br />
Kurz vor eines zu erwartenden Konkurses in Folge <strong>der</strong> Inflationszeit und fehlgeschlagener<br />
Neuorientierung von <strong>der</strong> Rüstungsproduktion des Ersten Weltkrieges auf Friedensproduktion<br />
verbunden mit dem damaligen Ausfall privater Nachfrage nach Fahrrä<strong>der</strong>n, beging <strong>der</strong><br />
Firmengrün<strong>der</strong> 1925 Selbstmord, wurde aber posthum 1933 durch die Umbenennung eines<br />
Teils <strong>der</strong> am Firmengelände vorbeiführenden Ardeyer Straße geehrt.<br />
Wenige Tage später wurde die Firma vor dem Konkurs durch den Einstieg <strong>der</strong> Vereinigten<br />
Stahlwerke des Hugenberg-Konzerns und Investition des Privatkapitals von Albert Vögler<br />
gerettet, stabilisierte sich bis zum Beginn <strong>der</strong> Weltwirtschaftskrise, überlebte diese trotz<br />
notwendiger Produktionsdrosselung und Entlassungen Dank <strong>der</strong> Verflechtung in den<br />
Hugenberg-Stinnes-Konzern. Seit <strong>der</strong> Machtübername <strong>der</strong> Nationalsozialisten und <strong>der</strong> bald<br />
darauf beginnenden Umstellung auf Rüstungsgüter- und Munitionsfertigung erreichte die<br />
UNION den Zenit ihres Bestehens, war in Person <strong>der</strong> Geschäftsführer Sils und van de Loo an<br />
allen wichtigen kommunalpolitischen Entscheidungen bis 1945 maßgeblich beteiligt und<br />
beschäftigte einschließlich Zwangsarbeiter und KZ-Häftlingen Mitte 1944 in zahlreichen<br />
Produktionsstätten in Deutschland und in Auschwitz-Birkenau nahezu 8.000 Beschäftigte.<br />
9<br />
Angaben zur Familie Bering in Fritz Klute, Fröndenberg Einst & Jetzt, Fröndenberg 1925 sowie Jochen von<br />
Nathusius, „Der Sanitätsrat an <strong>der</strong> Spitze des Turnvereins Jahn, Artikel im „Stadtspiegel“ vom 25.02.2004<br />
sowie Festschrift des Turnverein Jahn zum 50. Jubiläum seiner Gründung, Fröndenberg 1931<br />
10 Angaben zu Friedrich Bodelschwingh in Friedrich Bodelschwingh jun. „Erinnerungen an meinen Vater,<br />
Bielefeld 1923, verkürzte Ausgabe in 21.A.,Bielefeld 1980
100<br />
Sohn Friedrich Feuerhake war als einer <strong>der</strong> Prokuristen (ohne eigene Kapitaleinlage) in den<br />
1920er – 1940er Jahren bei <strong>der</strong> UNION tätig und war einer <strong>der</strong> führenden Vertreter <strong>der</strong><br />
<strong>Fröndenberger</strong> „Besseren Gesellschaftskreise“, zu denen bis 1933 auch die jüdische Familie<br />
Bernstein gehörte; er war Trauzeuge bei drei Hochzeiten von Töchtern <strong>der</strong> Familie, von denen<br />
zwei später in Konzentrationslagern ermordet wurden. 11<br />
Wilhelm Himmelmann (1841-1918)<br />
Begrün<strong>der</strong> <strong>der</strong> <strong>Fröndenberger</strong> Papier- und Pappenindustrie, dem nach <strong>der</strong> Ketten- und<br />
Metallindustrie bis in die 1970er Jahre wichtigsten Industriezweig im <strong>Fröndenberger</strong> Raum.<br />
Er übernahm als Alleininhaber 1874 die bereits 1854 gegründete „Papierfabrik von <strong>der</strong> Becke<br />
& Co.“, hervorgegangen aus <strong>der</strong> ehemaligen Stiftsmühle am Mühlengraben nördlich <strong>der</strong> Ruhr<br />
gelegen. 1869 wurden die Anlagen durch ein Ruhrhochwasser vernichtet und 1870 wie<strong>der</strong><br />
aufgebaut. Im Zusammenhang mit einer Ruhrregulierung und <strong>der</strong> Stilllegung des<br />
Mühlengrabens hielt die Dampfkraft als Energieträger erstmals Einzug in Fröndenberg und<br />
aus <strong>der</strong> „Papiermühle“ entwickelte sich eine stetig wachsende und technisch bis in die 1960er<br />
Jahre auf dem neuesten Stand <strong>der</strong> Pappenherstellung befindliche Papier-, Pappe- und<br />
Kartonfabrik. Wilhelm Himmelmann leitete die Fabrik bis zu seinem Tod 1918, sein<br />
Nachfolger wurde Schwiegersohn Paul Leesemann (1873-1921), <strong>der</strong> eine Adoptivtochter von<br />
Wilhelm Leesemann und seiner Ehefrau Elise, geb. Wildschütz geheiratet hatte. Ein Onkel<br />
von Paul Leesemann war <strong>der</strong> 1847 geborene Hermann Leesemann, von 1897-1919 Amtmann<br />
des Amtes Fröndenberg.<br />
Ähnlich wie Friedrich Bering, war Wilhelm Himmelmann ein För<strong>der</strong>er des evangelischen<br />
Krankenhauses, dazu aktiv im Bürgerschützenverein und als Veteran des 1871/71er Krieges<br />
im Kriegerverein aktiv.<br />
Nach dem Tod von Wilhelm Himmelmann wurde <strong>der</strong> Platz unterhalb seines Wohnhauses im<br />
Stiftsbezirk zu seinem Andenken „Wilhelmplatz“ benannt und 1933 zum „Wilhelm-<br />
Himmelmann-Platz umbenannt. An diesem Platz lag auch das Wohnhaus <strong>der</strong> Fabrikantenfamilie<br />
Leesemann (ehemals im Besitz von Moritz Wildschütz, dem Vater von Karl<br />
Wildschütz) und nur einen Steinwurf entfernt die Grundstücke und Häuser <strong>der</strong> Familie Wildschütz<br />
an <strong>der</strong> Ruhr- und Karlstraße (später Karl-Wildschütz-Straße) 12<br />
(Wilhelm) Willi Kettmann (ca. 1910 – 1978)<br />
Gebürtiger Frömerner und in seiner Heimatgemeinde langjähriger Bürgermeister, Mitglied<br />
<strong>der</strong> SPD. Auf <strong>der</strong>en Veranlassung und Vorschlag wurde im Oktober 1982 eine Straße nach<br />
dem Kommunalpolitiker benannt.<br />
Für die vorliegende Arbeit ist <strong>der</strong> Name Willi Kettmann deswegen von herausragen<strong>der</strong><br />
Bedeutung, da er <strong>der</strong> bisher einzige ehemalige Bürgermeister im gesamten Raum Fröndenberg<br />
ist, nach dem eine Straße benannt wurde. Keinem Amtmann, Vorsteher o<strong>der</strong> Bürgermeister<br />
<strong>der</strong> Kernstadt und ihrer Stadtteile wurde eine solche Ehrung zuteil. 13<br />
<strong>Die</strong><strong>der</strong>ich von Steinen (1699-1759)<br />
Gebürtig aus Frömern, Sohn einer weit verzweigten Pfarrerdynastie im märkischen Raum.<br />
<strong>Die</strong><strong>der</strong>ichs Urgroßvater Heinrich von Steinen sen. feierte mit seiner Gemeinde im November<br />
1545 als Pastor <strong>der</strong> Gemeinde Frömern erstmals den Gottesdienst nach <strong>der</strong> Lehre Luthers und<br />
begründete somit dort die Reformation. Bereits 1542 hatte <strong>der</strong> 1529 zum Priester geweihte<br />
11 Angaben zur Familie Feuerhake aus Stefan Klemp, „...richtige Nazis hat es hier nicht gegeben“, Münster 2000<br />
sowie Eigendarstellung <strong>der</strong> Firma UNION aus dem Jahr 1998 zum 100. Firmenjubiläum<br />
12 Angaben zu Wilhelm Himmelmann aus den Festschriften <strong>der</strong> Firma Himmelmann zum 75. und 100. Jubiläum<br />
<strong>der</strong> Firma, Fröndenberg 1929 und 1954, sowie Fritz Klute, Fröndenberg Einst & Jetzt, Fröndenberg 1925<br />
13 Angaben zu Willi Kettmann aus den Ratsprotokollen <strong>der</strong> Stadt Fröndenberg
101<br />
und als Chorherr im Kloster Scheda ansässige Heinrich „wie<strong>der</strong> die Römisch-katholischen<br />
Lehrsätze“ geheiratet und „mit großem Eifer gepredigt.“<br />
Urenkel <strong>Die</strong><strong>der</strong>ich war <strong>der</strong> erste gebürtige Westfale, <strong>der</strong> 1750 von Friedrich II. von Preußen<br />
zum Konsistorialrat ernannt wurde und bereits seit 1749 das Amt des „Generalinspekteurs <strong>der</strong><br />
lutherisch-märkischen Synode“ bekleidete.<br />
Sein überkonfessioneller Verdienst ist die Bearbeitung, Auswertung und Sammlung<br />
unzähliger Urkunden und schriftlichen Überlieferungen des gesamten westfälischen Raumes.<br />
Daraus entstand eine noch heute bis zur Zeit um die Mitte des 18. Jahrhun<strong>der</strong>ts maßgebende<br />
<strong>Geschichte</strong> Westfalens in mehreren Bänden. Zu Lebzeiten wurde seine diesbezügliche<br />
Leistung kaum wahrgenommen und tragischerweise verbrannte seine Sammlung wichtiger<br />
Dokumente und Unterlagen bei <strong>der</strong> Brandschatzung Frömerns während des Siebenjährigen<br />
Krieges. Nur durch die bereits gedruckt vorliegenden Abschriften und Transkriptionen sind so<br />
heute diese Dokumente noch greifbar. Mit dem Tod seines Sohnes und Amtsnachfolger starb<br />
die Pfarrerdynastie von Steinen in männlicher Linie 1797 in Frömern aus. 14<br />
Karl Wildschütz (1850 -1921)<br />
Gebürtiger <strong>Fröndenberger</strong>, Hotelier und Kaufmann in Fröndenberg, dessen Vater Moritz in<br />
den 1820er Jahren mehrere Häuser im Stiftsbezirk von <strong>der</strong> preussischen Domänenverwaltung<br />
in Hamm erworben hatte, darunter das spätere Wohnhaus <strong>der</strong> Fabrikantenfamilie Leesemann<br />
und das größte Haus am späteren „Himmelmannplatz“, das ehemalige Back- und Brauhaus<br />
des Stifts, dass er wenige Jahre später weiter verkaufte an die jüdische Familie Neufeld, die<br />
dort bis zum Zwangsverkauf des Hauses an die Gemeindeverwaltung im Herbst 1939 wohnte.<br />
Kein Mitglied <strong>der</strong> 1933 vierzehnköpfigen Familie überlebte den Holocaust.<br />
Sohn Karl Wildschütz betrieb ein Hotel in <strong>der</strong> späteren Villa Leesemann und war als Nachfolger<br />
seines Vaters bis 1882 Betreiber einer Brückenwirtschaft und Pächter des Ruhrbrückenzolls,<br />
den dieser wie die Häuser im Stiftsbezirk aus dem Nachlass des Stiftes<br />
erworben hatte. Nach dem Bahnbau 1870/71 verlegte er seine Tätigkeit in ein in den 1880er<br />
Jahren neu gebautes Hotel an <strong>der</strong> Ruhrstraße näher hin zur Eisenbahn und erwarb zahlreiche<br />
Grundstücke am Verlauf <strong>der</strong> später zu seinen Ehren benannten „Karlstraße“,1933 umbenannt<br />
in „Karl-Wildschütz-Straße.“<br />
Karl Wildschütz war ein Bru<strong>der</strong> <strong>der</strong> Ehefrau des Fabrikanten Wilhelm Himmelmann. 15<br />
14 Angaben zu <strong>Die</strong><strong>der</strong>ich von Steinen in: Klaus Basner, „Reformation und Gegenreformation im Raum<br />
Fröndenberg“, Fröndenberg 1989<br />
15 Angaben zu Karl Wildschütz aus Fritz Klute, Fröndenberg Einst & Jetzt, Fröndenberg 1925, „Sammlung<br />
Kulczak“ im Stadtarchiv Fröndenberg und Jochen von Nathusius/Stefan Klemp. Spuren jüdischen Lebens in<br />
Fröndenberg, Ausstellungskatalog, Fröndenberg 2005
102<br />
K. Straßenverzeichnis <strong>der</strong> Stadt Fröndenberg zum 31.12.2004<br />
Schwarz: Bestand <strong>der</strong> vor dem 1.1.1968 benannter Straßen, die ihre Namen beibehielten<br />
Violett: Neue Namen vom 1. 1.1968 bis 31.12.1970; Umbenennungen wie<br />
Neubenennungen<br />
Blau: Neue Namen vom 1. 1.1971 bis 31.12.1979<br />
Rot: Neue Namen vom 1. 1.1980 bis 31.12.1989<br />
Grün: Neue Namen vom 1. 1.1990 bis 31.12.2004<br />
Al = Stadtteil Altendorf<br />
Ar = Stadtteil Ardey<br />
Ba = Stadtteil Bausenhagen<br />
Be = Stadtteil Bentrop<br />
De = Stadtteil Dellwig<br />
F = Kernstadt Fröndenberg mit Westick und Hohenheide<br />
Fr = Stadtteil Frömern<br />
Fro = Stadtteil Frohnhausen<br />
La = Stadtteil Langschede<br />
Ne = Stadtteil Neimen<br />
Ost = Stadtteil Ostbüren<br />
St = Stadtteil Stentrop<br />
Str = Stadtteil Strickherdicke<br />
Wa = Stadtteil Warmen<br />
A<br />
Ahlinger Berg (De), Ratsbeschluss vom 1.7.1970<br />
Ahornweg (F)<br />
Akazienweg (F)<br />
Alleestraße (F)<br />
Alte Kreisstraße (Str)<br />
Altendorfer Straße (Al), Ratsbeschluss vom 1.7.1970<br />
Alter Mühlenweg (Fr)<br />
Alter Weg (Str)<br />
Am Backenberg (Fr)<br />
Am Baumgarten (Ost), Ratsbeschluss vom 19.7.1975<br />
Am Birnbaum (Fr)<br />
Am Brauck (De)<br />
Am Haarstrang (Fr), Ratsbeschluss vom 12.12.1979<br />
Am Hahnenbusch (F), Ratsbeschluss vom 29.8.1985<br />
Am Hang (Str), Ratsbeschluss vom 1.7.1970<br />
Am Klingelbach (F)<br />
Am Kraftwerk (Wa), Ratsbeschluss vom 1.7.1970<br />
Am Obsthof (Ost), Ratsbeschluss vom 1.7.1970<br />
Am Rodbusch (Ost), Ratsbeschluss vom 22.2.1995<br />
Am Sachsenwald (F)<br />
Am Schwimmbad (De)<br />
Am Sportplatz (Ost), Ratsbeschluss vom 1.7.1970<br />
Am Steinbruch (F)<br />
Am Ufer (La)<br />
Am Versstück (Ar), Ratsbeschluss vom 5.6.1974<br />
Am Walnussbaum (Ba), Beschluss vom 12.6.2001
103<br />
Amselweg (La)<br />
Annette-von-Droste-Hülshoff-Straße (F)<br />
Ardeyer Straße (Durchgangsstraße F, Ar, La), für Ar und La neu per Ratsbeschluss<br />
vom 1.7.1970, für Fröndenberg alte Bezeichnung<br />
Asternweg (F)<br />
Auf dem Brennen (Wa), Ratsbeschluss vom 20.12.1972<br />
Auf dem Krittenschlag (F)<br />
Auf dem Sodenkamp (F)<br />
Auf dem Spitt (Fr)<br />
Auf <strong>der</strong> Freiheit (F)<br />
Auf <strong>der</strong> Hege (Fr), Ratsbeschluss vom 15.12.1982<br />
Auf <strong>der</strong> Höhe (Ost), Ratsbeschluss vom 1.7.1970<br />
Auf <strong>der</strong> Kisse (La)<br />
Auf <strong>der</strong> Linde (Str), Beschluss vom 7.12.1999<br />
B<br />
Bachstraße (De)<br />
Bahnhofsallee (La), Beschluss vom 4.2.2003<br />
Bahnhofstraße (F)<br />
Bauernbrücke (Ost), Ratsbeschluss vom 1.7.1970<br />
Bauerngarten (Ar), Ratsbeschluss vom 15.7.1981<br />
Bauernkamp (Ost), Ratsbeschluss vom 1.7.1970<br />
Bausenhagener Straße (Durchgangsstraße Ost, Ba, St, Be), Ratsbeschluss vom 1.7.1970<br />
Beisenbrauck (Str), Ratsbeschluss vom 1.7.1970<br />
Bentroper Weg (Be), Ratsbeschluss vom 1.7.1970<br />
Bergstraße (F)<br />
Bertholdusstraße (F)<br />
Bethelstraße (De)<br />
Bielenbusch (Fr)<br />
Billmericher Weg (Al), Ratsbeschluss vom 1.7.1970<br />
Bilstein (Ar)<br />
Binnerstraße (De)<br />
Birkei (Ba), Ratsbeschluss vom 1.7.1970<br />
Birkenweg (F)<br />
Bismarckstraße (F)<br />
Blumenstraße (F), Ratsbeschluss vom 1.7.1970<br />
Böckelmannweg (Str)<br />
Bockenweg (Ost), Ratsbeschluss vom 1.7.1970<br />
Bodelschwinghstraße (De)<br />
Bonekamp (Fr)<br />
Bonhoeffer Straße (F), Ratsbeschluss vom 18.6.1969<br />
Brameck (Ost), Ratsbeschluss vom 1.7.1970<br />
Brandheide (F), Ratsbeschluss vom 5.6.1974<br />
Brauerstraße (Fr)<br />
Bredde (Ar), Ratsbeschluss vom 1.7.1970<br />
Bruayplatz (F), Ratsbeschluss vom 2.9.1989<br />
Brückenstraße (Fr), Ratsbeschluss vom 1.7.1970<br />
Buchenacker (Ar)<br />
Burgstraße (Ost), Ratsbeschluss vom 1.7.1970<br />
Burland (Ar)
104<br />
C<br />
Carlo-Mierendorf-Straße (F), Ratsbeschluss vom 20.12.1972<br />
D<br />
Dachsleite (F), Ratsbeschluss vom 5.6.1974<br />
Dahlienweg (F)<br />
Dorfstraße (Ar)<br />
Dörssiepen (De), Ratsbeschluss vom 11.5.1989<br />
Drosselweg (F)<br />
E<br />
Eberhardstraße (F), Ratsbeschluss vom 1.7.1970<br />
Eichendorffstraße (De)<br />
Eichholz (St), Ratsbeschluss vom 1.7.1970<br />
Elsternweg (F)<br />
Engelbertstraße (F)<br />
Eulenstraße (F)<br />
F<br />
Fasanenweg (F), Ratsbeschluss vom 10.11.1976<br />
Feldstraße (Ar)<br />
Feuerwehrstraße (Al), Ratsbeschluss vom 1.7.1970<br />
Fichtenweg (F)<br />
Fingers Kamp (F), Beschluss vom 14.3.2000<br />
Finkenweg (La)<br />
Fischerssiepen (F)<br />
Flie<strong>der</strong>weg (F)<br />
Freiheitstrasse (F)<br />
Friedhofstraße (F)<br />
Friedrich-Bering-Straße (F)<br />
Friedrich-Ebert-Straße (De)<br />
Frömerner Straße (Ost), Ratsbeschluss vom 1.7.1970<br />
Fuchskaute (F), Ratsbeschluss vom 8.9.1994<br />
Fuhrweg (Al), Ratsbeschluss vom 1.7.1970<br />
G<br />
Gartenstraße (La)<br />
Gerstenkamp, (Fr), Ratsbeschluss vom 9.6.1999<br />
Geschwister-Scholl-Straße (F), Ratsbeschluss vom 20.12.1972<br />
Gladiolenweg (F)<br />
Goethestraße (F)<br />
Goldbreite (Ar), Ratsbeschluss vom 9.2.1989<br />
Graf-Adolf-Straße (F)<br />
Graf-Ezzo-Weg (Ba), Ratsbeschluss vom 4.7.1991<br />
Grüner Weg (F)<br />
H<br />
Hainbach (Ar)<br />
Hanns-Martin-Schleyer-Straße (F), Ratsbeschluss vom 4.10.1978<br />
Hans-Böckler-Straße (F), Ratsbeschluss vom 2.10.1986<br />
Hardenbergstraße (F), Ratsbeschluss vom 1.7.1970<br />
Hasensprung (F), Ratsbeschluss vom 5.6.1974<br />
Haßleistrasse (F)<br />
Hauptstraße (Durchgangsstraße De, La), Ratsbeschluss vom 1.7.1970<br />
Heckenweg (Ost), Ratsbeschluss vom 1.7.1970<br />
Heideweg (Durchgangsstraße Str,Ar)
105<br />
Hellkammer (Durchgangsstraße Ba, Be), Ratsbeschluss vom 1.7.1970<br />
Hellweg (Str), Ratsbeschluss vom 1.7.1970<br />
Hengstenbergstraße (F)<br />
Henrichsknübel (St), Ratsbeschluss vom 1.7.1970<br />
Herdicker Kamp (Str), Ratsbeschluss vom 18.2.1976<br />
Hermann-Löns-Straße (F)<br />
Hilkenhohl (Ar)<br />
Hinter den Kämpen (Fr), Ratsbeschluss vom 12.12.1979<br />
Hintere Straße (De)<br />
Hirschberg (F)<br />
Hohenheide (Durchgangsstraße F, Ne, Fro)<br />
Holtkamp (Ba), Ratsbeschluss vom 1.7.1970<br />
Hubert-Biernat-Straße (Str), Ratsbeschluss vom 1.7.1970<br />
I<br />
Ibbingsen (Fr), Ratsbeschluss vom 1.7.1970<br />
Im Gründken (La), Ratsbeschluss vom 1.7.1970<br />
Im Heimgarten (La)<br />
Im Höfchen (De)<br />
Im Loh (Str)<br />
Im Rottland (Ar)<br />
Im Schelk (Durchgangsstraße Fr), für Ba Ratsbeschluss vom 1.7.1970<br />
Im Stift (F)<br />
Im Sun<strong>der</strong>n (Ba), Ratsbeschluss vom 1.7.1970<br />
Im Wiesengrund (F)<br />
In den Telgen (F)<br />
In den Wächelten (F)<br />
In <strong>der</strong> Liethe (De)<br />
In <strong>der</strong> Sasse (F), Ratsbeschluss vom 5.6.1974<br />
In <strong>der</strong> Twiete (Fr), Ratsbeschluss vom 1.7.1970<br />
In <strong>der</strong> Wahne (Ost), Ratsbeschluss vom 1.7.1970<br />
In <strong>der</strong> Waldemey (F)<br />
Irmgardstraße (F)<br />
Iserlohner Straße (Str), Ratsbeschluss vom 1.7.1970<br />
J<br />
Jägertal (F)<br />
Julius-Leber-Straße (F), Ratsbeschluss vom 18.6.1969<br />
K<br />
Kaiserstraße (Be), Ratsbeschluss vom 1.7.1970<br />
Kampstraße (Fr), Ratsbeschluss vom 1.7.1970<br />
Karl-Goerdeler-Straße (F), Ratsbeschluss vom 29.8.1984<br />
Karl-Wildschütz-Straße (F)<br />
Karrenweg (St), Ratsbeschluss vom 1.7.1970<br />
Kassberg (Str)<br />
Kesseborn (Fr)<br />
Kessebürener Weg (Ost), Ratsbeschluss vom 1.7.1970<br />
Kettelerstraße (F), Ratsbeschluss vom 9.12.1981<br />
Kiefernweg (F), Ratsbeschluss vom 20.12.1972<br />
Kirchplatz (F)<br />
Kirchweg (Ba), Ratsbeschluss vom 20.11.1970<br />
Kirschbaumliethe (De), Ratsbeschluss vom 2.9.1998<br />
Kleibusch (Str), Ratsbeschluss vom 1.7.1970
106<br />
Klusenweg (F)<br />
Kolpingstraße (F), Ratsbeschluss vom 9.12.1981<br />
Königsweg (Ne), Ratsbeschluss vom 20.11.1970<br />
Körnerstraße (F)<br />
Kornweg (Fr), Ratsbeschluss vom 19.7.1974<br />
Kuhstraße (Str)<br />
Kurt-Schumacher-Straße (F), Ratsbeschluss vom 20.12.1972<br />
L<br />
Landstraße (Durchgangsstraße Fro, Wa, Be), Ratsbeschluss vom 1.7.1970<br />
Landwehr (Fr)<br />
Lehmke (Fro)<br />
Lerchenweg (F)<br />
Lessingstraße (F)<br />
Lindenhofstraße (Fr), Ratsbeschluss vom 20.11.1979<br />
Lindenweg (F)<br />
Löhnbachstraße (F)<br />
Löhnquelle (F), Ratsbeschluss vom 5.6.1974<br />
Ludwig-Steil-Straße (F), Ratsbeschluss vom 18.6.1969<br />
M<br />
Magdalenenstraße (F)<br />
Margueritenweg (F)<br />
Markt (F)<br />
Mauritiusstraße (F)<br />
Meisenweg (La) , Ratsbeschluss vom 5.6.1974<br />
Mendener Straße (F), Ratsbeschluss vom 13.5.1993<br />
Menricusstraße (F)<br />
Merschstraße (Durchgangsstraße Fro, Wa), Ratsbeschluss vom 1.7.1970<br />
Mühlenbergstraße (F)<br />
Mühlenweg (Fr)<br />
Mutterkamp (Fr), Ratsbeschluss vom 1.7.1970<br />
N<br />
Nachtigallenweg (F), Ratsbeschluss vom 1.7.1970<br />
Natte (Str)<br />
Neimener Kirchweg (Ne), Ratsbeschluss vom 8.11.1990<br />
Neimener Weg (Ne)<br />
Nelkenweg (F)<br />
Neuenkamp (Be), Ratsbeschluss vom 1.7.1970<br />
Nie<strong>der</strong>heide (Ar), Ratsbeschluss vom 15.7.1981<br />
Nordstraße (F)<br />
O<br />
Ohlweg (De)<br />
Ölmühlenweg (Durchgangsstraße Wa, Be), Ratsbeschluss vom 1.7.1970<br />
Ostbürener Straße (Durchgangsstraße F, Ost), Ostbüren Ratsbeschluss vom 1.7.1970<br />
Ostfeld (Al), Ratsbeschluss vom 1.7.1970<br />
Ostholz (Ar), Ratsbeschluss vom 1.7.1970<br />
Ostmarkstraße (F)<br />
Otto-Wels-Straße (F), Ratsbeschluss vom 18.6.1969<br />
Overbergstraße (F)<br />
P<br />
Palzstraße (Durchgangsstraße Ba, St, Fro), Ratsbeschluss vom 1.7.1979<br />
Pappelallee (Al), Ratsbeschluss vom 1.7.1970
107<br />
Pastoratswald (Ba), Ratsbeschluss vom 1.7.1970<br />
Pater-Delp-Straße (F), Ratsbeschluss vom 18.6.1969<br />
Paul-Löbe-Straße (F), Ratsbeschluss vom 18.6.1969<br />
Penningheuers Kamp (De), Beschluss vom 12.6.2001<br />
Poststraße (Ost), Ratsbeschluss vom 1.7.1970<br />
Priorsheide (Ba), Ratsbeschluss vom 1.7.1970<br />
Prozessionsweg (Ba), Beschluss vom 30.9.2003<br />
Q<br />
Querweg (F)<br />
R<br />
Rehwinkel (F), Ratsbeschluss vom 8.9.1994<br />
Ringstraße (Al), Ratsbeschluss vom 1.7.1970<br />
Roggenweg (Fr), Beschluss vom 22.8.2000<br />
Rosenweg (De)<br />
Rudolf-<strong>Die</strong>sel-Straße (F), Ratsbeschluss vom 14.7.1982<br />
Ruhrblick (La)<br />
Ruhrstraße (F)<br />
Sch<br />
Schäferstraße (De)<br />
Schillerstraße (F)<br />
Schlehweg (F)<br />
Schlesierstraße (Ar)<br />
Schlotstraße (Wa), Ratsbeschluss vom 1.7.1970<br />
Schmiedestraße (Wa), Ratsbeschluss vom 1.7.1970<br />
Schörweken (De), Ratsbeschluss vom 1.7.1970<br />
Schröerstraße (F)<br />
Schürmanns Kamp (F), Ratsbeschluss vom 18.3.1981<br />
Schulstraße (De)<br />
Schwalbenweg (F), Ratsbeschluss vom 1.7.1970<br />
Schwarzer Kamp (Ar)<br />
Schwarzer Weg (F), Ratsbeschluss vom 30.6.1988<br />
Schwerter Straße (Al), Ratsbeschluss vom 1.7.1970<br />
S<br />
Simonweg (Str)<br />
Sonnenbergstraße (La)<br />
Springstraße (F)<br />
Starenweg (F)<br />
Steinkuhle (Ba), Ratsbeschluss vom 1.7.1970<br />
Stentroper Weg (Durchgangsstraße St, Wa), Ratsbeschluss vom 1.7.1970<br />
Strickherdicker Weg (De)<br />
Südstraße (F)<br />
Sümbergstraße (F)<br />
Sybrechtplatz (Fr), Ratsbeschluss vom 1.7.1970<br />
T<br />
Talstraße (Ar), Ratsbeschluss vom 1.7.1970<br />
Tannengarten (St), Ratsbeschluss vom 1.7.1970<br />
Thabrauck (Durchgangsstraße Ar, Str), Ratsbeschluss vom 1.7.1970<br />
Tharloh (Fr)<br />
Tulpenweg (F)<br />
Tummelplatz (Fro)
108<br />
U<br />
Ulmenweg (F)<br />
Unionstraße (F), Ratsbeschluss vom 16.6.1969<br />
Unnaer Straße (La, Str)<br />
V<br />
Veilchenweg (F), Ratsbeschluss vom 1.7.1970<br />
Vogelrute (F), Ratsbeschluss vom 13.4.1983<br />
Von-Galen-Straße (F), Ratsbeschluss vom 18.6.1969<br />
Von-Nell-Breuning-Straße (F), Beschluss vom 12.6.2001<br />
Von-Stauffenberg-Straße (F), Ratsbeschluss vom 20.12.1972<br />
Von-Steinen-Straße (Fr)<br />
Von-Tirpitz-Straße (F)<br />
W<br />
Wachtelweg (F)<br />
Waldweg (Ost), Ratsbeschluss vom 1.7.1970<br />
Wasserwerkstraße (F)<br />
Weidenweg (De), Ratsbeschluss vom 1.7.1970<br />
Weißes Feld (Fr), Ratsbeschluss vom 9.6.1999<br />
Werner-von-Siemens-Straße (F), Ratsbeschluss vom 4.10.1978<br />
Wernher-von-Braun-Straße (F), Ratsbeschluss vom 4.10.1978<br />
Westfeld (Durchgangsstraße Ar, La), Ratsbeschluss vom 1.7.1970<br />
Westick (F)<br />
Westicker Heide (F)<br />
Westicker Straße (Durchgangsstraße F, Ne)<br />
Wibbeltstraße (De), Ratsbeschluss vom 1.7.1970<br />
Wicke<strong>der</strong> Straße (Durchgangsstraße Wa, Fro, Ne, Be), Ratsbeschluss vom 1.7.1970<br />
Wilhelm-Feuerhake-Straße (F)<br />
Wilhelmstraße (Ost), Ratsbeschluss vom 1.7.1970<br />
Willi-Kettmann-Straße (Fr), Ratsbeschluss vom 20.10.1982<br />
Windgatt (Be), Ratsbeschluss vom 1.7.1970<br />
Winschotener Straße (F), Ratsbeschluss vom 5.6.1986<br />
Wulfesweide (Str), Ratsbeschluss vom 1.7.1970<br />
Z<br />
Zum Freisenhagen (F), Ratsbeschluss vom 20.12.1972<br />
Zum Siepen (Ar)<br />
Zur Dorfwäsche (Ba), Ratsbeschluss vom 1.7.1970<br />
Zur Düke (Str), Ratsbeschluss vom 1.7.1970<br />
Zur Haar (La)<br />
Zur Mark (Ost), Ratsbeschluss vom 1.7.1970<br />
Zur Tigge (Wa), Ratsbeschluss vom 1.7.1970<br />
Zur Tränke (Ba), Ratsbeschluss vom 1.7.1970
109<br />
Exkurs 7<br />
Anmerkungen zur Deutung mundartlich benannter Fluren und Gemarkungen im<br />
Zusammenhang mit ihrer Verwendung als <strong>Straßennamen</strong><br />
Von den heute im Stadtgebiet von Fröndenberg 295 gültigen <strong>Straßennamen</strong> tragen etwa 100<br />
Straßen Namen, die sich von einem Flur-, Feld- o<strong>der</strong> Gemarkungsnamen ableiteten lassen.<br />
Neben dem Bezug auf alte Besitzverhältnisse spielen dabei Bezeichnungen eine Rolle, die auf<br />
den ehemaligen Bewuchs (Wald, Weide, Wiese, Heide), die Bodenbeschaffenheit (Lehm,<br />
trockener, nasser o<strong>der</strong> sumpfiger Boden), die landwirtschaftliche Nutzung (Getreideanbau,<br />
Hude, Heuwiesen) o<strong>der</strong> die dort ehemals o<strong>der</strong> heute noch anzutreffenden Geländeverhältnisse<br />
(eben, abschüssig, am Abhang etc.) und die Lage (auf Höhenzügen o<strong>der</strong> in Tälern) hinweisen.<br />
Im Folgenden werden einige Begriffe, die für Straßenbenennungen übernommen wurden o<strong>der</strong><br />
Bestandteile von <strong>Straßennamen</strong> sind, näher erläutert 1<br />
darunter in Fettdruck ggf. ein Beispiel aus dem <strong>Fröndenberger</strong> Raum mit Ortsangabe<br />
ape, nie<strong>der</strong>deutsch für das Adverb „auf“<br />
ard, nie<strong>der</strong>deutsche Endsilbe für Acker- o<strong>der</strong> Pflugland<br />
(die) Becke o<strong>der</strong> Beke o<strong>der</strong> Bieke, verkürzt auch als Endsilbe „...ecke“ o<strong>der</strong> „...mecke“ vorkommend,<br />
nie<strong>der</strong>deutsch, Bach o<strong>der</strong> Bachlauf, als Endsilbe oft bei Ortsnamen vorkommend,<br />
die an einem Bachlauf liegen, siehe dazu auch die Deutung von „Ohl“<br />
(<strong>der</strong>) o<strong>der</strong> (das) Bil mit einem „l“, nie<strong>der</strong>deutsch, ansteigen<strong>der</strong> Stein, Felsklippe (häufiger<br />
Ortsname „Bilstein“)<br />
Im Stadtteil Ardey <strong>der</strong> Straßenname „Bilstein“<br />
(das o<strong>der</strong> <strong>der</strong>) Brauck, o<strong>der</strong> auch Brock o<strong>der</strong> Brok, nie<strong>der</strong>deutsch, Bruch o<strong>der</strong> Sumpfland<br />
aber auch für ein Geländestück, dass an einem steilen Abhang liegt, an einer „Bruchkante“,<br />
siehe dazu auch „Brink“<br />
Im Stadtteil Dellwig <strong>der</strong> Straßenname „Am Brauck“, in Strickherdicke „Beisenbrauck“<br />
(das o<strong>der</strong> <strong>der</strong>) Brink, nie<strong>der</strong>deutsch, Flurstück am Rand eines größeren zusammenhängenden<br />
Stücks Land o<strong>der</strong> am Abhang gelegen<br />
(<strong>der</strong>) Bur, nie<strong>der</strong>deutsch, Bauer<br />
Im Stadtteil Ardey <strong>der</strong> Straßenname „Burland“<br />
(die) Calle o<strong>der</strong> Kalle, nie<strong>der</strong>deutsch Geländemulde<br />
(<strong>der</strong>) o<strong>der</strong> (das) Dik o<strong>der</strong> <strong>Die</strong>k, nie<strong>der</strong>deutsch, Teich o<strong>der</strong> Tümpel<br />
(<strong>der</strong>) Dörrgänger, nie<strong>der</strong>deutsch, Durchgang, Durchlass (etwa durch eine Landwehrbefestigung<br />
(die) Gare o<strong>der</strong> Gähre, nie<strong>der</strong>deutsch, guter Boden, bzw. Triebkraft des Bodens und <strong>der</strong><br />
Natur = Gähren, Geile, Geilheit, Triebhaftigkeit, süddeutsch „Gäue“ (Gäuboden)<br />
1 Im Wesentlichen beruhen die Angaben auf <strong>der</strong> im Literatur- und Quellenanhang zum Thema „Flurnamen“<br />
genannten Literatur; <strong>der</strong> Verfasser hat sich im Laufe seiner Tätigkeit im Stadtarchiv eine kleine<br />
Karteikartensammlung zu diesem Thema angelegt, in <strong>der</strong> verstreut aufgefundene Hinweise aus diverser<br />
Literatur gesammelt ist.
110<br />
(<strong>der</strong>) o<strong>der</strong> (das) Gatt, nie<strong>der</strong>deutsch Gatter o<strong>der</strong> künstliche Aufschüttung, auch im Sinne von<br />
Durchlass durch ein Gatter o<strong>der</strong> eine Landwehr<br />
Im Stadtteil Bentrop <strong>der</strong> Straßenname „Windgatt“<br />
(<strong>der</strong>) o<strong>der</strong> (das) Hagen (Haagen o<strong>der</strong> auch Heggen), nie<strong>der</strong>deutsch, durch Hecken begrenztes<br />
(geschütztes) Stück Land o<strong>der</strong> Gemarkung<br />
Der Name des Stadtteils Bausenhagen<br />
(die) o<strong>der</strong> (das) Ham, nie<strong>der</strong>deutsch, Wiese<br />
(auf <strong>der</strong>) Haar, nie<strong>der</strong>deutsch, auf <strong>der</strong> Anhöhe, Höhenzug, Höhenrücken (Haarstrang!)<br />
im Stadtteil Frömern <strong>der</strong> Straßenname „Am Haarstrang“, im Stadtteil Langschede <strong>der</strong> Name „Zur Haar“<br />
(die) Haard(t), Hard(t), nie<strong>der</strong>deutsch, langgestrecktes schmales Weideland, siehe dazu auch<br />
„Haar“<br />
(die) Hed o<strong>der</strong> (das) Hees, nie<strong>der</strong>deutsch, Heide, unkultiviertes Land, Gebüsch, Gestrüpp<br />
(die) Helle, nie<strong>der</strong>deutsch, Halde o<strong>der</strong> Abhang, bergmännische Halde, in Ortsbezeichnungen<br />
mit mittelalterlicher bergmännischer <strong>Geschichte</strong> vorkommend (Hellefeld, Altenhellefeld),<br />
abgewandelt in „Höllenkopf“ (Westerwald und Siegerland)<br />
Als Name einer Verbindungsstraße zwischen den Stadtteilen Bausenhagen und Bentrop erhielt eine Straße den<br />
Namen „Hellkammer“, eventuell ursprünglich „Hellkamp“(?)<br />
(das) Hol, mit einem „l“, auch als Endsilbe „...hol“, nie<strong>der</strong>deutsch, Holz, Gehölz, aber auch<br />
Rodung o<strong>der</strong> aus Sumpf- o<strong>der</strong> Pol<strong>der</strong>land gewonnen (Hol-land, =Holland!)<br />
(<strong>der</strong>) o<strong>der</strong> (das) Holkamp, nie<strong>der</strong>deutsch, allgemein Land- o<strong>der</strong> Ackerland aus einer Rodung<br />
gewonnen, „Holmannskamp“ = Rodungsland, dass einem Bauern gehört, <strong>der</strong> es gerodet hat<br />
und <strong>der</strong> dann Hol(l)mann genannt wird.<br />
(<strong>der</strong>) o<strong>der</strong> (das) Hollkamp o<strong>der</strong> Hellkamp, nie<strong>der</strong>deutsch, Ackerland am Hang, siehe aber<br />
auch unter „Hol“ und unter „Helle“<br />
Im Stadtteil Bausenhagen <strong>der</strong> Straßenname „Holtkamp“<br />
(das) Husen, nie<strong>der</strong>deutsch, Haus o<strong>der</strong> auch Ansammlung von Häusern, Wohnplatz<br />
Der Name des Stadtteils Frohnhausen)<br />
(das) o<strong>der</strong> (<strong>der</strong>) Kamp, nie<strong>der</strong>deutsch, Feld o<strong>der</strong> freies (von Wohn- o<strong>der</strong> Gehöftbebauung<br />
freies) Land<br />
Im Stadtteil Ardey <strong>der</strong> Straßenname „Schwarzer Kamp“ (dunkle schwere Erde) o<strong>der</strong> <strong>der</strong> Name „Kampstraße“ in<br />
Fröndenberg. In Verbindung mit ehemaligen Besitzverhältnissen o<strong>der</strong> Anbau von Getreide; so im Stadtteil Frömern<br />
die Bezeichnung „Gerstenkamp“ o<strong>der</strong> in Fröndenberg „Fingers Kamp“; im Stadtteil Bentrop „Neuenkamp“, im<br />
Stadtteil Frömern <strong>der</strong> Straßenname „Hinter den Kämpen“<br />
(die) Kluse, mundartliche Verfremdung <strong>der</strong> klösterlichen Einsiedelei o<strong>der</strong> <strong>der</strong> Klause<br />
In Fröndenberg <strong>der</strong> Straßenname „Klusenweg“<br />
(<strong>der</strong>) o<strong>der</strong> (das) Knapp, nie<strong>der</strong>deutsch, Abhang, Berg<br />
(<strong>der</strong>) o<strong>der</strong> (das) Laie o<strong>der</strong> Leye, nie<strong>der</strong>deutsch, Fels- o<strong>der</strong> Schiefergestein<br />
Haßleistraße in Fröndenberg
111<br />
(die) Lanfer o<strong>der</strong> Lamfer, mundartliche Verkürzung für „Landwehr“<br />
(<strong>der</strong>) o<strong>der</strong> (das) Lieth o<strong>der</strong> Liethe, nie<strong>der</strong>deutsch, Lichtung, urbar gemachtes Waldstück<br />
Im Stadtteil Dellwig die <strong>Straßennamen</strong> „Kirschbaumliethe“ und „In <strong>der</strong> Liethe“<br />
(das) Loh o<strong>der</strong> (<strong>der</strong>) Löhn, nie<strong>der</strong>deutsch, kleiner Wald o<strong>der</strong> kleines Gehölz, Nie<strong>der</strong>wald<br />
o<strong>der</strong> Bezeichnung für ein Stück Land, das ehemals bewaldet war<br />
Warmer Löhn im Stadtteil Warmen an den Ruhrwiesen, Auenlandschaft o<strong>der</strong> in Fröndenberg <strong>der</strong> Name für den in<br />
einem Waldstück entspringenden „Löhnbach“ mit entsprechend davon abgeleiteten <strong>Straßennamen</strong>; im Stadtteil<br />
Strickherdicke <strong>der</strong> Name „Im Loh“<br />
(die) o<strong>der</strong> (das) Mersch, nie<strong>der</strong>deutsch, ursprünglich „Marsch“, fruchtbare Nie<strong>der</strong>ung,<br />
Schwemmland<br />
<strong>Die</strong> Verbindungsstraße zwischen Frohnhausen und Warmen im Ruhrtal trägt den Namen „Merschstraße“<br />
(die) Mutte, Mehrzahl Mutten, nie<strong>der</strong>deutsch, Mutterschweine<br />
falsch im Stadtteil Frömern benannte Straße „Mutterkamp“, eigentlich richtig „Muttenkamp“, dort wo früher die<br />
Schweine im Sommer im Freien gehalten wurden<br />
(<strong>der</strong>) o<strong>der</strong> (das) Ohl o<strong>der</strong> Endsilbe „...ohl“, nie<strong>der</strong>deutsch, sumpfig feuchtes Land, Bachgrund,<br />
Siedlung an einem Bach- o<strong>der</strong> Flusslauf<br />
Im Stadtteil Dellwig die Bezeichnung „Ohlweg“<br />
(<strong>der</strong>) Pal, nie<strong>der</strong>deutsch, Pfahl o<strong>der</strong> Grenzpfahl, auch als Endsilbe „...pal“ verwendet,<br />
Herkunft für den Begriff „Pfalz“ als Grenzland o<strong>der</strong> von Grenzpfählen umgebenes Land<br />
Im Osten von Fröndenberg die Ortsverbindungsstraße „Palzstraße“<br />
Endsilbe „...rod“ o<strong>der</strong> „...rodt“ bei Ortsnamen, nie<strong>der</strong>deutsch, modriges Land, Sumpf o<strong>der</strong><br />
aber auch Rodung, siehe dazu aber auch „hol“ und „Holkamp“<br />
Im Stadtteil Ostbüren <strong>der</strong> Straßenname „Am Rodbusch<br />
(<strong>der</strong>) o<strong>der</strong> (das) Rottland, nie<strong>der</strong>deutsch, gerodetes Land<br />
Im Stadtteil Ardey <strong>der</strong> Straßenname „Im Rottland“<br />
(<strong>der</strong>) o<strong>der</strong> (das) Scheid, nie<strong>der</strong>deutsch, Flurstück von bestimmter Größe, auch als Endsilbe für<br />
die Gesamtgemarkung eines Dorfes, einer Bauerschaft o<strong>der</strong> eines Wohnplatzes verwendet.<br />
(<strong>der</strong>) o<strong>der</strong> (das) Schelk, nie<strong>der</strong>deutsch, abgeteiltes Stück Land, Gemarkung<br />
In Fröndenberg und im Stadtteil Bausenhagen die Bezeichnung „Im Schelk“<br />
(die) Schlade, nie<strong>der</strong>deutsch, Talschlucht<br />
(<strong>der</strong>) Schlag, mundartlich <strong>der</strong> Rodungsplatz, wo Bäume geschlagen wurden<br />
Im Wohngebiet <strong>der</strong> Straßenname „Auf dem Krittenschlag“, ursprünglich „Kreitenschlag“, wobei <strong>der</strong> Begriff<br />
„Kreite“ o<strong>der</strong> „Kritte“ nicht zu ermitteln ist<br />
(<strong>der</strong>) o<strong>der</strong> (die) Sife, nie<strong>der</strong>deutsch, Bach, siehe dazu auch unter „Siepen“<br />
(<strong>der</strong>) Siepen, nie<strong>der</strong>deutsch, feuchte Nie<strong>der</strong>ung, sumpfiges Gelände, von Wasser durchzogen,<br />
im <strong>Fröndenberger</strong> Raum meist verwendet bei <strong>der</strong> Bezeichnung eines Quellgebietes<br />
„Dörrsiepen“ im Stadtteil Dellwig für einen Weg an einem ausgetrockneten o<strong>der</strong> im Sommer austrocknenden<br />
Bachlauf o<strong>der</strong> in Deutung des Wortes „Dörr“ (=durch) ein „Durchfluss“ in Fröndenberg <strong>der</strong> Straßenname<br />
„Fischerssiepen“
112<br />
(die) Sode, nie<strong>der</strong>deutsch, Wiesenstück, abgetrenntes Stück o<strong>der</strong> abgehobene erste obere<br />
Deckschicht einer Wiese, die an<strong>der</strong>swo wie<strong>der</strong> Verwendung findet<br />
in Fröndenberg die Straße „Auf dem Sodenkamp“ für eine ehemalige Wiese<br />
(<strong>der</strong>) Spiert, nie<strong>der</strong>deutsch, Spieß, übertragen auf Flurbezeichnungen ein spitz zulaufendes<br />
Stück Land<br />
im Stadtteil Frömern die Straße „Auf dem Spitt“ in abgewandelter Form des Begriffs „Spiert“<br />
(<strong>der</strong>) o<strong>der</strong> (das) Stodt o<strong>der</strong> Stoth, nie<strong>der</strong>deutsch, (Holz)stoss, aufgeschichteter Haufen, aber<br />
auch mit den Beiwörtern „auf dem...“ o<strong>der</strong> „an dem...“ verwendet für steil abfallenden<br />
(aufsteigenden) Hügel<br />
(<strong>der</strong>) o<strong>der</strong> (die) Einzahl-Mehrzahl Stuken, nie<strong>der</strong>deutsch, Stamm- und Wurzelreste bei<br />
Kahlschlag einer Waldfläche o<strong>der</strong> nach einem Windbruch, ostdeutsch „Stubben“<br />
(die) Telgen (Mehrzahl), nie<strong>der</strong>deutsch, Bezeichnung für junge Eichen, die in<br />
Gemeinschaftsgemarkungen angepflanzt wurden zur späteren Schweinemast<br />
Im Wohngebiet Hohenheide <strong>der</strong> Straßenname „In den Telgen“ (wörtlich: Im jungen Eichenwäldchen)<br />
(<strong>der</strong>) o<strong>der</strong> (das) Thar o<strong>der</strong> Tha, nie<strong>der</strong>deutsch für schweren (Lehm)boden, kennzeichnet in<br />
den Flurbezeichnungen oft Wege zu ehemaligen Ton- o<strong>der</strong> Lehmgruben, Ziegeleien<br />
Im Stadtteil Strickherdicke <strong>der</strong> Straßenname „Thabrauck“, im Stadtteil Frömern die Bezeichnung „Tharloh“<br />
(die) o<strong>der</strong> (an <strong>der</strong>) Twiete, nie<strong>der</strong>deutsch, Weggabelung, Gabelung in „twei“(nie<strong>der</strong>deutsch<br />
zwei) Richtungen<br />
(in den) Wächelten, nie<strong>der</strong>deutsch, Wäldchen, Nie<strong>der</strong>wald<br />
Im Wohngebiet Hohenheide <strong>der</strong> Straßenname „In den Wächelten“<br />
(die) Waldemey o<strong>der</strong> Waldemay, nie<strong>der</strong>deutsch, Gemeinheitswald, Waldbezirk zur gemeinsamen<br />
Nutzung, gemeinsamer Besitz mehrerer Markgenossen unter Verwaltung eines Vorstehers<br />
(Holzrichters)<br />
Im Wohngebiet Hohenheide <strong>der</strong> Straßenname „In <strong>der</strong> Waldemey“<br />
(das) Widum o<strong>der</strong> Widdum, mittelalterlich für Stiftung, Kloster o<strong>der</strong> Pfarrhof („Witwentum“,<br />
Nachlassstiftung einer Witwe, Witwennachlass), aus dem nie<strong>der</strong>deutschen „wedeme“,<br />
umgangssprachlich verän<strong>der</strong>t in „Wieme“<br />
Endsilbe „...wig“ o<strong>der</strong> „...wick“ bei Ortsnamen, abgeleitet vom lateinischen „vicus“ (Dorf), in<br />
manchen Fällen nicht als Endsilbe son<strong>der</strong>n eigenständig verwendet als Ortsname („Wickede“)<br />
In Fröndenberg die Straßenbezeichnung „Westick“ und „Westicker Straße“ u.a.<br />
(die) Mehrzahl Wülfe o<strong>der</strong> Wulfe, nie<strong>der</strong>deutsch, Wildschweine (nicht etwa Wölfe)<br />
Im Stadtteil Strickherdicke <strong>der</strong> Straßenname „Wulfesweide“<br />
<strong>Die</strong>se in ihrer Deutung keineswegs als wissenschaftlich anzusehende Auswahl einiger Wörter<br />
kann hilfreich sein bei <strong>der</strong> Deutung vieler im <strong>Fröndenberger</strong> Raum vorkommenden <strong>Straßennamen</strong>,<br />
<strong>der</strong>en Benennung gerade in den ehemaligen kleineren Gemeinden auf Vorschlag <strong>der</strong><br />
Ortsheimatpfleger wie <strong>der</strong> alt-eingesessenen Bevölkerung zu Stande gekommen ist.<br />
Einerseits dürfen diese Deutungsversuche <strong>der</strong> Namen nach alten Flur- und Gemarkungsnamen<br />
nicht streng wissenschaftlich als fundiert hieb- und stichfest gelten, aber an<strong>der</strong>erseits kommt<br />
<strong>der</strong> alten mündlichen Überlieferung eine nicht zu unterschätzende Bedeutung zu.
113<br />
<strong>Die</strong> Benennung nach diesen alten Namen erscheint retrospektiv betrachtet jedenfalls für die<br />
Dörfer (und heutigen Stadtteile) sinnvoller und heimatverbundener gewesen zu sein als die<br />
Benennung nach örtlichen (damaligen) Gegebenheiten wie beispielsweise ein Blick auf die<br />
<strong>Straßennamen</strong> in Ostbüren zeigt. Dort wurden in <strong>der</strong> Umbenennungsphase 1968/70 die<br />
Namen „Poststraße“ und „Am Sportplatz“ gewählt; heute gibt es keine Post o<strong>der</strong> Poststelle<br />
mehr in Ostbüren und auch <strong>der</strong> Sportplatz befindet sich heute an an<strong>der</strong>er Stelle. Mit <strong>der</strong> Namensvergabe,<br />
die sich nach alten Hofesnamen o<strong>der</strong> Flurnamen gerichtet hätte, wäre diese (aus<br />
heutiger Sicht) Fehlbenennung vermieden worden.
114<br />
Schluss<br />
Zusammenfassung des Forschungsergebnisses<br />
Insgesamt 344 verschiedene <strong>Straßennamen</strong> können für das heutige Stadtgebiet von Fröndenberg<br />
nachgewiesen werden. 1 <strong>Die</strong>se Zahl darf jedoch nicht identisch zur Zahl <strong>der</strong> benannten<br />
Straßen gesetzt werden.<br />
Von diesen 344 <strong>Straßennamen</strong> bilden 295 <strong>Straßennamen</strong> den Bestand zum 31.12.2004.<br />
Das Ziel, für jede <strong>der</strong> 344 vergebenen Namen das Benennungsdatum exakt zu nennen, konnte<br />
aus zwei grundsätzlich von einan<strong>der</strong> zu unterscheidenden Gründen nicht erreicht werden:<br />
1. Trotz intensiver Recherche war es nicht möglich, für alle Benennungen nach 1912<br />
einen entsprechenden Beschluss des zuständigen Gemeinde- o<strong>der</strong> Stadtrates nachzuweisen,<br />
o<strong>der</strong> das Benennungsdatum durch die Überlieferung in den Akten des<br />
Bauamtes o<strong>der</strong> des Einwohnermeldeamtes parallel zu ermitteln. <strong>Die</strong>ser Fakt ist<br />
ärgerlich, wenn das Benennungsdatum in eine Zeit fällt, die im Prinzip durch die<br />
Aktenüberlieferung und durch lückenlos vorhandene Gemein<strong>der</strong>atsprotokolle abgedeckt<br />
ist. Nachvollziehbar, aber deswegen nicht weniger ärgerlich für einen zu vermutenden<br />
Benennungszeitraum, <strong>der</strong> nicht durch vorhandene Aktenüberlieferung abgedeckt<br />
werden kann. <strong>Die</strong>s bezieht sich vor allem auf das Fehlen von Gemein<strong>der</strong>atsprotokollen<br />
einiger amtsangehöriger Gemeinden, in denen es bereits vor 1968<br />
Straßenbenennungen gegeben hat; im Falle <strong>der</strong> Gemeinden Langschede und Ardey<br />
bereits vor 1945. Auch ein Benennungszeitraum für die vor 1945 existierenden<br />
Straßen im Wohngebiet Hohenheide kann nur sehr ungenau mit „vor 1933“ angegeben<br />
werden.<br />
2. Bis in das Jahr 1906 reicht die Überlieferung <strong>der</strong> Gemein<strong>der</strong>atsprotokolle zurück und<br />
1912 heißt es im Fall <strong>der</strong> „Sümbergstraße“ erstmals in den Gemein<strong>der</strong>atsprotokollen<br />
sinngemäß. „<strong>Die</strong> Straße erhält den Namen „Sümbergstraße.“ Gleichlautende Einträge<br />
für an<strong>der</strong>e Straßen zwischen 1906 und 1912 können nicht nachgewiesen werden. Es ist<br />
daher mit hoher Wahrscheinlichkeit anzunehmen, dass es konkrete Benennungsdaten<br />
für alle Straßen in <strong>der</strong> Gemeinde Fröndenberg vor 1912 nicht gibt und entsprechend<br />
nicht nachgewiesen werden können. Trotzdem ist es in einzelnen Fällen durch<br />
Nennung von <strong>Straßennamen</strong> in den Gemein<strong>der</strong>atsprotokollen möglich, den Benennungszeitraum<br />
wenigstens einzugrenzen und darüber hinaus ggf. den genannten<br />
<strong>Straßennamen</strong> in den Kontext <strong>der</strong> kommunalen <strong>Geschichte</strong> einzubinden.<br />
Aus den beiden aufgeführten Gründen bleiben folgende Lücken festzuhalten:<br />
<br />
<br />
Kein Benennungsdatum für 25 vor 1912 existierende Straßen (berührt den o.a.<br />
Punkt 2<br />
Kein Benennungsdatum für 29 <strong>Straßennamen</strong>, die zwischen 1912 und 1945 zur<br />
Benennung angestanden haben, bzw. in <strong>der</strong> amtlichen Überlieferung ab 1945<br />
vorhanden sind. <strong>Die</strong>ses betrifft in <strong>der</strong> Hauptsache die Straßen im Wohngebiet<br />
Hohenheide, sowie die vor 1945 zu vermutende Benennung von Straßen in den<br />
Gemeinden Langschede und Ardey. (berührt den o.a. Punkt 1)<br />
1 <strong>Die</strong> Zahl setzt sich zusammen aus den heute gültigen <strong>Straßennamen</strong>, den nicht mehr gültigen (umbenannt o<strong>der</strong><br />
eingezogen) <strong>Straßennamen</strong> abzüglich <strong>der</strong> exakt 1:1 nachzuweisenden Doppelnamen, auch wenn die eine<br />
Straße in <strong>der</strong> Gemeinde A, die an<strong>der</strong>e in <strong>der</strong> Gemeinde B nachgewiesen werden kann. So ist <strong>der</strong> Straßenname<br />
„Bahnhofstraße“ für drei Gemeinden nachzuweisen, wird aber nur einmal gezählt, während <strong>der</strong> lediglich<br />
ähnlich klingende Name „Bahnhofsallee“ eigenständig mitgezählt wird.
115<br />
<br />
Kein Benennungsdatum für 7 <strong>Straßennamen</strong> nach 1945, davon 6 in <strong>der</strong> Gemeinde<br />
Langschede zwischen 1949 und 1967, sowie 1 Straße in <strong>der</strong> Gemeinde Dellwig<br />
zwischen 1950 und 1961. (berührt den o.a. Punkt 1)<br />
Das heißt: Bei 61 Straßenbenennungen (von 344 = knapp 18%) kann <strong>der</strong> Benennungszeitpunkt<br />
nur annähernd ermittelt werden.<br />
Erfreulich ist, dass nahezu je<strong>der</strong> Straßenname in irgend einer Art und Weise zu deuten ist,<br />
auch wenn in vielen Fällen die Bemerkung „benannt nach einem Flur- und Gemarkungsnamen“<br />
o<strong>der</strong> „nach einem nie<strong>der</strong>deutschen Ausdruck benannt“ nicht in jedem Fall zu befriedigen<br />
vermag. Der Verfasser ist hier sprachwissenschaftlich nicht gebildet genug, um in<br />
jedem Fall „Dichtung und Wahrheit“ in <strong>der</strong> im Literaturverzeichnis genannten „Fachliteratur“<br />
zur Flurnamenerforschung auseinan<strong>der</strong> zu halten. Viele schlüssig klingenden Deutungsmuster<br />
erscheinen zu einfach o<strong>der</strong> zu weit hergeholt. <strong>Die</strong>ses Misstrauen mag aber auch seinen Grund<br />
haben durch Vorbehalte gegen oftmals noch an die „Blut und Boden-Forschung“ <strong>der</strong><br />
Nationalsozialisten erinnernden Forschungsansätze und Forschungsziele mancher Autoren<br />
und Hobbyforscher in diesem Bereich.<br />
Auch die „Urkeimzelle“ des <strong>Fröndenberger</strong> Ortsmittelpunktes und Keimzelle <strong>der</strong><br />
Klosteransiedlung, nämlich <strong>der</strong> Haßleiberg, bzw. die danach genannte „Haßleistraße“ die sich<br />
bisher hartnäckig jeglichem Deutungsmuster entzogen hat, könnte mundartlich nie<strong>der</strong>deutsch<br />
mit einiger Phantasie auf die sprachliche Urform „Laie“ o<strong>der</strong> „Leye“ zurückgeführt 2 werden<br />
als Bezeichnung für einen felsigen Untergrund, was im Falle des Haßleiberges ja durchaus<br />
zuträfe.<br />
Über die eigentliche <strong>Geschichte</strong> <strong>der</strong> <strong>Straßennamen</strong> hinaus erschien es wichtig und sinnvoll,<br />
neben <strong>der</strong> reinen Benennungsgeschichte auch die Bau- und Siedlungsgeschichte mit in die<br />
Darstellung einzubeziehen. <strong>Die</strong> Benennung alleine darzustellen ohne die <strong>Geschichte</strong> <strong>der</strong> zu<br />
benennenden Objekte, <strong>der</strong> Straßen und Plätze, wäre eine aus dem Zusammenhang <strong>der</strong><br />
Kommunalgeschichte herausgerissene Forschung gewesen, die den einen o<strong>der</strong> an<strong>der</strong>en<br />
Namen hätte erklären können, aber nur ungenügend den Kontext zur Zeitgeschichte hätte<br />
erkennen lassen.<br />
Zusammenfassend können folgende Kernaussagen zur Straßenbenennung und zu den<br />
<strong>Straßennamen</strong> in <strong>der</strong> Stadt Fröndenberg festgehalten werden:<br />
<br />
<br />
Vor 1912 3 sind amtlicherseits keine <strong>Straßennamen</strong> festgelegt worden, die Benennung<br />
beruht auf mündliche Tradierung, bzw. schriftliche Übernahme dieser<br />
mündlich tradierten Namen. Zu den ältesten tradierte Namen gehört <strong>der</strong> ehemalige<br />
Marktplatz im Stadtteil Langschede, sowie die Namen des Kernbestands an<br />
Straßen in <strong>der</strong> Gemeinde Fröndenberg rund um die Bebauung des ehemaligen<br />
Stifts und die Namen <strong>der</strong> nach allen vier Himmelsrichtung vom Stiftsbezirk<br />
ausgehenden Straßen und Wege nach Unna, Ostbüren, Westick, Ardey und zur<br />
Ruhr.<br />
Nach 1912, bzw. nach <strong>der</strong> Zusammenlegung <strong>der</strong> selbständigen Gemeinden Stift<br />
Fröndenberg, Dorf Fröndenberg und Westick 1902 und <strong>der</strong> Verabschiedung eines<br />
ersten Ortsstatuts und einer Polizeiverordnung bezüglich des Straßenausbaus 1906<br />
2 Siehe dazu den Exkurs 7<br />
3 Am 26.10.1912 kann erstmals eine amtliche Straßenbenennung nachgewiesen werden („Sümbergstraße“)
116<br />
beginnt die planmäßige Bebauung vorhandenen o<strong>der</strong> neu angelegter Straßen. <strong>Die</strong><br />
bisher „wild genummerten“ Häuser erhalten eine durchgehend am Straßenverlauf<br />
orientierte Hausnummerierung und <strong>der</strong> Gemein<strong>der</strong>at beschließt offizielle <strong>Straßennamen</strong>,<br />
die durch die Polizeiverwaltung zu bestätigen und zu genehmigen sind. Bei<br />
<strong>der</strong> Bebauung des Sümberg und <strong>der</strong> dort notwendigen Straßenbenennung werden<br />
bezugnehmend und vorausschauend auf die 1930 groß begangene 700-Jahr-Feier<br />
Straßen nach Gestalten <strong>der</strong> märkischen <strong>Geschichte</strong>, sowie <strong>der</strong> Kloster- und<br />
Kirchengeschichte gewählt. Durch Benennungen in den 1950er Jahren, sowie in<br />
<strong>der</strong> Umbenennungsphase 1968/70 wird diese Benennung mit geschichtlichem<br />
Hintergrund abgerundet.<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Mit Beginn <strong>der</strong> Tätigkeit eines nationalsozialistisch ausgerichteten Gemein<strong>der</strong>ats<br />
ab Frühjahr 1933 wird durch umfangreichen Straßenbau, Pflasterung und<br />
Kanalisation vorhandener Straßen und umfangreiche Benennung von Straßen im<br />
deutschnationalen („Dichter und Denker“) und nationalsozialistischen Sinn (von<br />
Hitler bis zur Ostmark) in Teilen durchaus erfolgreich die bisherige Industriegemeinde<br />
äußerlich zu eine „aufgeräumte“ Kleinstadt umzuwandeln. Erfolgreich<br />
durchgeführte Maßnahmen werden jedoch zu Kriegsende durch Zerstörungen<br />
(Möhnekatastrophe, Bombenangriffe und Bodenkämpfe) zunichte gemacht;<br />
1945-46 werden einige 1933 geän<strong>der</strong>te <strong>Straßennamen</strong> rückbenannt.<br />
Zwischen 1949 und 1967 setzt eine rege Wohnbautätigkeit ein und die entstehenden<br />
Wohnstraßen werden möglichst neutral nach Blumen und Bäumen<br />
benannt, die Benennung nach „Dichtern und Denkern“ wird nicht fortgesetzt, nur<br />
in Einzelfällen werden Gemarkungs- und Flurnamen bevorzugt.<br />
Entwicklung in den Gemeinden: Beginnend in den Industriegemeinden Langschede<br />
und Ardey noch vor 1945 und fortgesetzt in den ebenfalls westlich<br />
gelegenen Gemeinden Strickherdicke und Dellwig ab 1949/50 bis hin zum Jahr<br />
1960 in <strong>der</strong> Gemeinde Frömern setzt eine ähnliche Entwicklung in den amtsangehörigen<br />
Gemeinden erst später ein. Bis 1967 gibt es in den östlichen amtsangehörigen<br />
Gemeinden keine offiziellen Stras-sennamen; die Gemein<strong>der</strong>äte und<br />
Bürgermeister halten dieses für unnötig und überflüssig. Mehr als in <strong>der</strong> Kernstadt<br />
wird in den Gemeinden Wert auf die Überlieferung von Flur- und Gemarkungsnamen<br />
gelegt, daneben kommen örtliche Gegebenheiten, wie etwa die Lage rund<br />
um die Kirche, o<strong>der</strong> die Führung <strong>der</strong> Straßen längs des Bahnhofs, eines Sportplatzes<br />
o<strong>der</strong> einer Schule zum Tragen.<br />
Wachsendes Primat <strong>der</strong> Verwaltung gegenüber dem Rat: Nach dem Zweiten<br />
Weltkrieg übernimmt zunehmend die Verwaltung von <strong>der</strong> einen Seite und <strong>der</strong> vom<br />
Rat benannte Wegebau- und Friedhofsausschuss von <strong>der</strong> an<strong>der</strong>en Seite her dem<br />
Gemeinde- und Stadtrat abstimmungsfähige Vorlagen zu Straßenbenennungen zu<br />
liefern. Ab den 1990er Jahren werden Straßenbe-nennungen alleine durch die<br />
Zusammenarbeit von Ausschüssen und Bauamt durchgeführt; dem Rat werden die<br />
Ergebnisse zugeleitet, denen er seine Zu-stimmung verweigern kann; es findet zu<br />
diesem Thema i.d.R. keine grundsätzliche Beratung mehr im Stadtrat statt, eine<br />
vorherige Einigkeit im zuständigen Aus-schuss vorausgesetzt.<br />
Ostgebiete kontra Wi<strong>der</strong>stand: Ende <strong>der</strong> 1960er Jahre werden die Straßen im<br />
Neubaugebiet des westlichen Mühlenberges nach Personen des deutschen<br />
Wi<strong>der</strong>standes gegen das NS-Regime benannt, <strong>der</strong> Vorschlag einer Benennung
117<br />
nach Städtenamen <strong>der</strong> „Ostgebiete“ scheitert zu diesem Zeitpunkt an den<br />
Mehrheitsverhältnissen im Stadtrat wie auch einige Jahre später durch Einspruch<br />
<strong>der</strong> Anlieger in einem an<strong>der</strong>en geschlossenen Wohngebiet.<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<strong>Die</strong> kommunale Neuordnung zum 1.1.1968 bedingt die Umbenennung zahlreicher<br />
Straßen wegen Namensdoppelung in einigen Stadtteilen und die bisher straßennamenlosen<br />
Gemeinden und nunmehrigen Stadtteile im Osten des Stadtgebietes<br />
erhalten erstmals <strong>Straßennamen</strong>. Überwiegend werden die Straßen nach alten<br />
Gemarkungs- und Flurnamen benannt. Auch Benennungen nach 1970 richten sich<br />
in erster Linie nach diesem Kriterium. Ausnahme ist <strong>der</strong> Stadtteil Frömern, in dem<br />
alleine dort drei Straßen nach Persönlichkeiten <strong>der</strong> Ortsgeschichte benannt sind.<br />
Wachsen<strong>der</strong> Einfluss <strong>der</strong> Anlieger und Bürgerschaft: <strong>Die</strong> umfangreichen Verän<strong>der</strong>ungen<br />
werden durch das Bauamt, den Wegebau- und Friedhofsausschuss,<br />
sowie von einer extra dafür eingerichtete Son<strong>der</strong>kommission geplant. Im Nachgang,<br />
sowie in Einzelfällen bereits in <strong>der</strong> Planungsphase, kommt es zu teils<br />
massiven Protesten <strong>der</strong> Anlieger, die sich eine Benennung o<strong>der</strong> Umbenennung<br />
ihrer Wohnstraßen nicht mehr in allen Fällen durch die Verwaltung und Politik<br />
vorschreiben lassen wollen. Zunächst reagiert die Verwaltung darauf ablehnend<br />
und „obrigkeitsstaatlich“, trifft aber im Jahr 1981/82 die bürgernahe und „wegweisende“<br />
Entscheidung, dass vor Benennung und Umbenennung einer Straße die<br />
betroffenen Anlieger in jedem Fall zu befragen, bzw. in den Namenfindungsprozess<br />
einzubeziehen sind.<br />
Im Umkehrschluss wird dadurch allerdings bis heute die in einigen Fällen politisch<br />
gewollte Umbenennung einiger mit umstrittenen <strong>Straßennamen</strong> versehener Straßen<br />
massiv behin<strong>der</strong>t und abgeblockt. Mit Hinweis auf die notwendige und meist nicht<br />
zu erreichende Zustimmung <strong>der</strong> Anlieger wurden somit Umbenennungspläne<br />
vereitelt. („Von-Tirpitz-Straße“, „Hengstenbergstrasse“ o<strong>der</strong> „Ostmarkstraße“)<br />
Benennung von Industriestraßen: Ende <strong>der</strong> 1970er bis Anfang <strong>der</strong> 1980er Jahre<br />
entsteht im Ruhrtal entlang <strong>der</strong> Bahnlinie im Osten des Stadtgebiets ein<br />
Industriegebiet, dessen Straßen nach Pionieren <strong>der</strong> Industriegeschichte benannt<br />
werden, ebenso wird an die Rolle <strong>der</strong> Gewerkschaften erinnert, sowie des<br />
ermordeten Arbeitgeberpräsidenten Schleyer gedacht. Bis heute ist dies das letzte<br />
größere thematisch zusammenhängend benannte Straßenviertel im Stadtgebiet.<br />
Anfang <strong>der</strong> 1990er Jahre entsteht noch die flächenmäßig aber sehr viel kleinere<br />
geschlossene Wohnbebauung rund um die Kettelerstraße und Kolpingstraße.<br />
Rechtliche Grundlagen: <strong>Die</strong> Straßenbenennung war ist ein Aufgabenfeld <strong>der</strong><br />
amtlichen Verwaltungs-tätigkeit in <strong>der</strong> Verantwortung <strong>der</strong> politischen Gremien für<br />
die nahezu uneinge-schränkt die „Allzuständigkeit“ <strong>der</strong> Kommunen zum Tragen<br />
kommt gem §§ 1 und 2 <strong>der</strong> gültigen Kommunalverfassung. <strong>Die</strong>se Aussage hatte<br />
auch eingeschränkt für die Jahre 1918 - 1933 Gültigkeit, bzw. galt eingeschränkt<br />
seit Verabschiedung <strong>der</strong> revidierten Gemeindeordnung 1946, sowie uneingeschränkt<br />
seit Verabschiedung <strong>der</strong> neuen Gemeindeordnung für das Land NRW<br />
1952. Nur in begründeten Aus-nahmefällen (die in Fröndenberg bisher nicht<br />
vorgekommen sind) kann die Kommunalaufsicht des Kreises, <strong>der</strong> Bezirksregierung<br />
o<strong>der</strong> des Landes in diesem Punkt in den Entscheidungsprozess <strong>der</strong><br />
Kommune eingreifen. Es bleibt <strong>der</strong> Kommune überlassen, ob sie für den Bereich<br />
<strong>der</strong> Straßenbenennung eine eigene Satzung erlässt. In Fröndenberg ist dies bisher<br />
nicht für nötig erachtet worden. Im Allgemeinen richtet sich die Benennung von
118<br />
Straßen noch heute nach den Grundsätzen <strong>der</strong> „Verordnung über die Benennung<br />
von Straßen, Plätzen und Brücken“ aus dem April 1939, selbst-verständlich unter<br />
Auslassung <strong>der</strong> darin festgeschriebenen nationalsozialistischen Interessen und<br />
Belange. Uneinge-schränkt gilt hierbei beson<strong>der</strong>s <strong>der</strong> Grundsatz, Straßen nicht<br />
nach noch lebenden Personen zu benennen. 4<br />
4 In <strong>der</strong> laufenden Aktenüberlieferung des Bauamtes finden sich dazu einige grundlegende Aufsätze zum Thema<br />
<strong>der</strong> Straßenbe- und Umbenennung aus den Jahren 1960 - 1991, lei<strong>der</strong> ohne genaue Quellenangabe. Dem<br />
äußeren Erscheinungsbild nach stammen die Aufsätze entwe<strong>der</strong> aus den „Mitteilungen des NRW Städte- und<br />
Gemeindebundes“, aus <strong>der</strong> Zeitschrift „Demokratische Gemeinde“, aus den „Kommunalpolitischen Blättern“<br />
o<strong>der</strong> sind direkt vom „Städte- und Gemeindebund“ an die Mitgliedskommunen gerichtete Schreiben. Fast<br />
durchgehend wird Bezug genommen auf die im Text genannte Verordnung aus dem Jahr 1939.
Anhang 1<br />
Ausgewählter Quellen und Dokumente<br />
1. Drei Karten zur Verwaltungsgeschichte des Raumes Fröndenberg<br />
2. <strong>Die</strong> Anlage des Stiftes und ehemaligen Klosters Fröndenberg vor 1812<br />
3. Artikel aus dem Hellweger Anzeiger (HA) vom 1.4.1967 zum 65.Jubiläum <strong>der</strong><br />
Bildung <strong>der</strong> Gemeinde Fröndenberg aus drei selbständigen Gemeinden im Jahr 1902<br />
4. Titelblatt und eine Beispielseite des Fluchtlinien- und Bebauungsplanes <strong>der</strong> „Ortslage“<br />
Fröndenberg aus dem Jahr 1898<br />
5. Ortsstatut und Polizeiverordnung vom 16.März 1906 für die Gemeinde Fröndenberg<br />
6. Straßenverzeichnis <strong>der</strong> Gemeinde Fröndenberg aus dem Jahr 1931 und daraus<br />
entwickelt ein Straßenverzeichnis <strong>der</strong> Straßen, für die das Ortsstatut aus dem Jahr<br />
1931 Gültigkeit besaß und eine daraus entstandene „Bekanntmachung“<br />
7. Auszug aus dem Gemein<strong>der</strong>atsprotokoll <strong>der</strong> Gemeinde Fröndenberg vom 10.8.1926<br />
beinhaltend die Benennung von Straßen, u.a. die „Hengstenbergstraße“<br />
8. Auszug aus dem Gemein<strong>der</strong>atsprotokoll <strong>der</strong> Gemeinde Fröndenberg vom 27.6.1933<br />
beinhaltend die Um- und Neubenennung von Straßen<br />
9. Auszug aus dem Gemein<strong>der</strong>atsprotokoll <strong>der</strong> Gemeinde Fröndenberg vom 25.8.1933<br />
mit Bekanntgabe eines Dankschreibens des Botschafters von Hassel wegen<br />
Benennung <strong>der</strong> „Von-Tirpitz-Straße“<br />
10. Auszüge aus dem Stadtplan des Jahres 1940 Bereich Westick und Bereich Innenstadt<br />
<strong>der</strong> Gemeinde Fröndenberg<br />
11. Reichsgesetzblatt Nr.64 vom 3.4.1939 „Verordnung über die Benennung von Straßen,<br />
Plätzen und Brücken“ und Ausführungsanweisungen zur gen. Verordnung<br />
veröffentlicht am 26.7.1939 als „Run<strong>der</strong>lass <strong>der</strong> Reichsministeriums des Inneren“<br />
12. <strong>Straßennamen</strong>liste <strong>der</strong> Stadt Fröndenberg vom 24.1.1953 auf Anfor<strong>der</strong>ung <strong>der</strong><br />
Privatärztlichen Verrechnungsstelle Westfalen-Süd<br />
13. Drei aufeinan<strong>der</strong> folgende Aktenstücke zur Benennung <strong>der</strong> Straße „Am Klingelbach“<br />
aus dem Jahr 1955<br />
14. Stadtplan und dazugehöriges Straßenverzeichnis eines Plans des <strong>Fröndenberger</strong><br />
Heimat- und Verkehrsverein aus dem Jahr 1963, <strong>Straßennamen</strong>stand Sommer 1958<br />
15. Ein Schriftstück und ein Aktenstück zur Benennung <strong>der</strong> „Schlesierstraße“ in <strong>der</strong><br />
amtsangehörigen Gemeinde Ardey im Jahr 1958<br />
16. Antrag <strong>der</strong> CDU-Fraktion vom 18.6.1969 zur Benennung von Straßen im<br />
Neubaugebiet Mühlenberg-West<br />
17. Abschrift vom 17.7.1963 eines Rundschreibens aus dem „Wochendienst“ des<br />
Gemeindetages Westfalen-Lippe vom 24.6.1963 mit Bezugnahme einer Empfehlung<br />
des Bundesministers für gesamtdeutsche Fragen in je<strong>der</strong> Kommune eine „Berliner<br />
Straße“ zu benennen<br />
18. Protokollnie<strong>der</strong>schrift aus einer Sitzung <strong>der</strong> Stadt- und Amtsdirektoren des Kreises<br />
Unna am 18.6.1957 zum Tagesordnungspunkt 7 „Nummerierung <strong>der</strong> Häuser“ in<br />
einzelnen Gemeinden des Kreisgebiets<br />
19. Zeitungsausschnitte zur Stadtratssitzung vom 17.6.1969 u.a. zum Bereich Benennung<br />
<strong>der</strong> Straßen auf dem Mühlenberg vom 18./19.6.1969, sowie Zeitungsausschnitt vom<br />
18.12.1991 zum Erscheinen einer Dokumentation über die Vertreter des deutschen<br />
Wi<strong>der</strong>standes gegen das NS-Regime, denen zu Ehren Straßen benannt wurden<br />
20. Antrag <strong>der</strong> CDU-Ratsfraktion zur Benennung <strong>der</strong> „Hans-Böckler-Straße“ vom<br />
21.5.1986
21. Vorschlag <strong>der</strong> FDP-Ratsfraktion zur Umbenennung <strong>der</strong> „Ostmarkstraße“ und <strong>der</strong><br />
„Von-Tirpitz-Straße“ vom 28.6.1993, sowie eine Beschlussvorlage <strong>der</strong> Verwaltung<br />
zur Beibehaltung <strong>der</strong> Benennung „Von-Tirpitz-Straße“ mit Bezugnahme auf einen<br />
Än<strong>der</strong>ungsantrag von Prof. Dr. Roemheld vom 24.5.1993 sowie zwei Zeitungsartikel<br />
zum Antrag <strong>der</strong> FDP-Ratsfraktion vom 3.7.1993<br />
22. Brief einer Anwohnerin des neu benannten „Storchenwegs“ vom 28.1.1971 an den<br />
Bürgermeister <strong>der</strong> Stadt Fröndenberg und diverse Zeitungsausschnitte zum<br />
Themenkomplex „Storchenweg-Drosselstiege“ zwischen dem 9.-12.2.1971
Anhang 2<br />
Register sämtlicher <strong>Straßennamen</strong> im Gebiet <strong>der</strong> heutigen Stadt Fröndenberg/Ruhr<br />
mit ggf. nötigen Angaben zur Erstbenennung, früherer Benennung und/o<strong>der</strong> späterer<br />
Benennung<br />
(ohne die Berücksichtigung amtlicherseits geplanter, dann aber nicht durchgeführter<br />
Benennungen o<strong>der</strong> Umbenennungen)<br />
<strong>Straßennamen</strong> in Fettdruck markieren den Straßenbestand zum 31.12.2004<br />
<strong>Straßennamen</strong> in Kursivdruck sind heute nicht mehr existent. Sie wurden umbenannt<br />
o<strong>der</strong> im sehr geringen Umfang auch eingezogen o<strong>der</strong> aber in den verlauf bestehen<strong>der</strong><br />
an<strong>der</strong>er Straßen einbezogen<br />
<strong>Die</strong> Buchstabenkombination in Klammern hinter den <strong>Straßennamen</strong> markiert die<br />
jeweilige Zugehörigkeit zu einem Stadtteil, bzw. vor 1968 zur Zugehörigkeit zu einer<br />
amtsangehörigen Gemeinde<br />
Ist kein exaktes Benennungsdatum (i.d.R. Datum des Gemeinde- o<strong>der</strong><br />
Stadtratsbeschluss), kann dieses nicht nachgewiesen werden. Genannt ist dann <strong>der</strong><br />
gemäss Bebauung o<strong>der</strong> Nennung des Namens in an<strong>der</strong>en Zusammenhängen zu<br />
vermutende Zeitraum <strong>der</strong> Erstbenennung. Beson<strong>der</strong>s bei älteren <strong>Straßennamen</strong> ist<br />
dabei zu berücksichtigen, dass eine Nennung des Namens in verschiedenster<br />
Überlieferung nicht gleichbedeutend mit einem Benennungsdatum durch den<br />
Gemein<strong>der</strong>at übereinstimmen muss. Es ist davon auszugehen, dass ein Kernbestand<br />
alter Straßen beson<strong>der</strong>s im Innenstadtbereich nie offiziell per Gemein<strong>der</strong>atsbeschluss<br />
benannt wurde.<br />
Der in manchen Fällen verwendete Begriff „Altbestand“ bezieht sich auf nicht<br />
datierbare Benennungen vor 1968, ein Jahr für die vermutete Benennung ist je nach<br />
Quellenlage dabei nach Möglichkeit mit angegeben.<br />
Bei den genannten Benennungsdaten (und damit Datum <strong>der</strong> amtlich offiziellen<br />
Benennung) ist bei älteren Straßen beson<strong>der</strong>s in den amtsangehörigen Gemeinden zu<br />
berücksichtigen, dass diese Straßen bereits seit Jahrzehnten mündlich tradiert diese<br />
Namen führten, wenn auch nicht offiziell per Gemein<strong>der</strong>atsbeschluss festgehalten.<br />
Kürzel für die Zugehörigkeit <strong>der</strong> Straßen:<br />
Altendorf (Al)<br />
Ardey (Ar)<br />
Bausenhagen (Ba)<br />
Bentrop (Be)<br />
Dellwig (De)<br />
Frömern (Fr)<br />
Fröndenberg mit Westick und Hohenheide (F)<br />
Frohnhausen (Fr)<br />
Langschede (La)<br />
Neimen (Ne)<br />
Ostbüren (Ost)<br />
Stentrop (St)<br />
Strickherdicke (Str)<br />
Warmen Wa)
Name Benennungsdatum früherer heutiger Name o<strong>der</strong> umbenannt in<br />
Name<br />
Kursivdruck: heute nicht mehr existent<br />
siehe dann dort<br />
Adolf-Hitler-Platz (F) 19.04.1933 bereits vor 1933 Markt Markt<br />
Ahlinger Berg (De) 01.07.1970 Kirchplatz (De)<br />
Ahornweg (F) 21.10.1963<br />
Akazienweg (F) 01.07.1954<br />
Alleestraße (F) 31.07.1945 Westicker Straße (westl. Teil)<br />
1933-1945 Hermann-Göringstraße<br />
Alte Kreisstraße (Str) 22.09.1958<br />
Altendorfer Straße (Al) 01.07.1970<br />
Alter Mühlenweg (Fr) 10.05.1960<br />
Alter Weg (Str) 22.09.1958<br />
Am Backenberg (Fr) 10.05.1960<br />
Am Baumgarten (Ost) 19.07.1974 Am Graben<br />
Am Birnbaum (Fr) 10.05.1960<br />
Am Brauck (De) 09.01.1950<br />
Am Graben (Ost) 05.06.1974 Am Baumgarten<br />
Am Haarstrang (Fr) 12.12.1979<br />
Am Hahnenbusch (F) 29.08.1985<br />
Am Hang (Str) 01.07.1970 Rosenweg (Str)<br />
Am Klingelbach (F) 08.03..1955<br />
Am Kraftwerk (Wa) 01.07.1970<br />
Am Obsthof (Ost) 01.07.1970<br />
Am Rodbusch (Ost) 22.02.1995<br />
Am Sachsenwald (F) 20.04.1965<br />
Am Schwimmbad (De) 09.01.1950<br />
Am Sonnenhang (F) 23.10.1951 Eberhardstraße<br />
Am Sportplatz (Ost) 01.07.1970
Am Steinbruch (F) vor 1933<br />
Am Ufer (La)<br />
Altbestand, ca. 1963-1967, nicht zu ermitteln<br />
Am Versstück (Ar) 05.06.1974<br />
Am Walnussbaum (Ba) 12.06.2001<br />
Amselweg (La)<br />
Altbestand, ca. 1963-1967, nicht zu ermitteln<br />
Amselweg (F) 27.09.1957 Nachtigallenweg<br />
Annette-von-Droste-Hülshoff-Straße (F) 27.06.1933 Westickerfeldweg<br />
Antoniusstraße (F) nach 1914 Goethestraße<br />
Ardeyer Straße (F, Ar, La) Gesamtverlauf 01.07.1970<br />
vor 1968 in Ardey und in Langschede "Kreisstraße"<br />
Ardeyer Straße (F) vor 1850<br />
Asternweg (F) 23.10.1951<br />
Auf dem Beisen 10.08.1926 Westicker Feldweg<br />
Auf dem Brennen (Wa) 20.12.1972<br />
Auf dem Krittenschlag (F) vor 1933<br />
Auf dem Sodenkamp (F) vor 1850<br />
Auf dem Spitt (Fr) 10.05.1960<br />
Auf <strong>der</strong> Freiheit (F) vor 1850<br />
Auf <strong>der</strong> Hege (Fr) 15.12.1982<br />
Auf <strong>der</strong> Höhe (Ost) 01.07.1970<br />
Auf <strong>der</strong> Höhe (Str) 22.09.1958 Hubert-Biernat-Straße<br />
Auf <strong>der</strong> Kisse (La) 07.05.1965<br />
Auf <strong>der</strong> Linde (Str) 07.12.1999<br />
Bachstraße (De) 09.01.1950<br />
Bachstraße (Fr) 10.05.1960 In <strong>der</strong> Twiete<br />
Bahnhofsallee (La) 04.02.2003<br />
Bahnhofstraße (F) nach 1870<br />
Bahnhofstraße (Fr) 10.05.1960 Brückenstraße<br />
Bahnhofstraße (La) Altbestand, vor1927 Hauptstraße (De,La)<br />
Bauernbrücke (Ost) 01.07.1970<br />
Bauerngarten (Ar) 15.07.1981<br />
Bauernkamp (Ost) 01.07.1970<br />
Bausenhagener Straße (Ost, Ba, St, Be) 01.07.1970
Beisenbrauck (Str) 01.07.1970 Schulweg (Str)<br />
Bentroper Weg (Be) 01.07.1970<br />
Bergstraße (F)<br />
10.06.1908 erstmals aktenkundig<br />
Bertholdusstraße (F) 19.08.1924<br />
Bethelstraße (De) 20.10.1967<br />
Bielenbusch (Fr) 27.12.1968<br />
Billmericher Weg (Al) 01.07.1970<br />
Bilstein (Ar) 29.11.1965<br />
Binnerstraße (De) 28.10.1960<br />
Birkei (Ba) 01.07.1970<br />
Birkenweg (F) 23.10.1951<br />
Bismarckstraße (F) 27.06.1933 Löhnbachstraße(alt)<br />
Blumenstraße (F) 01.07.1970 Gartenstraße (F)<br />
Böckelmannweg (Str) 20.01.1960<br />
Bockenweg (Ost) 01.07.1970<br />
Bodelschwinghstraße (De) 04.09.1956<br />
Bonekamp (Fr) 27.12.1968<br />
Bonhoefferstraße (F) 18.06.1969<br />
Brameck (Ost) 01.07.1970<br />
Brandheide (F) 05.06.1974<br />
Brauck (Str) 22.09.1958 Zur Düke<br />
Brauerstraße (Fr) 10.05.1960<br />
Bredde (Ar) 01.07.1970 Karrenweg (Ar)<br />
Bruayplatz (F) 02.09.1989<br />
Brückenstraße (Fr) 01.07.1970 Bahnhofstraße (Fr)<br />
Buchenacker (Ar) 29.11.1965<br />
Burgstraße (Ost) 01.07.1970<br />
Burland (Ar) 29.11.1965<br />
Carlo-Mierendorf-Straße (F) 20.12.1972<br />
Dachsleite (F) 05.06.1974<br />
Dahlienweg (F) 27.09.1957<br />
Dellwiger Weg (Str) 22.09.1958 Strickherdicker Weg
Dorf (Fro) 25.01.1956 Palzstraße<br />
Dorfstraße (Ar) Altbestand, vor 1959<br />
Dorfstraße (Str) 22.09.1958 Kleibusch<br />
Dörssiepen (De) 11.05.1989<br />
Drosselstiege (La) Altbestand, ca. 1963-1967, nicht zu ermitteln Storchenweg<br />
Meisenweg<br />
Drosselweg (F) 02.11.1960<br />
Eberhardstraße (F) 01.07.1970 Am Sonnenhang (F)<br />
Eichendorffstraße (De) 04.09.1956<br />
Eichholz (St) 01.07.1970<br />
Elsternweg (F) 27.09.1957<br />
Engelbertstraße (F) 19.08.1924<br />
Eulenstraße (F) vor 1850 1933-1945 Horst-Wessel-Straße Eulenstraße<br />
1945-1946 Lutherstraße<br />
Fasanenweg (F) 10.11.1976<br />
Feldstraße (Ar) Altbestand, vor 1959<br />
Feldstraße (La) Altbestand, vor 1938 Ostmarkstraße (La)<br />
Feldweg (Fro) 25.01.1956 Wicke<strong>der</strong> Straße<br />
Feuerwehrstraße (Al) 01.07.1970<br />
Fichtenweg (F) 21.10.1963<br />
Fingers Kamp (F) 14.03.2000<br />
Finkenweg (La)<br />
Altbestand, ca. 1963-1967, nicht zu ermitteln<br />
Finkenweg (F) 27.09.1957 Schwalbenweg<br />
Fischerssiepen (F) 10.08.1926<br />
Flie<strong>der</strong>weg (F) 03.11.1949<br />
Freiheitstraße (F) vor 1850<br />
Friedhofstraße (F)<br />
14.09.1906 erstmalig aktenkundig<br />
Friedrich-Bering-Straße (F) 27.06.1933 Friedrichstraße<br />
Friedrich-Ebert-Straße(De) 01.10.1962<br />
Friedrichstraße (F) 06.06.1914 Friedrich-Bering-Straße<br />
Frömerner Straße (Ost) 01.07.1970<br />
Fuchskaute (F) 08.09.1994
Fuhrweg (Al) 01.07.1970<br />
Gartenstraße (La) Altbestand, vor 1930<br />
Gartenstraße (Ar) Altbestand, vor 1959 Talstraße<br />
Gartenstraße (F) nicht vor 1914, nicht nach 1926 Blumenstraße<br />
Gartenweg (De) 09.01.1950 Weidenweg<br />
Gerstenkamp (Fr) 09.06.1999<br />
Geschwister-Scholl-Straße (F) 20.12.1972<br />
Gladiolenweg (F) 12.10.1967<br />
Goethestraße (F) 27.06.1933<br />
Goldbreite (Ar) 09.02.1989<br />
Graf-Adolf-Straße (F) 19.08.1924 1945-1946 Moellerstraße<br />
16.05.1946<br />
Graf-Ezzo-Weg (Ba) 04.07.1991<br />
Grenzweg (Ar) 05.12.1952 einbezogen worden in Thabrauck<br />
Grüner Weg (F) 19.06.1953<br />
Hainbach (Ar) 20.10.1967<br />
Hanns-Martin-Schleyer-Straße (F) 04.10.1978<br />
Hans-Böckler-Straße (F) 02.10.1986<br />
Hans-Schemm-Straße (F) 03.12.1936 Magdalenenstraße<br />
Hardenbergstraße (F) 01.07.1970 bis 1933 Zwischen den Wegen<br />
1933-1970 Vom-Stein-Straße<br />
Hasensprung (F) 05.06.1974<br />
Haßleistraße (F) vor 1850<br />
Hauptstraße (De) 09.01.1950<br />
Hauptstraße (La) 01.07.1970 Bahnhofstraße (La)<br />
Heckenweg (Ost) 01.07.1970<br />
Heide (Str) 22.09.1958 einbezogen in Heideweg<br />
Heideweg (Str, Ar) Gesamtverlauf 01.07.1970<br />
Heideweg (Ar) Altbestand, vor 1959<br />
Hellkammer (Ba, Be) 01.07.1970<br />
Hellweg (Str) 01.07.1970 Landwehr (in an<strong>der</strong>er Quelle bereits 1959 anteilig Hellweg?)<br />
Hengstenbergstraße (F) 10.08.1926
Henrichsknübel (St) 01.07.1970<br />
Herdicker Kamp (Str) 18.02.1976<br />
Herrman-Göring-Straße (F) 27.06.1933 Westicker Straße (westl.Teil) Alleestraße<br />
Hermann-Löns-Straße (F) 27.06.1933<br />
Hilkenhohl (Ar) 16.07.1959<br />
Himmelssiepen (F) vor 1933 Im Jägertal<br />
Hinter den Kämpen (Fr) 12.12.1979<br />
Hintere Straße (De) 09.01.1959<br />
Hirschberg (F)<br />
nicht vor 1920, Baubeginn Keune/Kath.Krankenhaus<br />
Hohenheide (F) vor 1933<br />
Hohenheide (Fro) 25.01.1956 seit 1970 alle drei Stadtteile (F,Fro,Ne)<br />
Hohenheide (F, Fro, Ne) Gesamtverlauf 01.07.1970 berührende Verbindungsstraße<br />
Holtkamp (Ba) 01.07.1970<br />
Horst-Wessel-Straße (F) 27.06.1933 1850-1933 Eulenstraße Eulenstraße<br />
1945-1946 Lutherstraße<br />
Hubert-Biernat-Straße (Str) 01.07.1970 Auf <strong>der</strong> Höhe<br />
Ibbingsen (Fr) 01.07.1970 Ostbürener Straße (Fr)<br />
Im Gründken (La) 01.07.1970 Ostmarkstraße<br />
Im Heimgarten (La) 12.12.1952<br />
Im Höfchen (De) 09.01.1950 Unnaer Weg<br />
Im Loh (Str) 22.09.1958<br />
Im Rottland (Ar) 16.07.1959<br />
Im Schelk (Ba, Fr) Gesamtverlauf 01.07.1970, neu für Bausenhagen<br />
Im Schelk (Fr) 10.05.1960<br />
Im Schelk (F) vor 1933 eingebunden in den "Querweg"<br />
Im Stift (F) vor 1850<br />
Im Sun<strong>der</strong>n (Ba) 01.07.1970<br />
Im Wiesengrund (F) 19.06.1953<br />
In den Telgen (F) vor 1933<br />
In den Wächelten (F) vor 1933<br />
In <strong>der</strong> Liethe (De) 09.01.1959
In <strong>der</strong> Sasse (F) 05.06.1974<br />
In <strong>der</strong> Twiete (Fr) 01.07.1970 Bachstraße (Fr)<br />
In <strong>der</strong> Wahne (Ost) 01.07.1970<br />
In <strong>der</strong> Waldemey (F) vor 1933<br />
Irmgardstraße (F) 19.08.1924<br />
Jägertal (F) 27.06.1933 Himmelssiepen<br />
Julius-Leber-Straße (F) 18.06.1969<br />
Kaiserstraße (Be) 01.07.1970<br />
Kampstraße (Fr) 01.07.1970 Kleine Bahnhofstraße<br />
Karl-Goerdeler-Straße (F) 29.08.1984<br />
Karl-Wildschütz-Straße (F) 27.06.1933 Karlstraße<br />
Karlstraße (F) 25.1.1910 erstmals aktenkundig, wahrscheinlich um 1900 Karl-Wildschütz-Straße<br />
Karrenweg (St) 01.07.1970<br />
Kaarweg(Ar) 20.10.1967 Bredde<br />
Kassberg (Str) 22.09.1958<br />
Kesseborn (Fr) 18.06.1969<br />
Kessebürener Weg (Ost) 01.07.1970<br />
Kettelerstraße (F) 09.12.1981<br />
Kiefernweg (F) 20.12.1972<br />
Kirchplatz (F) vor 1850<br />
Kirchplatz (Fr) 10.05.1960 Sybrechtplatz<br />
Kirchplatz (De) 09.01.1950 Ahlinger Berg<br />
Kirchweg (Ba) 01.01.1971<br />
Kirschbaumliethe (De) 02.09.1998<br />
Kleibusch (Str) 01.07.1970 Dorfstraße (Str)<br />
Kleine Bahnhofstraße (Fr) 10.05.1960 Kampstraße<br />
Klusenweg (F) 03.10.1924<br />
Kolpingstraße (F) 09.12.1981<br />
Königsweg (Ne) 20.11.1970 Unterdorf<br />
Körnerstraße (F) 28.09.1934<br />
Kornweg (Fr) 19.07.1974<br />
Kreisstraße (La) zwischen Mai und August 1949 Oststraße Ardeyer Straße
Kreisstraße (Ar) Altbestand, vor 1959 Ardeyer Straße<br />
Kuhstraße (Str) 22.09.1958<br />
Kurt-Schumacher-Straße (F) 20.12.1972<br />
Landstraße (Fro, Wa, Be) für Gesamtverlauf 01.07.1970<br />
Landstraße (Fro) 25.01.1956<br />
Landwehr (Fr) 10.05.1960<br />
Landwehr (Str) 22.09.1958 Hellweg<br />
Lehmke (Fro) 25.01.1956<br />
Lerchenweg (F) 02.09.1958<br />
Lessingstraße (F) 27.06.1933 Münzenfundstraße nach 1945 nach Westen verlegt (Neubaustraße),<br />
bisherige Lessingstraße wird <strong>der</strong><br />
Hermann-Löns-Straße zugeschlagen<br />
Lindenhofstraße (Fr) 20.11.1970 Lindenstraße<br />
Lindenstraße (Fr) 10.05.1960 Lindenhofstraße<br />
Lindenweg (F) 01.07.1954<br />
Löhnbachstraße (F), alt 20.12.1907 erstmals aktenkundig Parallelstraße Bismarckstraße<br />
Löhnbachstraße (F), neu 03.12.1936<br />
Löhnquelle (F) 05.06.1974<br />
Lönsstraße (De) 04.09.1956 Wibbelstraße<br />
Ludwig-Steil-Straße (F) 18.06.1969<br />
Lutherstraße(F) 31.07.1945 vor 1850 Eulenstraße Eulenstraße<br />
1933-1945 Horst-Wessel-Straße<br />
ab 16.05.1946 wie<strong>der</strong> Eulenstraße<br />
Magdalenenstraße (F) 31.07.1945 Hans-Schemm-Straße<br />
Margueritenweg (F) 15.08.1950<br />
Marienstraße (F) 31.07.1945 1850-1933 Schulstraße (F) Eulenstraße<br />
1933-1945 Schlageterstraße<br />
Markt (F) vor 1850 1933-1945 Adolf-Hitler-Platz<br />
31.07.1945<br />
Markt (La) Altbestand seit dem 18. Jh. einbezogen in Ardeyer Straße<br />
Mauritiusstraße (F) 05.04.1960<br />
Meisenweg (La) 05.06.1974 Drosselstiege
01.07.1970 Storchenweg<br />
Mendener Straße (F) 13.05.1993<br />
Menricusstraße (F) 20.04.1965<br />
Merschstraße (Fro, Wa) Gesamtverlauf 01.07.1970<br />
Merschstraße (Fro) 25.01.1956 Ruhrstraße o<strong>der</strong> "Siedlung" (beides nicht amtlich)<br />
Möllerstraße (F) 31.07.1945 Graf-Adolf-Straße Graf-Adolf-Straße<br />
Mühlenstraße (La) Altbestand, vor 1930 letztmalig 1962 nachgewiesen<br />
Mühlenbergstraße (F) 03.10.1924<br />
Mühlenweg (Fr) 10.05.1960<br />
Münzenfundstraße(F) 10.08.1926 1933-? Lessingstraße (alt) H.-Löns-Straße<br />
Mutteerkamp (Fr) 01.07.1970 Schulstraße (Fr)<br />
Nachtiagllenweg (F) 01.07.1970 Amselweg<br />
Natte (Str) 22.09.1958<br />
Neimener Kirchweg (Ne) 08.11.1990<br />
Neimener Weg (Ne) 01.07.1970<br />
Nelkenweg (F) 12.10.1967<br />
Neuenkamp (Be) 01.07.1970<br />
Nie<strong>der</strong>heide (Ar) 15.07.1981<br />
Nordstraße (F) 01.07.1954<br />
Nordstraße (La) Altbestand, vor 1930 <strong>der</strong> Ardeyer Straße zugeordnet<br />
Nordstraße (De) 01.10.196 Schörweken<br />
Ohlweg (De) 09.01.1950<br />
Ölmühlenweg (Wa, Be) 01.07.1970<br />
Ostbürener Straße (F) vor 1850 1933-1945 Horst-Wessel-Straße<br />
Ostbürener Straße (Ost) 01.07.1970<br />
Ostbürener Straße (Fr) 10.05.1960 Ibbingsen<br />
Ostfeld (Al) 01.07.1970<br />
Ostholz (Ar) 01.07.1970 Schäferstraße<br />
Ostmarkstraße (F) 02.08.1938<br />
Ostmarkstraße (Ar) 01.10.1938 Schwarzer Weg Thabrauck<br />
Ostmarkstraße (La) 09.06.1938 Feldstraße Im Gründken<br />
Oststraße (La) Altbestand, vor 1927 teilweise 1949 umbenannt in Kreistraße,
<strong>der</strong> übrige Teil ebenfalls noch vor 1968<br />
Otto-Wels-Straße (F) 18.06.1969<br />
Overbergstraße (F)<br />
nicht vor 1928, Fertigstellung <strong>der</strong> Overbergschule<br />
Palzstraße (Ba, St, Fro) Gesamtverlauf 01.07.1970 Dorf (Fro), in Bausenhagen und Stentrop ohne Namen<br />
Pappelallee (Al) 01.07.1970 Provinzialstraße (De,Al)<br />
Parkstraße (F) um 1900 von-Tirpitz-Straße<br />
Pastoratswald (Ba) 01.07.1970<br />
Pater-Delp-Straße (F) 18.06.1969<br />
Laul-Löbe-Straße (F) 18.06.1969<br />
Penningheuers Kamp (De) 12.06.2001<br />
Poststraße (Ost) 01.07.1970<br />
Priorsheide (Ba) 01.07.1970<br />
Provinzialstraße(De,Al) Altbestand vor 1909, Erstnachweisung Schulakten Altendorf Pappelallee<br />
Prozessionsweg (Ba) 30.09.2003<br />
Querweg (F) vor 1933 Im Schelk (F) zugeordnet<br />
Rehwinkel (F) 08.09.1994<br />
Ringstraße (Al) 01.07.1970<br />
Roggenweg (Fr) 22.08.2000<br />
Rosenweg (De)<br />
1952-1961, ab 1952 erschlossen, 1961 bei Ortsbegehung genannt<br />
Rosenweg (F) 03.11.1949 Veilchenweg<br />
Rosenweg (Str) 22.09.1958 Am Hang<br />
Rudolf-<strong>Die</strong>sel-Straße (F) 14.07.1982<br />
Ruhrblick (La) 12.12.1952<br />
Ruhrstraße (F) vor 1850<br />
Ruhrstraße (De) 09.01.1950 einbezogen in Ohlweg<br />
Schäferstraße (De) 09.01.1950<br />
Schäferstraße (Ar) 14.12.1967 Ostholz<br />
Schillerstraße (F) 27.06.1933 Westickerfeldweg<br />
Schlageterstraße (F) 27.06.1933 Schulstraße (F) Eulenstraße<br />
Schlehweg (F) 12.10.1967<br />
Schlesierstraße (Ar) 16.09.1958<br />
Schlotstraße (Wa) 01.07.1970
Schmiedestraße (Wa) 01.07.1970<br />
Schörweken (De) 01.07.1970 Nordstraße (De)<br />
Schröerstraße (F) vor 1850<br />
Schürmanns Kamp (F) 18.3.1981<br />
Schulstraße (Ar) Altbestand Westfeld<br />
Schulstraße (De) 09.01.1950<br />
Schulstraße (F) vor 1850 1933-1945 Schlageterstraße Eulenstraße<br />
1945-1946 Marienstraße<br />
Schulstraße (Fr) 10.05.1960 Mutterkamp<br />
Schulstraße (La) Altbestand, vor 1930 Westfeld<br />
Schulweg (Str) 22.09.1958 Beisenbrauck<br />
Schwalbenweg (F) 01.07.1970 Finkenweg (F)<br />
Schwarzer Kamp (Ar) 29.11.1965<br />
Schwarzer Weg (F) 30.06.1988<br />
Schwarzer Weg (Ar) Altbestand Ostmarkstraße (Ar)<br />
Schwerter Straße (Al) 01.07.1970 Provinzialstraße<br />
Simonweg (Str) 20.01.1960<br />
Sonnebachstraße (Ar) 16.07.1959 einbezogen in Westfeld<br />
Sonnenbergstraße (La) 12.12.1952<br />
Sonnenhang (Str) 20.01.1960 Wulfesweide<br />
Springstraße (F) ca. 1938/39, erstmals im Stadtplan 1940<br />
planmässige Bebauung erst nach 1945<br />
Starenweg (F) 02.11.1960<br />
Steinkuhle (Ba) 01.07.1970<br />
(Am) Steinufer (F)<br />
vor 1850, unbebauter Fußweg<br />
Stentroper Weg (St, Wa) 01.07.1970<br />
Storchenweg (La) 01.07.1970 Drosselstiege Meisenweg<br />
Strickherdicker Weg (De) 09.01.1950<br />
Strickherdicker Weg (Str) 01.07.1970 Dellwiger Weg<br />
Südstraße (F) 03.11.1949<br />
Sümbergstraße (F) 26.10.1912 <strong>der</strong> ältere nördliche Bereich heute<br />
Teil <strong>der</strong> Overbergstraße
Sybrechtplatz (Fr) 01.07.1970 Kirchplatz (Fr)<br />
Talstraße (Ar) 01.07.1970<br />
Tannengarten (St) 01.07.1970<br />
Thabrauck (Ar, Str, Fr) Altbestand in Str 01.07.1970<br />
in Ardey Ostmarkstraße<br />
vor 1959<br />
in Frömern nicht benannt<br />
Tharloh (Fr) 27.12.1968<br />
Tulpenweg (F) 23.10.1951<br />
Tummelplatz (Fro) 25.01.1956<br />
Ulmenweg (F) 22.04.1958<br />
Unionstraße (F) 18.06.1969<br />
Unnaer Straße (Str) 22.09.1958 Provinzialstraße, Reichsstrasse (keine amtliche Bezeichnung)<br />
Unnaer Straße (La) 01.07.1970 Provinzialstraße, Reichsstrasse (keine amtliche Bezeichnung)<br />
Unnaer Straße (F) vor 1850 Eulenstraße<br />
Unnaer Weg(De) Altbestand, tradiert, nicht offiziell benannt Im Höfchen<br />
Unterdorf (Fro) 25.01.1956 amtlich, tradiert bereits früher Königsweg<br />
Veilchenweg (F) 01.07.1970 Rosenweg (F)<br />
Vogelrute (F) 13.04.1983<br />
vom-Stein-Straße (F) 27.06.1933 Zwischen den Wegen Hardenbergstraße<br />
von-Galen-Straße (F) 18.06.1969<br />
Von-Nell-Breuning-Straße (F) 12.06.2001<br />
Von-Stauffenberg-Straße (F) 20.12.1972<br />
Von-Steinen-Straße (Fr) 10.05.1960 Hauptstraße (Landstraße 1.Ordnung), kein amtl.Straßenname<br />
Von-Tirpitz-Straße (F) 27.06.1933 bis 1933 Parkstraße<br />
Wachtelweg (F) 02.11.1960<br />
Waldweg (Ost) 01.07.1970<br />
Warmer Löhn (Wa) 01.07.1970<br />
Wasserwerkstraße (F) 03.10.1924<br />
Wasserwerkstraße (De) 09.01.1950 einbezogen in Hauptstraße (De,La)<br />
Weidenweg (De) 01.07.1970 Gartenweg<br />
Weißes Feld (Fr) 09.06.1999<br />
Werner-von-Siemens-Straße (F) 04.10.1978
Wernher-von-Braun-Straße (F) 04.10.1978<br />
Westfeld (Ar, La) 01.07.1970 in Ardey Schulstraße<br />
in Langschede Schulstraße<br />
Westick (F) vor 1850 einbezogen in die Annette-von-Droste-<br />
Hülshoff-Straße<br />
Westicker Heide (F) vor 1933<br />
Westicker Straße (F, Ne) vor 1850<br />
Westicker Straße, Stadtmitte (F) vor 1850 1933-1945 Hermann-Göringstraße Alleestraße<br />
Westickerfeldweg (F) 05.01.1926 erstmalig aktenkundig Annette-von-Droste-Hülshoff-Straße<br />
Wibbeltstraße (De) 01.07.1970 Lönsstraße<br />
Wicke<strong>der</strong> Straße (Fro, Ne) 01.07.1970 Feldweg (Fro), in Neimen bis 1970 ohne Namen<br />
Wilhelm-Feuerhake-Straße (F) 19.04.1933<br />
Wilhelm-Himmelmann-Platz (F) 27.06.1933 1918 Wilhelmplatz eingezogen, Teil <strong>der</strong> Winschotener Str.<br />
Wilhelmplatz (F) 28.05.1918 Wilhelm-Himmelmann-Platz<br />
heute nicht mehr offiziell benannter Platz<br />
zwischen "Im Stift"/"Unionstr" und<br />
"Winschotener Straße"<br />
Wilhelmstraße (Ost) 01.07.1970<br />
Willi-Kettmann-Straße (Fr) 20.10.1982<br />
Windgatt (Be) 01.07.1970<br />
Winschotener Straße (F) 05.06.1986<br />
Wulfesweide (Str) 01.07.1970 Sonnenhang (Str)<br />
Zum Freisenhagen (F) 20.12.1972<br />
Zum Siepen (Ar) 20.10.1967<br />
Zur Dorfwäsche (Ba) 01.07.1970<br />
Zur Düke (Str) 01.07.1970 Brauck<br />
Zur Haar (La)<br />
Altbestand ca.1963-1967, nicht zu ermitteln<br />
Zur Mark (Ost) 01.07.1970<br />
Zur Tigge (Wa) 01.07.1970<br />
Zur Tränke (Ba) 01.07.1970<br />
Zwischen den Wegen(F) 10.08.1926 1933-1970 Vom-Stein-Straße Hardenbergstraße
Literaturverzeichnis Seite 1<br />
Anhang 3<br />
A. Gedruckte Quellen (allg. Literatur, Monographien und Aufsätze)<br />
a. Literatur zur Ortsgeschichte, Kommunalgeschichte des Raumes Fröndenberg<br />
Klaus Basner, Reformation und Gegenreformation im Raum Fröndenberg,<br />
Fröndenberg 1989 (Beiträge zur Ortsgeschichte, Band 5)<br />
Klaus Basner, <strong>Die</strong> <strong>Geschichte</strong> <strong>der</strong> Schulen im Raum Fröndenberg von den Anfängen bis um<br />
1900, Fröndenberg 1991 (Beiträge zur Ortsgeschichte, Band 7)<br />
Benno Grüne, <strong>Die</strong> Schulen <strong>der</strong> Palz (Kirchspiel Bausenhagen) von den Anfängen bis zur<br />
kommunalen Neuglie<strong>der</strong>ung 1968, Menden 2002<br />
Fa. Himmelmann (Hrsg.) Festschriften zum 75. und 100. Firmenjubiläum <strong>der</strong> Papierfabrik<br />
Himmelmann, Fröndenberg, 1929 und 1954<br />
Everhard Holtmann, Nach dem Krieg und vor dem Frieden – <strong>der</strong> gesellschaftliche und<br />
politische Neubeginn nach 1945 im Kreis Unna, Köln 1985<br />
Werner Keßler (Hrsg.), Festschrift 750 Jahre (1230-1980) Stiftskirche Fröndenberg,<br />
Fröndenberg 1980<br />
Stefan Klemp, Nachkriegszeit – die Jahre 1945 bis 1949 in Fröndenberg – Neubeginn o<strong>der</strong><br />
Restauration, Fröndenberg 1990 (Beiträge zur Ortsgeschichte, Band 6)<br />
Stefan Klemp, „Richtige Nazis hat es hier nicht gegeben...“- eine Stadt, eine Firma, <strong>der</strong><br />
vergessene Wirtschaftsführer und Auschwitz, Münster, 2.überarbeitet Auflage, 2000<br />
Stefan Klemp, Sparkasse Meschede (Hrsg.), Vom Thaler zum Euro, 150 Jahre Sparkasse<br />
Fröndenberg, Fröndenberg 2002<br />
Fritz Klute, Fröndenberg einst & jetzt – ein <strong>Fröndenberger</strong> Heimatbuch, Fröndenberg 1925,<br />
unverän<strong>der</strong>ter Nachdruck Fröndenberg 1981<br />
Franz Lueg, Frundeberg-Fröndenberg 1197-1997 – Spuren <strong>der</strong> Vergangenheit,<br />
Fröndenberg 1997 (Beiträge zur Ortsgeschichte, Band 10)<br />
Franz Lueg, Ich gehe ins Stift – zur Aufhebung des Stiftes Fröndenberg vor 175 Jahren<br />
(1812), Fröndenberg 1987 (Beiträge zur Ortsgeschichte, Band 2)<br />
Franz Lueg, St. Marien im Weg durch die Zeit, in: 300 Jahre Pfarrei St. Marien 1688-1988<br />
Fröndenberg, Fröndenberg 1988 (Festschrift <strong>der</strong> katholischen Kirchengemeinde)<br />
Erich Lülff, Gemeindeverwaltung Langschede (Hrsg.), Langschede, Dellwig und Ardey - ein<br />
Gang durch die <strong>Geschichte</strong>, Langschede 1967<br />
Erich Lülff, Gemeindesparkasse Fröndenberg (Hrsg.), 100 Jahre Gemeinde-Sparkasse zu<br />
Fröndenberg 1852-1952, Fröndenberg 1952
Literaturverzeichnis Seite 2<br />
Ludwig Maduschka (Kreisoberbaurat), Oberkreisdirektor des Landkreises Unna (Hrsg.)<br />
Studie zum Entwicklungsplan für den Kreis Unna, Unna 1961<br />
Jochen von Nathusius, <strong>Die</strong> Möhnekatastrophe am 17.Mai 1943, Ursachen-Verlauf-Folgen,<br />
Dokumente aus dem Stadtarchiv, Fröndenberg 2003 (Beiträge zur Ortsgeschichte, Band 15)<br />
Friedhelm Niggemeier, Menschen im Wi<strong>der</strong>stand – aufgezeigt an <strong>Straßennamen</strong> in einem<br />
<strong>Fröndenberger</strong> Wohngebiet, Fröndenberg 1991 (Beiträge zur Ortsgeschichte –Son<strong>der</strong>band-)<br />
Josefa Redzepi, Amt und Gemeinde Fröndenberg während <strong>der</strong> Weimarer Republik,<br />
Fröndenberg 1986 (Beiträge zur Ortsgeschichte, Band 1)<br />
Günther Renzing (Bearbeitung), Stadt Fröndenberg Stadtarchiv (Hrsg.), Fröndenberg und<br />
seine Ortsteile (<strong>Fröndenberger</strong> Bil<strong>der</strong>bücher) Band 1-4, Fröndenberg 1988-1990<br />
Heinz Röttgermann, <strong>Die</strong> <strong>Geschichte</strong> <strong>der</strong> Industrie des Wirtschaftsraumes<br />
Menden/Fröndenberg, Menden 2.verän<strong>der</strong>te Auflage 1952 (1.Auflage 1938)<br />
(Beiträge zur Heimatkunde des Hönnetals, Band 3)<br />
Oskar Rückert(Verfasser) und Ernst Nolte (Nachbearbeitung), Heimatblätter für Unna und<br />
den Hellweg, Unna 1930-1943 in loser Folge als Serie im „Hellweger Anzeiger“ erschienen,<br />
erstmals als Buch zusammengefasst und nachbearbeitet von Ernst Nolte, Unna 1949<br />
Stadtverwaltung Fröndenberg (Hrsg.), 40 Jahre Städtepartnerschaft Fröndenberg-Bruay la<br />
Buissiere 1964-2004, Fröndenberg 2004<br />
Stadtverwaltung Fröndenberg (Hrsg.), Europa ist unsere Heimat, Städtepartner Bruay-la-<br />
Buissiere, Fröndenberg und Winschoten, Fröndenberg 1989<br />
Fa. Union (Hrsg.) Festschrift zum 100. Jubiläum <strong>der</strong> Firmengründung 1898, Fröndenberg<br />
1998<br />
Willy Timm, Frömern – Beiträge zur Ortsgeschichte, Unna 1953<br />
Willy Timm, <strong>Die</strong> Ortschaften <strong>der</strong> Grafschaft Mark, Unna 1991<br />
(Schriftenreihe des Stadtarchivs Unna, Heft 11)<br />
b. Literatur zur <strong>Straßennamen</strong>forschung in an<strong>der</strong>en Kommunen<br />
Nach Autorenalphabet, Hervorhebung <strong>der</strong> Städte- und Gemeindenamen durch Fettdruck<br />
Ferdy Fischer, <strong>Straßennamen</strong> in Arnsberg, Arnsberg 1988<br />
Karin von Gymnich, Von Adjutantenkamp bis Zeppelinstraße, <strong>Straßennamen</strong> in Hemer<br />
erzählen, Hemer 1986<br />
Manfred Hildebrandt (Bearbeitung), Stadt Herne (Hrsg.)<br />
Herne: von Ackerstraße bis Zur-Nieden-Straße, Stadtgeschichte im Spiegel <strong>der</strong><br />
<strong>Straßennamen</strong>, Herne, 2.A. 1997 (Veröffentlichungen des Stadtarchivs Herne, Bd.1)<br />
Marga Koske, Meiningsen – Ein Beitrag zur Siedlungsgeschichte <strong>der</strong> Soester Börde<br />
In: Soester Zeitschrift, Heft 79, Soest 1955
Literaturverzeichnis Seite 3<br />
Bernd Leupold, Ehre wem Ehre gebührt ?<br />
<strong>Straßennamen</strong> als Spiegel des Zeitgeistes. Bayreuth und Bamberg im Vergleich<br />
http://www.uni-bayreuth.de/departements/neueste/ZeitgeistLeupold.htm 23.12.2004<br />
Aloys Molter , Stadt Frankfurt a.M., Dezernat Planung und Sicherheit,<br />
Stadtvermessungsamt (Hrsg.)<br />
<strong>Die</strong> Benennung <strong>der</strong> Straßen, Plätze und Brücken in <strong>der</strong> Stadt Frankfurt am Main<br />
September 2001<br />
Günter v.Roden (Hrsg. und Bearbeitung) <strong>Straßennamen</strong> in Duisburg, Duisburg 1982ff,<br />
veröffentlicht in mehreren Teilabschnitten in den „Duisburger Forschungen“<br />
ausgewertet wurde für die vorliegende Arbeit lediglich das Vorwort zum Teil 1 „Altstadt“<br />
Willy Timm, <strong>Straßennamen</strong> <strong>der</strong> Stadt Unna – <strong>Geschichte</strong> und Deutung, Unna, 1982<br />
Herbert Wilhelmy, Historischer Verein Holzwickede (Hrsg.)<br />
Orts- Flur- und <strong>Straßennamen</strong> in Holzwickede, Holzwickede, 2.A. 2003<br />
(ohne Autorenangabe) Straßenindex A-Z<br />
in: 1100 Jahre (Dortmund)-Aplerbeck<br />
http://www.aplerbeck.de/aplerbec/strassen/str_az.htm 23.12.2004<br />
c. Literatur zur Flurnamenforschung<br />
Landschaftsverband Westfalen-Lippe, Kreisheimatverein Beckum-Warendorf und<br />
Landeskundliches Institut Westmünsterland (Veranstalter)<br />
„Aus den Ohren – aus dem Sinn“, schriftliches Seminarmaterial zur Flurnamenforschung<br />
im Kernmünsterland, Praxisseminar vom März 2002<br />
Hans-Hermann Hochkeppel, Flur-, Gewässer- und Ortsnamen in Balve, Balve 2004<br />
Jan Wohlgemuth, Flurnamen in Westfalen<br />
Seminararbeit am Institut für Deutsche Philologie I an <strong>der</strong> Westfälischen Wilhelms-<br />
Universität Münster, Abteilung für Nie<strong>der</strong>deutsche Sprache und Literatur, Sommersemester<br />
2000 bei Dozent Dr. R. Peters M.A.<br />
http://www.linguist.de/Deutsch/fln.htm 23.12.2004<br />
d. Gesetzestexte, amtliche Mitteilungsblätter und Verordnungen<br />
Amtliche Bekanntmachungen <strong>der</strong> Britischen Militärregierung und Nachrichtenblatt für den<br />
Kreis Unna (wöchentlich), komplette Ausgabe von August 1945 bis November 1949<br />
Amtsblatt <strong>der</strong> königlich preussischen Regierung in Arnsberg ab 1816, ab 1918 Amtsblatt<br />
<strong>der</strong> preussischen Regierung in Arnsberg Teil II Verordnungen und Bekanntmachungen <strong>der</strong><br />
Orts- und Kreisbehörden, ab 1947 Amtsblatt <strong>der</strong> Bezirksregierung Arnsberg,<br />
Preußisches Gesetz- und Verordnungsblatt, diverse Ausgaben ab 1850<br />
Reichsgesetzblatt, Teil A, diverse Ausgaben 1932 bis 1944
Literaturverzeichnis Seite 4<br />
e. Pläne und Karten<br />
Fluchtlinien und Bebauungsplan <strong>der</strong> Gemeinde Fröndenberg in neun Blättern, Maßstab<br />
1:1.000, Stand 1898<br />
Amtlicher Stadtplan des Amtsbauamtes für die Gemeinde Fröndenberg, Fröndenberg<br />
herausgegeben ohne Datum (Bearbeitungsstand entspricht <strong>der</strong> Situation 1939/1940), Maßstab<br />
1:10.000<br />
-erster bisher nachgewiesener öffentlicher Stadtplan-<br />
Stadtplan Fröndenberg –Brücke zum Sauerland-, herausgegeben vom Heimat- und<br />
Verkehrsverein Fröndenberg im Auftrag <strong>der</strong> Stadtverwaltung ohne Datum (Bearbeitungsstand<br />
ca. 1962-1964), nur für die damalige Stadt Fröndenberg (ab 1969 Kernstadt) ohne<br />
amtsangehörige Gemeinden (ab 1969 Stadtteile), Maßstab 1:10.000<br />
Amtlicher Stadtplan Fröndenberg, herausgegeben von <strong>der</strong> Stadt Fröndenberg und dem<br />
Kommunalverband Ruhrgebiet, Maßstab 1:15.000, Ausgabe 1985, mit allen Stadtteilen<br />
(diese Pläne in Abstimmung mit dem KVR erschienen ab <strong>der</strong> kommunalen Neuglie<strong>der</strong>ung des Kreisgebietes 1969)<br />
Amtlicher Stadtplan Fröndenberg, herausgegeben von <strong>der</strong> Stadt Fröndenberg und dem<br />
Kommunalverband Ruhrgebiet, Maßstab 1:15.000, Ausgabe 1997, mit allen Stadtteilen,<br />
<strong>der</strong>zeit (März 2005) letzter amtlicher Stadtplan<br />
Faltplan Fröndenberg (Kernstadt und Stadtteile Langschede, Dellwig, Ardey),<br />
herausgegeben von <strong>der</strong> Geographischen Verlagsgesellschaft München ohne Mitarbeit <strong>der</strong><br />
Stadtverwaltung, 4.Auflage (1.-3. Auflage bei <strong>der</strong> Stadtverwaltung unbekannt),<br />
Bearbeitungsstand ca. 2003, Maßstab etwa 1:10.000 ohne Angabe<br />
B. Tageszeitungen und wöchentliche Anzeigenblätter<br />
„Hellweger Anzeiger“ Lokalseiten für Fröndenberg und Unna<br />
„Westfalenpost“ Lokalseiten für Fröndenberg, Menden und Unna<br />
„Westfälische Rundschau“, Lokalseiten für Fröndenberg<br />
diverse Ausgaben September 1959 bis Dezember 2004<br />
„Stadtanzeiger“, „Stadtspiegel“ und „Wochenanzeiger“<br />
diverse Ausgaben ab Oktober 2002<br />
C. ungedruckte o<strong>der</strong> unveröffentlichte Quellen<br />
a. Stadtarchiv Fröndenberg<br />
Bestand A (Stadt-, Gemeinde- und Amtsverwaltung bis 1968)<br />
A 1832 Protokolle des Gemein<strong>der</strong>ats <strong>der</strong> Gemeinde Ardey 1946 – Juli 1964<br />
A 1837-38 Protokolle des Gemein<strong>der</strong>ats <strong>der</strong> Gemeinde Dellwig 1946- Juli 1964<br />
A 1840 Protokolle des Gemein<strong>der</strong>ats <strong>der</strong> Gemeinde Frömern vom 2.5.1947 – 29.12.1967<br />
A 1864 Protokolle des Gemein<strong>der</strong>ats <strong>der</strong> Gemeinde Langschede 1946 - 1962<br />
A 1865a-d, Protokolle des Gemein<strong>der</strong>ats Langschede und <strong>der</strong> Großgemeinde<br />
Langschede-Dellwig-Ardey 1963 bis Juli 1964, bzw. August 1964-1967<br />
A 1890 Protokolle des Gemein<strong>der</strong>ates Fröndenberg 28.1.1906 – 22.3.1919<br />
A 1891 Protokolle des Gemein<strong>der</strong>ates Fröndenberg 14.4.1919 – 30.5.1922<br />
A 1892 Protokolle des Gemein<strong>der</strong>ates Fröndenberg 5.7.1922 – 13.11.1929
Literaturverzeichnis Seite 5<br />
A 1893 Protokolle des Gemein<strong>der</strong>ates Fröndenberg 13.12.1929 – 29.10.1934<br />
(Gemein<strong>der</strong>atsprotokolle ab 1934 mit Betreffen zur Straßenbenennung<br />
finden sich in Abschrift, ab den 60er Jahren in Kopie in den jeweiligen<br />
Akten des Einwohnermeldeamtes und des Bauamtes wie<strong>der</strong>)<br />
A 3659 Einwohnermeldeamt, <strong>Straßennamen</strong> und Hausnummern 1949-1967<br />
A 5244, Amtsbauamt, Neuanlage von Straßen und Wegen, Ortsstatute 1906-1930<br />
A 5305, Amtsbauamt, <strong>Straßennamen</strong> und Hausnummern 1933-1936<br />
A 6041, Amtsbauamt, Wohnplätze, Straßen- und Hausnummern 1949-1962<br />
inhaltlich <strong>der</strong> Akte A 679 entsprechend aufgebaut für die heutigen Stadtteile<br />
mit den Anfangsbuchstaben L (Langschede – W (Warmen), jedoch nicht<br />
inhaltlich getrennt und daher wegen Provenienzprinzip nicht nachträglich in<br />
Einzelakten zerlegt wie bei Akte A 6879<br />
A 6119, Gemeinde Fröndenberg, Gemeindebauamt, Anliegerbeiträge 1927-1933<br />
A 6318, Amtsbauamt, Ortsstatuten und Bebauungsstatute 1924-1932<br />
A 6879-1 bis 6879-10, Amtsbauamt, Hausnummerierungen, Neubenennung von Straßen und<br />
Wegen 1952 –1964, ohne Verwendung von 6879-2 (Billmerich)<br />
-1 = heutiger Stadtteil Ardey<br />
-3 = heutiger Stadtteil Bausenhagen<br />
-4 = heutiger Stadtteil Bentrop, Neimen, Warmen, Stentrop<br />
-5 = heutiger Stadtteil Dellwig<br />
-6 = heutiger Stadtteil Frohnhausen<br />
-7 = heutiger Stadtteil Frömern<br />
-8 = heutige Kernstadt Fröndenberg<br />
-9 = heutiger Stadtteil Langschede<br />
-10= heutiger Stadtteil Strickherdicke<br />
Bestand B (Stadtverwaltung Fröndenberg ab 1.1.1968)<br />
B-0050 Sitzungsprotokoll des Stadtrats vom 18.06.1969<br />
B-0051 Sitzungsprotokolle des Stadtrats des Jahres 1970<br />
B-0052 Sitzungsprotokolle des Stadtrats des Jahres 1971<br />
B-....... (noch unverzeichnet), Sitzungsprotokoll des Stadtrats vom 02.09.1989<br />
Verwaltungsbereichte <strong>der</strong> Amtsverwaltung (alle erschienenen Berichte; erstmalig 1933,<br />
letztmalig erarbeitet für das Rechnungsjahr 1955)<br />
Verwaltungsbereichte <strong>der</strong> Gemeindeverwaltung Fröndenberg (alle erschienenen Berichte,<br />
erstmalig 1933, letztmalig 1941; 1942-1944 nur vorbereitende Materialsammlung)<br />
b. inoffizielles Zwischenarchiv bisher (Stand 2005) auf mehrere Dachböden und<br />
Kellerräume verteilt<br />
Protokolle des Wegebau- und Friedhofsausschuss <strong>der</strong> Gemeinde, bzw. <strong>der</strong> Stadt<br />
Fröndenberg 1946 bis 1967; mehrere Ordner im Altbestand des Bauamtes, offiziell noch nicht<br />
dem Stadtarchiv übergeben und dort verzeichnet; zur Übergabe in nächster Zeit vorgesehen.<br />
Protokolle des Wegebau- und Friedhofsausschuss <strong>der</strong> Großgemeinde Langschede<br />
(Ardey-Langschede-Dellwig) 1965-1967 (alle Existierenden, nach 1967 wurde dieser erst mit<br />
Bildung <strong>der</strong> Großgemeinde gegründete Ausschuss wie<strong>der</strong> aufgelöst und in den<br />
Wegebauausschuss <strong>der</strong> „neun“ Stadt Fröndenberg/Ruhr integriert),<br />
mehrere Ordner im Altbestand des Bauamtes, offiziell noch nicht dem Stadtarchiv übergeben<br />
und dort verzeichnet; zur Übergabe in nächster Zeit vorgesehen
Literaturverzeichnis Seite 6<br />
c. Stadtarchiv Fröndenberg (Ergänzungssammlungen)<br />
Sammlung Kulczak, Zeitungsausschnitte, Fotos und Aufzeichnungen zur kommunalen<br />
<strong>Geschichte</strong> <strong>der</strong> Kernstadt Fröndenberg zwischen 1900 und 1980 thematisch geordnet in<br />
Stehordnern<br />
d. Bestand <strong>der</strong> laufenden Verwaltung<br />
Bauamt <strong>der</strong> Stadt Fröndenberg, Akten „Straßenbenennungen, Umbenennungen“<br />
1962-2004, drei Ordner in chronologischer Abfolge (bei Einzelbenennungen) o<strong>der</strong> nach<br />
Baugebieten sortiert.<br />
Bauamt <strong>der</strong> Stadt Fröndenberg, Friedhofsverwaltung, Nachweisbuch <strong>der</strong> Beerdigungen<br />
auf dem kommunalen Friedhof <strong>der</strong> Gemeinde Fröndenberg 1866-1952