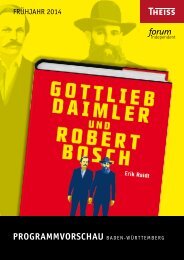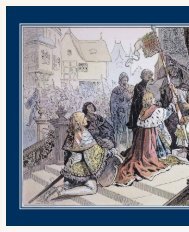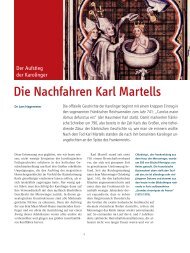Leseprobe - Theiss-Verlag
Leseprobe - Theiss-Verlag
Leseprobe - Theiss-Verlag
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
66 | Das römische Handwerk<br />
Grundstoff Ton und Stein |<br />
67<br />
ten. Während die offizielle Kunst in den nordwest -<br />
lichen Provinzen einen deutlichen römischen Einfluss<br />
erkennen lässt, bleiben die regional beauftragten<br />
Werke eher von indigenen Traditionen geprägt, die<br />
erst verhältnismäßig spät seit dem ausgehenden 2./<br />
frühen 3. Jh. die offiziellen Arbeiten beeinflussten.<br />
Namentlich sind uns die Künstler aber nur dann bekannt,<br />
wenn Meister wie Samus und Severus, die<br />
Mitte des 1. Jh. in Mogontiacum/ Mainz arbeiteten,<br />
ein Werk wie die Mainzer Iupitersäule signierten. Andere<br />
Ateliers werden nach stilistischen Kriterien erschlossen.<br />
Das gilt für die zeitgleich tätige Annaius-<br />
Werkstatt, der die Forschung aufgrund ähnlicher<br />
Bearbeitung mehrere Werke zuweist. Sie hat ihren<br />
Namen nach dem in Bingen aufgefundenen Grabstein<br />
des Soldaten Annaius Daverzus erhalten. Hier<br />
hat die Anwesenheit des Militärs sicher den Arbeitsmarkt<br />
positiv beeinflusst, weil die Soldaten schon<br />
früh indigene Handwerker mit zahlreichen Arbeiten<br />
beauftragten. Das gilt wohl auch für die in einem kleinen<br />
vicus wie Nassenfels tätigen Betriebe, die vor Ort<br />
verblieben, als die Truppen später verlegt wurden. In<br />
Nîmes arbeiteten bereits in augusteischer Zeit Steinmetze,<br />
die aus Rom zugewandert sein dürften. Anhand<br />
von mehreren Skulpturen eines Denkmals lassen<br />
sich dort zwei wohl im gleichen Atelier tätige<br />
Meister unterscheiden.<br />
In der Côte d’Or konnten in einer eng begrenzten<br />
Region außer der in Dijon tätigen Werkstatt zwei weitere<br />
Betriebe bei Nuits-St.-Georges und Beire-le-<br />
Châtel/ Mâlain lokalisiert werden. Sie lassen trotz eigener<br />
Stile so große Ähnlichkeiten erkennen, dass die<br />
Steinmetzmeister wohl oft von Atelier zu Atelier weiterzogen.<br />
Da allen Arbeiten aber eindeutig römische<br />
Einflüsse fehlen, gründet sich die von lebhaftem Handel<br />
und florierender Wirtschaft geförderte Tätigkeit<br />
der Handwerker hier im Wesentlichen auf die einheimische<br />
keltische Tradition.<br />
An den Werkstücken haben die Arbeitstechniken<br />
der Bildhauer oft Spuren hinterlassen, die sich in verschiedenen<br />
Gegenden oder sogar von Werkstatt zu<br />
Werkstatt unterscheiden können. puntelli – kleine<br />
Markierungspunkte auf ansonsten glatt abgearbeiteten<br />
Oberflächen – deuten auf den Einsatz eines dem<br />
Storchschnabel ähnlichen Gerätes, mit denen in kleinerem<br />
Maßstab gefertigte Modelle wunschgemäß zu<br />
vergrößern waren. Solange der Handwerker mit<br />
Werkzeugen wie dem Flachmeißel die groben Strukturen<br />
z.B. am Kopf herausarbeitete, ließ er wegen der<br />
benötigten Festigkeit den Hals zunächst unbearbeitet<br />
stehen. Feinheiten wie Gewandfalten, Haarlocken,<br />
Pupillen und Mundwinkel wurden seit dem späten<br />
2. Jh. zunehmend gebohrt. Mit dieser in Kleinasien<br />
entwickelten Technik soll ein kräftigerer Schatten-<br />
schlag erreicht worden sein, der sich durch die Bemalung<br />
der Skulpturen aber nicht sehr stark ausgewirkt<br />
haben kann. Die mit einem Meißel geglättete<br />
Oberfläche wurde poliert, zumindest bei Marmor mit<br />
Wachs behandelt und zum Schluss farbig gefasst. Dadurch<br />
waren nicht nur die Stoßfugen verdeckt, die<br />
sich beim Andübeln der oft separat gefertigten Köpfe<br />
und Arme nicht vermeiden ließen, sondern es konnten<br />
auch Details aufgemalt werden, die der Steinmetz<br />
nicht ausgearbeitet hatte.<br />
Die vor allem aus Nordafrika bekannten großflächigen<br />
Mosaikböden, die detailreich und farbenprächtig<br />
Szenen aus dem Alltag wiedergeben, faszinieren<br />
jeden Betrachter. Allgemein geht die Entwicklung von<br />
Ungewohnt erscheinen heute<br />
Skulpturen, bei denen die in<br />
der Antike farbige Fassung rekonstruiert<br />
worden ist wie<br />
hier an der bekannten Augustus-Statue<br />
von Primaporta.<br />
Das überdeckte zugleich die<br />
manchmal an Reliefs nur grob<br />
ausgearbeiteten Konturen der<br />
Darstellung.<br />
Utica (Tunesien): Aus verschie<br />
denfarbigem Gestein<br />
zusammengesetzter Marmorboden.<br />
Antiker Handwerkerpfusch in<br />
Augst (Schweiz): Bei der Reparatur<br />
dieses Mosaikbodens<br />
haben die Mosaizisten einfach<br />
den linken Henkel des Kraters<br />
kopiert, ohne ihn für die richtige<br />
Optik zu spiegeln. Vielleicht<br />
war aber auch technisches<br />
Unvermögen bei der Reparatur<br />
der Grund für diese<br />
Nachlässigkeit.<br />
schwarz-weißen Ornamenten zu polychromen Techniken,<br />
wobei die frühen Arbeiten aus Augst einen<br />
stark italischen Einfluss zeigen, der später gegenüber<br />
solchen aus dem Rhônetal und Trier bzw. den rheinischen<br />
Werkstätten zurücktritt. Insgesamt bewahren<br />
sich die Künstler trotz stilistischer Ähnlichkeiten bis<br />
in das 3. Jh. hinein eine große Kompositionsfreiheit.<br />
Die aus vielen, teils sehr kleinen Steinchen zusam -<br />
mengesetzten Beläge erforderten sorgfältige Vorarbei<br />
ten. Vitruv empfahl als Unterlage den von Straßen<br />
her bekannten dreischichtigen Aufbau aus Tragschicht<br />
(statumen), einer feineren, ca. 22 cm dicken<br />
Mittelschicht (ruderus) und der obersten Bettung von<br />
11 cm (nucleus). Diese Stärken werden aber nur selten<br />
erreicht. Da fast immer eine Fuge die beiden oberen<br />
Schichten trennt, erfolgte der Auftrag des nucleus auf<br />
einen vollständig trockenen ruderus.<br />
Vorlagenbücher, aus denen der Auftraggeber das<br />
gewünschte Motiv wählte, sind bei Mosaikböden sicher<br />
vorauszusetzen, obwohl die Meister bei den Darstellungen<br />
natürlich auch eigene Entwürfe umsetzten.<br />
Gewisse stilistische Eigenheiten, die sich regional<br />
häufiger wiederholen, lassen »Werkstattkreise« mit<br />
besonderen Traditionen vermuten. In Britannien<br />
scheinen vier solcher Zentren in Dorchester, Cirencester,<br />
Water Newton und Brough on Humber bestanden<br />
zu haben.<br />
Über den entweder mit roter Farbe auf den Boden<br />
gemalten oder in der obersten Bodenschicht ange -<br />
rissenen Entwurf wurden die Mosaiksteine in den<br />
partienweise aufgetragenen, noch feuchten Mörtel<br />
gedrückt, bevor vielleicht ein Mitarbeiter oder Lehrling<br />
die Zwischenräume nach dem Trocknen ausfugte.<br />
Viele der Mittelmotive hatten die Handwerker –<br />
vielleicht schon seriell? – in einer Werkstatt vorgefertigt,<br />
die dann beim Verlegen mit Kürzungen oder