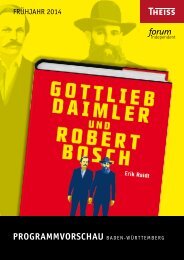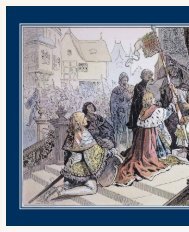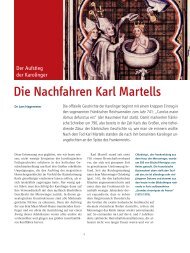Leseprobe - Theiss-Verlag
Leseprobe - Theiss-Verlag
Leseprobe - Theiss-Verlag
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
72 | Das römische Handwerk<br />
Organische Materialien: Textil- und Lederwaren, Holzobjekte und Knochenschnitzerein |<br />
73<br />
Die bei der Schafschur im Frühsommer benutzten<br />
Metallscheren ähneln den noch heute gängigen Formen,<br />
obwohl das Vlies manchmal auch von Hand<br />
ausgerissen wurde. Das anfangs bräunliche Haar der<br />
kleinen ziegenähnlichen Tiere war im Laufe der Zeit<br />
zu einer qualitätvollen Faser von hellem Ton veredelt<br />
worden. In Italien schützte man besonders feine,<br />
wertvolle Wolle vor Verunreinigungen, indem man<br />
den Schafen lederne Überzüge anlegte. Da das heute<br />
als Krempeln bezeichnete Auflockern der Faserbündel<br />
unbekannt war, kämmten professionelle lanarii<br />
pectinarii mit grobzinkigen Eisenkämmen (pectares)<br />
vor allem bei langhaarigem Vlies Unreinheiten aus.<br />
Dabei parallelisierten sie zugleich auch die Fasern,<br />
nachdem ein Bad in heißem, mit Seifenkraut versetztem<br />
Wasser das Wollfett reduziert, aber nicht vollständig<br />
entfernt hatte. Gute Qualitäten wie die lana<br />
Gallicana aus Gallien konnten entweder vor Ort weiterverarbeitet<br />
oder an die in Städten wie Rom tätigen<br />
lanarii geliefert werden. Sogar in der Baetica reagierte<br />
man auf die sich ändernde Nachfrage und führte<br />
seit dem frühen 1. Jh. statt fertiger Textilien zunehmend<br />
Rohwolle aus.<br />
Flachs, mit 50 bis 90 cm langen Fasern der wichtigste<br />
pflanzliche Rohstofflieferant, wurde vor allem<br />
im Osten des Römischen Reiches angebaut. Aber<br />
auch die keltischen Stämme der Morini und Caleti<br />
produzierten im Nordwesten Galliens schon vor den<br />
später weltweit bekannten flämischen Handwerkern<br />
qualitativ hochwertiges Leinen, mit dem sie vor allem<br />
die in Gesoriacum/ Boulogne-sur-Mer stationierte<br />
britannische Flotte belieferten. Man raufte Flachs bereits<br />
bei der sogenannten Gelbreife vorsichtig von<br />
Hand aus, um die langen Fasern nicht zu brechen,<br />
und trocknete die zu Garben gebundenen, kopfüber<br />
aufgestellten Stängel einige Tage. Anschließend wurden<br />
sie bei einem Röste/ Rotte genannten Vorgang gewässert<br />
oder gedörrt, damit die in die aufgebrochene<br />
Epidermis eindringenden Mikroorganismen die Fasern<br />
vom umgebenden Gewebe lösen konnten. Bevor<br />
das Material gänzlich verdarb, musste der Flachs wieder<br />
getrocknet und anschließend einzeln mit Holzhauen<br />
aufgeschlagen werden. Erst dann ließen sich<br />
die kleinteiligen Rindenreste von den Fasern trennen,<br />
die beim Hecheln parallelisiert und zugleich von den<br />
letzten noch anhaftenden Unreinheiten befreit wurden.<br />
Dabei fiel auch das kurzfaserige, z.B. für Dochte<br />
verwendete Werg an. Der ähnlich aufbereitete Hanf<br />
diente vor allem für den nautischen Bedarf wie das<br />
Kalfatern.<br />
Das Verspinnen aller textilen Rohfasern war eine<br />
arbeitsintensive, von den Frauen eines Haushaltes<br />
ganzjährig betriebene Tätigkeit, auch wenn die Notiz,<br />
dass am 4. August mit der Arbeit an 28 Pfund Wolle<br />
begonnen wurde, eher auf die Winterzeit weist. Nach<br />
den altrömischen mos maiorum galt das Spinnen sogar<br />
für die matronae der höheren Schichten als standesgemäße<br />
Beschäftigung. Daher tragen Frauen auf<br />
den Grabsteinen als Zeichen ihrer Würde die meist<br />
als Schmuckring fehlinterpretierte Fingerkunkel, einen<br />
mit 25 cm Länge meist recht kurzen Handrocken,<br />
dessen ringförmiges Ende am Ringfinger steckt. Die<br />
gläsernen Kunkeln aus sepulkralem Kontext dienten<br />
wohl tatsächlich nur als Schmuck und nicht der prakti<br />
schen Tätigkeit.<br />
Außer einiger Übung verlangte das Spinnen viel<br />
Fingerspitzengefühl, denn von der Festigkeit und der<br />
Stärke des Garnes hingen letztlich Stoff- und Fadenqualität<br />
ab. Den 20 bis 30 cm langen Spinnrocken aus<br />
Holz oder Bein, auf dem das Vliesknäuel befestigt<br />
war, hielt die Spinnerin in der Linken. Davon zupfte<br />
sie mit den Fingern der rechten Hand einige Fasern<br />
ab und verzwirbelte sie gleichzeitig zu einem Faden<br />
der gewünschten Stärke, den die durch das Gewicht<br />
des Spinnwirtels tanzende Spindel – ein ebenfalls bis<br />
zu 30 cm langer, an einem Ende abgerundeter Stab –<br />
zu einem möglichst gleichmäßigen Garn verdrehte.<br />
Nach den unterschiedlichen lokalen Traditionen bevorzugte<br />
man im Westen die z-förmig im Uhrzeigersinn<br />
laufende, im Osten dagegen die gegenläufige<br />
oder s-förmige Drehung. Geringe Unebenheiten des<br />
Die von den antiken Schäfern<br />
bei der Schafschur benutzten<br />
Scheren sind nicht nur in großer<br />
Zahl erhalten geblieben,<br />
sondern ähneln von ihrer<br />
Form her auch den noch heute<br />
gebräuchlichen Werkzeugen,<br />
wie die Anzeige aus dem<br />
Katalog von manufactum im<br />
Vergleich zu einem römischen<br />
Exemplar zeigt.<br />
Palmyra, Syrien, Hypogäum<br />
des Artaban. Loculusplatte<br />
einer Dame mit Spinnrocken,<br />
2. Jh. n.Chr.<br />
Tabarka (Tunesien), Raum<br />
mit drei Apsiden. Dargestellt<br />
ist bei den Szenen aus dem<br />
ländlichen Leben auch die<br />
Schäferin, die in der Nähe<br />
eines Stalles ihre Schafe<br />
hütet und zugleich das Vlies<br />
zu Wolle verspinnt.<br />
Fadenstrangs konnte das anschließende Verzwirnen<br />
ausgleichen. Während sich hölzerne Spindeln nur selten<br />
erhalten haben, finden sich in Siedlungen oder<br />
Villen häufig tönerne, scheibenförmige Spinnwirtel<br />
bzw. solche aus Bein. Besonders kostbare Spindeln<br />
waren mit Gewichten aus Bernstein, Gagat oder sogar<br />
so ausgefallenen Materialien wie Elfenbein und Eisen<br />
beschwert.<br />
Auch Weben gehörte zu den Tätigkeiten des häuslichen<br />
Fleißes, das den Webgewichten nach auf zahlreichen<br />
Gutshöfen betrieben wurde. Ihrem gehäuften<br />
Auftreten nach dürften Ateliers in den Villen Biberist/<br />
Spitalhof und Orbe-Bosceaz Tuchwaren sogar<br />
über den Eigenbedarf hinaus für den Verkauf produziert<br />
haben, was Columella, der beispielsweise Wollkämmer<br />
zur familia einer Farm rechnet, für wirt-<br />
schaft lich sinnvoll hielt. Vereinzelt bestanden auch<br />
Werkstätten wie das textrinum in Pompeji, wo eine<br />
Wandkritzelei den Arbeitsbeginn an einem Webauftrag<br />
vermerkte. Dass gewerbliche Webereien ebenso<br />
wie Weber insgesamt seltener bezeugt sind, erklärt<br />
sich wohl durch eine häufig im <strong>Verlag</strong>swesen vergebe -<br />
ne Tätigkeit, die z.B. für die in Vindolanda gekaufte<br />
Wolle vorausgesetzt werden darf. Die im 1. Jh. üblichen<br />
vertikalen Webstühle blieben zwar nicht erhalten,<br />
waren aber den pyramidalen Webgewichten aus<br />
Ton nach reichsweit in Siedlungen und Villen in<br />
Gebrauch. Ihr Rückgang im 2. und 3. Jh. hängt ausschließlich<br />
mit dem neu entwickelten horizontalen<br />
Webstuhl zusammen, bei dem die Kette nicht mehr<br />
mit Gewichten, sondern mit dem Kettbaum straff gespannt<br />
wurde, was eine rationellere Arbeit zuließ. Erhaltene<br />
Textilien zeigen verschiedene Bindungstechniken<br />
wie die mehrfach variierte Leinwand- und<br />
Köperbindung.<br />
Die Brettchenweberei ist durch Funde der dafür<br />
benötigten Brettchen aus Bein belegt. Mit dieser<br />
Technik stellte man bevorzugt bunte Borten her, die<br />
auf Gewänder aufgenäht wurden.<br />
Die locker gewebten Wollwaren verdichtete erst<br />
der Walker zu einem festeren Stoff mit glatter Oberflächenstruktur<br />
oder zu Filz. Sie konnten bei dem<br />
hohen Bedarf an Textilien sicher mit einem guten<br />
Einkommen rechnen, zumal sie die Kleider auch reinig<br />
ten. Während in jedem Haus gewebt werden<br />
konnte, erforderte das Walken eine ausreichende<br />
Wasserversorgung. An vielen wasserdicht ausgekleideten<br />
Wannen oder Fässern, die in den Boden einge-