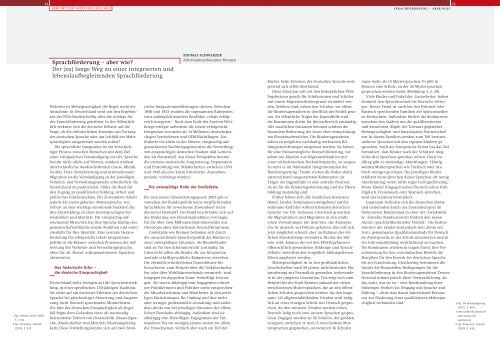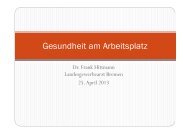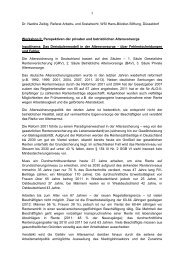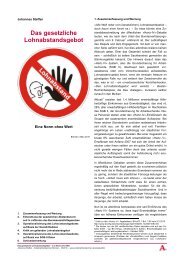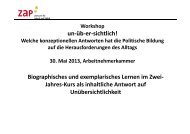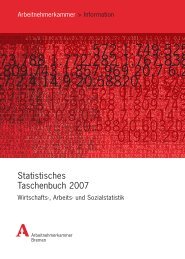Aus Vielfalt eigene Stärken entwickeln - bei der ...
Aus Vielfalt eigene Stärken entwickeln - bei der ...
Aus Vielfalt eigene Stärken entwickeln - bei der ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
44<br />
B E R I C H T Z U R S O Z I A L E N L AG E 2 012<br />
45<br />
S P R AC H F Ö R D E R U NG – A B E R W I E ?<br />
1 Vgl. Herbert, Ulrich (1986),<br />
S. 71-81.<br />
2 Vgl. Schweitzer, Helmuth<br />
(2009), S. 432.<br />
Sprachför<strong>der</strong>ung – aber wie?<br />
Der (zu) lange Weg zu einer integrierten und<br />
lebenslaufbegleitenden Sprachför<strong>der</strong>ung<br />
Weltweit ist Mehrsprachigkeit die Regel, nicht die<br />
<strong>Aus</strong>nahme. In Deutschland wird seit den Ergebnissen<br />
<strong>der</strong> PISA-Studien heftig über die richtige Art<br />
<strong>der</strong> Sprachför<strong>der</strong>ung gestritten. In <strong>der</strong> Öffentlichkeit<br />
verkürzt sich die deutsche Debatte auf die<br />
Frage, ob die erfor<strong>der</strong>lichen Konzepte am Vorrang<br />
<strong>der</strong> deutschen Sprache o<strong>der</strong> am Leitbild <strong>der</strong> Mehrsprachigkeit<br />
ausgerichtet werden sollen?<br />
Die sprachliche Integration ist ein vielschichtiger<br />
Prozess zwischen Menschen mit dem Ziel<br />
einer erfolgreichen Verständigung vor Ort. Sprache<br />
beruht nicht allein auf Worten, son<strong>der</strong>n umfasst<br />
unterschiedliche <strong>Aus</strong>drucksformen (Laute, Mimik,<br />
Gestik). Trotz Globalisierung und internationaler<br />
Migration ist die Verständigung in <strong>der</strong> jeweiligen<br />
Verkehrs- und Verwaltungssprache erfor<strong>der</strong>lich. Sie<br />
hinreichend zu praktizieren, bildet die Basis für<br />
den Zugang zu qualifizierter Bildung, Ar<strong>bei</strong>t und<br />
politischer Einflussnahme. Für Zuwan<strong>der</strong>er behält<br />
jedoch die zuerst gelernte ›Muttersprache‹ von<br />
Geburt an eine wichtige emotionale Funktion für<br />
ihre Entwicklung zu einer mehrsprachigen Persönlichkeit<br />
und Identität. Für einsprachig aufwachsende<br />
Menschen hat ihre Sprache häufig eine<br />
gemeinschaftsstiftende soziale Funktion und somit<br />
ebenfalls für ihre Identität. Eine zentrale Herausfor<strong>der</strong>ung<br />
für erfolgreiche lokale Integrationspolitik<br />
ist die Balance zwischen Prozessen <strong>der</strong> Aufwertung<br />
<strong>der</strong> Verkehrs- und Verwaltungssprache,<br />
ohne die als ›fremd‹ wahrgenommenen Sprachen<br />
abzuwerten.<br />
Das historische Erbe –<br />
die deutsche Einsprachigkeit<br />
THOMAS SCHWARZER<br />
Ar<strong>bei</strong>tnehmerkammer Bremen<br />
Deutschland steht, bezogen auf die Sprachentwicklung,<br />
in einer spezifischen 150-jährigen Tradition.<br />
Sie zielte auf ein forciertes Erlernen <strong>der</strong> deutschen<br />
Sprache <strong>bei</strong> gleichzeitiger Abwertung und <strong>Aus</strong>grenzung<br />
nicht Deutsch sprechen<strong>der</strong> Min<strong>der</strong>heiten.<br />
Die Idee <strong>der</strong> deutschen Einsprachigkeit als Regelfall<br />
folgte dem Gedanken einer als notwendig<br />
betrachteten Einheit von (Staats-)Volk, (Staats-)Sprache,<br />
(Staats-)Gebiet und Identität (Staatsangehörigkeit).<br />
Diese Vorstellung konnte sich auf zwei historische<br />
Integrationserfahrungen stützen. Zwischen<br />
1880 und 1933 wurden die sogenannten Ruhrpolen,<br />
trotz anfänglich massiver Konflikte, relativ erfolgreich<br />
integriert. 1 Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs<br />
erfolgte außerdem die relativ erfolgreiche<br />
Integration von mehr als 14 Millionen deutschsprachigen<br />
Vertriebenen und DDR-Flüchtlingen. Das<br />
för<strong>der</strong>te vor allem in <strong>der</strong> älteren, einsprachig aufgewachsenen<br />
Nachkriegsgeneration die Vorstellung<br />
von einsprachigen deutschen Städten und Gemeinden<br />
als Normalfall. <strong>Aus</strong> dieser Perspektive konnte<br />
die extreme rassistische <strong>Aus</strong>grenzung, Deportation<br />
und Ermordung von ›Min<strong>der</strong>heiten‹ zwischen 1933<br />
und 1945 als eine kurze historische ›<strong>Aus</strong>nahmeperiode‹<br />
verdrängt werden. 2<br />
Die zwiespältige Rolle <strong>der</strong> Großstädte<br />
Bis zum neuen Zuwan<strong>der</strong>ungsgesetz 2005 gab es<br />
vonseiten <strong>der</strong> Bundespolitik keine verpflichtenden<br />
Sprachkurse für erwachsene Zuwan<strong>der</strong>er nichtdeutscher<br />
Herkunft. Der Bund beschränkte sich auf<br />
die För<strong>der</strong>ung von Einzelmaßnahmen vorrangig<br />
für die über zwei Millionen (Spät-)<strong>Aus</strong>siedler aus<br />
Osteuropa ohne hinreichende Deutschkenntnisse.<br />
Großstädte wie Bremen befanden sich durch<br />
die unzureichende Sprachenpolitik des Bundes in<br />
einer zwiespältigen Situation. Als Bundeslän<strong>der</strong><br />
sind sie für den Schulunterricht zuständig. Im<br />
Unterricht sollen die Kin<strong>der</strong> die zur Integration<br />
zentrale schriftsprachliche Kompetenz erwerben.<br />
Die ebenfalls erfor<strong>der</strong>lichen Deutschkurse für<br />
Erwachsene, zum Beispiel über die Volkshochschulen<br />
o<strong>der</strong> über Wohlfahrtsverbände vermittelt, sind<br />
hingegen im doppelten Sinne ›freiwillige Leistungen‹.<br />
Sie waren abhängig vom Engagement einzelner<br />
Politikerinnen und Politiker sowie entsprechen<strong>der</strong><br />
Mitar<strong>bei</strong>terinnen und Mitar<strong>bei</strong>ter in den jeweiligen<br />
Einrichtungen. Ihr Umfang und ihre mehr<br />
o<strong>der</strong> weniger professionelle Gestaltung sind außerdem<br />
direkt von <strong>der</strong> jeweiligen Situation <strong>der</strong> öffentlichen<br />
Haushalte abhängig. Außerdem sind sie<br />
abhängig vom freiwilligen Engagement <strong>der</strong> Einwan<strong>der</strong>er.<br />
Bis vor wenigen Jahren waren vor allem<br />
die Erwachsenen, vielfach aber auch ein Teil <strong>der</strong><br />
Kin<strong>der</strong>, <strong>bei</strong>m Erlernen <strong>der</strong> deutschen Sprache weitgehend<br />
sich selbst überlassen.<br />
Diese Situation soll seit den bedenklichen PISA-<br />
Ergebnissen gerade für Schülerinnen und Schüler<br />
mit einem Migrationshintergrund verän<strong>der</strong>t werden.<br />
Seitdem sind, neben den Schulen, vor allem<br />
die Kin<strong>der</strong>tagesstätten in den Blick <strong>der</strong> Politik geraten.<br />
Als öffentliche Träger <strong>der</strong> Jugendhilfe sind<br />
die Kommunen direkt für diesen Bereich zuständig.<br />
Alle staatlichen Instanzen betonen seitdem die<br />
beson<strong>der</strong>e Bedeutung des zuvor eher vernachlässigten<br />
Elementarbereiches. Die Kin<strong>der</strong>tagesstätten<br />
sollen zu möglichst nachhaltig wirksamen Bildungseinrichtungen<br />
umgebaut werden. Sie haben<br />
für eine frühestmögliche Deutschför<strong>der</strong>ung, vor<br />
allem von Kin<strong>der</strong>n aus Migrantenfamilien mit<br />
einer nichtdeutschen Herkunftssprache, zu sorgen.<br />
So steht es im Nationalen Integrationsplan <strong>der</strong><br />
Bundesregierung. 3 Damit rücken die bisher dafür<br />
unzureichend ausgestatteten Kommunen als<br />
Träger <strong>der</strong> Jugendhilfe in eine zentrale Position,<br />
da sie für die Kin<strong>der</strong>tagesbetreuung und die Elternbildung<br />
zuständig sind.<br />
Früher haben sich alle staatlichen Instanzen<br />
(Bund, Län<strong>der</strong>, Kommunen) weitgehend auf die<br />
wirksame Kraft <strong>der</strong> vorherrschenden deutschen<br />
Sprache ›vor Ort‹ verlassen. Gleichzeitig wurden<br />
die Migrantinnen und Migranten in den städtischen<br />
Verwaltungen mit dem Satz ›die Amtssprache<br />
ist deutsch‹ auf Distanz gehalten. Das soll sich<br />
jetzt möglichst schnell, aber im Rahmen <strong>der</strong> örtlichen<br />
Haushaltslage verän<strong>der</strong>n. Bis das <strong>der</strong> Fall<br />
sein wird, können die seit den PISA-Ergebnissen<br />
offensichtlich gewordenen ›Bildungs- und Sprachdefizite‹<br />
weiterhin den vorgeblich bildungsfernen<br />
Eltern angelastet werden.<br />
Mehrsprachigkeit ist in den großstädtischen<br />
Gesellschaften nach 50 Jahren nichtdeutscher Einwan<strong>der</strong>ung<br />
zur Normalität geworden, insbeson<strong>der</strong>e<br />
in <strong>der</strong> jüngeren Generation. Das zeigt sich zum<br />
Beispiel für die Stadt Bremen anhand <strong>der</strong> vielen<br />
verschiedenen Muttersprachen, die an den öffentlichen<br />
Schulen gesprochen werden. An den insgesamt<br />
143 allgemeinbildenden Schulen wird lediglich<br />
an einer einzigen Schule nur Deutsch gesprochen.<br />
An drei weiteren Schulen werden neben<br />
Deutsch ledig noch zwei weitere Sprachen gesprochen.<br />
Dagegen werden an 56 Schulen, <strong>der</strong> größten<br />
Gruppen, zwischen 11 und 15 verschiedene Muttersprachen<br />
gesprochen, an weiteren 36 Schulen<br />
sogar mehr als 15 Muttersprachen. Es gibt in<br />
Bremen eine Schule, an <strong>der</strong> 26 Muttersprachen<br />
gesprochen werden (siehe Abbildung 3, S. 29).<br />
Viele Kin<strong>der</strong> und Enkel <strong>der</strong> ›Gastar<strong>bei</strong>ter‹ haben<br />
dennoch den Sprachwechsel ins Deutsche vollzogen.<br />
Dieser Trend ist auch <strong>bei</strong> den Polnisch o<strong>der</strong><br />
Russisch sprechenden Familien <strong>der</strong> Spätaussiedler<br />
zu beobachten. Außerdem för<strong>der</strong>t die Konkurrenz<br />
zwischen den Städten um die qualifiziertesten<br />
und kreativsten ›Köpfe‹ die Toleranz gegenüber<br />
Mehrsprachigkeit und binationalen Partnerschaften.<br />
In diesen Familien werden zum Teil bewusst<br />
mehrere Sprachen mit den <strong>eigene</strong>n Kin<strong>der</strong>n gesprochen.<br />
Auch die Europäische Union hat das Ziel<br />
formuliert, dass Kin<strong>der</strong> nach <strong>der</strong> Schulzeit möglichst<br />
drei Sprachen sprechen sollten. Doch im<br />
Alltag gibt es eindeutige ›Abstufungen‹. Häufig<br />
werden Muttersprachen wie Türkisch o<strong>der</strong> Arabisch<br />
weniger geschätzt. Die jeweiligen Kin<strong>der</strong><br />
erfahren <strong>bei</strong>m Sprechen dieser Sprachen oft wenig<br />
Anerkennung, wenn nicht sogar Geringschätzung.<br />
Wenn Kin<strong>der</strong> hingegen neben Deutsch schon früh<br />
Englisch, Französisch o<strong>der</strong> Spanisch sprechen,<br />
wird das meistens bewun<strong>der</strong>t.<br />
Insgesamt befinden sich die deutschen Städte<br />
und Gemeinden durch das Zusammenspiel im<br />
för<strong>der</strong>ativen Bundesstaat in einer Art ›Zwickmühle‹.<br />
Einzelne Bundesressorts för<strong>der</strong>n den neuen<br />
Ansatz sprachlichkultureller <strong>Vielfalt</strong>. 4 Die Kultusminister<br />
<strong>der</strong> Län<strong>der</strong> sind jedoch weit davon entfernt,<br />
gemeinsame Qualitätsstandards für Deutsch<br />
als Zweitsprache in <strong>der</strong> Schule umzusetzen und in<br />
<strong>der</strong> Lehrerausbildung verpflichtend zu machen.<br />
Die Kommunen wie<strong>der</strong>um tragen durch ihre Verantwortung<br />
für den vorschulischen Bereich die<br />
Hauptlast für den Erwerb <strong>der</strong> deutschen Sprache<br />
bis zur Einschulung. Gleichzeitig bestimmen die<br />
Län<strong>der</strong> die finanziellen Bedingungen für die<br />
Sprachför<strong>der</strong>ung in den Kin<strong>der</strong>tagesstätten. Dessen<br />
Personal nimmt jedoch diese ›Verstaatlichung‹ als<br />
das wahr, was sie ist – eine Beschränkung ihrer<br />
bisherigen Freiheit im Umgang mit Sprache und<br />
Bildung –, ohne dass damit hinreichend Ressourcen<br />
zur För<strong>der</strong>ung einer qualifizierten Mehrsprachigkeit<br />
verbunden sind. 5<br />
3 Vgl. Die Bundesregierung<br />
(2007), S. 48 ff.<br />
4 www.vielfalt-als-chance.de<br />
www.wissen-undwachsen.de<br />
5 Vgl. Schweitzer, Helmuth<br />
(2009), S. 439.