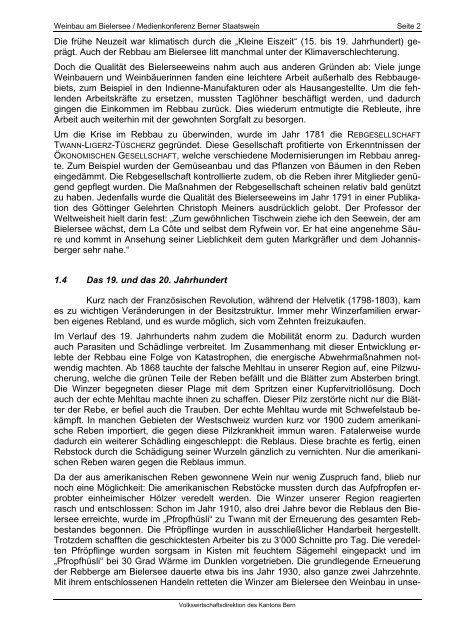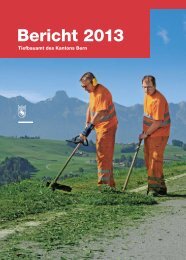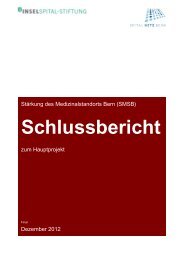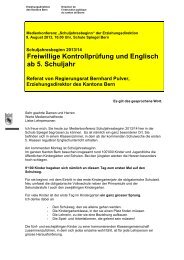Faktenblatt - Kanton Bern
Faktenblatt - Kanton Bern
Faktenblatt - Kanton Bern
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Weinbau am Bielersee / Medienkonferenz <strong>Bern</strong>er Staatswein Seite 2<br />
Die frühe Neuzeit war klimatisch durch die „Kleine Eiszeit“ (15. bis 19. Jahrhundert) geprägt.<br />
Auch der Rebbau am Bielersee litt manchmal unter der Klimaverschlechterung.<br />
Doch die Qualität des Bielerseeweins nahm auch aus anderen Gründen ab: Viele junge<br />
Weinbauern und Weinbäuerinnen fanden eine leichtere Arbeit außerhalb des Rebbaugebiets,<br />
zum Beispiel in den Indienne-Manufakturen oder als Hausangestellte. Um die fehlenden<br />
Arbeitskräfte zu ersetzen, mussten Taglöhner beschäftigt werden, und dadurch<br />
gingen die Einkommen im Rebbau zurück. Dies wiederum entmutigte die Rebleute, ihre<br />
Arbeit auch weiterhin mit der gewohnten Sorgfalt zu besorgen.<br />
Um die Krise im Rebbau zu überwinden, wurde im Jahr 1781 die REBGESELLSCHAFT<br />
TWANN-LIGERZ-TÜSCHERZ gegründet. Diese Gesellschaft profitierte von Erkenntnissen der<br />
ÖKONOMISCHEN GESELLSCHAFT, welche verschiedene Modernisierungen im Rebbau anregte.<br />
Zum Beispiel wurden der Gemüseanbau und das Pflanzen von Bäumen in den Reben<br />
eingedämmt. Die Rebgesellschaft kontrollierte zudem, ob die Reben ihrer Mitglieder genügend<br />
gepflegt wurden. Die Maßnahmen der Rebgesellschaft scheinen relativ bald genützt<br />
zu haben. Jedenfalls wurde die Qualität des Bielerseeweins im Jahr 1791 in einer Publikation<br />
des Göttinger Gelehrten Christoph Meiners ausdrücklich gelobt. Der Professor der<br />
Weltweisheit hielt darin fest: „Zum gewöhnlichen Tischwein ziehe ich den Seewein, der am<br />
Bielersee wächst, dem La Côte und selbst dem Ryfwein vor. Er hat eine angenehme Säure<br />
und kommt in Ansehung seiner Lieblichkeit dem guten Markgräfler und dem Johannisberger<br />
sehr nahe.“<br />
1.4 Das 19. und das 20. Jahrhundert<br />
Kurz nach der Französischen Revolution, während der Helvetik (1798-1803), kam<br />
es zu wichtigen Veränderungen in der Besitzstruktur. Immer mehr Winzerfamilien erwarben<br />
eigenes Rebland, und es wurde möglich, sich vom Zehnten freizukaufen.<br />
Im Verlauf des 19. Jahrhunderts nahm zudem die Mobilität enorm zu. Dadurch wurden<br />
auch Parasiten und Schädlinge verbreitet. Im Zusammenhang mit dieser Entwicklung erlebte<br />
der Rebbau eine Folge von Katastrophen, die energische Abwehrmaßnahmen notwendig<br />
machten. Ab 1868 tauchte der falsche Mehltau in unserer Region auf, eine Pilzwucherung,<br />
welche die grünen Teile der Reben befällt und die Blätter zum Absterben bringt.<br />
Die Winzer begegneten dieser Plage mit dem Spritzen einer Kupfervitriollösung. Doch<br />
auch der echte Mehltau machte ihnen zu schaffen. Dieser Pilz zerstörte nicht nur die Blätter<br />
der Rebe, er befiel auch die Trauben. Der echte Mehltau wurde mit Schwefelstaub bekämpft.<br />
In manchen Gebieten der Westschweiz wurden kurz vor 1900 zudem amerikanische<br />
Reben importiert, die gegen diese Pilzkrankheit immun waren. Fatalerweise wurde<br />
dadurch ein weiterer Schädling eingeschleppt: die Reblaus. Diese brachte es fertig, einen<br />
Rebstock durch die Schädigung seiner Wurzeln gänzlich zu vernichten. Nur die amerikanischen<br />
Reben waren gegen die Reblaus immun.<br />
Da der aus amerikanischen Reben gewonnene Wein nur wenig Zuspruch fand, blieb nur<br />
noch eine Möglichkeit: Die amerikanischen Rebstöcke mussten durch das Aufpfropfen erprobter<br />
einheimischer Hölzer veredelt werden. Die Winzer unserer Region reagierten<br />
rasch und entschlossen: Schon im Jahr 1910, also drei Jahre bevor die Reblaus den Bielersee<br />
erreichte, wurde im „Pfropfhüsli“ zu Twann mit der Erneuerung des gesamten Rebbestandes<br />
begonnen. Die Pfröpflinge wurden in ausschließlicher Handarbeit hergestellt.<br />
Trotzdem schafften die geschicktesten Arbeiter bis zu 3‘000 Schnitte pro Tag. Die veredelten<br />
Pfröpflinge wurden sorgsam in Kisten mit feuchtem Sägemehl eingepackt und im<br />
„Pfropfhüsli“ bei 30 Grad Wärme im Dunklen vorgetrieben. Die grundlegende Erneuerung<br />
der Rebberge am Bielersee dauerte etwa bis ins Jahr 1930, also ganze zwei Jahrzehnte.<br />
Mit ihrem entschlossenen Handeln retteten die Winzer am Bielersee den Weinbau in unse-<br />
Volkswirtschaftsdirektion des <strong>Kanton</strong>s <strong>Bern</strong>