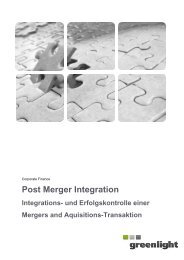menseth - Greenlight Consulting
menseth - Greenlight Consulting
menseth - Greenlight Consulting
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Ethische Unternehmensführung<br />
Unterneh<strong>menseth</strong>ik und<br />
Compliance<br />
Management<br />
1. Wertemanagement und gelebte Werte<br />
1.1. Was sind Werte wert?<br />
1.2. Ergebnissee der „Führungskräftebefragung 2009“ über Werte<br />
2. Erfolgreich führen mit Werten<br />
2.2. Geschäftsmoral ist Führungsaufgabe<br />
2.3. Ethische Spielregeln setzen und verankern<br />
3. Unterneh<strong>menseth</strong>ik<br />
3.1. Unterneh<strong>menseth</strong>ik‐<br />
in Professional Service<br />
Die Theoriee unvollständiger Verträge<br />
3.2. Unterneh<strong>menseth</strong>ik Firms<br />
4. Compliance<br />
Management<br />
4.1. Vertrauenskultur als Bestandteil<br />
effektiver Compliance<br />
4.2. Praxisbeispiel: Compliance‐ Handbuch von Siemens (2009)<br />
4.3. Einführung sozialtechnischer Maßnahmen mit Hilfe des Compliance‐ Ansatzes<br />
4.4. Corporate<br />
Governance<br />
4.5. Wirtschaftsethik als zentraler Aspekt der Corporate Governance<br />
5. Corporate Social Responsibility als Erfolgsfaktor<br />
Seite 1
Ethische Unternehmensführung<br />
Unterneh<strong>menseth</strong>ik und Compliance Management<br />
Ökologisches und soziales Engagement wird zum langfristigen Trend. Von Bio‐Food, Bio‐Baumwolle,<br />
bis Hybridmotoren fast alle Gebrauchsgegenstände folgen aktuell der Entwicklung eines „gewissenhaften“<br />
nachhaltigen Konsums. Gesellschaftliche Bewegungen wie die LOHAS (Lifestyle of Health and<br />
Sustainability) fördern Werte wie Qualität, Authentizität und Gesundheit und bestärken die Konsumenten<br />
zu einem bewusst besseren Lebensstil (CSR& Konsum, 2008,1, S.116‐117).<br />
Ebenso gilt es Werte in der Unternehmenskultur fest zu verankern. Die Wirtschaftskandale der letzen<br />
Zeit wie z. B. bei Siemens oder VW haben gezeigt, dass korruptes Verhalten von Führungskräften<br />
enorme Reputationsschäden und immense Kosten verursacht. Die Prävention von Illegalem und unmoralischem<br />
Verhalten vom Topmanagement stellt einen wichtigen Bestandteil des modernen<br />
Compliance Managements und damit der Corporate Governance dar. Da illegale Handlungen weder<br />
durch das Strafrecht noch durch Kontrollsysteme vollständig verhindert werden können, ist die Einführung<br />
eines professionellen Wertemanagements‐Systems nötig. Eine klare Orientierung und das<br />
Vorleben der Geschäftsmoral durch das Topmanagement sind bei der erfolgreichen Etablierung der<br />
Werte in die Geschäftspraxis von entscheidender Bedeutung (Wieland, 2008, S.86‐87).<br />
1. Wertemanagement und gelebte Werte<br />
Der Wert eines Unternehmens hängt zunehmend sowohl von der effektiven<br />
Nutzung weltweiter Wertschöpfungsketten, als auch von der Wahrnehmung<br />
sozialer und gesellschaftlicher Verantwortung ab (DNWE, Wertemanagement,<br />
2009). Unmoralische und illegale Verhaltungsweisen wirken wertvernichtend.<br />
Ein professionelles Werte‐Management‐System sollte daher Bestandteil der Corporate Governance<br />
sein. Das Ziel besteht darin, Werte in einen lebendigen Prozess zu etablieren. Unternehmenswerte<br />
sollen demnach nicht nur kodifiziert werden, sondern auch in allen relevanten Geschäftsprozessen<br />
implementiert, systematisiert, kontrolliert und Verantwortlichkeiten des Führungspersonals bestimmt<br />
werden (Wieland, 2008, S. 86). Klar definierte Werte und deren Umsetzung in das alltägliche<br />
Geschäft geben dem Unternehmen eine Identität und dem Management Handlungsmaßstäbe<br />
(DNWE, Wertemanagement, 2009).<br />
Quelle: Prof. Dr. habil. Josef Wieland<br />
Seite 2
Ethische Unternehmensführung<br />
1.1 Was sind Werte wert?<br />
Ein solides Wertemanagement macht Unternehmen attraktiv und reduziert die Gefahr von Reputationsrisiken.<br />
Eine klare und feste Führung stellt einen Erfolgsfaktor dar. Unternehmen mit gelebten Werten genießen<br />
einen besseren Ruf und sind somit attraktiver für potenziellen Führungsnachwuchs. Dies belegt<br />
eine Untersuchung von Kotler & Heskett, welche schlussfolgert, „dass Unternehmen, die durch<br />
Werte getrieben werden, mehr Umsatz, mehr Beschäftigungswachstum und einen günstiger verlaufenden<br />
Aktienkurs aufweisen als andere“.<br />
In einer weiteren Umfrage durch McKinsey hat man herausgefunden, dass Investoren zu erheblichen<br />
Aufschlägen für Anteile an Unternehmen bereit sind, wenn diese über eine erfolgreiche Corporate<br />
Governance verfügen (Hardebusch, 2007, S.16).<br />
Allgemein lässt sich sagen, dass Werte im Trend liegen und die heutigen Führungskräfte nicht weniger,<br />
sondern deutlich mehr Wert auf Werte legen (Schmidt, 2007, S. 1).<br />
1.2. Ergebnisse der „Führungskräftebefragung 2009“ über Werte<br />
(www.wertekomission.de)<br />
In einer Onlinebefragung wurden bundesweit 502 junge Führungskräfte<br />
im Alter zwischen 26 und 40 interviewt.<br />
Sie wurden unter anderem befragt nach welchen Werten sie ihr Leben ausrichten. Wie aus der unterstehenden<br />
Graphik zu entnehmen ist, stellen Familie und Ehrlichkeit eines der am häufigsten genannten<br />
Werte dar. Erfolg und Anerkennung wirkt eher abgeschlagen bei 10%. Daraus wird der<br />
Trend zum Downshifting deutlich. Family Values und die Balance zwischen Beruf und Privatleben<br />
stehen im Mittelpunkt.<br />
Quelle: Bucksteeg, M. & Hattendorf, K. (2009). Führungskräftebefragung. S. 10<br />
Seite 3
Ethische Unternehmensführung<br />
Weiterhin zeigt die Umfrage, dass mehr als 80% der Befragten der Meinung sind, dass eine auf Werten<br />
aufgebaute Geschäftsbeziehung deutlich stabiler ist.<br />
Skepsis zeigt sich vor allem bezüglich der Umsetzung der Werte. Fast 40% der Befragten meinen,<br />
dass sich ihre Unternehmen nur aus Marketingzwecken auf Werte bezögen. Hieraus lässt sich eine<br />
klare Trennlinie ableiten: In der Theorie sind die Werte klar formuliert, jedoch scheint ein wertorientiertes<br />
Handeln in der Praxis noch nicht vollkommen etabliert zu sein. Managemententscheidungen<br />
werden von mehr als der Hälfte der Befragten als nicht transparent genug, nicht sauber dokumentiert<br />
und als zu wenig nachvollziehbar interpretiert.<br />
Außerdem verspüren, wie aus der unterstehenden Graphik ersichtlich, mehr als zwei Drittel der Interviewten<br />
keine an Werten orientierte Führung durch das Topmanagement. Das Problem liegt somit<br />
in der Umsetzung der Werte, insbesondere bei der Implementierung und dem fehlenden Vorleben<br />
durch die oberste Führungsebene.<br />
Quelle: Bucksteeg, M. & Hattendorf, K.(2009). Führungskräftebefragung. S. 17<br />
Es geben sogar 38% der Befragten an, dass das Verhalten der direkten Vorgesetzen sie an dem aktiven<br />
„Leben“ der Unternehmenswerte hindern würden. Außerdem waren überhaupt nur 24% über<br />
die Werte ihrer Unternehmung informiert. Dies zeigt, dass die interne und externe Kommunikation<br />
von Werten nachhaltiger betrieben werden sollte.<br />
Zusammenfassend kann man feststellen, dass seit der Umfrage von 2007, die Werte Vertrauen und<br />
Ehrlichkeit und gerade in Zeiten der Krise der Wunsch nach Treue und Verbindlichkeit an Gewicht<br />
gewonnen haben. Deutlich wichtiger sind auch Family Values und Work‐Life‐Balance geworden.<br />
Problemfelder wie die fehlende Umsetzung der Werte in die Geschäftspraxis wurden deutlich(Bucksteeg<br />
& Hattendorf, 2009, S. 7‐29).<br />
Seite 4
Ethische Unternehmensführung<br />
2. Erfolgreich führen<br />
mit Werten<br />
Aus einer Emnid‐Umfrage im Auftrag der Stiftung „Wertvolle Zukunft“<br />
ging aus<br />
dem Ergebnis hervor, dass nur elf Prozent der Bevölkerung<br />
den<br />
deutschen Konzernbossen ihr Vertrauen schenken. Für den Vertrauensverlust werden vor allem Top‐<br />
in Ver‐<br />
Manager verantwortlich gemacht, die oft mit den Begriffen wie Skrupellosigkeit<br />
und Raffgier<br />
bindung gebracht werden (Focus<br />
Online Money, 2006). Dieses sehr negativ besetzte Bild gilt es durch<br />
Tugenden wie Ehrlichkeit, Offenheit und Transparenz zu<br />
revidieren. Im Kampf gegen Korruption und<br />
der Beachtung von Menschenrechten sind die zehn Prinzipien des<br />
Global Compact der Vereinten<br />
Nationenn oder die zahlreichen Handlungsempfehlungen<br />
der Corporate Governance wegweisend.<br />
Führungsqualitäten<br />
wie Charakter, Integrität und Glaubwürdigkeit stellen Themen mit Zukunftsper‐<br />
und<br />
spektivee dar (Wieland, 2008, S. .86). Wertesysteme und<br />
soziale Strukturen müssen entwickelt<br />
gepflegt werden.<br />
Als obersten Leitsatz<br />
muss in jedem Unternehmen gelten, dass Führen in erster Linie bedeutet, ein<br />
Vorbild zu sein. Mitarbeiterloyalität und exzellente Leistungen kann das Topmanagement nur erwar‐<br />
der<br />
ten, wenn es hohe Maßstäbe an das eigene Handeln legt.<br />
Zudem haben ein vorbildhaftes<br />
und authentisches Verhalten Auswirkungen auf die Motivation<br />
Mitarbeiter. Um diese zu steigern reichen finanzielle Anreize gewisss nicht aus. Vielmehr ein<br />
vertrau‐<br />
von<br />
ensvolles Verhältnis zwischen Vorgesetzten<br />
und Mitarbeitern schafft eine Basiss zur Entstehung<br />
Motivation und Identifikation mit dem Unternehmen. Physische und<br />
geistige Tätigkeiten sollten nicht<br />
voneinander getrennt sein, da die größte Zufriedenheit<br />
meist aus den Aufgaben resultiert, welche<br />
von Anfang an geplant, durchdacht, ausgeführt und später eigenständig kontrolliert werden. Mitar‐<br />
beiter an Entscheidungsprozessen teilhaben<br />
zu lassen, fordert die Akzeptanz einer Unternehmens‐<br />
strategiee und verstärkt das „Wir‐Gefühl“.<br />
zu seinen Mitarbeitern wird nur jener aufbauen können,<br />
welcher<br />
Ein wirkliches Vertrauensverhältnis<br />
den Anliegen und Problemen anderer offen begegnet und sowohl über interkulturelle, als auch über<br />
emotionale Kompetenz verfügt.<br />
Führungskräfte müssen<br />
es verstehen mit verschiedenstenn Persön‐<br />
lichkeiten und Charakteren kommunizieren zu können (Schmidt, 2007, S.5).<br />
Die Wertekommission schlägt folgende Werte als Basis der Unternehmensführung vor (Hardebusch,<br />
2007, S. 15):<br />
‣<br />
‣<br />
Nachhaltigkeit<br />
Integrität<br />
‣ Vertrauen<br />
‣ Verantwortung<br />
‣ Mut<br />
‣ Respekt<br />
Seite 5
Ethische Unternehmensführung<br />
2.1. Geschäftsmoral ist Führungsaufgabe<br />
Mit den Worten:„The moral of this story is break the rules, you can cheat, you can lie, but as long as<br />
you make money it´s all right.” beschrieb ein früherer Enron Vice Präsident die Geschäftsmoral von<br />
seinem damaligen Arbeitgeber (Scherer & Platzer, 2008, S. 140.) Die Enron Corporation stellt eines<br />
der bekanntesten Negativbeispiele für eine gut umgesetzte Unternehmenskultur dar. Um solche<br />
Fehlverhalten zu vermeiden, stehen uns zahlreiche Werkzeuge wie Code of Ethics, Code of Conduct,<br />
Whistleblowing, Compliance Programme und noch viele mehr zur Verfügung. Es bedarf allerdings<br />
nicht nur formalen Compliance‐ Mechanismen, sondern die Geschäftsmoral muss vom Topmanagement<br />
gewollt und vor allem vorgelebt werden (Wieland, 2008, S.87). Werte müssen schriftlich niedergelegt,<br />
durch Führungskräfte eindeutig kommuniziert und konsequent in die Geschäftspraxis implementiert<br />
werden.<br />
2.2. Ethische Spielregeln setzen und verankern<br />
Nach welchen ethischen Grundsätzen Menschen handeln ist fraglich und individuell sehr verschieden.<br />
Um ein verantwortliches, nachhaltiges Wirtschaften zu erreichen, empfiehlt es sich daher nicht<br />
sich nur auf das individuelle moralische Verständnis des Einzelnen zu verlassen. Vielmehr gilt es den<br />
Konflikt zwischen Rendite und Gewissen mit klaren Vorgaben auf der institutionellen Ebene zu regeln,<br />
um nicht den Mitarbeitern den Entscheidungskonflikt aufzubürden. Viele Unternehmen stellen<br />
deshalb einen Verhaltenskodex auf, der für die Mitarbeiter als klare Orientierung dienen soll. Dieser<br />
verfehlt jedoch seinen Zweck, wenn er nur erlassen wird, um eine Rechtfertigung gegenüber Eigentümern,<br />
Aktionären und der Öffentlichkeit geltend zu machen. Es ist somit von entscheidender Bedeutung<br />
zu ethischen Regeln klare Aussagen zu treffen und Verantwortung und Nachhaltigkeit als<br />
Zielsetzung von Führungskräften zu verankern. (Braun, 2008, S. 84‐85)<br />
Verankerung von ethischen Grundsätzen<br />
Von der…<br />
zur…<br />
Individuellen Ebene<br />
‣ Eigene Wertvorstellungen<br />
‣ Individuelle moralische<br />
Grundsätze<br />
Institutionellen Ebene<br />
‣ Verankerung von ethischer<br />
Verantwortung und Nachhaltigkeit<br />
‣ Lösung des Gewissenskonflikts<br />
zwischen Rendite und<br />
Gewissen<br />
Seite 6
Ethische Unternehmensführung<br />
3. Unterneh<strong>menseth</strong>ik<br />
Die Unterneh<strong>menseth</strong>ik beschäftigt sich mit den Werten, Normen und Folgen des betrieblichen Handelns.<br />
Weiterhin regelt sie das Verhältnis zwischen Moral und Gewinn. Sie versucht Normen und<br />
Ideale unter den Bedingungen der modernen Wirtschaft nach innen und außen zu tragen. Eine Unterneh<strong>menseth</strong>ik<br />
betrifft alle im Unternehmen und muss von allen mitgestaltet werden. Sie hilft beispielsweise<br />
ein Gemeinschaftsbewusstsein, eine Orientierungshilfe oder ein Kollegialitätsbewusstsein<br />
aufzubauen (Hummel, 2005, S.16‐18.).<br />
3.1. Unterneh<strong>menseth</strong>ik‐ Die Theorie unvollständiger Verträge<br />
Wenn Menschen in einer Unternehmung miteinander agieren sind formelle und informelle Verträge<br />
notwendig. Allerdings sind einige von diesen unvollständig im Hinblick auf eine zu inexakte Bestimmung<br />
oder sie sind nicht justiziabel. Dies führt zu einer erhöhten Unsicherheit. Angetrieben durch die<br />
fortschreitende Globalisierung vermehrt sich die Anzahl solcher unvollständigen Verträge. An diesem<br />
Punkt setzt die Unterneh<strong>menseth</strong>ik ein und versucht die Lückenhaftigkeit von Verträgen zu kompensieren.<br />
„Moral‐ verstanden als Fairness, Integrität, Vertrauen etc. – hat die Aufgabe, die durch unvollständige<br />
Verträge verursachte Unsicherheit aufzufangen und die damit verbundenen Kosten von<br />
Interaktionen zu senken“ (Homann & Lütge, 2005, S. 87). Das Management trägt die Verantwortung<br />
Verträge durch sogenannte „weiche“ Faktoren wie Moral und Kultur entsprechend zu ergänzen. Die<br />
Unterneh<strong>menseth</strong>ik zielt im Hinblick der Theorie der unvollständigen Verträge darauf ab, konkrete<br />
Handlungsanweisungen zu geben und die Gefahr von Abhängigkeiten mit entsprechenden Ausbeutungsmöglichkeiten<br />
zu verhindern (Homann & Lütge, 2005, S. 86‐88).<br />
3.2. Unterneh<strong>menseth</strong>ik für Professional Service Firms<br />
Weiterhin stehen in besonderem Maße auch Professional Service Firms wie z.B. Unternehmensberatungen,<br />
Wirtschaftprüfungsgesellschaften, Analysten, Personalberater etc. in der Verantwortung<br />
ethisches Verhalten zu institutionalisieren. Sie sind nicht nur auf der Suche nach einer stetigen Effizienzverbesserung<br />
für ihre Klienten, sondern auch für die Beschaffung mit relevanten Informationen<br />
sowie für die Sicherstellung des rechtmäßigen Verhaltens der Kunden zuständig. Dadurch kommt<br />
ihnen ein wichtiger Beitrag zur Funktionsfähigkeit der Wirtschaft zu.<br />
Um die Unterneh<strong>menseth</strong>ik institutionell zu verankern, ist es eine offene Führungs‐, Kommunikations‐,<br />
und Informationskultur von Vorteil. Zudem sollte man Diskussionen und der kritischen Hinterfragung<br />
von Normen und Werten Raum geben. Bezüglich der Führungsfunktion empfiehlt sich ein<br />
personenorientierter, demokratischer Führungsstil. Hierbei ist es wichtig die Eigenverantwortung<br />
und Autonomie der Mitarbeiter zu stärken und die intrinsische Motivation zu betonen. Als Kontrollfunktion<br />
sollten vor allem ein prozessorientiertes und qualitatives Kontrollverfahren und die Bewertung<br />
langfristiger Erfolgspotentiale im Mittelpunkt stehen (Scherer & Alt, 2002, S. 304‐323).<br />
Seite 7
Ethische Unternehmensführung<br />
3.3 Entwicklung einer Unternehmenskultur<br />
Die Unternehmenskultur umfasst Werte, Normen und Soll‐Vorgaben eines Unternehmens. Sie entsteht<br />
in einem dynamischen Prozess und wird unter anderem vom Charisma der Geschäftsführung<br />
getragen. Die Entwicklung einer Unternehmenskultur vollzieht sich schrittweise und darf den Mitarbeitern<br />
nicht aufgezwungen werden. Möglich wird dies durch Umfragen und offenen Diskussionen<br />
von Mitarbeitern und Führungskräften über Wertvorstellungen (Hummel, 2005, S.90‐91).<br />
Die Unternehmenskultur umfasst folgende Funktionen:<br />
Identifikationsfunktion<br />
Motivationsfunktion<br />
Integrationsfunktion<br />
Koordinationsfunktion<br />
4. Compliance Management<br />
Integritäts‐ und Redlichkeitsmanagement, die Erfüllung und Einhaltung von<br />
Richtlinien, sowie die gesetzlichen und normativen Ansprüche an ein Unternehmen<br />
können unter Compliance zusammengefasst werden. Die Überset‐<br />
Korruption<br />
zung von Compliance bedeutet – Regelüberwachung ‐ und stellt den präventiven<br />
Charakter heraus.<br />
Compliance umschreibt die Summe der organisatorischen Maßnahmen im Unternehmen, die gewährleisten,<br />
dass sich Organe und Mitarbeiter rechtmäßig verhalten. Zudem dient es zur Abwendung<br />
von Schäden bei der Gesellschaft und bei Dritten.<br />
Compliance Systeme müssen mehr bieten als das reine Überwachen von Gesetzmäßigkeiten und<br />
Berechtigungen. Durch den stetigen Druck und die steigende Komplexität verstärkt sich der Druck auf<br />
Finanzmärkte, Geschäftspartner und Unternehmensbeteiligte. Dadurch Erhöhen sich die Anforderungen<br />
an interne Kontroll‐ und Überwachungssysteme, insbesondere bedingt durch die stetige<br />
wachsenden Ansprüche aus dem regulatorischen Umfeld. (KonTraG, TransPuG, Corporate Governance<br />
Kodex, 4./8. EU‐Richtlinie)<br />
Neben einer rechtlichen Perspektive enthält Compliance auch eine ethische Dimension. Hierbei gilt<br />
es, bezogen auf selbstgesteuerte Standards, Soft law und moralischen Grundsätzen ein ordnungsgemäßes<br />
Vorgehen zu gewährleisten und somit illegales und unmoralisches Verhalten von Führungskräften<br />
zu unterbinden (Möllers, 2009)<br />
Doch es reicht gewiss nicht aus Werte nur zu artikulieren, ein internes Kontrollsystem ist notwendig,<br />
welches Regelverstöße wahrnimmt und sie zu verhindern versucht.<br />
Die vier Eckpfeiler eines Compliance‐Systems :<br />
Identifikation von Risiken<br />
Internes Informationssystem<br />
Internes Kontrollsystem<br />
Externes Kommunikationssystem<br />
Seite 8
Ethische Unternehmensführung<br />
Das Compliance‐ System dient dazu, Risiken zu minimieren und die Effizienz und Effektivität der Unternehmensabläufe<br />
zu verbessern. Außerdem stellt es einen zentralen Baustein für das Wertemanagement<br />
dar. Compliance Systeme verfehlen allerdings ihren Nutzen, wenn sich die Handlungsweisen<br />
vom Unternehmen und deren Mitarbeitern an keinen klaren moralischen Grundwerten orientieren<br />
(Hardebusch, 2007, S.18).<br />
4.1. Einführung sozialtechnischer Ethikmaßnahmen mit Hilfe des Compliance‐ Ansatzes<br />
Viele Firmen greifen bei der Einführung sozialtechnischer Ethikmaßnahmen auf einen Compliance‐<br />
Ansatz zurück. Er dient dazu den Mitarbeitern möglichst detaillierte Verhaltensrichtlinien vorzugeben.<br />
Dadurch soll bezweckt werden, dass Mitarbeiter und Geschäftspartner ihre vertraglichen Pflichten<br />
ordnungsgemäß erfüllen. Somit sollen ein individuelles Vorteilsstreben, Unehrlichkeit oder Faulheit<br />
unterbunden werden. Neben der Schaffung und Durchsetzung von klaren Rahmenbedingungen,<br />
erfolgt auch eine „Einführung von Anreiz‐ und Kontroll‐Strukturen, die Definition von Überwachungsstandards,<br />
die Entwicklung geeigneter Mechanismen der Fremdkontrolle und die Installation von<br />
Sanktionsmaßnahmen“(Hummel, 2005, S.111).<br />
Der Compliance Ansatz ist so ausgelegt, dass detaillierte Ge‐ und Verbote erlassen werden, um den<br />
rechtlichen Ansprüchen Rechnung zu tragen. Die Mitarbeiter können sich in ethisch‐kritischen Situationen<br />
auf die Regelungen berufen. Bei auftretenden Lücken oder Abweichungen von den Standards<br />
kann das Regelwerk ergänzt bzw. weiter ausgefeilt werden. Mit Hilfe von positiven und negativen<br />
Anreizen werden die Mitarbeiter dazu angehalten das vorgegebene Regelwerk zu befolgen.<br />
Der Compliance‐Ansatz stellt eine sinnvolle Maßnahme dar, um Wirtschaftskriminalität zu verhindern<br />
(Hummel, 2005, S. 110‐111).<br />
4.2. Praxisbeispiel: Compliance‐Handbuch von Siemens ( 2009)<br />
Die praktische Umsetzung des Compliance Ansatzes wird anhand des Compliance‐ Handbuches von<br />
Siemens dargestellt. Nach dem Korruptionsskandal im Geschäftsjahr 2006/2007, will Siemens unter<br />
anderem mit Hilfe eines Handbuches der Korruption den Kampf ansagen und das Vertrauen der Öffentlichkeit<br />
zurückgewinnen. Der Guide erfasst, was den Mitarbeitern erlaubt ist und was nicht und<br />
an wen sie sich bei auftretenden Compliance Problemen wenden sollen.<br />
Siemens verfügt über Business Conduct Guidelines, welche die elementare Verhaltensgrundsätze<br />
enthalten. Im Zuge einer Erweiterung des Compliance‐Programms wurde eine Compliance Helpdesk‐<br />
„Ask Us“ eingeführt. Dies steht den Mitarbeitern bei spezifischen Detailfragen zur Verfügung. Zudem<br />
wurde ein neues globales Compliance Helpdesk „Tell Us“ eingerichtet, welches anonyme Meldungen<br />
von beobachteten Compliance Verstößen entgegennimmt. Einen besonderen Stellenwert nehmen<br />
bei Siemens auch Compliance Schulungen ein, um ein Fehlverhalten im Vorfeld zu vermeiden.<br />
Siemens fordert von allen seinen Führungskräften, „dass Prozesse und Verfahren durchgängig angewendet<br />
werden und ihr Geist im Tagesgeschäft aller unserer Unternehmen spürbar ist.“ (Compliance<br />
Handbuch – Korruptionsbekämpfung S. 11). Weiterhin werden konkrete Richtlinien aufgeführt. Es<br />
wird z.B. bei dem Punkt „Geschenke und Einladung“ erläutert, worum es geht, warum es problematisch<br />
ist, welche Regelungen hiervor vorgesehen sind und was dies für die Praxis bedeutet. Im Laufe<br />
des Guides werden auf diese Weise alle geschäftsrelevanten Themen abgearbeitet.<br />
Den Abschluss des Siemens Compliance‐ Guides bilden die Folgen, mit denen die Mitarbeiter bei<br />
einem Fehlverhalten konfrontiert sind (Compliance‐Handbuch‐ Korruptionsbekämpfung S. 1‐44).<br />
Seite 9
Ethische Unternehmensführung<br />
Quelle: Compliance‐ Handbuch, Korruptionsbekämpfung, S. 11.<br />
4.3. Vertrauenskultur als Bestandteil effektiver Compliance<br />
Die Berichte über Datenscreening und Nachforschungen gegen Mitarbeiter<br />
nehmen kein Ende. Es scheint so, als sehen die Großkonzerne dies als eine Möglichkeit<br />
das Unternehmen vor Schaden zu schützen. Dies ist jedoch ein falscher<br />
Ansatz. Prof. Dr. habil. Josef Wieland äußert sich in einem Interview zu diesem<br />
Thema folgendermaßen: „Wer seine gesamte Belegschaft unter Generalverdacht<br />
stellt und flächendeckend Daten analysiert, der baut eine Misstrauenskultur auf.“ (Halfmann, 2009)<br />
Dies hat negative Auswirkungen auf die Produktivität und den wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens.<br />
Es sieht sich zudem auch rechtlichen Problemen gegenübergestellt. Das Compliance Management,<br />
für welches die Leitung des Unternehmens die Verantwortung trägt, befasst sich nicht nur mit<br />
den rechtlichen Vorschriften, sondern auch mit investigativen Maßnahmen. Jedoch ist bei diesen<br />
Maßnahmen das Verhältnis zur Unternehmenskultur und Werten wie Offenheit, Ehrlichkeit und<br />
Transparenz entscheidend. Der Aufbau von vertrauensfördernden Maßnahmen und klare Aussagen<br />
zu Werten stellen präventive Maßnahmen zur Verhinderung von Fehlverhalten der Mitarbeiter dar.<br />
Unternehmen brauchen eine wirksame Compliance‐ Kultur, die genaue Angaben macht, was geheim<br />
gehalten wird und was durch technische Maßnahmen von verantwortlichen Organen kontrolliert<br />
wird. (Halfmann, 2009).<br />
Nur so kann der Mitarbeiter Vertrauen zu den bestehenden Regeln und somit auch zum verantwortlichen<br />
Management gewinnen.<br />
Seite 10
Ethische Unternehmensführung<br />
4.4. Corporate Governance<br />
Corporate Governance hat sich zu einem der meist diskutierten Managementthemen der heutigen<br />
Zeit entwickelt. Bekannt gewordene Fälle von Missmanagement und Unternehmensschieflagen wie<br />
bei Mannesmann haben die Wichtigkeit der Einhaltung und Kontrolle der Corporate Governance<br />
Standards in den Mittelpunkt gerückt.<br />
Corporate Governance befasst sich mit dem Setzen und Einhalten von Verhaltensregeln in einem<br />
Unternehmen und stellt dabei primär das Verhältnis von Eignern von Aktiengesellschaften und deren<br />
obersten Organen dar. Hierbei ist meist die juristische Perspektive vorherrschend ( Bischofs, 2008,<br />
S.300).<br />
Corporate Governance beinhaltet einen transparenten Umgang mit Interessenskonflikten, welche es<br />
aufzuzeigen, zu verringern und schließlich aufzulösen gilt. Eine gute und ethische Unternehmensführung<br />
ist nicht nur für Anteilseigner und Stakeholder, sondern auch für Partner und Mitarbeiter von<br />
großem Interesse (Buhlmann, 2008, S. 89).<br />
4.5. Wirtschaftsethik als zentraler Aspekt der Corporate Governance<br />
Die Wirtschaftsethik befasst sich mit der Frage wie und mit welchen Konsequenzen ethische Prinzipien<br />
und Auffassungen in die moderne Wirtschaft implementiert werden können.<br />
Im Wesentlichen gilt es die grundlegende Qualität der unternehmerischen Leistung und die damit<br />
verbundenen vertretbaren Geschäftspraktiken zu hinterfragen: z.B. Welche Werte sollen für wen<br />
geschaffen werden? Welche Methoden zur Gewinnerzielung werden als legitim angesehen? Daraus<br />
leitet sich Handlungsbedarf für die Mitglieder von Aufsichtsgremien ab, welche sich zunächst damit<br />
beschäftigen müssen, woraus es bei einer ethisch „wertvollen“ Unternehmensführung primär ankommt.<br />
Von besonderer Wichtigkeit ist es, ethische orientierte Führungsgrundsätze auf allen hierarchischen<br />
Ebenen zu verankern und sie in die Alltagspraxis zu überführen.<br />
Corporate Governance darf bezüglich der Beziehungsgestaltung zwischen Unternehmensorganen<br />
und Stakeholdern nicht auf die rein rechtliche und vertragliche Ebene reduziert werden, sondern<br />
sollte die Aspekte eines Vertrauens‐ und Verständigungsorientierten Stakeholder‐Dialogs miteinschließen.<br />
Das Vertrauen und Glaubwürdigkeitspotenzial einer Unternehmenspolitik wird aus dem Blickwinkel<br />
eines Stakeholders vor allem durch die Transparenz und Verlässlichkeit der bereitgestellten Information,<br />
der Fairness und Ergebnisoffenheit abhängig gemacht (Bischofs, 2008, S.301‐302).<br />
Seite 11
Ethische Unternehmensführung<br />
5. CSR (Corporate Social Responsibility) Maßnahmen als<br />
Erfolgsfaktor<br />
Mit Slogans wie: „Mehr Verantwortung, weniger Emissionen‐ We C & Are“ oder<br />
„Bewusstsein macht<br />
attraktiv“ bewerben zum Beispiel C&A oder Norintra Pure<br />
Nature ihre Produkte und das mit Erfolg. Kaum ein großes Unternehmen benachhaltige<br />
richtet nicht über seine CSR Tätigkeiten. Die Berichtee über die<br />
Wahrnehmung gesellschaftlicher<br />
und sozialer Verantwortung haben zugenommen.<br />
Durch eine repräsentativen Umfrage fand man heraus (siehe Grafik<br />
oben), dasss 86% der deutschen<br />
Bevölkerung aktive Unternehmen, die soziale Verantwortung übernehmen, auf lange Sicht für erfolg‐<br />
eines<br />
reicher halten ( Lunau, 2005, S. 32). Das Thema CSR boomt und ist für den langfristigen Erfolg<br />
Unternehmens ein entscheidender Faktor.<br />
Die Entwicklung zur Wahrnehmung von sozialer und gesellschaftlicher Verantwortung wurde maß‐<br />
dem<br />
geblich durch die zunehmende<br />
Mündigkeit und Emanzipation der Kunden beeinflusst. Neben<br />
Preis spielt für den Kunden immer mehr die Frage nach den moralischen Werten<br />
eine tragende Rolle.<br />
Der kritische Konsument nimmt<br />
Arbeitsbedingungen, Umweltstandards und Produktionsabläufe un‐<br />
2007).<br />
ter die Lupe und entscheidet daraufhin über Kauf oder „Nichtkauf“ eines Produktes (Wiegand,<br />
In einer empirischen<br />
Studie der CSR Europe<br />
hat man in 12 europäischen Ländern jeweils 1000 Kon‐<br />
sumenten befragt. Schon 2002 waren zwei Drittel der Befragten der Meinung, dass Großunterneh‐<br />
men sowie Regierungen für soziale Themen die Verantwortung tragen. Sogar bei 70% der Befragten<br />
spielt die<br />
soziale Verantwortung<br />
von Unternehmen einee entscheidende Rolle beim Kauf des<br />
Produk‐<br />
Pro‐<br />
tes. 20%<br />
würden sogar einen höheren Preis für sozial und ökologisch<br />
verantwortbar hergestellte<br />
dukte akzeptieren (König, 2002, S.465‐466).<br />
Das Ergebnis einer aktuellen Studie der GfK Panel Services Deutschland und der Roland Berger Stra‐<br />
Preis für<br />
ein sozial‐ und ökologisch verantwortliches Management zu<br />
bezahlen. Die Befragung hat<br />
tegie Consultants ergab, dass die<br />
Konsumenten auch in Zeiten der Krise bereit sind, einen höheren<br />
fünf Typen von Konsumenten, den „Verantwortungsbewussten Engagierten“, den „Kritisch Konsu‐<br />
mierenden“, den „Fortschrittlichen Macher“ , den „Ich‐zentrierten Genießer“ und<br />
den „Eigenverant‐<br />
wortlichen Familienmenschen“ identifiziert.<br />
Seite 12
Ethische Unternehmensführung<br />
Durch die Studie fand man heraus, dass sich die Einstellungen der Konsumenten auch in deren Kaufverhalten<br />
niederschlagen. So kaufen 58% der „Kritisch Konsumierenden“ und 59% der „Verantwortungsbewussten<br />
Engagierten“ umweltverträgliche Produkte. „Verantwortungsbewusste Engagierte“<br />
und „Kritisch Konsumierende“ informieren sich vor einem Kauf über die sozialen Einstellungen und<br />
über die Umweltfreundlichkeit eines Unternehmens.<br />
(http://www.upj.de/forschung_detail.89.0.html?&tx_ttnews[backPid]=38&tx_ttnews[tt_news]=1433<br />
&cHash=47b3263487)<br />
Allgemein kann man feststellen, dass soziale Verantwortung weder einen ausschließlichen Trend<br />
noch eine Notwendigkeit darstellt. Es geht viel mehr um die Entstehung eines wichtigen Gebiets „beherzter<br />
Gestaltungsarbeit in einer Zeit, in der neue Vorstellungen entstehen, was Wirtschaft ist und<br />
Unternehmen tun“ (Lunau, 2004, S. 44‐45).<br />
Abschließend lässt sich feststellen, dass Compliance und Unterneh<strong>menseth</strong>ik in enger Verbindung<br />
miteinander stehen. Illegales und unmoralisches Verhalten von Führungskräften und Mitarbeitern<br />
kann nur erfolgreich verhindert werden, wenn in den Unternehmen „gelebte“ Wertemanagementsysteme<br />
für eine klare Orientierung sorgen. „Wertemanagement und Compliance Management sind<br />
daher zwei Seiten einer Medaille, die einander bedingen.“(Prof. Dr. habil. Josef Wieland, 2007, S. 87)<br />
Vertrauenswürdigkeit und der Aufbau von Reputation sind wichtig für nachhaltiges Wirtschaften.<br />
Wer langfristig erfolgreich sein will, sollte die Integration eines Compliance Managements verstärken,<br />
um Reputationsrisiken vorzubeugen (Wieland, 2008, S.87). Langfristiges Denken, Innovation,<br />
Integrität, Ehrlichkeit, Offenheit und Transparenz sind wichtige Themen. Denn nur wer offen gegenüber<br />
seiner Umwelt ist und ehrliches Verhalten zeigt, wird langfristig intern wie extern Glaubwürdigkeit<br />
und Vertrauen aufbauen können.<br />
Seite 13
Ethische Unternehmensführung<br />
Literaturverzeichnis:<br />
Zeitschriften/elektronische Zeitschriften:<br />
Braun, S. (2008). Zwischen Rendite und Gewissen. Forum,1, 84‐85.<br />
Bischofs, R. (2008). Wirtschaftsethik und Unternehmenskultur als zentraler Aspekt der Corporate<br />
Governance. Zeitschrift für Wirtschafts‐und Unterneh<strong>menseth</strong>ik,2, 300‐302.<br />
Buhlmann, H. (2008). Bad Governance am laufenden Band. Forum, 1, 89.<br />
Hardebusch, C. (2007) Wertedebatte. Immobilienmanager, 11, 14‐18.<br />
König, M. ( 2002). CSR Europe. Zeitschrift für Wirtschafts‐und Unterneh<strong>menseth</strong>ik, 3, 465‐466.<br />
Scherer, A.& Alt, M. (2002). Unterneh<strong>menseth</strong>ik für Professional Service Firms. Problemtatbestände<br />
und Lösungsansätze. Zeitschrift für Wirtschafts‐ und Unterneh<strong>menseth</strong>ik, 3, 304‐330.<br />
Schmidt, K. (2007). „Mit Werten erfolgreich führen“. Bund katholischer Unternehmen e.V. Grüne<br />
Seiten.,71, 1‐8<br />
Wieland, J. (2008). Unterneh<strong>menseth</strong>ik und Compliance Management. Forum, 1, 86‐87.<br />
Autor unbekannt. (2008). Konsum & CSR. Forum, 1, 115‐117.<br />
Bücher:<br />
Homann, K. & Lütge, C. (2005). Einführung in die Wirtschaftsethik (2. Auflage). Münster: Lit<br />
Hummel, T.(Hrsg.) (2005). Schriften zum Internationalen Management. Einführung in die Unterneh<strong>menseth</strong>ik:<br />
Erste theoretische, normative und praktische Aspekte. München und Mering: Rainer<br />
Hampp<br />
Scherer, A. & Patzer, M. (2008). Betriebswirtschaftslehre und Unterneh<strong>menseth</strong>ik. Wiesbaden: Gabler.<br />
Thommen, J. & Achleitner A. (1991). Allgemeine Betriebswirtschaftslehre (5. Auflage 2006). Wiesbaden:<br />
Gabler<br />
Studie:<br />
Bucksteeg , M. & Hattendorf K. (2009). Führungskräftebefragung 2009.S. 1‐29.<br />
Lunau, Y. (2005). Unternehmensverantwortung: Wer darf was erwarten? VDMA Nachrichten,3,32‐33.<br />
Handbuch:<br />
Löscher, P. (2009). Siemens Compliance‐ Handbuch – Korruptionsbekämpfung, S. 1‐44.<br />
Seite 14
Ethische Unternehmensführung<br />
Internetseiten:<br />
Halfmann, Achim (2009). DNWE‐Expertenforum: Effektive Compliance braucht Vertrauenskultur.<br />
12.3.2009.<br />
http://csr‐news.net/main/2009/03/12/dnwe‐expertenforum‐effektive‐compliance‐brauchtvertrauenskultur/<br />
[Zugriff am 10.09.2009]<br />
Autor unbekannt.(2009). Gesellschaftliche Unternehmensverantwortung für Konsumenten tatsächlich<br />
kaufrelevant. 11.8.2009<br />
http://www.upj.de/forschung_detail.89.0.html?&tx_ttnews[backPid]=38&tx_ttnews[tt_news]=1433<br />
&cHash=47b3263487 [Zugriff am 7.9.2009]<br />
Autor unbekannt. (2009). DNWE, Wertemanagement.<br />
http://www.dnwe.de/wertemanagement.html<br />
Möllers, Thomas. Compliance ‐ Darstellung der wichtigsten Begriffe und Funktionen.<br />
http://www.jura.uni‐augsburg.de/fakultaet/lehrstuehle/moellers/materialien/6_compliance/ [Zugriff<br />
am 7.9.2009]<br />
Wiegand, Elita( 2007). Corporate Social Responsibility: Die neue Business‐Moral.<br />
http://www.innovativ‐in.de/c.3352.htm [Zugriff am 07.09.2009]<br />
Autor unbekannt. (2006). Focus Online Money. Deutsche halten Konzernbosse für korrupt.<br />
22.11.2006.<br />
http://www.focus.de/finanzen/news/arbeitsmarkt/umfrage_aid_119759.html [Zugriff am 10.9.2009]<br />
Seite 15