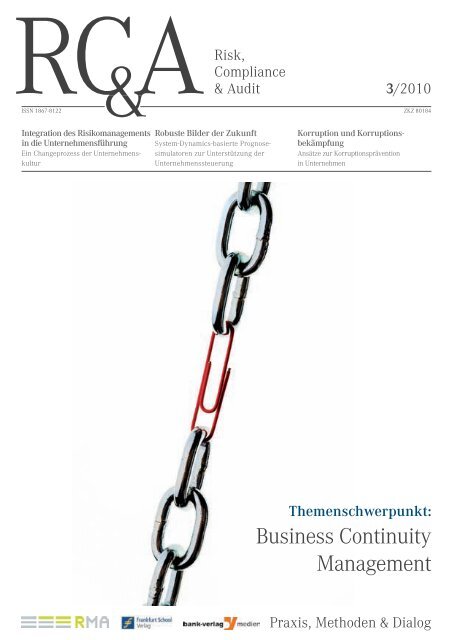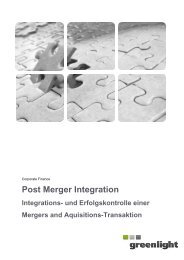Korruption und Korruptionsbekämpfung - Greenlight Consulting
Korruption und Korruptionsbekämpfung - Greenlight Consulting
Korruption und Korruptionsbekämpfung - Greenlight Consulting
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
3/2010<br />
ISSN 1867-8122<br />
ZKZ 80184<br />
Integration des Risikomanagements<br />
in die Unternehmensführung<br />
Ein Changeprozess der Unternehmenskultur<br />
Robuste Bilder der Zukunft<br />
System-Dynamics-basierte Prognosesimulatoren<br />
zur Unterstützung der<br />
Unternehmenssteuerung<br />
<strong>Korruption</strong> <strong>und</strong> <strong>Korruption</strong>sbekämpfung<br />
Ansätze zur <strong>Korruption</strong>sprävention<br />
in Unternehmen<br />
Themenschwerpunkt:<br />
Business Continuity<br />
Management<br />
Praxis, Methoden & Dialog
Risk<br />
<strong>Korruption</strong> <strong>und</strong> <strong>Korruption</strong>sbekämpfung<br />
Ansätze zur <strong>Korruption</strong>sprävention in Unternehmen<br />
Wie im Zuge des 2006 aufgedeckten Siemens-Schmiergeldskandals bekannt wurde, soll sich das Unternehmen<br />
durch Zahlung von 1,4 Mrd. Euro weltweit Aufträge gesichert haben. Bei <strong>Korruption</strong>sfällen dieser Dimensionen<br />
drohen Bußgelder bis zu einer Million Euro. 1 Ab Mai 2009 ermittelte die Staatsanwaltschaft zudem gegen<br />
MAN wegen des Verdachts auf Zahlung von Bestechungsgeldern in Millionenhöhe. Die Leistungen von 50<br />
bis 100 Mio. Euro im vergangenen Jahrzehnt sollen zur Verkaufsförderung von Bussen <strong>und</strong> Lastkraftwagen<br />
geflossen sein. Experten schätzen, dass MAN Bußgelder bis zu 50 Mio. Euro drohen. 2 Wie die oben genannten<br />
Meldungen deutlich machen, sind <strong>Korruption</strong>sskandale keine Seltenheit. Eine Studie zeigt jedoch, dass<br />
drei Viertel der 500 umsatzstärksten Unternehmen auf Ihren Webseiten inzwischen Informationen zu<br />
Antikorruptionsmaßnahmen veröffentlichen. Die Sensibilität auf Seiten der Unternehmen hat vor dem<br />
Hintergr<strong>und</strong> hoher drohender Bußgelder offensichtlich zugenommen. 3<br />
Es ist davon auszugehen, dass sich <strong>Korruption</strong> langfristig immer<br />
negativ auf den Erfolg eines Unternehmens auswirkt. Unternehmen,<br />
deren Strategie sich aus klaren ethischen Gr<strong>und</strong>sätzen<br />
ableitet, erzielen höhere Gewinne als korrupte. Heute<br />
drohen bei der Aufdeckung von <strong>Korruption</strong>shandlungen hohe<br />
Strafen u. a. in den USA, sofern die Unternehmen etwa an der<br />
New Yorker Börse gelistet sind. Zur Vermeidung solcher Schäden<br />
werden ein striktes Unternehmensstrafrecht <strong>und</strong> klare<br />
Sanktionsmechanismen innerhalb der Konzerne gefordert.<br />
Zuwendungsempfänger<br />
(z. B. Beamter,<br />
Einkaufsleiter eines<br />
Unternehmens)<br />
manipuliert<br />
Entscheidung<br />
leistet an<br />
Zuwendungsgeber<br />
(z. B. Geschäftsführer<br />
eines<br />
Unternhemens)<br />
vertritt<br />
1. <strong>Korruption</strong> – Begriff <strong>und</strong> Fakten<br />
Aufzeichnungen über <strong>Korruption</strong>shandlungen im Wirtschaftsleben<br />
finden sich bereits 2000 v. Chr. Diese berichten vor allem<br />
über die Zahlung von Bestechungsgeldern an Beamte. <strong>Korruption</strong><br />
tritt seit jeher in unterschiedlichen Ausprägungen <strong>und</strong><br />
in allen Wirtschaftssystemen auf. Generell bildet die politische<br />
Einflussnahme auf die Wirtschaft eines Landes (beispielsweise<br />
durch die Behinderung des freien Preismechanismus) eine<br />
Motivation für gesetzeswidrige Handlungen. Trotz mangelnder<br />
eindeutiger Begriffsdefinition gilt <strong>Korruption</strong> stets als moralisch<br />
verwerflich. In Politik, Verwaltung <strong>und</strong> Wirtschaft werden<br />
die Einflussmöglichkeiten zur Bereicherung <strong>und</strong> Bevorteilung<br />
des Einzelnen zum Schaden des Gemeinwohls missbraucht.<br />
1 Vgl. o. V.: <strong>Korruption</strong>sskandal – Heinrich von Pierer soll Buße tun, in: Zeit<br />
online vom 23.10.2009, elektronisch veröffentlicht unter http://www.zeit.<br />
de/wirtschaft/unternehmen/2009-10/siemens-pierer-bussgeld<br />
2 Vgl. o. V.: Schmiergeldaffäre – MAN droht Bußgeld von bis zu 50 Millionen<br />
Euro, in: Spiegel online vom 19.10.2009 , elekronisch veröffentlicht<br />
unter http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/0,1518,656099,00.<br />
html.<br />
3 Vgl. o. V.: <strong>Korruption</strong>sskandal – Schwarze Kassen, weiße Westen, in:<br />
Presse.com vom 19.09.2009, elektronisch veröffentlicht unter http://<br />
diepresse.com/home/wirtschaft/international/509043/index.do.<br />
34<br />
Geschädigte<br />
(z. B. Kommune,<br />
Staat,<br />
Endverbraucher)<br />
Abbildung 1: <strong>Korruption</strong>sschema 4<br />
erteilt<br />
Auftrag an<br />
Begünstigte<br />
(z. B. Firma des<br />
Zuwendungsgebers)<br />
Die individuelle Zielverfolgung steht im Vordergr<strong>und</strong>. So werden<br />
materielle oder immaterielle Vorteile geschaffen, die jeglichem<br />
Anspruch entbehren. <strong>Korruption</strong> liegt faktisch dann vor,<br />
wenn ein Dritter benachteiligt wird. 5 Das Zusammenwirken<br />
der Beteiligten eines <strong>Korruption</strong>sfalls lässt wie in Abbildung 1<br />
darstellen:<br />
Laut der Statistik des B<strong>und</strong>eskriminalamts (BKA) für das<br />
Jahr 2008 haben die polizeilich bekannt gewordenen <strong>Korruption</strong>sfälle<br />
ihren Schwerpunkt im Bereich der allgemeinen<br />
öffentlichen Verwaltung. Allerdings sank der Anteil der hier<br />
aufgetretenen <strong>Korruption</strong>sfälle von 79 Prozent im Jahr 2007<br />
4 Eigene Darstellung in Anlehnung an Elschenbroisch, T.: Vermögensabschöpfung<br />
in <strong>Korruption</strong>sverfahren – Darstellung anhand ausgewählter<br />
Entscheidungen aus der Rechtsprechung, in: Trancparency International<br />
(Hrsg.): <strong>Korruption</strong> in Deutschland: Strafverfolgung der <strong>Korruption</strong> –<br />
Möglichkeiten <strong>und</strong> Grenzen, Tagung am 08./09.12.2004 in Berlin, S. 22.<br />
5 Vgl. Krug, S.: <strong>Korruption</strong> in verschiedenen Wirtschafssystemen – Eine<br />
komparatorische Analyse, Wiesbaden 2007, S. 1-17, 57 <strong>und</strong> 70 f.<br />
Risk, Compliance & Audit 3/2010
Risk<br />
auf 46 Prozent. Dies ist mutmaßlich der Wirksamkeit der <strong>Korruption</strong>sbekämpfungsmaßnahmen<br />
zuzuschreiben. Auffallend<br />
ist die Zunahme der Delikte in der Privatwirtschaft auf einen<br />
Anteil von 37 Prozent gegenüber 15 Prozent im Jahr 2007.<br />
Das BKA geht jedoch von einer höheren Dunkelziffer aus.<br />
Abbildung 2 veranschaulicht die Entwicklung der polizeilich<br />
erfassten <strong>Korruption</strong>sdelikte in verschiedenen Sektoren im<br />
Jahresvergleich 2007/2008.<br />
38,6% 38,2%<br />
13,5%<br />
9,7%<br />
2007 2008<br />
79%<br />
Sachbearbeiter Leitungsebene sonsge<br />
Funkonen<br />
Bürgermeister<br />
46%<br />
37%<br />
Abbildung 3: Verteilung der Funktionalität auf der Nehmerseite 8<br />
Allg. öffentliche<br />
Verwaltung<br />
15%<br />
Wirtscha<br />
5%<br />
15%<br />
Strafverfolgungs-/<br />
Juszbehörden<br />
1%<br />
Polik<br />
2%<br />
32,3%<br />
Abbildung 2: Verteilung der polizeilich erfassten <strong>Korruption</strong>sdelikte im<br />
Jahresvergleich 2007/08 6<br />
17,2% 16,8%<br />
14,7% 14,4%<br />
Im Jahr 2008 wurden 3.020 <strong>Korruption</strong>statverdächtige registriert.<br />
Davon waren 1.694 Personen Vorteilsnehmer <strong>und</strong><br />
1.326 Vorteilsgeber. Von 67 Prozent der im Jahr 2008 registrierten<br />
„Nehmer“ <strong>und</strong> 90 Prozent der polizeilich registrierten<br />
Tatverdächtigen auf der Geberseite ist die berufliche Stellung<br />
bekannt. Wie die Abbildungen 3 <strong>und</strong> 4 zeigen, weisen nicht<br />
zuletzt Positionen mit einer hohen Entscheidungsbefugnis<br />
auch eine hohe <strong>Korruption</strong>sanfälligkeit auf.<br />
Die Zuwendungen auf der Vorteilsnehmerseite beliefen sich<br />
im Jahr 2008 auf einen monetären Gesamtwert von 93 Mio.<br />
Euro nach 44 Mio. im Vorjahr. Vor allem die angezeigten Beträge<br />
aus dem Freistaat Bayern (mehr als 60 Mio. Euro) waren<br />
für den starken Anstieg ausschlaggebend. Bargeldzahlungen,<br />
Bewirtungen sowie Sachzuwendungen spielen hier die größte<br />
Rolle. Statistische Auswertungen zeigen, dass die „Erlangung<br />
von Aufträgen“ das häufigste Ziel des korrupten Handelns ist.<br />
Insgesamt wird der materielle Vorteil auf der Geberseite mit<br />
etwa 372 Mio. Euro beziffert. 7<br />
Geschäsführer Angestellter leitender<br />
Angestellter<br />
2. Mikroökonomischer Nutzen vs.<br />
Makroökonomischer Schaden<br />
Um den Schaden <strong>und</strong> den Nutzen des Einzelnen durch <strong>Korruption</strong><br />
darzustellen, muss eine Argumentation aus wirtschaftlicher<br />
Perspektive zugr<strong>und</strong>e gelegt werden. An dieser Stelle<br />
können nur vereinzelte Aspekte angeschnitten werden, da die<br />
Folgen der Wirtschaftskriminalität in unzähligen Bereichen<br />
mit unterschiedlicher Ausprägung auftreten.<br />
Auf Seiten des Korrumpierten entsteht ein quantifi zier barer<br />
Nutzen in Form von Auftragserteilungen, Ersparnissen oder Erträgen.<br />
Der Vorteilsnehmer vernachlässigt das Risiko der Entdeckung<br />
seines Fehlverhaltens bei seiner Entscheidung, sich durch<br />
unzulässige Mittel „kaufen“ zu lassen. Solange jedoch nicht ausgeschlossen<br />
werden kann, dass die <strong>Korruption</strong>shandlung aufge-<br />
4,6%<br />
Privatperson Firmeninhaber sonsge<br />
Abbildung 4: Verteilung der Funktionalität auf der Geberseite 9<br />
6 Eigene Darstellung auf der Gr<strong>und</strong>lage der Daten in B<strong>und</strong>eskriminalamt<br />
(Hrsg.): <strong>Korruption</strong> – B<strong>und</strong>eslagebild, Wiesbaden 2009, S. 9.<br />
7 Vgl. B<strong>und</strong>eskriminalamt (Hrsg.): <strong>Korruption</strong> – B<strong>und</strong>eslagebild, Wiesbaden<br />
2009, S. 14 f.<br />
8 Eigene Darstellung auf der Gr<strong>und</strong>lage der Daten in B<strong>und</strong>eskriminalamt<br />
(Hrsg.): <strong>Korruption</strong> – B<strong>und</strong>eslagebild, Wiesbaden 2009, S. 10.<br />
9 Eigene Darstellung auf der Gr<strong>und</strong>lage der Daten in B<strong>und</strong>eskriminalamt<br />
(Hrsg.): <strong>Korruption</strong> – B<strong>und</strong>eslagebild, Wiesbaden 2009, S. 12.<br />
Risk, Compliance & Audit 3/2010 35
Risk<br />
deckt wird, ist lediglich der „scheinbare“ Nutzen überschaubar.<br />
Wirtschaftskriminalität bringt unter anderem Wettbewerbsvorteile<br />
auf Seiten derer, die ohne den Einsatz unlauterer Mittel<br />
nicht mehr als Marktteilnehmer auftreten würden. Zusätzlich<br />
verdrängen sie Konkurrenten.<br />
Problematisch wird es immer dann, wenn ein Unternehmen<br />
auf einen Markt trifft, in den ein Eintritt ohne Zuwendung<br />
praktisch ausgeschlossen ist. Internationale <strong>Korruption</strong>, die<br />
den Markteintritt in andere Länder erst ermöglicht, ist eine<br />
verbreitete <strong>und</strong> gegenwärtig immer noch weithin akzeptierte<br />
Praxis – sowohl im Geschäftsverkehr als auch bei staatlichen<br />
Institutionen. Die <strong>Korruption</strong>sgewinne begünstigen<br />
einzelne Volkswirtschaften oder Personen. Zugleich werden<br />
andere Marktteilnehmer ökonomisch geschädigt. Aufgr<strong>und</strong><br />
des Informationsdefizits unvollkommener Märkte ist sich<br />
diese Mehrheit ihrer Benachteiligung nicht bewusst. Die Intransparenz<br />
ist eine Bedingung, die korrupte Vorgänge erst<br />
möglich macht. Ohne verdecktes Handeln der Beteiligten<br />
ist das Abschöpfen von Gewinnen Einzelner nicht denkbar.<br />
Durch die unlauter gezahlten Zuwendungen erhöhen sich<br />
die Kosten des Unternehmens. Sie werden durch den höheren<br />
Preis eines Produktes durch den Abnehmer refinanziert.<br />
Zudem hemmen <strong>Korruption</strong>szahlungen Innovationen, da beispielsweise<br />
Entscheidungen nicht mehr durch objektive Kriterien<br />
geleitet werden, sondern vom „Bestochenen“ aufgr<strong>und</strong><br />
der Zuwendung erfolgen. Den Zuschlag bei der Auftragsvergabe<br />
erhält somit möglicherweise ein veraltetes Produkt.<br />
Letztendlich kann resümiert werden, dass in einer globalisierten<br />
Welt die Allgemeinheit durch die <strong>Korruption</strong>shandlung<br />
einzelner Wirtschaftssubjekte geschädigt wird. Da bei international<br />
agierender <strong>Korruption</strong> Vorteilsnehmer <strong>und</strong> Benachteiligter<br />
in unterschiedlichen Volkswirtschaften ansässig sind,<br />
kann eine Nutzen-Schaden-Gegenrechnung jedoch kaum vorgenommen<br />
werden. Unser ethisches Verständnis lehnt etwaige<br />
Nutzen-Motive als Rechtfertigungsargumente für kriminelle<br />
Handlungen ohnehin kategorisch ab. 10<br />
3. Justizfehler <strong>und</strong> innerbetriebliches Versagen<br />
bei der Anwendung von Präventionsmaßnahmen<br />
Auch wenn sich die Gesetzgebung im Hinblick auf die <strong>Korruption</strong>sbekämpfung<br />
in den letzten Jahren verbessert hat, bleiben<br />
Mängel im Bereich des Strafrechts bestehen. Da der Staat nicht<br />
auf die Selbstkontrolle der Unternehmen vertrauen kann, sind<br />
vom Gesetzgeber Vorgaben <strong>und</strong> Regularien notwendig. Sie<br />
10 Vgl. Vogt, O.: <strong>Korruption</strong> im Wirtschaftsleben – Eine betriebswirtschaftliche<br />
Schaden-Nutzen-Analyse, Wiesbaden 1997, S. 41-139.<br />
36<br />
müssen den Gr<strong>und</strong>stein für die <strong>Korruption</strong>sverhinderung legen<br />
<strong>und</strong> eventuelle Vergehen konsequent bestrafen. Dabei<br />
mangelt es an der politischen Beharrlichkeit, eindeutige Gesetze<br />
zu verabschieden. Zudem fehlt es an Sonderdezernaten,<br />
die als Spezialisten konzentriert in diesem Bereich ermitteln.<br />
Unternehmensintern sind nachhaltige Präventionspläne<br />
bzw. deren Realisierung erforderlich. So wird vielfach moniert,<br />
dass ehrliche Mitarbeiter zu wenig motiviert werden <strong>und</strong> es zu<br />
wenig Antikorruptionsstellen innerhalb der Betriebe gibt. Eine<br />
Organisation muss so aufgebaut sein, dass sie Bestechlichkeit<br />
von vornherein nicht zulässt, da der Mitarbeiter keine Vorteile<br />
daraus ziehen kann. Außerdem muss das wohlwollende Vorleben<br />
korrekten Verhaltens durch die Unternehmensleitung<br />
praktiziert werden. Jeder einzelne Mitarbeiter ist darüber hinaus<br />
für ethisch einwandfreies Benehmen verantwortlich. Die<br />
Geschäftsführung hat Sorge zu tragen, dass bereits im Vorfeld<br />
(etwa durch so genannte Integritätstests bei der Mitarbeiterauswahl)<br />
schädigendem Verhalten vorbeugt wird. 11<br />
4. Nationale <strong>und</strong> internationale rechtliche<br />
Gr<strong>und</strong>lagen der <strong>Korruption</strong><br />
Als originärer Straftatbestand existiert „<strong>Korruption</strong>“ in<br />
Deutschland nicht. Widerrechtliche Handlungen werden als<br />
Gesetzesverstoß wie beispielsweise Bestechung, Subventionsbetrug,<br />
Vorteilsgewährung sowie Vorteilsnahme geahndet.<br />
Einschlägige juristische Gr<strong>und</strong>lagen finden sich unter anderem<br />
im Strafgesetzbuch (StGB), im Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb<br />
(UWG), im Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen<br />
(GWG) sowie im Gesetz zur Bekämpfung internationaler Bestechung<br />
(IntBestG). Um der <strong>Korruption</strong> präventiv entgegenzutreten,<br />
existieren ferner zahlreiche gesetzliche Regelungen<br />
<strong>und</strong> Empfehlungen:<br />
• Der Deutsche Corporate Governance Kodex (DCGK) enthält<br />
zwar keine konkreten Weisungsempfehlung hinsichtlich<br />
der <strong>Korruption</strong>sproblematik. Gleichwohl greift er die<br />
verwandten Themen „Risikomanagement“ <strong>und</strong> „Interne<br />
Kontrollen“ auf <strong>und</strong> erörtert den Umgang mit Interessenskonflikten<br />
innerhalb des Unternehmens. 12<br />
• Mit dem Gesetz zur Kontrolle <strong>und</strong> Transparenz im Unternehmensbereich<br />
(KonTraG) wurde ein System zur Risikofrüherkennung<br />
(das <strong>Korruption</strong>sprävention mit ein-<br />
11 Vgl. Bannenberg, B.: <strong>Korruption</strong> in Deutschland, in: netzwerk recherche/<br />
Transparency International/B<strong>und</strong> der Steuerzahler (Hrsg.): <strong>Korruption</strong> –<br />
Schatten der demokratischen Gesellschaft, Wiesbaden 2002, S. 28.<br />
12 Vgl. Transparency International (Hrsg.): ABC der <strong>Korruption</strong>sprävention<br />
Berlin 2004, S. 17.<br />
Risk, Compliance & Audit 3/2010
Risk<br />
schließt) als verpflichtendes Element bei börsennotierten<br />
Unternehmen <strong>und</strong> Kapitalgesellschaften eingeführt. 13<br />
• Seit 2002 gelten für alle an einer US-Börse notierten Unternehmen<br />
die Vorschriften des Sabanes-Oxley-Acts (SOX).<br />
Neben einem internen Kontrollsystem muss demnach ein<br />
geeigneter Ansatz definiert werden, die Mitarbeiter vor negativen<br />
Auswirkungen schützt, sofern diese auf potenzielle<br />
<strong>Korruption</strong>sfälle aufmerksam machen.<br />
• Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit <strong>und</strong><br />
Entwicklung (OECD) setzte bei zunehmender Globalisierung<br />
mit dem 1999 in Kraft getretenen OECD-Abkommen<br />
einen wichtigen Meilenstein im Hinblick auf eine internationale<br />
Antikorruptionsrichtline. Auch Nicht-Mitglieder<br />
können sich der Vereinbarung verpflichten, sobald sie bestimmte<br />
Kriterien erfüllen. Beispielsweise muss ein Nicht-<br />
OECD-Mitgliedsland Handelspartner eines Mitgliedstaates<br />
sein <strong>und</strong> die Voraussetzungen für die nationale Umsetzung<br />
des Regelwerks erfüllen. Die Mitgliedsstaaten müssen das<br />
Regelwerk ohne Änderungen in nationales Recht übernehmen.<br />
Ein Ziel des umfassenden Kataloges ist es, Bestechung<br />
zu verhindern <strong>und</strong> konsequent unter Strafe zu stellen. Die<br />
Länder müssen das internationale Recht integrieren, bekommen<br />
aber bei der Umsetzung aufgr<strong>und</strong> der unterschiedlichen<br />
Rechtssysteme Empfehlungen seitens der OECD. 14<br />
5. Korrutionsprävention im Unternehmen –<br />
ein Ansatzmodell<br />
Alle Teilnehmer am Wirtschaftsleben müssen sich verpflichtet<br />
fühlen, die genannten nationalen <strong>und</strong> internationalen Richtlinien<br />
<strong>und</strong> Gesetze zu beachten. Auf Unternehmensebene ist<br />
die oberste Leitung dafür verantwortlich, dass die Vorgaben<br />
erfolgreich in der Organisation umgesetzt werden.<br />
Transparency International Deutschland gibt mit einer Kontrollliste<br />
Hilfestellung für eine unternehmensinterne Selbstüberprüfung,<br />
die auf die <strong>Korruption</strong>sbekämpfung ausgerichtet<br />
ist. Hierbei werden ausgewählte Themenbereiche angesprochen,<br />
durch die korruptionsbedrohte Sektoren aufgedeckt<br />
werden können. Die Aufstellung erhebt keinen Anspruch auf<br />
Vollständigkeit <strong>und</strong> ist an die Größe, Art <strong>und</strong> Branche des<br />
Unternehmens individuell anzupassen. Die Checkliste deckt<br />
die in Abbildung 5 genannten Sachgebiete ab <strong>und</strong> betrifft die<br />
Funktionsbereiche Unternehmensleitung, Personalwesen, Finanz-<br />
<strong>und</strong> Rechnungswesen, Vertrieb <strong>und</strong> Einkauf.<br />
13 Vgl. Transparency International (Hrsg.): ABC der <strong>Korruption</strong>sprävention,<br />
Berlin 2004, S. 27 f.<br />
14 Vgl. Geiger, R.: <strong>Korruption</strong>sbekämpfung im Zeichen der Globalisierung,<br />
in: netzwerk recherche/Transparency International/B<strong>und</strong> der Steuerzahler<br />
(Hrsg.): <strong>Korruption</strong> – Schatten der demokratischen Gesellschaft,<br />
Wiesbaden 2002, S. 46 f.<br />
• Geschäftspolitik (Compliance-Policy)<br />
• Unternehmensführung (Risk Management <strong>und</strong> Management<br />
Controls)<br />
• Vorteilsnahmen <strong>und</strong> Zuwendungen/ Vorteilsgewährungen<br />
an/von Dritte/n<br />
• Organmitgliedschaften in <strong>und</strong> finanzielle Beteiligungen<br />
an anderen Unternehmen<br />
• Spenden <strong>und</strong> Sponsoring an/von politische/n<br />
Organisationen<br />
• Regelungen für Mitarbeiter (z. B. Nebentätigkeiten)<br />
• Regelungen zum Verhalten gegenüber K<strong>und</strong>en <strong>und</strong><br />
Wettbewerbern<br />
• Regelungen zum Verhalten gegenüber Lieferanten <strong>und</strong><br />
sonstigen Geschäftspartnern (z. B. Berater, Gutachter,<br />
Treuhänder, Vertreter, freiberufliche Mitarbeiter)<br />
• Kontrollen von Tochtergesellschaften <strong>und</strong> Beteiligungen<br />
• Kontrollen innerbetrieblicher Prozesse (insbes. bei der<br />
Buchführung)<br />
Abbildung 5: Themenbereiche zur Aufdeckung von korruptionsgefährdeten<br />
Bereichen im Unternehmen 15<br />
Um im Tagesgeschäft compliance-konform zu agieren, ist das<br />
oberste Management für die Implementierung <strong>und</strong> die Einhaltung<br />
der Anti-<strong>Korruption</strong>smaßnahmen verantwortlich. Eine<br />
adäquate Kontrolle <strong>und</strong> konsequente Sanktionen im Falle der<br />
Aufdeckung von korruptem Fehlverhalten demonstrieren dabei<br />
hohe ethische Standards gegenüber Mitarbeitern, K<strong>und</strong>en<br />
<strong>und</strong> Geschäftspartnern. Letztendlich muss dem Management<br />
bewusst sein, dass nur die Vermeidung von Wirtschaftskriminalität<br />
das Unternehmen vor Prozesskosten, Strafzahlungen,<br />
Imageverlusten <strong>und</strong> den daraus resultierenden Ertragseinbußen<br />
schützt. Hinsichtlich der <strong>Korruption</strong>sproblematik muss es<br />
Ziel eines jeden Unternehmens sein, diese von vorneherein zu<br />
verhindern. Vor allem in komplexen Unternehmensstrukturen<br />
muss dies durch ein umfassendes Regelwerk bzw. Maßnahmenpaket<br />
gewährleistet werden. Das Management ist verantwortlich<br />
für die Einführung der präventiven Maßnahmen <strong>und</strong> deren regelmäßige<br />
Kontrollen. Um die ständige Überwachung gewährleisten<br />
zu können, müssen idealerweise spezielle Kontrollgremien<br />
gebildet werden, die in einem ersten Schritt das Unternehmen<br />
hinsichtlich seines Gefährdungspotenzials untersuchen. Die<br />
Definition geeigneter Maßnahmen, um Gefährdungen aufzu-<br />
15 Vgl. Transparency International (Hrsg.): Checkliste für „Self-Audit“ zur<br />
<strong>Korruption</strong>sprävention in Unternehmen, Berlin 2007, S. 6, elektronisch<br />
veröffentlicht unter: http://www.transparency.de/fileadmin/pdfs/Themen/Wirtschaft/checklisteNEUNPR.pdf.<br />
Risk, Compliance & Audit 3/2010 37
Risk<br />
decken, soll Risiken minimieren <strong>und</strong> durch periodische Anpassung<br />
des Regelwerks zielorientiertes Handeln garantieren.<br />
Arbeitnehmer <strong>und</strong> Geschäftspartner sind über die unternehmensspezifischen<br />
Antikorruptionsmaßnahmen durch die<br />
obersten Führungskräfte regelmäßig zu informieren. Dazu<br />
gehört neben der Publizierung der einschlägigen gesetzlichen<br />
Regelungen <strong>und</strong> Richtlinien auch die Definition von unternehmensinternen<br />
Prozessabläufen. Ausgewählte Mitarbeiter,<br />
beispielsweise alle Abteilungsleiter, müssen dahingehend regelmäßig<br />
geschult werden <strong>und</strong> ihr Wissen auch in ihren Verantwortungsbereiche<br />
kommunizieren. Nur ein sensibilisierter<br />
Mitarbeiter erkennt latente Gefahren <strong>und</strong> kann vorhandene<br />
Unregelmäßigkeiten melden. Voraussetzung ist zum einen,<br />
mit dem geltenden Regelwerk vertraut zu sein, zum anderen<br />
die Möglichkeit zu haben (etwa einem Compliance-Gremium)<br />
Auffälligkeiten zu berichten. Wichtig dabei ist, dass über Telefon,<br />
Inter- oder Intranet auch anonyme Hinweise ermöglicht<br />
werden. Um die Glaubwürdigkeit der Betriebsleitung zu unterstreichen,<br />
werden im Idealfall jährlich die aufgedeckten<br />
Fehlhandlungen <strong>und</strong> die daraus resultierenden Sanktionen an<br />
Mitarbeiter <strong>und</strong> Stakeholder kommuniziert. Eine wichtige Rolle<br />
spielt die Handhabung bei der Neueinstellung von Personal.<br />
Die Personalabteilung ist hier in der Pflicht, über Antikorruptionsmaßnahmen<br />
aufzuklären. Neue Mitarbeiter müssen ein<br />
Dokument über die erfolgte Aufklärung unterschreiben. Abweichungen,<br />
beispielsweise ein fehlender Rücklauf des zu unterzeichnenden<br />
Belegs, sind durch festgelegte Regularien <strong>und</strong><br />
Konsequenzen zu verfolgen.<br />
Der Einführung der Antikorruptionsmaßnahmen gehen eine<br />
risikoorientierte Untersuchung der Geschäftseinheiten, ein<br />
zeitlich klar definierter Umsetzungsplan sowie eine lückenlose<br />
Dokumentation voraus. Eine Risikobewertung besonders gefährdeter<br />
Unternehmensbereiche kann durch die Gewichtung<br />
verschiedener Faktoren geschehen. Die Gewichtung des potenziellen<br />
Risikos kann sich beispielsweise daran orientieren, mit<br />
welchem Anteil der Unternehmensbereich bzw. eine bestimmte<br />
Region am Umsatz beteiligt ist. Hilfreich ist hierbei unter<br />
anderem der Index von Transparency International, der das<br />
Gefährdungspotenzial einzelner Länder einstuft. 16<br />
Befugnisse bzw. die Festlegung bestimmter Richtlinien sollten<br />
bei folgenden Themen besonders beachtet werden:<br />
• Geschenke, sonstige Vergütungen<br />
• Einladungen<br />
• Aufträge von privaten K<strong>und</strong>en oder öffentlichen Institutionen<br />
• Sponsoring, Spenden<br />
16 Vgl. Transparency International (Hrsg.): Surveys and indices by country,<br />
Berlin 2009, elektronisch veröffentlich unter http://www.transparency.<br />
org/policy_research/surveys_indices/gcb/2009<br />
38<br />
• Bankkonten, Zahlungsverkehrsmethoden <strong>und</strong> Investitionen<br />
mit hohem Volumen <strong>und</strong>/oder Risiko<br />
Bei Geschäftspartnern sind die Rahmenverträge zu prüfen.<br />
Durch ein Auditing der Partner, aber auch durch die Überprüfung<br />
der Prozessabläufe aller internen Abteilungen wird angestrebt,<br />
das Risiko von <strong>Korruption</strong>shandlungen zu verhindern.<br />
Alle Maßnahmen, die mit der Antikorruptionsimplementierung,<br />
der ständigen Kontrolle <strong>und</strong> der Anpassung zusammenhängen,<br />
sind mit Kosten verb<strong>und</strong>en. Die Ressourcen müssen<br />
vom Management bereit gestellt werden. Das Budget ist idealerweise<br />
einem eigenen Cost-Center zuzuweisen. Die Höhe der<br />
Kosten ist unter anderem abhängig von der Unternehmensgröße,<br />
der Mitarbeiterzahl, der K<strong>und</strong>enstruktur <strong>und</strong> -art (Privatk<strong>und</strong>en,<br />
öffentliche Verwaltung etc.), dem Volumen der risikoreichen<br />
Aktivitäten (Geschenke, Sponsoring etc.) oder der Art<br />
<strong>und</strong> dem Umfang der Schulung der Mitarbeiter. Mindestens<br />
jährlich ist zudem die Effizienz der Compliance Aktivitäten zu<br />
prüfen <strong>und</strong> anzupassen.<br />
Im Rahmen der Antikorruptionsbekämpfung müssen Unternehmen<br />
pro-aktiv eine geeignete langfristige Strategie<br />
entwickeln. Externe Experten aus Unternehmensberatungen<br />
können dabei erfolgreich Hilfestellung leisten, indem sie ihre<br />
Erfahrungswerte bei der Implementierung <strong>und</strong> Fortführung<br />
der Antikorruptionsmaßnahmen einbringen. Das oberste Management<br />
muss vollkommen hinter diesem Konzept stehen,<br />
um die Durchsetzbarkeit sowie Glaubwürdigkeit der Compliance-Aktivitäten<br />
zu demonstrieren. Daneben sollte die Geschäftsleitung<br />
die moralischen <strong>und</strong> ethischen Gr<strong>und</strong>manifeste<br />
des Unternehmens vorleben. Eine ständige Anpassung an sich<br />
ändernde Rahmenbedingungen, wie etwa Gesetzesangleichungen<br />
oder die Änderung der Unternehmensausrichtung,<br />
ist dabei unerlässlich.<br />
6. Fazit<br />
Die Bekämpfung der <strong>Korruption</strong> ist <strong>und</strong> bleibt eine zentrale<br />
Aufgabe jedes Unternehmens. Die im Rahmen des vorliegenden<br />
Beitrags gezeigten Lösungsansätze erheben keinen Anspruch<br />
auf Vollständigkeit. Jedes Unternehmen muss seinen<br />
Gegebenheiten entsprechend agieren, um dauerhaft bereits<br />
im Kleinen nicht-regelkonformen Handlungen entgegenzuwirken.<br />
Obwohl deutsche Firmen im internationalen Vergleich als<br />
weniger korrupt gelten, sind die Risiken von Schmiergeldzahlungen<br />
weiterhin in hohem Maß vorhanden. 17<br />
Autorin:<br />
Maria Graf ist Beraterin der <strong>Greenlight</strong> <strong>Consulting</strong> GmbH.<br />
17 Vgl. Beller, K.: Schmiergeld-Ranking ohne Sieger, in: Financial Times<br />
Deutschland vom 4.10.2006.<br />
Risk, Compliance & Audit 3/2010