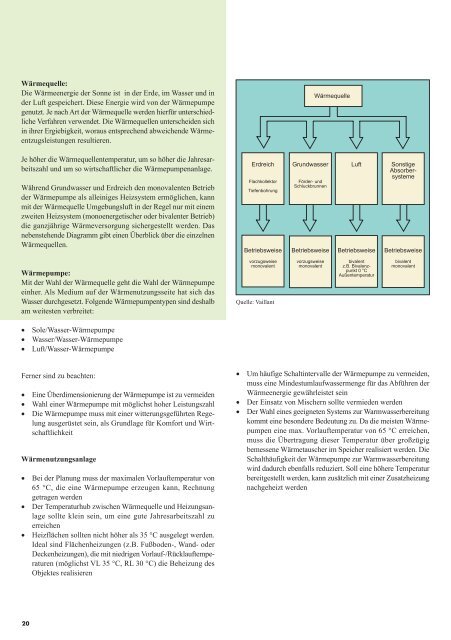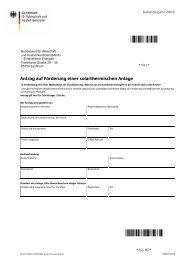PLANUNGSLEITFADEN WÃRMEPUMPEN
PLANUNGSLEITFADEN WÃRMEPUMPEN
PLANUNGSLEITFADEN WÃRMEPUMPEN
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Wärmequelle:<br />
Die Wärmeenergie der Sonne ist in der Erde, im Wasser und in<br />
der Luft gespeichert. Diese Energie wird von der Wärmepumpe<br />
genutzt. Je nach Art der Wärmequelle werden hierfür unterschiedliche<br />
Verfahren verwendet. Die Wärmequellen unterscheiden sich<br />
in ihrer Ergiebigkeit, woraus entsprechend abweichende Wärmeentzugsleistungen<br />
resultieren.<br />
Wärmequelle<br />
Je höher die Wärmequellentemperatur, um so höher die Jahresarbeitszahl<br />
und um so wirtschaftlicher die Wärmepumpenanlage.<br />
Während Grundwasser und Erdreich den monovalenten Betrieb<br />
der Wärmepumpe als alleiniges Heizsystem ermöglichen, kann<br />
mit der Wärmequelle Umgebungsluft in der Regel nur mit einem<br />
zweiten Heizsystem (monoenergetischer oder bivalenter Betrieb)<br />
die ganzjährige Wärmeversorgung sichergestellt werden. Das<br />
nebenstehende Diagramm gibt einen Überblick über die einzelnen<br />
Wärmequellen.<br />
Erdreich<br />
Flachkollektor<br />
Tiefenbohrung<br />
Betriebsweise<br />
Grundwasser<br />
Förder- und<br />
Schluckbrunnen<br />
Betriebsweise<br />
Luft<br />
Betriebsweise<br />
Sonstige<br />
Absorbersysteme<br />
Betriebsweise<br />
Wärmepumpe:<br />
Mit der Wahl der Wärmequelle geht die Wahl der Wärmepumpe<br />
einher. Als Medium auf der Wärmenutzungsseite hat sich das<br />
Wasser durchgesetzt. Folgende Wärmepumpentypen sind deshalb<br />
am weitesten verbreitet:<br />
vorzugsweise<br />
monovalent<br />
Quelle: Vaillant<br />
vorzugsweise<br />
monovalent<br />
bivalent<br />
z.B. Bivalenzpunkt<br />
0 °C<br />
Außentemperatur<br />
bivalent<br />
monovalent<br />
· Sole/Wasser-Wärmepumpe<br />
· Wasser/Wasser-Wärmepumpe<br />
· Luft/Wasser-Wärmepumpe<br />
Ferner sind zu beachten:<br />
· Eine Überdimensionierung der Wärmepumpe ist zu vermeiden<br />
· Wahl einer Wärmepumpe mit möglichst hoher Leistungszahl<br />
· Die Wärmepumpe muss mit einer witterungsgeführten Regelung<br />
ausgerüstet sein, als Grundlage für Komfort und Wirtschaftlichkeit<br />
Wärmenutzungsanlage<br />
· Bei der Planung muss der maximalen Vorlauftemperatur von<br />
65 °C, die eine Wärmepumpe erzeugen kann, Rechnung<br />
getragen werden<br />
· Der Temperaturhub zwischen Wärmequelle und Heizungsanlage<br />
sollte klein sein, um eine gute Jahresarbeitszahl zu<br />
erreichen<br />
· Heizflächen sollten nicht höher als 35 °C ausgelegt werden.<br />
Ideal sind Flächenheizungen (z.B. Fußboden-, Wand- oder<br />
Deckenheizungen), die mit niedrigen Vorlauf-/Rücklauftemperaturen<br />
(möglichst VL 35 °C, RL 30 °C) die Beheizung des<br />
Objektes realisieren<br />
· Um häufige Schaltintervalle der Wärmepumpe zu vermeiden,<br />
muss eine Mindestumlaufwassermenge für das Abführen der<br />
Wärmeenergie gewährleistet sein<br />
· Der Einsatz von Mischern sollte vermieden werden<br />
· Der Wahl eines geeigneten Systems zur Warmwasserbereitung<br />
kommt eine besondere Bedeutung zu. Da die meisten Wärmepumpen<br />
eine max. Vorlauftemperatur von 65 °C erreichen,<br />
muss die Übertragung dieser Temperatur über großzügig<br />
bemessene Wärmetauscher im Speicher realisiert werden. Die<br />
Schalthäufigkeit der Wärmepumpe zur Warmwasserbereitung<br />
wird dadurch ebenfalls reduziert. Soll eine höhere Temperatur<br />
bereitgestellt werden, kann zusätzlich mit einer Zusatzheizung<br />
nachgeheizt werden<br />
20