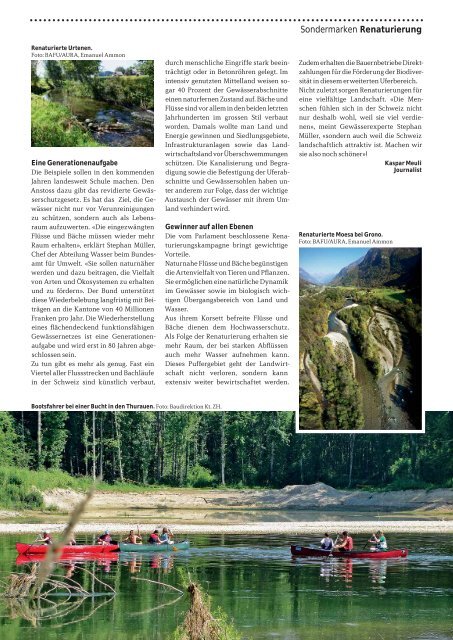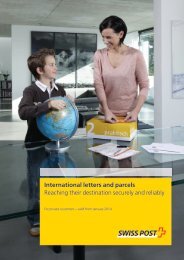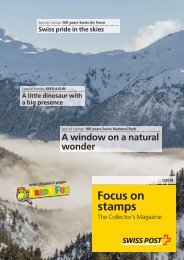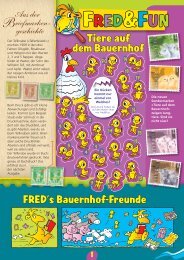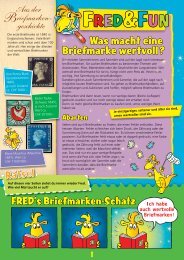Die Lupe 03/2013 - Die Post
Die Lupe 03/2013 - Die Post
Die Lupe 03/2013 - Die Post
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Renaturierte Urtenen.<br />
Foto: BAFU/AURA, Emanuel Ammon<br />
Eine Generationenaufgabe<br />
<strong>Die</strong> Beispiele sollen in den kommenden<br />
Jahren landesweit Schule machen. Den<br />
Anstoss dazu gibt das revidierte Gewässerschutzgesetz.<br />
Es hat das Ziel, die Gewässer<br />
nicht nur vor Verunreinigungen<br />
zu schützen, sondern auch als Lebensraum<br />
aufzuwerten. «<strong>Die</strong> eingezwängten<br />
Flüsse und Bäche müssen wieder mehr<br />
Raum erhalten», erklärt Stephan Müller,<br />
Chef der Abteilung Wasser beim Bundesamt<br />
für Umwelt. «Sie sollen naturnäher<br />
werden und dazu beitragen, die Vielfalt<br />
von Arten und Ökosystemen zu erhalten<br />
und zu fördern». Der Bund unterstützt<br />
diese Wiederbelebung langfristig mit Beiträgen<br />
an die Kantone von 40 Millionen<br />
Franken pro Jahr. <strong>Die</strong> Wiederherstellung<br />
eines flächendeckend funktionsfähigen<br />
Gewässernetzes ist eine Generationenaufgabe<br />
und wird erst in 80 Jahren abgeschlossen<br />
sein.<br />
Zu tun gibt es mehr als genug. Fast ein<br />
Viertel aller Flussstrecken und Bachläufe<br />
in der Schweiz sind künstlich verbaut,<br />
durch menschliche Eingriffe stark beeinträchtigt<br />
oder in Betonröhren gelegt. Im<br />
intensiv genutzten Mittelland weisen sogar<br />
40 Prozent der Gewässerabschnitte<br />
einen naturfernen Zustand auf. Bäche und<br />
Flüsse sind vor allem in den beiden letzten<br />
Jahrhunderten im grossen Stil verbaut<br />
worden. Damals wollte man Land und<br />
Energie gewinnen und Siedlungsgebiete,<br />
Infrastrukturanlagen sowie das Landwirtschaftsland<br />
vor Überschwem mun gen<br />
schützen. <strong>Die</strong> Kanalisierung und Begradigung<br />
sowie die Befestigung der Uferabschnitte<br />
und Gewässersohlen haben unter<br />
anderem zur Folge, dass der wichtige<br />
Austausch der Gewässer mit ihrem Umland<br />
verhindert wird.<br />
Gewinner auf allen Ebenen<br />
<strong>Die</strong> vom Parlament beschlossene Renaturierungskampagne<br />
bringt gewichtige<br />
Vorteile.<br />
Naturnahe Flüsse und Bäche begünstigen<br />
die Artenvielfalt von Tieren und Pflanzen.<br />
Sie ermöglichen eine natürliche Dynamik<br />
im Gewässer sowie im biologisch wich-<br />
tigen Übergangsbereich von Land und<br />
Wasser.<br />
Aus ihrem Korsett befreite Flüsse und<br />
Bäche dienen dem Hochwasserschutz.<br />
Als Folge der Renaturierung erhalten sie<br />
mehr Raum, der bei starken Abflüssen<br />
auch mehr Wasser aufnehmen kann.<br />
<strong>Die</strong>ses Puffergebiet geht der Landwirtschaft<br />
nicht verloren, sondern kann<br />
extensiv weiter bewirtschaftet werden.<br />
Sondermarken Renaturierung<br />
Zudem erhalten die Bauernbetriebe Direktzahlungen<br />
für die Förderung der Biodiver -<br />
sität in diesem erweiterten Uferbereich.<br />
Nicht zuletzt sorgen Renaturierungen für<br />
eine vielfältige Landschaft. «<strong>Die</strong> Menschen<br />
fühlen sich in der Schweiz nicht<br />
nur deshalb wohl, weil sie viel verdienen»,<br />
meint Gewässerexperte Stephan<br />
Müller, «sondern auch weil die Schweiz<br />
landschaftlich attraktiv ist. Machen wir<br />
sie also noch schöner»!<br />
Kaspar Meuli<br />
Journalist<br />
Renaturierte Moesa bei Grono.<br />
Foto: BAFU/AURA, Emanuel Ammon<br />
Bootsfahrer bei einer Bucht in den Thurauen. Foto: Baudirektion Kt. ZH.