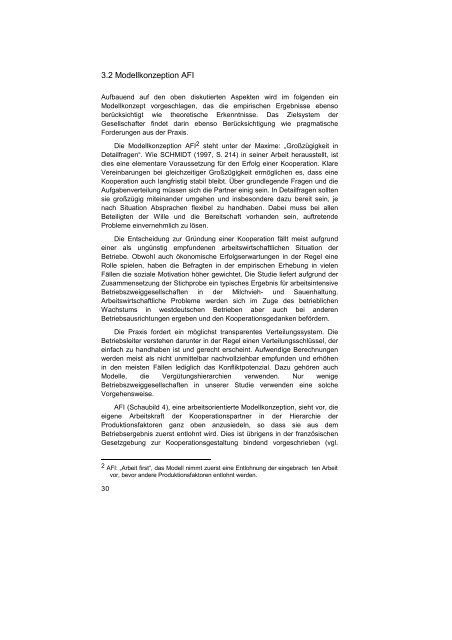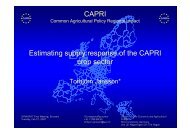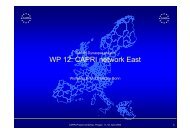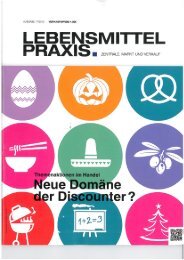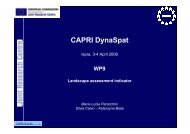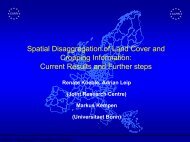Motivation, Zielsetzung und innere Organisation von ...
Motivation, Zielsetzung und innere Organisation von ...
Motivation, Zielsetzung und innere Organisation von ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
3.2 Modellkonzeption AFI<br />
Aufbauend auf den oben diskutierten Aspekten wird im folgenden ein<br />
Modellkonzept vorgeschlagen, das die empirischen Ergebnisse ebenso<br />
berücksichtigt wie theoretische Erkenntnisse. Das Zielsystem der<br />
Gesellschafter findet darin ebenso Berücksichtigung wie pragmatische<br />
Forderungen aus der Praxis.<br />
Die Modellkonzeption AFI 2 steht unter der Maxime: „Großzügigkeit in<br />
Detailfragen“. Wie SCHMIDT (1997, S. 214) in seiner Arbeit herausstellt, ist<br />
dies eine elementare Voraussetzung für den Erfolg einer Kooperation. Klare<br />
Vereinbarungen bei gleichzeitiger Großzügigkeit ermöglichen es, dass eine<br />
Kooperation auch langfristig stabil bleibt. Über gr<strong>und</strong>legende Fragen <strong>und</strong> die<br />
Aufgabenverteilung müssen sich die Partner einig sein. In Detailfragen sollten<br />
sie großzügig miteinander umgehen <strong>und</strong> insbesondere dazu bereit sein, je<br />
nach Situation Absprachen flexibel zu handhaben. Dabei muss bei allen<br />
Beteiligten der Wille <strong>und</strong> die Bereitschaft vorhanden sein, auftretende<br />
Probleme einvernehmlich zu lösen.<br />
Die Entscheidung zur Gründung einer Kooperation fällt meist aufgr<strong>und</strong><br />
einer als ungünstig empf<strong>und</strong>enen arbeitswirtschaftlichen Situation der<br />
Betriebe. Obwohl auch ökonomische Erfolgserwartungen in der Regel eine<br />
Rolle spielen, haben die Befragten in der empirischen Erhebung in vielen<br />
Fällen die soziale <strong>Motivation</strong> höher gewichtet. Die Studie liefert aufgr<strong>und</strong> der<br />
Zusammensetzung der Stichprobe ein typisches Ergebnis für arbeitsintensive<br />
Betriebszweiggesellschaften in der Milchvieh- <strong>und</strong> Sauenhaltung.<br />
Arbeitswirtschaftliche Probleme werden sich im Zuge des betrieblichen<br />
Wachstums in westdeutschen Betrieben aber auch bei anderen<br />
Betriebsausrichtungen ergeben <strong>und</strong> den Kooperationsgedanken befördern.<br />
Die Praxis fordert ein möglichst transparentes Verteilungssystem. Die<br />
Betriebsleiter verstehen darunter in der Regel einen Verteilungsschlüssel, der<br />
einfach zu handhaben ist <strong>und</strong> gerecht erscheint. Aufwendige Berechnungen<br />
werden meist als nicht unmittelbar nachvollziehbar empf<strong>und</strong>en <strong>und</strong> erhöhen<br />
in den meisten Fällen lediglich das Konfliktpotenzial. Dazu gehören auch<br />
Modelle, die Vergütungshierarchien verwenden. Nur wenige<br />
Betriebszweiggesellschaften in unserer Studie verwenden eine solche<br />
Vorgehensweise.<br />
AFI (Schaubild 4), eine arbeitsorientierte Modellkonzeption, sieht vor, die<br />
eigene Arbeitskraft der Kooperationspartner in der Hierarchie der<br />
Produktionsfaktoren ganz oben anzusiedeln, so dass sie aus dem<br />
Betriebsergebnis zuerst entlohnt wird. Dies ist übrigens in der französischen<br />
Gesetzgebung zur Kooperationsgestaltung bindend vorgeschrieben (vgl.<br />
2 AFI: „Arbeit first“, das Modell nimmt zuerst eine Entlohnung der eingebrach ten Arbeit<br />
vor, bevor andere Produktionsfaktoren entlohnt werden.<br />
30