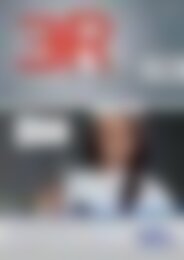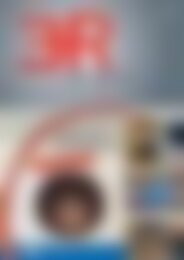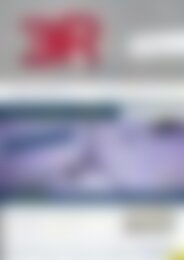3R 27. Oldenburger Rohrleitungsforum (Vorschau)
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
12/2012<br />
ISSN 2191-9798<br />
K 1252 E<br />
Vulkan-Verlag,<br />
Essen<br />
Fachzeitschrift für sichere und<br />
effiziente Rohrleitungssysteme<br />
Projekt2:Layout 1 30.10.2012 17:47 Uhr Seite 1<br />
www.<strong>3R</strong>-Rohre.de
www.vulkan-verlag.de<br />
Werden sie HDD-experte<br />
Jetzt bestellen!<br />
Praxishandbuch HDD-felsbohrtechnik<br />
Die Technologie des „Horizontal Directional Drilling“ war vor wenigen Jahren<br />
noch kaum bekannt. Mittlerweile hat sich die HDD-Felsbohrtechnologie zu<br />
einem bedeutenden Praxisbereich entwickelt und nimmt einen festen Platz<br />
in der Bohr- und Bautechnik ein.<br />
Aus diesem Grund ist es wichtig, den Stand dieser Bohrtechnologie<br />
in ihren Grundlagen, maschinenbautechnischen Funktionen<br />
sowie Anwendungen zu beschreiben und anhand zahlreicher<br />
Nutzungsbeispiele zu erläutern. Dieses Handbuch ist aus der<br />
Praxis entstanden und eröffnet den Einstieg in die vielfältigen<br />
Einsatzmöglichkeiten des HDDBohrens. Dabei werden neue,<br />
bisher für undenkbar gehaltene Verfahren aufgezeigt. Zielgruppen<br />
für dieses Grundlagenwerk sind BohrIngenieure<br />
und BohrTechniker, Baufachleute in der HDDTechnologie<br />
und ambitionierte Nachwuchskräfte. Es hilft Ingenieurbüros,<br />
Versorgungsfi rmen und Entsorgungsbetrieben, Kraftwerksplanern<br />
und Baubehörden bei Planungen, Trassenkonzeptionen,<br />
Regionalplanungskonzepten für neue Leitungskorridore und<br />
Versorgungswege sowie energetische Erschließungen.<br />
H.J. Bayer und M. Reich<br />
1. Auflage 2013,<br />
216 Seiten, Broschur<br />
DIN A5 in Farbe<br />
Wissen für DIe<br />
Zukunft<br />
Vorteilsanforderung per fax: +49 Deutscher (0) Industrieverlag 201 / GmbH 82002-34 | Arnulfstr. 124 | oder 80636 abtrennen München und im fensterumschlag einsenden<br />
Ja, ich bestelle gegen rechnung 3 Wochen zur Ansicht<br />
firma/Institution<br />
___ ex.<br />
Praxishandbuch HDD-felsbohrtechnik<br />
1. Auflage 2013 – ISBN: 978-3-8027-2769-6<br />
für € 60,- (zzgl. Versand)<br />
Vorname, Name des empfängers<br />
Straße / Postfach, Nr.<br />
Die bequeme und sichere Bezahlung per Bankabbuchung wird<br />
mit einer Gutschrift von € 3,- auf die erste rechnung belohnt.<br />
Land, PLZ, Ort<br />
Telefon<br />
Telefax<br />
Antwort<br />
Vulkan-Verlag GmbH<br />
Versandbuchhandlung<br />
Postfach 10 39 62<br />
45039 Essen<br />
e-Mail<br />
Branche / Wirtschaftszweig<br />
Bevorzugte Zahlungsweise Bankabbuchung rechnung<br />
Bank, Ort<br />
Widerrufsrecht: Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B.<br />
Brief, fax, e-Mail) oder durch rücksendung der Sache widerrufen. Die frist beginnt nach erhalt dieser Belehrung in Textform.<br />
Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache an die Vulkan-Verlag GmbH,<br />
Versandbuchhandlung, Huyssenallee 52-56, 45128 essen.<br />
Bankleitzahl<br />
Ort, Datum, Unterschrift<br />
Kontonummer<br />
PAPHDD2012<br />
nutzung personenbezogener Daten: für die Auftragsabwicklung und zur Pflege der laufenden Kommunikation werden personenbezogene Daten erfasst und gespeichert. Mit dieser Anforderung erkläre ich mich damit einverstanden, dass ich<br />
von Deutscher Industrieverlag oder vom Vulkan-Verlag per Post, per Telefon, per Telefax, per e-Mail, nicht über interessante, fachspezifische Medien und Informationsangebote informiert und beworben werde. Diese erklärung kann<br />
ich mit Wirkung für die Zukunft jederzeit widerrufen.
EDITORIAL<br />
Auf der Suche nach<br />
dem Königsweg<br />
Leider ist dieser in Bezug auf die Energiewende noch immer nicht gefunden – aber wer<br />
hätte damit auch ernsthaft gerechnet. Allerdings hätte man sich ein wenig mehr stringentes<br />
Handeln seitens der Politik gewünscht. Die Kompetenzaufteilung zwischen dem<br />
Umwelt- und dem Wirtschaftsministerium ist und war dabei sicher nicht hilfreich. Bei<br />
manchen der Entscheidungen und Vorschläge der letzten Wochen kamen einem doch<br />
Zweifel, ob wir uns in Deutschland auf dem Weg von der Markt- zur Planwirtschaft<br />
befinden. Statt Wettbewerb zu fördern, scheinen die dafür eingericheteten Instrumente<br />
eher das Gegenteil zu bewirken. Unternehmerisches Handeln ist Energieversorgern noch<br />
nie so schwer gemacht worden wie heute; dies betrifft sowohl Kraftwerksbetreiber als<br />
auch Netzbetreiber.<br />
Ein anderes Phänomen ist das Haftbarmachen der Bevölkerung. Ob zur Stabilisierung<br />
der Banken oder zur Haftung von Einnahmeausfällen durch nicht angeschlossene Offshore-<br />
Windparks, es gibt nichts, was nicht durch die privaten Haushalte gesichert werden könnte<br />
– so scheint es jedenfalls. Im nächsten Jahr werden ebendiese privaten Haushalte durch die<br />
Umlage nach dem EEG statt derzeit 3,6 Cent pro Kilowattstunde rund 5,3 Cent bezahlen<br />
müssen. Dies birgt eine Menge Sprengstoff für ein Wahljahr und das Potential noch viele<br />
weitere Ideen seitens der Politik zur Ausgestaltung der Energiewende zu erfahren.<br />
Auf der anderen Seite werden bereits konkrete Lösungsansätze für eine sichere<br />
Energieversorgung der Zukunft auf technischer Ebene diskutiert. Angelpunkt dabei ist<br />
die Frage, wie man die volatilen Energieformen wie Energie aus Wind oder Photovoltaik<br />
derart transportieren, steuern und/oder speichern kann, dass man die Energieerzeugung<br />
mit der Energienachfrage in Einklang bringt.<br />
Erste Pilotanlagen aus dem Bereich Power-to-Gas werden<br />
derzeit realisiert, das Arbeiten mit intelligenter Lastverschiebung<br />
wird bereits von einigen Versorgern wie der EWE AG, die in<br />
ihrem Versorgungsgebiet einen hohen Energieerzeugungsanteil<br />
aus Erneuerbaren Energien hat, praktiziert. Auch der<br />
Ausbau von Erdgaskavernenspeichern wie der Ende Oktober<br />
in Betrieb genommene Speicher in Etzel im Ostfriesischen<br />
Friedberg zeigt, dass bereits einiges in Bewegung ist.<br />
Es wird in Deutschland gelingen, eine sichere und<br />
kostenerträgliche, intelligente und vielschichtige Energieversorgung<br />
aufzubauen. Denn zum einen ist das technische<br />
Know-how zur Entwicklung entsprechender marktreifer<br />
Techniken vorhanden, und zum anderen gibt es hierzu keine<br />
Alternative.<br />
Zum Glück gibt es neben all diesen Themen hin und wieder<br />
Fixpunkte im Leben, die einen zum Innehalten und<br />
Ver weilen bringen und manche Dinge relativieren. In diesem<br />
Sinne wünsche ich Ihnen und Ihren Familien ein frohes<br />
Weihnachtsfest, besinnliche und ruhige Tage und ein<br />
gesundes und erfolgreiches Neues Jahr 2013.<br />
Nico Hülsdau<br />
Vulkan-Verlag GmbH<br />
12 / 2012949
ALT<br />
12/2012<br />
NACHRICHTEN<br />
977<br />
Stränge der Nord Stream-Pipeline sind in Betrieb<br />
Das <strong>27.</strong> <strong>Oldenburger</strong> Rohrleitungs forum fokussiert die Folgen<br />
des Klimawandels<br />
INDUSTRIE & WIRTSCHAFT<br />
EDITORIAL<br />
949 Auf der Suche nach<br />
dem Königsweg<br />
Nico Hülsdau<br />
FASZINATION<br />
TECHNIK<br />
998 Knochenarbeit im<br />
Düker<br />
953 Beide Stränge der Nord Stream-Pipeline sind in Betrieb<br />
954 Nabucco beginnt Genehmigungsverfahren der UVP für den Abschnitt Bulgarien<br />
955 LeakControl mit neuem Vertriebs partner<br />
956 Partnerschaftliches KGE-Gasspeicherprojekt<br />
956 Bauarbeiten an Erdgasfernleitung Sannerz-Rimpar beendet<br />
957 Startschuss für Neubau von Hauff-Technik<br />
958 egeplast mit neuer Kunststoff-Werkstatt und Rohr-Testgelände für Prüfungen<br />
958 Bayerischer Energiepreis 2012 geht an HUBER SE<br />
959 SIMONA teilt Umsatzentwicklung innerhalb des zweiten Halbjahres 2012 mit<br />
960 Göttingen nutzt Biowärme für die Altstadt<br />
960 Beulco jetzt auch in Italien vertreten<br />
961 NORMA Group AG auf solidem Wachstumskurs<br />
961 WELTEC BIOPOWER baut 3-Megawatt-Biogasanlage in Uruguay<br />
962 DMT übernimmt Mehrheit an der Höntzsch GmbH<br />
962 Atlas-Copco-Mitarbeiter sammeln 38.000 Euro für Wasserversorgung im Sudan<br />
963 Preis für neue Bekämpfungstechnologie von Wasserasseln in Trinkwasserversorgungsleitungen<br />
verliehen<br />
VERBÄNDE & ORGANISATIONEN<br />
964 400. Fachtagung der FIHB mit der Steinzeugindustrie in Mainz<br />
965 rbv und BFA LTB begrüßen Leitfaden der Bundesnetzagentur zur Verlegung von<br />
Glasfaserkabeln bei Arbeiten am Stromnetz<br />
RSV AKTUELL<br />
966 „Kompetenz nach DIN“ für die Grundstücksentwässerung<br />
966 Der neuberufene RSV-Beirat<br />
950 12 / 2012
990<br />
FKKS Special: Kathodischer Korrosionsschutz für die<br />
Innenflächen von metallischen Anlagen (KKS-I)<br />
1008<br />
Auftraggeber<br />
und Auftragnehmer ...<br />
VERANSTALTUNGEN<br />
970 Große Resonanz bei Nürnberger Kolloquien zur Kanalsanierung<br />
971 ÖGL-Symposium Grabenlos in Kitzbühel<br />
971 Baden-Württembergs Wirtschaftsminister eröffnet neues SKZ-<br />
Trainings-Center in China<br />
972 WASSER BERLIN INTERNATIONAL schärft ihr Profil<br />
974 Praxistag Wasserversorgungsnetze etabliert sich<br />
975 Rohrleitungen, Wasser und Trenchless Technologies im Fokus der INA<br />
in Tunesien<br />
977 SPECIAL: <strong>27.</strong> <strong>Oldenburger</strong> Rohrleitungs forum fokussiert Folgen des<br />
Klimawandels<br />
RECHT & REGELWERK<br />
... gemeinsam für<br />
Qualität<br />
Ihr Partner bei<br />
der Bewertung der<br />
■ Fachkunde<br />
■ technischen<br />
Leistungsfähigkeit<br />
■ technischen<br />
Zuverlässigkeit<br />
der ausführenden<br />
Unternehmen<br />
983 DVGW-Regelwerk Gas<br />
983 DVGW-Regelwerk Gas/Wasser<br />
984 DVGW-Regelwerk Wasser<br />
984 DWA-Regelwerk<br />
985 DIN-Normen<br />
986 VDMA-Regelwerk<br />
PRODUKTE & VERFAHREN<br />
1000 Sichere und optimale Abdichtung bei Mauerdurchführungen<br />
1001 Hochmobile Trinkwasseraufbereitung im Einsatz<br />
1002 Einsatzspektrum der HexelOne ® -Hochdruckrohre erweitert<br />
1002 Angebotspalette für PE 100-Rohre um Double Layer erweitert<br />
1003 Mit Bekaplast Aqua-Lining 400 Trinkwasserspeicher clever abdichten<br />
neutral – fair –<br />
zuverlässig<br />
Gütesicherung Kanalbau<br />
steht für eine objektive<br />
Bewertung nach einheitlichem<br />
Maßstab<br />
Gütesicherung Kanalbau RAL-GZ 961<br />
12 / 2012951
ALT<br />
12/2012<br />
HAUPTTHEMEN<br />
1024<br />
m duktile Gussrohre DN 600 mit ZM-Umhüllung<br />
n für die Turbinenleitung des Kraftwerkes<br />
lzbach verlegt<br />
Vermessung im Querschnitt mit der PANORAMO 3D-Ansicht<br />
KORROSIONSSCHUTZ<br />
988 forum kks 2013 in Esslingen<br />
989 Fachbereich „Innenschutz“ (KKS-I) stellt sich vor<br />
990 Kathodischer Korrosionsschutz für die Innenflächen von metallischen Anlagen (KKS-I)<br />
Von Norbert Tenzer<br />
995 Kathodischer Korrosionsschutz (KKS) und Fernwirktechnik im Wandel der Zeit<br />
Von Daniel Steller, Volkhard Schröder, Daniel Radtke<br />
ENERGIEVERSORGUNG<br />
VICES<br />
Marktübersicht<br />
Messen | Tagungen |<br />
Seminare<br />
Inserentenverzeichnis<br />
Impressum<br />
1004 Innensanierung einer Kühlwasserleitung mit RS BlueLine®<br />
1006 GFK-Wickelrohre DN 1000 für das Sölktal<br />
1008 Buoholzbach nutzt ZMU-Gussrohre DN 600 als Turbinenleitungen<br />
WASSERVERSORGUNG<br />
1009 Trinkwasserleitung im Eiltempo mit Raketenpflug eingezogen<br />
1010 Liechtensteiner Unterland setzt bei Wasserversorgung auf PE<br />
1012 Neue Verbindungsschieber DN 1800 und DN 2200 für die Schleuse Eisenhüttenstadt<br />
1014 Marode Trinkwasserleitungen im Schweinfurter Schulzentrum mit Close-Fit saniert<br />
ABWASSERENTSORGUNG<br />
1024 Messtechnik in der Abwasser-Kanalinspektion<br />
Von Arno Jugel<br />
1028 FBS-Stahlbetonrohre DN 2600 sichern Uferpromenade in Bonn-Mehlem<br />
1030 Flughafen Frankfurt: Kanal am Terminal A plus durchbohrt<br />
952 12 / 2012
NACHRICH<br />
INDUSTRIE & WIRTSCHA<br />
Beide Stränge der Nord<br />
Stream-Pipeline sind in Betrieb<br />
Nur 30 Monate<br />
nach Baubeginn<br />
des Pipelineprojektes<br />
wurde am 8.<br />
Oktober der zweite<br />
Strang der Nord<br />
Stream-Pipeline in<br />
Betrieb genommen.<br />
Rund um die<br />
Uhr haben internationale<br />
Spezialisten<br />
an der Pipeline<br />
durch die Ostsee<br />
gearbeitet. Die<br />
beiden Leitungsstränge<br />
mit einem<br />
Gesamtgewicht<br />
von vier Millionen<br />
Tonnen konnten<br />
trotz aller Herausforderungen<br />
beim<br />
Bau termingerecht<br />
und innerhalb des<br />
Budgets fertiggestellt<br />
werden.<br />
Matthias Warnig,<br />
Managing<br />
Director der Nord<br />
Stream AG, betonte:<br />
„Wir sind stolz<br />
auf diese herausragende<br />
Leistung. Sie wurde ermöglicht durch das Engagement<br />
aller Nord Stream-Mitarbeiter, die Unterstützung<br />
unserer Anteilseigner sowie durch unsere Geschäftspartner<br />
und die beauftragten Unternehmen aus der ganzen Welt.“<br />
Mit der offiziellen Inbetriebnahme des zweiten Stranges<br />
der Nord Stream-Pipeline wurde das vollständig automatisierte<br />
Pipelinesystem fertiggestellt. Die beiden Nord Stream-<br />
Pipelinestränge werden eine jährliche Transportkapazität von<br />
bis zu 55 Milliarden Kubikmetern bereitstellen und die Europäische<br />
Union für mindestens 50 Jahre mit russischem Erdgas<br />
vorsorgen. Der erste Strang transportiert seit November<br />
2011 Erdgas nach Europa.<br />
Gerhard Schröder (Bild), Vorsitzender des Aktionärsausschusses<br />
der Nord Stream AG, sagte: „Nord Stream ist mit<br />
Sicherheit eines der modernsten Systeme für den Transport<br />
von Energie, das für die zuverlässige Belieferung Europas aus<br />
den weltweit größten Lagerstätten Russlands sorgt. Heute<br />
können wir mit Stolz sagen: ‚We Deliver‘.“<br />
Anlässlich der Fertigstellung beider Pipelinestränge kamen<br />
am 8. Oktober hochrangige Gäste sowie Vertreter mehrerer<br />
europäischer Länder und der Anteilseigner von Nord Stream<br />
Gerhard Schröder, Vorsitzender des Aktionärsausschusses der Nord Stream AG, sagte vor 200<br />
internationalen Gästen am 8. Oktober in der Bucht von Portowaja: „Heute können wir mit Stolz<br />
sagen: ‚We Deliver‘“<br />
in einer feierlichen Zeremonie an der Bucht von Portowaja an<br />
der russischen Ostseeküste zusammen. Vom Kontrollzentrum<br />
der nahegelegenen Gazprom-Verdichterstation Portowaja<br />
aus wurde der Gasfluss durch den zweiten Pipelinestrang<br />
gestartet. Von hier aus wird das russische Gas durch die Ostsee<br />
bis in das europäische Fernleitungsnetz gepumpt. Die<br />
hochmodernen Kompressoren der Verdichterstation erzeugen<br />
einen Druck von bis zu 220 bar. Dies reicht aus, um das Gas<br />
durch die beiden jeweils 1.224 km langen Pipelinestränge<br />
ohne zusätzliche Kompressorstationen bis nach Lubmin an<br />
der deutschen Ostseeküste zu transportieren.<br />
In einem vierjährigen intensiven Konsultationsverfahren mit<br />
den neun Ostsee-Anrainerstaaten wurde der genaue Verlauf<br />
der Pipelinestränge festgelegt. Die Ergebnisse des Umweltmonitorings<br />
bestätigen, dass der Bau der Nord Stream-Pipeline<br />
nur geringe Auswirkungen auf die Umwelt hatte.<br />
Warnig ergänzte: „Ich bin sehr stolz darauf, dass wir dieses<br />
ambitionierte Infrastrukturprojekt innerhalb des Zeitplans und<br />
des Budgets umgesetzt haben. Wenn man sich die zahlreichen<br />
anderen europäischen Pipelineprojekte in ihren verschiedenen<br />
Planungsstadien anschaut, erkennt man: Nord Stream<br />
Foto: Nord Stream AG<br />
12 / 2012953
NACHRICHTEN<br />
INDUSTRIE & WIRTSCHAFT<br />
Nabucco beginnt Genehmigungsverfahren<br />
der UVP für den Abschnitt Bulgarien<br />
Die Nabucco National Company Bulgarien gab am 5.<br />
November bekannt, dass der 412 km lange bulgarische<br />
Abschnitt der Nabucco-Pipeline nun offiziell die Genehmigungsphase<br />
für die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP)<br />
begonnen hat. Die für das UVP-Verfahren erforderlichen<br />
Unterlagen wurden am 31. Oktober<br />
2012 beim Umweltministerium in Bulgarien<br />
eingereicht.<br />
Nabucco hatte bereits früher in diesem Jahr<br />
die Fertigstellung des UVP-Zulassungsverfahrens<br />
für den ungarischen Abschnitt der Strecke<br />
bekannt gegeben, für welche die letzte der vier<br />
Genehmigungen im Juni erteilt worden war.<br />
Reinhard Mitschek (Bild), Geschäftsführer<br />
der Nabucco Gas Pipeline GmbH, sagte:<br />
„Nabucco ist in Bulgarien bereits weit<br />
vorangekommen und wir gratulieren<br />
dem hiesigen Team zu diesem nächsten<br />
Schritt in der Projektentwicklung.<br />
Nabucco hat sich zur Befolgung des<br />
optimalen Vorgehens im Einklang mit<br />
den nationalen und internationalen<br />
Vorschriften bis hin zur Zusammenarbeit<br />
mit allen am Projekt Beteiligten<br />
verpflichtet, damit wir für die<br />
Länder, die wir durchqueren, eine<br />
Win-Win-Situation gewährleisten können. ”<br />
Marii Kossev, Geschäftsführer der Nabucco National Company<br />
in Bulgarien sagte: „Wir freuen uns darauf, die ausgezeichnete<br />
Zusammenarbeit mit den Behörden fortführen zu können:<br />
ihr Feedback zu implementieren und mit der Öffentlichkeit<br />
und anderen Interessensvertretern im UVP-Verfahren zusammenzuarbeiten.<br />
Neben der Förderung der Diversifizierung der<br />
Energieversorgung und der Wahlfreiheit für die bulgarischen<br />
Bürger, wird Nabucco Hunderte von Jobs in Bulgarien, Investitionen<br />
in Höhe von einer Milliarde Euro, Steuern und neue<br />
Geschäftsmöglichkeiten generieren.”<br />
Die Einreichung der UVP-Unterlagen markiert den Beginn<br />
des rechtlichen Verfahrens der Umweltverträglichkeitsprüfung<br />
in Bulgarien. Im Anschluss an eine Überprüfung durch die<br />
zuständige Behörde, wird Nabucco (in Bulgarien durch sein<br />
nationales Unternehmen vertreten), das Feedback nach einer<br />
Beratungszeit umsetzen. Im nächsten Schritt wird eine Rücksprache<br />
mit der Öffentlichkeit entlang der Strecke erfolgen,<br />
an deren Anschluss die Bewerbung an die Behörden für eine<br />
endgültige Entscheidung zurückgeschickt wird.<br />
Als zukünftige Gas-Pipeline aus dem kaspischen Raum und<br />
dem Nahen Osten für die Versorgung von mehr als 500 Millionen<br />
potenziellen Kunden in Europa, ist Nabucco das Vorzeigeprojekt<br />
im südlichen Korridor. Das Nabucco-Konsortium wird<br />
weiterhin eng mit dem Konsortium Shah Deniz II und mit der<br />
Transanatolischen Gas-Pipeline (TANAP) zusammenarbeiten<br />
uf dem Weg in die Zukunft!<br />
r OOWV ist im Bundesgebiet einer der großen Wasserr-<br />
und Abwasser entsor ger. Mit Weitsicht und innovaen<br />
Ideen wollen wir die kommenden Herausforderunn<br />
meistern. Und neue Aufgaben warten auf uns – seien<br />
dabei!<br />
WV · Personalabteilung · Georgstraße 4 · 26919 Brake<br />
werbung@oowv.de<br />
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt für die Leitung des<br />
Trink- und Abwasserzentrums in Oldenburg:<br />
Ingenieur (w/m),<br />
Fachrichtung Bauingenieurwesen mit Schwerpunkt<br />
Siedlungswasserwirtschaft/Tiefbau<br />
Nähere Informationen unter www.oowv.de<br />
meinsam · nachhaltig · transparent<br />
nannt-2 1 22.11.12 08:53<br />
954 12 / 2012
LeakControl<br />
mit neuem<br />
Vertriebspartner<br />
Die RBS wave konnte für ihr Produkt<br />
LeakControl einen neuen<br />
Vertriebspartner dazugewinnen:<br />
WaterGroup ist ein Consultingunternehmen,<br />
das sich schwerpunktmäßig<br />
mit Themen der Wasserverwendung<br />
im kommunalen Bereich<br />
(Versorger, Kommunen) und im<br />
Bereich Gewerbe und Industrie<br />
beschäftigt. Wegen der knappen<br />
Wasserressourcen in Australien ist<br />
das Know-how von WaterGroup<br />
mit modernen Lösungsansätzen<br />
im Bereich Verbrauchsoptimierung,<br />
Verlustbekämpfung und Smart<br />
Metering stark nachgefragt.<br />
WaterGroup möchte seine<br />
Aktivitäten im Bereich Water Loss<br />
Management ausweiten und hierbei<br />
auch das System LeakControl<br />
bei den Wasserversorgern in Australien<br />
und Neuseeland etablieren.<br />
Die Unterzeichnung der Vertriebsvereinbarung<br />
fand am 19.<br />
September mit den Vertretern der<br />
RBS wave, Bild unten Erwin Kober<br />
(Geschäftsführer, li.) und Rainer<br />
Deiss (Bereichsleiter Operations,<br />
re.) sowie dem Geschäftsführer<br />
der WaterGroup, Günter Hauber-<br />
Davidson (Mitte), in Stuttgart statt.<br />
Qualität ohne Kompromisse<br />
Das Qualitätskonzept bei egeplast ist so einfach wie wirksam: Sich nie<br />
mit dem Zweitbesten zufrieden zu geben. Daher auditieren wir alle<br />
unsere Lieferanten, kontrollieren eingehende Rohstoffe und unterziehen<br />
jedes Rohr schon während der Fertigung einer permanenten<br />
Ultraschall-Kontrolle – 100 Prozent Sicherheit für Sie.<br />
Gebaut für Generationen: Kunststoffrohrsysteme<br />
von egeplast erfüllen über viele Jahrzehnte einwandfrei<br />
ihre Funktion – zuverlässig, langlebig<br />
und umweltfreundlich. Nachhaltigkeit bedeutet<br />
für uns, in langen Zyklen zu denken und zu handeln.<br />
Ihr Nutzen: kompromisslose Qualität, verlässliche<br />
Rohrsysteme.<br />
Wir schaffen für Sie Mehrwerte.<br />
egeplast international GmbH<br />
Robert-Bosch-Straße 7<br />
48268 Greven<br />
Telefon: +49.2575.9710 - 0<br />
E-Mail: info@egeplast.de<br />
Dipl.-Ing. Peter Brägelmann<br />
Leiter Qualitätssicherung und<br />
Qualitätsmanagement<br />
LeakControl ist ein auf Ultraschall-Durchfluss-Messung<br />
basierendes<br />
System zur stationären<br />
Überwachung von Rohrnetzen auf<br />
Wasserverluste. Das System kann<br />
sowohl in statischen als auch virtuellen<br />
Messzonen (DMA – District<br />
Metering Areas) eingesetzt werden.<br />
12 / 2012<br />
unterirdisch gut<br />
Sehen Sie den neuen egeplast-Unternehmensfi lm.<br />
www.egeplast.de
NACHRICHTEN<br />
INDUSTRIE & WIRTSCHAFT<br />
Partnerschaftliches KGE-Gasspeicherprojekt<br />
Nach rund zwei Jahren Bauzeit hat die Kommunale Gasspeichergesellschaft<br />
Epe mbH & Co. KG (KGE) am 29. Oktober den<br />
Gasspeicher im Eper Amtsvenn offiziell mit einem derzeitigen<br />
Gesamtgasvolumen von 54 Mio. m³ in einer Kaverne in Betrieb<br />
l.): Henning Deters (Vorstandsvorsitzender GELSENWASSER AG), Dr.<br />
rd Bollermann (Regierungspräsident Arnsberg), Dietmar Bückemeyer<br />
chnischer Vorstand Stadtwerke Essen AG), Bernd Heinz (Prokurist<br />
rtmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH, DEW 21), Dr.<br />
rnhard Klocke (Geschäftsführer KGBE-Kommunale Gasspeicher<br />
teiligungsgesellschaft mbH), Dr. Peter Klingenberger (Geschäftsführer<br />
N Gas Storage GmbH, EGS), Dietmar Spohn (Technischer Geschäftsführer<br />
adtwerke Bochum Holding GmbH und ewmr - Energie- und<br />
asserversorgung Mittleres Ruhrgebiet GmbH), Prof. Dr. Karl-Heinz Lux<br />
U Clausthal) und Dr. Alexander Hölzer (ewmr)<br />
genommen. Nach dem Endausbau im Oktober 2015 wird das<br />
Gesamtgasvolumen in vier Kavernen ca. 270 Mio. m³ betragen.<br />
Zurzeit stehen damit 42 Mio. m³ als Arbeitsgasvolumen<br />
zur Verfügung, Ende 2015 werden es dann ca. 205 Mio. m³<br />
sein. Während der Bauphase wurden 7 km Gasleitungen<br />
verlegt. Der Speicher ist an die Transportnetze der Open<br />
Grid Europe und der Thyssengas angeschlossen.<br />
„Die KGE arbeitet mit der E.ON Gas Storage GmbH<br />
beim Betrieb des Speichers eng zusammen. Die EGS<br />
betreibt die Kavernen, während wir die Gasmengen<br />
unserer Kunden disponieren. Wir haben zum Schutz der<br />
Landschaft und zum Vorteil der Anwohner bewusst auf<br />
den Bau einer eigenen Verdichter- und Entnahmestation<br />
verzichtet. Daher nutzen wir diesbezüglich die Anlagen<br />
der EGS”, so Dr. Bernhard Klocke, Geschäftsführer der<br />
KGBE-Kommunale Gasspeicher Beteiligungsgesellschaft<br />
mbH als persönlich haftende Gesellschafterin der KGE.<br />
Neben der Partnerschaft mit der EGS ist die KGE<br />
selbst ein partnerschaftliches Projekt der vier Anteilseigner<br />
ewmr - Energie- und Wasserversorgung Mittleres<br />
Ruhrgebiet GmbH, Dortmunder Energie- und Wasserversorgung<br />
GmbH (DEW21), Stadtwerke Essen AG und<br />
GELSENWASSER AG. Gemeinsame Ziele sind, die Versorgungssicherheit<br />
jederzeit zu gewährleisten und die Speicherkapazitäten<br />
für Handelsaktivitäten zur Verfügung zu stellen.<br />
rung der<br />
bahnlinie<br />
ottgers<br />
Bauarbeiten an Erdgasfernleitung<br />
Sannerz-Rimpar beendet<br />
Die Erdgasfernleitung<br />
von Sannerz nach Rimpar<br />
ist vollständig fertiggestellt.<br />
Die bisher noch<br />
offenen Baumaßnahmen<br />
zur Eisenbahnunterquerung<br />
bei Mottgers sind<br />
beendet. Die Pipeline ist in Betrieb und zum Erdgastransport<br />
bereit. Im März dieses Jahres wurde mit dem Bau der etwa 67<br />
km langen Erdgasfernleitung mit einem Durchmesser von etwa<br />
1 m und einem Betriebsdruck von 100 bar begonnen. Mit der<br />
Leitung können nach Fertigstellung bis zu 2 Millionen m³<br />
pro Stunde transportiert werden. Insgesamt hat Open Grid<br />
Europe rund 125 Millionen Euro in die Leitung und den Neubau<br />
einer Gasdruckmess- und Regelanlage in Rimpar investiert.<br />
„Früher als geplant konnten die Bauarbeiten an der Eisenbahnunterquerung<br />
bei Mottgers beendet werden“, freut sich Projektleiter<br />
André Graßmann von Open Grid Europe und bedankt<br />
sich bei den Anwohnern für die Geduld und das aufgebrachte<br />
Verständnis, da die Arbeiten zum Teil rund um die Uhr erfolgten.<br />
Für die im Microtunnelverfahren mit Produktrohrvortrieb<br />
durchgeführte Unterquerung der Eisenbahnlinie waren erhebliche<br />
Tiefbauarbeiten erforderlich. Hierzu musste eine ca. 100 m<br />
lange Bohrung in Buntsandstein durchgeführt werden. Für die<br />
in ca. 22 m Tiefe liegende Startgrube wurden hierbei etwa<br />
20.000 m³ Fels abgetragen.<br />
Die noch offenen Rekultivierungs- und Restarbeiten werden<br />
je nach Wetterlage jetzt noch durchgeführt beziehungsweise<br />
im Frühjahr des nächsten Jahres fortgesetzt.<br />
Die Leitung „Sannerz-Rimpar“, die auf Grund der Open<br />
Season in 2008 errichtet wurde, ist als so genannter „Loop“<br />
weitgehend parallel zu der bestehenden Leitung „Rimpar-<br />
Schlüchtern“ verlegt worden und dient unter anderem der<br />
Versorgung regionaler Abnehmer (Stadtwerke, Industriebetriebe)<br />
in Bayern und Hessen. Die Leitung ist eine wichtige<br />
Verbindung im europäischen Erdgastransportnetz. Mit<br />
den zusätzlichen Nord-Süd-Kapazitäten baut Open Grid<br />
Europe Netzengpässe ab und verbessert damit sowohl<br />
den innerdeutschen als auch den grenzüberschreitenden<br />
Transport.<br />
956 12 / 2012
Startschuss für Neubau von Hauff-Technik<br />
Die Veranstaltung war unspektakulär und blieb nahezu<br />
unbemerkt von den Bürgern – und doch war der 17.<br />
Oktober ein ganz besonderer Tag: Mit dem ersten Spatenstich<br />
für den Neubau der Firma Hauff-Technik fiel der<br />
Startschuss für die bisher größte Industrieansiedlung in<br />
der Geschichte Hermaringens.<br />
Bürgermeister Jürgen Mailänder unterstrich die große<br />
Bedeutung, die das geplante Werk mit 160 Mitarbeitern<br />
für seine Gemeinde habe. Sowohl hinsichtlich zu erwartender<br />
Gewerbesteuereinnahmen, als auch im Hinblick<br />
auf eventuelle Neubürger. Er erinnere sich noch gut an<br />
den überraschenden Anruf, als Hauff anfragte, ob er drei<br />
Hektar Land anzubieten habe, erzählte der Bürgermeister.<br />
„Habe ich nicht, beschaffe ich aber“, sei seine spontane<br />
Antwort gewesen. Das sei wohl eine Situation, in die ein<br />
„Landschulte“ wie er nicht allzu häufig in seinem Berufsleben<br />
gerate.<br />
Mit dem neuen Standort Hermaringen wachse nun endlich<br />
zusammen, was zusammen gehöre, betonte Hauff-<br />
Geschäftsführer Dr. Michael Seibold im Hinblick auf die drei<br />
Standorte, auf die sich die Firma derzeit verteilt. Über 50<br />
Jahre nach ihrer Gründung habe Hauff nun die Chance, sich<br />
quasi noch einmal neu zu gründen.<br />
Spatenstich für den Hauff-Neubau<br />
Einen „gut zweistelligen Millionenbetrag“ werde man in<br />
den Neubau investieren, hieß es gestern seitens der Indus-<br />
Holding AG, zu der Hauff seit 1986 gehört. Der Hauff-Jahresumsatz<br />
wird mit rund 36 Millionen Euro angegeben. So<br />
groß die Freude über die Neuansiedlung auch ist, ist man sich<br />
auch im Klaren darüber, dass der Neubau das Landschaftsbild<br />
erheblich verändern wird. Im Vorfeld war dieser Aspekt im<br />
Gemeinderat ausführlich besprochen worden. Neben einem<br />
zweigeschossigen Bürogebäude wird eine große Halle ent-<br />
www.fachverband-steinzeug.de<br />
Steinzeugrohre –<br />
Qualität für Generationen<br />
Steinzeugrohre –<br />
aus biologischem Anbau
NACHRICHTEN<br />
INDUSTRIE & WIRTSCHAFT<br />
egeplast mit neuer Kunststoff-Werkstatt<br />
und Rohr-Testgelände für Prüfungen<br />
Das neue egeConference-Schulungszentrum in Greven<br />
Im Praxis-Schulungsraum werden theoretische Inhalte direkt umgesetzt<br />
In den kommenden Monaten finden bei egeplast wieder<br />
zahlreiche Seminare rund um den Einsatz von Rohrsystemen<br />
aus Polyethylen und Polypropylen statt. Im neuen egeConference-Schulungszentrum<br />
und auf dem 2.000 m 2 großen<br />
Testgelände für Rohrverlegungen bei egeplast in Greven/<br />
Westfalen sind Kunststoffrohrsysteme jetzt anfassbar. So<br />
schlagen die regelmäßigen Seminarangebote die Brücke von<br />
der Theorie zur Baustellenpraxis. Die Veranstaltungen finden<br />
in einer überschaubaren Gruppengröße – je nach thematischer<br />
Ausrichtung – von 15 bis zu 50 Teilnehmern statt.<br />
Von der Ingenieurkammer-Bau Nordrhein-Westfalen ist<br />
die Mehrzahl der angebotenen Seminare als Fortbildungsveranstaltung<br />
anerkannt. Die jeweiligen Registrier-Nummern<br />
sind auf www.egeplast.de dokumentiert. Nach Abschluss des<br />
Seminars werden Teilnahmezertifikate ausgestellt und alle<br />
behandelten Seminarinhalte werden sowohl in Papierform als<br />
auch digital zum Download zur Verfügung gestellt. Zusätzlich<br />
zu den Terminen in Greven bietet egeplast auch Seminare in<br />
verschiedenen Regionen vor Ort an.<br />
Ausführliche Informationen zu den Seminarinhalten und<br />
Gebühren können auf www.egeplast.de/service-kontakt/<br />
seminare/ eingesehen werden. Eine direkte Online-Anmeldung<br />
ist möglich, außerdem werden Formulare für die Anmeldung<br />
per Fax zur Verfügung gestellt.<br />
Bayerischer Energiepreis 2012 geht an HUBER SE<br />
Bayerns Wirtschafts- und Energieminister Zeil verlieh am 18.<br />
Oktober in Nürnberg den Energiepreis 2012. Das Unternehmen<br />
HUBER SE belegte in der Kategorie Energiekonzepte und<br />
Initiativen den ersten Platz und wurde für den innovativen und<br />
verantwortungsvollen Umgang mit Energie ausgezeichnet.<br />
Zeil bezeichnete die ausgezeichneten Projekte als „Herausragende<br />
Entwicklungen für eine innovationsorientierte<br />
Energiewende“. Das CO 2<br />
-sparende Projekt „Heizwärme aus<br />
dem Abwasserkanal“, das die Huber SE in Zusammenarbeit<br />
mit der Stadt Straubing/Stadtentwässerung und der GFM<br />
beratende Ingenieure GmbH umsetzte, versorgt in Straubing<br />
102 Wohneinheiten mit rund 65 % des Wärmebedarfs über<br />
das Abwasser. Bei diesem Objekt mit guter Wärmedämmung<br />
entspricht das jährlich knapp 350.000 kWh. Ermöglicht wird<br />
diese Einsparung durch ein Verfahren, bei dem die Wärme des<br />
Abwassers – also warmes Wasser, das beim Duschen, Baden,<br />
Waschen und Spülen in die Kanalisation fließt – durch einen<br />
speziellen Wärmetauscher entzogen wird. Eine Wärmepumpe<br />
passt die Temperatur der entzogenen Abwasserwärme der<br />
benötigten Heiztemperatur der Wohnungen an. Im Vergleich<br />
zur Erd- und Grundwasserwärme punktet das Verfahren der<br />
Abwasserwärmenutzung mit ganzjährig hohen Temperaturen<br />
von mindestens 12°C.<br />
Huber erkannte die Abwasserwärme früh als Energieschatz<br />
und entwickelte im Stammhaus in Berching das in Straubing<br />
installierte ThermWin®-Verfahren. Wichtigster Bestandteil<br />
dieser zukunftsweisenden Entwicklung ist der Wärmetauscher<br />
RoWin. Er steht in direktem Kontakt mit dem kommu-<br />
958 12 / 2012
nalen Abwasser, trotz aller Unreinheiten und Störstoffe, die<br />
das Abwasser enthält. Deshalb entwickelten Ingenieure der<br />
Huber SE ein Selbstreinigungsverfahren für den Wärmetauscher<br />
RoWin, um bestmögliche Übertragungswerte liefern<br />
zu können, damit die Wirtschaftlichkeit der Gesamtanlage<br />
garantiert ist.<br />
Das Projekt läuft seit dem eisigen Winter des Jahres 2010<br />
und überzeugte gleich bei seinem ersten Härtetest mit zuverlässiger<br />
Wärmeleistung. Entscheidend für die Auszeichnung<br />
mit dem Bayerischen Energiepreis waren die Nutzung regenerativer<br />
Energiequellen und die daraus resultierende Einsparung<br />
von ca. 70 t CO 2<br />
. Der Bayerische Energiepreis wurde erstmals<br />
1999 verliehen und wird seit 2000 im Zwei-Jahres-Turnus<br />
vergeben. Die Preisträger werden durch eine unabhängige<br />
Jury von Energieexperten verschiedener bayerischer Universitäten<br />
in einem mehrstufigen Auswahlverfahren gekürt.<br />
Oberbürgermeister Pannermayr Straubing, Dr.-Ing. Ralf<br />
Mitsdörffer, Geschäftsführer GFM, Bay. Wirtschaftsminister Zeil<br />
und Georg Huber, Vorstandsvorsitzender HUBER SE (v. l. n. r.)<br />
SIMONA teilt Umsatzentwicklung innerhalb<br />
des zweiten Halbjahres 2012 mit<br />
Die Umsatzentwicklung des SIMONA-Konzerns im dritten<br />
Quartal 2012 war zufriedenstellend. Es konnten Umsatzerlöse<br />
von 78,1 Mio. EUR erzielt werden. Damit ist fast das Niveau<br />
des dritten Quartals 2011 (78,9 Mio. EUR) erreicht worden.<br />
Gegenüber dem zweiten Quartal 2012 (76,4 Mio. EUR) konnten<br />
die Umsatzerlöse um 2,2 % gesteigert werden. Insgesamt hat<br />
der Konzern bis zum 30.09.2012 Umsatzerlöse von 227,2 Mio.<br />
EUR erwirtschaftet. Aufgrund der deutlichen Umsatzrückgänge<br />
in den ersten beiden Quartalen entspricht das einem Rückgang<br />
von 5,8 % gegenüber dem Vorjahr (241,2 Mio. EUR).<br />
Ein gesunkenes Grundvertrauen der verarbeitenden Industrie<br />
und die damit verbundene nachlassende Investitionstätigkeit<br />
bestimmen weiterhin das weltweite Konjunkturumfeld.<br />
Der Absatz von Platten aus PE, PP und Fluorkunststoffen,<br />
insbesondere für den chemischen Behälter- und Apparatebau<br />
sowie die Solarindustrie, liegt daher weiterhin unter Plan.<br />
Zuwächse bei Rohren aus PE, die vorwiegend in der Wasserver-<br />
und -entsorgung eingesetzt werden, führten zu einem<br />
Plus im Produktbereich Rohre und Formteile.<br />
Die Ertragslage ist stabil, im Vergleich zum sehr guten Vorjahr<br />
aber nur bedingt zufriedenstellend. Die Rohstoffpreise sind zu<br />
Beginn des dritten Quartals zwar kurzfristig leicht gesunken,<br />
liegen zwischenzeitlich aber wieder über dem Niveau zum<br />
Halbjahr 2012. Insgesamt belasten hohe und volatile Rohstoffpreise<br />
weiter die Rohmarge. Das Ergebnis vor Ertragssteuern<br />
(EBT) für die ersten neun Monate 2012 beträgt 10,6<br />
Mio. EUR (Vorjahr 16,3 Mio. EUR) oder 4,7 % vom Umsatz<br />
(Vorjahr 6,7 %). Das EBIT beträgt 10,0 Mio. EUR (Vorjahr 16,2<br />
Mio. EUR) bzw. 4,4 % vom Umsatz (Vorjahr 6,7 %).<br />
Die Finanz- und Vermögenslage des Konzerns hat sich in den<br />
ersten neun Monaten 2012 nicht signifikant verändert. Die<br />
Liquidität im Konzern ist im Vergleich zum 31.12.2011 weiter<br />
gestiegen (3,5 Mio. EUR) und bewegt sich mit 59,9 Mio. EUR<br />
auf hohem Niveau.<br />
Die für das Gesamtjahr 2012 angestrebten Konzernumsatzerlöse<br />
von mehr als 300 Mio. EUR bei einer EBIT-Marge von 5 %<br />
werden nur bei einer unerwartet positiven Entwicklung der<br />
Weltwirtschaft im vierten Quartal zu erreichen sein.
NACHRICHTEN<br />
INDUSTRIE & WIRTSCHAFT<br />
Göttingen nutzt Biowärme für die Altstadt<br />
In der niedersächsischen Universitätsstadt Göttingen versorgen<br />
Blockheizkraftwerke (BHKW) über Fernwärmenetze<br />
Haushalte mit Bioenergie aus der Region. In Zukunft sollen die<br />
Netze Stück für Stück ausgeweitet werden. Für ihr Engagement<br />
ist die Stadt am 16. November als „Energie-Kommune“<br />
ausgezeichnet worden. Mit dem Titel würdigt die Agentur für<br />
Erneuerbare Energien vorbildliche kommunale Energieprojekte<br />
und stellt sie auf dem Infoportal www.kommunal-erneuerbar.<br />
de ausführlich vor.<br />
„Als größere Stadt sind unsere Möglichkeiten bei der Nutzung<br />
Erneuerbarer Energien natürlich eingeschränkter als<br />
auf dem Land, da uns nur begrenzt freie Flächen zur Verfügung<br />
stehen. Dafür können wir mehr über Effizienzsteigerung<br />
bewirken. In Göttingen ist uns aber wichtig, dass beides Hand<br />
in Hand geht“, erklärt Oberbürgermeister Wolfgang Meyer.<br />
„Dazu stehen wir auch im Austausch mit dem Landkreis Göttingen.<br />
Die Kooperation gibt uns zusätzliche Gestaltungsmöglichkeiten.“<br />
Die gemeinsame Energieagentur Region Göttingen<br />
vernetzt zudem Kommunen, Landwirte, Unternehmen, Bürger<br />
und die Wissenschaftler der Göttinger Universität.<br />
Auch die Göttinger Fernwärme wird zum Teil aus der<br />
Re gion versorgt: Über eine 8 km lange Leitung wird Rohbiogas<br />
aus einer Anlage im benachbarten Rosdorf nach Göttingen<br />
transportiert. Dort fließt es in drei neue 650-Kilowatt-BHKW,<br />
die an das größte Fernwärmenetz in der Innenstadt angeschlossen<br />
sind und mittels Kraft-Wärme-Kopplung Strom und<br />
Wärme erzeugen. „Das größte Potenzial für die Nutzung von<br />
Fernwärme liegt in verdichteten Innenstadtgebieten, in denen<br />
es die Erneuerbaren Energien ansonsten relativ schwer haben.<br />
Wir wollen daher die Fernwärme in der historischen Innenstadt<br />
deutlich ausbauen“, berichtet die Leiterin des städtischen<br />
Fachdienstes Klimaschutz und Energie, Dinah Epperlein.<br />
In einem Modellprojekt ließ die Stadt untersuchen, wie<br />
auch im historischen Stadtquartier am Botanischen Garten<br />
eine CO 2<br />
-freie Energieversorgung möglich ist. Das Ergebnis:<br />
Ohne Beeinträchtigung der denkmalgeschützten Dächer und<br />
Fassaden können durch Sanierungen 40 % des Wärmeverbrauchs<br />
eingespart werden. Bei einem Anschluss aller Haushalte<br />
an das Fernwärmenetz lassen sich durch ein weiteres<br />
Biogas-BHKW die restlichen Emissionen vollständig einsparen<br />
– auch im Strombereich wäre der Bedarf gedeckt. „Über die<br />
Fernwärme können wir die Erneuerbaren Energien in die Stadt<br />
hineintragen“, freut sich Epperlein.<br />
„Für die Umsetzung der Energiewende vor Ort müssen sich<br />
in dicht besiedelten Städten Energieeffizienz und Erneuerbare<br />
ergänzen“, meint Nils Boenigk, Projektleiter „Kommunal Erneuerbar“<br />
bei der Agentur für Erneuerbare Energien. „Die Energie-<br />
Kommune Göttingen nutzt effiziente Biogas-Kraftwerke,<br />
Fernwärmenetze und die gute Zusammenarbeit mit dem<br />
Landkreis, um dieser Herausforderung gerecht zu werden.“<br />
Beulco jetzt auch in Italien vertreten<br />
el Beul, Gesellschafter von Beulco, (li.) und<br />
da Bocchiola Rauhe von Co.Ra.B. srl<br />
Um weitere<br />
Schritte zur<br />
Wachstumsstrategie<br />
in<br />
Südeuropa<br />
und im Nahen<br />
Osten festzulegen,<br />
fand im<br />
Hause Beulco<br />
im September<br />
eine Handelsvertretertagung<br />
statt. Ziel<br />
dieser Tagung<br />
war, durch<br />
den Austausch<br />
wichtiger Marktinformationen effiziente Maßnahmen für<br />
den Ausbau der Marktposition in den jeweiligen Ländern<br />
zu definieren. Für den Verbindungstechnikhersteller sind<br />
diese Auslandsaktivitäten ein wesentlicher Bestandteil der<br />
Gesamt-Unternehmensstrategie, deshalb wird das Attendorner<br />
Unternehmen diesen Marktausbau aktiv und progressiv<br />
unterstützen.<br />
Seit dem 1. Oktober 2012 betreut das Unternehmen Co.Ra.B.<br />
srl. den italienischen Markt für Beulco. Die jahrzehntelange<br />
Erfahrung im Buntmetallgeschäft macht Co.Ra.B. zu einem idealen<br />
Partner und kompetenten Berater für die Kunden vor Ort.<br />
Ebenso wie Beulco ist Co.Ra.B. ein familiengeführtes Unternehmen,<br />
das auf Langfristigkeit und Kontinuität setzt. Von<br />
ihrer neuen Zentrale in Mailand aus koordiniert Co.Ra.B. nun<br />
die Aktivitäten für Beulco. „Mit der Etablierung einer Handelsvertretung<br />
in Italien möchten wir einen weiteren Schritt<br />
960 12 / 2012
NORMA Group AG auf solidem Wachstumskurs<br />
Die NORMA Group AG verfolgt weiter ihren soliden Kurs<br />
und hat das dritte Quartal 2012 erfolgreich abgeschlossen.<br />
Der Konzernumsatz von Januar bis September 2012 ist um<br />
5,8 % auf 467,3 Millionen Euro gestiegen (Vorjahr: 441,7<br />
Millionen Euro). Zu diesem Ergebnis haben die Übernahmen<br />
der Schweizer Connectors Verbindungstechnik AG im April<br />
2012 und der Nordic Metalblok S.r.l. in Italien im Juli 2012<br />
beigetragen. Das bereinigte betriebliche Ergebnis (bereinigtes<br />
EBITA) verbesserte sich gegenüber dem Vergleichszeitraum<br />
des vergangenen Jahres um 4,3 % auf 83,5 Millionen Euro<br />
(Vorjahr: 80,1 Millionen Euro). Die bereinigte EBITA-Marge<br />
lag bei 17,9 % und somit weiterhin auf hohem Niveau (Vorjahr:<br />
18,1 %).<br />
„Wir sind zufrieden mit dem erzielten Wachstum zum<br />
Ende des dritten Quartals. Unsere Zahlen zeugen von einem<br />
robusten Geschäftsmodell. Wir konnten insbesondere in den<br />
Regionen Amerika und Asien-Pazifik unseren Wachstumskurs<br />
fortführen“, sagt Werner Deggim, Vorstandsvorsitzender der<br />
NORMA Group. Der Auftragsbestand lag zum Ende des dritten<br />
Quartals 2012 mit 221,4 Millionen Euro leicht unter dem<br />
Vergleichswert des Vorquartals (229,3 Millionen Euro). „Wir<br />
spüren aber auch, dass das konjunkturelle Umfeld in Europa<br />
schwieriger geworden ist. Unsere Kunden sind angesichts der<br />
herausfordernden Wirtschaftslage vorsichtiger geworden und<br />
erwarten für den Rest des Jahres mehr Gegenwind. Wir haben<br />
daher unsere Prognose für 2012 angepasst.“<br />
WELTEC BIOPOWER baut 3-Megawatt-<br />
Biogasanlage in Uruguay<br />
Ein Milchpulver-Produzent aus Uruguay hat WELTEC BIOPO-<br />
WER mit dem Bau einer 3-Megawatt-Biogasanlage beauftragt.<br />
Die Bauarbeiten nördlich von Montevideo beginnen im<br />
Januar 2013. WELTEC wird in der ersten Ausbaustufe eine<br />
800-Kilowatt-Anlage, elektrisch, errichten. Bis zum Jahr 2015<br />
wird die volle Leistung von 3 MW installiert.<br />
Die Wahl fiel unter anderem aufgrund des hohen Anforderungsprofils<br />
und der erforderlichen Qualitätsstandards bei der<br />
Produktion der Milchtrockenmasse auf WELTEC BIOPOWER.<br />
Der Kunde setzt bei der Errichtung der beiden 5.000 m 3 großen<br />
Fermenter auf Edelstahl. Zudem konnte WELTEC den Auftraggeber<br />
durch ein hohes Maß an Auslandserfahrung sowie<br />
Flexibilität in der Anlagen-Erweiterung, auch im industriellen<br />
Maßstab, überzeugen. Nicht zuletzt durch den Bau großer<br />
Biomethan-Parks wie in Könnern, Sachsen-Anhalt, wurde<br />
der Investor aus Lateinamerika auf WELTEC aufmerksam. Der<br />
Unternehmer, der seine Milchprodukte für den asiatischen<br />
Markt produziert, wird die Biogasanlage auch betreiben. Dabei<br />
kann er zukünftig den Strom und die anfallende Abwärme<br />
in seinem Herstellungs- und Verpackungsprozess einsetzen.<br />
Durch die Aufzucht von rund 8.000 Milchkühen und die<br />
Produktion von Futtermitteln deckt er wesentliche Teile der<br />
gesamten Wertschöpfungskette ab. Parallel zu den folgenden<br />
Ausbaustufen der Biogasanlage soll der Bestand an Milchkühen<br />
auf rund 14.000 aufgestockt werden, sodass ausreichend<br />
Rindergülle als Substrat für die Anlage zur Verfügung steht.<br />
Die Landwirtschaft in Uruguay verfügt insgesamt über<br />
ein großes Rohstoffpotenzial für die Bioenergie-Erzeugung.<br />
Und sie hat eine große Bedeutung für die Volkswirtschaft:<br />
Immerhin knapp 10 % trägt der Sektor zum Bruttoinlandsprodukt<br />
des 3,5-Millionen-Einwohner-Staates bei. Aktuell<br />
stützt sich der Primärenergiebedarf Uruguays noch auf Erdöl.<br />
Mindestens die Hälfte des Bedarfs soll jedoch bis zum Jahr<br />
Der Kunde setzt bei der Errichtung<br />
der beiden 5.000 m 3 großen<br />
Fermenter auf Edelstahl<br />
2015 aus erneuerbaren Quellen stammen. Auch deshalb hat<br />
die Regierung in Montevideo das Ziel ausgegeben, mindestens<br />
ein Drittel des landwirtschaftlichen Abfalls energetisch<br />
zu nutzen. Dafür wurden im Jahr 2010 auch die rechtlichen<br />
Rahmenbedingungen geschaffen: Eine Einspeisevergütung<br />
soll bis 2030 für eine Anlagenpopulation mit einer Kapazität<br />
von 200 MW sorgen. Seit Mitte des Jahres 2010 können<br />
Betreiber den grünen Strom in das Netz des staatlichen Energieversorgers<br />
UTE einspeisen oder direkt an UTE veräußern.<br />
Uruguays Energiepolitik ist wegen des wachsenden Energiebedarfs,<br />
der Klimaziele und der angestrebten Unabhängigkeit<br />
von Energieimporten auf einen breiten Energiemix und die<br />
Einbindung einheimischer Energieressourcen fokussiert. Die<br />
Umsetzung dieser Strategien in Verbindung mit dem investitionsfreundlichen<br />
Umfeld bietet erfahrenen Unternehmen wie<br />
WELTEC BIOPOWER günstige Bedingungen für die Beteiligung.<br />
Somit könnte das Projekt Referenzcharakter für das Land und<br />
den Kontinent bekommen.<br />
Bild: WELTEC BioPOWER<br />
12 / 2012961
NACHRICHTEN<br />
INDUSTRIE & WIRTSCHAFT<br />
DMT übernimmt Mehrheit an der<br />
Höntzsch GmbH<br />
Aufgrund steigender Überwachungsanforderungen und<br />
einer stetigen Erhöhung des Automatisierungsgrades repräsentiert<br />
die Messtechnik derzeit einen Motor des Wachstums<br />
im Industriesektor. Seit dem Beginn des vierten Quartals<br />
2012 stellt der schwäbische Hersteller von Strömungs- und<br />
Durchflusstechnik Höntzsch und das Essener Technologieund<br />
Consultingunternehmen DMT ihre Marktkompetenz in<br />
diesem Bereich national wie international auf eine breitere,<br />
gemeinsame Basis.<br />
Die Ziele der Beteiligung liegen in der Erweiterung des<br />
Produktportfolios im Wachstumsfeld der „konfektionierten“<br />
Messtechnik. Hier soll die Entwicklung zukünftig weiter in<br />
Richtung innovativer, Engineering-basierter Lösungen für<br />
kundenspezifische Messaufgaben auf Basis selbst entwickelter<br />
und konfektionierbarer Messtechnik gehen. Mittelfristig ist<br />
eine Steigerung der Innovationspotenziale, die Realisierung<br />
von Vertriebssynergien sowie die beschleunigte Internationalisierung<br />
der Dienstleistungen beider Unternehmen angestrebt.<br />
Das Geschäftsfeld Industriesysteme der DMT vertreibt und<br />
installiert seit vielen Jahren weltweit spezialisierte industrielle<br />
Mess-, Prüf- und Überwachungssysteme. Dabei werden vorrangig<br />
Kunden aus den Branchen Energie, Rohstoffe, Chemie<br />
und Petrochemie, Stahl, Antriebstechnik sowie Fluidtechnik<br />
bedient.<br />
Höntzsch bietet hochwertige messtechnische Produkte<br />
zur Sicherstellung der Prozess- und Anlagensicherheit an. Sie<br />
erfassen den Durchfluss, Massestrom und die Strömungsgeschwindigkeiten<br />
von Gasen und Flüssigkeiten gerade auch<br />
unter schwierigen Einsatzbedingungen (hohe Temperaturen<br />
und Geschwindigkeiten, aggressive und explosive Gase, nasse<br />
und mit Partikeln beladene Gase). Kalibrierdienstleistungen im<br />
eigenen Kalibrierzentrum runden das Leistungsspektrum ab.<br />
Die Entwicklung neuer Produkte und ein Ausbau des Firmenstandorts<br />
in Waiblingen sind geplant. Die Geschäftsführung<br />
der Höntzsch GmbH wird durch Heinz-Gerd Körner,<br />
Vorsitzender der Geschäftsführung bei der DMT, verstärkt.<br />
Atlas-Copco-Mitarbeiter sammeln<br />
38.000 Euro für Wasserversorgung im Sudan<br />
28 Beschäftigte von Atlas Copco erliefen beim Essener Marathon<br />
Mitte Oktober fast 4.000 Euro für notleidende Menschen<br />
lz präsentieren die Marathonläuferinnen und -läufer ihre Medaillen<br />
Bild: Atlas Copco<br />
in Dürreregionen. Ihre Teilnahme am 50. Marathon rund um<br />
den Essener Baldeneysee machten sportliche Atlas-Copco-<br />
Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter zu einem Spendenlauf.<br />
Mit der Zusage ihrer Geschäftsleitung, für jeden<br />
zurückgelegten Kilometer zehn Euro zu spenden, erlief<br />
eine bunt gemischte Truppe in den Disziplinen Nordic<br />
Walking und Staffelmarathon mit 391 km eine Summe<br />
von 3.910 Euro: Die 17-jährige Auszubildende absolvierte<br />
die Strecke ebenso motiviert wie ihre 63-jährige<br />
kaufmännische Kollegin oder der Mittvierziger Montagetechnik-Spezialist.<br />
„Alle Teilnehmer kamen ins Ziel,<br />
einige sogar mit persönlichen Bestzeiten“, berichtet<br />
Peter Kamperhoff, EDV-Fachmann bei Atlas Copco und<br />
Schriftführer von Water for All Deutschland e. V.<br />
Insgesamt sammelten die Mitarbeiter in diesem<br />
Jahr bereits 38.000 Euro. Das Geld geht an ein Projekt<br />
zur besseren Wasserversorgung im Sudan. In der<br />
trockenen Region Kassala trägt das Projekt zu einer<br />
Regulierung der Wasserversorgung und damit zu einer<br />
gesicherten Ernährung für etwa 15.000 Haushalte bei.<br />
962 12 / 2012
Preis für neue Bekämpfungstechnologie von<br />
Wasserasseln in Trinkwasserversorgungsleitungen<br />
verliehen<br />
Mit dem bundesweit ausgeschriebenen Professor<br />
Adelbert-Seifriz-Preis vom Verein für Technologietransfer<br />
Handwerk für innovative und erfolgreich<br />
implementierte Projekte von Wissenschaft und<br />
Handwerk sind am 28. September Michael Scheideler<br />
(Scheideler Verfahrenstechnik, Haltern am See)<br />
und Priv.-Doz. Dr. Günter Gunkel (Technische Universität<br />
Berlin, Fachgebiet Wasserreinhaltung) für<br />
die Entwicklung eines neuen CO 2<br />
-Spülverfahrens<br />
ausgezeichnet worden. Diese Kooperation zwischen<br />
Scheideler und Dr. Gunkel rückt damit ein<br />
Thema in die Öffentlichkeit, das von vielen Wasserversorgern<br />
noch immer vernachlässigt wird: die<br />
biologische Trinkwasserqualität und deren Beeinflussung<br />
durch Kleinstlebewesen (Invertebraten) in<br />
TW-Verteilungssystemen.<br />
Das CO 2<br />
-Spülverfahren ist ein an der TU Berlin<br />
in Kooperation mit der Fa. Scheideler Verfahrenstechnik<br />
entwickeltes Verfahren, das es ermöglicht,<br />
Wasserasseln und andere Kleintiere aus Trinkwasserversorgungssystemen<br />
auszutragen. Diese<br />
Rohrnetzbewohner, deren natürlicher Lebensraum<br />
unsere Oberflächengewässer sind, kommen mitunter<br />
in hohen Dichten in den Versorgungsleitungen<br />
vor, ohne dass bislang eine wirksame Technologie<br />
zu deren Entfernung zur Verfügung stand. Insbesondere<br />
die Wasserasseln krallen sich an die Rohrwandung<br />
fest, wenn im Zuge einer Rohrnetzspülung<br />
die Wasserströmung steigt und entziehen sich so<br />
dem Austrag. Das von Dr. Günter Gunkel und Dipl.<br />
Ing. Michael Scheideler entwickelte und inzwischen<br />
erfolgreich implementierte Verfahren narkotisiert<br />
die Wasserasseln und anderen Invertebraten mit<br />
dem CO 2<br />
-Spülwasser, so dass sie dann direkt bei<br />
dem Spülvorgang ausgetragen werden können.<br />
Weitere Vorteile des Verfahrens sind der schonende<br />
Spülvorgang, ohne dass der Rohrbewuchs<br />
abgesprengt wird, und das nur Narkotisieren der<br />
Tiere, d.h. bei dem Spülvorgang treten keine toten<br />
Tiere auf, die Quelle für sekundäre Verkeimungen<br />
sein können (<strong>3R</strong> berichtete darüber in 12/2010).<br />
Der „Prof.-Adalbert-Seifriz-Preis für Technologietransfer<br />
im Handwerk“, auch bekannt unter dem Namen<br />
„Meister sucht Professor“ wird für erfolgreiche Transferbeispiele<br />
einer Kooperation zwischen Handwerkern und<br />
Wissenschaftlern vergeben. Der Preis wurde vom handwerk-magazin<br />
mit der Steinbeis-Stiftung ins Leben gerufen<br />
und wird vom Baden-Württembergischen Handwerkstag<br />
(BWHT), dem „Verein Technologietransfer Handwerk“ sowie<br />
Prototyp der Entwicklung eines CO 2<br />
-Generators für Rohrnetzspülungen<br />
dem Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH)<br />
unterstützt.<br />
Das nun ausgezeichnete Verfahren wurde vom Bundesministerium<br />
für Technologie und Wissenschaft im ProInno-<br />
Programm gefördert und kam in den letzten Jahren bereits<br />
bei mehreren deutschen Wasserversorgern zum Einsatz.<br />
Auch wenn Wasserasseln in Trinkwasserversorgungssys-<br />
12 / 2012963
NACHRICHTEN<br />
BÄNDE & ORGANISATIONEN<br />
rüßung der Teilmer<br />
durch Bauass.<br />
l.-Ing. Karl-Heinz<br />
(Geschäftsführer<br />
FVST)<br />
400. Fachtagung der FIHB mit der<br />
Steinzeugindustrie in Mainz<br />
Seit 61 Jahren führt die Fördergemeinschaft zur Information<br />
der Hochschullehrer für das Bauwesen e.V. (FIHB)<br />
regelmäßig Fachtagungen zur Weiterbildung der Hochschullehrer<br />
aus den Fachbereichen Architektur und Bauingenieurwesen<br />
von Hochschulen und Fachhochschulen<br />
in enger Kooperation mit der Industrie durch. Die Steinzeugrohr-Hersteller,<br />
vertreten durch den Fachverband<br />
Steinzeugindustrie e.V. (FVST), waren dabei vom ersten<br />
Jahr an ein aktiver Partner des FIHB, um Informationen<br />
über Neuentwicklungen von Produkten und Systemen zu<br />
vermitteln sowie über Neuerungen in nationalen und europäischen<br />
Normungsprozessen zu berichten. Daher war die<br />
Freude groß, gerade die 400. Seminarveranstaltung, die<br />
sich inzwischen als so genannte „Steinzeug“-Dozententagung<br />
etabliert hat, mit dem Thema „Abwasserableitung im<br />
Wandel – Ganzheitliche Lösungen für Entwässerungsnetze“<br />
gestalten zu können. Die Jubiläumstagung fand in diesem<br />
Jahr am 15. und 16. Oktober in Mainz statt.<br />
Nachhaltige Lösungen für die Zukunft<br />
Nach Eröffnung der Tagung durch den<br />
FIHB-Vorstand, Prof. Dr.- Ing. Prof. h. c.<br />
Wolfgang Krings, setzte der Geschäftsführer<br />
des FVST, Bauass. Dipl.-Ing. Karl-<br />
Heinz Flick, mit seinem Eröffnungsvortrag<br />
„Bauen mit gutem Gewissen – Hinsichtlich<br />
ökologischer Nachhaltigkeit“ den ersten<br />
Höhepunkt. Die „praktischen Auswirkungen<br />
von fachgerechtem Prüfen von<br />
Leitungen in Abwassernetzen“ standen<br />
im Fokus des Fachvortrages von Dipl.-<br />
Ing. Dietmar T. Böhme (Steinzeug-Keramo<br />
GmbH). Dem „Klimawandel – Auswirkungen<br />
auf die Bemessung von Entwässerungsnetzen“<br />
widmete sich Prof. Dr.-Ing.<br />
T.G. Schmitt von der TU Kaiserslautern.<br />
Die Konzepte des Wirtschaftsbetriebes Mainz<br />
zum „Netzbetrieb und Hochwasserschutz“ stellte<br />
Dipl.-Ing. Michael Paulus vor. Es folgten zwei Vorträge zu<br />
höchst anspruchsvollen Methoden innerhalb der Rohrvortriebstechnik<br />
von Dr.-Ing. Ulrich Bohle (Steinzeug-Keramo<br />
GmbH). Dr.-Ing. Joachim Beyert (RWTH Aachen) stellte<br />
in seinem interessanten Vortrag „Neue Möglichkeiten für<br />
Instandhaltung und Erneuerung von Leitungen der Grundstücksentwässerung“<br />
vor.<br />
Die insgesamt sieben Fachvorträge fokussierten ihre Themen,<br />
wenn auch auf unterschiedlichste Weise, so doch alle<br />
mit Blick auf Zukunftslösungen, Umweltverantwortung und<br />
Generationengerechtigkeit.<br />
Steinzeug-Hochschulinitiative<br />
Zum Abschluss der Tagung stellte Dipl.-Ing. Dietmar T.<br />
Böhme, langjähriger Organisator dieser Fachtagung, die<br />
Aktivitäten der Steinzeugindustrie zur Unterstützung der<br />
studentischen Ausbildung – die Steinzeug Hochschulinitiative<br />
– den Teilnehmern vor. So berichtete er rückblickend<br />
über den erfolgreichen Hochschultag zur IFAT 2012, an dem<br />
rund 300 Studenten mit ihren Betreuern teilnahmen. Auch<br />
bereits neue Veranstaltungen für Studierende anlässlich<br />
der WASSER BERLIN INTERNATIONAL 2013 und IFAT 2014<br />
kündigte Böhme an. Neben der Betreuung auf Messen stehen<br />
auch regelmäßige Vorlesungen an Hochschulen oder<br />
die Betreuung von Exkursionen zu den Herstellerwerken<br />
auf der Agenda der Steinzeug-Hochschulinitiative, ebenso<br />
wie die Themenvergabe und Betreuung von Bachelor- und<br />
Masterarbeiten.<br />
Traditionell gehört zu der FVST-FIHB-Dozententagung<br />
auch ein Exkursionstag. In diesem Jahr führte Dipl.-Ing.<br />
Michael Paulus in Ergänzung zu seinem praxisrelevanten Referat<br />
zum Mainzer Hochwasserschutzkonzept am zweiten Tag<br />
die Teilnehmer zur Besichtigung des „Wildgrabens“ und des<br />
„Hochwasserpumpwerkes Gasserallee“. Ebenso ist es gute<br />
Tradition, dass viele Professoren, Dozenten und Ausbilder von<br />
verschiedenen deutschen Universitäten und Fachhochschulen<br />
der Fachrichtungen Bauwesen und Siedlungswasserwirtschaft<br />
an dieser Tagung teilnehmen. Intensive Fachdiskussionen,<br />
-gespräche und zahlreiche Wortmeldungen unterstrichen<br />
deren hohes Niveau und die hohe Akzeptanz. Auch<br />
die Wahl der Referenten und die Entscheidung für das<br />
höchst aktuelle Thema „Abwasserableitungen im Wandel“<br />
erwiesen sich als attraktiv und erfolgreich.<br />
Der Fachverband Steinzeugindustrie e.V. und seine<br />
Mitgliedsfirmen werden auch zukünftig die FIHB bei<br />
ihren Weiterbildungsangeboten mit praxisorientierten<br />
Fachtagungen, Messebetreuungen und Vorlesungen<br />
unterstützen.<br />
fessoren zu Gast in Mainz<br />
964 12 / 2012
v und BFA LTB begrüßen Leitfaden der<br />
Bundesnetzagentur zur Verlegung von<br />
Glasfaserkabeln bei Arbeiten am Stromnetz<br />
In Deutschland ist der Ausbau der Glasfasernetze ins Stocken<br />
geraten, doch dabei gibt es deutliche regionale Unterschiede:<br />
Während einige Telekommunikationsunternehmen ihre<br />
Glasfaser netze in Städten wie München, Köln oder Hamburg<br />
ausbauen, ist es um die Verfügbarkeit in ländlichen Regionen<br />
wesentlich schlechter bestellt. Dabei ist ein modernes und leistungsstarkes<br />
Netz für die Informations gesellschaft von morgen<br />
und den damit verbundenen digitalen Lebensstil nötig –<br />
hierin sind sich die Fachleute einig.<br />
Doch jetzt ist Bewegung in den Ausbau des Glasfasernetzes<br />
in Deutschland gekommen. Mit dem Leitfaden für die Verlegung<br />
von Glasfaserkabeln oder Leerrohren bei notwendigen Arbeiten<br />
am Stromnetz hat die Bundesnetzagentur im August dieses<br />
Jahres den Stein ins Rollen gebracht. Durch das gleichzeitige<br />
Verlegen von Stromleitungen und Glasfaserkabeln<br />
für die Erweiterung der Telekommunikations infrastruktur sollen<br />
Synergien gehoben und der Breitbandausbau beschleunigt<br />
werden. Dieser Ansatz wird von Rohrleitungsbauverband<br />
e. V. (rbv) und Bundesfachabteilung Leitungsbau (BFA LTB)<br />
unterstützt: Die Leitungsbauunternehmen können von einem<br />
Ausbau des Netzes nur profitieren – egal, ob in Form von<br />
Dienstleistern, die mit Jahresverträgen für Serviceleistungen<br />
ausgestattet sind, oder als Fachfirmen, die die erforderlichen<br />
Bauleistungen erbringen.<br />
Internetverkehr steigt konstant<br />
Der Bedarf an modernen Übertragungsnetzen lässt sich mit<br />
beeindruckenden Zahlen verdeutlichen: Der Internetverkehr<br />
steigt jedes Jahr konstant um 50%, verdoppelt sich alle 21<br />
Monate und verzehnfacht sich etwa alle sechs Jahre, das<br />
haben einschlägige Untersuchungen ergeben. Die Spitzenlasten<br />
haben sich von 2009 zu 2010 verdreifacht. Dabei bewegt<br />
sich die Nachfrage deutlich zu höher-bitratigen Produkten.<br />
Alle Technologien, die hohe Bitraten zum Teilnehmer ausliefern,<br />
benötigen eine Glasfaserinfrastruktur. Doch das ist in<br />
erster Linie teuer. Die Kosten für einen entsprechenden Ausbau<br />
des Glasfasernetzes beziffern Fachleute mit rund 65 Mrd. Euro.<br />
An dieser Stelle will der von der Bundesnetzagentur<br />
herausgegebene Leitfaden Anreize geben. Der zehnseitige<br />
Leitfaden sieht grundsätzlich zwei Modelle vor, unter denen<br />
eine gleichzeitige Verlegung stattfinden kann. In Variante 1<br />
kann ein Stromnetzbetreiber beispielsweise Glasfaserkabel<br />
im Auftrag eines Telekommunikationsanbieters mitverlegen.<br />
Der Telekommunikationsanbieter beteiligt sich dann anteilig<br />
an den anfallenden Tiefbaukosten. Diese machen häufig 80 %<br />
der Ausbaukosten für Glasfaser aus.<br />
Sowohl für den Stromnetzbetreiber als auch für den Telekommunikationsanbieter<br />
sinken beim gemeinsamen Ausbau im<br />
Vergleich zu einer separaten Verlegung der Kabel die Kosten<br />
für die nötigen Tiefbauarbeiten. Der Stromnetzbetreiber kann<br />
auch auf eigene Rechnung Glasfaserkabel mitverlegen. Bei<br />
dieser zweiten Variante werden die nicht durch den Stromnetzbetreiber<br />
im Rahmen des eigenen Netzbetriebs genutzten<br />
Kapazitäten der Kabel dann vermarktet, wobei künftige Vermarktungserlöse<br />
beim Stromnetzbetreiber kostenmindernd<br />
wirken – so die Grundideen, die hinter den Modellen stecken.<br />
Das Ziel ist klar: Die ambitionierten Ziele der Breitbandstrategie<br />
der Bundesregierung sollen möglichst schnell umgesetzt<br />
werden, das Mitverlegen von Glasfaserkabeln oder Leerrohren<br />
durch die Stromnetzbetreiber dabei einen wichtigen Beitrag<br />
leisten. Der Leitfaden thematisiert insbesondere die Frage, ob<br />
und wie die dabei entstehenden Kosten der Stromnetzbetreiber<br />
im Rahmen der Anreizregulierung berücksichtigt werden.<br />
Gleichzeitig will er den investierenden Unternehmen Klarheit<br />
und Sicherheit über die Konditionen des Ausbaus geben. Von<br />
Seiten der Bundesnetzagentur hofft man, dass die bestehenden<br />
Möglichkeiten intensiv genutzt werden. Dabei kommt den<br />
örtlichen Versorgern eine Schlüsselrolle zu. Nach einer aktuellen<br />
Erhebung sollen sich von 980 Versorgern bereits 150 für eine<br />
Beteiligung an der Erschließung entschieden, bzw. sich damit<br />
beschäftigt und Planungen auf den Weg gebracht haben.<br />
Leitungsbauer müssen sich vorbereiten<br />
Das wertet man bei rbv und BFA LTB als Schritt in die<br />
richtige Richtung. Werden die Netze weiter ausgebaut,<br />
können Leitungsbauunternehmen davon nur profitieren.<br />
Zum Beispiel als Dienstleister, die mit Jahresverträgen für<br />
Serviceleistungen ausgestattet sind, oder als Fachfirmen,<br />
die die erforderlichen Bauleistungen erbringen. Das setzt<br />
umfangreiches Fachwissen voraus. Nicht jeder, der fachgerecht<br />
Rohre verlegen kann, kennt sich auch mit der Breitbandtechnologie<br />
aus. Doch genau hierauf müssen sich die<br />
Leitungsbauer einstellen und ihr Leistungsspektrum erweitern.<br />
Verband und Bundesfachabteilung weisen in diesem<br />
Zusammenhang auf die vielfältigen Qualifikationsmöglichkeiten<br />
hin, die unter anderem vom Berufsförderungswerk<br />
des Rohrleitungsbauverbandes (brbv) angeboten werden.<br />
Mit vielfältigen Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten in<br />
den Sparten Gas/Wasser, Fernwärme, Kanalbau, Kabelbau<br />
– Strom, Industrierohrleitungsbau und Telekommunikation<br />
stellt das Berufsförderungswerk den Leitungsbauunternehmen<br />
das notwendige Rüstzeug zur Verfügung, um den<br />
Anforderungen eines im Wandel befindlichen Marktes in<br />
jeder Beziehung gerecht zu werden.<br />
Informationen sowie den „Leitfaden für die Verlegung von<br />
Glasfaserkabeln bei Arbeiten am Stromnetz“ finden Sie<br />
auf den Internetseiten der Bundesnetzagentur oder unter<br />
www.<strong>3R</strong>-Rohre.de zum Download.<br />
12 / 2012965
NACHRICHTEN<br />
RSV- AKTUELL<br />
„Kompetenz nach DIN“ für die Grundstücksentwässerung<br />
Mangelhafte Dienstleistungen und unseriöses Gebaren durch<br />
„Kanalhaie“ werden oft und gern beklagt, wenn über die Dichtheitsprüfung<br />
und Sanierung von Grundstücksentwässerungen<br />
diskutiert wird. Gemeinsam hat DIN CERTCO mit dem<br />
Verband der Rohr- und Kanaltechnik-Unternehmen (VDRK)<br />
e.V. und dem RSV-Rohrleitungssanierungsverband e.V. die<br />
DIN-Zertifizierung zum „DIN-geprüften Fachbetrieb für die<br />
Bestandsaufnahme, Beratung und Sanierung von Grundstücksentwässerungsanlagen“<br />
entwickelt.<br />
Die neue, erstmals der Öffentlichkeit vorgestellte Zertifizierung<br />
schafft mit dem DIN-Zertifikat (Bild) für alle Fachbetriebe<br />
der Sanierung von Grundstücksentwässerungsanlagen<br />
ein einheitliches, nachvollziehbares und dem Stand der<br />
Technik entsprechendes Qualitätsniveau. Das ist nicht nur ein<br />
entscheidendes Argument „pro Qualität“. Der DIN-geprüfte<br />
Fachbetrieb gibt auch Orientierung in dem Dschungel der<br />
verschiedenen Zertifikate und Gütezeichen, die rund um die<br />
Grundstücksentwässerung in den vergangenen Jahren entstanden<br />
sind.<br />
Die in Kooperation mit den beiden praxisnahen Fachverbänden<br />
und DIN CERTCO geschaffenen DIN-Zertifikate sollen für<br />
mehr Transparenz und Vertrauen sorgen. Die klare Botschaft<br />
an den Grundstückseigentümer lautet: Das DIN-Zeichen steht<br />
für eine seriöse, qualifizierte Dienstleistung zur Bestandsaufnahme<br />
und Sanierung von Grundstücksentwässerungsanlagen.<br />
Nur die neuen DIN-geprüften Fachbetriebe sind berechtigt,<br />
das Qualitätszeichen von DIN CERTCO zu führen und werblich<br />
zu nutzen. Alle zertifizierten Fachbetriebe können tagesaktuell<br />
auf der Internetseite von DIN CERTCO abgerufen werden. Der<br />
einfachste Weg des Grundstückseigentümers zu Qualität und<br />
Sicherheit ist aber zweifellos, schon vor der Einholung von<br />
Angeboten einfach das DIN-Zertifikat „Geprüfter Fachbetrieb<br />
für die Bestandsaufnahme, Beratung und Sanierung von<br />
Grundstücksentwässerungsanlagen“ anzufordern.<br />
Das neue Zeichen für Qualität und Seriosität in der Grundstücksentwässerung:<br />
Das Logo „DIN-geprüfter Fachbetrieb<br />
für die Bestandsaufnahme, Beratung und Sanierung von<br />
Grundstücksentwässerungsanlagen“<br />
»KONTAKT: DIN CERTCO, Bonn, Gerd Niedree,<br />
Tel. +49 228 9267775, E-Mail: Gerd.Niedree@dincertco.de<br />
RSV-Rohrleitungssanierungsverband e.V, Lingen/Ems,<br />
Horst Zech, Tel. +49 5963 9810877, E-Mail: rsv-ev@t-online.de<br />
VDRK – Verband der Rohr- und Kanal-Technik-Unternehmen e. V.,<br />
Kassel, Gerhard Treutlein, Tel. +49 561 207567 0,<br />
E-Mail: info@vdrk.de<br />
Mehr Informationen<br />
für interessierte<br />
Fachunternehmen<br />
Der neuberufene RSV-Beirat<br />
Am 13. September 2012 trafen sich der RSV-Vorstand, die<br />
RSV-Geschäftsführung und die künftigen Mitglieder des neu ins<br />
Leben gerufenen Beiratsgremiums zur konstituierenden Sitzung<br />
in Braunlage. Die Einrichtung dieses Gremiums wurde auf der<br />
letzten RSV-Mitgliederversammlung Anfang 2012 in Oldenburg<br />
beschlossen.<br />
Das Gremium besteht aus unabhängigen, nicht dem RSV<br />
angehörigen Fachleuten, deren Aufgabe darin besteht, den<br />
Vorstand und die Geschäftsführung des RSV in allen Verbandsfragen<br />
beratend zu unterstützen.<br />
Mitglieder des Beirats sind Dipl.-Ing. (FH) Jochen Bärreis,<br />
Nürnberg, Dipl.-Ing. (FH) Nico Hülsdau, Vulkan-Verlag GmbH,<br />
Essen, Dipl.-Ing. Karsten Messer, hanseWasser Bremen GmbH,<br />
Bremen, Dipl.-Ing. Andreas Schreiber, Deutsche Bahn AG, Berlin,<br />
Dipl.-Ing. Peter Sczepanski, Budapester Kanalisationswerke<br />
AG, Budapest, Dr.-Ing. Hans-Christian Sorge, IWW Rheinisch-<br />
Westfälisches Institut für Wasser, Biebesheim am Rhein sowie<br />
Prof. Dipl.-Ing. Thomas Wegener, Jade Hochschule, Oldenburg.<br />
Zum Vorsitzenden des Beirats wurde von den Anwesenden<br />
Herr Andreas Schreiber gewählt, die Stellvertretung übernimmt<br />
Nico Hülsdau. Die erste offizielle Sitzung des Beirats<br />
fand am 14. November 2012 in Berlin statt.<br />
966 12 / 2012
JOCHEN BÄRREIS<br />
Derzeit ist Jochen Bärreis Prokurist und<br />
Generalbevollmächtigter für Sonderaufgaben<br />
im Bereich Unternehmensgründung<br />
bei der Diringer & Scheidel<br />
GmbH & Co. Beteiligungsgesellschaft<br />
KG in Mannheim sowie Generalbevollmächtigter<br />
der Swisstec Holding, Schweiz. Außerdem ist er<br />
tätig als Niederlassungsleiter bei der hkc Hackmann + Kollath<br />
Ingenieur-Consult GmbH in Nürnberg.<br />
Nach dem Bauingenieursstudium 1986 (Vertiefungsrichtung:<br />
Wasserbau) arbeitete Bärreis zunächst als Bauleiter,<br />
später als Oberbauleiter bei der Brochier GmbH in Nürnberg.<br />
1993 wurde er dort Zweigniederlassungsleiter und übernahm<br />
anschließend den Geschäftsführerposten von Brochier in der<br />
Slowakei und Tschechien, bevor er 1997 zum Prokuristen<br />
ernannt wurde. Von 1999 bis 2010 war Bärreis Geschäftsführer<br />
der Diringer & Scheidel Rohrsanierung GmbH & Co. KG<br />
und damit verantwortlich für 250 Mitarbeiter in elf Niederlassungen<br />
und zwei Beteiligungsgesellschaften.<br />
Dipl.-Ing. (FH) Jochen Bärreis<br />
Diringer&Scheidel GmbH & Co.<br />
Beteiligungsgesellschaft KG, Nürnberg<br />
E-Mail: jochen@baerreis.de<br />
NICO HÜLSDAU<br />
Nach seinem Studium an der FH Münster<br />
mit Schwerpunkt Versorgungstechnik<br />
begann Nico Hülsdau 1996 im Vulkan-Verlag.<br />
Dort übernahm er zunächst<br />
die Betreuung der Fachzeitschriften <strong>3R</strong><br />
und Gaswärme International. Seit 2009<br />
ist er als Programmbereichsleiter für Fachliteratur und Veranstaltungen<br />
zum Thema Rohrleitungstechnik verantwortlich.<br />
Hierzu gehören neben der Fachzeitschrift <strong>3R</strong> auch Buchtitel<br />
wie der IRO-Tagungsband und der IRO-Ausstellungsführer<br />
sowie der Praxistag Korrosionsschutz.<br />
Dipl.-Ing. (FH) Nico Hülsdau<br />
Vulkan Verlag GmbH, Essen<br />
E-Mail: n.huelsdau@vulkan-verlag.de<br />
KARSTEN MESSER<br />
Karsten Messer ist seit Oktober 1992<br />
bei der hanseWasser Bremen GmbH<br />
und ihren Vorgänger-Organisationen<br />
beschäftigt. Als Teamleiter Ingenieurdienste<br />
Netz liegt Messers Schwerpunkt<br />
auf der Abwicklung von Kanalbaumaßnahmen<br />
in offener und geschlossener Bauweise, der<br />
Erarbeitung und Pflege von Teilleistungskatalogen für Neubau<br />
und Sanierung sowie vertragliche Grundlagen (VOB und<br />
Verdingungsunterlagen).<br />
Dipl.-Ing. Karsten Messer<br />
hanseWasser Bremen GmbH<br />
E-Mail: messer@hansewasser.de<br />
ANDREAS SCHREIBER<br />
Andreas Schreiber studierte Maschineningenieurwesen<br />
und Konstruktionstechnik<br />
an der TU Dresden und<br />
arbeitete von 1990 bis 1996 als Konstrukteur<br />
im Ingenieurbüro bei der<br />
Deutsche Reichsbahn/Deutsche Bahn<br />
AG. Von 1996 bis 2001 war er bei der Deutsche Bahn AG,<br />
DB Anlagen- und Hausservice GmbH Produktmanager/Leiter<br />
Ingenieurbüro Umweltschutz. Seit 2002 bis heute ist Schreiber<br />
verantwortlich für die Umsetzung eines systematischen<br />
Programms zur Erfassung, Optimierung, Inspektion, Bewertung<br />
und Sanierung von Grundstücksentwässerungsanlagen<br />
der Deutschen Bahn AG in ganz Deutschland.<br />
Bei der DWA-Regelwerksarbeit hat er an den Merkblättern<br />
M 771 „Abwässer aus der Wäsche, Instandhaltung und Pflege<br />
von Fahrzeugen“ und M 190 „Eignung von Unternehmen für<br />
die Herstellung, baulichen Unterhalt, Sanierung und Prüfung<br />
von Grundstücksentwässerungsanlagen mitgewirkt.<br />
Dipl.-Ing. Andreas Schreiber<br />
Deutsche Bahn AG, Berlin<br />
E-Mail: Andreas.Schreiber@deutschebahn.com<br />
12 / 2012967
NACHRICHTEN<br />
RSV- AKTUELL<br />
PETER SCZEPANSKI<br />
Seit 1986 ist der studierte Diplomingenieur<br />
(Wasserbau) bei den Berliner<br />
Wasserbetrieben (ehem. VEB Wasserversorgung<br />
und Abwasserbehandlung<br />
Berlin) tätig. Bis 1997 leitete er die<br />
Rohrnetzbetriebsstelle Mitte im Zentrum<br />
Berlins mit 125 Mitarbeitern und war verantwortlich<br />
für Bau, Betrieb und Instandhaltung der Wasserverteilnetze<br />
sowie für den Entstörungsdienst für Berlin.<br />
2009 entsandte ihn die Berlinwasser International AG nach<br />
Ungarn zu den Budapester Kanalisationswerken. Dort ist er<br />
als Technischer Direktor u. a. verantwortlich für den Betrieb<br />
und die Instandhaltung des Budapester Kanalsystems, der ca.<br />
180 Pumpstationen, sowie der zwei Kläranlagen.<br />
Peter Sczepanski ist seit vielen Jahren Mitglied des Technischen<br />
Komitees „Wassertransport und –verteilung“ des<br />
DVGW. Er leitet den ständigen DVGW-Projektkreis „Grabenlose<br />
Bauweisen“ und ist Mitglied weiterer DVGW-Projektkreise.<br />
Dipl.-Ing. Peter Sczepanski<br />
Budapester Kanalisationswerke AG, Budapest<br />
E-Mail: sczepanskip@fcsm.hu<br />
DR. CHRISTIAN SORGE<br />
Nach der Ausbildung als Facharbeiter<br />
Straßenbau, studierte Sorge Bauingenieurwesen<br />
in Erfurt und Weimar (mit<br />
den Vertiefungsrichtungen Verkehr/<br />
Wasser/Umwelt und Siedlungswasserwirtschaft).<br />
Er promovierte in Weimar,<br />
das Thema seiner Dissertation: „Materialtechnische Zustandsbewertung<br />
von metallischen Trinkwasserleitungen als Beitrag<br />
zur Rehabilitationsplanung“.<br />
Der Ingenieur für Wasserversorgung Dr. Sorge ist am IWW<br />
Zentrum Wasser tätig. Am Regionalstandort Rhein-Main ist er<br />
stellvertretender Bereichsleiter Wassernetze. Er berät Wasserversorgungsunternehmen<br />
und Institute, koordiniert und<br />
bearbeitet nationale und europäische Forschungsvorhaben.<br />
Zudem erstellt er Instandhaltungskonzepte für Transportleitungssysteme<br />
sowie materialtechnische Zustandsbewertungs-<br />
und Nutzungsdauerprognosen.<br />
Dr.-Ing. Hans-Christian Sorge<br />
IWW Rheinisch-Westfälisches Institut für Wasserforschung<br />
gemeinnützige GmbH, Zentrum Wasser Regionalstandort Rhein-<br />
Main, Biebesheim<br />
E-Mail: c.sorge@iww-online.de<br />
PROF. THOMAS WEGENER<br />
Nach seinem Bauingenieur-Studium<br />
begann Thomas Wegener 1983 seine<br />
berufliche Laufbahn im Tief- und<br />
Rohrleitungsbau bei der Unternehmensgruppe<br />
Ludwig Freytag und war<br />
nach kurzer Zeit mit der Bauleitung<br />
zunächst im Inland, später auch im Ausland betraut. Nach<br />
dem Ergänzungsstudium zum Schweißfachingenieur an der<br />
SLV Hannover 1984 wickelte er zahlreiche Baumaßnahmen<br />
in Dänemark ab. 1989 übernahm er die Betriebsleitung der<br />
Beteiligungsgesellschaft Asphaltbau Henning GmbH & Co.<br />
KG in West-Berlin. Mit der Rückkehr zu Ludwig Freytag 1991<br />
wurde er Abteilungsleiter im Fernleitungsbau mit Einstieg in<br />
den Großrohrleitungsbau. Seit Beginn 1994 bis zum Ausscheiden<br />
1999 war er als Niederlassungsleiter in Deutschland und<br />
Europa für Ludwig Freytag tätig. Im Frühjahr 1999 wurde er<br />
zum Professor für Baubetrieb an die Fachhochschule Oldenburg<br />
berufen. Seit September 2001 ist er Geschäftsführer<br />
der iro GmbH Oldenburg, im Juni 2003 wurde er in den iro-<br />
Vorstand gewählt.<br />
Prof. Dipl.-Ing. Thomas Wegener<br />
Jade Hochschule, Oldenburg<br />
E-Mail: wegener@iro-online.de<br />
968 12 / 2012
RsV-Regelwerke<br />
RSV Merkblatt 1<br />
renovierung von entwässerungskanälen und -leitungen<br />
mit vor Ort härtendem Schlauchlining<br />
2011, 48 Seiten, DIN A4, broschiert, € 35,-<br />
RSV Merkblatt 2<br />
renovierung von Abwasserleitungen und -kanälen mit<br />
rohren aus thermoplastischen Kunststoffen durch<br />
Liningverfahren ohne ringraum<br />
2009, 38 Seiten, DIN A4, broschiert, € 29,-<br />
RsV Merkblatt 2.2<br />
renovierung von Abwasserleitungen und -kanälen mit<br />
vorgefertigten rohren durch TIP-Verfahren<br />
2011, 32 Seiten DIN A4, broschiert, € 29,-<br />
RsV Merkblatt 3<br />
renovierung von Abwasserleitungen und -kanälen durch<br />
Liningverfahren mit ringraum<br />
2008, 40 Seiten, DIN A4, broschiert, € 29,-<br />
RsV Merkblatt 4<br />
reparatur von drucklosen Abwässerkanälen und<br />
rohrleitungen durch vor Ort härtende Kurzliner (partielle Inliner)<br />
2009, 20 Seiten, DIN A4, broschiert, € 29,-<br />
RsV Merkblatt 5<br />
reparatur von entwässerungsleitungen und Kanälen<br />
durch roboterverfahren<br />
2007, 22 Seiten, DIN A4, broschiert, € 27,-<br />
RsV Merkblatt 6<br />
Sanierung von begehbaren entwässerungsleitungen und<br />
-kanälen sowie Schachtbauwerken - Montageverfahren<br />
2007, 23 Seiten, DIN A4, broschiert, € 29,-<br />
RsV Merkblatt 6.2<br />
Sanierung von Bauwerken und Schächten<br />
in entwässerungssystemen<br />
2012, 41 Seiten, DIN A4, broschiert, € 35,-<br />
RsV Merkblatt 7.1<br />
renovierung von drucklosen Leitungen /<br />
Anschlussleitungen mit vor Ort härtendem Schlauchlining<br />
2009, 30 Seiten, DIN A4, broschiert, € 29,-<br />
RsV Merkblatt 7.2<br />
Hutprofiltechnik zur einbindung von Anschlussleitungen –<br />
reparatur / renovierung<br />
2009, 31 Seiten, DIN A4, broschiert, € 30,-<br />
RsV Merkblatt 8<br />
erneuerung von entwässerungskanälen und -anschlussleitungen<br />
mit dem Berstliningverfahren<br />
2006, 27 Seiten, DIN A4, broschiert, € 29,-<br />
RsV Merkblatt 10,<br />
Kunststoffrohre für grabenlose Bauweisen<br />
2008, 55 Seiten, DIN A4, broschiert, € 37,-<br />
RsV information 11<br />
Vorteile grabenloser Bauverfahren für die erhaltung und<br />
erneuerung von Wasser-, Gas- und Abwasserleitungen<br />
2012, 42 Seiten DIN A4, broschiert, € 9,-<br />
Auch als<br />
eBook<br />
erhältlich!<br />
www.vulkan-verlag.de<br />
Jetzt bestellen!<br />
Wissen für DIe<br />
Zukunft<br />
faxbestellschein an: +49 201 / 82002-34 Deutscher Industrieverlag oder GmbH abtrennen | Arnulfstr. und 124 im | fensterumschlag 80636 München einsenden<br />
Ja, ich / wir bestelle(n) gegen rechnung:<br />
___ ex. rSV-M 1 € 35,-<br />
___ ex. rSV-M 2 € 29,-<br />
___ ex. rSV-M 2.2 € 29,-<br />
___ ex. rSV-M 3 € 29,-<br />
___ ex. rSV-M 4 € 29,-<br />
___ ex. rSV-M 5 € 27,-<br />
___ ex. rSV-M 6 € 29,-<br />
Ich bin rSV-Mitglied und erhalte 20 % rabatt<br />
auf die gedruckte Version (Nachweis erforderlich!)<br />
___ ex. rSV-M 6.2 € 35,-<br />
___ ex. rSV-M 7.1 € 29,-<br />
___ ex. rSV-M 7.2 € 30,-<br />
___ ex. rSV-M 8 € 29,-<br />
___ ex. rSV-M 10 € 37,-<br />
___ ex. rSV-I 11 € 9,-<br />
zzgl. Versandkosten<br />
firma/Institution<br />
Vorname, Name des empfängers<br />
Straße / Postfach, Nr.<br />
Land, PLZ, Ort<br />
Telefon<br />
Telefax<br />
Antwort<br />
Vulkan-Verlag GmbH<br />
Versandbuchhandlung<br />
Postfach 10 39 62<br />
45039 Essen<br />
e-Mail<br />
Branche / Wirtschaftszweig<br />
Bevorzugte Zahlungsweise Bankabbuchung rechnung<br />
Bank, Ort<br />
Widerrufsrecht: Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B.<br />
Brief, fax, e-Mail) oder durch rücksendung der Sache widerrufen. Die frist beginnt nach erhalt dieser Belehrung in Textform.<br />
Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache an die Vulkan-Verlag GmbH,<br />
Versandbuchhandlung, Huyssenallee 52-56, 45128 essen.<br />
Bankleitzahl<br />
Ort, Datum, Unterschrift<br />
Kontonummer<br />
nutzung personenbezogener Daten: für die Auftragsabwicklung und zur Pflege der laufenden Kommunikation werden personenbezogene Daten erfasst und gespeichert. Mit dieser Anforderung erkläre ich mich damit einverstanden, dass ich<br />
von DIV Deutscher 12 / Industrieverlag<br />
2012969<br />
oder vom Vulkan-Verlag per Post, per Telefon, per Telefax, per e-Mail, nicht über interessante, fachspezifische Medien und Informationsangebote informiert und beworben werde.<br />
Diese erklärung kann ich mit Wirkung für die Zukunft jederzeit widerrufen.<br />
✘<br />
XfrSVM1212
NACHRICHTEN<br />
VERANSTALTUNGEN<br />
INDUSTRIE & WIRTSCHAFT<br />
ferenten<br />
und<br />
isatoren<br />
bei den<br />
rnberger<br />
lloquien:<br />
(v.l.n.r.)<br />
r. Robert<br />
Thoma,<br />
e Scholl,<br />
Stephan<br />
Reder,<br />
Burkard<br />
agspiel,<br />
Jörg<br />
unecker,<br />
Claudia<br />
harnagl,<br />
. Werner<br />
Krick,<br />
tin Güth,<br />
r. Ursula<br />
umeister<br />
Große Resonanz bei Nürnberger Kolloquien<br />
zur Kanalsanierung<br />
Zum diesjährigen Kolloquium zur Kanalsanierung am <strong>27.</strong> September<br />
unter dem Motto „Grundstücksentwässerung und<br />
Baustellen mit besonderer Herausforderung“ kamen über 175<br />
Bauingenieure, Techniker und Entscheidungsträger aus Kommunen<br />
und Industrie nach Nürnberg. Im Fokus der Veranstaltung<br />
stand die aktuelle bayerische Mustersatzung zur Grundstücksentwässerung.<br />
Es ging unter anderem um deren kritische<br />
Betrachtung, die Herausforderungen der Grundstücksentwässerung<br />
für Wohnungsbauunternehmen und die speziellen<br />
Anforderungen bei industriellen Liegenschaften. Außerdem<br />
kamen die technischen Grundlagen der Dichtheitsprüfung nach<br />
der neuen DIN 1986-30 und die besonderen Anforderungen<br />
an Sanierungsbaustellen zur Sprache. Veranstalter der jährlich<br />
stattfindenden Kolloquien ist die Verbund IQ gGmbH mit ihren<br />
Partnern Georg-Simon-Ohm-Hochschule Nürnberg, Stadtentwässerung<br />
und Umweltanalytik Nürnberg, Gütezeichen<br />
Kanalbau und RSV Rohrleitungssanierungsverband e.V.<br />
Nachhaltigkeit und Umweltschutz bleiben<br />
unberücksichtigt<br />
Die Mustersatzung definiert den Mindeststandard beim<br />
Zusammenwirken der privaten Anschlussnehmer und der<br />
öffentlichen Hand als Entsorgungspflichtiger. Kleinen Gemeinden<br />
bietet sie Rechtssicherheit und Richtlinien für die Zusammenarbeit.<br />
Große Kommunen mit spezialisiertem, professionellem<br />
Personal orientieren sich mit ihrer Hilfe an aktuellen<br />
Trends und Rechtsprechungen. Diplom-Ingenieur Burkard<br />
Hagspiel, Werkleiter der Stadtentwässerung und Umweltanalytik<br />
Nürnberg, sieht die Mustersatzung hinsichtlich ihrer positiven<br />
Wirkung kritisch. Solange in dieser nichts über die Ziele,<br />
die Auswirkungen für die Umwelt, die Nachhaltigkeit und den<br />
volkswirtschaftlichen Nutzen der Abwasserwirtschaft steht,<br />
bleibt für ihn das Resultat der Satzung auf die Verwaltung der<br />
Gemeinde begrenzt. „Es gibt weiterhin keine Anregungen, das<br />
Wasser<br />
anders<br />
z u<br />
behandeln,<br />
als in<br />
d e n<br />
nächst<br />
e n<br />
Kanal<br />
abzuleiten“,<br />
bemerkt Hagspiel. Langfristig sollte sich die Entwässerungssatzung<br />
verändern, weg von einseitig definierten „Geschäftsbedingungen“<br />
des kommunalen Entwässerungsbetriebes, hin<br />
zu einer nachhaltigen Gestaltung der Entsorgungssysteme. Ziel<br />
sollte ein in die gesamte Infrastruktur der Gemeinde integrierter<br />
Bewirtschaftungsprozess sein, der einem Gemeinschaftsvertrag<br />
über die gemeinschaftliche Nutzung der Ressource<br />
Wasser folgt.<br />
Viel Geld, wenig Anerkennung<br />
Die Aufgaben und Herausforderungen der Grundstücksentwässerung<br />
für ein großes Wohnungsbauunternehmen stellte<br />
Martin Güth von der Gewofag in München dar. Größtes<br />
Manko bei der Umsetzung der Richtlinien in die Praxis: Die<br />
Maßnahmen erfolgen im Verborgenen. „So wird leider ihr<br />
Nutzen nicht unmittelbar sichtbar, weshalb das Engagement<br />
der Wohnungsbauunternehmen keine angemessene Wertschätzung<br />
erfährt“, berichtete Martin Güth. Der Projektleiter<br />
und Fachsprecher Versorgungstechnik erläuterte die Strategien<br />
der Grundstücksentwässerung des Wohnungsbauunternehmens,<br />
das mehr als 37.000, davon rund 32.000<br />
eigene Wohneinheiten verwaltet. Die bisher durchgeführten<br />
und geplanten Projekte stellen eine große finanzielle<br />
Herausforderung für das Unternehmen dar. „Hinzu kommt,<br />
dass die Belastung für die Mieter unterschätzt und teilweise<br />
falsch eingeschätzt wurde“, ergänzte Güth. Bereits die<br />
Vorbereitungen seien langwierig, der Aufwand für Betreuung<br />
und Dokumentation groß und die Projekte kämen nur<br />
langsam voran. Güth berichtete, dass die Versickerung des<br />
Niederschlagswassers in Innenstadtlagen sehr schwierig ist,<br />
große Aufwendungen für die Wohnungswirtschaft erfordert<br />
und die Folgen – wie Grundwasser und Feuchte – nicht<br />
absehbar sind.<br />
Kanalsanierung im Spagat<br />
Claudia Scharnagl, Geschäftsführerin der U.T.E. Ingenieur<br />
GmbH aus Regensburg, zeigte die besonderen Herausforderungen<br />
für die Grundstücksentwässerung industrieller<br />
Liegenschaften auf. Hier sind umfassende Vorkenntnisse<br />
über Produktionsabläufe ebenso nötig wie aufwändige<br />
Bestands erfassung und Zustandsbewertung sowie Sanierungsplanungen<br />
mit Spezialmaterialien. Spezielle Anforderungen<br />
und die Tatsache, dass jeder Industriebetrieb<br />
anderes Abwasser und andere Anforderungen hat, müssen<br />
berücksichtigt werden. Dazu kommt die Erwartung vieler<br />
Auftraggeber, dass die Abwicklung schnell und unkompliziert<br />
erfolgt. Ihr Fazit: „Daraus ergibt sich ein Spagat<br />
zwischen Betriebsabläufen und Bauausführung, zwischen<br />
enger Bauzeit und hochwertiger Sanierung sowie hoher<br />
Umweltpräsenz.“<br />
Der Sanierungsbedarf von industriellen Grundstücksentwässerungsanlagen<br />
ist hoch, da industrielles Abwasser meist<br />
aggressiver und stärker belastet ist, als häusliches Abwasser.<br />
Die Grundstücksentwässerungsanlagen weisen hier häufig<br />
gravierende Schäden auf und stellen hohe Anforderungen an<br />
die Sanierung. Die Materialien müssen in Absprache mit den<br />
Herstellern sehr genau ausgewählt werden, Materialtests im<br />
Vorfeld und Analysen der Abwasserzusammensetzung sind<br />
970 12 / 2012
ÖGL-Symposium Grabenlos in Kitzbühel<br />
Zahlreiche Teilnehmer aus dem In- und Ausland trafen sich am<br />
16. und 17. Oktober 2012 beim ÖGL-Symposium Grabenlos<br />
in Kitzbühel bei der größten Fachveranstaltung im Bereich der<br />
grabenlosen Technologien in Österreich. Das jährlich von der<br />
ÖGL, Österreichische Vereinigung für grabenloses Bauen und<br />
Instandhalten von Leitungen, organisierte Symposium traf mit<br />
abwechslungsreichen Vorträgen, einer großen Fachausstellung<br />
und vielen Möglichkeiten zum Erfahrungsaustausch genau den<br />
Geschmack der Besucher und war somit auch 2012 eine sehr<br />
gute Dialogplattform für die Branche.<br />
Der gelungene Vortrags-Mix mit vielen Praxisbeispielen<br />
aktueller Bauvorhaben, Produktinnovationen und den neuesten<br />
wissenschaftlichen Erkenntnissen begeisterte Experten<br />
namhafter Bauunternehmen, sondern auch Ziviltechniker und<br />
Vertreter der öffentlichen Hand.<br />
Besonders beeindruckt von der Veranstaltung zeigte sich<br />
Bürgermeister Dr. Klaus Winkler, der in seinen Begrüßungsworten<br />
den Vormarsch der grabenlosen Technologien in Tirol<br />
betonte: „In Tirol war und ist das Thema Umwelt von großer<br />
Bedeutung und der Einsatz der grabenloser Technologien als<br />
umweltschonende Alternative zu herkömmlichen Bauweisen<br />
umso gefragter. Bestes Beispiel dafür ist die Kanalbauoffensive<br />
2020 der Stadt Innsbruck, die verstärkt auf die Vorteile<br />
grabenloser Technologien setzt.“<br />
ÖGL Award an Kanal Wien<br />
Im Rahmen der traditionellen Abendveranstaltung<br />
vergaben Univ. Prof.<br />
Hans Georg Jodl, Vorstandsvorsitzender<br />
der ÖGL, und Dr. Ute Boccioli,<br />
Geschäftsführerin der Vereinigung,<br />
erstmals den ÖGL Award für herausragende,<br />
umweltschonende und<br />
in öffentlichkeitswirksamer Weise<br />
realisierte grabenlose Bauvorhaben.<br />
Aus zahlreichen Einreichungen<br />
kürte der Vorstand der ÖGL das Vorzeigeprojekt<br />
„Asperner Sammelkanal-Entlastungskanal“<br />
der Wien Kanal<br />
zum diesjährigen Gewinnerprojekt.<br />
Univ.Prof. Dr. Hans Georg Jodl,<br />
Dipl.-Ing. Josef Jorda,<br />
Dipl.-Ing. Thomas Milkovics,<br />
Dr. Ute Boccioli (v.l.n.r.)<br />
Univ.Prof. Dr. Hans Georg Jodl, Vorstandsvorsitzender der<br />
ÖGL, und Dr. Ute Boccioli, Geschäftsführerin der Vereinigung,<br />
überreichten den ÖGL Award an die Preisträger. Dipl.-Ing.<br />
Thomas Milkovics, Projektleiter der Wien Kanal, nahm als<br />
Auftraggebervertreter gemeinsam mit Dipl.-Ing. Josef Jorda,<br />
der für die Planungsarbeiten verantwortlich zeichnete, die<br />
Auszeichnungen entgegen.<br />
Das ÖGL Symposium Grabenlos 2013 findet am 15./16<br />
Oktober 2013 in der Steiermark statt.<br />
Baden-Württembergs Wirtschaftsminister<br />
eröffnet neues SKZ-Trainings-Center in China<br />
Am 14. Oktober 2012 nahm Baden-Württembergs Wirtschaftsminister<br />
Nils Schmid im Rahmen seines Chinabesuchs<br />
an der Eröffnung der Startup Factory in Kunshan teil. Das SKZ<br />
freute sich sehr über die Unterstützung des Ministers bei der<br />
Eröffnung des neuen Standortes.<br />
Das Kunststoff-Zentrum SKZ hat seit einigen Jahren das Potential<br />
des chinesischen Marktes erkannt und seine Aktivitäten im<br />
Bereich Aus- und Weiterbildung Schritt für Schritt ausgebaut.<br />
Um sich auf dem chinesischen Aus- und Weiterbildungsmarkt<br />
nachhaltig zu etablieren, wurde in China ein Trainings-Center<br />
mit entsprechend eingerichteten Technika eröffnet, so dass<br />
Praxislehrgänge u. a. zum Thema Spritzgießen und auch zum<br />
Schweißen als offene Kurse angeboten werden können.<br />
Die hochwertige Ausstattung des Spritzgieß-Technikums<br />
ist Grundlage für eine Ausbildung mit sehr hohem Praxisbezug<br />
und gleichzeitig auf modernstem Niveau. Die Lehrgänge sind<br />
zugeschnitten auf Facharbeiter, Techniker und Ingenieure,<br />
die in China mit praktischen und leitenden Aufgaben in der<br />
Industrie betraut sind.<br />
Das SKZ Trainings-Center befindet sich in der Startup Factory<br />
in der Stadt Kunshan, Provinz Jiangsu, liegt also ca. 40 km<br />
westlich von Shanghai. Das Center bietet folglich vor allem den<br />
vielen im Großraum Shanghai angesiedelten Unternehmen aus<br />
der Kunststoff-Branche beste Voraussetzungen, Fachkräfte<br />
nach deutschen Standards ausbilden zu lassen.<br />
Die Startup Factory ist ein Modell zweier deutscher Unternehmer<br />
mit langjähriger China-Erfahrung, das kleinen und mittelständischen<br />
Unternehmen einen leichten Einstieg in den chinesischen<br />
Markt durch umfangreiche Unterstützung ermöglicht.<br />
Baden-Württembergs Wirtschaftsminister Nils Schmid (vorne,<br />
Mitte) nahm im Rahmen seines Chinabesuchs an der Eröffnung<br />
der Startup Factory in Kunshan teil<br />
12 / 2012971
NACHRICHTEN<br />
VERANSTALTUNGEN<br />
INDUSTRIE & WIRTSCHAFT<br />
WASSER BERLIN INTERNATIONAL<br />
schärft ihr Profil<br />
Die Fachmesse für Wasser und Abwasser, die vom 23. bis 26.<br />
April 2013 stattfindet, hat ein Konzept entwickelt, das den sich<br />
stetig ändernden Rahmenbedingungen für die Wasserwirtschaft<br />
Rechnung trägt. Sie stellt als einzige Branchenveranstaltung<br />
den gesamten Kreislauf der Wasserwirtschaft inklusive<br />
ihrer Schnittstellen in angrenzende Bereiche in den Fokus.<br />
Die Ausrichtung der Fachmesse in der deutschen Hauptstadt<br />
wird zunehmend internationaler. Bei der vergangenen<br />
Veranstaltung kamen ein Drittel der Aussteller und ein Drittel<br />
der Fachbesucher aus dem Ausland. Das entspricht den Veränderungen,<br />
mit denen die Wasserwirtschaft durch die Auswirkungen<br />
der Globalisierung konfrontiert wird. Die übergreifender<br />
werdende internationale Gesetzgebung, der Wandel in der<br />
Bevölkerungsstruktur, das Wachstum der Weltbevölkerung<br />
und sich ändernde klimatische Bedingungen werfen Fragen<br />
auf und erfordern umfassende Lösungen.<br />
Produkten und Lösungen passende Systeme für verschiedenste<br />
Anforderungen entwickelt werden können – ganz<br />
gleich in welcher Gegend der Welt und unter welchen<br />
Bedingungen.“<br />
Ein Bestandteil des neuen Konzeptes sind fünf Kompetenz-Zentren<br />
zu Themenschwerpunkten, die erstmals auf<br />
der WASSER BERLIN INTERNATIONAL 2013 eingerichtet<br />
werden. Die Kompetenz-Zentren haben die Aufgabe,<br />
gezielt Aussteller und Fachbesucher themenspezifisch<br />
zusammenzuführen und die Schlüsselthemen der Messe<br />
hervorzuheben. Dies sind „Bildung und Forschung“,<br />
„Industriewasser“, „Innovation“, „IT in der Wasserwirtschaft“<br />
und „Leitungsbau“.<br />
Im Kompetenz-Zentrum „Bildung und Forschung“<br />
(Halle 5.2) kommen technologische Kompetenz und<br />
wissenschaftliche Expertise zusammen. Das Kompetenz-Zentrum<br />
„Industriewasser“ (Halle 4.2) zeigt,<br />
welche Relevanz das Wasser in den Prozessabläufen<br />
der verschiedenen Branchen hat und welche neuen,<br />
zukunftsträchtigen Geschäftsfelder damit verbunden sind.<br />
Im Kompetenz-Zentrum „Innovation“ (Halle 2.2) stehen junge<br />
aufstrebende Unternehmen mit ihren neuen Entwicklungen<br />
im Fokus – ein idealer Ort, um potenzielle Projektpartner zu<br />
finden. Große IT-Unternehmen sowie Spezialdienstleister und<br />
Betreiber treffen sich im Kompetenz-Zentrum „IT in der Wasserwirtschaft“<br />
(Halle 6.2). Unter anderem sind hier folgende<br />
Themen gebündelt: Stand und Perspektiven im Bereich des<br />
Zählerwesens, W 406, Smart Metering und Liberalisierung<br />
des Messwesens. An keinem anderen Ort finden Fachbesucher<br />
mehr Kompetenz und fachliches Wissen zum Thema<br />
Leitungsbau als im Kompetenz-Zentrum „Leitungsbau“ (1.2).<br />
Sämtliche Technologien, Firmen und Produkte der Branche<br />
sind hier vertreten: vom konventionellen Leitungsbau bis zu<br />
den grabenlosen Technologien, wie Mikrotunnelbau, Horizontalspülbohrverfahren<br />
und Kanalsanierung.<br />
Wasser ist ein Weltmarkt<br />
Deswegen müssen sich Unternehmen der Wasserwirtschaft<br />
im veränderten Kontext zunehmend stärker neu einordnen.<br />
Dabei bietet WASSER BERLIN INTERNATIONAL Unterstützung.<br />
Sie gibt die notwendigen Antworten auf alle anfallenden<br />
Fragenkomplexe.<br />
Cornelia Wolff von der Sahl, Projektleiterin WASSER BER-<br />
LIN INTERNATIONAL: „Wir verfolgen den 360-Grad-Ansatz.<br />
Mit einem ganzheitlichen Blick auf den Wassermarkt zeigt<br />
WASSER BERLIN INTERNATIONAL Ausstellern und Fachbesuchern,<br />
welchen Einfluss das System auf ihre Unternehmen<br />
und welchen Einfluss ihre Unternehmen auf das System<br />
haben. Auch wenn in den verschiedenen Regionen der Welt<br />
unterschiedliche Rahmenbedingungen herrschen, sind doch<br />
die Grundprinzipien überall die gleichen. Unsere Aussteller<br />
wollen einem internationalen Publikum zeigen, dass aus ihren<br />
Nachhaltigkeit im Umgang mit Regenwasser<br />
Lange Zeit wurde Regenwasser nicht als Ressource betrachtet,<br />
sondern wie Abwasser behandelt. In der Vergangenheit<br />
wurde es, zusammen mit Schmutzwasser aus Haushalten und<br />
Industrie, in das Kanalnetz geleitet und von dort weiter ins<br />
Klärwerk. Dies wirkte sich in vielerlei Hinsicht schädlich auf<br />
die Umwelt und den natürlichen Wasserhaushalt aus.<br />
Im Rahmen von WASSER BERLIN INTERNATIONAL 2013 findet<br />
am 25. und 26. April 2013 unter dem Titel „Regenwasserbewirtschaftung<br />
– Stormwater Management“ ein anderthalbtägiges<br />
Fachsymposium zum nachhaltigen Umgang mit<br />
Regenwasser statt. Veranstaltet wird das Fachsymposium<br />
von der technisch-wissenschaftlichen Fachzeitschrift gwf-<br />
Wasser|Abwasser in Kooperation mit dem Beuth-Verlag und<br />
dem Bund der Ingenieure für Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft<br />
und Kulturbau e.V. (BWK).<br />
972 12 / 2012
23. - 26. April 2013<br />
INTERNATIONAL 2013<br />
Berlin<br />
NewYork<br />
London<br />
Casino<br />
Paris<br />
Eingang Süd<br />
Messe- und Kongresshalle<br />
Fertigstellung Ende 2013<br />
Stand: 13.11.2012<br />
Änderungen vorbehalten<br />
Wasserver- & -entsorgung,<br />
Verbände, Kompetenz-Zentrum Innovationen<br />
Armaturen, Brunnenbau, Pumpen, Geothermie,<br />
Verbände, Kompetenz-Zentrum Industriewasser<br />
Mess-, Regel- und Analysetechnik<br />
Kompetenz-Zentrum IT in der Wasserwirtschaft<br />
Rohrleitungsbau, Kompetenz-Zentrum Leitungsbau<br />
NO DIG BERLIN<br />
Wasseraufbereitung, Regenwassermanagement,<br />
Kunststoffrohre, Guss-, Steinzeug-, Stahl und Betonrohre<br />
Verbände, Länderforum<br />
Kompetenz-Zentrum Bildung und Forschung<br />
WASsERLEBEN Publikumsausstellung<br />
Kongress und Fachsymposien<br />
Fachbesucherregistrierung<br />
Kongressregistrierung<br />
Freigelände<br />
Messeleitung, Presse<br />
Young Water Professionals Lounge<br />
Offizieller Partner ACWUA<br />
Die negativen Folgen Messe einer Berlin GmbH falschen · Messedamm Regenwasserbewirtschaftung<br />
sind vielfältig: www.wasser-berlin.de Wenn etwa · bei wasser@messe-berlin.de<br />
starken Niederschlä-<br />
22 ·14055 Berlin · Germany<br />
Telefon + 49(0)30 / 3038-2148 · Fax +49(0)30 / 3038-2079<br />
gen sehr viel Regen in kurzer Zeit fällt, sind Abläufe und Kanalisation<br />
schnell überlastet. Hochwassersituationen werden<br />
durch solche Engpässe zusätzlich verschärft. Häufig gelangt<br />
bei Starkregenereignissen verschmutztes Wasser aus Überlaufbauwerken<br />
in Bäche und Flüsse und beeinträchtigt dort<br />
die Öko-Systeme. Andererseits können Gebiete, aus denen<br />
das Regenwasser ständig und in großem Umfang abgeleitet<br />
wird, mit der Zeit trocken fallen, was schädliche Auswirkungen<br />
auf die dort ansässige Fauna und Flora hat. Hinzu kommt, dass<br />
bei der herkömmlichen Regenwasserentsorgung Kosten für<br />
Kanalnetz- und Klärwerksbetreiber entstehen – aber auch für<br />
Hausbesitzer, wenn für das anfallende Regenwasser eine von<br />
der Schmutzwasserableitung getrennte Gebühr erhoben wird.<br />
Auf dem Fachsymposium in Berlin wird der aktuelle Stand<br />
dezentraler Lösungen für eine moderne, nachhaltige Regenwasserbewirtschaftung<br />
vorgestellt. Hochkarätige internationale<br />
Fachleute der Siedlungswasserwirtschaft sowie der<br />
Stadt- und Landschaftsplanung geben einen umfassenden<br />
Überblick über den Stand von Forschung und Technik. Anhand<br />
anschaulicher Beispiele aus der Praxis wird verdeutlicht, wie<br />
sich die dezentrale Bewirtschaftung der Regenabflüsse in<br />
bestehende Baustrukturen oder neue Planungsgebiete integrieren<br />
lässt. Neben technischen Lösungen werden Normierung<br />
und Zulassungsverfahren sowie der Eingang in das Baurecht<br />
ausführlich behandelt. Abgerundet wird die Veranstaltung<br />
durch eine Exkursion zu einem Berliner Wohngebiet mit<br />
dezentraler Regenwasserbewirtschaftung sowie durch eine<br />
informative und gesellige Abendveranstaltung.<br />
Grabenlos gut!<br />
Oldenburg · Hannover · Dessau · Herne · Leipzig · Wetzlar · Aschaffenburg<br />
Saar · Mannheim · Nürnberg · Freiburg · München · www.dus-rohr.de<br />
12 / 2012973
NACHRICHTEN<br />
VERANSTALTUNGEN<br />
INDUSTRIE & WIRTSCHAFT<br />
Praxistag Wasserversorgungsnetze etabliert sich<br />
Während der Pausen nutzten die Teilnehmer die Gelegenheit<br />
sich auszutauschen<br />
Rund 50 Teilnehmer besuchten den 2. Praxistag Wasserversorgungsnetze<br />
am 6. November in Essen, den die Fachzeitschrift<br />
<strong>3R</strong> zusammen mit ZfW und iro veranstaltete.<br />
Moderiert wurde die ganztägige Veranstaltung von Prof. Thomas<br />
Wegener vom iro-Institut für Rohrleitungsbau, Oldenburg.<br />
Im ersten Themenblock „Netzbetrieb – Analysieren und Optimieren“<br />
stellte Tobias Kuhn (RBS Wave, Stuttgart) zunächst die<br />
hydraulische Rohrnetzberechnung sowie Erfahrungen bei Kalibrierung,<br />
Ausarbeitung von Löschwasser- und Spülplänen vor.<br />
Anschließend erläuterte Dr. Andreas Wolters (3S consult, Garbsen)<br />
die Berechnung und Optimierung von Wasserverteilnetzen,<br />
bevor Sebastian Cichowlas (EWE Netz GmbH, Oldenburg) Zielnetzplanung<br />
konkret anhand des Beispiels Cuxhaven darlegte.<br />
Dr. Hans-Jürgen Kocks (Salzgitter Mannesmann Line Pipe,<br />
Siegen) referierte nach der ersten Kaffeepause über das<br />
Thema „Zustandsbewertung von metallischen Rohrleitungen<br />
der Gas- und Wasserversorgung – Konzept und Inhalt<br />
der künftigen GW 18 und GW 19“. Um die Unterstützung der<br />
Rohrnetzbewertung mittels materialtechnischer Zustandsbewertungen<br />
ging es danach im Vortrag von Dr. Hans-Christian<br />
Sorge vom IWW Rheinisch-Westfälisches Institut für Wasser<br />
in Mülheim/Ruhr. Axel Frerichs (OOWV) stellte schließlich<br />
die Strategie zum Einsatz von optimierten Spülverfahren am<br />
Beispiel des OOWV vor.<br />
Thematisch eingebettet in den zweiten Themenblock<br />
„Steuern, Regeln und Automatisieren in der Wasserversorgung“<br />
zeigte zunächst Edgar von Krüdener (vKD Mess- und<br />
Prüfsysteme, Kürten) die Alternative zur Festverdrahtung<br />
beim Überwachen, Steuern und Regeln über öffentliche und<br />
nicht-öffentliche Funknetze auf. Anschließend präsentierte<br />
Axel Sacharowitz (3S Antriebe, Berlin) den „Netzbetrieb der<br />
Zukunft“ durch die kabellose Automatisierung erdverlegter<br />
Armaturen.<br />
Der dritte Block der Veranstaltung widmete sich dem<br />
Thema „Monitoring von Wasserversorgungsnetzen und<br />
Leckageortung“. Hier referierten Dr. Gerald Gangl (RBS<br />
Wave, Stuttgart) und Jürgen Kurz (SebaKMT, Baunach) über<br />
ein gemeinsam durchgeführtes Projekt in Dortmund mit der<br />
DEW 21. Hier galt es mithilfe eines Monitoringssystems mit<br />
virtuellen Zonen Wasserverluste zu reduzieren.<br />
Während der Pausen nutzten die Teilnehmer intensiv die<br />
Gelegenheit sich untereinander und mit den Referenten auszutauschen.<br />
Der 3. Praxistag Wasserversorgungsnetze wird<br />
Ende nächstes Jahres erneut in Essen stattfinden.<br />
Die Teilnehmer während der Vorträge. Prof. Thomas Wegener (vorn, re.) neben Holger Oetken vom ZfW (Mitte) und Dr. Andreas<br />
Wolters von 3S Consult, (vorn, li.) moderierte den 2. Praxistag Wasserversorgungsnetze<br />
974 12 / 2012
Rohrleitungen, Wasser und Trenchless<br />
Technologies im Fokus der INA in Tunesien<br />
Seit 2008 in Paris 43 Staaten die UfM, Union for Mediterranean,<br />
ausgerufen haben, sind viele Studien erarbeitet und<br />
Pilotprojekte gestartet worden, um den Mittelmeer-Anrainerstaaten<br />
Impulse für ihre wirtschaftliche Entwicklung zu geben.<br />
Die EU hat dafür viele Fördergelder bereitgestellt. Nun wird<br />
es Zeit, dass Wirtschaftsunternehmen stärker eingebunden<br />
werden und der Transfer sich auch auf der Ebene der kleinen<br />
und mittelständischen Unternehmen abspielt.<br />
Auf Initiative der tunesischen Regierung und unter der<br />
Schirmherrschaft des tunesischen Ministerpräsidenten<br />
Hamadi Jebali findet im Januar 2013 in Tunis erstmalig eine<br />
internationale Konferenz mit begleitender Ausstellung zum<br />
Thema Infrastruktur für alle nordafrikanischen Staaten statt.<br />
Firmen aus Europa und weltweit sind aufgefordert, sich auf<br />
der „Infrastructure North Africa“ (INA) zu engagieren und<br />
Lösungen für die Revitalisierung der Infrastrukturen in Nordafrika<br />
einzubringen.<br />
In sechs Sessions werden die für die Infrastruktur Nordafrikas<br />
wichtigen Themen wie Wasserver- und entsorgung,<br />
Pipelines, Transport und Verkehr und Erneuerbare Energien<br />
aufgegriffen, diskutiert und Lösungsvorschläge präsentiert.<br />
Zur besseren Bearbeitung dieser Themen konnten wichtige<br />
Kooperationspartner gewonnen werden. Die GSTT (German<br />
Society for Trenchless Technology) wird die Session zum<br />
Thema „Trenchless Technologies“ maßgeblich unterstützen.<br />
Für die Session „Traffic and Transportation“ konnte die ITA<br />
(International Tunneling and Underground Space Association)<br />
als Partner gewonnen werden.<br />
Im Anschluss an die Konferenz am 23. Januar werden<br />
zusätzlich Seminare angeboten. Teilnehmer können hier tiefer<br />
in die Themen „Trenchless Technologies“, Integrity Management“<br />
und „Abwassermanagement“ einsteigen.<br />
Im Rahmen der Vorbereitungen besuchte Dr. Klaus Ritter<br />
mehrere tunesische Firmen, Behörden und Ministerien und<br />
sicherte sich deren Unterstützung. So wird beispielsweise die<br />
tunesische Umweltministerin Mamia Elbanna Zayani als Co-<br />
Chair die „Infrastructure North Africa“ unterstützen.<br />
Die inhaltliche Koordination der Konferenz erfolgt über ein<br />
Advisory Committee, in dem auf europäischer Seite Fachorganisationen<br />
und Berater eingebunden sind. Die nordafrikanischen<br />
Staaten gestalten über ihre betroffenen Fachbehörden<br />
aus Tunesien, Ägypten, Libyen, Algerien und Marokko die<br />
Konferenz.<br />
»KONTAKT: www.infrastructurenorthafrica.com<br />
EiTEP-Geschäftsführer Dr. Klaus Ritter (Organisator der<br />
INA, 2. v. li.) und die lokalen Partner Slim und Sami Zghal<br />
haben den Geschäftsführer der ETAP (Tunisian Company of<br />
Petroleum Activities), Yassine Mestiri getroffen<br />
Die tunesische Umweltministerin Mamia Elbanna Zayani wird<br />
die „Infrastructure North Africa“ als Co-Chair unterstützen<br />
Jetzt Mediadaten<br />
Kontakt: Helga Pelzer<br />
+49 201 82002-35<br />
h.pelzer@vulkan-verlag.de<br />
2013 anfordern!<br />
12 / 2012975
IRO SPECIAL<br />
Book your stand today!<br />
<strong>27.</strong> <strong>Rohrleitungsforum</strong><br />
For more information visit<br />
www.psseries.com/vietnam<br />
or call +65 6411 7781<br />
5 – 7 March 2013<br />
Tan Binh Exhibition & Convention Centre ( TBECC)<br />
Ho Chi Minh City, Vietnam<br />
www.psseries.com/vietnam<br />
Meet local and regional buyers within the Process System industry.<br />
You ideal platform to showcase your products, generate business and promote your presence in the industry.<br />
Process System Vietnam is Vietnam’s most established international exhibition on fluid, air and gas handling systems. The<br />
premier event on Process Systems focuses on four sectors; Pumps & Systems, Valves, Compressors and Fluid Power. Process<br />
Systems Vietnam provides the ideal marketplace for International manufacturers and suppliers to launch new products,<br />
reach out to key buyers, appoint agents and distributors, build brand awareness and establish business networks in<br />
Vietnam.<br />
Process System Vietnam will take place from 5 to 7 March 2013 at the Tan Binh Exhibition & Convention Centre,<br />
Ho Chi Minh City, Vietnam. Take advantage of this opportunity; book your stand at the exhibition today!<br />
www.psseries.com/vietnam<br />
Contact us today for stand and sponsorship<br />
opportunities at the exhibition.<br />
Tel : +65 6411 7781<br />
Fax : +65 6411 7778<br />
Email : moody.saw@informa.com<br />
For more information visit www.psseries.com/vietnam or call + 65 6411 7781<br />
976 12 / 2012
Rohrleitungen – im Zeichen des Klimawandels<br />
<strong>27.</strong> <strong>Oldenburger</strong> Rohrleitungs forum<br />
fokussiert Folgen des Klimawandels<br />
Am 7. und 8. Februar lädt das iro e.V. die gesamte Rohrleitungsbaubranche<br />
in die Räumlichkeiten der Jade-Hochschule.<br />
Das Motto 2013 lautet: „Rohrleitungen – im Zeichen des<br />
Klimawandels“. Da liegt es auf der Hand, dass es in vielen<br />
Beiträgen um die Folgen für die Entwässerungssysteme geht,<br />
die die bevorstehenden Starkregenereignisse verkraften , aber<br />
auch längere trockenere Perioden überstehen werden müssen.<br />
Aber auch andere Konsequenzen aus dem sich abzeichnenden<br />
Klimawandel sind abzuleiten. Wird der stete Anstieg<br />
der Temperaturen Auswirkungen auf unseren Gasverbrauch<br />
haben? Haben heißere Sommer Folgen für die Qualität der<br />
Wasserversorgung? Dies sind nur zwei von vielen Fragen,<br />
die aufgrund des Klimawandels beim <strong>27.</strong> <strong>Oldenburger</strong> <strong>Rohrleitungsforum</strong><br />
aufgeworfen und diskutiert werden.<br />
Darüber hinaus erwartet die Besucher und Teilnehmer eine<br />
gewohnt große Themenvielfalt. Um sich bereits im Vorfeld<br />
schon einmal genauer mit den diesjährigen Themenblöcken<br />
vertraut zu machen, finden Sie hier die Themenblöcke und<br />
Vorträge, die am Donnerstag, den 7. Februar, und am Freitag,<br />
den 8. Februar gehalten werden.<br />
Foto: KMG Pipe Technologies<br />
12 / 2012977
IRO SPECIAL<br />
<strong>27.</strong> <strong>Rohrleitungsforum</strong><br />
Programm Do, 07.02.2013<br />
2 Klimawandel und Folgen – ein globales Ereignis<br />
• Stadthydrologie - Quo vadis?<br />
• Der Klimawandel und seine Auswirkungen auf die<br />
Versicherungswirtschaft<br />
• Klimawandel und Überflutungsvorsorge: Handlungsempfehlungen<br />
für Kommunen<br />
3 Umweltschutz durch Kunststoffrohrsysteme<br />
• Polyethylendruckrohre im Zeitalter von Klimawandel<br />
und Energiewende – Nachhaltiger Schutz für Medien im<br />
erweiterten Temperatureinsatzbereich<br />
• Biogas- und JGS-Anlagen: Rechtliche Anforderungen an<br />
Kunststoffrohrleitungssysteme – Medienbeständigkeit<br />
und Eignungsnachweise<br />
• Erneuerbare Energien: Einsatzmöglichkeiten und Grenzen<br />
von PVC-Rohren<br />
4 Planungs- und Betriebssicherheit von<br />
HD-Leitungen – deterministische und<br />
probalistische Ansätze<br />
• Probabilistische Beurteilungskriterien und deterministische<br />
Sicherheitsvorschriften: Instrumente zur Risikoanalyse in<br />
der Schweiz<br />
• Probabilistische Bewertungen im Rahmen der Genehmigungsplanung<br />
für ein Pipeline-Projekt<br />
• Deterministischer und probabilistischer Ansatz – was sind<br />
die Unterschiede – wie wichtig ist das im Endergebnis? –<br />
Die Vorgehensweise in den Niederlanden<br />
5 HDD Horizontal Directional Drilling I<br />
• Großbohrtechnik im Wohngebiet – logistische und bohrtechnische<br />
Besonderheiten<br />
• Speicherleitung Jemgum – Pipelineverlegung durch<br />
Serien-HDD‘s<br />
• Speicherleitung Jemgum – Horizontalbohrungen im<br />
Grenzbereich<br />
6 IT-Modelle für zukünftige<br />
Herausforderungen für den Rohrleitungsbau<br />
• Energiesystemoptimierungen unter Berücksichtigung leitungsgebundener<br />
Wärmeversorgung, Klimawandel und<br />
dem Ausbau erneuerbarer Energien<br />
• Digitale Wärmebedarfskarte als Planungswerkzeug für<br />
Nah- und Fernwärmekonzepte<br />
• Flexibilisierung städtischer Wasserinfrastruktur durch<br />
intelligente Modelle und eine ganzheitliche Wasserh<br />
a u sh a l t sb e tr a c h tu n g<br />
7 Umgang mit extremen Regenereignissen –<br />
die wassersensible Stadt<br />
• Projekt KLAS – Strategien zum Umgang mit extremen<br />
Regenereignissen in Bremen<br />
• Überflutungsanalysen und -vorsorge mit dem Einsatz<br />
neuer Niederschlags-Abflussmodelle<br />
• Starkregen und Stadtentwässerung – mehr als eine nur<br />
technische Herausforderung!<br />
8 Betonrohre – Umweltbewusstsein und<br />
nachhaltiges Bauen<br />
• Stauraumkanäle für Starkregenereignisse<br />
• Erdwärmetauscher – am Beispiel des Dienstgebäudes<br />
des Umweltbundesamtes Dessau<br />
• Nachhaltigkeit von Beton- und Stahlbetonrohren -<br />
Ökobilanzieller Werkstoffvergleich<br />
9 Entwicklungen bei der Planung von Erdgas-HD-Leitungen<br />
– Sicherheits- und<br />
Genehmigungsaspekte<br />
• Ermittlung des Ausbaubedarfs von Erdgastransportnetzen<br />
unter regulatorischen Rahmenbedingungen<br />
• Konflikte und Konsequenzen im Genehmigungsverfahren<br />
der Nordeuropäischen Erdgasleitung in Niedersachsen<br />
• Sicherheit von Erdgashochdruckleitungen im internationalen<br />
Vergleich<br />
10 HDD Horizontal Directional Drilling II<br />
• Grabenlose Verlegetechniken für das Neu-Installieren<br />
und Austauschen von Erdkabeln<br />
• Einsatzgebiete eines Pipe Trusters im HDD<br />
• Spülungsaufbereitung – neue Techniken und Normen<br />
11 IT-Lösungen und Anwendungen im<br />
Rohrleitungsbau und -betrieb<br />
• Wie läuft es denn...? - Die Fachschale „Geocom Geonis<br />
SEW“ im Einsatz<br />
• Gemas – eine Plattform für die Erweiterung von<br />
Kanalkatastern<br />
• Betriebsführung für Leitungsnetze<br />
11a Ausblasen von Geruchsverschlüssen infolge<br />
HD-Reinigung<br />
• Hochdruckreinigungstechnik im modernen Kanalbetrieb<br />
- Theorie und Praxis am Beispiel hanseWasser<br />
Bremen GmbH<br />
• Nischenproblem Ausblasungen – von Betreiberseite<br />
vermeidbar? – Vom Problem zum Projekt<br />
• Forschungsprojekt „Ausblasen von Geruchsverschlüssen<br />
infolge Hochdruckreinigung“ – Ein Bericht<br />
978 12 / 2012
Rohrleitungen – im Zeichen des Klimawandels<br />
12 Starkregen und Kanalsanierung – hydraulische<br />
und bauliche Ertüchtigung des Netzes in<br />
Hamburg-Bergedorf<br />
• Das Bergedorfer Sanierungskonzept: Überflutungs- und<br />
Gewässerschutz für Hamburgs Osten<br />
• Teilmaßnahme Sielbau „Neuer Weg“: Aufrechterhaltung<br />
der Vorflut im Starkregenfall<br />
• Dimensionierung von Abwasserkanälen vor dem Hintergrund<br />
des Klimawandels<br />
13 Stahlrohre<br />
• Mobiles Arbeiten an der Pipeline – Das intelligente Rohrbuch<br />
von morgen?<br />
• Innovative Verbindungstechnik für Stahlrohre – Automatisiertes<br />
Laserstrahlschweißen und Prüfen von<br />
Rohrverbindungen<br />
• Stand der nationalen und internationalen Normungsaktivitäten<br />
für den CO2-Transport<br />
14 Pipelines – das sicherste Transportmedium<br />
• Ermittlung der Sicherheit von Rohrfernleitungen<br />
• Beurteilung der Gefährdung von Rohrfernleitungen durch<br />
Erdbeben<br />
• Kriterien und Sicherheitsaspekte zur Inbetriebnahme von<br />
Produktenpipelines<br />
15 Diskussion im Café: Hausanschlusssanierung – ja<br />
oder nein?<br />
• Über das Thema Grundstücksentwässerung diskutieren:<br />
K.-H. Flick (GS Grundstücksentwässerung, Hennef),<br />
U. Halbach (Sachverständiger für Abwasserbeseitigung,<br />
Chemnitz), M. Müller (Techn. Betriebe Solingen), R. Pagelsen<br />
(COPA Umweltservice, Brunsbek), F. Pucher (Sprecher<br />
BI „Dichtheitsprüfung Nein Danke!“, Haddenhausen),<br />
Leitung: Dr. I. Borovsky (VSB, Hannover)<br />
16 Projektmanagement-Methoden aus<br />
Auftraggebersicht<br />
• Prozess- und Vertragsmanagement in komplexen<br />
Pipeline-Projekten<br />
• Einzel- und multiprojektspezifisches Controlling einschließlich<br />
Risikomanagement<br />
• Die Anforderungen an ein einzel- und multiprojektspezifisches<br />
Informationssystem<br />
16a Einbau und Abdichtung von Netz- und<br />
Hausanschlüssen<br />
• Grundsätzliche Anforderungen der Regelwerke an Durchdringungen<br />
für Versorgungsleitungen<br />
• Grundlagen für nachhaltige und fachgerechte Gebäudedurchdringungen<br />
für Versorgungsleitungen<br />
• Technische Lösungen für regelwerks- und fachgerechte<br />
Gebäudedurchdringungen für Versorgungsleitungen<br />
Programm Do, 07.02.2013<br />
Foto: KMG Pipe Technologies<br />
12 / 2012979
IRO SPECIAL<br />
<strong>27.</strong> <strong>Rohrleitungsforum</strong><br />
Programm Fr, 08.02.2013<br />
17 Klimawandel – Folgen für die<br />
Trinkwasserversorgung<br />
• Klimawandel – angepasste Rohrnetze: wie flexibel sind<br />
Wasserverteilungssysteme?<br />
• Auswirkungen des Klimawandels auf die Trinkwasservorräte<br />
in Süddeutschland – Ergebnisse aus der<br />
KLIWA-Kooperation<br />
• Auswirkungen / Folgen des Klimawandels am Bodensee<br />
aus Sicht der Trinkwasserversorgung<br />
18 GFK-Rohrsysteme<br />
• Grabenlose Installation von großkalibrigen GFK-Rohren<br />
• Qualitätssicherung und Überwachung von<br />
GFK-Rohrvortrieben<br />
• Stauraumkanäle aus gewickelten GFK-Rohrsystemen<br />
und integrierten Einbauten sorgen für verbesserten<br />
Umweltschutz und Nachhaltigkeit<br />
19 Abschlussarbeiten und Projekte an<br />
der Jade Hochschule in Oldenburg<br />
• In diesem Block werden eine Reihe von druckfrischen<br />
Arbeiten aus dem Bereich des Rohrleitungsbaus oder<br />
des allgemeinen Baubetriebes vorgestellt.<br />
• Titel der Arbeiten und Vortragende werden aktuell<br />
ausgehängt!<br />
Moderator: Prof. Th. Wegener<br />
20 Die Energiewende – der Rohrvortrieb<br />
leistet seinen Beitrag<br />
• Rohrvortrieb und verwandte Verfahren – Grenzen und<br />
Möglichkeiten in der Anwendung<br />
• Ausschreibung von Rohrvortriebsarbeiten<br />
• Kreuzung sensibler Verkehrswege am Beispiel Frankfurter<br />
Flughafen<br />
Foto: Amitech<br />
21 Fernwärme-Praxis<br />
• EnEff: Wärme – Kostengünstiger Wärmetransport für<br />
den effektiven Ausbau der Kraft – Verlegung von Kunststoffverbundmantelrohr-(KVMR)<br />
Leitungen mit zeitweise<br />
fließfähigen, sich selbstverdichtenden Verfüllmaterialien<br />
(ZfsV) – Teil 1: Voruntersuchungen<br />
• Qualitätssicherung: Wareneingang – Produktion –<br />
Muffenisolierung<br />
• Vom Muffensystem zur Mantelrohrverbindung beim KMR,<br />
ein ewig aktuelles Thema<br />
22 Regionale Konzepte zur<br />
Entwässerungsplanung in der Umsetzung<br />
• Der Anspruch und die Werkzeuge der integralen<br />
Entwässerungsplanung<br />
• Veränderungsbedarf in der integralen Entwässerungsplanung<br />
durch Starkregenereignisse?<br />
• Strategie und Umgang mit Starkregenereignissen am Beispiel<br />
Oldenburg, Alexanderstraße<br />
23 Anwendungen duktiler Guss-Rohrsysteme unter<br />
verschiedenen Aspekten der Nachhaltigkeit<br />
• Wärmetauscher im Düker<br />
• Erneuerung der Hauptwasserleitung HW 1.1 DN 700<br />
zwischen Hattersheim und Frankfurt Sindlingen mit dem<br />
Langrohr-Relining-Verfahren<br />
• Bau und Betrieb von Abwasserdruckleitungen<br />
24 Neue BDEW-DB-DVGW Gas- und<br />
Wasserleitungskreuzungsrichtlinien<br />
• Übersicht der GWKR 2012 / Ril 877<br />
• Antragstellung und Anwendung nach GWKR 2012 / Ril 877<br />
• Technische Neuerungen GWKR 2012 / Ril 877 aus Sicht<br />
der DB und der EVU‘s<br />
980 12 / 2012
Rohrleitungen – im Zeichen des Klimawandels<br />
25 GSTT-Bauweisen sicher und wirtschaftlich –<br />
aktuelle Informationen pro NoDig<br />
• GSTT Information Nr. 11 – Entscheidungshilfen für den<br />
grabenlosen Leitungsbau – ein Beitrag zum Klimaschutz<br />
• DN 19573 – Mörtel für Neubau und Sanierung von Entwässerungssystemen<br />
außerhalb von Gebäuden<br />
• GSTT-CO2-Kalkulator für Schlauchliningverfahren<br />
26 Schweißtechnik<br />
• Schweißen von Kunststoffen – Aktuelles aus der<br />
DVS-Richtlinienarbeit<br />
• Untersuchung von Schadenfällen im Fernwärme-<br />
Rohrleitungsbau<br />
• Bau von Gashochdruckleitungen<br />
26a Gasnetze der Zukunft<br />
• Power to Gas – Einblick in die Technologie, Marktreife,<br />
Ausblick in die Zukunft<br />
• Biogas im Energiemix – eine Bilanz<br />
• Anforderungen an moderne Gasnetze<br />
27 Lebensraum Trinkwasserleitungsnetze im Fokus<br />
des Klimawandels<br />
• Das Rohrleitungssystem als Lebensraum – möglicher<br />
Einfluss von Umweltfaktoren – Nahrungsquellen für<br />
Wasserasseln<br />
• Tiere in Trinkwasserverteilnetzen – faunistische Beprobung,<br />
Bekämpfung und Überwachung<br />
• Entfernung von Ablagerungen, Biofilmen und Tieren aus<br />
den Trinkwasserverteilnetzen – neue Aufgaben infolge<br />
des Klimawandels<br />
28 Eine echte Alternative – Rohrvortrieb mit<br />
Steinzeug-VT-Rohren<br />
• Einsatz von Dehnerstationen beim Rohrvortrieb mit<br />
Steinzeug-VT-Rohren – Grundlagen und Praxisberichte<br />
• Rohrmantelschmierung beim Rohrvortrieb - Bentonitsuspension<br />
und Injektionstechnik<br />
• Dichtheitsprüfung von Abwasserleitungen – Prüfbedingungen<br />
und Bewertung von Ergebnissen<br />
Foto: Steinzeug Keramo GmbH<br />
29 Korrosionsschutz als Baustein der der<br />
Leitungsintegrität<br />
• Qualitätssicherung beim Rohrleitungsbau durch<br />
Korrosionsschutzmessungen<br />
• KKS überwachen und steuern mit moderner Technik<br />
• Umsetzung der Erkenntnisse aus den Forschungsprojekten<br />
zur Wechselstromkorrosion und der Hinweise der AfK-<br />
Empfehlung Nr. 11 im Rohrleitungsbetrieb der Open Grid<br />
Europe GmbH<br />
30 RSV – von der Prüfung bis zur Zertifizierung<br />
• Lecksuche bei Gas- und Trinkwasserleitungen<br />
• Kriterien für eine fachgerechte Ausführung der Sanierung<br />
im Grundstücksentwässerungsbereich<br />
• Nachweis der Dichtheit bei Hutprofilen im Anschlussbereich<br />
31 Fernwärme – Forschung und Entwicklung<br />
• Europaviertel Frankfurt – Messkonzept zur Qualitätssicherung<br />
der in fließfähigen Verfüllmaterialien gebetteten<br />
Fernwärmeleitungen<br />
• Entwicklung eines kleinen Fernwärmehausanschlusses für<br />
eine wirtschaftliche Anschlussverdichtung<br />
• Perspektiven und Ziele für die Fernwärmeforschung im<br />
Hinblick auf den Klimawandel<br />
Programm Fr, 08 .02.2013<br />
MELDEN SIE SICH JETZT AN!<br />
Kontakt: Institut für Rohrleitungsbau<br />
an der FH Oldenburg e. V., Ina Kleist,<br />
Tel. +49 441 3610-39-0,<br />
E-Mail: kleist@iro-online.de,<br />
www.iro-online.de<br />
WEITERE INFORMATIONEN<br />
zu jedem Vortrag und die Kontaktdaten<br />
der Referenten unter<br />
www.oldenburger-rohrleitungsforum.de
IRO SPECIAL<br />
<strong>27.</strong> <strong>Rohrleitungsforum</strong><br />
Kennen Sie schon die iro-App?<br />
Die iro-App feierte beim <strong>Oldenburger</strong> <strong>Rohrleitungsforum</strong> 2012 Ihre Premiere. Auch 2013 steht Sie Ihnen wieder zur Verfügung<br />
– rundum optimiert und noch übersichtlicher. Damit haben Sie vor Ort und auch im Vorfeld auf Ihrem Mobilgerät (Smartphone,<br />
Tablet) alle Themenblöcke, Vorträge und Hallenpläne immer im Blick und können Sie sich vormerken.<br />
Mehr Informationen über<br />
jeden einzelnen Vortrag,<br />
inkl. Kurzzusammenfassung<br />
und Kontaktdaten des<br />
Referenten, finden Sie hier.<br />
Wo ist Aussteller XY genau zu<br />
finden? Alle Hallenpläne und<br />
Standnummern finden Sie hier!<br />
Sie suchen ein spezielles Produkt?<br />
Hier finden Sie es!<br />
Legen Sie Ihre persönliche<br />
Merkliste an mit allen Vorträgen,<br />
die Sie interessieren etc.<br />
Alle Aussteller inkl. Standort<br />
und Produktspektrum<br />
samt Kontaktdaten<br />
Weitere Informationen z.B. zum<br />
legendären Grünkohlabend oder<br />
Telefonnummern von Taxizentralen<br />
finden Sie hier.<br />
Weitere Informationen zur iro-App unter<br />
www.oldenburger-rohrleitungsforum.de<br />
982 12 / 2012
RECHT & REGELWERK<br />
DVGW-Regelwerk Gas<br />
G 292 „Überwachung und Steuerung von Biogaseinspeisungen aus Sicht des Dispatching“<br />
Ausgabe 10/12, EUR 21,41 für DVGW-Mitglieder, EUR 28,55 für Nicht-Mitglieder<br />
Derzeit sind in Deutschland rund 80 Anlagen zur Einspeisung<br />
regenerativ erzeugter Gase aus Biogasaufbereitungsanlagen<br />
in Erdgasnetze in Betrieb. Die Anzahl der Einspeiseanlagen<br />
wird in den nächsten Jahren stark ansteigen, da die energiepolitisch<br />
formulierten Ziele der Einspeisemengen für 2020 mit<br />
6 Mrd. m³ und für 2030 mit 10 Mrd. m³ Biomethan pro Jahr<br />
festgelegt sind. Umgerechnet mit einer Einspeiseleistung von<br />
700 m³/h pro Anlage entspricht dieses Größenordnungen von<br />
1.000 bzw. 1.700 Einspeiseanlagen, die bis zu den jeweiligen<br />
Zeitpunkten zu errichten sind.<br />
Um das notwendige Fachwissen und die gesammelten Erfahrungen<br />
für die Überwachung und Steuerung von Einspeiseanlagen<br />
einem breiten Interessentenkreis zugänglich zu<br />
machen, hat der DVGW-Projektkreis „Dispatching in der<br />
Gasversorgung“ im Technischen Komitee „Dispatching“ das<br />
DVGW-Merkblatt G 292 „Überwachung und Steuerung von<br />
Biogaseinspeisungen aus Sicht des Dispatching“ erarbeitet<br />
und herausgegeben. Das Merkblatt beinhaltet die Definition<br />
eines Mindestumfangs überwachungsbedürftiger, steuerund<br />
abschaltrelevanter Parameter von BGAA und BGEA zur<br />
Einhaltung der DVGW-Arbeitsblätter G 260, G 262 und G 685<br />
für Dispatchingprozesse sowie die Beschreibung von Überwachungs-<br />
und Meldekonzepten als Grundlage für die operative<br />
Arbeit in Dispatchingzentralen. Zielgruppe des Merkblatts<br />
sind Netz- und Anlagenbetreiber sowie an der Planungs- und<br />
Errichtungsphase beteiligte Unternehmen.<br />
Im Einzelnen wird im DVGW-Merkblatt G 292 eingegangen<br />
auf:<br />
»»<br />
den Datenumfang der Fernübertragung zwischen Dispatchingzentralen<br />
als ständig besetzte Stellen und den<br />
Anlagen zur Einspeisung und Aufbereitung von Biogas,<br />
»»<br />
die Mindestanforderungen an überwachungsrelevante<br />
Parameter und Beschreibungen von Meldeprozessen und<br />
Verhaltensweisen, falls Grenzwertverletzungen vorliegen,<br />
»»<br />
die Definition von Prozessen zur erstmaligen Inbetriebnahme<br />
und Wiederinbetriebnahme der Anlagen,<br />
»»<br />
allgemeine Informations- und Meldekonzepte,<br />
»»<br />
Handlungsempfehlungen, wie ein Nachweis der Anlagenverfügbarkeit<br />
nach § 33 Abs. 2 GasNZV von 96 % gegenüber<br />
dem Anschlussnehmer erbracht, verfolgt und ausgewertet<br />
wird,<br />
»»<br />
eine Optimierung des Aufwandes zur Konditionierung des<br />
einzuspeisenden Biogases mit Flüssiggas und<br />
»»<br />
die Rückspeisung und Deodorierung.<br />
DVGW-Regelwerk Gas/Wasser<br />
GW 309 Entwurf „Elektrische Überbrückung bei Rohrtrennungen“<br />
Ausgabe 10/2012, EUR 16,61 für DVGW-Mitglieder, EUR 22,14 für Nicht-Mitglieder<br />
Dieses Arbeitsblatt wurde vom Projektkreis „Elektrotechnische<br />
Fragestellungen“ im Technischen Komitee „Außenkorrosion“<br />
überarbeitet. Die Überarbeitung wurde notwendig, da zu<br />
Grunde liegende, andere technische Regelwerke überarbeitet<br />
wurden. In den Erläuterungen werden auch Hinweise auf die<br />
Verfahrensweise in Sonderfällen gegeben. Zur Erleichterung<br />
für den Anwender wurde eine Checkliste erstellt. Gegenüber<br />
DVGW-Arbeitsblatt GW 309:1986-11 wurden folgende<br />
Änderungen vorgenommen:<br />
»»<br />
Aktualisierung der Verweise<br />
»»<br />
Anpassung an den Stand der Technik<br />
»»<br />
Aufführung von Hinweisen für die Praxis<br />
Einsprüche bis 31.01.2013 an frenz@dvgw.de<br />
12 / 2012983
RECHT & REGELWERK<br />
DVGW-Regelwerk Wasser<br />
W 557 „Reinigung und Desinfektion von Trinkwasser-Installationen“<br />
Ausgabe 10/2012, EUR 32,97 für DVGW-Mitglieder, EUR 43,96 für Nicht-Mitglieder<br />
Dieses Arbeitsblatt wurde vom Projektkreis „Reinigung und<br />
Desinfektion von Trinkwasser-Installationen“ des Technischen<br />
Komitees „Hygiene in der Trinkwasser-Installation“<br />
erarbeitet. Es dient als Grundlage für eine Vermeidung und<br />
Beseitigung von mikrobiellen Kontaminationen und unerwünschten<br />
Ablagerungen in Trinkwasser-Installationen im<br />
Sinn der Trinkwasserverordnung. Es beschreibt die Reinigung<br />
von Trinkwasser-Installationen und die Anlagendesinfektion<br />
von Trinkwasser-Installationen oder Teilen davon und benennt<br />
Anwendungsbereiche von Desinfektionsverfahren ebenso wie<br />
vorbeugende Maßnahmen zur Abwendung einer mikrobiellen<br />
Kontamination. Die kontinuierliche Desinfektion des Trinkwassers<br />
(Trinkwasserdesinfektion) ist dagegen im DVGW-<br />
Arbeitsblatt W 556 (in Vorbereitung) beschrieben.<br />
Allgemeine Anforderungen an die Reinigung und Desinfektion<br />
von nicht ortsfesten Anlagen sind in der DIN 2001-2 aufgeführt.<br />
Reinigung und Desinfektion von Wasserverteilungsanlagen<br />
werden im DVGW-Arbeitsblatt W 291 beschrieben.<br />
Das vorliegende Arbeitsblatt wendet sich an Planer, Errichter<br />
und Betreiber von Trinkwasser-Installationen sowie Hersteller<br />
von Bauteilen, an die zuständigen Behörden (z. B. Gesundheitsämter)<br />
und ausführende Fachfirmen.<br />
DWA-Regelwerk<br />
Entwurf Arbeitsblatt DWA-A 143-2 „Sanierung von Entwässerungssystemen außerhalb von<br />
Gebäuden – Teil 2: Statische Berechnung zur Sanierung von Abwasserleitungen und -kanälen<br />
mit Lining- und Montageverfahren“<br />
November 2012, 113 Seiten, ISBN 978-3-942964-57-9, Ladenpreis 82,00 Euro, fördernde DWA-<br />
Mitglieder 65,60 Euro<br />
Das Arbeitsblatt gilt für die statische Berechnung von Linern<br />
und Montageelementen mit beliebigen Querschnitten. Es<br />
ersetzt das Merkblatt ATV-M 127-2 aus dem Jahr 2000. Die<br />
Überarbeitung war insbesondere aufgrund des Konzeptes mit<br />
Teilsicherheitsfaktoren für die Einwirkungen (Lasten) und die<br />
Widerstände (Festigkeiten und Verformungskennwerte), das<br />
mit dem Eurocode 1 eingeführt wurde, erforderlich geworden.<br />
Ein weiterer Grund war die für den Brückenbau gültige neue<br />
Regelung für den Schwerlastverkehr (neue Bezeichnung für<br />
das Schwerlastfahrzeug: Tandemsystem (Abkürzung TS) bzw.<br />
Lastmodell 1 (LM 1).<br />
Neben der Überarbeitung wurden in das Arbeitsblatt Erweiterungen<br />
und Präzisierungen aufgenommen:<br />
»»<br />
Die Tabelle für die Werkstoffkennwerte wurde erweitert<br />
und aktualisiert.<br />
»»<br />
Tabellen mit Teilsicherheitsbeiwerten γF und γM sowie eine<br />
Tabelle mit Kombinationsbeiwerten γ wurden ergänzt. Der<br />
bisherige Sicherheitsstandard mit den globalen Sicherheitsbeiwerten<br />
erf γ ≅ 2,0 für den Lastfall Wasserdruck<br />
bzw. 1,5 für die Lastkombination Erd- und Verkehrslasten<br />
wird im Wesentlichen beibehalten.<br />
»»<br />
Es wird nun zwischen charakteristischen Werten (Index k)<br />
und Bemessungswerten (Index d) unterschieden – letztere<br />
enthalten den Teilsicherheitsbeiwert.<br />
»»<br />
Bei Eiprofilen werden unterschiedliche Ersatzkreise für den<br />
Stabilitätsnachweis bei Altrohrzustand I und II sowie für<br />
den Spannungsnachweis bei Altrohrzustand III definiert.<br />
»»<br />
Es werden Hinweise zur Beanspruchung in Längsrichtung<br />
des Liners gegeben.<br />
»»<br />
Ferner werden Hinweise zur Anwendung von eingeführten<br />
Berechnungsmethoden wie die Finite-Elemente-Methode<br />
gegeben.<br />
»»<br />
Die Angaben zum Ansatz von Imperfektionen werden den<br />
Querschnittsformen und Liningverfahren zugeordnet.<br />
Die Abhängigkeit der Exzentrizität der angenommenen<br />
Altrohrgelenke vom Zustand der Altrohrdruckzonen wird<br />
verdeutlicht.<br />
»»<br />
Es werden Nachweise bei Linern für Druckrohre behandelt.<br />
»»<br />
Der Altrohrzustand IIIa (Altrohr als Kies betrachtet)<br />
wird für folgende Fälle eingeführt: untypisches Altrohr-<br />
Bruchbild (z. B. erhebliche Scherbenbildung), deutliche<br />
Korrosion, stark reduzierte Festigkeit des Altrohres, sehr<br />
große Verformungen. Es werden Beiwerte für UP-GF-<br />
Liner ergänzt (Anhang D und E).<br />
»»<br />
Hinzugekommen sind ferner Beiwerte für Eiquerschnitte<br />
(Anhang D).<br />
984 12 / 2012
Frist zur Stellungnahme: Hinweise und Anregungen zu dieser<br />
Thematik nimmt die DWA-Bundesgeschäftsstelle gerne<br />
entgegen. Das Arbeitsblatt DWA-A 143-2 wird bis zum 31.<br />
Januar 2013 öffentlich zur Diskussion gestellt.<br />
Stellungnahmen richten Sie bitte schriftlich, nach Möglichkeit<br />
in digitaler Form an die DWA-Bundesgeschäftsstelle.<br />
»KONTAKT: DWA-Bundesgeschäftsstelle, Hennef,<br />
Dipl.-Geogr. Christian Berger, E-Mail: berger@dwa.de<br />
Entwurf Arbeitsblatt DWA-A 143-3 „Sanierung von Entwässerungssystemen außerhalb von Gebäuden –<br />
Teil 3: Vor Ort härtende Schlauchliner“<br />
November 2012, 48 Seiten, ISBN 978-3-942964-49-4, Ladenpreis 42,00 Euro, fördernde DWA-Mitglieder 33,60 Euro<br />
Das Arbeitsblatt ist für die Renovierung von Entwässerungssystemen<br />
außerhalb von Gebäuden anwendbar, die hauptsächlich<br />
als Freispiegelsysteme betrieben werden. Beim<br />
Schlauchlining wird ein flexibler Schlauch aus Träger- und/oder<br />
Verstärkungsmaterial, der mit Folien/Beschichtungen versehen<br />
sein kann, mit Reaktionsharz imprägniert und dann über<br />
einen Schacht mit Wasser oder Luftdruck in den Kanal gestülpt<br />
(inversiert) oder mithilfe einer Winde in den Kanal eingezogen.<br />
Zusätzliche Folien können als Einbauhilfe verwendet werden.<br />
Für die Sanierung von Abwasserkanälen werden üblicherweise<br />
nur warm- oder lichthärtende Systeme eingesetzt.<br />
Objekt der Schadensbehebung ist in der Regel mindestens<br />
eine Haltung eines zu sanierenden Abwasserkanals bzw.<br />
einer Abwasserleitung im öffentlichen und nicht öffentlichen<br />
Bereich.<br />
Das Arbeitsblatt legt die technischen Anforderungen an vor<br />
Ort härtende Schlauchliner in der Nennweite ≥ DN 200 fest.<br />
Schlauchlining kann in begehbaren und nicht begehbaren<br />
Kanälen in allen Querschnittsformen ohne Trockenwetterrinne<br />
wie z. B. Kreis-, Ei-, Maul-, Rechteck-, Drachen-, Dachoder<br />
Ovalprofil, und unabhängig vom vorhandenen Werkstoff<br />
sowohl im Freispiegel- als auch im Druckleitungsbereich<br />
eingesetzt werden, der allerdings nicht Gegenstand dieses<br />
Arbeitsblattes ist.<br />
Schlauchliner werden in der Regel im Durchmesserbereich DN<br />
100 bis DN 2000 und in nicht kreisförmigen Querschnitten<br />
gleichen Umfangs in Abhängigkeit der Verfahrenstechnik und<br />
der Härtungsverfahren eingesetzt. Abweichende Querschnitte<br />
und Größen sind möglich.<br />
Schlauchlining setzt eine sorgfältige<br />
Ist-Aufnahme des Altrohr-Boden-Systems<br />
voraus. Durch die Sanierung mit<br />
dem Schlauchlining wird die hydraulische<br />
Leistungsfähigkeit des vorhandenen<br />
Systems nicht wesentlich beeinträchtigt,<br />
ggf. ist eine Berechnung der<br />
hydraulischen Leistungsfähigkeit in der<br />
Planungsphase durchzuführen. Bei Einsturz<br />
und Hindernissen im Querschnitt<br />
ist Schlauchlining nur einsetzbar, wenn diese Schäden vorab<br />
behoben werden. Bei Lageabweichung (vertikal, horizontal),<br />
Querschnittsverformung sowie Querschnittsänderung sind<br />
zusätzliche Überlegungen notwendig. Das Arbeitsblatt richtet<br />
sich an alle im Bereich der Sanierung von Entwässerungssystemen<br />
planende, betreibende sowie Aufsicht führende<br />
Institutionen als auch an Sanierungsfirmen.<br />
Frist zur Stellungnahme: Hinweise und Anregungen zu dieser<br />
Thematik nimmt die DWA-Bundesgeschäftsstelle gerne<br />
entgegen. Das Arbeitsblatt DWA-A 143-3 wird bis zum 31.<br />
Januar 2013 öffentlich zur Diskussion gestellt. Stellungnahmen<br />
richten Sie bitte schriftlich, nach Möglichkeit in digitaler<br />
Form an die DWA-Bundesgeschäftsstelle.<br />
»KONTAKT: DWA-Bundesgeschäftsstelle, Hennef, Dipl.-Geogr.<br />
Christian Berger, E-Mail: berger@dwa.de<br />
DIN-Normen<br />
DIN EN 12007-2 „Gasinfrastruktur - Rohrleitungen mit einem maximal zulässigen Betriebsdruck bis einschließlich<br />
16 bar - Teil 2: Spezifische funktionale Anforderungen für Polyethylen (MOP bis einschließlich 10 bar)“<br />
Ausgabe 10/2012, Preisgruppe 13, Deutsche Fassung EN 12007-2:2012<br />
DIN EN 12007-4 „Gasinfrastruktur - Rohrleitungen mit einem maximal zulässigen Betriebsdruck bis einschließlich<br />
16 bar - Teil 4: Spezifische funktionale Anforderungen für die Sanierung“<br />
Ausgabe 10/2012, Preisgruppe 15, Deutsche Fassung EN 12007-4:2012<br />
12 / 2012985
RECHT & REGELWERK<br />
VDMA-Regelwerk<br />
Einheitsblatt 24657 „Technische Ausrüstung für Anlagen der zentralen Regenwasserbehandlung und -rückhaltung<br />
- Hinweise für Betrieb, Instandhaltung und Erneuerung“<br />
Oktober 2012, 53,10 Euro<br />
Die VDMA-Fachabteilung Wasser- und Abwassertechnik des<br />
Fachverbandes Verfahrenstechnische Maschinen und Apparate<br />
stellt der Fachwelt das mit Ausgabedatum Oktober 2012<br />
veröffentlichte VDMA-Einheitsblattes 24657 „Technische<br />
Ausrüstung für Anlagen der zentralen Regenwasserbehandlung<br />
und -rückhaltung Hinweise für Betrieb, Instandhaltung<br />
und Erneuerung“ vor.<br />
Dieses VDMA-Einheitsblatt gilt im Wesentlichen für maschinelle<br />
und elektrotechnische Komponenten und Systeme in zentralen<br />
Bauwerken zur Regenwasserbehandlung und -rückhaltung im<br />
Misch- und Trennsystem der öffentlichen Abwasserkanalisation.<br />
Die Behandlung von Regenwasserabflüssen in Abwasserkanalisationen<br />
ist eine relativ junge Technologie, die vor etwa 40<br />
Jahren begann. Wegen fehlender Erfahrung war anfänglich das<br />
technische Regelwerk schwach. Inzwischen hat die Regenwasserbehandlung<br />
eine stürmische Entwicklung genommen<br />
und es sind heute in Deutschland etwa 45.500 Anlagen der<br />
zentralen Regenwasserbehandlung und -rückhaltung aller Art<br />
in Betrieb. Nunmehr liegen umfangreiche praktische Erfahrungen<br />
vor, die eine Ergänzung des technischen Regelwerkes zum<br />
Betrieb, zur Instandhaltung und Erneuerung der maschinenund<br />
elektrotechnischen Ausrüstung wünschenswert machen.<br />
Die technischen Erstausrüstungen vieler Regenwasserbehandlungsanlagen<br />
haben das Ende der normalen Nutzungsdauer<br />
erreicht, so dass ein großer Erneuerungsbedarf besteht.<br />
Erstmals innerhalb des VDMA-Regelwerkes thematisiert<br />
dieses VDMA-Einheitsblatt die technische Ausrüstung der<br />
zentralen Anlagen zur Regenwasserbehandlung und -rückhaltung<br />
in Misch- und Trennsystemen der öffentlichen Abwasserkanalisation.<br />
Es soll mit dazu beitragen, den Prozess von<br />
der Planung, Installation und Inbetriebnahme über den Normalbetrieb<br />
und die Instandhaltung bis hin zur Erneuerung der<br />
technischen Ausrüstung zu verbessern. Die Instandhaltung<br />
steht dabei im Vordergrund. Für durchschnittlich belastete<br />
Anlagen werden aus der Sicht der Anlagenbauer Zeitintervalle<br />
für die Sichtkontrollen, Funktionsprüfungen, Genauigkeitsprüfungen,<br />
Wartungen und erwartete Nutzungsdauern der<br />
technischen Ausrüstung genannt.<br />
Das VDMA-Einheitsblattes 24657 „Technische Ausrüstung für<br />
Anlagen der zentralen Regenwasserbehandlung und -rückhaltung<br />
Hinweise für Betrieb, Instandhaltung und Erneuerung“<br />
kann zum Preis von 53,10 Euro zzgl. MwSt. ausschließlich über<br />
den Beuth Verlag im DIN (www.beuth.de) bezogen werden.<br />
»KONTAKT: VDMA Verfahrenstechnische Maschinen und Apparate,<br />
Frankfurt/Main, Hans Birle, E-Mail: hans.birle@vdma.org<br />
Jetzt Mediadaten<br />
2013 anfordern!<br />
Kontakt: Helga Pelzer<br />
+49 201 82002-35<br />
h.pelzer@vulkan-verlag.de<br />
986 12 / 2012
Jetzt<br />
als Heft, als e-Paper<br />
oder als<br />
Heft + e-Paper<br />
Sichere und effiziente<br />
Rohrleitungssysteme<br />
Nutzen Sie das Know-how der führenden Fachzeitschrift<br />
für die Entwicklung von Rohrleitungen,<br />
Komponenten und Verfahren im Bereich der Gasund<br />
Wasserversorgung, der Abwasserentsorgung,<br />
der Nah- und Fernwärmeversorgung, des Anlagenbaus<br />
und der Pipelinetechnik.<br />
Mit zwei englischsprachigen Specials pro Jahr.<br />
<strong>3R</strong> erscheint in der Vulkan-Verlag GmbH, Huyssenallee 52-56, 45128 Essen<br />
Vulkan-Verlag GmbH<br />
www.3r-rohre.de<br />
Vorteilsanforderung per Fax: +49 (0) 931 / 4170 - 492 oder im Fensterumschlag einsenden<br />
Ja, ich möchte <strong>3R</strong> regelmäßig lesen. Bitte schicken Sie mir das Fachmagazin für zunächst ein Jahr (12 Ausgaben)<br />
□ als Heft für € 268,- zzgl. Versand (Deutschland: € 27,- / Ausland: € 31,50)<br />
□ als e-Paper (PDF als Einzellizenz) für 268,-<br />
□ als Heft + e-Paper (PDF) für € 375,40 (Deutschland) / € 379,90 (Ausland)<br />
Für Schüler und Studenten (gegen Nachweis) zum Vorzugspreis<br />
□ als Heft für € 134,- zzgl. Versand (Deutschland: € 27,- / Ausland: € 31,50)<br />
□ als e-Paper für € 134,- (PDF als Einzellizenz)<br />
□ als Heft + e-Paper (PDF) für € 201,20 (Deutschland) / € 205,70 (Ausland)<br />
Nur wenn ich nicht bis 8 Wochen vor Bezugsjahresende kündige, verlängert sich der Bezug um ein Jahr.<br />
Die sichere, pünktliche und bequeme Bezahlung per Bankabbuchung wird mit einer Gutschrift von € 20,-<br />
auf die erste Jahresrechnung belohnt.<br />
Antwort<br />
Leserservice <strong>3R</strong><br />
Postfach 91 61<br />
97091 Würzburg<br />
Firma/Institution<br />
Vorname/Name des Empfängers<br />
Straße/Postfach, Nr.<br />
Land, PLZ, Ort<br />
Telefon<br />
E-Mail<br />
Branche/Wirtschaftszweig<br />
Telefax<br />
Bevorzugte Zahlungsweise □ Bankabbuchung □ Rechnung<br />
Bankleitzahl<br />
Kontonummer<br />
Widerrufsrecht: Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) oder<br />
✘<br />
durch Rücksendung der Sache widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die<br />
rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache an Leserservice <strong>3R</strong>, Franz-Horn-Str. 2, 97082 Würzburg<br />
Datum, Unterschrift<br />
PA<strong>3R</strong>IN0512<br />
Nutzung personenbezogener Daten: Für die Auftragsabwicklung und zur Pflege der laufenden Kommunikation werden personenbezogene Daten erfasst, gespeichert und verarbeitet. Mit dieser Anforderung erkläre ich mich damit einverstanden,<br />
dass ich von DIV Deutscher Industrieverlag oder vom Vulkan-Verlag □ per Post, □ per Telefon, □ per Telefax, □ per E-Mail, □ nicht über interessante Fachangebote informiert und beworben werde. Diese Erklärung kann ich mit Wirkung für die<br />
Zukunft jederzeit widerrufen.<br />
Bank, Ort
FKKS AKTUELL<br />
KORROSIONSSCHUTZ<br />
forum kks 2013 in Esslingen<br />
Vom 28. bis zum 30. Januar 2013 veranstaltet der fkks im Best Western Premier Hotel Park Consul<br />
Stuttgart/Esslingen das forum kks 2013, zu dem alle Mitglieder, Freunde und Förderer des fkks sowie alle<br />
am kathodischen Korrosionsschutz Interessierten herzlich eingeladen sind. Das forum kks 2013 beinhaltet<br />
unter anderem den fkks Infotag 2013 zum Thema Kathodischer Korrosionsschutz im Stahlbetonbau, den<br />
fkks Workshop Zustandsbewertung und die Jahreshauptversammlung 2013.<br />
fkks Infotag 2013<br />
Der fkks Infotag 2013 „Kathodischer Korrosionsschutz im<br />
Stahlbetonbau – Stand der Technik, Regelwerke und Praxis“<br />
findet am 29. Januar 2013 in der Zeit von 9 bis 17 Uhr, statt.<br />
Zielgruppe sind Ingenieure, Planer, Ausführende und Materialhersteller,<br />
die sich auf dem Gebiet des kathodischen Korrosionsschutzes<br />
von Stahl in Beton über den aktuellen Stand<br />
der Normung und Praxis sowie zukunftsweisende Trends und<br />
Entwicklungen informieren wollen.<br />
Der fkks-Infotag 2013 richtet sich gleichermaßen an Bauherren,<br />
Planer, Ausführende sowie alle weiteren Interessierten,<br />
die den kathodischen Korrosionsschutz von Stahl in Beton als<br />
leistungs- und konkurrenzfähiges Instandsetzungsverfahren<br />
kennengelernt haben oder kennenlernen möchten.<br />
Der kathodische Korrosionsschutz von Stahl in Beton (KKSB)<br />
wurde, nachdem er bereits gegen Ende der 1950er Jahre in<br />
experimentellen Studien angewendet wurde, zunächst in Ermangelung<br />
geeigneter Anodenmaterialien wieder verworfen. R. F.<br />
Stratful verhalf dem KKSB im Jahr 1974 durch die Veröffentlichung<br />
eines Forschungsberichtes über eine KKS-Installation mit<br />
leitfähigem Asphalt als Fremdstromanode zu neuer Beachtung.<br />
Im Jahr 1986, d.h. zwölf Jahre später, wurde die erste<br />
KKSB-Anlage in Deutschland im Rahmen eines 1985 initiierten,<br />
internationalen Forschungsvorhabens, des BRITE-Projektes,<br />
in Betrieb genommen und schützte 15 Jahre lang die<br />
durch Korrosion geschädigte Bewehrung einer Stützwand des<br />
Berliner Autobahnrings vor weiteren Querschnittsverlusten,<br />
bevor die Anlage wegen erforderlicher Umbaumaßnahmen<br />
im Jahr 2001 rückgebaut wurde.<br />
Seit den frühen Versuchsinstallationen hat die konsequente<br />
Entwicklung neuer bzw. die Weiterentwicklung vorhandener<br />
und dauerhafter Anodenmaterialien, insbesondere in den<br />
1980er Jahren, dazu geführt, dass der KKSB zusehends in den<br />
Fokus des Interesses von Bauherren und sachkundigen Planern<br />
bei der Instandsetzung, vorwiegend chloridgeschädigter Bauwerke,<br />
rückt. Die Korrosionsschutzwirkung durch kathodische<br />
Polarisation für das System Stahl/Beton wurde mittlerweile<br />
hinreichend nachgewiesen und vielfach publiziert. Seit 1999<br />
existiert die DIN EN 12696, die die Leistungsanforderungen<br />
an KKSB-Systeme regelt und in ihrer aktuellen Fassung in eine<br />
ISO Norm überführt wurde. Der mittlerweile lange Erfahrungszeitraum<br />
mit dieser Form des elektrochemischen Korrosionsschutzes<br />
sowie die vorhandenen und gültigen europäischen und<br />
internationalen Normen und Regelwerke machen den kathodischen<br />
Korrosionsschutz von Stahl in Beton zu einem häufig<br />
wirtschaftlichen, effektiven und vor allem in seiner Anwendung<br />
sicheren Instandhaltungsverfahren, das durch die Kombination<br />
mit konventionellen Instandsetzungsarbeiten zur deutlichen<br />
Wertsteigerung korrosionsgefährdeter Bauwerke führen kann.<br />
Die aktuellen Entwicklungen bei der Überarbeitung der<br />
Instandsetzungsrichtline (RiLiSib) zur Instandhaltungsrichtlinie<br />
sowie ihrer Verknüpfung mit den eingeführten und gültigen<br />
europäischen und internationalen Standards wie der DIN EN<br />
15257 und der DIN EN ISO 12696 bilden ebenso Schwerpunkte<br />
der Veranstaltung wie Berichte über interessante Projekte<br />
und praktische Fragestellungen.<br />
Die Vortragenden sind: Prof. Dr.-Ing. Bernd Isecke (BAM<br />
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung), Univ.<br />
Prof. Dr.-Ing. Michael Raupach (Institut für Bauforschung der<br />
RWTH-Aachen), Dr.-Ing. Thorsten Eichler (CORR-LESS Isecke<br />
& Eichler Consulting GmbH & Co. KG), Dipl.-Ing. Susanne<br />
Gieler-Breßmer (IGF Ingenieur-Gesellschaft für Betoninstandsetzung<br />
Gieler-Breßmer & Fahrenkamp GmbH), Dipl.-Ing.<br />
Gregor Gerhard (Massenberg GmbH), Dr. rer. nat. Dr.-Ing.<br />
Franz Pruckner (PP engineering GmbH).<br />
fkks workshop<br />
Der fkks workshop „Zustandsüberwachung und -bewertung<br />
von erdverlegten Rohrleitungen aus Stahl“ findet am 30. Januar<br />
2013 in der Zeit von 13 bis 17 Uhr statt.<br />
Das Verfahren des Kathodischen Korrosionsschutzes (KKS)<br />
und dessen Anwendung auf erdverlegte Stahlrohrleitungen<br />
hat sich seit Jahrzehnten als wirksame Maßnahme zum Schutz<br />
gegen Korrosionsangriffe bewährt. Dabei stand und steht<br />
hauptsächlich die Betriebssicherheit und die Werterhaltung<br />
der geschützten Rohrleitungen im Vordergrund. Es ist deshalb<br />
z.B. bei Gashochdruckleitungen eine Selbstverständlichkeit<br />
geworden, dass Undichtigkeiten aufgrund des Versagens der<br />
Korrosionsschutzsysteme praktisch nicht vorkommen. Auch in<br />
Netzen, wo der KKS nicht durchgängig vorhanden ist, stechen<br />
die geschützten Leitungsbereiche durch stark verminderte<br />
Störungshäufigkeit heraus. Dies allein sind schon herausragende<br />
Gründe für die konsequente Anwendung des Verfahrens.<br />
Viele Betreiber von Versorgungsnetzen sind bemüht, ihre<br />
Instandhaltungsstrategien zu optimieren. Dies geht häufig<br />
einher mit der Überlegung, die vorherrschende präventive<br />
Instandhaltung in eine zustandsorientierte Instandhaltung<br />
zu überführen. Wichtigster Baustein einer solchen zustandsorientierten<br />
Instandhaltung ist die Kenntnis über den jeweils<br />
aktuellen Zustand der Rohrleitungen.<br />
Hier kann KKS unterstützen. An wirksam kathodisch<br />
geschützten Rohrleitungen sind Korrosionsvorgänge soweit<br />
reduziert, dass sie in Bezug auf die Nutzungsdauer vernachläs-<br />
988 1-2 12 / 2012
sigbar sind. Es kann also davon ausgegangen werden, dass sich<br />
der Zustand des Stahlrohres hinsichtlich Wanddicke solange<br />
nicht verändert, wie ein wirksamer KKS nachgewiesen wird.<br />
Darüber hinaus stehen bei kathodisch geschützten Leitungen<br />
elektrische Messverfahren zur Verfügung mittels derer auch<br />
andere, möglicherweise kritische Leitungszustände erfasst<br />
und überwacht werden können. Z.B. können dies der Zustand<br />
der Rohrumhüllung oder eventuelle elektrochemische Einwirkungen<br />
(Streuströme, Kontaktelemente) sein.<br />
Durch die kontinuierliche messtechnische Überwachung des<br />
KKS kann ein Warnbereich bei der Zustandsbewertung definiert<br />
werden, der, wenn er erreicht wird, ausreichend Handlungsspielraum<br />
bietet bis sich ein kritischer Zustand einstellen kann.<br />
Im Vergleich zu alternativen Zustandsbewertungsverfahren,<br />
die häufig mit Rohrleitungsfreilegungen verbunden sind,<br />
sind die im Zusammenwirken mit dem KKS nutzbaren Messverfahren<br />
kostengünstig.<br />
In einem Workshop sollen die genannten Aspekte mit<br />
Technikern und Instandhaltungsstrategen diskutiert werden.<br />
In kurzen Vorträgen werden Beispiele vorgestellt, die sich<br />
bereits in der praktischen Anwendung befinden. Zielgruppe<br />
sind Assetmanager, Rohrnetz- und Korrosionsschutzfachleute<br />
und technische Führungskräfte aus Versorgungsunternehmen.<br />
Die Vortragenden sind Dipl.-Phys. Rainer Deiss (RBS wave GmbH<br />
EnBW Regional AG), Hans Gaugler (Stadtwerke München Services<br />
GmbH), Dipl.-Ing. Thomas Laier (RWE Westfalen-Weser-<br />
Ems Netzservice GmbH), Dr.-Ing. Klaus-Erich Nowak, Dipl.-Ing.<br />
Hans-Willy Theilmeier-Aldehoff (Open Grid Europe GmbH).<br />
49. Jahreshauptversammlung<br />
Die 49. Jahreshauptversammlung des fkks Fachverband<br />
Kathodischer Korrosionsschutz e.V. findet am 30. Januar 2013<br />
in der Zeit von 9 bis 12 Uhr statt.<br />
Die Tagesordnung lautet wie folgt:<br />
1. Begrüßung durch den Vorstand<br />
2. Bericht des Vorstandes und des Geschäftsführers<br />
3. Vorlage des Kassenberichts 2012 und Bericht der Kassenprüfer<br />
4. Entlastung des Vorstandes und des Kassierers, Wahl der<br />
Kassenprüfer<br />
5. Bericht des Fachbeirats<br />
6. Bericht der fkks cert gmbh<br />
7. 50 Jahre fkks<br />
8. Beschluss über die Verleihung der Kuhn-Medaille 2014<br />
9. Verschiedenes<br />
Das Jahr 2014 wirft seine Schatten voraus. 2014, das Jahr,<br />
in dem der fkks 50 Jahre besteht und die CeoCor auf Einladung<br />
des DVGW und fkks mit Ihrem jährlichen Kongress in Weimar<br />
gastiert. Deshalb wird die Jahreshauptversammlung 2014 im<br />
Zusammenhang mit dem im Mai 2014 in Weimar stattfindenden<br />
CeoCor-Kongress zusammengelegt. In diesem würdigen<br />
Rahmen wird die Kuhn-Ehrenmedaille verliehen werden.<br />
»KONTAKT: Geschäftsstelle des fkks Fachverband Kathodischer Korrosionsschutz<br />
e. V., Esslingen, Hans-Gerhard Köpf, Tel. +49 711 919<br />
927 20, E-Mail: geschaeftsstelle@fkks.de<br />
Fachbereich „Innenschutz“ (KKS-I)<br />
stellt sich vor<br />
Der Fachbereich „Innenschutz“ (Leitung: Dipl. Ing. Norbert Tenzer,<br />
(siehe auch Fachbericht ab Seite 990 in dieser <strong>3R</strong>) innerhalb des<br />
fkks beschäftigt sich in vorrangig mit Fragen zum Korrosionsschutz<br />
von metallischen Oberflächen im Inneren von Anlagen.<br />
Darüber hinaus sind Aufgabenstellungen zur Ermittlung von<br />
Korrosionsmechanismen sowie Techniken zur messtechnischen<br />
Erfassung von Korrosionsvorgängen weitere Schwerpunkte.<br />
Mitglieder des Fachbeirates sind gegenwärtig Dipl. Ing.<br />
Dieter Martin (Martin GmbH) und Dipl. Ing. Norbert Tenzer,<br />
(TZ-ICC), die neben Fachbeiratsaufgaben auch die Aus- und<br />
Weiterbildung von KKS-Fachpersonal hinsichtlich „kathodischem<br />
Innenschutz für innere Oberflächen metallischer<br />
Behälter“ als Prüfungsbeauftragte des fkks-cert im Rahmen<br />
der DIN EN 15257 wahrnehmen.<br />
Aufgrund anderweiter Verpflichtungen konnte die aktive<br />
Tätigkeit des Fachbereiches „Innenschutz“ erst im November<br />
2012 aufgenommen werden. Gegenwärtig ist es die vorrangige<br />
Zielsetzung, die Vorteile und Möglichkeiten, die aus der<br />
Anwendung eines KKS-I resultieren können, breitenwirksamer<br />
bekannt zu machen. Hierzu erfolgt eine unmittelbare Kontaktaufnahme<br />
bei potentiellen KKS-I-Anwendern wie Unternehmen<br />
in der chemischen Industrie, Planungsabteilungen des<br />
Anlagenbaus, Herstellern von Biogas-Fermentern. Bei entsprechendem<br />
Interesse wird die Kontaktaufnahme gekoppelt<br />
mit dem Angebot eines Beratungsgespräches zu Korrosion<br />
und Korrosionsschutz entsprechend den spezifischen Belangen<br />
oder auch einem Inhouse-Einführungsseminar zum KKS-I.<br />
Bewerbung korrosionsrelevanter Themen in Zeitschriften der<br />
Bereiche Chemie und Anlagenbau sind vorgesehen.<br />
Ein wichtiges Anliegen des Fachbeirates ist es, in Zukunft<br />
allen Interessierten, potentiellen Kunden und natürlich den fkks-<br />
Mitgliedern beratend zur Verfügung zu stehen. Dies gilt nicht<br />
nur für zentrale Themen des KKS-I, sondern auch für tangierte<br />
Themen wie Hilfestellung bei Schadensfällen, Ermittlung<br />
von Korrosionsursachen, Unterstützung bei Werkstofffragen,<br />
Abschätzungen zur Nutzungsdauer von Anlagen sowie ggf.<br />
Vermittlung von Untersuchungsstellen und Sachverständigen.<br />
Weiterhin ist vorgesehen, insbesondere deutsche Firmen, die<br />
Anlagenbauprojekte im Ausland abwickeln, stärker damit vertraut<br />
zu machen, welches Potential der KKS-I bietet, und dass<br />
entsprechende Leistungen und die Begleitung der Projekte im<br />
Ausland durch deutsche Fachfirmen angeboten werden kann.<br />
12 / 2012989
FACHBERICHT<br />
KORROSIONSSCHUTZ<br />
Von Norbert Tenzer<br />
Kathodischer Korrosionsschutz<br />
für die Innenflächen von metallischen<br />
Anlagen (KKS-I)<br />
Kathodischer Korrosionsschutz für die Innenflächen von metallischen Anlagen (KKS-I) ist eine weltweit eingesetzte Technik<br />
um sicheren Schutz von metallischen Anlagen gegen Korrosion zu bewirken. Anwendungen bestehen für Anlagen in der<br />
Trinkwasseraufbereitung und -speicherung, für Behälter und Reaktionsgefäße in der chemischen Industrie, für Anlagen in der<br />
Erdöl- und Erdgasindustrie sowie für Behälter und großdimensionierte Rohrleitungen, die Seewasser beinhalten, wie z. B. zur<br />
Kühlung von Luftverflüssigungsanlagen, Kraftwerken und Meerwasserentsalzungsanlagen. Darüber hinaus bestehen weitere<br />
Spezialanwendungen für Abwasser- und Biogasanlagen.<br />
Diese allgemeine Beschreibung des KKS-I soll Betreibern entsprechender Anlagen eine Information vermitteln, dass kathodischer<br />
Korrosionsschutz auch für den Schutz der Innenflächen von Anlagen gegen Korrosion ein großes Anwendungsspektrum bietet. Neben<br />
den eingangs genannten Standardanwendungsbereichen bestehen vielfältige weitere Anwendungsmöglichkeiten für metallische<br />
Anlagen, wobei hervorgehoben werden soll, dass nicht nur für un- oder niedrig legierte Stähle, sondern auch für nichtrostende Stähle,<br />
Aluminium, Blei, Kupfer, Titan und Zink usw. Anwendungsmöglichkeiten bestehen. Mit der erstmalig in 2003 herausgegebenen DIN EN<br />
12499 liegt zudem ein Regelwerk vor, aus dem Grundlagen, Anwendungsbereiche und Ausführungsdetails entnommen werden können.<br />
EINLEITUNG<br />
Analog zur weit verbreiteten und bekannten Technik des<br />
kathodischen Außenschutzes von Rohrleitungen, Behältern,<br />
Hafen- und Offshore-Anlagen ist oft weniger bekannt, dass<br />
kathodischer Korrosionsschutz (KKS) auch für die Innenflächen<br />
von metallischen Anlagen eine wirksame Methode zur Vermeidung<br />
von Korrosion darstellen kann. Zur Unterscheidung<br />
von anderen Anwendungsbereichen des KKS wird für die spezielle<br />
Adaption des KKS auf die Innenflächen von Anlagen das<br />
Kürzel KKS-I verwendet. Umgangssprachlich findet sich die<br />
Kurzform „kathodischer Innenschutz“. Im industriellen Bereich<br />
wird KKS-I oft standardmäßig bei Anlagen vorgesehen, die<br />
mit Seewasser beaufschlagt werden. Nicht vergessen werden<br />
soll aber auch, dass sich häufig auch im privaten Bereich eine<br />
KKS-I-Anlage befindet. KKS-I wird von Herstellern der Warmwasserspeicher<br />
für häusliche Heizungsanlagen standardmäßig<br />
vorgesehen, um Innenkorrosion des Warmwasserspeichers<br />
zu verhindern.<br />
Gegenstand dieses Artikels ist es, die prinzipielle Möglichkeiten<br />
des KKS-I aufzuzeigen und spezifische Besonderheiten<br />
darzulegen, die KKS-I von den klassischen Anwendungen<br />
des KKS im Außenbereich von Anlagen unterscheidet. Die<br />
Betrachtungen sind schwerpunktmäßig auf den industriellen<br />
Bereich ausgerichtet, wo klassische Anwendung für den<br />
Innenschutz von Tanks (Rohöl und Wasser), Rohrleitungen<br />
mit großen Dimensionen und Wasserkreislaufsysteme, wie<br />
Anlagen, die große Mengen Seewasser zur Kühlung benötigen,<br />
bestehen. Sonderanwendungen des KKS-I ergeben sich<br />
darüber hinaus oft dort, wo durch aggressive Medien oder<br />
Betriebsbedingungen die Korrosionsbedingungen unwirtschaftlich<br />
kurze Standzeiten hervorrufen (Bild 1) oder sich<br />
durch Verzicht auf höherwertige Werkstoffe wirtschaftliche<br />
Vorteile ergeben.<br />
Voraussetzung zur Anwendung des KKS-I ist naturgemäß<br />
ein vollständiges Eintauchen der gegen Korrosion zu schützenden<br />
Flächen in einen elektrisch leitfähigen Elektrolyten.<br />
Prinzipiell treten bei der Korrosion im Inneren von Anlagen die<br />
gleichen Korrosionsmechanismen auf, die auch beim kathodischen<br />
Außenschutz anzutreffen sind. Die Korrosionswahrscheinlichkeit<br />
in Systemen, die Wässer für den menschlichen<br />
Gebrauch umfassen, können nach den Regelwerken in der DIN<br />
EN 12502-Reihe abgeschätzt werden. Für Anlagen, die stark<br />
salzhaltige Wässer oder aggressive Chemikalien enthalten,<br />
sind häufig eigene Untersuchungen erforderlich. Oft können<br />
erforderliche Informationen aber auch in entsprechenden<br />
Veröffentlichungen oder spezieller Fachliteratur gefunden<br />
werden. Grundsätzliche Informationen und Anforderungen, die<br />
bei der Anwendung des KKS-I zugrunde gelegt werden sollten,<br />
finden sich in DIN EN 12499. Für Anlagen im außereuropäischen<br />
Ausland finden sich entsprechende Normenanforderungen<br />
spezifisch nach Anwendungsfall unterteilt, für Trinkwasser<br />
oder trinkwasserähnliche Wässer in NACE SP0196 für den<br />
kathodischen Innenschutz mit galvanischen Anoden bzw.<br />
NACE SP0388 für den kathodischen Innenschutz mit Fremdstrom.<br />
Für spezialisierte Anwendungen bei Anlagen, die durch<br />
Prozesswässer gefährdet sind, finden sich Empfehlungen in<br />
NACE SP0575. Darüber hinaus ist eine vielfältige Fachliteratur<br />
verfügbar, aus der oft notwendige Hinweise bezüglich Korrosionsgrundlagen,<br />
Planungsparametern, Ausführungs- und<br />
Überwachungsdetails entnommen werden können.<br />
Wie bei vielen Anlagen gilt auch für den KKS-I, dass die wirtschaftlich<br />
günstigste Lösung in der Regel erreicht wird, wenn<br />
KKS-I bereits während der Planung bzw. des Neubaus der<br />
Anlage berücksichtigt wird. Hat die Korrosion erst einmal<br />
gravierende Ausmaße (Bild 2) angenommen, so kann der<br />
KKS-I zwar das weitere Fortschreiten der Korrosionsschä-<br />
990 12 / 2012
digung verzögern, aber massiv geschädigte Bereiche lassen<br />
sich nur durch eine konstruktive Sanierung wieder in den<br />
gebrauchsfähigen Zustand versetzen.<br />
GRUNDSÄTZE UND KRITERIEN FÜR KKS-I<br />
DIN EN ISO 8044 definiert Korrosion wie folgt:<br />
„Korrosion, ist die Reaktion eines metallischen Werkstoffes<br />
mit seiner Umgebung, die eine messbare Veränderung des<br />
Werkstoffes bewirkt und zu einer Beeinträchtigung der<br />
Funktion eines metallischen Bauteils oder eines ganzen<br />
Systems führen kann. In den meisten Fällen ist die Reaktion<br />
elektrochemischer Natur, in einigen Fällen kann sie chemischer<br />
oder metallphysikalischer Natur sein.“<br />
Um mittels KKS-I die Korrosion zu verhindern bzw. zu reduzieren,<br />
muss eine elektrochemische Reaktion vorliegen, da<br />
durch den KKS eine Verschiebung des Korrosionspotentials zu<br />
negativeren Potentialen bis zum Erreichung eines Schutzpotentials<br />
bewirkt werden muss, um vollständigen Korrosionsschutz<br />
zu erreichen. Besondere Bedingungen für den KKS-I<br />
treten dadurch auf, dass naturgemäß sehr unterschiedlich<br />
Medien mit unterschiedlichen Betriebsbedingungen im Inneren<br />
von Anlagen vorliegen können. Erschwerend kommt hinzu,<br />
dass die Anlagen selbst aus verschiedenen Metallpaarungen<br />
bestehen können, wodurch bei hoch leitfähigen Elektrolyten<br />
massive Korrosion durch Elementbildung ausgelöst wird<br />
(Bild 3). Angesichts dieser Komplexität weist DIN EN 12499<br />
darauf hin: „Ein einziges Potentialkriterium kann nicht den<br />
Bereich der unterschiedlichen Bedingungen abdecken, die<br />
beim kathodischen Innenschutz vorliegen können.“ Insofern<br />
ist es wesentlich, dass in einer ersten Stufe zur Anwendung<br />
des KKS-I zunächst der jeweils vorliegende Korrosionsmechanismus<br />
ermittelt wird. In einer zweiten Stufe sind dann<br />
Abschätzungen zu den Schutzmöglichkeiten vorzunehmen.<br />
Zur grundsätzlichen Abschätzung, ob ein thermodynamisch<br />
stabiler Zustand erreicht werden kann, können die PotentialpH-Diagramme<br />
nach Pourbaix (Bild 4) genutzt werden. In<br />
einem kartesischen Koordinatensystem wird auf der Abszisse<br />
der pH-Wert und auf der Ordinate das Normalpotential, das<br />
mit Hilfe der Nernst-Gleichung ermittelt wird, abgebildet. In<br />
der Regel lassen sich drei Bereiche definieren:<br />
Der Korrosionsbereich mit einem Anteil gelöster Metallionen<br />
> 10-6 mol/l.<br />
Der Passivitätsbereich, in dem vornehmlich die Bildung von<br />
Oxiden und/oder Hydroxiden erfolgt, die bei entsprechender<br />
Haftfestigkeit vor weiteren Korrosionen schützen können.<br />
Der Immunitätsbereich, in dem die Konzentration gelöster<br />
Metallionen < 10-6 mol/l beträgt.<br />
Derartige Diagramme können für alle Metalle erstellt werden.<br />
Umfangreiche Erklärungen finden sich in [1].<br />
Die thermodynamische Betrachtung allein gibt aber noch<br />
keine Information, ob die betrachteten Reaktionen auch tatsächlich<br />
ablaufen. Hierzu ist die Kinetik der elektrolytischen<br />
Teilreaktionen zu untersuchen. Die Potentialabhängigkeit einer<br />
elektrolytischen Reaktion wird dabei durch die Stromdichte-<br />
Potentialkurve beschrieben. Der Stromdichte-Spannungsverlauf<br />
charakterisiert den Reaktionsablauf und erlaubt die<br />
Bild 1: Massiver Korrosionsangriff bis zum Durchbruch an den Wänden<br />
eines 3000 m³ -Solelagertanks; Wandstärke 10 mm; Medium Sole;<br />
Werkstoff Kesselblech H II; Betriebstemperatur 25-45 °C; pH 11; Cl- 300 g/l;<br />
NaOH bis 1,5 g/l; Na 2<br />
CO 3<br />
bis 1 g/l; NaOCl bis 50 ppm; Standzeit < 3 Jahre<br />
Bild 2: Diverse Undichtigkeiten aufgrund von Innenkorrosion an der<br />
Prozesswanne eines Biomassekessels; Medium Rauchgaskondensat;<br />
Werkstoff 1.4571; Betriebstemperatur 56-62 °C; Chloridgehalt des<br />
Kondensats 450 ppm; Standzeit < 5 Jahre<br />
Bild 3: Korrosion durch Elementbildung zwischen Edelstahlschraube<br />
und C-Stahl-Leitblech in einem Reaktionsgefäß zur Aufbereitung von<br />
Sulfatlauge; Medium gesättigte KCL mit Begleitsalzen; Betriebstemperatur<br />
40 °C; spez. Widerstand 3,5 Ωcm; Standzeit < 6 Monate<br />
12 / 2012991
FACHBERICHT<br />
KORROSIONSSCHUTZ<br />
Bild 4:<br />
vereinfachte<br />
Potential-pH-<br />
Diagramme für<br />
Eisen in Wasser mit<br />
den theoretischen<br />
Bereichen für<br />
Korrosion, Immunität<br />
und Passivität [1]<br />
a) Eisen in Wasser<br />
b) Eisen in Wasser<br />
bei 10-2 Mol/l<br />
Chromgehalt<br />
Bestimmung der wesentliche Parameter zur Auslegung des<br />
KKS-I. In der Praxis wird allerdings meist nur die Schutzstromdichte<br />
im Bereich des Schutzpotentials ermittelt. Wie in<br />
DIN EN 12499 aufgeführt, müssen die Schutzpotentiale<br />
aufgrund praktischer Erfahrungen und durch Untersuchungen<br />
individuell bestimmt werden. In Bild 5 ist der kathodische<br />
Ast einer potentiostatisch ermittelten Stromdichte-<br />
Spannungskurve exemplarisch dargestellt. Richtwerte für<br />
Schutzpotentialbereiche werden in DIN EN 12499 für Eisen<br />
und niedrig legierten Stahl, nichtrostenden Stahl, Kupfer und<br />
Kupferlegierungen, Zinn, Zink, Blei, Aluminium und Titan sowie<br />
niedriglegierten Stahl in Verbindung mit nichtrostendem Stahl<br />
und Aluminiumlegierungen mit Magnesium oder Mangan aufgeführt.<br />
Nur wenn sich unter Berücksichtigung aller Einflüsse<br />
das Vorhandensein eines Schutzpotentialbereiches ermitteln<br />
lässt, ist die Anwendung des KKS-I möglich.<br />
BESONDERHEITEN DES KKS-I<br />
Auch wenn das Prinzip des KKS unabhängig vom Anwendungsbereich<br />
wie Außenschutz von Rohrleitungen, Casings, Schutz<br />
von Hafenanlagen oder Innenschutz von Anlagen usw. prinzipiell<br />
stets gleich ist, treten naturgemäß spezifische Besonderheiten<br />
auf, die bei der Planung und Anwendung des KKS-I<br />
zu beachten sind. Ein wesentlicher Punkt ergibt sich durch die<br />
Begrenzung des Innenraumes aufgrund der äußeren Geometrie<br />
des Schutzobjektes, wobei u. U. durch Einbauten weitere<br />
zu beachtende Einflüsse auftreten können. Die Begrenzungen<br />
durch die Geometrie des Objektes haben Auswirkungen auf<br />
die Stromverteilung an der Metalloberfläche und es können<br />
elektrische Abschirmeinflüsse auftreten. Diese Effekte müssen<br />
bei der Anodenkonfiguration spezifisch berücksichtigt<br />
werden. Bei komplizierten Oberflächen kann eine modellhafte<br />
Berechnung der Stromverteilung hilfreich für die Planung der<br />
Anodenpositionen sein [2, 3]. Mitunter bestehen in der praktischen<br />
Ausführung aber Einschränkungen durch die Möglichkeiten<br />
am Objekt selbst, wie z. B. durch freien, verfügbaren<br />
Raum, Zugänglichkeit oder Strömungsbedingungen usw., wie<br />
Bild 6 exemplarisch verdeutlicht.<br />
Weiterhin ist zu beachten, dass sowohl an Kathoden wie<br />
Anoden Gasentwicklung auftreten kann. Vorrangig ist hier<br />
aufgrund der möglichen Knallgasbildung die kathodische<br />
Wasserstoff-Entwicklung von Bedeutung, so dass aus Sicherheitsgründen<br />
bei geschlossenen Behältern Maßnahmen zur<br />
gefahrlosen Ableitung berücksichtigt werden müssen.<br />
PLANUNGSDETAILS UND SCHUTZVERFAHREN<br />
Durch die vielfältigen Einflüsse, die sich aus den verschiedenen<br />
Werkstoffen, Medien, Betriebsbedingungen und der<br />
Objektgeometrie ergeben, ist in der Regel für jeden Einzelfall<br />
ein spezifisches KKS-I-Design erforderlich. In Tabelle 1 sind<br />
die wesentlichen Parameter zusammengestellt, die bei der<br />
Auslegung eines KKS-I-Systems beachtet werden sollten.<br />
NACE SP0575 nennt für die in der Planung zugrunde zu legende<br />
Schutzstromdichte einen Bereich von 50 bis 400 mA/m². Für<br />
Abscheider in der Erdgasförderung, die stark mit CO 2<br />
und H 2<br />
S<br />
beaufschlagt sind, werden in der Literatur [4] Stromdichten<br />
von bis zu 3,45 A/m² genannt, um bei Betriebstemperaturen<br />
von 89 °C kathodischen Schutz zu erzielen. Eigene Untersuchungen<br />
für einen Abscheidungsbehälter in der Kaliindustrie<br />
ergaben eine Schutzstromdichte von über 1 A/m² im Bereich<br />
von stark angeströmten Strömungsbrechern (C-Stahl, v > 3<br />
m/s, T 50 °C, gesättigte, KCL-Sole). Werden die Metalloberflächen<br />
mit geeigneten Materialien beschichtet, so wird eine<br />
drastische Reduzierung der erforderlichen Schutzstromdichte<br />
bewirkt. In der Regel wird durch die Kombination „KKS-I und<br />
Beschichtung der Innenflächen“ wirtschaftlich und technisch<br />
die günstigste Lösung erreicht, auch wenn KKS-I für blanke<br />
Oberflächen durchaus angewandt werden kann.<br />
Die KKS-I-Anlagen können sowohl mit galvanischen Anoden<br />
als auch mit Fremdstrom realisiert werden. In der Praxis<br />
haben sich typische Anwendungsbereiche herausgebildet.<br />
Galvanische Anoden finden bevorzugt Anwendung für den<br />
992 12 / 2012
Bild 6:<br />
Innenraum<br />
einer 2-stufigen<br />
Kreiselpumpe max.<br />
Betriebsdruck<br />
80 bar; Durchsatz<br />
max. 4800 m³/h;<br />
Werkstoffe C-Stahl<br />
und Edelstahl;<br />
Medium Trinkwasser;<br />
Betriebstemperatur<br />
35 °C<br />
Bild 5: Stromdichte-Potentialkurve bei der Polarisation von Stahl<br />
in alkalischer Lösung<br />
Anwendungsvoraussetzungen<br />
Schutzstromdichte(n) ermitteln<br />
Anodendesign zur Erzielung<br />
ausreichender Stromdichten<br />
Konstruktive Maßnahmen<br />
Randeffekte im Elektrolyten<br />
Auswirkungen auf Beschichtungen<br />
Elektrische Kontinuität<br />
Leitfähigkeit des Elektrolyten<br />
Existenz eines gemeinsamen Schutzpotentialbereiches<br />
Elektrolyteinfluss (pH, Salze, Gase)<br />
Beschichtung<br />
Polarisationswiderstand<br />
Betriebsbedingungen (Temperatur, Strömungsgeschwindigkeit)<br />
Beschichtungseigenschaften<br />
Anlagengeometrie<br />
Einführungen für Kabel, Anoden und Messelektroden<br />
Ableitung von Gasen (H 2<br />
, Cl 2<br />
)<br />
Anlagengeometrie<br />
Gasentwicklung<br />
Reaktionsprodukte der Anoden<br />
kathodische Niederschläge<br />
Sauerstoffzehrung<br />
Enthaftung<br />
kathodische Unterwanderung an Beschichtungsfehlstellen<br />
kathodische Blasenbildung in der Beschichtung<br />
alkalische Verseifung<br />
Tabelle 1: Schematische Übersicht wesentlicher Einflussfaktoren zur<br />
Anwendung des KKS-I<br />
Bild 7: Zn-Opferanode in einem Wärmetauscher<br />
im Übergangsbereich Behälter<br />
(C-Stahl) / Kühlrohrbündel (Titan);<br />
Betriebszeit ca. 2 Jahre<br />
Bild 8: Trinkwassertankfarm,<br />
Fassungsvermögen je Tank 100.000 m³<br />
Bild 9: Prozessgefäß, Fassungsvermögen<br />
120 m³<br />
Bild 10: Aktivkohlefilter, Fassungsvermögen<br />
120 m³<br />
12 / 2012993
FACHBERICHT<br />
KORROSIONSSCHUTZ<br />
besteht. In diesem Fall ist, z. B. durch Wellen-Gleitringkontakte,<br />
die niederohmige Verbindung sicher zu stellen.<br />
Meist werden für die Potentialüberwachung beim KKS-I<br />
Bezugselektroden zweiter Art eingesetzt, wobei darauf zu<br />
achten ist, dass die Bezugselektroden für den Einsatz im<br />
jeweiligen Elektrolyten geeignet sind. Hinweise zum Anwendungsbereich<br />
verschiedener Bezugselektroden finden sich in<br />
DIN EN 12499 oder in [5]. Besonderer Beachtung bedarf u. U.<br />
die Temperaturabhängigkeit der Bezugselektroden. In einigen<br />
Fällen kann es auch ratsam sein die Bezugselektroden außerhalb<br />
des kathodisch geschützten Innenraumes zu installieren<br />
und die elektrische Ankopplung über einen Elektrolytschlüssel<br />
zu realisieren.<br />
Bild 11: Krählwerk, Behälterdurchmesser 25 m<br />
Innenschutz von Wassererhitzern, Warmwasserspeichern,<br />
Kühlern, Kondensatoren, Rohölbehältern und Röhren-Wärmetauschern<br />
(Bild 7). Der Fremdstromschutz wird vorrangig<br />
für große Objekte und Objekte in Prozessanlagen angewandt.<br />
Bei der Verwendung von galvanischen Anoden ist zu<br />
beachten, dass u. U. eine große Anodenmasse benötigt wird.<br />
Bei Verwendung von Zink errechnet sich bei einer mittleren<br />
Schutzstromdichte von 100 mA/m² für eine zweijährige Nutzungsdauer<br />
eine Anodenmasse von ca. 240 kg pro 100 m²<br />
unbeschichteter Kathodenfläche. Bei Extremstromdichten<br />
von 2 A/m² resultieren bei gleichen Ausgangsparametern<br />
bereits ca. 4.800 kg. Hier gilt es nicht nur ausreichend Platz<br />
für diese Massen zur Verfügung zu haben, sondern es ist auch<br />
zu bedenken, dass entsprechende Mengen Anodenkorrosionsprodukt<br />
im Medium anfallen. U. U. muss auch bedacht werden,<br />
dass der turnusmäßige Wechsel, insbesondere bei größeren<br />
Anodenmassen, zeitaufwändig wird und damit Auswirkungen<br />
auf die erforderlichen Stillstandzeiten der Anlage haben kann.<br />
Die dominierenden Vorteile des Schutzes mit galvanischen<br />
Anoden durch einfache Installation „keine Stromzuführung<br />
von außen und quasi Wartungsfreiheit“ können damit in Frage<br />
gestellt sein. Grenzen für die Verwendung galvanischer Anoden<br />
bestehen bei sauren Elektrolyten (pH < 5,5), aufgrund der<br />
dann stark zunehmenden Eigenkorrosionsrate. Amphoteres<br />
Verhalten und Potentialumkehr bei erhöhten Temperaturen<br />
gegenüber Stahl kann den Einsatz von Zink weiter begrenzen.<br />
Der KKS-I mit Fremdstrom kann Probleme der Kontamination<br />
des Elektrolyten durch Reaktionsprodukte der Anoden<br />
umgehen, indem Anodenmaterialien ausgewählt werden, die<br />
einen praktisch vernachlässigbaren Abtrag aufweisen, wie<br />
platiniertes oder mit Mischmetalloxiden beschichtetes Titan.<br />
Eine Nutzungsdauer von > 25 Jahren kann bei entsprechendem<br />
Design gewährleistet werden. Wie bei allen technischen<br />
Anlagen ist aber beim Fremdstromverfahren regelmäßige<br />
Wartung unumgänglich und die Anlagen erfordern Potentialkontrolleinrichtungen,<br />
um eine Einstellung auf das erforderliche<br />
Schutzpotential zu gewährleisten. Besonderer Beachtung<br />
bedürfen rotierende Bauteile wie Rührer oder Impeller, da<br />
hier nicht immer davon auszugehen ist, dass eine ausreichend<br />
niederohmige Verbindung zu den übrigen Teilen der Anlage<br />
BEISPIELE ZUR ANWENDUNG DES KKS-I<br />
In [5] sind praktisch ausgeführte Beispiele von KKS-I-Projekten<br />
zu einem Wärmetauscher, einem Öl-Salzwasserbehälter,<br />
einem Tank für Kesselspeisewasser, einem Nassgasometer,<br />
einem Druckfilter-Kessel, einem nickelplatierten Laugen-<br />
Eindampfer und einer Kreiselpumpe aufgeführt. Weitere Beispiele<br />
für die KKS-I-Planungen oder Projektrealisierungen,<br />
die vorgenommen wurden, sind Trinkwassertanks (Bild 9),<br />
Prozessbehälter (Bild 8), Filterbehälter (Bild 10) und Krählwerke<br />
(Bild 11). Bei kathodisch von außen geschützten Rohrleitungen,<br />
die elektrolytisch leitfähige Medien transportieren,<br />
tritt häufig eine Beeinflussung an Isolierverbindungen auf. In<br />
diesem Fall kann mittels einer speziellen KKS-I-Maßnahme,<br />
die nur lokal im Bereich des Isolierflansches wirksam ist, die<br />
Beeinflussung aufgehoben werden.<br />
LITERATUR<br />
[1] Pourbaix, M., Lectures on electrochemical corrosion, Plenum<br />
Press, 1973<br />
[2] Martinez S. and Stern I., A mathematical model for the<br />
internal cathodic protection of cylindrical structures by<br />
wire anodes, Journal of Applied Electrochemistry 30, 2000<br />
[3] Yan J.-F et al., Mathematical modeling of cathodic protection<br />
using the boundary element method with a nonlinear<br />
polarization curve, The Electrochemical Society Inc., No. 7,<br />
Vol. 139, July 1992<br />
[4] Gareth J. et al., Use of internal impressed current cathodic<br />
protection systems for CO2 corrosion control in offshore<br />
seperators, NACE Corrosion 2000, Paper 00011<br />
[5] Baeckmann W. v., et al., Handbuch des kathodischen<br />
Korrosionsschutzes, VCH Verlagsgesellschaft mbH<br />
AUTOR<br />
DIPL.-ING. NORBERT TENZER<br />
TZ-International Corrosion Con.<br />
Tel. +49 2331 591032<br />
E-Mail: N.Tenzer@tz-icc.eu<br />
994 12 / 2012
PRODUKTE & VERFAHREN<br />
KORROSIONSSCHUTZ<br />
Kathodischer Korrosionsschutz<br />
(KKS) und Fernwirktechnik im<br />
Wandel der Zeit<br />
Von Daniel Steller, Volkhard Schröder, Daniel Radtke<br />
Seit den 1980er Jahren setzen sich Fernüberwachungsgeräte auch an KKS-Stationen durch. Bereits 1990 folgten erste<br />
Kompaktgeräte, die sogar schon in Messpfähle passten und die die erfassten Messdaten auch von entfernten Messpunkten<br />
über die Rohrleitung oder per C-Netz übertrugen. Mit Einführung der D-Netze folgten die bis heute bekannten KKS-<br />
Fernüberwachungsgeräte, die meist per SMS-Daten an eine Zentrale senden. Die moderne Technik bietet jedoch seit Jahren<br />
mehr Möglichkeiten, bei gleichzeitig wesentlich reduzierter Hardware.<br />
Immer mehr Betreiber von KKS-Anlagen verlangten in den<br />
letzten Jahren zu Recht bei den Planungen zur Ausrüstung<br />
ihrer Systeme die Nutzung modernerer Kommunikationswege<br />
und zusätzlichen technischen Nutzen.<br />
Es war einfach nicht mehr Stand der Technik, an Stationen<br />
mehrere Fernwirkgeräte zu betreiben und dazu<br />
eventuell auch mehrfach die Kommunikationsnetze wie<br />
GSM belegen zu müssen. Auch sollte es möglich sein, die<br />
Fernwirkgeräte direkt anzusprechen und Parameter „live“<br />
zu ändern, oder neben den täglich eingestellten Standardmessungen<br />
spontan auch aktuelle Messwerte einzusehen<br />
oder zu loggern.<br />
Die Steffel KKS GmbH entwickelte 2009 die modulare<br />
Produktreihe ISM2010 (Bild 1). Aufbauend auf den zuvor<br />
im Stationsbereich weit verbreiteten Multifunktionsgeräten<br />
ISM2000 deckt das neue Fernwirkgerät nun bereits<br />
seit 2010 die Wünsche der Anwender nach individuellen<br />
Möglichkeiten ab.<br />
MESSTECHNIK<br />
Die Messtechnik wurde grundsätzlich dual (DC + AC parallel),<br />
optimal gefiltert (parametrierbar) und die Kanäle potentialfrei<br />
zueinander aufgebaut. Die Auflösung der Potentialmesskanäle<br />
ist sowohl in der Lage, DC-Werte bis zu 1 mV als auch<br />
etwaige AC-Beeinflussungen bis 100 V noch sauber parallel<br />
zu erfassen. Frei konfigurierbare Standard-Abtastraten und<br />
zusätzliche „Loggerspuren“, die z. B. im Hinblick auf mögliche<br />
Beeinflussungs-Untersuchungen interessant sind, wurden<br />
integriert. Über die Loggerspuren kann der Anwender parallel<br />
zu den Standardmessungen bis zu zwei Messspuren,<br />
z. B. im Raster von 1 s, mitloggern und sich diese grafisch<br />
oder tabellarisch ansehen oder exportieren.<br />
Flexibilität, genau wie in modernen SPS-/Automationssystemen,<br />
ermöglicht das ISM 2010. Anwender, die mehr als<br />
nur Ausgangsspannung, Ausgangsstrom und das Potential<br />
überwachen wollen, stecken zu den drei integrierten Messkanälen<br />
einfach weitere Messwertkarten hinzu. Bis zu 35 Kanäle<br />
Bild 1: Das kompakte KKS-Multitalent ISM2010<br />
Bild 2: Prinzipaufbau von modernen Fernwirkkomponenten<br />
12 / 2012995
PRODUKTE & VERFAHREN<br />
KORROSIONSSCHUTZ<br />
(jeweils DC+AC) können derzeit pro Fernwirkgerät zeitgleich<br />
erfasst werden. Damit ergibt sich ein breites Anwendungsspektrum,<br />
das z. B. für Betreiber von Parkhäusern (Schutz von<br />
Stahl in Beton), über Hafenanlagen und Spundwänden bis hin zu<br />
großen LKS-Anlagen (lokaler kathodischer Korrosionsschutz)<br />
interessant ist. Das ISM2010 bietet für alle KKS-Betreiber<br />
die Möglichkeit, große Datenmengen mit einem einzigen<br />
Fernwirkgerät vor Ort erfassen zu können. Denn auch an<br />
KKS-Stationen von Rohrleitungsnetzen fordert die zusätzliche<br />
Erfassung von Rohrströmen, Ableitströmen, Messproben usw.<br />
(speziell DC+AC) künftig immer Daten. Die Systemerweiterungen<br />
können auch später nachgerüstet werden.<br />
INDIVIDUELLE KOMMUNIKATIONSWEGE<br />
Bezüglich der Anbindung der Geräte wurde darauf Wert<br />
gelegt, dass alle modernen Übertragungswege unterstützt<br />
werden. Die ISM2010-Fernwirkgeräte sind somit für den<br />
Betrieb mit integrierten Mobilfunk-, Ethernet- oder herkömmlichen<br />
Analog- oder ISDN-Modems geeignet. Durch<br />
die Nutzung von externen Mediakonvertern können Ethernetbasierte<br />
ISM2010 auch über andere existierende Verbindungen<br />
wie z. B. über LWL oder ADSL eingebunden werden.<br />
Die Geräte sind somit über alle Verbindungsarten, selbst via<br />
Mobilfunk, bidirektional ansprechbar.<br />
Das Gerät kann über einen Systembus um weitere Systemfunktionen<br />
oder Komponenten aufgestockt werden, wie<br />
Erweiterungsmodule, Zusatz-Messkanäle oder die Gleichrichterkommunikation.<br />
Meldeeingänge können zusätzliche Funktionen<br />
ausführen (z. B. Start der manuellen Taktung auslösen)<br />
oder einfach nur Informationen an die Zentrale absetzen (z. B.<br />
Türmeldekontakt der Stationstür).<br />
Neben dem internen und frei parametrierbaren Taktrelais,<br />
das durch GPS oder DCF zeitsynchronisiert wird, kann ein<br />
weiteres integriertes Relais z. B. zum Schalten einer Warnleuchte<br />
oder Ausgabe einer Meldung an eine SPS genutzt<br />
werden. Zur lokalen Konfiguration der Geräte steht ferner<br />
eine RS232-Serviceschnittstelle zur Verfügung. Anschlüsse<br />
für Versorgungsspannung, Messkanäle, Melde-Ein- und<br />
-Ausgänge, GPS bzw. DCF-77-Antennen und internen Gerätebus<br />
(auch zur Kommunikation mit den Gleichrichtern) sind<br />
über Steckkontakte herausgeführt. Einige Anwender nutzen<br />
die Möglichkeit, sich die KKS Werte über das ISM2010<br />
vorgefiltert und optimal aufbereitet über Profibus-DP in ein<br />
vorhandenes Leitsystem einspielen zu lassen. Die Zuordnung<br />
der über den Bus ausgegebenen Werte kann mit der Servicesoftware<br />
komfortabel auf individuelle Kundenwünsche<br />
parametriert werden.<br />
EINSATZBEREICHE<br />
Mit der Auslegung der Betriebsspannung von 8 – 32 V DC<br />
und optionalem USV-Systemnetzteil entspricht das ISM2010<br />
sämtlichen Anforderungen an seine Umgebung, egal ob in 12<br />
V- oder 24 V-Solarstationen bzw. netzversorgt. Das integrierte<br />
Taktmodul kann Messproben, Schutzstromanlagen oder<br />
andere Baugruppen vor Ort schalten oder takten – durch<br />
Anschluss einer GPS- oder DCF-Antenne auf Wunsch zeitsynchron<br />
mit allen anderen eingebundenen Geräten. Anwender<br />
sparen somit Kosten für autarke Taktgeräte und haben<br />
jederzeit vollen Zugriff auf die Schalt-/Taktparameter aus<br />
der Ferne.<br />
STUFENLOSE FERNSTEUERUNG VON<br />
KKS-GLEICHRICHTERN<br />
Das Gerät dient auch zur stufenlosen Fernsteuerung von<br />
KKS-Gleichrichtern. Egal ob ein Neugerät in elektronischer<br />
Bild 3: KKS-Schutzanlage mit Netzteil, GSM-Fernwirktechnik und<br />
stufenlos fernverstellbarem Schutzstromgerät, davor vergrößert<br />
dargestellt ist das ISM-Schrittmotorset<br />
Bild 4: Systemvisualisierung auch z. B. auf einem Tablet PC<br />
996 12 / 2012
Ausführung oder mit einem Fernsteuerset als Nachrüstsatz,<br />
mit dem ISM 2010 hält sich der Anwender alle Möglichkeiten<br />
offen. Die grundsätzliche Art der Schutzstromerzeugung<br />
(mechanisch/elektronisch) bleibt somit auch bei Wunsch nach<br />
geregelten oder ferngesteuerten Gleichrichtern eine freie<br />
Entscheidung des Betreibers.<br />
Das Fernsteuerset ermöglicht es, die meist schon bestehenden<br />
und bewährten Stelltrafo-Schutzstromgeräte kostengünstig<br />
mit einer stufenlosen Regelung oder Fernsteuerung<br />
nachzurüsten. Hierzu wird der jeweilige Betätigungsknauf von<br />
der Stelltrafo-Achse gegen das intelligente Schrittmotorset<br />
ausgetauscht, mit Spannung versorgt und per Verbindungskabel<br />
direkt an den Systembus der KKS-Fernwirktechnik angeschlossen.<br />
Durch die hohe Auflösung der verwendeten Schrittmotoren,<br />
der Steuerungselektronik sowie des zusätzlichen Getriebes<br />
erfolgt die Justage der Ausgangswerte stufenlos.<br />
Bis zu 24 Fernsteuersets, d. h. also bis zu 24 einzelne<br />
Schutzstromgeräte können parallel am Systembus eines einzigen<br />
ISM2010-Fernwirkgerätes betrieben werden. Die Multikanal<br />
Fernsteuerung von KKS-Gleichrichtern bietet vor allem im<br />
Bereich des Schutz von Stahl in Beton (z. B. Parkhäusern) oder<br />
der Einzelanodensteuerungen im lokalen kathodischen Korrosionsschutz<br />
seinen Anwendern ein enormes Einsparpotential.<br />
oder Steuern von Gleichrichtern.<br />
Der Zugang ist über alle gängigen Browser, auch der<br />
moderner Smartphones oder Tablet PCs (Bild 4) möglich,<br />
die Zugriff auf das Internet (bzw. bei lokaler Installation auf<br />
das entsprechende Firmen-Netzwerk) haben.<br />
Das KKS-Managementsystem kann in hierarchischer Form<br />
genutzt werden, wird aber vor allem wegen seiner Möglichkeit<br />
für individuelle Visualisierungen geschätzt. So können Fotos<br />
oder Grafiken von Systemnetzplänen hinterlegt, einzelne Stationen<br />
als aktive Elemente mit Funktionalitäten überlagert,<br />
Links zu anderen Web-Ressourcen hinterlegt (z. B. Geo-<br />
Informationswebseiten) u. a. ermöglicht werden.<br />
Das Festlegen von Referenzwerten, Rechenoperationen,<br />
grafische oder tabellarische Auswertungen, interaktive Meldungen,<br />
Anzeige von Grenzwertverletzungen, Trends, Potentialverläufe,<br />
volle Ereigniskontrolle im Meldebuch, Speichern<br />
von grafischen Charts, Export von Tabellen zu Excel oder als<br />
pdf sind weitere Beispiele dafür, dem Anwender der KKS-<br />
Fernwirkzentrale „MS2010“ die Arbeit so angenehm wie<br />
möglich zu machen. Die Kommunikation mit den eingebundenen<br />
Geräten geschieht in beide Richtungen. Über die konfigurierbare<br />
Alarmkaskade können Anwender sich zusätzlich<br />
über bestimmten Meldungen per E-Mail informieren lassen.<br />
DIE KKS FERNWIRKZENTRALE<br />
Aufbauend auf die KKS-Fernwirksoftware „Checkpoint“ und<br />
abwärtskompatibel zu älteren Fernwirkgeräten entspricht die<br />
neue Fernwirkzentrale auch dem Wunsch nach systemunabhängigen<br />
und somit ausgegliederten Hauptkomponenten der<br />
Hard- und Software. Die heutige, als „Cloud Lösung“ bekannte<br />
Strategie wurde bereits 2009 Bestandteil des neuen Systems.<br />
Hierbei steht es den Anwendern frei, ob sie die Software<br />
zentral auf eigener Hardware installieren oder die Vorteile der<br />
Nutzung des angebotenen Online-Zugangs nutzen.<br />
Der große Vorteil, den viele Kunden der Cloud-Variante<br />
nutzen ist der, dass Steffel zusätzlich die Auswertung der<br />
jeweiligen KKS-Daten übernehmen kann. Das Unternehmen<br />
stellt Anwendern optional die nötigen Daten in Form von<br />
Quartals- oder Monatsberichten regelmäßig zur Verfügung.<br />
Auf Besonderheiten, Alarme oder Ausfälle wird sofort reagiert<br />
und der Kunde umgehend informiert.<br />
Anwender können sich natürlich auch stets selbst einloggen<br />
und haben – je nach Rechtevergabe – die Möglichkeiten zum<br />
direkten Takten von Anlagengruppen, Ändern von Parametern<br />
FAZIT UND ZUKUNFT<br />
Moderne KKS-Fernwirktechnik erledigt heute längst die verschiedensten<br />
Aufgaben. Eine aufwändige Komponentenvielfalt<br />
ist selbst für datenintensive oder ferngesteuerte Anlagen<br />
nicht erforderlich. So setzten Kunden das ISM2010 leicht<br />
modifiziert auch in den Fachbereichen Strom und Gas als<br />
Fernwirkgeräte zur Übertragung von Meldungen, Messwerten<br />
und Befehlen ein. Die Entwicklung bleibt nicht stehen. Ständig<br />
wird in Sachen Hard- und Software weiterentwickelt. So wird<br />
2013 der Outdoor KKS-Sensor für jene Bereiche mit Batterieversorgung<br />
und geringem Platzbedarf durch ein neues System<br />
abgelöst. Der nach IP65 gefertigte Pfahlsensor PS2005 wird<br />
u. a. eine verbesserte Messtechnik sowie zusätzliche Ausstattungsmerkmale<br />
erhalten und die mobile Datenerfassung im<br />
KKS wird um ein neues Multifunktionsgerät erweitert.<br />
KONTAKT<br />
STEFFEL KKS GMBH, Lachendorf, Tel. +49 5145 9891-200,<br />
E-Mail: steffel@steffel.com, www.steffel.com<br />
Jetzt Mediadaten<br />
Kontakt: Helga Pelzer<br />
+49 201 82002-35<br />
h.pelzer@vulkan-verlag.de<br />
2013 anfordern!<br />
12 / 2012997
FASZINATION TECHNIK<br />
KNOCHENARBEIT IM DÜKER<br />
Abbau von Carbonat-Sinterablagerungen aus einer über 100 Jahre alten Stahldükerleitung unter<br />
dem Rhein-Herne Kanal bei Oberhausen. In den Düker wurde anschließend im Relining-Verfahren<br />
ein PEHD-Rohrstrang zur Ableitung der Abwässer der neuen Stadtmitte Oberhausen eingezogen<br />
FOTOGRAF: ULRICH WINKLER
PRODUKTE & VERFAHREN<br />
4 pipes GmbH<br />
Sichere und optimale Abdichtung<br />
bei Mauerdurchführungen<br />
Die 4 pipes GmbH verfügt über Kernkompetenzen im<br />
Bereich der Wanddurchführungen und Dichtungen und ist<br />
Problemlöser und Komplettanbieter für nahezu alle Anforderungen<br />
und Anwendungen im Rohrleitungsbau. Die Produktpalette<br />
umfasst Gliederkettendichtungen Typ Inner-<br />
Links und Pressio-Ringraumdichtungen, Labyrinthdichtungen,<br />
Mauerkragen sowie Compenseal-Dichtungen für Leitungen<br />
mit Rohrbewegungen. Mauerhülsen und Dichtmassen für<br />
besondere Problemlösungen runden diesen Bereich ab.<br />
InnerLinks-Gliederkettendichtungen dichten Ringräume<br />
sicher wasser- und gasdicht ab. Sie sind durch ihre abgestuften<br />
Größen flexibel einsetzbar für die verschiedensten<br />
Kombinationen von Mauerhülsen/Kernbohrungen und<br />
Medienrohren. Die Dichtungen sind grundsätzlich dicht gegen<br />
drückendes Wasser. Die InnerLinks-Gliederkettendichtungen<br />
sind immer auch für nachträgliche Montage geeignet.<br />
Nicht geeignet sind sie bei besonders dünnwandigen PE-<br />
Rohren (z.B. flexible Fernwärmerohre). Für diese Anwendungen<br />
bietet 4 pipes die Pressio Ringraumdichtung für<br />
Fernwärmerohre. Diese Pressio Ringraumdichtungen sind<br />
eine weitere Variante zur sicheren Ringraumabdichtung von<br />
Mauerdurchführungen bei Rohrleitungen. Die Dichtungen sind<br />
grundsätzlich dicht gegen drückendes Wasser mit Druckscheiben<br />
aus rostfreiem Edelstahl und extra weichem Elastomer.<br />
Speziell nach Kundenwunsch angefertigt werden die<br />
Pressio-Individual Ringraumdichtungen. Sonderausführungen<br />
für die unterschiedlichsten Rohrformgebungen sowie u. a.<br />
exzentrische Durchführungen mehrerer Rohre oder Kabel<br />
gehören zur besonderen Kompetenz von 4 pipes.<br />
Compenseal Abdichtmanschetten werden bei zu erwartenden<br />
Rohrbewegungen oder -setzungen vor die Wand<br />
geflanscht. Das System bietet eine sichere Abdichtung bis<br />
0,5 bar. Die Abdichtung eignet sich insbesondere für warmgehende<br />
Leitungen wie Nah- oder Fernwärmerohre.<br />
Labyrinthdichtungen werden bei Bauwerksdurchführungen,<br />
insbesondere von vorisolierten Rohrleitungen für Nah- und<br />
Fernwärme, als Wasserstop direkt in der Wand mit einbetoniert.<br />
Ein hochwertiger Gummi garantiert höchste Sicherheit<br />
bis 2 m Wassersäule.<br />
Mauerhülsen aus Kunststoff, Faserzement oder Stahl<br />
dienen in Kombination mit den Pressio- und InnerLinks-<br />
Ringraumdichtungen zur Durchführung von Medienrohren<br />
und Kabeln jeglichen Materials durch Decken, Wände und<br />
Böden. Sie formen eine perfekte Maueröffnung für die<br />
Ringraumdichtung.<br />
Alle Produkte gewährleisten den sicheren Verschluss einer<br />
Mauerdurchführung von Gas-, Wasser-, Abwasserrohren und<br />
Kabeln gegen drückendes und nichtdrückendes Wasser.<br />
»KONTAKT: 4 pipes GmbH, Nürnberg, Tel. +49 911 81006-0,<br />
E-Mail: info@4pipes.de, www.4pipes.de<br />
Compenseal Abdichtmanschetten bieten eine sichere<br />
Abdichtung bis 0,5 bar<br />
Pressio-Ringraumdichtungen sind grundsätzlich dicht gegen<br />
drückendes Wasser<br />
1000 12 / 2012
Berkefeld VWS Deutschland GmbH<br />
Hochmobile Trinkwasseraufbereitung<br />
im Einsatz<br />
Auf der erstmals stattgefundenen Hausmesse des Technischen<br />
Hilfswerks (THW) im niedersächsischen Barme präsentierte<br />
Berkefeld die mobile Wasseraufbereitungsanlage des Typs<br />
TWA 4 light im laufenden Betrieb. Die TWA 4 light produziert m 3<br />
Trinkwasser pro Stunde und kann damit im Einsatz für Hilfsorganisationen<br />
bis zu 10.000 Menschen versorgen. Sie entspricht den<br />
speziellen Anforderungen der weltweiten Katastrophenhilfe und<br />
zeichnet sich durch einfache und sichere Handhabung bei Betrieb,<br />
Aufbau und Transport sowie eine verlässliche Prozesstechnik aus.<br />
Auf Basis der Erfahrungen von Trinkwasserexperten aus<br />
Hilfsorganisationen und den Einsatzerfahrungen mit anderen<br />
mobilen Anlagentypen wurde die TWA 4 light den speziellen<br />
Anforderungen im Einsatz in Katastrophengebieten entsprechend<br />
konzipiert. Sie vereint eine Reihe von Prozessschritten,<br />
die, aufeinander abgestimmt, die meisten süßen Oberflächenwässer<br />
problemlos zu Trinkwasser aufbereiten. Als ersten<br />
Schritt hinter der Rohwasserförderung sieht das System eine<br />
Inline-Flockungsstrecke vor, die damit eine Wasserproduktion<br />
innerhalb von kürzester Zeit ermöglicht. Nach einer Sandfiltration<br />
erfolgt eine Aktivkohlefiltration zur Entfernung letzter<br />
verbliebener Schmutzstoffe. Eine anschließende Depotchlorung<br />
verhindert eine Wiederverkeimung des Trinkwassers. Komplettiert<br />
wird das System durch eine Reinwasserlagerung für rund<br />
10.000 Liter und eine Verteilung über zwei Entnahmestation mit<br />
selbstschließenden Hähnen. Da die gesamte Anlage mit Dieselpumpen<br />
betrieben wird, entfällt jegliche Stromversorgung. Unter<br />
Ausnutzung von natürlichem Gefälle kann der Energieaufwand<br />
für die Anlage weiter minimiert werden. Transportiert wird die<br />
verpackte Anlage auf nur zwei Europaletten. Die TWA 4 light<br />
ist mit jedem Airliner wie auch auf dem Landweg leicht an den<br />
Einsatzort zu bringen und ist damit hochmobil und nicht auf<br />
zusätzliche Umschlagsgeräte angewiesen.<br />
Die TWA 4 light wurde bereits von mehreren Rotkreuzorganisationen<br />
in Krisengebieten wie etwa nach den Überschwemmungen<br />
in Pakistan mit Erfolg eingesetzt. „Bewährt<br />
haben sich im Einsatz die extrem hohe Mobilität der Anlage<br />
und die äußerst einfache und sichere Handhabung bei Aufbau,<br />
Betrieb und Rückspülung der Filter“, betonte Yannick Liedtke,<br />
der zuständige Projektleiter beim Wassertechnikunternehmen<br />
Berkefeld. „Bei der Verarbeitung und den Komponenten<br />
der Anlagen stellen wir eine hohe Qualität sicher, und die<br />
logistische Versorgung kann für die meisten Ersatzteile und<br />
Betriebsstoffe vor Ort im Einsatzland erfolgen.“ Auch bei<br />
einem hohen Verschmutzungsgrad des Rohwassers erfüllt das<br />
daraus erzeugte Trinkwasser die Anforderungen der Weltgesundheitsorganisation<br />
WHO.<br />
Die Trinkwasseraufbereitungsanlage TWA 4 light präsentiert auf der THW-<br />
Hausmesse. Hilfsorganisationen und Militär informierten sich hier über den<br />
Stand der Technik in der mobilen Wasseraufbereitung<br />
»KONTAKT: Berkefeld VWS Deutschland GmbH,<br />
Veolia Water Solutions & Technologies, Celle, Stefan Jakubik,<br />
Tel. +49 05141 803-174, E-Mail: stefan.jakubik@veoliawater.com<br />
Der einfache Aufbau der TWA 4 light ermöglicht eine zügige<br />
Inbetriebnahme und einfache und sichere Handhabung bei<br />
Betrieb und Rückspülung<br />
12 / 20121001
PRODUKTE & VERFAHREN<br />
egeplast international GmbH<br />
Einsatzspektrum der HexelOne ® -<br />
Hochdruckrohre erweitert<br />
egeplast HexelOne®-Rohre können nun auch grabenlos verlegt<br />
werden. Einsetzbar sind die Hochdruckrohre mit Schutzmantel<br />
für die offene Verlegung im Sandbett, die offene,<br />
egeplast HexelOne ® -Hochdruckrohre können nun auch<br />
für alternative Verlegetechniken eingesetzt werden<br />
sandbettfreie Verlegung, Pflügen, Fräsen, Relining und HDD.<br />
Das werkstoffhomogene Hochdruckrohr aus Polyethylen ist<br />
bis zu 32 bar (Wasser) bzw. 16 bar (Gas) belastbar.<br />
Der Einsatz in alternativen Verlegemethoden wird möglich<br />
durch eine punktlastbeständige Innenschicht aus dem<br />
Werkstoff PE 100-RC sowie einen additiven Schutzmantel<br />
aus abriebfestem Polypropylen.<br />
Während bislang die Schutzmantelrohre<br />
des innovativen<br />
Herstellers von Kunststoffrohrsystemen<br />
aus Greven einen farbigen<br />
Mantel hatten, werden die<br />
silberfarbenem HexelOne®-Rohre<br />
künftig mit einem transparenten<br />
Außenmantel geliefert. Die<br />
Zertifizierung durch den TÜV ist<br />
bereits erteilt worden. Der transparente<br />
Mantel ermöglicht den<br />
Schutz eines integrierten rücklesbaren<br />
Barcodes. Als Varianten<br />
bietet egeplast die HexelOne®-<br />
Hochdruckrohre ab sofort auch<br />
mit Diffusionssperrschichten<br />
(SLA®), Leiterbändern zur Rohrortung<br />
(DCT®) und Detektionsschichten (3L®) an.<br />
»KONTAKT: egeplast international GmbH, Greven, Tel. +49 2575-<br />
9710-100, E-Mail: info@egeplast.de, www.egeplast.de<br />
Wavin GmbH<br />
Angebotspalette für PE 100-Rohre<br />
um Double Layer erweitert<br />
Die Wavin GmbH mit den Standorten Twist und Westeregeln<br />
wird im Januar 2013 ein neues Produkt offerieren: Wavin<br />
PE-100 Double Layer wird die bisher in Vollwand gefertigten<br />
PE-100 Gas- und Wasserrohre ergänzen. Dabei handelt es sich<br />
um ein coextrudiertes PE 100-Rohr mit einer innenliegenden,<br />
schwarzen Trägerschicht und einer außenliegenden, ca. zehnprozentigen,<br />
farblichen Signalschicht. Die Regelbelastungen<br />
für das neue Produkt werden durch die Qualitätsanforderungen<br />
nach GW 335-2 festgelegt:<br />
»»<br />
Betriebs-und Prüfdrücke nach SDR-Klassen, Transportmedien<br />
Gas und Wasser<br />
»»<br />
Lieferbar als Stangenware, Ringbund oder auf<br />
Jumbotrommeln<br />
»»<br />
Aufnahme von Verkehrslasten bis SLW 60 bei Standardüberdeckungen<br />
0.8 m - 2.5 m<br />
»»<br />
100 Jahre Lebensdauer bei Verlegung im Sandbett<br />
Das Produkt wird zunächst im Nennweitenbereich 90-450 mm<br />
verfügbar sein. Die Fertigung<br />
erfolgt gemäß den Vorgaben<br />
der DIN EN 1555 / DIN EN 12201.<br />
Vorgaben zu Transport,<br />
Lagerung, Installation, Verbindung<br />
und Inbetriebnahme<br />
sind in der KRV-Verlegeanleitung<br />
A 135 „PE 80 und PE<br />
100“ Druckrohre, Trink- und<br />
Abwasserversorgung außerhalb<br />
von Gebäuden verfügbar.<br />
»KONTAKT: Wavin GmbH, Twist,<br />
Tel. +49 5936 12-0,<br />
E-Mail: info@wavin.de,<br />
www.wavin.de<br />
Wavin PE 100 Double Layer sind<br />
langlebige Druckrohre zur Verlegung<br />
im Sandbett<br />
1002 12 / 2012
STEULER-KCH GmbH<br />
Mit Bekaplast Aqua-Lining 400<br />
Trinkwasserspeicher clever abdichten<br />
Trinkwasserbehälter stellen einen wichtigen Baustein in<br />
der Grundversorgung der Bevölkerung mit dem lebensspendenden<br />
Nass dar. Gleich, welcher Bauart sie sind, alle müssen<br />
über eine Abdichtung verfügen. Sie schützt den Beton und<br />
verhindert, dass Wasser verloren geht oder verunreinigende<br />
Stoffe mit ihm in Berührung kommen. In der Vergangenheit<br />
kamen dafür häufig Beschichtungen oder Auskleidungen mit<br />
Spezialmörteln, Edelstahl oder Fliesen zum Einsatz. Doch<br />
nach vielen Jahren im Dauergebrauch müssen etliche der<br />
Auskleidungen nun ersetzt werden.<br />
Dazu entwickelte STEULER-KCH das flexible Auskleidungssystem<br />
Bekaplast Aqua-Lining 400, dessen Werkstoff für den<br />
Einsatz mit Trinkwasser zugelassen ist: Das System besteht<br />
aus flexiblen Platten mit den Abmessungen 4.000 x 2.020 x<br />
4 mm oder Rollenware aus Polyethylen hoher Dichte (PE-HD),<br />
die auf ihrer Rückseite über 400 konische Ankernoppen pro<br />
m 2 verfügen. Sie sorgen für die kraftschlüssige und unlösbare<br />
Verbindung von Untergrund und den PE-HD-Platten.<br />
Bekaplast Aqua-Lining 400 lässt sich an jede Behältergeometrie<br />
anpassen, auch Durchdringungen und Sonderlösungen<br />
sowie Vorkonfektionierungen sind kein Problem. Alle Stoßkanten<br />
erhalten eine flüssigkeitsdichte Schweißnaht. Mittels<br />
Funkeninduktor lässt sich die Dichtigkeit sicher nachweisen.<br />
Das System ist auf Leckagen hin überwachbar. Seine Oberfläche<br />
ist glatt, antiadhäsiv sowie physiologisch unbedenklich<br />
und weist hohe mechanische und chemische Beständigkeit<br />
auf. Es ist für Temperaturschwankungen im Behälter von bis<br />
zu 20 °Celsius geeignet.<br />
Bei Neubauten von Beton-Trinkwasserspeichern kommen<br />
die Vorteile der Rollenware deutlich zum Tragen: Das Endlossystem<br />
von 2.020 mm Höhe und einer Länge von 50.000<br />
mm verringert die Zahl der Schweißnähte<br />
gegenüber Standardplatten erheblich. Die<br />
PE-HD-Auskleidung wird vor dem Gießen<br />
des Betons einfach an die innere Wandverschalung<br />
angelegt. Nach dem Aushärten<br />
des Baukörpers bildet sie die fertige innere<br />
Verkleidung, die im günstigsten Fall nur<br />
über eine einzige senkrechte Schweißnaht<br />
verfügt. Die Boden- und Deckenauskleidung<br />
erfolgt nach dem gleichen Prinzip im<br />
Estrich und im Deckenbeton. Ihre verbliebenen<br />
Plattenstöße sind mit Profilen hinterlegt<br />
und noch flüssigkeitsdicht zu verschweißen.<br />
Dieses vergleichsweise schnelle und flexible<br />
Einbringen der Auskleidung spart viel Zeit<br />
und damit Kosten.<br />
Auch für die schnelle und preisgünstige<br />
Nachrüstung oder Sanierung bestehender<br />
Behälter ist das System bestens geeignet:<br />
Bestehende Altauskleidungen wie Fliesen,<br />
Beschichtungen und Anstriche brauchen in der<br />
Regel nicht demontiert zu werden. Das spart<br />
erheblich Zeit und Kosten. Auf die Altauskleidung<br />
aufgedübelte Einschubleisten fixieren die Ankernoppen<br />
der PE-HD-Platten formschlüssig. Dadurch<br />
lassen sich auch Risse im Untergrund einfach und<br />
sicher und ohne aufwändige Reparaturarbeiten<br />
überbrücken. Zusätzlich befestigte PE-HD-Leisten<br />
erlauben es, die Plattenstöße sicher, flüssigkeitsdicht<br />
und kraftschlüssig zum Untergrund zu<br />
verschweißen.<br />
STEULER-KCH hat seit mehr als 50 Jahren<br />
Erfahrungen mit thermoplastischen Auskleidungen<br />
der Marke Bekaplast. Daraus entstand Bekaplast<br />
Aqua-Lining 400 in seiner unverwechselbaren<br />
blauen Farbe. Das Unternehmen unterstützt auf<br />
Wunsch die komplette Planung und Produktion<br />
sowie auch den Einbau mit eigenen Monteuren.<br />
»KONTAKT: STEULER-KCH GmbH, Siershahn,<br />
E-Mail: ingolf.zoeller@steuler-kch.de<br />
Diese Grafik stellt den<br />
Unterschied des Aqualining<br />
400-Auskleidungssystems<br />
in der Befestigungsart<br />
bei Neubau (oben) oder<br />
Sanierung (unten) sehr<br />
anschaulich dar<br />
Unverwechselbar durch seinem typischen blauen Farbton,<br />
schützt das Aqua-Lining 400-Auskleidungssystem diesen<br />
Trinkwasserspeicher. Die Dichtigkeitsprüfung mittels<br />
Funkeninduktor stellt die absolute Wasserundurchlässigkeit<br />
des Trinkwasserspeichers sicher<br />
12 / 20121003
PROJEKT KURZ BELEUCHTET<br />
ENERGIEVERSORGUNG<br />
Innensanierung einer Kühlwasserleitung<br />
mit RS BlueLine ®<br />
Bei diesem Auftrag kam es buchstäblich auf jede Minute an: Bereits bei der Planung der Sanierung der Kühlwasserhauptleitung<br />
DN 600 in einem Heizkraftwerk musste der zeitliche Ablauf optimiert werden, um die Ausführungszeit zu minimieren. Lediglich<br />
fünf Werktage standen den Sanierungsspezialisten von der DIRINGER&SCHEIDEL ROHRSANIERUNG GmbH & Co. KG, NL Herne, für<br />
den Einbau eines so genannten RS BlueLiners® inklusive aller nötigen Vor- und Nacharbeiten zur Verfügung. Zumindest sahen das<br />
die Ausschreibungsunterlagen der Planer vor, die im Auftrag der Kraftwerksbetreiber die Sanierungsarbeiten begleiteten. Und das<br />
Verfahren, bei dem ein flexibler Schlauchträger mit einem Zweikomponenten-Epoxidharz imprägniert, in die zu sanierende Leitung<br />
eingebracht und anschließend durch Wärmezufuhr mit Warmwasser zu einem neuen Rohr ausgehärtet wird, hat alle Erwartungen<br />
erfüllt. Wie vorgesehen konnte das Heizkraftwerk nach Abschluss der geplanten Revisionsarbeiten pünktlich wieder ans Netz gehen.<br />
„Nicht nur der Zeitdruck trug zu den besonderen Rahmenbedingungen<br />
der Baumaßnahme bei“, erinnert sich Bauleiter Dipl.-Ing.<br />
(FH) Jens Wahr, DIRINGER&SCHEIDEL ROHRSANIERUNG GmbH<br />
& Co. KG, NL Herne. Die zu sanierende Kühlwasserhauptleitung<br />
verläuft zwischen Pumpenhaus und Hauptgebäude des Heizkraftwerkes<br />
und unterquert eine öffentliche Straße, die während<br />
der Sanierungsarbeiten zwingend freizuhalten war. Darüber<br />
hinaus war die Leitung für den maschinentechnischen Einsatz<br />
nur vom Pumpenhaus aus zugänglich. Am Startpunkt wurde<br />
ein T-Stück ausgebaut, um die Haltung für die spätere Inversion<br />
vorzubereiten. Ebenso schwer zu erreichen war der Endpunkt<br />
der rund 40 m langen Leitung. „Ihr Ende befindet sich im Hauptgebäude<br />
und ist nur zu Fuß über enge Gänge und eine Treppe<br />
erreichbar“, beschreibt Wahr die Situation vor Ort. Da sie sich<br />
zudem in rund 3 m Höhe befindet, musste zur Erreichbarkeit<br />
bauseits ein Gerüst erstellt werden.<br />
Enges Zeitfenster<br />
Alles Arbeiten, die die Beteiligten vor hohe logistische und<br />
technische Herausforderungen stellten, zumal alles innerhalb<br />
des genau definierten Zeitfensters über die Bühne gehen<br />
musste, in dem sich die Anlage aufgrund einer Revision außer<br />
Betrieb befand.<br />
Bei der alten Leitung handelte es sich um eine rund 40 m<br />
lange Kühlwasserhauptleitung DN 600 aus Stahl ST 35<br />
mit 6,5 mm Wanddicke. Sie war in den 1960er Jahren in<br />
Betrieb genommen worden. Die Leitung arbeitet unter<br />
einem Betriebsdruck von etwa 2,5 bar. Die maximale Wassertemperatur<br />
beträgt 30° C, und die Förderleistung liegt<br />
bei ca. 3.600 m 3 /h. Vor allem aufgrund der starken Korrosion<br />
im Bereich der Sohle war eine Sanierung dringend<br />
erforderlich geworden.<br />
Rohr-im-Rohr-Lösung<br />
Bereits in der Ausschreibung war eine Innensanierung der<br />
Kühlwasserleitung mit dem RS BlueLine®-Verfahren der RS<br />
Technik AG vorgesehen. Dabei wird ein flexibler Schlauchträger<br />
mit einem Zweikomponenten-Epoxidharz imprägniert,<br />
in die zu sanierende Leitung eingebracht und anschließend<br />
durch Wärmezufuhr zu einem neuen Rohr ausgehärtet. Die<br />
Alle Fotos: RS Technik<br />
Vorbereitung der Anlagentechnik<br />
Der Einbau des RS BlueLine ® -Systems erfolgt im<br />
Wasserinversionsverfahren mit Heißwasseraushärtung<br />
1004 12 / 2012
Rohr-im-Rohr-Lösung ist unabhängig und alleine tragfähig und<br />
übernimmt ohne Unterstützung des Altrohres alle statischen<br />
Außen- und Innenlasten. Allerdings verfügt das Verfahren<br />
nicht nur über Einsparpotentiale in punkto Kosten und Zeit.<br />
Auch umweltschutztechnische Gesichtspunkte finden<br />
Berücksichtigung. Das Epoxidharz ist Styrol-frei und es kommt<br />
bei der Anwendung zu keinen Geruchsbelästigungen. Die<br />
Dosierung und luftfreie Mischung der Epoxidharzkomponenten<br />
sowie die Imprägnierung des Liners erfolgen direkt vor<br />
Ort in einer mobilen Misch- und Tränkanlage. Dabei wird der<br />
Liner unter Vakuum gesetzt, gleichmäßig mit dem Harzsystem<br />
getränkt und kalibriert. Eine so genannte speicherprogrammierbare<br />
Steuerung (SPS) sorgt dann für einen kontrollierten<br />
Einbauprozess, der mit einer umfangreichen Mess- und<br />
Dokumentationstechnik begleitet wird.<br />
Das leistungsstarke Paket aus modernster Sanierungstechnik<br />
und hochwertigen Harzsystemen hat die Anforderungen<br />
der Sanierungsmaßnahme in vollem Umfang erfüllt. Vor dem<br />
Einbau des Schlauchliners wurde die alte Leitung mittels Sandstrahl<br />
gereinigt, eine andere Reinigungsart war wegen der<br />
Bitumenbeschichtung nicht möglich.<br />
Die Fachzeitschrift<br />
für Gasversorgung<br />
und Gaswirtschaft<br />
Sichern Sie sich regelmäßig diese führende Publikation.<br />
Lassen Sie sich Antworten geben auf alle Fragen zur<br />
Gewinnung, Erzeugung, Verteilung und Verwendung von<br />
Gas und Erdgas.<br />
Jedes zweite Heft mit Sonderteil R+S -<br />
Recht und Steuern im Gas und Wasserfach.<br />
NEU<br />
Jetzt als Heft<br />
oder als ePaper<br />
erhältlich<br />
KONTAKT<br />
RS Technik Aqua GmbH, Nürnberg, Jochen Bärreis,<br />
Tel. +49 911 99919688, E-Mail: j.baerreis@rstechnik.com<br />
DIRINGER & SCHEIDEL ROHRSANIERUNG GmbH & Co. KG,<br />
NL Herne, Dipl.-Ing. Jens Wahr, Tel. +49 2323 387980,<br />
E-Mail: jens.wahr@dus.de<br />
Wählen Sie einfach das Bezugsangebot,<br />
das Ihnen zusagt!<br />
· Als Heft das gedruckte, zeitlos-klassische Fachmagazin<br />
· Als ePaper das moderne, digitale Informationsmedium für<br />
Computer, Tablet-PC oder Smartphone<br />
· Als Heft + ePaper die clevere Abo-plus-Kombination<br />
ideal zum Archivieren<br />
Qualitätssicherung vor Ort: Der kontrollierte<br />
Einbauprozess wird überwacht und dokumentiert<br />
Alle Bezugsangebote und Direktanforderung<br />
finden Sie im Online-Shop unter<br />
www.gwf-gas-erdgas.de<br />
www.gwf-gas-erdgas.de<br />
12 / 2012
PROJEKT KURZ BELEUCHET<br />
ENERGIEVERSORGUNG<br />
GFK-Wickelrohre DN 1000<br />
für das Sölktal<br />
Von Mag. Roland Gruber, Chefredakteur zek-HYDRO Fachmagazin für Wasserkraft<br />
Rund 8.000 lfdm FLOWTITE GFK-Rohre hat die Gebrüder Haider Bauunternehmung GmbH im Auftrag der<br />
Elektroversorgungsunternehmen EVU Gröbming Gesellschaft m.b.H. für die Erstellung der Zuleitungen der Kraftwerke Seifriedbach<br />
und Großsölkbach im Sölktal verlegt. Geliefert wurden die Rohre in der Nennweite DN 1000 von der ETERTEC GmbH & Co KG,<br />
dem österreichischen Vertriebspartner der AMITECH Germany GmbH. Es handelt sich um glasfaserverstärkte Kunststoffrohre,<br />
die im Wickelrohrverfahren hergestellt wurden. Sie verfügen über die Steifigkeitsklasse SN 5000, die Druckstufen reichen von<br />
PN 6 bis PN 25. Bei der Wahl des Werkstoffes, bei der vor allem wirtschaftliche Aspekte eine Rolle spielten, haben die GFK-<br />
Rohre neben ihrem geringen Gewicht, der einfachen Verlegung sowie der Korrosionsbeständigkeit vor allem in Bezug auf einen<br />
kostengünstigen Bau und Betrieb sowie die Instandhaltung überzeugt.<br />
Ins Sölktal geliefert wurden die Rohre in der Nennweite DN 1000 von der ETERTEC GmbH & Co KG,<br />
dem österreichischen Vertriebspartner der AMITECH Germany GmbH<br />
Die Inbetriebnahme der neuen Wasserkraftwerke soll die<br />
Stromversorgung in der Gemeinde St. Nikolai/Sölktal langfristig<br />
sicherstellen. Bei der Planung und Errichtung der Krafthäuser<br />
im Naturpark Sölktäler galt dem Schutz der Landschaft<br />
dabei besondere Aufmerksamkeit. Ein Gesichtspunkt, unter<br />
dem sich auch der Einsatz der GFK-Rohre im wahrsten Sinne<br />
des Wortes bezahlt gemacht hat – hierin sind sich die an der<br />
Baumaßnahme beteiligten Partner einig. „Es macht schon<br />
einen Unterschied, ob man in einem schwierigen Gelände und<br />
einem sensiblen Bauumfeld mit einem vergleichsweise leichten<br />
Rohrwerkstoff arbeiten kann, oder regelrechte Schwergewichte<br />
zu bewegen hat“, erläutert ETERTEC-Geschäftsführer<br />
Udo Steidle einen Vorteil von Rohren aus glasfaserverstärktem<br />
Kunststoff. „Das Volumengewicht von FLOWTITE GFK-<br />
Rohren ist beispielsweise viermal geringer als das von Sphäroguss<br />
und zehnmal geringer als das von Rohren aus Beton“,<br />
macht Steidle deutlich. Dementsprechend<br />
zeigte sich das<br />
ausführende Unternehmen mit<br />
der Handhabung der 1 m, 3 m<br />
und 6 m langen Rohre sehr<br />
zufrieden: Trotz der schwierigen<br />
Rahmenbedingungen<br />
bei der Erstellung der Druckrohrleitungen<br />
für die beiden<br />
Kraftwerke konnten die Tiefbaumaßnahmen<br />
nach nur sehr<br />
kurzer Bauzeit abgeschlossen<br />
werden. Entscheidend dazu<br />
beigetragen hat die einfache<br />
Verlegung und Installation von<br />
Rohren und Kupplungen.<br />
Erfolgreich eingesetzt<br />
Die GFK-Rohre wurden von<br />
ETERTEC zu den Einbaustellen<br />
im Sölktal transportiert.<br />
Zum Auftragsumfang zählten<br />
rund 8.000 lfdm GFK-Rohre in<br />
den Nennweiten DN 1000 in den Druckstufen PN 6, PN 10,<br />
PN 16, PN 20 und PN 25 inklusive der benötigten Formteile.<br />
„Wir beliefern seit Jahrzehnten den österreichischen<br />
Siedlungswasserbau mit Rohrsystemen und Technologie für<br />
Wasser, Abwasser und Druckrohrleitungen“, so Steidle weiter.<br />
Dabei machen die FLOWTITE GFK-Rohre einen Großteil der<br />
Produktpalette aus. Laut Aussage von Geschäftsführer Steidle<br />
werden die Rohrsysteme aus glasfaserverstärktem Kunststoff<br />
seit vielen Jahren erfolgreich eingesetzt, unter anderem für<br />
den Bau von Druckrohrleitungen von Wasserkraftwerken.<br />
Dabei ist der Einsatz des Werkstoffes für die Auftraggeber<br />
unter wirtschaftlichen Aspekten äußerst sinnvoll. Etwa<br />
in Bezug auf die einfache und schnelle Verlegung, aber auch<br />
mit Blick auf die Werkstoffeigenschaften, wobei vor allem die<br />
Korrosionsbeständigkeit der Rohre zu einer langen Nutzungsdauer<br />
beiträgt. „Zusammen mit den hervorragenden hydrau-<br />
1006 12 / 2012
Zum Auftragsumfang zählten rund 8.000 lfdm GFK-Rohre in den Nennweiten<br />
DN 1000 in den Druckstufen PN 6, PN 10, PN 16, PN 20 und PN 25 inklusive<br />
der benötigten Formteile<br />
In einem schwierigen Gelände und einem sensiblen Bauumfeld<br />
ist es vorteilhaft, mit einem vergleichsweise leichten<br />
Rohrwerkstoff zu arbeiten<br />
lischen Eigenschaften – aufgrund der glatten Innenfläche gibt<br />
es kaum Reibungsverluste und der Druck des Wasserschlages<br />
ist bei gleichen Bedingungen deutlich geringer als bei<br />
alternativen Werkstoffen – trägt das dazu bei, dass sich der<br />
Wartungsaufwand und die Betriebskosten in einem durchaus<br />
überschaubaren Rahmen bewegen“, bringt Steidle die Vorteile<br />
des leistungsstarken Rohrsystems auf einen Punkt.<br />
KONTAKT<br />
Amitech Germany GmbH, Mochau OT Großsteinbach,<br />
Tel. +49 3431 71820, E-Mail: info@amitech-germany.de,<br />
www.amitech-germany.de<br />
8th Pipeline Technology<br />
Conference<br />
Pipeline Technology<br />
Conference 18.-20. März 2013, Hannover 2010<br />
Europa’s führende Konferenz<br />
für neue Pipelinetechnologien<br />
Mehr Informationen unter www.pipeline-conference.com<br />
Euro Institute for Information<br />
and Technology Transfer<br />
Oldenbourg Industrieverlag GmbH<br />
Vulkan-Verlag GmbH<br />
WISSEN für die ZU<br />
2012 11 <strong>3R</strong> ptc de.indd 1 09.11.2012 13:02:46
PROJEKT KURZ BELEUCHTET<br />
ENERGIEVERSORGUNG<br />
Buoholzbach nutzt ZMU-Gussrohre<br />
DN 600 als Turbinenleitungen<br />
Im Schweizer Kanton Nidwalden begannen Anfang Juli 2011 die Verlegearbeiten für eine 1.944 m lange Turbinenleitung für das<br />
Kraftwerk Buoholzbach. Wie bei den meisten Druckleitungen, die in der Schweiz das Wasser zu Turbinen befördern, fiel auch hier<br />
die Entscheidung des Bauherrn, der EWN (Kantonales Elektrizitätswerk Nidwalden Stans) auf Duktus-Rohre.<br />
Die Buoholzbachleitung hat eine Nettofallhöhe von 408 m<br />
und verläuft wie nahezu alle Leitungen im alpinen Raum durch<br />
felsigen Untergrund. Dass die EWN sich daher für die langfristig<br />
sichere Lösung, nämlich neben einer ZM-Umhüllung<br />
der Rohre, auch in einzelnen Bereichen der Trasse für die<br />
Wanddickenklasse K12 entschied, zeugt von dem immer<br />
stärker werdenden Bewusstsein, die grüne Energie auch mit<br />
nachhaltig sicheren Werkstoffen zu verbinden.<br />
Das Projekt Buoholzbach steht im Zusammenhang mit den<br />
für die nächsten 15 Jahre geplanten Investitionen des Nidwalder<br />
Energieversorgers. 63 Millionen Schweizer Franken sollen<br />
in neue Produktionsanlagen gesteckt werden. Unter anderem<br />
werden fünf neue Kraftwerke entstehen. Eines davon ist Buoholzbach.<br />
Auf dem Gemeindegebiet von Wolfenschiessen und<br />
Oberdorf wird ein Gewässerabschnitt des Buoholzbaches für<br />
die Stromproduktion genutzt. Sieben Millionen Kilowattstunden<br />
erneuerbare Energie soll das Kraftwerk in Zukunft pro<br />
Jahr liefern und rund 1.500 Haushalte versorgen.<br />
„Wir sind stolz darauf, unseren Beitrag für die Energieversorgung<br />
der Zukunft leisten zu können“, sagt Werner Volkart<br />
vom Duktus Vertriebspartner Hagenbucher in der Schweiz.<br />
„Duktus Rohre der Nennweite DN 600 mit ZM-Umhüllung<br />
und die entsprechenden Formstücke haben der Verlegefirma<br />
keinerlei Probleme bereitet, obwohl die Trassen teilweise<br />
in schwierigem Gelände verliefen. Das BLS®-System ist ein<br />
Alleskönner und qualifizierte sich erneut durch seine einfache<br />
Handhabung. In weniger komplizierten Streckenabschnitten<br />
konnten wir auf 780 m die BRS®-Verbindung zur<br />
Verfügung stellen und so dem Bauherrn angemessen wirtschaftliche<br />
Lösungen bieten. Die Flexibilität unserer Verbindungen<br />
ist ein Mehrwert, den die EWN zu schätzten wusste.“<br />
Im August 2012 hat das Kraftwerk Buoholzbach seinen<br />
Betrieb aufgenommen.<br />
KONTAKT<br />
Duktus Rohrsysteme Wetzlar GmbH, Wetzlar, Elvira Sames-<br />
Dickopf, Tel. +49 6441 49-1490, E-Mail: elvira.samesdickopf@duktus.com,<br />
www.duktus.com<br />
1.944 m duktile Gussrohre DN 600 mit ZM-Umhüllung wurden<br />
für die Turbinenleitung des Kraftwerkes Buoholzbach verlegt<br />
Die Arbeiten begannen im Juli 2011, ab August 2012 liefert<br />
das Kraftwerk sauberen Strom<br />
1008 12 / 2012
PROJEKT KURZ BELEUCHTET<br />
WASSERVERSORGUNG<br />
Trinkwasserleitung im Eiltempo mit<br />
Raketenpflug eingezogen<br />
22 Jahre nach dem Start des Projektes „Aufbau Ost“ ist die wirtschaftliche und infrastrukturelle Bilanz für Sachsen positiv. Seit<br />
1991 wurden etwa 84 % der kommunalen Abwasseranlagen und zahlreiche Trinkwasserleitungen saniert oder neu errichtet.<br />
Im Sommer wurde das Nürnberger Rohrleitungsbauunternehmen Mennicke mit der Erneuerung einer Trinkwasserleitung im<br />
Landkreis Bautzen beauftragt. Die Verlegung erfolgte im Eiltempo mit dem grabenlosen Raketenpflugverfahren und zog bei einer<br />
Baustellenvorführung die Aufmerksamkeit sächsischer Versorger auf sich.<br />
Innerhalb weniger Tage verlegte Mennicke zwischen den<br />
sächsischen Gemeinden Bornitz und Radibor im Auftrag<br />
der Kreiswasserwerke Bautzen Wasserversorgung GmbH<br />
gemeinsam mit einem Partnerunternehmen eine Trinkwasserleitung<br />
DA 315 SDR 11. Der Einziehvorgang selbst konnte<br />
sogar innerhalb eines Tages abgeschlossen werden. „Den<br />
ersten Abschnitt von 223 m schafften wir in 32 Minuten“,<br />
sagt Frank Strauch, Polier bei Mennicke. Nach acht Stunden<br />
waren die knapp 1.000 m unter der Erde.<br />
Die raketenhafte Geschwindigkeit verdanken die beteiligten<br />
Unternehmen nicht nur der schnellen und präzisen Arbeit<br />
des Teams auf der Baustelle, sondern auch einem besonderen<br />
Gerät: dem Raketenpflug. Auf den ersten Blick ein ganz normaler<br />
Pflug, fällt auf den zweiten Blick die besondere Ausstattung<br />
der Baumaschine auf. Am Ende des Pflugschwertes sitzt ein<br />
Aufweitkopf, der in seiner Form an eine Rakete erinnert und<br />
dem Pflug seinen Namen verleiht. Dieser weitet das Erdreich<br />
während des Einziehvorgangs auf. Die bis zu 250 m langen<br />
Rohrstränge, die zuvor von Mennicke mit Elektrostumpfschweißung<br />
aus einzelnen,12 m langen PE-Rohren verbunden<br />
wurden, werden an das Pflugschwert montiert und während<br />
des Pflügens in den entstehenden Hohlraum eingezogen.<br />
Die Bauarbeiten hinterlassen dabei kaum Spuren in der<br />
Landschaft. Lediglich eine Einzug- und mehrere Verbindungsgruben<br />
sind im Nachhinein entlang der Verlegestrecke zu<br />
sehen. „Das Raketenpflugverfahren ist sehr kosteneffizient,<br />
spart Zeit und schont Umwelt und Boden“, fasst Markus Warmuth-Baron,<br />
Leiter des Bereichs Rohrsanierung bei Mennicke,<br />
die Vorteile der Methode zusammen.<br />
Bei einer Baustellenvorführung beobachteten Vertreter<br />
regionaler Versorgungsunternehmen gespannt den raschen<br />
Einziehvorgang. Olaf Böhme, Geschäftsführer der Kreiswerke<br />
Bautzen Wasserversorgung GmbH, informierte in einem Vortrag<br />
über Vorzüge und technische Ausführung des Raketenpflugverfahrens.<br />
„In den neuen Bundesländern herrscht hoher<br />
Bedarf im Bereich Rohrsanierung und -instandhaltung“, sagt<br />
Marion Melzer, zuständig für Marketing und Vertrieb bei Mennicke.<br />
„Mennicke bietet eine breite Palette an innovativen, grabenlosen<br />
Sanierungsverfahren. Mit einigen Versorgern konnten<br />
wir bereits über individuelle Anwendungsmöglichkeiten für<br />
weitere Bauvorhaben in Sachsen sprechen“, so Marion Melzer.<br />
KONTAKT<br />
Mennicke Rohrbau GmbH, Nürnberg, Marion Melzer,<br />
E-Mail: mmelzer@mennicke.de<br />
Zwischen den sächsischen Gemeinden Bornitz und Radibor<br />
erneuerte Mennicke eine Trinkwasserleitung<br />
DA 315 SDR 11 innerhalb weniger Tage<br />
Zahlreiche Versorger aus Sachsen verfolgten den Einzug<br />
bei einer Baustellenpräsentation. In Sachsen gibt es hohen<br />
Bedarf an kosteneffizienten Sanierungsmethoden<br />
12 / 20121009
PROJEKT KURZ BELEUCHTET<br />
WASSERVERSORGUNG<br />
Liechtensteiner Unterland setzt bei<br />
Wasserversorgung auf PE<br />
Wasserversorgungsunternehmen setzen seit mehr als 50 Jahren Rohrleitungen aus Polyethylen (PE) ein. Für gusseiserne<br />
Absperrarmaturen müssen deshalb Übergangsstücke eingebaut werden. Seit 1990 setzt die Wasserversorgung Liechtensteiner<br />
Unterland (WLU) fast ausschließlich Rohre aus Polyethylen ein. In 2011 wurde beschlossen neu, auch FRIALOC PE-Absperrarmaturen<br />
einzusetzen, womit auf ein komplett homogenes Netz aus Kunststoff umgestellt wurde.<br />
Die Wasserversorgung Liechtensteiner Unterland versorgt<br />
rund 13.000 Einwohner oder 4.000 Haushalte mit Trinkwasser.<br />
Im Leitungsnetz, das rund 250 km umfasst, stammen<br />
die ältesten Teilstrecken noch aus der Zeit vor 1960.<br />
Das Team um Geschäftsführer Georg Matt ist auch für den<br />
Unterhalt und den Ausbau des Netzes verantwortlich. Das<br />
ist nicht immer einfach, denn „wir befinden uns hier auf<br />
einer ewigen Baustelle“, erklärt Matt. Probleme bereiten<br />
vor allem alte Leitungen, die noch aus Gusseisen bestehen.<br />
Obwohl in der Wasserversorgung bereits seit mehr<br />
als 50 Jahren Rohre aus Polyethylen eingesetzt werden,<br />
findet die Ablösung der Gussleitungen nur zögerlich statt.<br />
Oft werden nur lecke Leitungen ersetzt und vielerorts<br />
verlegt man auch heute noch neue Eisenrohre. Bei der<br />
WLU wurden vor rund 50 Jahren die ersten PE-Leitungen<br />
eingesetzt, damals noch hauptsächlich für Hausanschlüsse.<br />
Seit dem Grundsatzbeschluss im Jahr 1990, ausschließlich<br />
noch Kunststoffrohre zu verlegen, findet die Ablösung im<br />
Liechtensteiner Unterland zügig statt. Bis heute wurden<br />
bereits 49 % des Versorgungs- und Verteilungsnetzes und<br />
68 % der Hausanschlüsse aus PE erstellt (Schnitt über das<br />
ganze Netz: 57 %).<br />
Im Gebiet der WLU sind die Umgebungsbedingungen<br />
teilweise hart. Saurer Boden und vagabundierende Ströme<br />
von Hauserdungen oder Einflüsse von der Eisenbahn lassen<br />
die betroffenen Gussleitungen zum Teil schnell und stark<br />
korrodieren. Auch deshalb werden seit 1990 bei Netzausbauten<br />
oder Reparaturen nur noch Polyethylenrohre<br />
eingesetzt.<br />
KORROSION MACHT PROBLEME<br />
„Wir haben gute Erfahrungen gemacht. Die Schadensrate<br />
ist in den letzten 20 Jahren rückläufig wie auch die der<br />
Wasserverluste“, resümiert Matt. Im Jahre 1990 musste<br />
die WLU eine Leitung auswechseln, die erst seit 1979 in<br />
Betrieb war. Und dies obwohl die Leitung fachgerecht mit<br />
einem dicken Kiesmantel eingebettet war. Damals wurde<br />
ein stark korrodiertes Gusseisenrohr wegen zahlreichen<br />
Lecks bereits nach elf Jahren Betriebszeit durch eine PE-<br />
Leitung ersetzt. „Heute nach 22 Jahren ist das PE-Rohr noch<br />
immer dicht. Auch das zeigt, dass wir die Schadens- und<br />
Verlustrate mit dem Einsatz von Kunststoffrohren vermindern<br />
konnten.“ Die Kunststoffleitungen werden – wo<br />
möglich – immer miteinander verschweißt und bilden ein<br />
homogenes Rohrleitungsnetz. Weil der Werkstoff eine hohe<br />
Elastizität besitzt, nehmen PE-Leitungen keinen Schaden,<br />
wenn sich der Boden setzt. „Diesen Frühling hatten wir<br />
erstmals einen Schadensfall an einer Kunststoffleitung, als<br />
ein Bagger das Rohr verletzte“, erzählt Matt und fügt an:<br />
„Schäden mit Fremdeinwirkung können mittlerweile nahezu<br />
ausgeschlossen werden, da uns die Unternehmen, die die<br />
Grabarbeiten ausführen, vorher anfragen.“<br />
FRIALOC PE-Absperrarmaturen werden mit einer FRIAGRIP-<br />
Kupplung an eine Gussleitung angeschlossen<br />
Hausanschlüsse werden mit FRIALEN-Druckanbohrventilen<br />
abgezweigt<br />
1010 12 / 2012
HOHER WARTUNGSAUFWAND<br />
Für ein komplett werkstoffhomogenes Netz fehlte bisher noch<br />
das letzte Glied: Absperrarmaturen, mit denen bei Wartungsund<br />
Unterhaltsarbeiten Teilstrecken außer Betrieb genommen<br />
werden, bestanden bislang ausschließlich aus Gusseisen. Diese<br />
werden bei Leitungen aus Guss direkt zusammenmontiert. Für<br />
den Einsatz der Absperrarmaturen in einer Kunststoffleitung<br />
brauchte es zusätzliche Übergangsstücke. Gusseisenarmaturen<br />
sind natürlich ebenfalls Ablagerungen und Korrosion<br />
unterworfen. So musste die WLU Mitte der 1980er Jahre viele<br />
Guss-Armaturen ersetzen, die erst 15 bis 20 Jahre in Betrieb<br />
waren. „Das hängt auch damit zusammen, dass Unterhalt<br />
und Wartung früher zu Gunsten von Wasserleitungs-Neubauten<br />
vernachlässigt wurden“ räumt Matt ein. Mittlerweile<br />
überprüft die WLU nach Möglichkeit alle Netz-Armaturen<br />
jährlich. Dazu werden sie zweimal nacheinander geschlossen<br />
und wieder geöffnet. So kann sichergestellt werden, dass<br />
die Absperrarmatur im Bedarfsfall funktioniert. Matt gibt zu<br />
bedenken: „Diese Arbeit darf man nicht unterschätzen, da es<br />
im gesamten Netz der WLU etwa 2.300 Netzschieber und<br />
4.400 Hausanschlussschieber gibt.“<br />
Vor rund fünf Jahren brachte die FRIATEC AG die erste<br />
Kunststoffarmatur auf den Markt, die von der Glynwed AG<br />
vertrieben wird. Die ersten Erfahrungen überzeugten und<br />
so entschied die WLU, ab 2011 nur noch Schieber aus Polyethylen<br />
einzusetzen. Diese werden direkt mit den Rohren<br />
verschweißt und sind grundsätzlich wartungsfrei. Obwohl die<br />
Armaturen nach Firmenaussagen bereits seit vielen Jahren<br />
ohne Zwischenfälle funktionieren, möchte Matt sie anfangs<br />
regelmäßig prüfen: „Wir werden Teststrecken einrichten, um<br />
in den nächsten Jahren herauszufinden, welches Wartungsintervall<br />
sinnvoll ist. In jedem Fall sollten die neuen Armaturen<br />
nicht mehr jedes Jahr überprüft werden müssen.“<br />
Matt ist von den Kunststoffarmaturen überzeugt: „Dass<br />
wir vor bald zwei Jahren beschlossen haben, komplett auf<br />
FRIALOC PE-Armaturen zu wechseln, war für uns nur ein<br />
logischer Schritt.“ Nun ist es möglich, das gesamte Netz mit<br />
PE-Rohren und PE-Armaturen zu bauen, ohne Verschraubungen<br />
und Kupplungen zu gusseisernen Armaturen. Auch von<br />
den Unternehmen vor Ort, die den Rohrleitungsbau für die<br />
WLU ausführen, erhielt Matt bisher nur positives Feedback.<br />
Denn das geringe Gewicht der Schieber im Vergleich zu den<br />
Armaturen aus Gusseisen ist auf der Baustelle ein Vorteil. Für<br />
den Geschäftsführer liegt die Zukunft klar bei Armaturen und<br />
Leitungen aus Polyethylen. Er weiß aber auch: „Ob Guss oder<br />
Kunststoff, das ist eine Frage der Philosophie“. So sei die alte<br />
Generation der Brunnenmeister mit Gussrohren aufgewachsen<br />
und auch bei der WLU brauchte es vor rund 20 Jahren erst<br />
einen Generationenwechsel, um Polyethylen flächendeckend<br />
einzusetzen. Mit dem Einbau der ersten Kunststoffschieber<br />
geht die WLU erneut neue Wege und wies darauf hin, dass<br />
es noch keine langjährige Erfahrung gebe. „Wenn wir nur auf<br />
Produkte setzen würden, die sich 30 Jahre bewährt haben,<br />
hätten wir auch noch keine Kunststoffleitungen verlegt“,<br />
erklärt Matt diesen mutigen Schritt. Vom gesamten Leitungsnetz<br />
sind derzeit 57 % aus Kunststoff, das sind etwa<br />
140 km. Würde die WLU im selben Tempo mit dem Umbau<br />
fortfahren, wäre in etwa 17 Jahren das gesamte Netz aus<br />
Polyethylen gebaut. „Das wird aber nicht so kommen, weil die<br />
Austauschrate sukzessive abnimmt“, so der Geschäftsführer.<br />
Ein Blick auf die alten Strukturen verdeutlicht dies: Noch 2 %<br />
des Netzes besteht aus Leitungen, die vor 1960 eingebaut<br />
wurden, 25 % stammen aus der Zeit von 1961 bis 1985. Doch<br />
der Planungshorizont erstreckt sich weit in die Zukunft, dazu<br />
Matt: „Heute blicken wir ins Jahr 2050. Das heißt alle Ausbauten,<br />
die wir heute machen, orientieren sich am mutmaßlichen<br />
Verbrauchsverhalten in 40 Jahren“.<br />
KONTAKT<br />
Friatec AG, Mannheim, Tel. +49 621 486-0,<br />
E-Mail: info-frialen@friatec.de, www.friatec.de<br />
PE-Leitungen sind unempfindlich gegenüber<br />
Setzungserscheinungen und gelten sogar als erdbebensicher<br />
PE-Absperrarmaturen waren bisher das fehlende Glied für ein<br />
komplett werkstoffhomogenes Wassernetz<br />
12 / 20121011
PROJEKT KURZ BELEUCHTET<br />
WASSERVERSORGUNG<br />
Neue Verbindungsschieber<br />
DN 1800 und DN 2200 für die<br />
Schleuse Eisenhüttenstadt<br />
Es war ein Projekt, das hohes technisches Fachwissen, vor allem aber Fingerspitzengefühl und ein gutes Augenmaß erforderte: Im<br />
Auftrag des Wasser- und Schifffahrtsamtes Berlin hat die Coswiger Tief- und Rohrleitungsbau GmbH, ein Mitgliedsunternehmen<br />
des Rohrleitungsbauverbandes e.V. (rbv), die 80 Jahre alten Armaturen in der Zwillingsschachtschleuse Eisenhüttenstadt durch<br />
neue Ringkolbenventile ersetzt. Die Demontage der in die Jahre gekommenen Armaturen und das Herausheben der Bauteile aus<br />
dem Schieberkeller erwiesen sich dabei ebenso als große Herausforderung an die Präzision wie das anschließende Einheben und<br />
Einbauen der neuen Ventile. Doch damit nicht genug: Aufgrund des im Schieberkeller vorhandenen Brückenkranes mit einer max.<br />
Tragkraft von 20 t und des für die Bauleistungen auszuwählenden mobilen Kranes mussten die einzelnen Bauteile der neuen<br />
Armaturen den vorhandenen Krantragkräften angepasst werden. Zudem fanden alle Arbeiten unter laufendem Schleusenbetrieb<br />
statt, während Pumpen in der Umbauphase den Schiffsverkehr sicherstellten.<br />
Die Zwillingsschachtschleuse Eisenhüttenstadt liegt an der<br />
Spree-Oder-Wasserstraße (SOW) bei km 127,3 im Land Brandenburg.<br />
Zwischen Kersdorf und Eisenhüttenstadt befindet<br />
sich die obere Stauhaltung, die im Wesentlichen durch<br />
die Pumpwerke Neuhaus und Eisenhüttenstadt mit Wasser<br />
gespeist wird. „Beim so genannten Doppelschleusenbetrieb<br />
– dabei fährt ein Schiff zu Berg, ein Schiff zu Tal – wird der<br />
Wasserspiegel in beiden Kammern durch unterirdische Verbindungskanäle<br />
ausgeglichen“, erklärt Dipl.-Ing. Werner Grywotz,<br />
Baubevollmächtigter des Wasser- und Schifffahrtsamtes Berlin.<br />
Danach wird über ein Auslaufbauwerk mit Energiebrechern<br />
in das Unterwasser geleert. Hierbei können rund 50 % des für<br />
einen Schleusenvorgang benötigten Wassers gespart werden.<br />
„Möglich wird das durch ein Ausgleichssystem mit drei Großarmaturen,<br />
wobei es sich um zwei wechselseitig angeordnete<br />
Ringkolbenschieber DN 1800 und einen Walzenschieber<br />
DN 2000 handelt“, so Grywotz weiter.<br />
SONDERANFERTIGUNGEN ERFORDERLICH<br />
Aufgrund ihrer konstruktiven Eigenschaften sind Ringkolbenventile<br />
zur Regelung der Durchflüsse am besten geeignet.<br />
Durch genau aufeinander abgestimmte Öffnungs- und<br />
Schließvorgänge der Armaturen lässt sich der Wasserspiegel<br />
in den beiden Schleusenkammern optimal regulieren. Sie können<br />
in allen Zwischenstellungen gefahren werden und lassen<br />
eine hohe Hubspielzahl zu. Allerdings sind sie aufgrund ihrer<br />
Konstruktion nicht begehbar, so dass eine Befahrung zu Inspektionszwecken<br />
nur dann möglich ist, wenn der massive<br />
Klappenteller in Offenstellung den vollen Querschnitt freigibt.<br />
Die Schieber der Schleuse Eisenhüttenstadt wurden Ende der<br />
1920er Jahre hergestellt und im Rahmen einer Grundinstandsetzung<br />
in den 90er Jahren erstmals geringfügig überholt.<br />
„Undichtigkeiten an einem der Ringkolbenschieber machten<br />
dann Ende 2006 weitere Untersuchungen notwendig, um den<br />
nötigen Reparaturaufwand festzustellen“, erinnert sich Gry-<br />
Hier wurden die neuen epoxidharzbeschichteten Armaturen<br />
DN 1800 von einem 500-t-Autokran in die Schieberkammer<br />
eingehoben<br />
Bereits die Demontage der alten ca. 43 t schwere Ringkolben- und<br />
Walzenschieber und das Herausheben aus der Schieberkammer<br />
bedeuteten eine technische und logistische Herausforderung<br />
1012 12 / 2012
wotz. „Zudem wurden bei einer Anlageninspektion im Frühjahr<br />
2007 gravierende Schäden am anderen Ringkolbenschieber<br />
festgestellt, die eine sofortige Außerbetriebnahme der Armatur<br />
nach sich zogen.“ In der Folgezeit wurde ein Konzept für<br />
eine umfangreiche Sanierung der Anlage erstellt, das den<br />
Austausch der abgenutzten gusseisernen Armaturen vorsah.<br />
Da man Armaturen dieser Größenordnung nicht einfach so<br />
kaufen kann, wurde ein Magdeburger Spezialunternehmen<br />
mit der Herstellung der entsprechenden Sonderanfertigungen<br />
DN 1800 und DN 2000 beauftragt. Ihre Bedienung erfolgt<br />
durch Getriebe, die mit einem elektrischen Stellantrieb ausgerüstet<br />
sind.<br />
BESONDERE HERAUSFORDERUNG<br />
„Eine besondere Herausforderung bestand schon darin, die<br />
alten, ca. 43 t schweren Ringkolben- und Walzenschieber<br />
zerstörungsfrei zu demontieren und aus der Schieberkammer<br />
herauszuheben“, erinnert sich Bauleiterin Dipl.-Ing. Franziska<br />
Mühle, Coswiger Tief- und Rohrleitungsbau GmbH. Diese Vorgehensweise<br />
war mit dem Auftraggeber vereinbart worden,<br />
da die Armaturen nach entsprechender Aufarbeitung als Ausstellungsstücke<br />
auf dem Schleusengelände installiert werden<br />
sollten. „Insbesondere das Lösen der rostigen M36-Schrauben<br />
der Außen- und Innenflanschverbindungen der Altarmaturen<br />
gestaltete sich alles andere als einfach“, so Mühle. Als ebenso<br />
filigrane Herausforderung erwies sich das Einheben der epoxidharzbeschichteten<br />
Neu-Armaturen mit einem 500-t-Autokran<br />
und die Montage der Bauteile auf den neu errichteten Betonstreifenfundamenten<br />
in der Schieberkammer, wobei besonders<br />
die für die Edelstahlschrauben M36 bis M45 nötige Schlüsselweite<br />
von bis zu 70 mm von den Monteuren ein Höchstmaß<br />
an Ausführungsqualität und Verantwortung erforderte. Hinzu<br />
kam, dass für den Ein- und Ausbau der Armaturen vorhandene<br />
Stahlpodeste und -galerien vorübergehend aus der Schieberkammer<br />
entfernt werden mussten.<br />
Neben den neuen Ringkolbenventilen lieferte das ausführende<br />
Unternehmen Sonderformstücke wie Reduzierungen,<br />
Flansche, Passstücke und Stahlkonstruktionen als Unterbau<br />
für die Armaturen. Letztendlich konnten alle Arbeiten reibungslos<br />
und termingerecht durchgeführt werden, wobei<br />
der Auftraggeber die gute Ausführungsqualität ebenso ausdrücklich<br />
hervorhebt wie die Zuverlässigkeit und Termintreue<br />
des Unternehmens aus Coswig, das seit 1998 Mitglied im<br />
Rohrleitungsbauverband ist. Die Qualifikation dokumentieren<br />
die Rohrleitungs- und Anlagenbauprofis unter anderem<br />
mit der Erfüllung der Qualifikationskriterien der Arbeitsblätter<br />
GW 301: G2 ge,st,pe / W1 ge,st,az,ku,pe / BMS und<br />
GW 302 R 2 des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches<br />
e.V. (DVGW).<br />
Die neuen Armaturen haben ihren ersten Probelauf mit Bravour<br />
bewältigt. Entsprechend dem Beginn der Öffnung bzw.<br />
der Gesamtöffnungszeit der Armaturen wurde der Durchfluss<br />
über die frequenzgesteuerten Antriebe so optimiert, dass die<br />
gewünschte Ausspiegelung nach max. 450 s abgeschlossen<br />
ist. Eine Feinregulierung ist über das Ringkolbenventil bei<br />
Erfordernis möglich. Während die Zeit zum Ausspiegeln bei den<br />
bisherigen Armaturen 450 s betrug, wurde die zulässige Maximalzeit<br />
bei den neuen Ringkolbenventilen auf 630 s begrenzt.<br />
KONTAKT<br />
Rohrleitungsbauverband e. V., Köln, Martina Buschmann,<br />
Tel. +49 221 37668-36, E-Mail: buschmann@rbv-koeln.de<br />
Fotos: Coswiger Tief- und Rohrleitungsbau GmbH<br />
Per Tieflader kamen die neuen epoxidharzbeschichteten<br />
Armaturen DN 1800 zu ihrem Einsatzort<br />
Die Armaturen wurden auf einem extra angefertigten<br />
Montagetisch abgesetzt und von hier aus mit dem Brückenkran<br />
auf das neu errichtete Betonstreifenfundament gehoben<br />
12 / 20121013
PROJEKT KURZ BELEUCHTET<br />
WASSERVERSORGUNG<br />
Marode Trinkwasserleitungen im<br />
Schweinfurter Schulzentrum mit<br />
Close-Fit saniert<br />
In den vergangenen 30 Jahren wurden die Methoden zur grabenlosen Rohrsanierung sukzessive weiterentwickelt. Bewährt hat<br />
sich dabei das Close-Fit-Verfahren, das vielseitig – bei Trinkwasser-, Gas und Abwasserleitungen – anwendbar ist. Die Vorteile des<br />
Verfahrens sprechen für sich: Kosteneffizienz durch die kurze Sanierungszeit, Langlebigkeit der erneuerten Rohre und Schonung<br />
der Umwelt. Zahlreiche Gründe, die auch bei der Sanierung des Trinkwassersystems im Schweinfurter Schulzentrum für den<br />
Einsatz von Close-Fit-Linern sprachen.<br />
Das Schulzentrum im westlichen Stadtteil inklusive seiner<br />
unterirdischen Wasserversorgung entstand zur Zeit der Gründung<br />
des Landkreises Schweinfurt in den 1970er Jahren. Im<br />
Zuge der damaligen Erweiterung des Gebiets investierte die<br />
Stadt in den Ausbau der städtischen Infrastruktur, um den<br />
Bedürfnissen der steigenden Bewohnerzahl gerecht zu werden.<br />
In den vergangenen Jahren machten Umwelteinflüsse den<br />
1973 verlegten DN 150 GGG-Rohrleitungen immer stärker<br />
zu schaffen. Mehrere Rohrbrüche veranlassten die Stadt- und<br />
Wohnbau GmbH Schweinfurt (SWG) das marode Leitungsnetz<br />
zu sanieren. Seit August ist die Mennicke Rohrbau GmbH für<br />
die Sanierung im Einsatz.<br />
DURCHFÜHRUNG BEI LAUFENDEM<br />
SCHULBETRIEB<br />
Um die Sanierung bei laufendem Schulbetrieb durchführen zu<br />
können, wählte man das Close-Fit-Lining-Verfahren, mit dem<br />
abschnittsweise 800 m neue SDR 17 Leitung DN 150 grabenlos<br />
in die schadhaften Altrohre eingezogen wird. Zuvor werden<br />
die alten Rohre mit Federstahlkratzern gereinigt und mit Hilfe<br />
einer fahrbaren Kamera der Innendurchmesser bestimmt.<br />
Dann wird der Close-Fit-Liner mittels einer Winde eingezogen.<br />
Durch das nachfolgende Einleiten von Heißdampf und Druck<br />
formt sich das Rohr zurück in seine ursprüngliche, runde Form<br />
(Memory Effekt) und legt sich dabei ohne Ringspalt an das<br />
alte Rohr an (Close-Fit).<br />
PE 100-Druckrohre DA 125 ersetzen. Außerdem werden<br />
die Hydranten und Hausanschlüsse der einzelnen Gebäude<br />
erneuert. Um Wasserversorgung und Brandschutz jederzeit<br />
zu gewährleisten, installiert Mennicke eine provisorische Notwasserversorgung<br />
DN 100 aus PE-Rohren. Durch die überwiegend<br />
grabenlose Sanierung mit dem Close-Fit-Verfahren<br />
ergeben sich viele Pluspunkte: Der Verkehrsfluss rund um<br />
die Schule muss nur kurz an den jeweiligen Bauabschnitten<br />
begrenzt werden, so dass Schulbusse und Elternfahrzeuge<br />
kaum beeinträchtigt werden. Da keine Baugräben ausgehoben<br />
werden müssen, ist die Bauzeit deutlich kürzer als bei offenen<br />
Verlegeverfahren. Schon Ende November sollte das Wasser<br />
aus neuen Leitungen in die Schulgebäude fließen.<br />
»KONTAKT: : Mennicke Rohrbau GmbH, Nürnberg, Marion Melzer,<br />
Tel +49 911 3607-284, mmelzer@mennicke.de www.mennicke.de<br />
EINSATZ EINES EXPANDERS ZUR VERBINDUNG<br />
DER LEITUNGEN<br />
Für die anschließende Verbindung der neuen PE-Leitung<br />
mit der vorhandenen Druckrohrleitung kommt ein expandergestütztes<br />
Schweißverfahren zum Einsatz. „Mithilfe des<br />
Expanders – ein hydraulisches Runddrückgerät – werden die<br />
Close-Fit-Liner von innen auf den erforderlichen Durchmesser<br />
aufgeweitet. Während der Schweißung stützt der Expander<br />
das Rohr von innen und gewährleistet den erforderlichen<br />
Schweißdruck“, erklärt Markus Warmuth-Baron, Leiter des<br />
Bereichs Rohrsanierung, das Verfahren.<br />
Neben den 800 m grabenloser Verlegung wird Mennicke<br />
rund 150 m alte DN 100 Leitung in offener Bauweise durch<br />
Sanierung des Trinkwassersystems im Schwein furter<br />
Schulzentrum mithilfe des Close-Fit-Verfahrens<br />
1014 12 / 2012
Marktübersicht<br />
2012<br />
Rohre + Komponenten<br />
Maschinen + Geräte<br />
Korrosionsschutz<br />
Dienstleistungen<br />
Sanierung<br />
Institute + Verbände<br />
Fordern Sie weitere Informationen an unter<br />
Tel. 0201/82002-35 oder E-Mail: h.pelzer@vulkan-verlag.de<br />
www.3r-marktuebersicht.de<br />
12 / 20121015
2012<br />
RohRe + Komponenten<br />
Marktübersicht<br />
Armaturen<br />
Armaturen + Zubehör<br />
Absperrklappen<br />
Anbohrarmaturen<br />
Rohre<br />
PE 100-RC Rohre<br />
Schutzmantelrohre<br />
1016 12 / 2012
RohRe + Komponenten<br />
2012<br />
Kunststoff<br />
Formstücke<br />
Rohrdurchführungen<br />
Marktübersicht<br />
Dichtungen<br />
Ihr „Draht“ zur Anzeigenabteilung von<br />
Helga Pelzer<br />
Tel. 0201 82002-35<br />
Fax 0201 82002-40<br />
h.pelzer@vulkan-verlag.de<br />
12 / 20121017
2012<br />
mAschInen + GeRäte<br />
Marktübersicht<br />
Kunststoffschweißmaschinen<br />
horizontalbohrtechnik<br />
Berstlining<br />
Leckageortung<br />
1018 12 / 2012
KoRRosIonsschutZ<br />
Kathodischer Korrosionsschutz<br />
12 / 20121019
2012<br />
KoRRosIonsschutZ<br />
Marktübersicht<br />
Kathodischer Korrosionsschutz<br />
1020 12 / 2012
KoRRosIonsschutZ<br />
2012<br />
Korrosionsschutz<br />
Marktübersicht<br />
Ihr „Draht“ zur Anzeigenabteilung von<br />
Helga Pelzer<br />
Tel. 0201 82002-35<br />
Fax 0201 82002-40<br />
h.pelzer@vulkan-verlag.de<br />
12 / 20121021
2012<br />
DIenstLeIstunGen / sAnIeRunG<br />
Marktübersicht<br />
Dienstleistungen<br />
Ingenieurdienstleistungen<br />
Sanierung<br />
sanierung<br />
Gewebeschlauchsanierung<br />
InstItute + VeRBänDe<br />
Institute<br />
Verbände<br />
1022 12 / 2012
InstItute + VeRBänDe<br />
2012<br />
Verbände<br />
Marktübersicht<br />
12 / 20121023
FACHBERICHT<br />
ABWASSERENTSORGUNG<br />
Messtechnik in der Abwasser-<br />
Kanalinspektion<br />
Ein Überblick anhand einiger Messverfahren und was zu bedenken ist<br />
Von Arno Jugel<br />
Kanalinspektion bedeutet Sammeln von Informationen des Abwasserkanals. Dazu wird modernste Kameratechnik ergänzt mit<br />
verschiedenen Messverfahren angewendet. Diese Messverfahren gilt es so einzusetzen, dass die Randbedingungen für eine<br />
aussagekräftige Messung berücksichtigt und hergestellt werden.<br />
Alle Bilder in diesem Beitrag:<br />
IBAK 2012<br />
Abwasser-Kanalinspektion bedeutet in erster Linie die Kamerabefahrung<br />
der Kanalrohre und Erfassung des Gesehenen<br />
mit kodierten und numerischen Zustandsbeschreibungen, die<br />
in Datenbanksystemen hinterlegt werden. Eine Zustandsbeschreibung<br />
gibt dabei kodiert den Schadenssachverhalt (z.B.<br />
Riss) und nummerisch dessen Ausdehnung (Rissbreite) wieder.<br />
Ergebnis der Befahrung sind dann die aufgezeichneten Videos<br />
oder Filme sowie die Zustandsdaten in einer Datenbank. So<br />
entstehen für den Kanalnetzbetreiber recht große Datenmengen,<br />
die weitgehend automatisiert weiterverarbeitet<br />
werden müssen.<br />
Um eine möglichst objektive Erfassung des Kanalzustandes<br />
zu erhalten, versucht man dem Bediener der Inspektionstechniken<br />
entsprechende Werkzeuge an die Hand zu geben.<br />
Alles, was subjektiv vom Inspekteur beurteilt wird, ist von der<br />
Begabung abhängig und entsprechenden Schwankungen bei<br />
Personalwechsel unterlegen.<br />
Der Einsatz von Messtechnik dient also nicht nur der<br />
Arbeitserleichterung, sondern in der Hauptsache geht es<br />
darum, die Ergebnisse bestmöglich zu objektivieren. Das funktioniert<br />
nur, wenn alle nötigen Randbedingungen für eine<br />
korrekte Messung beachtet werden.<br />
Grundsätzlich ist die optische Kanalinspektion an sich schon<br />
eine Vermessung. Es werden, bezogen auf einen definierten<br />
Nullpunkt, Rohrschäden und Zustände eingemessen. Wird nun<br />
bei der Messung ein anderer Bezugspunkt gewählt als bei der<br />
Auswertung, so geht der Abstand zwischen den Bezugspunkten<br />
zu jeder Messung als Fehler ein (siehe Bild 1).<br />
Bild 1: Mögliche Bezugspunkte, nur einer ist der richtige<br />
Werden bei der TV-Befahrung die Zustände z.B. bezogen<br />
auf den Rohranfang gemessen und zur Weiterverarbeitung<br />
die Daten dann aber mit dem Bezugspunkt Schachtmitte<br />
interpretiert, so ergibt sich ein Fehler vom halben Schachtdurchmesser<br />
– also schon ein sehr großer Fehler.<br />
Zur geografischen Darstellung ist es wichtig, dass der Bezugspunkt<br />
die richtigen Koordinaten bekommt. Ist die Schachtmitte<br />
wirklich als Schachtmitte und nicht aus Versehen mit der<br />
Schacht-Deckelkoordinate im System angegeben?<br />
Nun ein kleiner Überblick, was es im Kanalrohr zu vermessen gibt:<br />
»»<br />
Entfernung der Zustände mit Lage am Umfang<br />
»»<br />
Durchmesser, punktuelle Deformation<br />
»»<br />
Schadenslängen, -breiten etc.<br />
»»<br />
Rohrneigung<br />
»»<br />
Temperaturen im Rohr<br />
»»<br />
Physikalische Dichtheit – Druckprüfung mit Wasser oder<br />
Luft<br />
»»<br />
Profilanalyse im kontinuierlichen Messverlauf<br />
»»<br />
PANORAMO-Messen in der Abwicklung<br />
»»<br />
PANORAMO SI 3D-Vermessung und Punktewolke<br />
»»<br />
Geometrie und Lage von Zuleitungskanälen u.v.m.<br />
DIE SCHADENSVERMESSUNG<br />
Wird von einem Kanalrohr eine Videoaufzeichnung gemacht,<br />
fehlt dem Betrachter leicht ein optischer Vergleich, um Größenverhältnisse<br />
richtig einzuschätzen. Da macht es Sinn,<br />
Risse in der Rohrwandung nicht zu schätzen, sondern zu<br />
vermessen. Das Messprinzip ist dabei, einen projizierten<br />
Laserpunkt mit einer eingeblendeten Marke im Videobild<br />
in Deckung zu bringen. Das Kamerasystem berechnet aus<br />
dem sich ergebenden Kamera-Schwenkwinkel die Strecken<br />
für Schadenslängen.<br />
Die zu messenden Strecken können dabei in zwei unterschiedlichen<br />
Ebenen liegen wie Bild 2 und Bild 3 zeigen.<br />
Die Kamera ist das Messgerät und muss zentrisch in einem<br />
Rohr mit Kreisprofil stehen. Für einen fehlerfreien Bezugspunkt<br />
muss die Kamera-Achse auf der Rohrachse liegen.<br />
Ist die Kameralage davon abweichend, so wird der Messwert<br />
entsprechend verfälscht. In Bild 4 wird sehr deutlich,<br />
dass die Kamera nicht mehr in einer Umgebung steht, in der<br />
eine fehlerfreie Messung möglich ist – aber wohl auch nicht<br />
mehr nötig ist.<br />
1024 12 / 2012
Gleiches gilt bei der Messung auf der Rohrwand für<br />
deformierte Rohre. Die Messebene muss genau auf der<br />
mathematisch beschriebenen Rohrwandung liegen. Jede<br />
Abweichung davon durch Deformation oder ein- bzw.<br />
ausragende Wandungsteile bedeutet einen fehlerhaften<br />
Messwert.<br />
Als Messsystem kann ein mit Laser ausgestattetes<br />
Videokamerasystem (wie z.B. die IBAK ARGUS 5) verwendet<br />
werden. Was die ganze Sache noch objektiver – weil<br />
vom Betrachter sehr gut nachvollziehbar – macht, ist das<br />
PANORAMO System. Ein Film dieses Systems besteht neben<br />
der perspektivischen 3D-Ansicht (siehe Bild 5), durch die<br />
der Betrachter selbst hindurch navigieren kann, auch aus<br />
der Darstellung der abgewickelten Rohrwandung. Auf dieser<br />
flächigen Darstellung lässt sich sehr einfach eine Strecke<br />
ausmessen (siehe Bild 6). Auch das Ei-Profil wird unterstützt<br />
und liefert korrekte Ergebnisse.<br />
VERMESSUNGEN IM SCHACHT<br />
Das PANORAMO-Prinzip ist mit der „PANORAMO-SI,<br />
dem System zur vollständigen optischen Erfassung von<br />
Schächten, um weitere Techniken zur Vermessung ergänzt<br />
worden.<br />
Für einen Bezugspunkt im Schacht ergibt sich das Problem,<br />
dass die Schächte sehr oft ein nicht rundes und auch<br />
nicht mathematisch beschreibbares Profil haben. Auch bei<br />
Schächten aus Beton-Ringen ergeben sich mit dem Konus und<br />
dem Schachtunterteil Geometrien, auf denen Schäden nur<br />
vermessen werden können, wenn mit sehr vielen Abstandsmessungen<br />
zwischen Bauteil und Messgerät (die Kamera) ein<br />
Bezug hergestellt wird.<br />
Genau das kann dieses System automatisch mit der „Punktewolke“<br />
(Bild 7). Die Punktewolke ist ein Bezugssystem aus<br />
definierten Punkten, das die Oberfläche der Schachtgeometrie<br />
von innen darstellt.<br />
Die Punktewolke wird automatisch aus dem Schacht-Scan<br />
nach einem komplexen Bildverarbeitungsverfahren berechnet.<br />
Voraussetzung hierfür ist nur ein gut belichteter SI Film.<br />
Mit diesen Darstellungen, der perspektivischen<br />
3D-Ansicht, der Abwicklung und eben der Punktewolke selbst,<br />
kann dann ziemlich jedes Maß im 3D-Raum des Schachtes<br />
gemessen werden – und das am Schreibtisch, ohne in den<br />
Schacht einsteigen zu müssen (siehe Bild 8).<br />
Auch die Vermessungen auf der Schacht-Abwicklung<br />
basieren auf den Daten der Punktewolke, ohne die die Lage<br />
der Kamera im Schacht für das Mess-System unbekannt<br />
wäre.<br />
In Bild 9 ist ein Schacht mit beliebigem Profil – hier eckig<br />
– und einem Zulauf, der weit einragt. Mit dem Bezugssystem<br />
aus der Punktewolke und dem Referenzabstand der Bilder<br />
im Film ist die SI 3D-Vermessung möglich. Dabei wird mit<br />
mindestens vier Mausklicks ein Mess-Kreis auf das Profil des<br />
Zulaufs gelegt. Das System berechnet automatisch daraus<br />
den Durchmesser des Zulaufs.<br />
Die Bedienung geschieht mit der Vermessungssoftware<br />
am Film. Ein Einstieg in den Schacht ist nicht erforderlich.<br />
Bild 2: Messebene Rohrwand, z.B.<br />
Risse der Rohrwand<br />
Bild 3: Messebene Rohrquerschnitt,<br />
z.B. einragende Gegenstände<br />
Bild 4:<br />
Bildbeispiel:<br />
„Keine<br />
gute<br />
Kameralage<br />
möglich“<br />
Bild 5:<br />
Vermessung im<br />
Querschnitt mit<br />
der PANORAMO<br />
3D-Ansicht<br />
Bild 6:<br />
Vermessung auf<br />
der Rohrwand<br />
mit der<br />
PANORAMO-<br />
Abwicklung<br />
12 / 20121025
FACHBERICHT<br />
ABWASSERENTSORGUNG<br />
Bild 7: Punktewolke mit Innendurchmesser<br />
der angeschlossenen Haltung<br />
Bild 8: Panoramo-SI-Abwicklung: Vermessen des<br />
Durchmessers eines Zulaufs<br />
Bild 9: 3D-Ansicht mit Vermessung „im Raum“<br />
GEOMETRIE UND LAGE VON<br />
ANSCHLUSSKANÄLEN<br />
Ein weiteres Thema für die Vermessung ist die Lage der<br />
Anschlusskanäle. Der Hauptkanal ist mit seinen Schächten<br />
überirdisch sichtbar und zugänglich. Die Haltungen liegen meist<br />
geradlinig zwischen den Schächten. So ist für den Hauptkanal<br />
die geografische Lage überwiegend bekannt und wird in Informationssystemen<br />
und GIS-Datenbanken verwaltet.<br />
Für Anschlussleitungen – also die Zuleitungen von den<br />
Grundstücken zum Hauptkanal – ist das die Ausnahme. Sie<br />
sind überirdisch nicht sichtbar. Pläne zu verbauten Leitungen<br />
gibt es sehr oft gar nicht. Ihre Lage ist also in der Regel unbekannt.<br />
Eine „vermessergenaue“ Erfassung ist aber oft auch<br />
nicht erforderlich und zu kostenintensiv. Ziel ist es, die Lage<br />
der Leitungen für deren betriebliche Beurteilung gegebenenfalls<br />
Sanierungen und andere Baumaßnahmen zu kennen.<br />
Mit der TV-Inspektion der Zuleitungen muss also auch ein<br />
Lageplan der untersuchten Anschlüsse erstellt werden. Das<br />
lässt sich mit der Nutzung der grafischen TV-Inspektionssoftware<br />
IKAS32 mit Plan-Erweiterung und einer systematischen<br />
Vorgehensweise gut bewerkstelligen.<br />
Für die Lage einer Zuleitung ist erst mal wichtig, wo sie<br />
angeschlossen ist. Die Lage des „oberen“ Leitungsendes (Von-<br />
Punkt), z.B. am Gebäude (Revisionsschacht, Straßeneinlauf,<br />
etc..), und des „unteren“ Anschlusspunktes sind in der Regel<br />
nicht offensichtlich erkennbar. Der Verlauf dazwischen ist<br />
auch unbekannt und durch verbaute Rohr-Krümmer und<br />
Bögen nicht geradlinig. Auf keinen Fall zu vernachlässigen<br />
ist, dass für Zuleitungen teilweise erhebliche Höhenunterschiede<br />
zwischen Gebäudeanschluss und dem Anschluss am<br />
Hauptkanal überwunden werden. Die Lage einer Zuleitung ist<br />
also immer dreidimensional zu betrachten. Die Höhen können<br />
nicht vernachlässigt werden.<br />
Es gilt also, die örtliche Lage dieser Punkte einer Leitung mit<br />
der TV-Inspektion festzustellen (siehe Bild 10). Der Anschlusspunkt<br />
am Hauptkanal – also der Abzweiger in der Haltung<br />
– wird vom Inspektionssystem automatisch berechnet. Dazu<br />
müssen die Daten vom Hauptkanal aus Schachtkoordinaten,<br />
Haltungslänge und Durchmesser, Sohlhöhen am oberen und<br />
unteren Schacht, etc. vorliegen. Diese ergeben sich aus der<br />
TV-Inspektion des Hauptkanals und es sollte kein Problem sein,<br />
sie als Vorgabe für eine Zuleitungsinspektion bereitzustellen.<br />
So haben wir für den Verlauf der Leitung den ersten<br />
Bezugspunkt.<br />
Bei der Kamerabefahrung werden dann auch die Rohrkrümmerbauteile<br />
erfasst. Um den weiteren Verlauf der Leitung an<br />
dieser Stelle zu bestimmen, gibt es mehrere Möglichkeiten:<br />
1) Die Kamera kann überirdisch an dieser Position geortet<br />
werden. Mit einem Markierungspunkt kann die Lage des<br />
Krümmers und Rohrverlaufs dann geografisch eingemessen<br />
werden. Das ist sicher eine genaue Vorgehensweise, aber<br />
auch sehr aufwändig.<br />
2) Statt einen Ortungspunkt der Kamera an der Position des<br />
Krümmers zu erstellen, werden die Krümmerwinkel einfach<br />
im Inspektionssystem IKAS32 eingegeben. Das IKAS32-<br />
Programm kann aus diesen Daten den Rohrverlauf inkl.<br />
Höhenlage berechnen. Damit werden die nötigen Ortungspunkte<br />
auf ein Minimum reduziert. Ergibt sich beispielsweise<br />
der Gebäudeanschluss – also der Von-Punkt – eindeutig<br />
aus den Örtlichkeiten und dem Katasterplan, braucht selbst<br />
dieser nicht geortet zu werden.<br />
3) Das Schätzen der Krümmerwinkel im Kamerabild ist manchmal<br />
etwas unsicher, die angegeben Winkel zu ungenau.<br />
Dazu kann die Inspektionssoftware IKAS 32 um eine optische<br />
Vermessung der Krümmer erweitert werden (siehe<br />
Bild 11). Dieser Vermessungsdialog berechnet dem Inspek-<br />
1026 12 / 2012
Bild 10: Die lagebestimmenden Elemente einer Zuleitung<br />
Bild 13: Aufsummieren der<br />
Toleranzen<br />
Bild 12: 3D-Leitungsverlauf aus<br />
TV-Inspektion berechnet<br />
Bild 11: IKAS-Navigator zur opt. Krümmervermessung<br />
teur aus wenigen Mausklicks den Knick- und Richtungswinkel<br />
viel besser als diese abgeschätzt werden können. Der<br />
eigentliche Inspektionsvorgang bleibt dabei unverändert<br />
und wird eben nur um die Krümmervermessung erweitert.<br />
Dies bedeutet einen minimalen Mehraufwand.<br />
Nun ist es wichtig, nochmal an das eingangs Erwähnte zu<br />
erinnern. Die erste Messung bei einer TV-Inspektion ist der<br />
Entfernungswert eines Zustandes. Es nützt nichts, die Krümmerwinkel<br />
präzise auszumessen, ohne dabei auch den Entfernungswert<br />
genau zu messen.<br />
Wir haben also die Leitung mit dem Kamerasystem befahren<br />
und neben den Schäden auch die Krümmer und Abzweiger<br />
bestimmt, woraus die Inspektionssoftware IKAS 32 automatisch<br />
den 3D-Leitungsverlauf berechnet (siehe Bild 12).<br />
Um ein Aufsummieren der Toleranzen für den aus der TV-<br />
Befahrung ermittelten Leitungsverlauf zu verhindern, muss<br />
der Verlauf an mindestens zwei bekannten Fixpunkten eingepasst<br />
werden. Ein Punkt, der Anschlusspunkt am Hauptkanal,<br />
hat sich bereits automatisch ergeben – das erledigt, wie<br />
beschrieben, die Inspektionssoftware. Der zweite Punkt, also<br />
z.B. der Gebäudeanschluss oder Revisionsschacht etc., ist im<br />
Gelände – wenn nicht anders möglich auch durch Kameraortung<br />
– zu bestimmen und in den Verlaufsplan zu übernehmen.<br />
Ohne Ortung des „Von-Punktes“ summieren sich die Toleranzen<br />
über die Länge der Leitung auf. Schon wenige Grad Abweichung<br />
führen zu erheblichen Fehlern der Endpunktlage (siehe<br />
Bild 13). Daraus kann man dann nicht mehr zuverlässig erkennen,<br />
was eigentlich an der Leitung zur Entwässerung angeschlossen<br />
ist. Der obere Anschlusspunkt einer Leitung sollte also immer<br />
aus den örtlichen Begebenheiten und, wenn nötig, mit Kameraortung<br />
möglichst genau festgestellt werden. Mit dem IKAS32<br />
und seinen Assistenten-Funktionen ist der Leitungsverlauf mit<br />
wenigen Bedienungsschritten auf diesen Punkt eingepasst.<br />
Bild 14: Leitungsverlauf am „Bezugssystem“ Hauptkanal<br />
Wie gut und genau der Lageplan am Ende ist, hängt dabei<br />
auch schon von der Qualität der Vermessungsdaten ab, die<br />
der Inspekteur vom Auftraggeber bekommt. So muss sich<br />
die Stationierung des Anschlusspunktes auf die richtigen<br />
Schachtkoordinaten beziehen (Vergleiche in der Einleitung<br />
die Angaben zur Einmessung der Schäden). Auch die Sohlhöhen<br />
der Haltung an den Schächten oben und unten gehen mit<br />
der Rohrdimension in die Lage der Leitung ein (siehe Bild 14).<br />
Auch die Ortung des Von-Punktes der Leitung sollte bezogen<br />
auf den Hauptkanal in den Lageplan übertragen werden<br />
und nicht auf Gebäude-Ecken. In der Regel sind Gebäude im<br />
Katasterplan nicht präzise eingemessen dargestellt.<br />
AUTOR<br />
DIPL.-ING.(FH) ARNO JUGEL<br />
IBAK Helmut Hunger GmbH & Co. KG, Kiel<br />
Tel. +49 431 7270-334<br />
E-Mail: a.jugel@ibak.de<br />
12 / 20121027
PROJEKT KURZ BELEUCHTET<br />
ABWASSERENTSORGUNG<br />
FBS-Stahlbetonrohre DN 2600<br />
sichern Uferpromenade in<br />
Bonn-Mehlem<br />
Kreisrunde Stahlbetonrohre mit Fuß und Falzmuffe sind im Auftrag des Tiefbauamtes der Stadt Bonn bei der Sanierung der<br />
Rheinuferpromenade im Bereich der Mündung des Mehlemer Bachkanals eingebaut worden. Die von der Berding Beton GmbH,<br />
Rohr- und Schachtwerk DW-Nievenheim, nach den Anforderungen der Qualitätsrichtlinien der Fachvereinigung Betonrohre und<br />
Stahlbetonrohre e.V. (FBS) produzierten Rohre in der Nennweite DN 2600 verfügen mit ihrer begehbaren einseitigen Berme über<br />
einen außergewöhnlichen Querschnitt, dessen hydraulische Eigenschaften einen ausreichenden Trockenwetterabfluss sicherstellen.<br />
Ein schweres Unwetter hatte im 4. Juli 2010 in Mehlem,<br />
dem südlichsten Bonner Ortsteil im Stadtbezirk Bad<br />
Godesberg, große Schäden verursacht. Unter anderem<br />
wurden Teile der Uferböschung und der Uferpromenade<br />
im Bereich der Einmündung des Mehlemer Bachkanals<br />
in den Rhein sowie Teile der angrenzenden Hausgrundstücke<br />
unterspült und weggerissen. Nach ersten Sicherungsmaßnahmen<br />
durch Feuerwehr und städtischem<br />
Tiefbauamt – dazu zählte die Stabilisierung der Böschung<br />
mit Sandsäcken und Spritzbeton – wurde der zerstörte<br />
Mündungsbereich des Bachkanals erneuert. In einem<br />
ersten Arbeitsschritt wurden 240 m 2 Spundwände zur<br />
Sicherung der Baugrube eingebaut und rund 150 m 3 Erdreich<br />
unter Wasser ausgehoben. Danach wurde mit 110 m 3<br />
Unterwasserbeton ein Auflager für die vier benötigten FBS-<br />
Stahlbetonrohre hergestellt.<br />
Foto: BERDING BETON GmbH<br />
Stabilität für den Uferbereich: FBS-Stahlbetonrohre DN 2600 sind im Auftrag des<br />
Tiefbauamtes der Stadt Bonn bei der Sanierung der Rheinuferpromenade im Bereich<br />
der Mündung des Mehlemer Bachkanals eingebaut worden<br />
Der Querschnitt der Stahlbetonrohre mit<br />
Berme stellt die Begehbarkeit des<br />
der Querschnitts-Reduktion für eine<br />
1028 12 / 2012
„Dabei handelte es sich um Rohre gemäß DIN EN 1916 /<br />
DIN V1201, Typ 2, mit werkseitig auf dem Spitzende vormontierter<br />
Gleitringdichtung “, erläutert Dipl.-Ing. Hans-<br />
Georg Müller, Niederlassungsleitung, Berding Beton GmbH,<br />
DW Nievenheim, Dormagen. Die in der Schalung erhärteten<br />
Stahlbetonrohre verfügen mit einer monolithisch hergestellten<br />
einseitigen Berme über ein bauliches Merkmal, das nicht<br />
alltäglich ist. „Dieser Querschnitt stellt zum einen die Begehbarkeit<br />
des Profils sicher“, so Müller, „darüber hinaus sorgt er in<br />
Folge der Querschnitts-Reduktion für eine ausreichend hohe<br />
Schleppspannung. Auf diese Weise bleibt der Kanal auch bei<br />
Trockenwetterlagen ablagefrei und eine Geruchsbelästigung<br />
wird unterbunden.“<br />
Die mehr als 22 t schweren Rohre verfügen über eine Baulänge<br />
von 3,00 m und wurden entsprechend den Anforderungen<br />
der FBS-Qualitätsrichtlinie Teil 1.1 hergestellt. Für Müller<br />
ein wichtiges Kriterium, „denn damit verfügen die Rohre über<br />
ein zusätzliches Plus“. Das FBS-Qualitätssicherungssystem<br />
mit seiner umfassenden werkseigenen Produktionskontrolle<br />
(WPK) stellt eine für Rohrwerkstoffe einmalige und lückenlose<br />
Qualitätskontrolle von den Ausgangsstoffen über die<br />
Herstellung bis zu den Endprodukten sicher. Im Rahmen der<br />
halbjährlichen Fremdüberwachung durch bauaufsichtlich anerkannte<br />
Güteschutzgemeinschaften oder Prüfinstitute, wird<br />
die Erfüllung der Norm- und FBS-Anforderungen kontrolliert<br />
und bewertet. „Hinter dem FBS-Qualitätszeichen steht damit<br />
ein System, das dem Anwender von FBS-Kanalbauteilen eine<br />
hohe Qualität sicherstellt“, so Müller.<br />
Die Lücke zwischen den neu verlegten Rohren und dem vorhandenen<br />
Bachkanal an der Abrissstelle wurde mit einem Übergangsbauwerk<br />
geschlossen. Als weitere Sicherungsmaßnahme<br />
wurden im Bereich des Auslaufbauwerks zusätzlich 40 m 3<br />
Beton verarbeitet und 35 m 2 Basaltsteine zur Auskleidung<br />
verbaut. Darüber hinaus ließ das Tiefbauamt den vom Hochwasser<br />
betroffenen Uferbereich mit Boden auffüllen und mit<br />
Basalt- und Wasserbausteinen verkleiden.<br />
KONTAKT<br />
FBS, Bonn, Tel. +49 228 9545654, E-Mail: info@fbsrohre.de,<br />
www.fbsrohre.de<br />
Foto: BERDING BETON GmbH<br />
Foto: FBS<br />
einer einseitigen monolithischen<br />
Profils sicher und sorgt in Folge<br />
ausreichend hohe Schleppspannung<br />
Die wiederhergestellte Uferpromenade in Mehlem: Als zusätzliche Sicherungsmaßnahme<br />
wurden im Bereich des Auslaufbauwerks 40 m 3 Beton verarbeitet<br />
und 35 m 2 Basaltsteine zur Auskleidung verbaut<br />
12 / 20121029
PROJEKT KURZ BELEUCHTET<br />
ABWASSERENTSORGUNG<br />
Flughafen Frankfurt: Kanal am<br />
Terminal A plus durchbohrt<br />
Ein Abwasserkanal auf dem Rollfeld des Terminals A wurde beim Bau des neuen Terminals A plus mit unterirdischen Stahlseilen<br />
durchbohrt. Der neue Flugsteig ging am 10. Oktober 2012 in Betrieb. Kostenerwägungen und Zeitplanung veranlassten die<br />
Fraport AG, den Schaden mithilfe von Sanierungsrobotern zu reparieren. Ein Aufriss der Rollbahn konnte damit umgangen werden.<br />
Beauftragt wurde das Unternehmen Schwalm aus Bad Hersfeld, das auf Kanalreinigung, Entsorgung von Reinigungsrückständen<br />
aus Grubenentleerung und Fettabscheider-Service, TV-Inspektion von Kanalhaltungen sowie auf Verfahren des partiellen<br />
Relinings im Rahmen der grabenlosen Sanierung von Hauptrohren und Hausanschlüssen spezialisiert ist. Die Arbeiten dauerten<br />
zweieinhalb Wochen.<br />
Während der Baumaßnahmen für das neue Flughafenterminal<br />
A plus wurden Stahlseile zur Befestigung von Stahlspundwänden<br />
schräg ins Erdreich getrieben. Aufgrund von Unachtsamkeit,<br />
die genauen Umstände sind noch nicht geklärt, durchschossen<br />
einige dieser Stahlseile, im Fachjargon Ankerlitzen<br />
genannt, einen Abwasserkanal, der direkt vor dem Erweiterungsbau<br />
verläuft. Zur Veranschaulichung stelle man sich den<br />
Querschnitt des Kanalrohrs vor: die Ankerlitzen traten bei<br />
11 Uhr ein und bei 5 Uhr wieder aus. Diese Sehnen aus Stahl<br />
behinderten damit aber den freien Abfluss im Kanal. Zudem<br />
war nun durch eben diese Löcher in der Rohrwand Beton in<br />
den Abwasserkanal geflossen. Den Beton hatte man im Erdreich<br />
verpresst, um die Ankerlitzen an ihrem Ende nach Dübelprinzip<br />
zu verankern. Das Erweiterungsgebäude ist längst<br />
fertig und wartet auf Inbetriebnahme. Die Ankerlitzen beließ<br />
man im Boden. Was man nicht wusste: Sie steckten an einigen<br />
Stellen auch im Kanalrohr.<br />
Im Zuge einer kameratechnischen Befahrung der Kanalisation<br />
wurde dieser Schaden nun im August 2012 entdeckt.<br />
Die Fraport lässt die gesamte Flughafenkanalisation nach der<br />
,Eigenkontrollverordnung (EKVO) in regelmäßigen Abständen<br />
auf Dichtheit überprüfen. Zuständig bei der Fraport AG ist<br />
der Geschäftsbereich Handels- und Vermietungsmanagement.<br />
Jürgen Scheuring, Leiter des dortigen Fachbereichs<br />
Bedarf- und Netzmanagement Medien, sieht sich als Ver- und<br />
Entsorgungsunternehmen für den gesamten Flughafenbetrieb.<br />
Er betont, dass die Qualitätsstandards der Fraport in<br />
puncto Umwelttechnik und Wirtschaftlichkeit führend sind<br />
und höchsten Anforderungen gerecht werden. Um in dem<br />
versperrten Kanalabschnitt wieder für ungehinderten Abfluss<br />
zu sorgen, mussten zunächst die Stahlseilstücke, die wie Sehnen<br />
das Rohr quer durchzogen, mit einem Roboter herausgeschnitten<br />
werden. Am Arbeitsarm des dafür eingesetzten<br />
Roboters Talpa FSR 2060, der sich jeder Situation flexibel<br />
anpasst, war zu diesem Zweck ein Druckluft Winkelschleifer<br />
aufmontiert. Michael Maul und Reinhard Herwig, beide<br />
Fachkräfte für Rohr-, Kanal- und Industrieservice, führten die<br />
Arbeiten für Schwalm durch. Die Facharbeiter arbeiteten sich<br />
Schritt für Schritt im Kanal vor. Sechs Stahlseilstücke mussten<br />
insgesamt herausgetrennt werden. Die inzwischen völlig<br />
Christian Englert (li.), Bauleiter Fraport, und Michael Maul,<br />
Schwalm Teamleiter, am Steuerpult im Sanierungsfahrzeug<br />
Fundstück: Im Verlauf der Sanierungsarbeiten aus dem Kanal<br />
geborgene Bohrkrone<br />
1030 12 / 2012
Schemadarstellung der Durchbohrung: Eintritt (11 Uhr) und Austritt<br />
(5 Uhr) der Ankerlitzen<br />
Thomas Brauneis (Kanalservice Brauneis), Reinhard Herwig (Schwalm),<br />
Ralf Brauneis (Junior-Chef Brauneis), Michael Maul (Teamleiter<br />
Schwalm) und Christian Englert (Bauleiter Fraport) (v.l.n.r.)<br />
verkrusteten Betonablagerungen wurden ebenfalls mithilfe<br />
des Roboters und einem Meißelvorsatz herausgestemmt.<br />
Von Etappe zu Etappe wurde der betroffene Kanalabschnitt<br />
mit Hochdruckspülung zwischengereinigt und der jeweilige<br />
Abraum abgesaugt. Hierfür stand ein Hochdruckspülfahrzeug<br />
der Firma Brauneis aus Hainburg bei Seligenstadt bereit. Nachdem<br />
der Kanal von seinen Hindernissen befreit war, wurden<br />
die durchlöcherten Rohrabschnitte mit kunstharzgetränktem<br />
ECR-Glasfaserlaminat, so genannten Kurzlinern, von innen<br />
dauerhaft abgedichtet und stabilisiert. Für Michael Maul, der<br />
die grabenlose Sanierung vor Ort federführend voranbrachte,<br />
war der Fraport-Einsatz Routine.<br />
Christian Englert, Bauleiter der Fraport AG, unter dessen<br />
Aufsicht der zweieinhalbwöchige Sondereinsatz lief, dazu: „Am<br />
10. Oktober 2012 ging der neue Flugsteig A plus in Betrieb. An<br />
diesem Abwasserkanal hingen wichtige Gebäudeabschnitte.<br />
Das grabenlose Verfahren sparte uns nicht nur Nerven, sondern<br />
vor allem Zeit und natürlich viel Geld.“<br />
KONTAKT<br />
Schwalm Kanalsanierung, Bad Hersfeld, E-Mail: info@<br />
schwalm-kanalsanierung.de<br />
12 / 20121031
AKTUELLE TERMINE<br />
SERVICES<br />
SEMINARE UND SCHULUNGEN<br />
AGE<br />
SEMINARE<br />
Technik der Gasversorgung für Kaufleute<br />
12./13.03.2013 Nürnberg<br />
Technik der Abwasserentsorgung für Kaufleute<br />
28.05.2013 Leipzig<br />
AGFW<br />
SEMINAR<br />
Wartung und Instandhaltung von Fernwärmesystemen<br />
16./17.01.2013 Nürnberg<br />
BAU-Akademie Nord<br />
SEMINARE<br />
GW 15 – Grundkurs Nachumhüllen von<br />
Rohren, Armaturen und Formteilen nach<br />
DVGW-Merkblatt GW 15<br />
07.-09.01.2013 Bad Zwischenahn<br />
28.-30.01.2013 Bad Zwischenahn<br />
11.-13.02.2013 Bad Zwischenahn<br />
18.-20.02.2013 Bad Zwischenahn<br />
04.-06.03.2012 Bad Zwischenahn<br />
08.-12.04.2012 Bad Zwischenahn<br />
GW 15 – Nachschulung Nachumhüllen von<br />
Rohren, Armaturen und Formteilen nach<br />
DVGW-Merkblatt GW 15<br />
10.01.2013 Bad Zwischenahn<br />
31.01.2013 Bad Zwischenahn<br />
07.02.2013 Bad Zwischenahn<br />
14.02.2013 Bad Zwischenahn<br />
21.02.2013 Bad Zwischenahn<br />
07.03.2013 Bad Zwischenahn<br />
04.04.2013 Bad Zwischenahn<br />
11.04.2013 Bad Zwischenahn<br />
GW 330 – Grundkurs PE-Schweißer gemäß<br />
DVGW-Arbeitsblatt GW 330<br />
04.-08.02.2013 Bad Zwischenahn<br />
25.02.-01.03.2013 Bad Zwischenahn<br />
08.04.-12.04.2013 Bad Zwischenahn<br />
GW 330 – Nachschulung PE-Schweißer<br />
gemäß DVGW-Arbeitsblatt GW 330<br />
14.01.2013 Bad Zwischenahn<br />
15.01.2013 Bad Zwischenahn<br />
21.01.2013 Bad Zwischenahn<br />
22.01.2013 Bad Zwischenahn<br />
18.03.2013 Bad Zwischenahn<br />
19.03.2013 Bad Zwischenahn<br />
15.04.2013 Bad Zwischenahn<br />
16.04.2013 Bad Zwischenahn<br />
17.04.2013 Bad Zwischenahn<br />
18.04.2013 Bad Zwischenahn<br />
GW 129 – Sicherheit bei Bauarbeiten im<br />
Bereich von Versorgungsanlagen für Baumaschinenführer<br />
gemäß DVGW-Hinweis<br />
GW 129<br />
11.01.2013 Bad Zwischenahn<br />
16.01.2013 Bad Zwischenahn<br />
25.01.2013 Bad Zwischenahn<br />
30.01.2013 Bad Zwischenahn<br />
12.03.2013 Bad Zwischenahn<br />
GW 129 - Sicherheit bei Bauarbeiten im<br />
Bereich von Versorgungsanlagen für Ausführende,<br />
Aufsichtsführende und Planer<br />
gemäß DVGW-Hinweis GW 129<br />
18.01.2013 Bad Zwischenahn<br />
15.02.2013 Bad Zwischenahn<br />
GW 128 – Grundkurs Vermessungsarbeiten<br />
an Gas- und Wasserrohrnetzen<br />
21./22.01.2013 Bad Zwischenahn<br />
18./19.02.2013 Bad Zwischenahn<br />
11./12.03.2013 Bad Zwischenahn<br />
GW 128 Nachschulung Vermessungsarbeiten<br />
an Gas- und Gas- und Wasserrohrnetzen<br />
23.01.2013 Bad Zwischenahn<br />
13.03.2013 Bad Zwischenahn<br />
Thementag Rohrleitungsbau: Großrohre aus<br />
Polyethylen – Einsatz von PE-HD-Rohren<br />
in der Praxis<br />
06.02.2013 Bad Zwischenahn<br />
W 339 - Fachkraft für Muffentechnik<br />
metallischer Rohrsysteme – DVGW-<br />
Arbeitsblatt W 339<br />
18.-20.03.2013 Bad Zwischenahn<br />
brbv<br />
SPARTENÜBERGREIFENDE<br />
GRUNDLAGENSCHULUNGEN<br />
Fachaufsicht (A/B) für horizontales Spülbohrverfahren<br />
nach GW 329<br />
A: 07.-11.01.2013 Celle<br />
B: 07.-16.01.2013 Celle<br />
Bauleiter (A/B) für horizontales Spülbohrverfahren<br />
nach GW 329<br />
A: 07.-18.01.2013 Celle<br />
B: 07.-25.01.2013 Celle<br />
Geräteführer (A/B) für horizontales Spülbohrverfahren<br />
nach GW 329<br />
A: 14.-19.01.2013 Celle<br />
B: 14.01.-05.02.2013 Celle<br />
GFK-Rohrleger nach DVGW-Arbeitsblatt<br />
W 324 – Grundkurs<br />
06./07.12.2012 Gera<br />
GFK-Rohrleger nach DVGW-Arbeitsblatt<br />
W 324 – Nachschulung<br />
18.01.2013 Gera<br />
Baustellenabsicherung und Verkehrssicherung<br />
RSA/ZTV-SA - 1 Tag<br />
15.01.2013 Augsburg<br />
INFORMATIONSVERANSTALTUNGEN<br />
Arbeitssicherheit im Tief- und Leitungsbau<br />
30.01.2013 Bingen<br />
Baurecht 2013<br />
29.01.2013 Würzburg<br />
Einbau und Abdichtung von Netz- und<br />
Hausanschlüssen bei Neubau und Sanierung<br />
16.01.2013 Stuttgart<br />
GAS/WASSER<br />
GRUNDLAGENSCHULUNGEN<br />
GW 128 Grundkurs „Vermessung“<br />
11 Termine ab 04.12.2012 bundesweit<br />
GW 128 Nachschulung „Vermessung“<br />
10 Termine ab 07.12.2012 bundesweit<br />
Sicherheit bei Arbeiten im Bereich von<br />
Versorgungsleitungen – Schulung nach<br />
Hinweis GW 129<br />
6 Termine ab 04.12.2012 bundesweit<br />
Schweißaufsicht nach DVGW-Merkblatt<br />
GW 331<br />
28.01.-01.02.2013 Aachen<br />
28.01.-01.02.2013 Würzburg<br />
PE-HD Schweißer nach DVGW-Arbeitsblatt<br />
GW 330 – Grundkurs<br />
32 Termine ab 03.12.2012 bundesweit<br />
PE-HD Schweißer nach DVGW-Arbeitsblatt<br />
GW 330 – Verlängerung<br />
56 Termine ab 03.12.2012 bundesweit<br />
Nachumhüllen von Rohren, Armaturen, und<br />
Formteilen nach DVGW-Merkblatt GW 15<br />
– Grundkurs<br />
19 Termine ab 03.12.2012 bundesweit<br />
Nachumhüllen von Rohren, Armaturen, und<br />
Formteilen nach DVGW-Merkblatt GW 15<br />
– Nachschulung<br />
21 Termine ab 06.12.2012 bundesweit<br />
INFORMATIONSVERANSTALTUNGEN<br />
Aufbaulehrgänge Gas/Wasser<br />
12 Termine ab 08.01.2013 bundesweit<br />
Arbeiten an Gasleitungen – BGR 500<br />
Kap. 2.31<br />
09.01.2013 Münster<br />
16.01.2013 Albershausen<br />
24.01.2013 Magdeburg<br />
Bau von Gasrohrnetzen bis 16 bar<br />
30./31.01.2013 Bingen<br />
Techniklehrgang für Vorarbeiter im<br />
Rohrleitungsbau - Gas/Wasser<br />
14.-18.01.2013 Nürnberg<br />
21.-25.01.2013 Hamburg<br />
DVGW-Arbeitsblatt GW 301 – Qualitätsanforderungen<br />
für Rohrleitungsbauunternehmen<br />
17.01.2013 Karlsruhe<br />
PRAXISSEMINARE<br />
Druckprüfung von Gas- und Wasserleitungen<br />
16./17.01.2013 Remshalden<br />
Arbeiten an Gasleitungen – BGR 500,<br />
Kap. 2.31 – Fachaufsicht<br />
07.-11.01.2013 Gera<br />
Fachaufsicht Korrosionsschutz für<br />
Nachumhüllungsarbeiten gemäß DVGW-<br />
Merkblatt GW 15<br />
10.01.2013 Frankfurt<br />
1032 12 / 2012
AKTUELLE TERMINE<br />
SERVICES<br />
SEMINARE UND SCHULUNGEN<br />
Fachwissen für Schweißaufsichten nach<br />
DVGW-Merkblatt GW 331 inkl. DVS-<br />
Abschluss 2212-1<br />
14./15.01.2013 Dortmund<br />
FERNWÄRME<br />
GRUNDLAGENSCHULUNGEN<br />
Geprüfter Netzmeister Fernwärme –<br />
Vollzeitlehrgang<br />
28.01.-15.03.2013 Köln, Dresden<br />
Zusatzqualifikation Fernwärme<br />
28.01.-15.03.2013 Köln, Dresden<br />
DVGW<br />
INTENSIVSCHULUNGEN<br />
Abnahme von Druckprüfungen an<br />
Trinkwasserrohrleitungen<br />
04.12.2012 Hannover<br />
11.12.2012 Herdecke<br />
Berechnung und Optimierung von<br />
Gasverteilungsnetzen<br />
04.-06.12.2012 Göttingen<br />
Trinkwasserverordnung – Neue Pflichten<br />
und Chancen für Wasserversorger<br />
14.02.2013 Ulm<br />
Egeplast<br />
SEMINARE<br />
PE-Rohre in der Versorgung<br />
15.01.2013 Greven/Westfalen<br />
05.02.2013 Greven/Westfalen<br />
05.03.2012 Greven/Westfalen<br />
Spülbohrseminar<br />
24.01.2013 Greven/Westfalen<br />
Druckprüfungen an Kunststoffrohren<br />
nach W 400<br />
19.-20.03.2013 Greven/Westfalen<br />
06.-07.11.2013 Greven/Westfalen<br />
04.-05.12.2013 Greven/Westfalen<br />
Druckprüfungen an Kunststoffrohren<br />
nach G 469<br />
12.-13.03.2013 Greven/Westfalen<br />
09.-10.10.2013 Greven/Westfalen<br />
<strong>27.</strong>-28.11.2013 Greven/Westfalen<br />
GWI Essen<br />
SEMINARE<br />
Praxis der Ortsgasverteilung<br />
10./11.01.2013 Essen<br />
Instandhaltung von Gasleitungen aus Stahlrohren<br />
größer 5 bar gem. DVGW G 466-1<br />
23./24.01.2013 Essen<br />
Sicherheitstraining bei Bauarbeiten im<br />
Bereich von Versorgungsleitungen - BALSibau<br />
- DVGW GW 129<br />
25.01.2013 Essen<br />
22.02.2013 Essen<br />
19.04.2013 Essen<br />
12.07.2013 Essen<br />
<strong>27.</strong>09.2013 Essen<br />
22.11.2013 Essen<br />
Sachkundigenschulung Gas-Druckregelund<br />
-Messanlagen im Netzbetrieb und in<br />
der Industrie<br />
18.-20.02.2013 Essen<br />
24.-26.06.2013 Essen<br />
16.-18.09.2013 Essen<br />
09.-11.12.2013 Essen<br />
Arbeiten an freiverlegten Gasrohrleitungen<br />
auf Werksgelände und im Bereich betrieblicher<br />
Gasverwendung gemäß DVGW G<br />
614 Praxis der Ortsgasverteilung<br />
25.02.2013 Essen<br />
06.09.2013 Essen<br />
Gasspüren und Gaskonzentrationsmessungen<br />
04./05.03.2013 Essen<br />
18./19.06.2013 Essen<br />
07./08.10.2013 Essen<br />
Sachkundige für Klärgas- und Biogasanlagen<br />
in der Abwasserbehandlung<br />
05./06.03.2013 Essen<br />
Grundlagen, Praxis und Fachkunde von<br />
Gas-Druckregelanlagen nach DVGW<br />
G 491, G 495 und G459-2<br />
11./12.03.2013 Essen<br />
10.-11.07.2013 Essen<br />
20.-21.11.2013 Essen<br />
Instandhaltung von Gasrohrnetzen<br />
14./15.03.2013 Essen<br />
Die DVGW-TRGI 2008 - Technische Regeln<br />
für Gasinstallationen<br />
18.03.2013 Essen<br />
18.07.2013 Essen<br />
Wirtschaftliche Instandhaltung von<br />
Gasnetzen und -anlagen<br />
21.03.2013 Essen<br />
18.12.2013 Essen<br />
Gas-Hausanschlüsse – Planung, Betrieb,<br />
Instandhaltung<br />
10./11.04.2013 Essen<br />
12./13.12.2013 Essen<br />
Auslegung und Dimensionierung von<br />
Gas-Druckregelanlagen<br />
10./11.04.2013 Essen<br />
09./10.10.2013 Essen<br />
Sicheres Arbeiten und Sicherheitstechnik<br />
in der Gas-Hausinstallation<br />
17./18.04.2013 Essen<br />
25./26.09.2013 Essen<br />
Sachkundige für Odorieranlagen - DVGW<br />
G 280<br />
24./25.04.2013 Essen<br />
12./13.11.2013 Essen<br />
Prüfungen, Dokumentationen und Abnahmen<br />
von Gas-Druckregelanlagen bis 5 bar<br />
durch Sachkundige<br />
14./15.05.2013 Essen<br />
05./06.11.2013 Essen<br />
Weiterbildung von Sachkundigen und technischen<br />
Führungskräften im Bereich<br />
von Gas-Druckregel- und -Messanlagen<br />
03./04.06.2013 Essen<br />
16./17.09.2013 Essen<br />
18./19.06.2013 Organisation und Logistik<br />
der Gasrohrnetzüberprüfung<br />
17.06.2013 Essen<br />
Weiterbildung von Sachkundigen und technischem<br />
Personal für Klärgas- und Biogasanlagen<br />
in der Abwasserbehandlung<br />
26./<strong>27.</strong>09.2013 Essen<br />
Grundlagen der Gas-Druckregelung<br />
15./16.10.2013 Essen<br />
HDT<br />
SEMINARE<br />
Druckstöße, Dampfschläge und<br />
Pulsationen in Rohrleitungen<br />
18./19.02.2013 Essen<br />
18./19.03.2013 Berlin<br />
22./23.04.2013 München<br />
Festigkeitsmäßige Auslegung von Druckbehältern<br />
03./04.12.2012 Essen<br />
Druckstöße, Dampfschläge und Pulsationen<br />
in Rohrleitungen<br />
18./19.02.2012 Essen<br />
Dichtverbindungen an Rohrleitungen<br />
26.02.2013 München<br />
Rohrleitungen EN 13480<br />
26./<strong>27.</strong>02.2013 München<br />
Flanschverbindungen<br />
<strong>27.</strong>02.2013 München<br />
Flanschberechnung EN 1591<br />
14.03.2013 Essen<br />
TAE<br />
SEMINARE<br />
Messtechnik beim kathodischen<br />
Korrosionsschutz (KKS)<br />
13.-15.05.2013 Ostfildern<br />
TAH<br />
SEMINARE<br />
Zertifizierter Kanalsanierungs-Berater<br />
2013<br />
14.01.-13.04.2013 Essen<br />
11.03.-15.06.2013 Hannover<br />
TAW<br />
SEMINARE<br />
Verfahrenstechnische Erfahrungsregeln bei<br />
der Auslegung von Apparaten und Anlagen<br />
04./05.03.2013 Wuppertal<br />
03./04.06.2013 Wuppertal<br />
Rohrleitungen in verfahrenstechnischen<br />
Anlagen planen und auslegen<br />
16./17.04.2013 Wuppertal<br />
12 / 20121033
AKTUELLE TERMINE<br />
SERVICES<br />
SEMINARE UND SCHULUNGEN<br />
Veranstaltungen zum<br />
Korrosionsschutz<br />
SEMINARE<br />
Refresherseminar zur Prüfung nach DIN<br />
EN 15257 A1, A2 erdverlegte Anlagen<br />
24./25.01.2013 Wuppertal (angeboten<br />
durch die Technische Akademie<br />
Wuppertal)<br />
Zertifikatsprüfung Grad 1, Grad 2 DIN<br />
EN 15257 A1, A2 erdverlegte Anlagen<br />
25.01.2013 Esslingen (angeboten durch<br />
die fkks cert gmbh)<br />
Zustandsbewertung von Rohrnetzen<br />
30.01.2013 Workshop in Esslingen (veranstaltet<br />
durch den fkks)<br />
Hochspannungsbeeinflussung erdverlegter<br />
Rohrleitungen<br />
31.01.2013 Esslingen (veranstaltet<br />
durch die Technische Akademie<br />
Esslingen) Tagungen<br />
12. Tagung Korrosionsschutz in der maritimen<br />
Technik<br />
23./24.01.2013 Hamburg (veranstaltet durch<br />
den Germanische Lloyd, die<br />
HTG und die GfKorr)<br />
Esslingen forum kks mit fkks Infotag 2013,<br />
fkks workshop Zustandsbewertung und<br />
Jahreshauptversammlung 2013<br />
28.-30.01.2013 Esslingen<br />
ZfW<br />
WORKSHOP<br />
Kathodischer Korrosionsschutz für Wasserrohrleitungen<br />
aus Stahl<br />
16./17.04.2013 Würzburg<br />
KONTAKTADRESSEN<br />
Kontakt für AGE-Seminare<br />
EW Medien und Kongresse GmbH, Tel.<br />
069/7104687-218, Fax 069/7104687-9218,<br />
www.ew-online.de<br />
AGFW<br />
AGFW-Projekt-GmbH, Tanja Limoni, E-Mail:<br />
t.limoni@agfw.de, www.energieeffizienzverband.de<br />
DVGW<br />
Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches<br />
e.V., Tel. 0228/9188-607,<br />
Fax 0228/9188-997,<br />
E-Mail: splittgerber@dvgw.de, www.dvgw.de<br />
egeConference<br />
egeplast international GmbH, Dipl.-Ing. Holger<br />
Hesse, Tel +49 2575/9710-252,<br />
E-Mail: Holger.Hesse@egeplast.de, www.<br />
egeplast.de<br />
GWI<br />
Gas- und Wärmeinstitut Essen e.V., Frau<br />
B. Hohnhorst, Tel. 0201/3618-143, Fax<br />
0201/3618-146, E-Mail: hohnhorst@gwiessen.de,<br />
www.gwi-essen.de<br />
HdT<br />
Haus der Technik Essen, Tel. 0201/1803-1,<br />
E-Mail: hdt@hdt-essen.de, www.hdt-essen.de<br />
TAH<br />
Technische Akademie Hannover e.V.,<br />
Dr. Igor Borovsky, Tel. 0511/39433-30,<br />
Fax 0511/39433-40, E-Mail: borovsky@<br />
ta-hannover.de, www.ta-hannover.de<br />
TAW<br />
Technische Akademie Wuppertal e.V.,<br />
Tel. 0202/7495-207, Fax 0202/7495-228,<br />
E-Mail: taw@taw.de, www.taw.de<br />
MESSEN UND TAGUNGEN<br />
Infrastructure North Africa<br />
21./22.01.2013 in Tunis; EITEP, Dennis Fandrich, Tel. 0511/90992-22,<br />
fandrich@eitep.de, www.infrastructurenorthafrica.com<br />
<strong>27.</strong> <strong>Oldenburger</strong> <strong>Rohrleitungsforum</strong><br />
07./08.02.2013 Institut für Rohrleitungsbau an der Fachhochschule Oldenburg<br />
e.V., Tel. 0441/361039-0, Fax 0441/361039-10,<br />
E-Mail: info@iro-online.de, www.iro-online.de<br />
20. Tagung Rohrleitungsbau – Energieinfrastruktur im Wandel<br />
22./23.01.2013 in Berlin; brbv GmbH, Gabriele Borkes, Tel. 0221/37668-20,<br />
Fax 0221/37668-62, E-Mail: koeln@brbv.de, www.brbv.<br />
de<br />
WASSER BERLIN INTERNATIONAL<br />
23.-26.04.2013 Messe Berlin GmbH, Tel. 030/3038-0, Fax 030/3038-<br />
2325, E-Mail: central@messe-berlin.de, www.wasserberlin.de<br />
Tiefbauforum Neu-Ulm<br />
24.01.2013 Saint-Gobain Building Distribution Deutschland GmbH, Kathrin<br />
Will, Tel. 069/40505-105,<br />
E-Mail: presse-sgbdd@saint-gobain.com<br />
5. Europäische Rohrleitungstage 2013<br />
26./<strong>27.</strong>06.2013 in St. Veit an der Glan, Österreich; MTA Messtechnik GmbH,<br />
Tel: +43/ 4212/71491, Fax: +43/4212/72298, E-Mail:<br />
office@mta-messtechnik.at, www.mta-messtechnik.at<br />
E-world energy & water<br />
05.-07.02.2013 in Essen;<br />
www.e-world-2013.com<br />
1034 12 / 2012
AKTUELLE TERMINE<br />
SERVICES<br />
INSERENTENVERZEICHNIS<br />
Firma<br />
<strong>27.</strong> <strong>Oldenburger</strong> <strong>Rohrleitungsforum</strong> 2013, Oldenburg Titelseite<br />
8th Pipeline Technology Conference 2013, Hannover 1007<br />
3S Consult GmbH, Garbsen 959<br />
Diringer & Scheidel Rohrsanierung GmbH & Co. KG, Mannheim 973<br />
egeplast international GmbH, Greven 955<br />
Fachverband Steinzeugindustrie, Frechen 957<br />
Güteschutz Kanalbau e.V., Bad Honnef 951<br />
IE expo 2013, Shanghai, Volksrepublik China 1031<br />
OOWV, Brake Stellenanzeige 954<br />
PS Vietnam 2013, Ho Chi Minh City, Vietnam 976<br />
Marktübersicht 1015-1023<br />
GANZ ROHR<br />
Heute schon<br />
Know-how geshoppt?<br />
Der neue Internetauftritt der <strong>3R</strong><br />
www.<strong>3R</strong>-Rohre.de
RsV-Regelwerke<br />
RSV Merkblatt 1<br />
renovierung von entwässerungskanälen und -leitungen<br />
mit vor Ort härtendem Schlauchlining<br />
2011, 48 Seiten, DIN A4, broschiert, € 35,-<br />
RSV Merkblatt 2<br />
renovierung von Abwasserleitungen und -kanälen mit<br />
rohren aus thermoplastischen Kunststoffen durch<br />
Liningverfahren ohne ringraum<br />
2009, 38 Seiten, DIN A4, broschiert, € 29,-<br />
RsV Merkblatt 2.2<br />
renovierung von Abwasserleitungen und -kanälen mit<br />
vorgefertigten rohren durch TIP-Verfahren<br />
2011, 32 Seiten DIN A4, broschiert, € 29,-<br />
RsV Merkblatt 3<br />
renovierung von Abwasserleitungen und -kanälen durch<br />
Liningverfahren mit ringraum<br />
2008, 40 Seiten, DIN A4, broschiert, € 29,-<br />
RsV Merkblatt 4<br />
reparatur von drucklosen Abwässerkanälen und<br />
rohrleitungen durch vor Ort härtende Kurzliner (partielle Inliner)<br />
2009, 20 Seiten, DIN A4, broschiert, € 29,-<br />
RsV Merkblatt 5<br />
reparatur von entwässerungsleitungen und Kanälen<br />
durch roboterverfahren<br />
2007, 22 Seiten, DIN A4, broschiert, € 27,-<br />
RsV Merkblatt 6<br />
Sanierung von begehbaren entwässerungsleitungen und<br />
-kanälen sowie Schachtbauwerken - Montageverfahren<br />
2007, 23 Seiten, DIN A4, broschiert, € 29,-<br />
RsV Merkblatt 6.2<br />
Sanierung von Bauwerken und Schächten<br />
in entwässerungssystemen<br />
2012, 41 Seiten, DIN A4, broschiert, € 35,-<br />
RsV Merkblatt 7.1<br />
renovierung von drucklosen Leitungen /<br />
Anschlussleitungen mit vor Ort härtendem Schlauchlining<br />
2009, 30 Seiten, DIN A4, broschiert, € 29,-<br />
RsV Merkblatt 7.2<br />
Hutprofiltechnik zur einbindung von Anschlussleitungen –<br />
reparatur / renovierung<br />
2009, 31 Seiten, DIN A4, broschiert, € 30,-<br />
RsV Merkblatt 8<br />
erneuerung von entwässerungskanälen und -anschlussleitungen<br />
mit dem Berstliningverfahren<br />
2006, 27 Seiten, DIN A4, broschiert, € 29,-<br />
RsV Merkblatt 10,<br />
Kunststoffrohre für grabenlose Bauweisen<br />
2008, 55 Seiten, DIN A4, broschiert, € 37,-<br />
RsV information 11<br />
Vorteile grabenloser Bauverfahren für die erhaltung und<br />
erneuerung von Wasser-, Gas- und Abwasserleitungen<br />
2012, 42 Seiten DIN A4, broschiert, € 9,-<br />
Auch als<br />
eBook<br />
erhältlich!<br />
www.vulkan-verlag.de<br />
Jetzt bestellen!<br />
Wissen für DIe<br />
Zukunft<br />
faxbestellschein an: +49 201 / 82002-34 Deutscher Industrieverlag oder GmbH abtrennen | Arnulfstr. und 124 im | fensterumschlag 80636 München einsenden<br />
Ja, ich / wir bestelle(n) gegen rechnung:<br />
___ ex. rSV-M 1 € 35,-<br />
___ ex. rSV-M 2 € 29,-<br />
___ ex. rSV-M 2.2 € 29,-<br />
___ ex. rSV-M 3 € 29,-<br />
___ ex. rSV-M 4 € 29,-<br />
___ ex. rSV-M 5 € 27,-<br />
___ ex. rSV-M 6 € 29,-<br />
Ich bin rSV-Mitglied und erhalte 20 % rabatt<br />
auf die gedruckte Version (Nachweis erforderlich!)<br />
___ ex. rSV-M 6.2 € 35,-<br />
___ ex. rSV-M 7.1 € 29,-<br />
___ ex. rSV-M 7.2 € 30,-<br />
___ ex. rSV-M 8 € 29,-<br />
___ ex. rSV-M 10 € 37,-<br />
___ ex. rSV-I 11 € 9,-<br />
zzgl. Versandkosten<br />
firma/Institution<br />
Vorname, Name des empfängers<br />
Straße / Postfach, Nr.<br />
Land, PLZ, Ort<br />
Telefon<br />
Telefax<br />
Antwort<br />
Vulkan-Verlag GmbH<br />
Versandbuchhandlung<br />
Postfach 10 39 62<br />
45039 Essen<br />
e-Mail<br />
Branche / Wirtschaftszweig<br />
Bevorzugte Zahlungsweise Bankabbuchung rechnung<br />
Bank, Ort<br />
Widerrufsrecht: Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B.<br />
Brief, fax, e-Mail) oder durch rücksendung der Sache widerrufen. Die frist beginnt nach erhalt dieser Belehrung in Textform.<br />
Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache an die Vulkan-Verlag GmbH,<br />
Versandbuchhandlung, Huyssenallee 52-56, 45128 essen.<br />
Bankleitzahl<br />
Ort, Datum, Unterschrift<br />
Kontonummer<br />
nutzung personenbezogener Daten: für die Auftragsabwicklung und zur Pflege der laufenden Kommunikation werden personenbezogene Daten erfasst und gespeichert. Mit dieser Anforderung erkläre ich mich damit einverstanden, dass ich<br />
von DIV Deutscher Industrieverlag oder vom Vulkan-Verlag per Post, per Telefon, per Telefax, per e-Mail, nicht über interessante, fachspezifische Medien und Informationsangebote informiert und beworben werde.<br />
Diese erklärung kann ich mit Wirkung für die Zukunft jederzeit widerrufen.<br />
✘<br />
XfrSVM1212