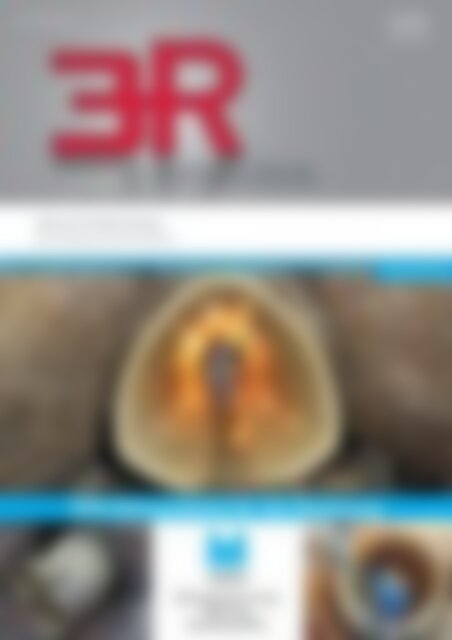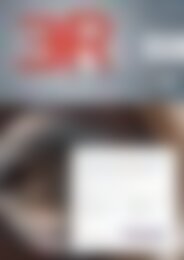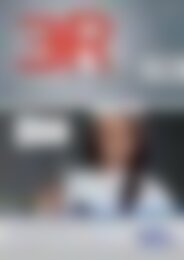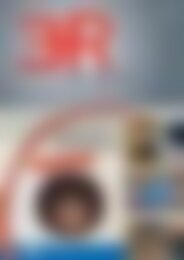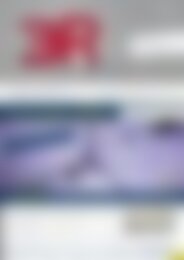3R Special Regenwasserbewirtschaftung (Vorschau)
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
www.<strong>3R</strong>-Rohre.de<br />
10 | 2013<br />
ISSN 2191-9798<br />
Fachzeitschrift für sichere und<br />
effiziente Rohrleitungssysteme<br />
LESEN SIE IN DIESER AUSGABE:<br />
<strong>Special</strong> <strong>Regenwasserbewirtschaftung</strong><br />
www.hobas.de<br />
GFK-Rohrsysteme für die Sanierung<br />
Schachtsanierung<br />
Relining<br />
Sonderprofile
3. Praxistag am 29. Oktober 2013 in Essen<br />
Wasserversorgungsnetze<br />
Programm<br />
Moderation: Prof. Th. Wegener,<br />
iro Institut für Rohrleitungsbau, Oldenburg<br />
Wann und Wo?<br />
Themenblock 1: Netzbetrieb - Analysieren und Optimieren<br />
Auf zu neuen Ufern -<br />
aktuelle Fragestellungen in der Wasserversorgung<br />
Th. Rücken, Timo Wehr, Rechenzentrum für Versorgungsnetze Wehr<br />
GmbH, Düsseldorf<br />
Einflüsse auf die Entscheidungsfindung im Asset Management<br />
M. Beck, Fichtner Water & Transportation GmbH, Berlin<br />
Themenblock 2: Strategien zur Netzspülung<br />
Zustandsorientierte Spülung von Trinkwassernetzen<br />
Dr. A. Korth, TZW, Außenstelle Dresden<br />
Softwarebasierte Ermittlung von Spülprogrammen<br />
zur Unterstützung systematischer Netzspülungen<br />
Dr. J. Deuerlein, 3S Consult GmbH, Garbsen<br />
Strategische Planung von Netzspülungen mit Hilfe<br />
von Trinkwasseranalysen<br />
M. Geib, OOWV Oldenburgisch-Ostfriesischer Wasserverband, Brake<br />
Themenblock 3: Netzüberwachung<br />
Multiparameter-Sensorik und Online-Überwachung<br />
für Wasserversorgungsnetze - Einsatz im Rahmen des<br />
Forschungsprojektes IWaNet<br />
W. Geiger, GERO Meßsysteme GmbH, Braunschweig<br />
Watercloud: Neue Wege im Wasserverlustmanagement<br />
H.-P. Karle, F.A.S.T GmbH, Langenbrettach<br />
Interdisziplinäre Planung von Netzspülungen durch neue Untersuchungsmethode<br />
mit Berücksichtigung der biologischen<br />
Trinkwasserqualität<br />
M. Scheideler, Scheideler Dienstleistungen, Haltern am See<br />
Themenblock 4: Netzbetrieb - Anwendungen aus Sicht<br />
der Wasserversorger<br />
Handlungsempfehlungen zur Minimierung von Rohrschäden<br />
an Hauptleitungen des Hamburger Versorgungsnetzes<br />
K. Krieger, HAMBURG WASSER, Hamburg; Dr. Ch. Sorge, IWW, Mülheim<br />
Umsetzung einer Netzmanagementstrategie bei der RWW–<br />
Rheinisch-Westfälischen Wasserversorgung<br />
J. Erbel, RWW GmbH, Mülheim, Dr. G. Gangl, RBS Wave GmbH, Stuttgart<br />
Veranstalter:<br />
Veranstalter<br />
<strong>3R</strong>, ZfW, iro<br />
Termin: Dienstag, 29.10.2013,<br />
9:00 Uhr – 17:15 Uhr<br />
Ort:<br />
Zielgruppe:<br />
Essen, Welcome Hotel<br />
Mitarbeiter von Stadtwerken<br />
und Wasserversorgungsunternehmen,<br />
Dienstleister im Bereich<br />
Netzplanung, -inspektion und<br />
-wartung<br />
Teilnahmegebühr*:<br />
<strong>3R</strong>-Abonnenten<br />
und iro-Mitglieder: 390,- €<br />
Nichtabonnenten: 420,- €<br />
Bei weiteren Anmeldungen aus einem Unternehmen<br />
wird ein Rabatt von 10 % auf den jeweiligen<br />
Preis gewährt.<br />
Im Preis enthalten sind die Tagungsunterlagen<br />
sowie das Catering (2 x Kaffee, 1 x Mittagessen).<br />
* Nach Eingang Ihrer schriftlichen Anmeldung (auch per Internet<br />
möglich) sind Sie als Teilnehmer registriert und erhalten eine<br />
schriftliche Bestätigung sowie die Rechnung, die vor Veranstaltungsbeginn<br />
zu begleichen ist. Bei Absagen nach dem 15.<br />
Oktober 2013 oder Nichterscheinen wird ein Betrag von 100,- €<br />
für den Verwaltungsaufwand in Rechnung gestellt. Die Preise<br />
verstehen sich zzgl. MwSt.<br />
Mehr Information und Online-Anmeldung unter<br />
www.praxistag-wasserversorgungsnetze.de<br />
Fax-Anmeldung: 0201-82002-40 oder Online-Anmeldung: www.praxistag-wasserversorgungsnetze.de<br />
Ich bin <strong>3R</strong>-Abonnent<br />
Ich bin iro-Mitglied<br />
Ich bin Nichtabonnent/kein iro-Mitglied<br />
Vorname, Name des Empfängers<br />
Telefon<br />
Telefax<br />
Firma/Institution<br />
E-Mail<br />
Straße/Postfach<br />
Land, PLZ, Ort<br />
Nummer<br />
✘<br />
Ort, Datum, Unterschrift
EDITORIAL<br />
Den richtigen Rahmen setzen<br />
Über die Energie-Infrastruktur wird generell in Europa<br />
und speziell in Deutschland intensiv diskutiert. Die „Energiewende“<br />
made in Germany ist leider noch nicht zum<br />
Exportschlager geworden, was angesichts der derzeitigen<br />
Schwierigkeiten nicht verwundert. Auf technischer Seite sind<br />
allerdings auch positive Fortschritte erkennbar, wie man<br />
auf der diesjährigen gat erleben konnte. Power-to-Gas ist<br />
eine der aussichtsreichsten Möglichkeiten, die Umstellung<br />
der deutschen Energie-Infrastruktur zu ermöglichen und<br />
die erforderliche Zwischenspeicherung der mit Windkraft<br />
oder Photovoltaik erzeugten Energie technisch zu realisieren.<br />
Dennoch bleibt die Aufgabe, einen rechtlichen sinnvollen<br />
Rahmen zu setzen.<br />
Reform des Enerneuerbare-Energien-Gesetz<br />
erwartet<br />
Unabhängig davon, welche Koalition am Ende der noch<br />
laufenden, langwierigen Verhandlungen stehen wird: Die<br />
Energiewirtschaft in Deutschland wartet „händeringend“<br />
auf eine Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes. Die<br />
vor Jahren sinnvolle Förderung von regenerativen Energien<br />
wird zunehmend zum finanziellen Hemmschuh. Gleichzeitig<br />
verschlechtert sich die wirtschaftliche Basis konventioneller<br />
Kraftwerke derart, dass deren Weiterbetrieb in Frage gestellt<br />
wird. Der Vorrang von regenerativ erzeugtem Strom bei der<br />
Einspeisung hat fatale Folgen. Die Zwischenspeichung dieses<br />
Stroms, z. B. durch Umwandlung und Speicherung in den<br />
Gasnetzen, kann dieses Problem lösen und wird über den<br />
Erfolg der Energiewende entscheiden.<br />
Auch jenseits der Energiethemen gibt es<br />
Infrastrukturaufgaben!<br />
In der öffentlichen Wahrnehmung scheint es ausnahmslos<br />
um die Frage der zukünftig richtigen Gestaltung unserer<br />
Energie-Infrastruktur zu gehen. Dies verwundert nicht, da<br />
der Bürger in erster Linie sensibel auf persönliche monetäre<br />
Auswirkungen reagiert.<br />
Die Aufrechterhaltung der Wasser- und Abwasserinfrastruktur<br />
ist allerdings ebenso dringlich und auch hierfür werden<br />
hohe Investitionen benötigt – dies sollte bei allem Treiben<br />
um die Energiewende nicht vergessen werden.<br />
Einen Bogen zwischen Energie- und Abwasserthemen<br />
schlägt die Nutzung von Abwärme in Abwasserkanälen,<br />
wie der Beitrag „50 % weniger Primärenergie mit Kanalwärmenutzung<br />
in Bad Cannstadt“ ab Seite 56 zeigt.<br />
Nico Hülsdau<br />
<strong>3R</strong>, Vulkan-Verlag GmbH<br />
Förderprogramm der EU für die europäische<br />
Energie-Infrastruktur<br />
„Die Macht des Geldes“ lautet die Überschrift eines Artikels<br />
in der jüngsten Spiegel-Ausgabe (14.10.2013). Darin wird die<br />
Initiative der Europäischen Kommission beschrieben, die EU-<br />
Kommissar Günther Oettinger am 14. Oktober vorgestellt<br />
hat. Es geht um die Verabschiedung einer Liste mit 248<br />
wichtigen Energie-Infrastrukturprojekten. Diese „Projekte<br />
von gemeinsamem Interesse“ werden u. a. von beschleunigten<br />
Planungsverfahren und verbesserten regulatorischen<br />
Bedingungen profitieren. Zudem ist eine finanzielle<br />
Unterstützung für den Zeitraum 2014 bis 2020 in Höhe von<br />
5,85 Mrd. Euro vorgesehen. Von den 248 Projekten entfallen<br />
119 Projekte auf den Bereich Strom und 113 Projekte auf<br />
den Bereich Gas. Für Deutschland ist die Unterstützung von<br />
15 Strom- und fünf Gasprojekten geplant. Die vollständige<br />
Liste finden Sie auf der <strong>3R</strong>-Internetseite www.<strong>3R</strong>-Rohre.de.<br />
10 | 2013 1
INHALT<br />
NACHRICHTEN<br />
12<br />
21<br />
Ausbildung zum Zertifizierten Kanal-Sanierungs-Berater:<br />
Prüfingenieure machen mit<br />
Podiumsdiskussion auf dem 2. Deutschen Reparaturtag<br />
INDUSTRIE & WIRTSCHAFT<br />
6 Streicher verlegt 18-m-Produktenrohre für MIDAL-Süd-Loop<br />
6 Benchmark für zerstörungsfreie Prüfverfahren<br />
7 Bau-Mediations-Team gegründet<br />
PERSONALIEN<br />
EDITORIAL<br />
01 „Den richtigen<br />
Rahmen setzen“<br />
Nico Hülsdau<br />
8 Dr.-Ing. Wulf Lindner in den Ruhestand verabschiedet<br />
8 Prof. Dr. Ulrich Panne ist neuer Präsident der BAM<br />
9 DVGW-Präsidium neu besetzt<br />
9 Dr.-Ing. Ehlers zum Professor für Bauverfahrenstechnik nach Osnabrück berufen<br />
10 Änderungen im Vorstand der DWA<br />
10 resinnovation baut Vertrieb aus<br />
VERBÄNDE<br />
11 Konventionelle Kraftwerksparks sind kein Auslaufmodell<br />
12 Ausbildung zum Zertifizierten Kanal-Sanierungs-Berater: Prüfingenieure machen mit<br />
2 10 | 2013
45<br />
Bohranlagen und Zubehör für jeden Untergrund<br />
VERANSTALTUNGEN<br />
14 TAW bietet Soft Skill-Training für Ingenieure<br />
15 Tube 2014: Kunststoffrohre in der Industrie<br />
17 Mehr als 100 Aussteller bei Tiefbaumesse InfraTech<br />
in Essen<br />
18 Kanäle kombiniert bewirtschaften<br />
21 Branchentreff beim 2. Deutschen Reparaturtag<br />
PRODUKTE & VERFAHREN<br />
44 Wettercockpit für die Bauwirtschaft<br />
44 Korrosionsschutz von Klöpperböden<br />
45 Bohranlagen und Zubehör für jeden Untergrund<br />
45 PP-Rohrmaterial mit verbesserten Eigenschaften<br />
46 DIBt-Zulassung für PERFECT-Liner erteilt<br />
46 Brandschutzmanschette durch Handel und Praxis<br />
ausgezeichnet<br />
47 Variabler Ausgleichsring für Rohrverbindungen<br />
47 Universelle Rohrkupplung für Abwasserrohrleitungen<br />
47 Endlos schwenkbarer Fräsarm mit 360° drehbarer<br />
Kamera<br />
Das Oldenburger Rohrleitungsforum als Treffpunkt<br />
der Wirtschaft und der Wissenschaft, als Marktplatz<br />
von Know-how und dem Neuesten aus der Rohrleitungswelt.<br />
28. Oldenburger Rohrleitungsforum<br />
06./07. Februar 2014<br />
über 3.000 Besucher aus Versorgungswirtschaft,<br />
Behörden, Ingenieurbüros, Bauunternehmen und<br />
Rohr- und Zubehörherstellern<br />
über 100 Fachvorträge in sechs parallelen Vortragsveranstaltungen<br />
vermitteln Wissen für die Praxis und<br />
bringen Impulse in die Hochschule<br />
über 350 internationale Aussteller mit dem Neuesten<br />
aus ihren Entwicklungsabteilungen<br />
in den Pausen: Kommunikation pur in den Gängen,<br />
auf dem Gelände und auf den Abendveranstaltungen<br />
Anmeldungen und weitere Informationen:<br />
Institut für Rohrleitungsbau<br />
an der Fachhochschule Oldenburg e.V.<br />
Ofener Straße 18 / 26121 Oldenburg<br />
Frau Ina Kleist<br />
Tel. 0441 361039-0 / Fax 0441 361039-10<br />
E-mail ina.kleist@iro-online.de / www.iro-online.de<br />
10 | 2013 3
INHALT<br />
FACHBERICHTE<br />
48<br />
54<br />
Unzureichende Planung, Ausschreibung und Ausführung<br />
bei Kanalsanierungen können Folgekosten erzeugen<br />
Nach Fertigstellung zum Neuzustand sanierter<br />
Mischwassersammler<br />
RECHT & REGELWERK<br />
24 Die neue HOAI 2013 - Änderungen und Auswirkungen auf die Honorare in der<br />
Kanalsanierung<br />
Dipl.-Ing. Peter Kalte, Dipl.-Ing. Arnulf Feller<br />
28 Neue Technische Regeln für Steinzeugrohre DIN EN 295 – 2013<br />
Bauass. Dipl.-Ing. Karl-Heinz Flick<br />
32 Änderung von Rohrleitungen - Teil 3: Änderung von Rohrfernleitungen zum<br />
Befördern wassergefährdender Stoffe, § 20 Abs. 2 S. 4 UVPG<br />
Dr. Bettina Keienburg, Dr. Michael Neupert<br />
38 DVGW-Regelwerk<br />
SERVICES<br />
19 Messen | Tagungen<br />
91 Marktübersicht<br />
100 Inserentenverzeichnis<br />
101 Buchbesprechung<br />
102 Seminare<br />
105 Impressum<br />
42 DWA-Regelwerk<br />
ABWASSERENTSORGUNG / SANIERUNG<br />
48 Auswirkungen und Folgekosten unzu reichender Planung, Ausschreibung und<br />
Ausführung bei Kanalsanierungen<br />
Dipl.-Ing. Roland Wacker<br />
53 Abwasser-Pumpenschacht mit Epoxidharz-Beschichtung dauerhaft saniert<br />
54 Cottbus saniert Mischwassersammler mit GFK-Sonderprofilen<br />
56 50 % weniger Primärenergie mit Kanalwärmenutzung in Bad Cannstadt<br />
Klaus W. König<br />
4 10 | 2013
Kompetenz, die<br />
verbindet<br />
60<br />
Löschwasserradien in einem Versorgungsgebiet<br />
WASSERVERSORGUNG<br />
60 Löschwasserkosten sind nicht gleich<br />
Trinkwasserkosten<br />
Dr.-Ing. Esad Osmancevic, Steffen Mayer<br />
68 Bau von drei 36 m langen DN 3000-GFK-<br />
Trinkwasserröhrenspeichern<br />
70 Einflüsse auf die Entscheidungsfindung im<br />
Asset Management<br />
Mike Beck<br />
KORROSIONSSCHUTZ<br />
74 Beeinflussung von Wasserleitungen durch<br />
Streuströme: Messtechnische Erfassung und<br />
Schutzmaßnahmen<br />
Dr. Markus Büchler, David Joos , Carl-Heinz Voûte<br />
80 Anwendungsbeispiele für die Prüfung von<br />
Rohrleitungen mit Guided Waves<br />
Dipl.-Ing. Hermann Schubert, Dr. Thomas Vogt<br />
GASVERSORGUNG<br />
& PIPELINETECHNIK<br />
86 LDACS-Leckerkennungssystem: Mehr Sicherheit<br />
durch verteilte akustische Sensoren<br />
Natalija Psöl, Dmitrij Pleschkow,<br />
Dr. Enwer Achmedov, Dr. Aleksey Turbin<br />
Pipeline Symposium 2013!<br />
18.–19. November 2013 in Hamburg<br />
Veranstaltung jetzt online buchen:<br />
www.tuev-nord.de/pipeline-Symposium<br />
TÜV NORD begleitet Sie<br />
über den gesamten Lebenszyklus<br />
Ihrer Pipelines<br />
Planung und Konstruktion<br />
Fertigung, Montage und Inbetriebnahme<br />
Betriebsbegleitung<br />
Rückbau und Stilllegung<br />
Ihr Nutzen:<br />
Einhaltung hoher Sicherheitsstandards<br />
Reduzierung von Betriebsstörungen<br />
Verbesserung der Wirtschaftlichkeit<br />
Reduzierung der Ausfall- und<br />
Reparaturkosten<br />
Kontakt: pipeline@tuev-nord.de<br />
www.tuev-nord.de<br />
10 | 2013 5
NACHRICHTEN INDUSTRIE & WIRTSCHAFT<br />
Streicher verlegt 18-m-Produktenrohre<br />
für MIDAL-Süd-Loop<br />
Zur Erweiterung der Kapazitäten der bestehenden Erdgasleitung<br />
MIDAL wird auf einer Strecke von insgesamt<br />
90 km eine Parallelleitung DN 1000 gebaut. Der Betreiber<br />
der MIDAL, die GASCADE Gastransport GmbH,<br />
beauftragte die MAX STREICHER GmbH & Co. KG<br />
aA mit dem dritten von insgesamt drei Baulosen des<br />
MIDAL-Süd Loop. Die 31 km lange Trasse zwischen<br />
Wertheim nahe Bad Orb und Thomashof bei Schlüchtern<br />
verläuft über weite Bereiche parallel zur Bundesautobahn<br />
A 66, die im Bereich des STREICHER-Loses viermal<br />
gequert wird.<br />
An der nördlichsten<br />
der vier Querungen<br />
begannen kürzlich<br />
die Bohrarbeiten im<br />
Microtunnelling-Verfahren.<br />
Für das grabenlose<br />
Einbringen<br />
der 18 m langen Rohrstücke<br />
griff Streicher<br />
auf diese Verlegemethode<br />
zurück.<br />
Benchmark für zerstörungsfreie Prüfverfahren<br />
In der Kunststoffindustrie existieren große Potenziale für<br />
zerstörungsfreie Prüfverfahren (ZfP). Häufig fehlt jedoch<br />
die geeignete Verbindung von Prüfsystemanbietern zu<br />
den real existierenden Anwendungen. Zudem kann eine<br />
einzelne ZfP-Technologie nie für sich alleine betrachtet<br />
werden. Es müssen immer auch die Wettbewerbstechnologien<br />
berücksichtigt werden, die ebenfalls Lösungen<br />
für eine spezifische Aufgabenstellung bieten können und<br />
damit im direkten Wettbewerb stehen.<br />
Zahlreiche, verschiedene zerstörungsfreie Prüfverfahren<br />
sind mittlerweile am Markt erhältlich. Mit einem neuen<br />
Kooperationsprojekt möchte das SKZ die Verbindung<br />
von Prüfsystemanbietern zu real existierenden Anwendungen<br />
fördern. Die Fähigkeiten der Messverfahren der<br />
teilnehmenden Prüfsystemanbieter sowie deren Marktbegleiter<br />
werden anhand konkreter Fragestellungen in<br />
einem Benchmark gegenübergestellt. Damit können die<br />
Systemgrenzen ausgelotet und Trends erkannt werden.<br />
Zudem profitieren die Prüfanbieter durch die Darstellung<br />
ihrer Leistungsfähigkeit, der Erschließung neuer Märkte<br />
und Rekrutierung neuer Kundenkreise.<br />
Die Vielfalt der heute existierenden Verfahren macht es<br />
erforderlich, einen Benchmark der Verfahren anhand<br />
real existierender Aufgabenstellungen zu erarbeiten.<br />
Das SKZ möchte dies den ZfP-Anbietern mit diesem<br />
Kooperationsprojekt ermöglichen. An zahlreichen<br />
Kunststoff-Bauteilen aus praktischen Anwendungen<br />
können die Grenzen der jeweiligen Messsysteme ausgelotet<br />
und verglichen werden. Die Anonymität bleibt<br />
hierbei zu jedem Zeitpunkt bestehen. Die teilnehmenden<br />
Prüfanbieter erhalten hierdurch einen Überblick<br />
über die Leistungsfähigkeit von Konkurrenztechnologien<br />
und eine entsprechende Einordnung ihrer eigenen<br />
Verfahren. Somit können Trends erkannt und<br />
Methoden zielorientiert weiterentwickelt werden. Die<br />
resultierenden Referenzmessungen ermöglichen zudem<br />
einen gezielten Marktzugang sowie die Rekrutierung<br />
neuer Kunden.<br />
KONTAKT:<br />
SKZ - Das Kunststoff-Zentrum, Würzburg, Dipl.-Ing. Giovanni Schober,<br />
Tel. +49 931 4104-464, E-Mail: g.schober@skz.de<br />
6 10 | 2013
PERSONALIEN NACHRICHTEN<br />
Bau-Mediations-Team gegründet<br />
Durch den Zusammenschluss von mehreren Baupraktikern mit<br />
jahrzehntelanger Erfahrung in verantwortungsvollen Positionen<br />
im Bauwesen wurde im Mai die BAU-MEDIATION-NRW<br />
gegründet. Zu den Gründungsmitgliedern gehören öffentlich<br />
bestellte und vereidigte Sachverständige aus verschiedenen<br />
Sparten des Baubereichs, die in den Standorten Bonn, Köln<br />
und Krefeld angesiedelt sind.<br />
Diese sehen ihre Aufgabe darin, die Lösung von Konflikten mit<br />
dem wechselseitigen Austausch der Hintergründe zu erhellen<br />
und das Ergebnis in einer verbindlichen, in die Zukunft<br />
weisenden Vereinbarung zu dokumentieren. Dabei steht im<br />
Gegensatz zum Gerichtsverfahren die Schuldfrage nicht im<br />
Vordergrund.<br />
Neben dem eigentlichen Ziel der Mediation gibt es auch die<br />
Berücksichtigung von Interessenlagen, die in einem Zivilprozess<br />
unbeachtet bleiben würden:<br />
»»<br />
Reduzierung der Verfahrenskosten und der<br />
Konfliktfolgekosten<br />
»»<br />
Möglichkeit eines unbürokratischen und flexiblen<br />
Verfahrens<br />
»»<br />
Schonung personeller und betrieblicher Ressourcen<br />
»»<br />
keine Öffentlichkeit durch Berichte in den<br />
Massenmedien.<br />
Die Mediation entwickelte sich aus der Praxis der außergerichtlichen<br />
Konfliktregelung. In Deutschland hat sich das Verfahren<br />
seit etwa 1990 zunehmend etabliert. Wichtigste Grundidee<br />
der Mediation ist die Eigenverantwortlichkeit der Konfliktparteien:<br />
Der Mediator ist verantwortlich für den Prozess, die<br />
Parteien sind verantwortlich für den Inhalt. Dahinter steht der<br />
Gedanke, dass die Beteiligten eines Konflikts selbst am besten<br />
wissen, wie dieser zu lösen ist, und vom Mediator lediglich<br />
hinsichtlich des Weges dorthin Unterstützung benötigen.<br />
Das Bau-Mediations-Team: Dipl.-Ing. Thomas Nordmann, Dipl.-Ing.<br />
Heinrich Schöneseiffen, Dipl.-Ing. Werner Bezela (v. l. n. r.)<br />
Die Konfliktlösung mit Unterstützung eines stundenweise<br />
honorierten Mediators kann insbesondere bei hohen<br />
Streitwerten kostengünstiger sein als die streitige Austragung<br />
vor Gericht mit Hilfe eines Rechtsanwalts. Sinnvoll<br />
ist gerade bei großen Bauprojekten die baubegleitende<br />
Mediation, die der Entstehung und Verfestigung von<br />
Konflikten gleich im Ansatz entgegenwirkt. Die Vorzüge<br />
der Mediation hat auch bereits der Gesetzgeber erkannt<br />
und mit Datum vom 21.7.2012 das Mediationsgesetz<br />
verabschiedet, in dem der Ablauf des Verfahrens formalrechtlich<br />
geregelt wird.<br />
KONTAKT: www.bau-mediation-nrw.de<br />
Garantie<br />
Quadro-Secura ®<br />
Nova<br />
Eine für Alle.<br />
Mehrspartenhauseinführung für Gas,<br />
Wasser, Strom oder Telekommunikation<br />
DOYMA GmbH & Co<br />
Industriestr. 43 - 57<br />
D-28876 Oyten<br />
Fon: (0 42 07) 91 66 - 300<br />
Fax: (0 42 07) 91 66 -199<br />
WWW.DOYMA.DE<br />
WEIL SICHER EINFACH<br />
SICHER IST.<br />
10 | 2013 7
NACHRICHTEN PERSONALIEN<br />
Dr.-Ing. Wulf Lindner in den Ruhestand verabschiedet<br />
Am 27. September 2013<br />
wurde Dr.-Ing. Wulf Lindner,<br />
Vorstand des Erftverbandes<br />
und Geschäftsführer der Erftverband<br />
aqua tec GmbH, im<br />
Rahmen einer festlichen Feierstunde<br />
auf Schloss Paffendorf<br />
in den Ruhestand verabschiedet.<br />
Seine herausragenden<br />
Leistungen und Verdienste<br />
für den Erftverband und für<br />
das Wasserfach würdigten<br />
der Verbandsratsvorsitzende,<br />
Bürgermeister Albert<br />
Bergmann (Stadt Zülpich),<br />
der stellvertretende Vorsitzende<br />
des Verbandsrats, Dr.<br />
Dieter Gärtner (RWE Power<br />
AG), Prof. Dr. Wolfgang Firk (Wasserverband Eifel-Rur) als<br />
Vertreter der Arbeitsgemeinschaft der Wasserwirtschaftsverbände<br />
agw und sein ständiger Stellvertreter als Vorstand<br />
des Erftverbandes und designierter neuer Vorstand, Norbert<br />
Engelhardt in ihren Ansprachen.<br />
Wulf Lindner studierte von 1971 bis 1977 Bauingenieurwesen<br />
an der Universität Stuttgart. Nach einem kurzen Intermezzo<br />
als Bauleiter beim Zweckverband Bodensee Wasserversorgung<br />
Stuttgart wurde er 1978 Mitarbeiter an den Instituten für<br />
Siedlungswasserwirtschaft und Wasserbau der Universität<br />
Stuttgart. Hier promovierte er 1983 über numerische Optimierungsmodelle<br />
zur Steuerung von Grundwasserentnahmen<br />
nach ökologischen Kriterien. In gleichem Jahr kam Dr.<br />
Wulf Lindner als Fachbereichsleiter Wasserversorgung zum<br />
Erftverband. Er wurde zuständig für die Sicherstellung der<br />
Wasserversorgung im Tätigkeitsbereich des Verbandes und<br />
war insbesondere verantwortlich für viele interdisziplinäre<br />
Forschungs- und Entwicklungsarbeiten.<br />
1995 verließ er den Verband und wechselte zum Deutschen<br />
Verein des Gas- und Wasserfaches (DVGW), einem technischwissenschaftlichen<br />
Verein, wo er zunächst den Bereich Wasserversorgung<br />
leitete und später zum Leiter des Gesamtbereichs<br />
Wasser der Hauptgeschäftsführung berufen wurde.<br />
2003 kam Wulf Lindner als Vorstand zurück zum Erftverband.<br />
In der Folgezeit entwickelte er den Erftverband zu einem<br />
modernen Dienstleistungsunternehmen. Seine Vorstandszeit<br />
war vor allen Dingen geprägt durch ein gelebtes Leitbild und<br />
die Einführung eines integrierten Managementsystems, das<br />
ein Qualitäts-, Umwelt- und technisches Sicherheitsmanagement<br />
einschloss, durch zahlreiche kontinuierliche Verbesserungsprozesse<br />
und durch viele Forschungs- und Entwicklungsprojekte<br />
im Wasser- und Abwasserbereich.<br />
Wichtige Bauprojekte wie die energetische Modernisierung<br />
von Kläranlagen und der Verbandsverwaltung, der Neubau<br />
des Labors, des Zentrallagers und der zentralen Instandhaltung<br />
sowie von Gewässermeistereien fallen ebenso in seine<br />
Amtszeit wie die Neustrukturierung der inneren Organisation.<br />
Dr. Wulf Lindner war in zahlreichen nationalen und internationalen<br />
Vorständen aktiv. Hervorzuheben ist sein Engagement<br />
z. B. als deutsches Vorstandsmitglied von EUREAU,<br />
dem Dachverband der europäischen Ver- und Entsorger, als<br />
Vorstandsvorsitzender des Instituts zur Förderung der Wassermengen<br />
und Wassergütewirtschaft und als Vorsitzender<br />
des Bundes der Wasser- und Kulturbauingenieure in NRW.<br />
Sein breitgefächertes Wissen zu fast allen Themen des Wasserfachs,<br />
vom Grundwasserschutz bis zur Hausinstallation,<br />
von mathematischen Modellen bis zur Wasserpolitik und von<br />
Klimafragen bis zur Qualitätsanforderung an Unternehmen<br />
stellte Dr. Lindner in über 150 Veröffentlichungen und Vorträgen<br />
unter Beweis.<br />
Prof. Dr. Ulrich Panne ist neuer Präsident der BAM<br />
Prof. Dr. Ulrich Panne hat ab dem 1. September 2013 die<br />
Leitung der BAM Bundesanstalt für Materialforschung und<br />
-prüfung übernommen. Der Chemiker löste Professor Dr.<br />
Manfred Hennecke ab, der elf Jahre die BAM als Präsident<br />
leitete und nun in den Ruhestand gegangen ist.<br />
Bei seiner Ernennung zum BAM-Präsidenten betonte Ulrich<br />
Panne, dass er die Verbindung von Ingenieurwissenschaften<br />
und Naturwissenschaften der BAM weiter ausbauen ausmöchte.<br />
Nur so können die herausfordernden Themen der<br />
Chemie bzw. der Materialwissenschaft und Werkstofftechnik<br />
multidisziplinär bearbeitet werden. Der 49-jährige analytische<br />
Chemiker ist seit 2004 an der BAM tätig und leitete<br />
die Abteilung 1 Analytische Chemie, Referenzmaterialien.<br />
Darüber hinaus ist er Professor für Instrumentelle Analytische<br />
Chemie an der Humboldt-Universität zu Berlin. Professor<br />
Panne ist Mitinitiator und seit 2012 einer der Sprecher der<br />
Graduiertenschule für Analytical Sciences Adlershof (SALSA)<br />
innerhalb der Exzellenzinitiative des Bundes und der Länder.<br />
Panne hat an der Universität Dortmund und am University<br />
College London Chemie studiert und an der Technischen<br />
Universität München promoviert und dort auch nach einem<br />
Postdoc-Aufenthalt am JRC Ispra 2001 habilitiert. Nach<br />
einem abgelehnten Ruf an die Universität Leipzig, wechselte<br />
der Chemiker 2004 an die BAM und die Humboldt-Universität<br />
zu Berlin. Schwerpunkt seiner Forschungsaktivitäten<br />
ist die instrumentelle Analytik, insbesondere im Bereich der<br />
Entwicklung neuer spektroskopischer Methoden.<br />
Für seine Verdienste auf diesem Gebiet ist er 2009 von der<br />
Gesellschaft Deutscher Chemiker (GDCh) mit dem Fresenius-<br />
Preis ausgezeichnet worden.<br />
8 10 | 2013
PERSONALIEN NACHRICHTEN<br />
DVGW-Präsidium neu besetzt<br />
Dr. Thomas Hüwener und Dietmar Bückemeyer sind zu<br />
neuen Vizepräsidenten Gas bzw. Wasser des Deutschen<br />
Vereins des Gas- und Wasserfaches (DVGW) gewählt<br />
worden. Die Wahl erfolgte am 30. September 2013 in<br />
Nürnberg einstimmig durch den DVGW-Bundesvorstand.<br />
Dr. Thomas Hüwener und Dietmar Bückemeyer folgen<br />
Dr. Jürgen Lenz und Dr. Georg Grunwald nach, die nicht<br />
wieder kandidierten. In ihren Ämtern bestätigt wurden<br />
DVGW-Präsident Dr. Karl Roth sowie Michael Riechel als<br />
dritter Vizepräsident.<br />
Dr. Thomas Hüwener ist seit März 2013 Mitglied der<br />
Geschäftsführung der Open Grid Europe GmbH mit<br />
dem Schwerpunkt Technik. Bevor er 2010 Bereichsleiter<br />
Leitungstechnik beim Essener Fernleitungsnetzbetreiber<br />
wurde, hatte er verschiedene technische Führungspositionen<br />
bei der E.ON Ruhrgas AG inne. Im Rahmen der<br />
DVGW-Mitgliederversammlung wurde Dr. Hüwener in<br />
den Bundesvorstand des Vereins gewählt. Er ist zudem<br />
Obmann des Technischen Komitees „Gastransport“ des<br />
DVGW. Dr. Thomas Hüwener (42), in Haltern geboren,<br />
hat Maschinenbau in Bochum und College Station (USA)<br />
studiert und ist mit einer Arbeit über Strömungsmaschinen<br />
an der Universität Essen promoviert worden.<br />
Dietmar Bückemeyer ist seit 2002 Technischer Vorstand<br />
der Stadtwerke Essen AG und zudem Geschäftsführer<br />
der Essener Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH.<br />
Bevor er in den Vorstand wechselte, war er Abteilungsleiter<br />
und Prokurist im Bereich Planung und Bau der<br />
Stadtwerke Essen AG. Dietmar Bückemeyer gehört dem<br />
DVGW-Bundesvorstand seit 2004 an. Darüber hinaus<br />
ist er Vorstandsvorsitzender der DVGW-Landesgruppe<br />
Nordrhein-Westfalen und Obmann des DVGW-Lenkungskomitees<br />
„Wasserversorgungssysteme“. Dietmar<br />
Bückemeyer (53), in Gelsenkirchen geboren, hat sein<br />
ingenieurwissenschaftliches Diplom in der Fachrichtung<br />
Maschinenbau erworben.<br />
Dietmar Bückemeyer, neuer<br />
Vizepräsident Wasser des DVGW<br />
Dr. Thomas Hüwener, neuer<br />
Vizepräsident Gas des DVGW<br />
Dr.-Ing. Ehlers zum Professor für Bauverfahrenstechnik<br />
nach Osnabrück berufen<br />
Prof. Dr.-Ing. Michael Ehlers, Jahrgang 1966, ist seit dem<br />
1. September 2013 an der Hochschule Osnabrück im<br />
Bereich der Bauverfahrenstechnik tätig.<br />
Ehlers studierte nach der Ausbildung zum Maurer von<br />
1988 bis Ende 1994 an der Universität Hannover Bauingenieurwesen<br />
mit der Vertiefungsrichtung Baubetrieb<br />
und Baubetriebswirtschaft. Mit über 14 Jahren Tätigkeit<br />
in mittelständischen Bauunternehmen als Bauleiter, Oberbauleiter<br />
und Abteilungsleiter ist er ein ausgewiesener<br />
Praktiker und hat den für eine praxisnahe Ausbildung<br />
notwendigen Erfahrungshorizont. Besondere Erfahrungen<br />
hat er im Erd-, Tief- und Straßenbau, aber auch im Bereich<br />
des industriellen Schlüsselfertigbau sammeln können.<br />
Als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Baubetrieb<br />
und Baubetriebswirtschaft der Leibniz Universität<br />
Hannover hat er bereits Lehrveranstaltungen in den Bereiche<br />
Ausschreibung und Vergabe von Bauleistungen, Kalkulation<br />
und Preisbildung, Termin- und Kostenplanung,<br />
Bauverfahrenstechnik, Sicherheitstechnik, Baubetriebswirtschaftliche<br />
Sonderprobleme in der Bauausführung<br />
sowie Grundlagen des Baurechts abgehalten. Außerdem<br />
war er im Rahmen der Aufstellung und Prüfung von Nachtragsforderungen<br />
und der baubetrieblichen Beratung und<br />
Begleitung laufender Baumaßnahmen gutachtlich tätig.<br />
Seine Promotion hat er zu dem Thema der „Untauglichkeit<br />
des üblichen Preises für die Anpassung der<br />
Vergütung“ verfasst. Er hat sich dort mit der aktuellen<br />
Diskussion rund um ein von einer Arbeitsgruppe im Bundesministerium<br />
der Justiz erarbeiteten Entwurfs zu einem<br />
möglichen Bauvertragsrecht im Bürgerlichen Gesetzbuch<br />
beschäftigt.<br />
Prof. Dr.-Ing. Michael Ehlers ergänzt das nunmehr fünf<br />
Lehrende umfassende Team Baubetrieb der Hochschule<br />
Osnabrück in idealer Weise. Seine Berufung bekräftigt<br />
die starke baubetriebliche Ausrichtung des Osnabrücker<br />
Standortes und schärft hier das Profil der Hochschule.<br />
10 | 2013 9
NACHRICHTEN PERSONALIEN<br />
Änderungen im Vorstand der DWA<br />
Dr. Jochen Stemplewski<br />
(Essen) ist neuer Vizepräsident<br />
der Deutschen Vereinigung für<br />
Wasserwirtschaft, Abwasser<br />
und Abfall e. V. (DWA). Die<br />
Mitgliederversammlung hat<br />
ihn am 24. September 2013 in<br />
Berlin in dieses Amt gewählt.<br />
Neues Mitglied im Präsidium<br />
ist Dipl.-Ing. Wolfgang Schanz<br />
(Stuttgart). Erstmalig in den<br />
Vorstand gewählt wurden<br />
Prof. Dr. Beate Jessel (Bonn),<br />
Dr. Uwe Müller (Dresden) und<br />
Dipl.-Ing. Jörg Simon (Berlin).<br />
Als Vorstandsmitglieder wiedergewählt<br />
wurden Dipl.-Ing.<br />
Dr. Jochen Stemplewski ist neuer<br />
Vizepräsident der Deutschen<br />
Arndt Bock (Ansbach), Prof.<br />
Vereinigung für Wasserwirtschaft, Dr.-Ing. Harro Bode (Essen),<br />
Abwasser und Abfall e. V.<br />
Dr.-Ing. Georg Grunwald<br />
(Bremen), Prof. Dr.-Ing. Heribert<br />
Nacken (Aachen), Dr. Frank Andreas Schendel (Bergisch<br />
Gladbach) und Dipl.-Ing. Robert Schmidt (München). Die Amtszeiten<br />
laufen jeweils vom 1. Januar 2014 bis zum 31. Dezember<br />
2017. Zum 31. Dezember 2013 scheiden aus dem Vorstand<br />
aus der bisherige Vizepräsident Dipl.-Ing. Eberhard Jüngel<br />
(Neidhardtsthal) und Prof. Dr.-Ing. Markus Disse (München).<br />
Dr. Jochen Stemplewski (64) ist Vorstandsvorsitzender von<br />
Emschergenossenschaft und Lippeverband in Essen und seit<br />
vielen Jahren in der DWA aktiv. Dem Präsidium gehört er<br />
bereits seit 2010 an. Daneben ist er Vorsitzender des Hauptausschusses<br />
Wirtschaft, seit der Gründung des Gremiums;<br />
auch in dieser Funktion wurde er bis 2017 von der Mitgliederversammlung<br />
bestätigt.<br />
Wolfgang Schanz (58) ist Leiter des Tiefbauamts der Stadt<br />
Stuttgart und dort außerdem 1. Betriebsleiter des Eigenbetriebs<br />
Stadtentwässerung. In der DWA wirkt er als Vorsitzender<br />
des Landesverbands Baden-Württemberg und ist in dieser<br />
Rolle seit 2004 Mitglied des Vorstands auf Bundesebene.<br />
Beate Jessel (51) bringt als Präsidentin des Bundesamts für<br />
Naturschutz besondere Kompetenz in Landschaftspflege,<br />
-planung und -entwicklung in die DWA ein.<br />
Uwe Müller (50) ist nicht nur in der Fachwelt gut bekannt,<br />
sondern auch ein in den Medien vielgefragter Hochwasser-<br />
Experte. Er ist Leiter des Referats „Wasser, Boden, Wertstoffe“<br />
des Landesamts für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie<br />
des Freistaates Sachsen, und zu seinem Referat gehört das<br />
Landeshochwasserzentrum. In der DWA tritt er die Nachfolge<br />
von Markus Disse (TU München) als Vorsitzender des Hauptausschusses<br />
„Hydrologie und Wasserbewirtschaftung“ an.<br />
Jörg Simon (51) bringt als Vorstandsvorsitzender der Berliner<br />
Wasserbetriebe die Expertise eines der größten wasserwirtschaftlichen<br />
Unternehmen Europas in den DWA-Vorstand ein.<br />
Die DWA ist fachlich in zehn „Hauptausschüsse“ gegliedert.<br />
Neben der Neuwahl von Uwe Müller wurden vier weitere<br />
Hauptausschussvorsitzende in ihren Ämtern bestätigt: für<br />
„Gewässer und Boden“ Arndt Bock (63), Leiter des Wasserwirtschaftsamts<br />
Ansbach, für „Recht“ Frank Andreas Schendel<br />
(66), früher Bayer AG, für „Bildung und Internationale Zusammenarbeit“<br />
Robert Schmidt (49), Technischer Werkleiter der<br />
Münchner Stadtentwässerung, sowie für Wirtschaft der neue<br />
Vizepräsident Jochen Stemplewski.<br />
Harro Bode (62), Vorstandsvorsitzender und Vorstand Technik<br />
und Flussgebietsmanagement des Ruhrverbands, und Georg<br />
Grunwald (52), früher hansewasser Bremen und Berliner Wasserbetriebe,<br />
bringen durch ihre Wiederwahl auch weiterhin<br />
ihre Erfahrung aus großen wasserwirtschaftlichen Unternehmen<br />
in die DWA und ihren Vorstand ein.<br />
Heribert Nacken (52), Lehr- und Forschungsgebiet Ingenieurhydrologie<br />
der RWTH Aachen, wurde als Leiter der Fachgemeinschaft<br />
Hydrologische Wissenschaften in der DWA und<br />
damit als Vorstandsmitglied der DWA bestätigt.<br />
resinnovation baut Vertrieb aus<br />
Die resinnovation GmbH, Rülzheim,<br />
einer der führenden Anbieter von<br />
maßgeschneiderten Kunstharz-Problemlösungen<br />
für die Kanalsanierung,<br />
baut den Vertrieb weiter aus.<br />
Seit dem 1. September 2013 verstärkt<br />
Dipl.-Betriebswirt (VWA)<br />
Peter Drüen das resinnovation-<br />
Team als Vertriebsleiter für NRW,<br />
Dipl.-Betriebswirt Peter Drüen (50) ist neuer resinnovation-<br />
Ansprechpartner „vom Westerwald bis zur Nord- und Ostsee“<br />
Niedersachsen, Hamburg, Schleswig-Holstein, Nordhessen<br />
und nördliche Rheinland-Pfalz. Der 50-Jährige ist<br />
damit quasi „vom Westerwald bis zur Nord- und Ostsee“<br />
der Ansprechpartner des Marktes für die stetig wachsende<br />
resinnovation-Produktpalette.<br />
Reichlich Erfahrung mit Werkstoffen und Anwendungen<br />
in der Kanalsanierung bringt Drüen mit. Von 2003<br />
bis 2010 war er Gebietsverkaufsleiter NRW bei einem<br />
namhaften Marktbegleiter; anschließend lernte er den<br />
Kanalsanierungsmarkt quasi aus der Gegenperspektive,<br />
als Bauleiter und Vertriebler eines regional tätigen Sanierungsdienstleisters<br />
kennen.<br />
10 10 | 2013
VERBÄNDE NACHRICHTEN<br />
Konventionelle Kraftwerksparks sind kein Auslaufmodell<br />
Eine sichere Energieversorgung in Deutschland ist auf lange<br />
Sicht nur mithilfe konventioneller thermischer Kraftwerke zu<br />
gewährleisten. „Selbst wenn die Ausbauziele für die erneuerbare<br />
Stromerzeugung bis 2030 erreicht werden, muss der<br />
konventionelle Kraftwerkspark fast unverändert vorgehalten<br />
werden – und das bis 2050“, betont FDBR-Geschäftsführer<br />
Dr. Reinhard Maaß.<br />
In der politischen Debatte um die Energiewende in Deutschland<br />
ist zuletzt u. a. der Eindruck entstanden, dass konventionelle<br />
Kraftwerke in Deutschland ein Auslaufmodell sind<br />
und allein erneuerbare Energien in einem umgebauten Energiesystem<br />
nach 2030 die Energieversorgung Deutschlands<br />
sicherstellen können. Dem widerspricht der FDBR in seinem<br />
Positionspapier „Thermische Kraftwerke liefern mehr als Strom<br />
– Fünf Missverständnisse in der energiepolitischen Diskussion“<br />
nachdrücklich.<br />
„Tatsache ist, dass erneuerbare Energien ebenso wie Speicherausbau<br />
oder Stromimporte nur unzureichend zur Sicherung<br />
von Energieversorgung, Netzstabilität und Energiequalität in<br />
Deutschland beitragen werden. Entsprechend ist thermische<br />
Kraftwerksleistung nahezu unverändert vorzuhalten. Tatsache<br />
ist auch, dass konventionelle Kraftwerke für System- und<br />
Versorgungssicherheit unverzichtbar bleiben und deshalb mit<br />
der Modernisierung des Kraftwerksparks zügig begonnen<br />
werden muss. Und schließlich ist es Fakt, dass Großkraftwerke<br />
auch bei dezentraler Stromerzeugung erforderlich sind. Große<br />
Verbundnetze sorgen zudem für die notwendige Netzstabilität<br />
– und sichern damit Standort- und Investitionsentscheidungen“,<br />
so Dr. Maas.<br />
Darüber hinaus zeigt das FDBR-Positionspapier, dass eine<br />
Lastsicherung allein durch GuD-Kraftwerke ineffizient sowie<br />
Das Steinkohlekraftwerk in Duisburg (Walsum 10) verfügt über<br />
eine installierte Leistung von 750 MW und wurde von Hitachi<br />
Power Europe schlüsselfertig errichtet<br />
riskant ist und kleine Gasturbinen nur geringe Wirkungsgrade<br />
erreichen und daher unwirtschaftlich sind. Dagegen können<br />
moderne Kohlekraftwerke einen insgesamt vergleichbaren<br />
Beitrag zur flexiblen Stromversorgung in Deutschland leisten<br />
– und dies mit rund 30 % geringeren CO 2<br />
-Emissionen.<br />
„Die Erneuerung des konventionellen Kraftwerksparks zur<br />
Anpassung an künftige Herausforderungen im Strommarkt<br />
ist zwingend notwendig und technisch machbar“, konstatiert<br />
Maaß. „Ein weiterer Investitionsstau wiederum birgt energiewirtschaftliche<br />
Risiken und hat einen Kapazitätsabbau bei<br />
den Technologieanbietern mit Verlust von Arbeitsplätzen und<br />
Know-how zur Folge.“<br />
NO DIG<br />
MOSCOW<br />
3.-6. Juni 2014<br />
Russland, Moskau<br />
Messegelände “Crocus Expo”<br />
www.nodig-moscow.ru<br />
FACHMESSE UND KONGRESS #1<br />
FÜR «GRABENLOSE TECHNOLOGIEN» IN RUSSLAND, GUS UND BALTISCH REGION<br />
10 | 2013 11
NACHRICHTEN VERBÄNDE<br />
Ausbildung zum Zertifizierten Kanal-Sanierungs-Berater:<br />
Prüfingenieure machen mit<br />
Bild 1: Gruppenfoto nach bestandener Prüfung: Die Kursleiter Mario<br />
Heinlein (1. v. li.) und Norbert Heidbrink (1. Reihe, 2. v. re.), mit<br />
den erfolgreichen Absolventen des ZKS-Berater-Lehrgangs bei den<br />
Stadtentwässerungsbetrieben Köln, AöR<br />
Die im Rahmen des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG)<br />
§§ 60f. sowie der Eigenkontrollverordnungen einiger Bundesländer<br />
festgelegte Verpflichtung zur Sanierung schadhafter<br />
Kanäle hat zu einem großen Beratungsbedarf bei<br />
öffentlichen und privaten Netzbetreibern geführt. Gefragt<br />
sind treffende Beurteilungen von Schadensbildern und<br />
-ursachen, eine umfassende Kenntnis der zahlreichen<br />
Verfahren und fachlich fundierte Sanierungskonzepte.<br />
Wie wähle ich als Verantwortlicher bei einer Kommune<br />
oder als Planer für das konkrete Schadensbild ein<br />
geeignetes Sanierungsverfahren? Diese Frage wird sich<br />
jeder verantwortungsbewusste Netzbetreiber oder Planer<br />
stellen, der neben wirtschaftlichen Aspekten auch Parameter<br />
wie die Nutzungsdauer im Blick hat. Die richtige<br />
Auswahl des Verfahrens und eine qualifizierte Ausführung<br />
tragen zu nachhaltigen Sanierungsergebnissen bei. Doch<br />
wie geht man richtig vor und was muss man beachten,<br />
Bild 2: Beleg für eine Erfolgsgeschichte: 1.326 Absolventen haben bis 2012 mit Erfolg an der<br />
Weiterbildung zum Zertifizierten Kanal-Sanierungs-Berater teilgenommen (Quelle: DWA)<br />
damit von der Planung über die Ausschreibung bis hin<br />
zur Ausführung alles den gewünschten Anforderungen<br />
entspricht?<br />
Hierzu sind in erster Linie Sachkenntnis und Fachwissen<br />
gefragt. Angesichts der Vielzahl an angebotenen<br />
Sanierungsverfahren können für spezifische Rahmenbedingungen<br />
technisch und wirtschaftlich optimierte Konzepte<br />
zur Substanzerhaltung erstellt werden. Nicht nur<br />
zur Ausarbeitung der Konzepte, sondern auch zu deren<br />
Umsetzung wird qualifiziertes Personal benötigt. Auch<br />
um sicherzustellen, dass bei Instandhaltung, Planung<br />
und Bauausführung eine Qualität erreicht wird, die den<br />
langfristigen, generationsübergreifenden Nutzungsansprüchen<br />
gerecht wird.<br />
Angebot geschaffen<br />
Aus diesem Grund hat die Fördergemeinschaft für die<br />
Sanierung von Abwasserleitungen und -kanälen 1997<br />
das Angebot der „Fortbildung zum Zertifizierten Kanal-<br />
Sanierungs-Berater“ geschaffen. Zu den Trägern dieser<br />
Fördergemeinschaft zählt neben der DWA Deutsche<br />
Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall<br />
e. V., dem Hauptverband der Deutschen Bauindustrie<br />
e. V., dem Rohrleitungssanierungsverband e. V. und dem<br />
Zentralverband des Deutschen Baugewerbes e. V. die<br />
RAL-Gütegemeinschaft Güteschutz Kanalbau e. V.<br />
Erfolgreich absolviert<br />
Doch das Engagement der Gütegemeinschaft geht<br />
über die Mitwirkung in der Fördergemeinschaft hinaus:<br />
Mittlerweile sind acht der vom Güteausschuss der<br />
RAL-Gütegemeinschaft Kanalbau beauftragten Prüfingenieure<br />
selbst Zertifizierte Kanalsanierungsberater.<br />
Die Gütegemeinschaft verfolgt hiermit zwei Ziele: Zum<br />
einen werden die notwendigen Kenntnisse zur Bewertung<br />
von Ausschreibung, Bauüberwachung und Ausführung<br />
geschaffen. Zum anderen verfügt die Gütesicherung über<br />
Spezialisten, die Auftraggebern, Planern und ausführenden<br />
Unternehmern kompetent zur<br />
Seite stehen können.<br />
„Die Fortbildung zum Zertifizierten<br />
Kanal-Sanierungs-Berater erweitert<br />
Grundkenntnisse zur Beurteilung<br />
der Einsatzfähigkeit von bekannten<br />
und neuen Sanierungsverfahren<br />
und schafft damit wichtiges Grundlagenwissen“,<br />
meint Prüfingenieur<br />
Dipl.-Ing. Norbert Heidbrink, der<br />
gemeinsam mit Dipl.-Ing. (FH)<br />
Mario Heinlein, Stadtentwässerung<br />
und Umweltanalytik Nürnberg, als<br />
Kursleiter tätig ist.<br />
12 10 | 2013
VERBÄNDE NACHRICHTEN<br />
Umfangreicher Lehrplan<br />
2012 fanden sieben jeweils vierwöchige Fortbildungsmaßnahmen<br />
statt, bei denen Fachwissen zur Schadensfeststellung,<br />
-analyse und Sanierungsplanung von Abwasserleitungen<br />
und -kanälen vermittelt wurde. Dabei standen<br />
neben rechtlichen und technischen Grundlagen im<br />
Kanalbau folgende Themen auf dem Lehrplan: Verfahren<br />
der Kanalreinigung, Inspektionsverfahren, Arbeits- und<br />
Gesundheitsschutz, Abwasser und Probenahmen, Reparatur-,<br />
Renovierungs- und Erneuerungsverfahren, Standsicherheit,<br />
Materialkunde, Umgang mit Sanierungsfehlern,<br />
Entwicklung von Sanierungskonzepten und Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen,<br />
Grundlagen der Bauausführung,<br />
Ausschreibung, Vergabe sowie Überwachung und Qualitätssicherung.<br />
Zugangsvoraussetzung zum Lehrgang ist<br />
ein Abschluss als Abwassermeister, Meister oder Diplom-<br />
Ingenieur bzw. Techniker mit mindestens fünf Jahren<br />
Berufserfahrung im Bereich Planung und Bau, Betrieb<br />
und Unterhalt von Entwässerungssystemen. Fundierte<br />
Kenntnisse in den Bereichen Kanalbau und Kanalinspektion<br />
sind ebenso Voraussetzung wie Grundkenntnisse über<br />
die einschlägigen Sanierungsverfahren. Das erforderliche<br />
Wissen zur Untersuchung von Kanälen, die Erarbeitung<br />
von Sanierungskonzepten sowie die Durchführung von<br />
Sanierungen werden durch Ablegen einer Prüfung nachgewiesen.<br />
Laut Prüfungsordnung gehören zur Prüfung<br />
eine Arbeitsprobe (Befahren einer Kanalhaltung mit Schadensansprache)<br />
sowie drei schriftliche Prüfungen und eine<br />
mündliche Prüfung (Diskussion des Sanierungskonzeptes).<br />
Mit bestandener Prüfung erhalten die Teilnehmer das Zertifikat<br />
„Zertifizierter Kanal-Sanierungs-Berater“.<br />
Positive Rückmeldungen<br />
Der Fortbildungslehrgang und die Ausbildungsinhalte kommen<br />
an – das belegen die unverändert hohen Anmeldungen zu<br />
den Lehrgängen ebenso wie die positiven Rückmeldungen der<br />
Teilnehmer. In 2012 fanden insgesamt sieben Schulungen von<br />
je vier Wochen Dauer statt. Hierzu zählte eine Blockschulung in<br />
Kerpen (24 Teilnehmer) sowie sechs Modulare Schulungen über<br />
einen Zeitraum von etwa zwei bis drei Monaten in Feuchtwangen<br />
(zwei Veranstaltungen: 23 bzw. 12 Teilnehmer), Dresden<br />
(25 Teilnehmer), Kerpen (18 Teilnehmer) und Köln (zwei Veranstaltungen:<br />
26 bzw. 29 Teilnehmer).<br />
Das Personal bei Betreibern, in Ingenieurbüros und in der<br />
Baubranche verfügt oft über eine gute Erstausbildung, das<br />
Thema Weiterbildung wird dagegen häufig stiefmütterlich<br />
behandelt. Doch nach wie vor gilt: Mehr Wissen bedeutet<br />
mehr Können. Deshalb gehört lebenslanges Lernen zum<br />
Beruf, in dem sich die Arbeitsbedingungen und Produkte<br />
ständig wandeln, unabdingbar dazu. „Qualifiziertes Arbeiten<br />
ist nicht zuletzt ein Garant für die nötige Sicherheit<br />
vor Ort auf den Baustellen sowie für eine hochwertige<br />
Ausführungsqualität, bringt aber auch den mit Planung und<br />
Ausschreibung beauftragten Ingenieur einen Mehrwert“,<br />
so Heidbrink weiter. In diesem Zusammenhang weist der<br />
Prüfingenieur auf die Güte- und Prüfbestimmungen RAL-<br />
GZ 961 hin. So heißt es z. B. im Punkt 3.16.2.1 Personal<br />
aressy.com - 12/12 - 8232<br />
Le Messe salon für des Umwelttechnik, éco-technologies, Energiewirtschaft<br />
und nachhaltige Entwicklung<br />
de l’énergie et du développement durable<br />
3. bis 6. Dezember 2013<br />
3 Paris > 6 Nord DECEMBRE Villepinte Frankreich 2013<br />
Paris Nord Villepinte FRANCE<br />
Umweltschutz<br />
Unternehmerische<br />
Sozialverantwortung<br />
in zusammenarbeit mit<br />
Energiewirtschaft<br />
Umweltfreundliche<br />
Konzepte<br />
Kontakt<br />
Für Besucher:<br />
imF Gmbh - bienvenue angui<br />
Tel: +49(0)221/13 05 09 09<br />
e-mail: b.angui@imf-promosalons.de<br />
Für Aussteller:<br />
reed exhibitions - Susanne Figaj<br />
Tel: +49(0)211 55 62 829<br />
e-mail: susanne.figaj@reedexpo.de<br />
www.pollutec.com<br />
10 | 2013 13<br />
91 x 255_all.indd 1 10/06/13 10:2
NACHRICHTEN VERBÄNDE / VERANSTALTUNGEN<br />
u. a. das Zertifikat ‚Zertifizierter Kanal-Sanierungs-Berater‘“,<br />
erklärt Heidbrink, der den Lehrgang im Jahr 2003<br />
selbst absolviert hat.<br />
Bild 3: Sein Fachwissen als Kanal-Sanierungs-Berater bringt<br />
Norbert Heidbrink (li.) in seine Tätigkeit als Prüfingenieur der<br />
Gütegemeinschaft Kanalbau mit ein<br />
unter den Anforderungen der Beurteilungsgruppe ABS<br />
(Ausschreibung und Bauüberwachung bei grabenloser<br />
Sanierung) hinsichtlich der personellen Ausstattung der<br />
Unternehmen: Verantwortliche mit erfolgreicher dreijähriger<br />
Tätigkeit in der Ausschreibung und Bauüberwachung<br />
von Kanalsanierungsarbeiten sowie Fachpersonal<br />
in angemessener Zahl entsprechend dem jeweiligen<br />
Auftragsumfang. In beiden Fällen gilt der Nachweis der<br />
Fachkunde als erbracht durch Vorlage geeigneter Schulungsnachweise.<br />
„Zu den geeigneten Nachweisen zählt<br />
Wichtige Impulse<br />
Seine Erfahrungen gibt er seitdem in seiner Funktion als<br />
Kursleiter an die Lehrgangsteilnehmer weiter. Er ist gemeinsam<br />
mit Mario Heinlein unter anderem für organisatorische<br />
Fragen während der Ausbildungszeit zuständig. „Bis auf<br />
wenige Ausnahmen stehen die Frauen und Männer, die die<br />
Zusatzausbildung absolvieren, mitten im Berufsleben und<br />
werden von ihren Arbeitgebern für die Qualifizierungsmaßnahme<br />
freigestellt“, weiß Heidbrink, der darüber hinaus<br />
auch als Dozent und im Prüfungsausschuss tätig ist. Das<br />
Drücken der Schulbank – üblicherweise geht der Unterricht<br />
täglich von 8 bis 17 Uhr – fordert viel Kraft und Engagement,<br />
bringt aber für das Berufsleben wichtige Impulse, so<br />
die Rückmeldungen vieler Absolventen. Eine Einschätzung,<br />
die Heidbrink teilt. „Der Lehrgang ist ein ideales Rüstzeug<br />
für den Prüfingenieur aber auch für den Planer und die<br />
Mitarbeiter ausführender Unternehmen“, so das Fazit des<br />
Kursleiters. „Der Kurs vermittelt ein stabiles Fundament<br />
an Fachwissen, das jedem ermöglicht, bei den wichtigen<br />
Themen rund um die Leitungsinfrastruktur auch einmal über<br />
den Tellerrand hinauszuschauen“.<br />
KONTAKT: RAL-Gütegemeinschaft Güteschutz Kanalbau, Bad Honnef,<br />
E-Mail: info@kanalbau.com, www.kanalbau.com<br />
TAW bietet Soft Skill-Training für Ingenieure<br />
Teamfähigkeit, Redegewandtheit oder Eigeninitiative<br />
– so genannte Soft Skills werden auch in technischen<br />
Berufen zunehmend wichtiger. Aus diesem Grund<br />
hat die der Technischen Akademie Wuppertal (TAW)<br />
angegliederte Akademie für Personalmanagement und<br />
Unternehmensentwicklung (afpu) das zweitägige Seminar<br />
„Professionelle Rhetorik für Ingenieure und Techniker“ (25.-<br />
26.11.2013, Technische Akademie Wuppertal) ins Leben<br />
gerufen. In den Kursen lernen die Teilnehmer, ihr Wissen<br />
auch „Fachfremden“ überzeugend zu vermitteln.<br />
In typischen Gesprächssituationen bekommen die Teilnehmer<br />
Techniken vermittelt, um eigene Statements auf den Punkt<br />
zu bringen, Gesprächspartner zu überzeugen und souverän<br />
auf Kritik zu reagieren.<br />
Ein Garant für den Erfolg der Veranstaltungen ist die<br />
homogene Zusammensetzung der Gruppen. „Hier sind die<br />
Techniker quasi unter sich“, so Ulrike Ligges, Leiterin der<br />
afpu. In kleinen Gruppen von maximal zehn Personen bleibt<br />
genügend Raum, um das Programm flexibel auf die speziellen<br />
Anforderungen der Teilnehmer zuzuschneiden. Ligges:<br />
„Praxisnahe Seminarinhalte sind uns besonders wichtig.<br />
Teilnehmer haben die Möglichkeit, Problemstellungen aus<br />
dem eigenen Berufsalltag vorzustellen und unmittelbar im<br />
Seminar erste Lösungsansätze zu entwickeln.“<br />
Für viele Techniker werden Soft Skills insbesondere dann<br />
interessant, wenn der nächste Schritt in der beruflichen<br />
Laufbahn erfolgt und sie Führungsverantwortung<br />
übernehmen. Speziell für deren Bedarf hat die TAW<br />
ein dreiteiliges Qualifizierungsprogramm entwickelt.<br />
Zusätzlich zum Rhetorik-Kurs lernen die Teilnehmer<br />
im Seminar „Führungstraining für Ingenieure und<br />
Techniker“ (Wuppertal), den eigenen Führungsstil<br />
weiterzuentwickeln, Mitarbeiter zu motivieren und<br />
Personalgespräche richtig zu führen. Das Modul<br />
„Projektmanagement” hilft den technischen<br />
Führungskräften, die Effizienz in ihren Projekten zu<br />
steigern. Ingenieure und Techniker, die ihre rhetorischen<br />
Fähigkeiten im Anschluss noch weiter vertiefen möchten,<br />
können ab 2014 außerdem am neuen „Aufbautraining:<br />
Professionelle Rhetorik und Schlagfertigkeit für Ingenieure<br />
und Techniker“ der TAW teilnehmen.<br />
KONTAKT: Technische Akademie Wuppertal e.V., www.taw.de/seminare<br />
14 10 | 2013
VERANSTALTUNGEN NACHRICHTEN<br />
Tube 2014: Kunststoffrohre in der Industrie<br />
Kunststoffrohre haben in den letzten 60 Jahren in vielen<br />
unterschiedlichen Anwendungsbereichen Einzug gehalten<br />
und in zahlreichen Marktsegmenten sogar die Marktführerschaft<br />
erobert. Ein wesentlicher Grund für den Erfolg ist<br />
das hohe Innovationspotenzial. Neue und weiterentwickelte<br />
Kunststoffe sowie Verbesserungen der Produktions- und<br />
Verfahrenstechniken ermöglichen die Entwicklung anwendungsspezifischer<br />
Problemlösungen. Auch zukünftig werden<br />
sich nach Ansicht des Kunststoffrohrverbandes KRV in<br />
Bonn (www.krv.de) für Kunststoffrohrsysteme neue Märkte<br />
eröffnen, z. B. durch den Ausbau der erneuerbaren Energien<br />
sowie der Informations- und Telekommunikationsnetze.<br />
Der Industriebereich nimmt unter den Anwendungsgebieten<br />
von Kunststoffrohren zwar nur eine kleinere Rolle ein, doch<br />
sind die Anforderungen an Industrierohrsysteme meist sehr<br />
anspruchsvoll und komplex. Moderne Kunststoffe, Rohrkonstruktionen<br />
und Verbindungstechniken erlauben hier nachfragegerechte<br />
und immer breitere Anwendungsfelder. So<br />
werden Kunststoffrohrsysteme erfolgreich in der Industrie<br />
und im Anlagenbau verwendet und ersetzen zunehmend<br />
herkömmliche Werkstoffe. Für den Einsatz von Kunststoff<br />
sprechen vor allem Aspekte wie Korrosionsbeständigkeit,<br />
Handhabung, Energieeinsparung, Wirtschaftlichkeit und<br />
Sicherheit.<br />
Rohre, Behälter und Formteile aus Kunststoff werden in den<br />
verschiedensten Industriebereichen genutzt. Eine große<br />
Bedeutung haben Kunststoffe für die chemische Industrie.<br />
Besondere Anforderungen an die Leitungskomponenten<br />
stellt der Transport von Chemikalien oder speziellen Wasserqualitäten.<br />
An erster Stelle ist hier die Medienbeständigkeit<br />
der Produkte zu nennen. Hohe Ansprüche werden außerdem<br />
an die Sicherheit, Standzeiten und Wirtschaftlichkeit<br />
gestellt. Zudem sollten Wartung, Reparatur und Verlegung<br />
möglichst einfach sein. Aus diesen Anforderungen resultiert<br />
eine große Vielfalt an unterschiedlichen Polymermaterialien<br />
im Kunststoffrohrleitungsbau.<br />
Werkstoffe für unterschiedlichste Anwendungen<br />
In der chemischen Verfahrenstechnik werden vor allem<br />
Polyolefine, Fluorkunststoffe, PVC-C, GFK und oft auch Verbundmaterialien<br />
wie z. B. Kombinationen von Thermo- und<br />
Duroplasten verwendet. ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)<br />
beispielsweise eignet sich aufgrund seiner mechanischen<br />
Eigenschaften, seiner guten chemischen Beständigkeit und<br />
seiner hohen Schlagzähigkeit auch im unteren Temperaturanwendungsbereich<br />
für eine Vielzahl von Anwendungen<br />
speziell in der Kälte- und Klimatechnik.<br />
GFK (Glasfaserverstärkter Kunststoff) ist ein hochfester Verbundwerkstoff,<br />
der besonders bei mechanisch, thermisch<br />
oder chemisch hoch beanspruchten Rohrleitungssystemen<br />
zum Einsatz kommt. Über die Kombination unterschiedlicher<br />
Rohstoffe lassen sich GFK-Rohre herstellen, die den spezifischen<br />
Anforderungen der Anwendung entsprechen. GFK<br />
weist auch bei hohen Temperaturen und einem chemischen<br />
Bild 1: PVC-Trinkwasserrohr (Quelle: KRV)<br />
Angriff eine hohe Steifigkeit und Festigkeit auf. Zusammen<br />
mit dem geringen Gewicht bietet der Werkstoff laut KRV<br />
besonders bei großen Nennweiten Vorteile.<br />
Die Weiterentwicklung der PE-Formmassen führte in den<br />
letzten Jahren zu einer deutlich verbesserten Leistungsfähigkeit<br />
von PE-Rohren und Formteilen. Das UV-beständige PE<br />
(Polyethylen) lässt sich sehr gut verarbeiten und kombiniert<br />
eine hohe chemische Widerstandsfähigkeit mit Zähigkeit<br />
und Steifigkeit. Zudem ist PE in einem weiten Temperaturbereich<br />
sowohl bei Minus- als auch bei Plus-Graden verwendbar.<br />
PE wird heute nicht mehr nach der Dichte eingeteilt,<br />
sondern in Festigkeitsklassen nach ISO 9080 (PE 63, PE<br />
80, PE 100). Im Vergleich zu anderen Thermoplasten weist<br />
PE nach Angaben der Frank GmbH (www.frank-gmbh.de)<br />
eine ausgezeichnete Diffusionsbeständigkeit auf und wird<br />
deshalb seit vielen Jahren für den sicheren Transport von<br />
Gasen verwendet. Weitere wesentliche Vorteile des Materials<br />
sind die UV-Stabilität und die Flexibilität des Werkstoffs.<br />
Mechanische Eigenschaften verbessert<br />
Bei PE 100 handelt es sich um eine Weiterentwicklung,<br />
die durch ein modifiziertes Polymerisationsverfahren eine<br />
höhere Dichte und verbesserte mechanische Eigenschaften<br />
wie eine erhöhte Steifigkeit und Härte aufweist. Außerdem<br />
konnte die Zeitstandfestigkeit deutlich verbessert werden.<br />
Das Material eignet sich u. a. zum Herstellen von Druckrohren<br />
größerer Dimensionen.<br />
PE-Rohre lassen sich grundsätzlich auch im Bereich energiereicher<br />
Strahlung verwenden, beispielsweise zum Ableiten<br />
radioaktiver Abwässer aus heißen Laboratorien oder<br />
als Kühlwasserleitungen in der Kernenergietechnik. Nach<br />
Unternehmensangaben werden PE-Rohrleitungen auch<br />
nach jahrelangem Einsatz nicht radioaktiv. Dank der physiologischen<br />
Unbedenklichkeit sind Rohre und Formteile<br />
aus PE andererseits auf Trinkwassertauglichkeit überprüft<br />
10 | 2013 15
NACHRICHTEN VERANSTALTUNGEN<br />
und mit fallender Temperatur ab. PP-R weist nach Angaben<br />
der Frank GmbH im Vergleich zu PP-H eine bessere<br />
Schlagzähigkeit auf.<br />
PP gilt als beständig gegenüber vielen Säuren und Laugen<br />
wie Alkalilaugen, Phosphorsäure oder Salzsäure. Gegenüber<br />
freiem Chlor und Ozon sowie Kohlenwasserstoffen – und<br />
damit auch gegen Benzin – ist PP dagegen nur bedingt<br />
beständig. Aufgrund seiner hohen Temperaturbeständigkeit<br />
betrachtet man PP bei Frank als ideal für den Einsatz<br />
in Beizanlagen, der chemischen Industrie oder bei hochaggressiven<br />
Abwässern. Zu beachten ist auch, dass die<br />
chemische Beständigkeit von der Betriebstemperatur, dem<br />
Betriebsdruck und eventuell von außen wirkenden Beanspruchungen<br />
abhängig ist.<br />
Bild 2: Verlegtes PVC-Kanalrohrsystem (Quelle: KRV)<br />
und zugelassen. Zu den besonderen Eigenschaften von PE<br />
gehört seine chemische Widerstandsfähigkeit. So weist PE<br />
eine ungewöhnlich hohe Beständigkeit gegenüber einer<br />
Vielzahl von Säuren und Laugen auf. Dazu zählen wässrige<br />
Lösungen von Salzen ebenso wie nicht oxidierende Säuren<br />
und Alkalien. Gegen starke Oxidationsmittel wie Salpetersäure,<br />
Ozon, Oleum, Wasserstoffperoxid oder Halogene ist<br />
PE aber nur bedingt bis nicht widerstandsfähig.<br />
Erwähnt sei an dieser Stelle auch PE-el (elektrisch leitfähiges<br />
Polyethylen), dass man häufig für den Transport von<br />
leicht brennbaren Medien wie z. B. Treibstoffen oder zum<br />
Transport von Stäuben bei Temperaturen bis 60 °C verwendet.<br />
Gegenüber dem Standard-PE ist bei PE-el eine<br />
verringerte Schlagzähigkeit und Zeitstandfestigkeit sowie<br />
eine geringfügig veränderte chemische Widerstandsfähigkeit<br />
zu beachten.<br />
PP (Polypropylen) bietet eine hohe mechanische Festigkeit,<br />
gute chemische Widerstandsfähigkeit und physiologische<br />
Unbedenklichkeit. Weitere Eigenschaften sind eine hohe<br />
chemische Beständigkeit und gute Langzeiteigenschaften<br />
gegenüber vielen Medien selbst bei hohen Temperaturen.<br />
Dank der im Vergleich zu PE höheren Wärmebeständigkeit<br />
gilt PP als günstiger Standardwerkstoff für den Einsatz bei<br />
höheren Temperaturen. Deshalb verwendet man PP bevorzugt<br />
bei oberirdischen Rohrinstallationen.<br />
Bei PP unterscheidet man verschiedene Polymertypen. Während<br />
das Homopolymere PP-H ausschließlich aus Propylen-<br />
Molekülen besteht, sind bei den beiden Copolymeren PP-B<br />
(Polypropylen Blockcopolymerisat) und PP-R (Polypropylen<br />
Randomcopolymerisat) Ethylenmonomere eingebaut. Beide<br />
Arten sind hoch wärmestabilisiert und gut geeignet zum<br />
Herstellen von druckbeanspruchten Rohrleitungssystemen.<br />
Die Schlagzähigkeit nimmt mit steigender Temperatur zu<br />
Sicherheit durch schwerentflammbare Kunststoffe<br />
Um statische Aufladungen abführen zu können, die beim<br />
Betrieb von thermoplastischen Rohrleitungssystemen in<br />
explosionsgeschützten Bereichen mit Flüssigkeiten oder<br />
Stäuben auftreten können, müssen die Werkstoffe elektrisch<br />
leitfähig sein. Die Zugabe von Leitruß verringert allerdings<br />
die Schlagzähigkeit und Zeitstandfestigkeit der elektrisch<br />
leitfähigen Werkstoffe PE-el und PPs-el, wohingegen die<br />
chemische Widerstandsfähigkeit weitgehend erhalten bleibt.<br />
Der schwerentflammbare Polypropylentyp PPs ist durch<br />
die Zugabe von Flammschutzmitteln in die Baustoffklasse<br />
B1 (gemäß DIN 4102 ) eingestuft und wird oft für Lüftungs-<br />
und Abgasleitungen in Gebäuden genutzt. PPs-el<br />
(schwer entflammbar, elektrisch leitfähig) vereint laut Frank<br />
die positiven Eigenschaften der schwer entflammbaren<br />
und elektrisch leitfähigen PP-Typen. Man verwendet den<br />
Werkstoff deshalb aus Sicherheitsgründen vor allem für den<br />
Transport von leicht entzündbaren Medien.<br />
Schwer entflammbar sind auch die beiden PVC (Polyvinylchlorid)<br />
Varianten PVC-U und PVC-C. Beim weichmacherfreien<br />
PVC-U handelt es sich um einen universellen Werkstoff<br />
mit guter Wirtschaftlichkeit und einfacher thermo-mechanischer<br />
Bearbeitbarkeit. Durch Nachchlorierung von PVC<br />
entsteht PVC-C, das gegenüber PVC-U eine höhere Temperaturbeständigkeit<br />
sowie in einigen Fällen eine verbesserte<br />
chemische Beständigkeit aufweist.<br />
Als letzter Werkstoff sei hier noch PVDF (Polyvinylidenfluorid)<br />
erwähnt, das zu den hochkristallinen thermoplastischen<br />
Hochleistungskunststoffen zählt und über eine hohe<br />
Steifigkeit auch im oberen Temperaturbereich verfügt.<br />
Der Werkstoff ist sehr widerstandsfähig gegenüber vielen<br />
organischen und anorganischen Medien. Weil PVDF<br />
ein Homopolymer ohne Zusatzstoffe wie beispielsweise<br />
Stabilisatoren und Farbstoffe ist, gilt es als physiologisch<br />
unbedenklich und lässt sich im Reinstmedienbereich verwenden.<br />
Neben der hohen mechanischen Festigkeit hat<br />
PVDF eine sehr gute chemische Widerstandsfähigkeit<br />
und ist im Vergleich zu anderen Fluorkunststoffen einfach<br />
und gut zu verarbeiten. Außerdem verfügt PVDF<br />
aufgrund seiner chemischen Struktur über eine gute<br />
Beständigkeit gegen UV- und Gammastrahlung und ist<br />
sehr alterungsbeständig.<br />
16 10 | 2013
VERANSTALTUNGEN NACHRICHTEN<br />
Neue Rohrgeneration mit erhöhter Abriebfestigkeit<br />
Die beschriebene große Werkstoffvielfalt ermöglicht es<br />
der Kunststoffrohrindustrie, für viele Anwendungsfälle die<br />
bestmögliche Problemlösung zu entwickeln. Ein Beispiel<br />
ist der Transport von feststoffhaltigen Medien, bei dem<br />
das zu transportierende Flüssig-/Feststoffgemisch aufgrund<br />
der hohen mechanischen Reibung die Innenflächen des<br />
Kunststoffrohres hoch belastet. Prinzipiell sind für solche<br />
Anwendungen sowohl PE 80- als auch PE 100-Rohre<br />
geeignet, denn sie verbinden gute mechanisch hydraulische<br />
Materialeigenschaften mit hoher Korrosions- und Inkrustationsbeständigkeit.<br />
Um diese guten Eigenschaften weiter<br />
zu verbessern und die wirtschaftliche Nutzungsdauer von<br />
Rohrleitungssystemen in diesen Anwendungsbereichen zu<br />
erhöhen, hat die Simona AG (www.simona.de) eine neue<br />
Rohrgeneration entwickelt. Dafür werden im Coextrusionsverfahren<br />
in der Schmelze unterschiedliche PE-Materialien<br />
zusammengefügt.<br />
Im vorliegenden Fall wird ein PE 100-Basisrohr mit einer<br />
Innenschicht eines höher molekularen PE-Werkstoffes kombiniert.<br />
Die coextrudierte, verschleißfeste Innenschicht ist<br />
in die genormte Rohrwandgeometrie integriert. Damit entsprechen<br />
die Rohre in ihrer Dimension den Anforderungen<br />
der DIN 8074 und können mit den bekannten und am Markt<br />
erhältlichen Formteilen verbunden und verarbeitet werden.<br />
Untersuchungen wie z. B. Zeitstandinnendruckversuche<br />
haben laut Hersteller ergeben, dass die Anforderungen der<br />
DIN 8075 an die Festigkeitseigenschaften erfüllt werden. Für<br />
diese Materialkombination wird eine Standzeiterhöhung des<br />
Rohrleitungssystems in Abhängigkeit des Fördermediums<br />
von 30 bis 50 % erwartet.<br />
KONTAKT: www.tube.de<br />
Mehr als 100 Aussteller bei Tiefbaumesse InfraTech<br />
in Essen<br />
Die InfraTech 2014 findet vom 15. bis zum 17. Januar 2014<br />
in der Messe Essen statt. Als „Volltreffer“ bezeichnet<br />
Roland Stud, Vertriebsleiter Mall GmbH, die Fachmesse.<br />
„Im Hinblick auf den Tief- und Infrastrukturbau eröffnen<br />
uns die von der neuen Messe ausgehenden Impulse<br />
enorme Chancen. In einem Bundesland wie Nordrhein-<br />
Westfalen besteht auch der Bedarf für eine interessante<br />
und innovative Fachmesse auf dem Infrastruktursektor.<br />
Wir bei Mall sind davon überzeugt, dass die InfraTech<br />
Deutschland ein großer Erfolg werden und dem Herzstück<br />
von NRW positive Impulse geben wird”, so Stud.<br />
Deutsch-Niederländische Handelskammer<br />
Die Deutsch-Niederländische Handelskammer (DNHK)<br />
unterstützt bereits seit mehr als 100 Jahren Unternehmen<br />
aus beiden Ländern bei ihren Geschäftstätigkeiten auf<br />
dem Nachbarmarkt. Mit ihren 1.000 Mitgliedern bildet<br />
die DNHK gleichzeitig das größte deutsch-niederländische<br />
Geschäftsnetzwerk.<br />
Günter Gülker ist seit Juli 2013 Geschäftsführer der DNHK<br />
und sagt zur InfraTech Deutschland: „Die Niederlande haben<br />
einen hervorragenden internationalen Ruf auf dem Gebiet<br />
von Infrastrukturprojekten. Wir freuen uns daher sehr über<br />
die Initiative, die Fachmesse InfraTech auch in Deutschland<br />
einzuführen. Das neue Konzept bietet niederländischen<br />
Unternehmen die Möglichkeit, ihr Fachwissen dem deutschen<br />
Geschäftsmarkt zu präsentieren. Das unterstützen wir voll<br />
und ganz.“<br />
Auch die Erwartungen beim Organisator Ahoy Rotterdam<br />
liegen hoch. Die Teilnehmerliste zählt inzwischen<br />
mehr als 100 Unternehmen, von denen etwa 80 % aus<br />
Deutschland und 20 % aus den Niederlanden stammen.<br />
Sicherlich hat sich der Organisator die Entscheidung,<br />
auch in Deutschland eine Infrastruktur-Fachmesse zu<br />
organisieren, nicht ganz leicht gemacht hat, doch jetzt<br />
übertrifft das Interesse der Wirtschaft alle Erwartungen.<br />
Europas wichtigste Region für Infrastrukturbau<br />
Nordrhein-Westfalen ist, was den Infrastrukturbau<br />
betrifft, die wichtigste Region Europas. Die deutsche<br />
Regierung geht davon aus, dass der Personenverkehr<br />
von heute bis zum Jahr 2025 um 16 % zunehmen wird<br />
und der Frachtverkehr sogar um 71 %. Allein im Bundesland<br />
NRW sind 300 Brücken an Bundesstraßen nicht gut<br />
erreichbar oder schlecht befahrbar. Die Kostenschätzung<br />
für ihre Erneuerung liegt bei mindestens 3,5 Mrd. Euro (!).<br />
Ein besserer Ort für eine Infrastruktur-Fachmesse als die<br />
Messe in Essen ist nach Meinung des Organisators kaum<br />
denkbar, vor allem deshalb, weil dort zur gleichen Zeit<br />
die Fachmessen DEUBAUKOM und DCOnex stattfinden.<br />
Die Messebesucher schlagen also eigentlich drei Fliegen<br />
mit einer Klappe.<br />
KONTAKT: www.infratech.de/de<br />
10 | 2013 17
NACHRICHTEN VERANSTALTUNGEN<br />
Kanäle kombiniert bewirtschaften<br />
Kanäle können mehr als nur Abwasser ableiten. Das ist das Fazit des 1. Deutschen Kanalnetzbewirtschaftungstages, der<br />
am 6. Juni 2013 in Geisingen an der Donau stattgefunden hat. Bei einer für das jeweilige Kanalnetz programmierten<br />
Bewirtschaftung lassen sich mehrere Funktionen gleichzeitig steuern – und damit sowohl Energie als auch Investitionen<br />
sparen. Doch die Umstellung dauert, sie verlangt von den Mitarbeitern der kommunalen Eigenbetriebe ein Umdenken und<br />
ändert deren Arbeitsweise.<br />
Der Titel des Kongresses<br />
lässt erwarten, dass es<br />
Nachfolgeveranstaltungen<br />
in bestimmtem Turnus<br />
geben wird. Nach<br />
dem Erfolg des Auftakts<br />
mit 21 Referenten, 34<br />
Ausstellern und knapp<br />
300 Teilnehmern werden<br />
beim Ausrichter, der Firma<br />
Uhrig, als auch beim<br />
Veranstalter Technische<br />
Akademie Hannover e. V.<br />
(TAH) entsprechende Pläne<br />
geschmiedet. Dr.-Ing.<br />
Igor Borovsky, Vorsitzender<br />
der TAH, ist zufrieden<br />
Bild 1: Wehrturm kurz vor dem Einbau in ein mit dem Verlauf der Premiere.<br />
„Wir hatten eine<br />
bestehendes Kanalnetz<br />
(Quelle: Uhrig Straßen- und Tiefbau GmbH) stattliche Teilnehmerzahl<br />
aus Deutschland, Frankreich,<br />
Belgien, Spanien, Portugal und USA. Dank Synchronübersetzung<br />
in verschiedene Sprachen konnten sich diese aus<br />
dem Ausland angereisten Fachleute gut an der Diskussion<br />
beteiligen.“<br />
Hintergrund<br />
Unsere Abwasserinfrastruktur hat sich sozial und räumlich<br />
ausgewogen entwickelt. Sie ist, überwiegend getragen von<br />
den Kommunen, über viele Jahrzehnte als zentrales System<br />
gewachsen. Dies gewährleistet uns heutzutage eine flächendeckende<br />
Entsorgung mit hoher Entwässerungssicherheit.<br />
Damit einher geht eine extrem lange technische und ökonomische<br />
Lebensdauer.<br />
Die Folge davon ist mangelnde Flexibilität – ein Hindernis im<br />
Hinblick auf die einschneidenden Veränderungen, vor denen<br />
Kanalnetzbetreiber zukünftig stehen werden. Industrialisierung,<br />
verändertes Konsumentenverhalten und demografische<br />
Umbrüche führen in vielen Regionen zur Reduktion des<br />
Wasserverbrauchs, was auch bei der Entwässerung erhebliche<br />
Rück- und Umbaukosten zur Folge hat. Kanalnetze sind<br />
grundsätzlich verschieden – und doch gibt es Gemeinsamkeiten.<br />
Es lohnt sich, Erfahrungen zu technischen Neuerungen<br />
sowie besondere Vorteile bei Organisation, Vergabe, Bau<br />
und Betrieb zu vergleichen, zu hinterfragen und zu diskutieren.<br />
Diese Möglichkeit bot der 1. Deutsche Kanalnetzbewirtschaftungstag.<br />
In zwei parallel laufenden Vortragsblöcken<br />
konnten sich die Teilnehmer über die Themen „Kanalnetzbewirtschaftung<br />
und Kanalsanierung“ sowie „Energie aus<br />
Abwasser“ genauer informieren.<br />
Intelligente Netzbewirtschaftung ist flexibel<br />
Die Intelligenz eines Kanalnetzes hängt zusammen mit der<br />
Fähigkeit, auf die gegenwärtigen und zukünftigen Herausforderungen<br />
flexibel zu reagieren. Ob den daraus erwachsenden<br />
Anforderungen in der Zukunft konventionelle<br />
Systeme mit Regenüberlaufbecken sowie Trenn- und Drosselbauwerken<br />
zufriedenstellend gewachsen sind? Diese und<br />
ähnliche Fragen wurden diskutiert. Prof. Dr.-Ing. Theo G.<br />
Schmitt, der Siedlungswasserwirtschaft an der TU Kaiserslautern<br />
lehrt und Obmann des DWA-Fachausschusses ES-2<br />
„Systembezogene Planung“ ist, eröffnete die Veranstaltung<br />
mit seinem Vortrag „Zukunftsherausforderung Netzbewirtschaftung“<br />
und gab bekannt, dass trotz der auffälligen Häufung<br />
lokaler Starkregenereignisse pauschale Bemessungszuschläge<br />
in der Siedlungsentwässerung nicht zu empfehlen<br />
sind. Vielmehr müsste die Überflutungsvorsorge als kommunale<br />
Gemeinschaftsaufgabe betrachtet werden, bei der<br />
neben der unterirdischen Kanalisation auch die Gegebenheiten<br />
der Oberfläche und lokaler Objektschutz einbezogen<br />
werden. Er empfiehlt eine Neuausrichtung der Bewertung<br />
und Betrachtung im Sinne eines Risikomanagements, das bei<br />
zunehmenden Ungewissheiten mit höherer Flexibilität und<br />
Anpassungsfähigkeit reagieren müsse – letztlich ein Plädoyer<br />
für eine stärker dezentrale Ausrichtung der Siedlungsentwässerung<br />
in Verbindung mit einer optimalen Bewirtschaftung<br />
vorhandener Kanalnetze.<br />
Die intelligente Kanalnetzbewirtschaftung darf aber kein<br />
Selbstzweck sein, so der Tenor der weiteren Vorträge. Es<br />
müssen Wirtschaftlichkeitsbetrachtung, Nutzungsdauer und<br />
Werterhalt im Vordergrund stehen. Insofern ist es schon für<br />
anstehende Sanierungsmaßnahmen wichtig, das Ziel zu kennen<br />
und zu wissen, wie das Kanalnetz der Zukunft aussehen<br />
soll. Nur so wird vermieden, in die falsche Richtung zu investieren,<br />
viele Jahrzehnte lang ins Hintertreffen zu geraten und<br />
der Entwicklung hinterher zu laufen. Massive substanzielle<br />
und finanzielle Probleme wären über eine längere Zeitspanne<br />
zu verkraften, möglicherweise verursacht durch bekannte<br />
Phänomene wie zunehmend aggressive und übel riechende<br />
Ablagerungen im Kanal, stark schwankende Abwasserkon-<br />
18 10 | 2013
VERANSTALTUNGEN NACHRICHTEN<br />
zentration oder Rückstau bei Hochwasser. Laut DWA-Leistungsvergleich<br />
kommunaler Kläranlagen 2011 besteht „bei einigen Anlagen<br />
(Kanalnetz und Kläranlage) noch immer Anpassungsbedarf an den<br />
Stand der Technik“. Könnten dort vielleicht schon fortschrittlichere<br />
Konzepte realisiert werden, statt weitere Becken zu bauen und aufwändige<br />
Hochwasserpumpwerke zu betreiben, statt vermeidbaren<br />
Austrag von Ablagerungen in Becken und Flüsse zu riskieren? Mit<br />
solchen und ähnlichen Fragen wurden die Aussteller in den Veranstaltungspausen<br />
konfrontiert.<br />
Energieeffizienz senkt Betriebskosten deutlich<br />
Den Präsentationen des 1. Deutschen Kanalnetzbewirtschaftungstages<br />
nach zu urteilen bestehen die viel versprechenden Aspekte<br />
einer intelligenten Netzbewirtschaftung aus Kombinationen von<br />
Nutzen des Kanalvolumens als Stauraumkanal sowie Einbauen von<br />
Spülschiebern und Wehranlagen zum Drosseln und Kaskadieren.<br />
Dies ermöglicht Staustufen mit und ohne Entlastung. Der Überflutungsschutz<br />
kann mit beweglichen Wehren meteorologisch gesteuert<br />
flexibel nach tatsächlicher Wettersituation erfolgen. Permanent<br />
saubere Kanäle sind die erwünschte Folge mit kontinuierlich weitergeleiteten<br />
Sedimenten. Auf der Kläranlage führt das zu gesteigerter<br />
Effizienz und sinkenden Betriebskosten aufgrund Vergleichmäßigung<br />
der Abwasserkonzentration und somit weitgehend konstanten<br />
CSB-Frachten im Zulauf.<br />
Bekanntermaßen sind Kläranlagen und Pumpwerke die größten<br />
Stromverbraucher einer Kommune. Deren Betriebskosten steigen<br />
und fallen entscheidend mit dem Stromverbrauch. Und hier darf bei<br />
neuartigen technischen Komponenten zur Kanalnetzbewirtschaftung<br />
eine spürbare und nachhaltige Einsparung durch Energieeffizienz<br />
erwartet werden. Wenn Wasser nicht aus Rückhaltebecken nach<br />
oben gepumpt werden muss, weil es im Kanalrohr auf normalem<br />
Niveau gestaut wird, spart das bereits elektrische Energie.<br />
Ein Verfahren zur Ermittlung der Wirtschaftlichkeit einer Kanalnetzbewirtschaftung<br />
hat Marko Siekmann vom FIW Aachen (Forschungsinstitut<br />
für Wasser- und Abfallwirtschaft an der RWTH Aachen e.V.)<br />
vorgestellt, ergänzt durch Erfahrungsberichte von Betreibern – z. B.<br />
zur frachtbezogenen Steuerung des Kanalnetzes in Wuppertal, zum<br />
Hochwasserschutz von Abwasseranlagen in Mainz und zur Nutzung<br />
von vorhandenem Stauraumvolumen durch Kaskadierung in Hürth<br />
(NRW). Drei Speicherkaskaden im Hauptschluss beinhalten dort die<br />
bisher fehlenden 3.400 m³ zur Rückhaltung und als zusätzliches Extra<br />
ein für den Hochwasserschutz aktivierbares Stauraum-Volumen<br />
von 2.500 m³.<br />
Bei Regen wird von oben nach unten gestaut, bei Trockenwetter von<br />
unten nach oben freigegeben – optimiert durch ein eigenes Prozessleitsystem.<br />
Laut Kai Wapenhans, Abteilungsleiter Entwässerung der<br />
Stadtwerke Hürth, kann die Kaskadierung eine wirtschaftlich sinnvolle<br />
Lösung sein, sobald die Mitarbeiter sich an die im Kanalbetrieb<br />
noch ungewohnte Hydraulik, an die größere Anzahl beweglicher Teile<br />
und entsprechend geänderte Verhaltensregeln sowie die größere<br />
Komplexität der Steuerung gewöhnt haben. Vermutlich ist die Arbeit<br />
dann auch körperlich weniger anstrengend und für die Gesundheit<br />
unbedenklich.<br />
MESSEN UND TAGUNGEN<br />
3. Praxistag Wasserversorgungsnetze<br />
29.10.2013 in Essen; b.pflamm@vulkanverlag.de,<br />
www.praxistagwasserversorgungsnetze.de<br />
8. Deutsches Symposium für grabenlose Leitungserneuerung<br />
05./06.11.2013 mit Fachausstellung; sgl@unisiegen.de,<br />
www.sgl.uni-siegen.<br />
de<br />
ROHRBAU Weimar<br />
18.-19.11.2013 in Weimar; IAB Weimar,<br />
rohrbau@fitr.de, www.iabweimar.de<br />
TÜV NORD Pipeline Symposium<br />
18.-19.11.2013 in Hamburg; c.jakubzig@<br />
tuev-nord.de, www.tuev-nord.<br />
de/weiterbildung/seminare/<br />
Pipeline-Symposium-2013<br />
DWA-Inspektions- und Sanierungstage<br />
11.-12.12.2013 in Dortmund; www.dwa.de<br />
Tiefbaumesse InfraTech<br />
15.-17.01.2014 in Essen; www.infratech.de/de<br />
Tagung Rohrleitungsbau<br />
21./22.01.2014 in Berlin; borkes@rbv-gmbh.<br />
de, www.brbv.de<br />
28. Oldenburger Rohrleitungsforum<br />
06./07.02.2014 info@iro-online.de, www.iroonline.de<br />
GEOTHERM 2014<br />
20./21.02.2014 in Offenburg; geotherm@<br />
messe-offenburg.de, www.<br />
geotherm-offenburg.de<br />
14. Göttinger Abwassertage<br />
25.-26.02.2014 in Göttingen; www.tahannover.de<br />
Tube 2014<br />
07.-11.04.2014 in Düsseldorf; www.tube.de<br />
IFAT 2014<br />
05.-09.05.2013 in München; info@ifat.de,<br />
www.ifat.de<br />
10 | 2013 19
NACHRICHTEN VERANSTALTUNGEN<br />
erforderlichen Sanierungsmaßnahmen im Kanalnetz sinken<br />
die Investitionen für nachträgliche Abwärmenutzung auf ein<br />
attraktives Niveau.<br />
Foto: www.netzbewirtschaftung.de<br />
Bild 2: Knapp 300 Teilnehmer kamen zum 1. Deutschen Kanalnetzbewirtschaftungstag<br />
am 6. Juni 2013 in Geisingen – darunter auch Fachleute aus<br />
Deutschland, Frankreich, Spanien, Belgien, Portugal und USA<br />
Wirtschaftlich sinnvolle Netzerneuerung<br />
In der Publikation „Branchenbild der deutschen Wasserwirtschaft<br />
2011“ stellen die Verfasser unter der Überschrift Netzerneuerung<br />
fest: „Trinkwasser- und Abwassernetze haben<br />
eine Lebensdauer von bis zu 100 Jahren. Dies bedeutet, dass<br />
die kontinuierliche Instandhaltung und Erneuerung der Netze<br />
eine Daueraufgabe ist. Die technisch und wirtschaftlich<br />
sinnvolle Netzerneuerungsrate muss jedes Unternehmen unter<br />
Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten wie z. B.<br />
Rohrnetzmaterial, Netzalter, Schadensraten, Leckagen ermitteln“.<br />
Ca. 31 % der vorhandenen Abwasserkanäle wurden in den<br />
letzten 25 Jahren gebaut, 39 % sind zwischen 25 und 50<br />
Jahren alt. Etwa 70 % der Abwasserkanäle sind demnach<br />
jünger als 50 Jahre. Die mittleren Kosten für die Kanalsanierung,<br />
ermittelt aus den Kostenangaben für Reparatur-, Renovierungs-<br />
und Erneuerungsmaßnahmen, lagen im Zeitraum<br />
von 2004 bis 2008 bei rund 908 € je Meter instand gesetzten<br />
Kanals. Im Mittel sind Investitionen in der Größenordnung<br />
von 8.000 € pro Jahr und Kilometer Kanalnetz von den Betreibern<br />
vorgesehen. Für eine Großstadt mit einem Kanalnetz<br />
von 2.000 km Länge entspricht dies einer Investition von 16<br />
Mio. € pro Jahr (Quelle: DWA-Umfrage 2009).<br />
Kanal als Nahwärmenetz?<br />
Sehen wir Kanalnetzbewirtschaftung unter dem Aspekt der<br />
Wirtschaftlichkeit, müssen wir auch das Potential der Wärmeenergie<br />
betrachten und diesen verborgenen Schatz heben, d.<br />
h. die verfügbare Energie in klingende Münze verwandeln.<br />
Dem Netzbetreiber fällt hier die entscheidende Rolle zu. Er<br />
kennt die besonders interessanten Stellen, wo stetig ein hoher<br />
Volumenstrom mit viel Wärme eingeleitet wird und diejenigen,<br />
bei denen diese Energie besonders effektiv als Abwärme,<br />
unter bestimmten Umständen sogar mit zusätzlicher<br />
Unterstützung durch staatliche Förderung, genutzt werden<br />
kann. Die optimale Betriebstemperatur der Kläranlage im<br />
Blick, kann die thermische Bewirtschaftung des Kanalnetzes<br />
eine lukrative Zusatzaufgabe sein. Im Zuge von ohnehin<br />
Kraftwerke, Industrie und Gewerbe könnten unter bestimmten<br />
Voraussetzungen darüber hinaus gezielt Abwärme in<br />
den Kanal abgeben, statt Flüsse und Atmosphäre damit zu<br />
belasten. Laut Univ.-Prof. Dr.-Ing. Karsten Körkemeyer von<br />
der Fakultät Baubetrieb und Bauwirtschaft der Universität<br />
Kaiserslautern ließen sich bei höherem Wärmepotential im<br />
Kanal und damit höheren Vorlauftemperaturen auch Wärmepumpen<br />
effektiver betreiben. Er plädierte im abschließenden<br />
Vortrag der Tagung in Geisingen dafür, die bauliche<br />
Sanierung zu kombinieren mit dem Einbau von Wärmetauschern<br />
und damit finanzielle Mittel effizient zu verwenden.<br />
Projekte zum Thema Nahwärmenetz Kanal sind derzeit in Lünen/NRW<br />
und im französischen Valenciennes/Nord-Pas-de-<br />
Calais beantragt bzw. in Planung. Bereits 2011 hat das Institut<br />
für Energiewirtschaft und Rationelle Energieanwendung<br />
(IER) der Universität Stuttgart eine Potential-Studie erstellt.<br />
Sie zeigt den Zusammenhang von Kläranlagen, geeigneten<br />
Abwasserkanälen, Industriegebieten und Gebieten mit hohem<br />
Wärmebedarf. Das Ergebnis zeigt, dass mit der vorhandenen<br />
Abwasserwärme in den Kanälen 8,9 % des deutschen<br />
Energiebedarfs für Raumwärme und Warmwasser gedeckt<br />
werden können. Durch die Einspeisung von Abwärme lässt<br />
sich das Potential für die Wärmeversorgung aus Abwasser<br />
um den Faktor 3 auf 28 % steigern. Es ist genügend Abwärme<br />
aus Kraftwerken und Industrieprozessen vorhanden, um<br />
das Potenzial zu decken. Die Studie schließt mit dem Hinweis,<br />
durch Abwärmenutzung blieben Wertschöpfung und<br />
Arbeitsplätze im eigenen Land. Wahrscheinlich bleiben sie<br />
sogar in der eigenen Kommune.<br />
Fazit<br />
Ziel könnte sein, so das Meinungsbild mehrerer Diskussionsrunden<br />
während der Veranstaltung in Geisingen, die hydraulische<br />
und die thermische Bewirtschaftung langfristig als<br />
Kombination zu planen und zu organisieren. Wenn Zustand,<br />
Sanierungsbedarf, freie Kapazitäten des vorhandenen Netzes<br />
und geplante Entwicklung neuer Entwässerungsabschnitte<br />
bekannt sind sowie verfügbare Wärmepotentiale festgestellt<br />
werden, kann mit speziell dafür entwickelten Verfahren ein<br />
Vergleich der Wirtschaftlichkeit zwischen traditioneller Bauund<br />
Betriebsweise einerseits und moderner Netzbewirtschaftung<br />
andererseits angestellt werden.<br />
Mehr zum 1. Deutschen Kanalnetzbewirtschaftungstags<br />
am 6. Juni 2013 in Verbindung mit dem Fachkongress<br />
Kanalsanierung / Energie aus Abwasser<br />
ist zu finden unter www.netzbewirtschaftung.de<br />
KONTAKT: www.netzbewirtschaftung.de, Dipl.-Ing. Klaus W. König,<br />
www.klauswkoenig.com<br />
20 10 | 2013
VERANSTALTUNGEN NACHRICHTEN<br />
Branchentreff beim 2. Deutschen Reparaturtag<br />
Es war eine gelungene Veranstaltung, die mit ihren<br />
Themenschwerpunkten und ihren fundierten Vorträgen<br />
konsequent an das erfolgreiche Debüt im vergangenen<br />
Jahr anknüpfen konnte – so der Tenor unter den Teilnehmern<br />
am 2. Deutschen Reparaturtag in Kassel. Rund<br />
270 Netzbetreiber, Planer und Mitarbeiter ausführender<br />
Unternehmen waren der Einladung vom Verband Zertifizierter<br />
Sanierungsberater für Entwässerungssysteme<br />
e.V. (VSB) und der Technischen Akademie Hannover e.V.<br />
(TAH) gefolgt, um am 19. September im Kongress Palais<br />
Kassel „Erfahrungen über den Einsatz und Wirkung der<br />
Reparaturtechniken aus Sicht der Nutzer“ auszutauschen.<br />
Offen und neutral berichteten kommunale Netzbetreiber<br />
und Planer aus Ingenieurbüros, unter welchen Gesichtspunkten<br />
und mit welchem Ergebnis Reparaturverfahren<br />
wie Injektions-, Kurzliner-, Roboter-, Manschetten- und<br />
Flutungstechnik in ihren Kommunen eingesetzt wurden.<br />
Mögliche Entscheidungskriterien für die „Technikauswahl<br />
bei Planung und Ausführung“ stellten einen weiteren<br />
Programmschwerpunkt dar. Eine Podiumsdiskussion und<br />
eine begleitende Fachausstellung mit 40 Herstellern und<br />
Verbänden rundeten den 2. Deutschen Reparaturtag in<br />
Kassel ab.<br />
„Erstmal reparieren oder gleich richtig sanieren?“<br />
Diese Frage stellte Dipl.-Ing. Michael Hippe, Vorsitzender<br />
des Vorstands, VSB e. V. Sie macht die Spannbreite der<br />
seit Jahren geführten Diskussion deutlich. Immer noch<br />
haftet den Reparaturtechniken der zweifelhafte Charakter<br />
der so genannten Feuerwehrstrategie an: Schnell<br />
und billig reparieren und dann sehen, wie lange es hält.<br />
Aber repariert ist eben nicht gleich neu. Lohnt es sich<br />
unter diesem Aspekt überhaupt, Geld für eine Reparatur<br />
auszugeben? Hinzu kommt die Vielfalt an Verfahren<br />
und Techniken: Welches Verfahren ist denn das für mein<br />
Vorhaben geeignete – nicht zuletzt im Sinne einer nachhaltigen<br />
und wirtschaftlichen Kanalunterhaltung? Dass<br />
detaillierte Qualitätsanforderungen und Normungen nach<br />
wie vor fehlen, macht eine Entscheidung auch nicht unbedingt<br />
leichter, sondern sorgt für weiteren Informationsbedarf.<br />
Dieser wurde auf dem 2. Deutschen Reparaturtag<br />
nachhaltig befriedigt. Ausstellung, Vorträge und die von<br />
Prof. Dr.-Ing. Volker Wagner von der Hochschule Wismar<br />
moderierte Diskussion machten deutlich, dass sich der<br />
Reparaturbereich und die in den letzten Jahren entwickelten<br />
Verfahren weiter etablieren konnten. Reparaturverfahren<br />
sind nicht nur unverzichtbar bei Vorsanierungen<br />
oder Ergänzungsarbeiten für die Renovierungsverfahren,<br />
sie sind eine wirtschaftliche Alternative bei vielen Einzelschadensbildern<br />
und -situationen: So lautet folgerichtig<br />
das Fazit von Herstellern, ausführenden Unternehmen,<br />
Auftraggebern und Planern nach dem Erfahrungsaustausch<br />
in Kassel. Von entscheidender Bedeutung für den<br />
Erfolg ist allerdings der fach- und sachgerechte Umgang<br />
Die Teilnehmer an der Podiumsdiskussion waren sich einig, dass eine detaillierte<br />
Planung und Ausschreibung sowie eine konsequente Bauüberwachung und<br />
die Qualifikation der ausführenden Firma zu den Erfolgsbausteinen von<br />
Reparaturverfahren zählen (Quelle: TAH)<br />
mit dem gesamten Themenbereich – angefangen bei<br />
der Auswahl des Verfahrens über die detaillierte Ausschreibung<br />
bis hin zur Qualität der Ausführung und einer<br />
konsequenten Bauüberwachung.<br />
Generationsübergreifende Aufgaben<br />
Wie wichtig schlagkräftige Konzepte für den Erhalt unserer<br />
unterirdischen Infrastruktur sind, legte Dr.-Ing. Igor<br />
Borovsky von der Technischen Akademie Hannover zum<br />
Auftakt der Veranstaltung dar. Traditionsgemäß verwies<br />
er in seiner Begrüßungsansprache auf die letzte von der<br />
Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser<br />
und Abfall e.V. (DWA) durchgeführte Umfrage zum<br />
Zustand der Kanalisation. Die Ergebnisse verdeutlichen<br />
die Notwendigkeit, dem Thema Kanalsanierung mehr<br />
Aufmerksamkeit zu widmen. „Die Branche steht hier<br />
vor generationsübergreifenden Aufgaben“, erklärte der<br />
1. Vorsitzende der TAH mit Blick auf die Verantwortung,<br />
die wir für die Erhaltung eines der größten Sachwerte in<br />
Deutschland haben. Es gibt zwar eine Tendenz zu höheren<br />
Investitionen, von einer Verbesserung des Gesamtzustandes<br />
sind wir aber noch weit entfernt. Allerdings<br />
– auch das ein Ergebnis der Umfrage von 2009 – sind<br />
Reparaturverfahren auf dem Vormarsch. In konkreten<br />
Zahlen bedeutet dies, dass mehr als 36 % aller Sanierungsverfahren<br />
in 2009 mit Ausbesserungs-, Injektionsoder<br />
Abdichtungsverfahren ausgeführt wurden.<br />
Positive Bilanz<br />
Hierbei stehen dem Markt mittlerweile vielfältige, allerdings<br />
auch sehr unterschiedliche Verfahren zur Verfügung.<br />
Die gängigsten Verfahren und der Stand der<br />
Technik waren Gegenstand des ersten Vortragsblocks<br />
10 | 2013 21
NACHRICHTEN VERANSTALTUNGEN<br />
in Kassel. Dr.-Ing. Joachim Beyert berichtete über seine<br />
Erfahrungen mit Injektionsverfahren, eine Technik, „ohne<br />
deren Einsatz kein größeres Wasserbauwerk vorstellbar<br />
wäre“, so der Referent von der RWTH Aachen. Mit Injektionen<br />
lassen sich undichte Rohrverbindungen, schadhafte<br />
Stutzen, Risse, fehlende Wandungsteile und Scherbenbrüche<br />
reparieren. Entweder werden Schadstellen im<br />
Bauwerk oder Boden und Hohlräume verfüllt, wobei<br />
eine unbegrenzte Injektionsmenge sowie die Möglichkeit<br />
zur Steuerung und Kontrolle von Injektionsdruck<br />
und -menge zu den charakteristischen Merkmalen dieser<br />
Technik gehören. Nach der Vorstellung der gängigsten<br />
Verfahren und Materialien fällte Beyert in Bezug auf die<br />
Bewertung der Nutzungsdauer ein positives Urteil: „Die<br />
Beständigkeit der Werkstoffe Kunstharz und Zementmörtel<br />
seien gut, das Ausführungsrisiko eher gering und<br />
Wirkprinzip und Abnutzungsvorrat äußerst gut“, so die<br />
Bilanz von Beyert, der gleichzeitig darauf hinwies, dass<br />
der erfolgreiche Einsatz der Injektionstechnik von Faktoren<br />
wie einer eingehenden Werkstoffüberwachung und<br />
einer Kontrolle der Ausführung abhängt.<br />
Reparieren, renovieren, erneuern<br />
Auf eine hochwertige Ausführungsqualität setzt man<br />
auch in Köln. Laut Dipl.-Ing. Marius Korczak, Stadtentwässerungsbetriebe<br />
Köln, AöR, hat die Kurzlinertechnik<br />
einen Anteil von knapp 12 % an den eingesetzten Reparaturtechniken<br />
im Nennweitenbereich < DN 1200. Erklärtes<br />
Ziel ist eine technisch und wirtschaftlich optimierte<br />
schnellstmögliche Beseitigung der vorgefundenen Schäden<br />
unter besonderer Berücksichtigung der finanziellen<br />
Bereitstellung, der Umsatzkapazitäten und der genehmigten<br />
wasserwirtschaftlichen und netzspezifischen<br />
Randbedingungen. „Dabei können die Bautätigkeiten<br />
in den einzelnen Stadtteilen vor Ort mit der gestuften<br />
Reihenfolge der Sanierungsverfahren nach Reparatur<br />
geschlossen und offen, Renovierung sowie Erneuerung<br />
verkehrsrechtlich und betrieblich gut koordiniert werden“,<br />
führte der Redner aus. Mit dem Einsatz von Kurzlinersystemen<br />
hat man in Köln dabei gute Erfahrungen gemacht.<br />
Sie werden insbesondere im Nennweitenbereich von<br />
DN 150 bis DN 600 eingesetzt, um punktuelle Schäden<br />
wie zum Beispiel Radialrisse und bedingt Streckenschäden<br />
aufgrund von leichteren Strukturschäden zu beseitigen,<br />
wobei für Korczak der erfolgreiche Einsatz des Produktes<br />
von einer detaillierten Beschreibung der Anforderungen<br />
und der Qualitätssicherung auf der Baustelle abhängig ist.<br />
Rahmenbedingungen wichtig<br />
Für Dipl.-Ing. Meike Rau von KASSELWASSER kommt es<br />
auch bei den so genannten Spachtel- und Verpressverfahren<br />
auf die Rahmenbedingungen an. „Zum Beispiel<br />
auf den Einsatz der Blasentechnik, mit deren Anwendung<br />
der Erfolg der Reparaturmaßnahme steht und fällt.“ So<br />
schilderte die Referentin von Anwendungsgrenzen der<br />
Verfahren, etwa wenn sich die Blase nicht positionieren<br />
lässt oder der zu reparierende Kanalabschnitt ein<br />
zu großes Gefälle aufweist bzw. Scherbenbildung und<br />
Risse zu ausgeprägt oder verzweigt sind. Gleiches gilt für<br />
schadhafte Rohrverbindungen mit zu großen vertikalen<br />
Lageversätzen. Ein bis zwei Roboterprojekte werden pro<br />
Jahr in Kassel ausgeschrieben, wobei es Vorgaben aus<br />
der „Zusätzlichen technischen Vertragsbedingung KAS-<br />
SELWASSER“ zu Robotersystem, Material, Ausführung,<br />
Qualitätssicherung und Dokumentation zu beachten gilt.<br />
Von der Vielfältigkeit bei den Typen von Innenmanschetten<br />
berichtete Dipl.-Ing. (FH) Walter Widdenhöfer, Stadt<br />
Bergisch Gladbach. Neben Elastomerprofilen, die mit<br />
Spannringen im Kanal fixiert werden, gibt es Edelstahlhülsen,<br />
die mittels Elastomeren bzw. mittels Reaktionsharzen<br />
mit der Kanalwandung abgedichtet werden sowie Innenmanschetten<br />
aus PVC mit PE-Schaumdichtung oder Stahl<br />
mit PU-Schaumdichtung. Deren Einsatz richtet sich – so<br />
Widdenhöfer – u. a. nach der Nennweite der beschädigten<br />
Leitung sowie nach der Rohrgeometrie. Bei Schäden<br />
wie Radial-, Quer- und Längsrissen, Scherbenbildung,<br />
Löchern, undichten Rohrverbindungen und Infiltration hat<br />
man in Bergisch Gladbach mit Innenmanschetten gute<br />
Erfahrung gemacht, zumeist bei Kreisprofilen. Zu den<br />
Vorteilen zählen für Widdenhöfer eine kurze Einbauzeit<br />
sowie die Anwenderfreundlichkeit und Einfachheit des<br />
Verfahrens.<br />
Erfahrung unabdingbar<br />
Verzweigte Grundleitungen ab einer Nennweite von DN<br />
100 sind das Einsatzgebiet für Flutungsverfahren. Laut<br />
Dipl.-Ing. (FH) Wilfried Günzel, Ingenieurbüro für Kanalinstandhaltung,<br />
Lage, wird es seit Anfang der 1990er Jahre<br />
in der Kanalsanierung eingesetzt. Es handelt sich um ein<br />
reines Abdichtungsverfahren, das die statische Tragfähigkeit<br />
des Kanals nicht wieder herstellen kann. Die Anwendung<br />
erfolgt in engen Grenzen gemäß der jeweiligen<br />
DIBt-Zulassungen bzw. Verfahrenshandbücher. „Die Ausführung<br />
sollte nur durch erfahrene Fachfirmen erfolgen“,<br />
so der Rat Günzels, „wobei es sich für den Auftraggeber<br />
empfiehlt, einen Verfahrenstechniker des jeweiligen Systemanbieters<br />
für die Baustelle heranzuziehen.“<br />
Ähnliches gilt für die Reparatur begehbarer Kanäle und<br />
Schächte, wobei die Begehung des zu reparierenden<br />
Abschnitts, die Festlegung von Reparaturziel und Qualitätskriterien,<br />
die Herstellung der Abwasserfreiheit, eine<br />
gründliche Reinigung bzw. Untergrundvorbereitung, die<br />
regelmäßige Kontrolle vor Ort und die Überprüfung von<br />
Reparaturzielen und Qualitätskriterien für Sven Lietzmann<br />
von der Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH zu den<br />
Voraussetzungen einer erfolgreichen Reparatur zählen.<br />
Insbesondere berichtete der Referent von praktischen<br />
Erfahrungen bei der Wiederherstellung oder Verbesserung<br />
der statischen Tragfähigkeit, der Wiederherstellung<br />
der Dichtheit, der Erhöhung der Widerstandsfähigkeit<br />
gegen Korrosion und Abrieb, den Ersatz von durch Verschleiß<br />
abgetragenem Material und die Verbesserung<br />
der hydraulischen Eigenschaften. „Die Reparatur von<br />
gemauerten Kanälen ist eine sinnvolle Alternative bei<br />
22 10 | 2013
VERANSTALTUNGEN NACHRICHTEN<br />
beschränkt zugänglichen Örtlichkeiten und wenn das<br />
Schadensbild vor Ort geprüft und das Reparaturziel klar<br />
ist“, lautet das Fazit von Lietzmann, für den eine qualifizierte<br />
und erfahrene Firma, eine fach- und sachgerechte<br />
Untergrundvorbereitung sowie die regelmäßige Kontrolle<br />
während der Arbeiten ebenso wie für seine Vorredner<br />
Voraussetzung für ein gutes Reparaturergebnis sind.<br />
Planung, Ausschreibung und Qualifikation das A und O<br />
Neben der Bausubstanz und den baulichen Rahmenbedingungen<br />
zählen in erster Linie eine detaillierte Planung<br />
und Ausschreibung sowie eine konsequente Bauüberwachung<br />
und die Qualifikation der ausführenden Firma<br />
zu den Erfolgsbausteinen von Reparaturverfahren. Eine<br />
Einschätzung, die sich wie ein roter Faden durch den<br />
Vortragsblock dieser Veranstaltung zog. Hinzu kommen<br />
planerische Aspekte, die bei der Auswahl der geeigneten<br />
Reparaturtechnik von entscheidender Bedeutung sind.<br />
Eine Standardsanierungstechnik gibt es nicht – hierin<br />
bestand in Kassel Konsens. Folgerichtig auch das Statement<br />
von Dipl.-Ing. (FH) Markus Vogel, VOGEL Ingenieure,<br />
Kappelrodeck, der in seinem Vortrag die Sicht des Planers<br />
darstellte. „Die Qualität des Sanierungsergebnisses steht<br />
im direkten Zusammenhang mit der Qualität und der<br />
Weitsicht der Planung. Hinzu kommt, dass kein Unternehmen<br />
über alle geeigneten und bewährten Reparaturverfahren<br />
und Einzeltechniken verfügt“, so Vogel, der<br />
maßgeblich an der Konzeption der Veranstaltungsreihe<br />
beteiligt war.<br />
Innerhalb der Verfahrensgruppen gibt es teils signifikante<br />
Unterschiede zwischen Einzeltechniken, z. B. hinsichtlich<br />
des gerätetechnischen Aufbaus und der Systemkomponenten,<br />
der Grundmaterialien und Materialkombinationen,<br />
der schadensbildbezogenen Einsatzmöglichkeiten (Art<br />
und Ausdehnung), der Einsatzgrenzen (Zugänglichkeit<br />
und Ausführungssicherheit), der Abhängigkeit von örtlichen<br />
Randbedingungen. „Deshalb ist eine dezidierte<br />
Technikauswahl je Schadensbild und örtlicher Situation<br />
durch Planer von Nöten“, so Vogel weiter. „Parameter wie<br />
Aufgabe, Technik, Nutzung und Kosten-Nutzen-Relation<br />
sind bei der Technikauswahl zu beachten.“<br />
Erfahrungswerte schaffen<br />
Hieraus lassen sich für den Planer verschiedene Erkenntnisse<br />
ableiten. Der funktionale Nutzen ist das prioritäre<br />
Ziel der Sanierung. Wobei die optische Erscheinung des<br />
Ergebnisses grundsätzlich von nachrangiger Bedeutung<br />
ist, denn die Qualität von Prospektfotos ist in der Realität<br />
kaum erreichbar. Auch die Rückkoppelung der Sanierungsergebnisse<br />
ist für den Planer enorm wichtig. „Der<br />
Abgleich von Ergebnis und Planung verschafft Erfahrungswerte<br />
und die Erfahrungswerte schaffen Sicherheit<br />
bei der Technikzuweisung“, ist Vogel überzeugt.<br />
Schlechte Sanierungsergebnisse haben in der Regel eine<br />
hohe Korrelation zur Qualität der Planung oder Bauüberwachung,<br />
sieht der erfahrene Ingenieur die Auftraggeber<br />
in der Verantwortung.<br />
Und Qualität hat letztendlich ihren Preis. So jedenfalls<br />
lautete das Fazit des ursprünglich von Dr.-Ing. Robert<br />
Stein, S & P Consult GmbH, Bochum, geplanten Vortrags<br />
zum Thema „Entscheidungskriterien zur Auswahl von<br />
Reparaturverfahren auf Basis einer Risikoanalyse“. Da<br />
der Referent seine Teilnahme kurzfristig absagen musste,<br />
übernahm Markus Vogel die Aufgabe, die ersten Arbeitsergebnisse<br />
der Arbeitsgemeinschaft LEWEKA vorzustellen.<br />
Die ARGE – die zwischenzeitlich in einem neuen Fachausschuss<br />
des VSB e.V. aufgegangen ist – beschäftigt sich<br />
mit empirischen, ingenieurtechnischen Überlegungen zur<br />
Quantifizierung von potenziellen Risikofaktoren, die die<br />
Nutzungsdauer von Kanalsanierungsarbeiten beeinflussen.<br />
Die in der Arbeitsgruppe erarbeiteten Überlegungen<br />
sollen vor Veröffentlichung den Technikherstellern und<br />
Anwendern zur Diskussion gestellt werden, um im besten<br />
Falle eine breite Trägerschaft der Ergebnisse erreichen<br />
zu können.<br />
Stark verzahnt<br />
Dass Planung und Ausschreibung sehr stark miteinander<br />
verzahnt sind, bestätigte M. Eng. Markus Dohmann, Stadt<br />
Backnang, in seinem abschließenden Vortrag über die<br />
„Art der Ausschreibung von Reparaturarbeiten“. Anhand<br />
von Ausschreibungen für eine Stutzensanierung und Fräsarbeiten<br />
machte der Redner deutlich, dass bereits weit vor<br />
der Ausführung die Weichen zu stellen sind, wenn man<br />
ein qualitativ hochwertiges Sanierungsergebnis erhalten<br />
möchte. „Da während bzw. nach der Bauausführung<br />
nur das überprüft oder eingefordert werden kann, was<br />
zuvor in der Ausschreibung detailliert beschrieben wurde,<br />
schreiben Sie nur Leistungen aus, die realistisch umsetzbar<br />
sind“, so Dohmanns Appell ans Auditorium.<br />
Die Beispiele aus der Praxis machten eines deutlich: Egal,<br />
wer draußen arbeitet, jemand muss ihm sagen, was zu<br />
machen ist. Vielleicht ist das die wichtigste Erkenntnis, die<br />
die Teilnehmer am 2. Deutschen Reparaturtag mit nach<br />
Hause genommen haben. Darüber hinaus wurden Antworten<br />
auf viele Fragen gegeben. Wie ist der Stand der<br />
Technik bei den verschiedenen Reparaturverfahren? Wie<br />
kommt die richtige Technik bezüglich des Schadensbildes,<br />
der Rahmenbedingungen und in Bezug auf den Erfolg<br />
einer Sanierungsmaßnahme auf die richtige Baustelle?<br />
Die, die in Kassel dabei waren, haben mit ihrem Interesse<br />
und ihrem Engagement wesentlichen Anteil daran,<br />
dass ein für die Sanierungsbranche wichtiges Thema die<br />
notwendige Wertschätzung erfährt. Die neutrale und<br />
offene Diskussion trägt entscheidend dazu bei, weitere<br />
Entwicklungen anzustoßen und Impulse zu setzen. Nicht<br />
nur in technischer Hinsicht, sondern auch mit Blick auf<br />
die Schaffung von klaren Regelungen und Normen, wie<br />
sie bei anderen Verfahren bereits Standard sind. In diesem<br />
Sinne bleibt abzuwarten, was sich in den nächsten<br />
Monaten tut. Für genügend Gesprächsstoff auf dem 3.<br />
Deutschen Reparaturtag ist jedenfalls gesorgt.<br />
KONTAKT: www.reparaturtag.de<br />
10 | 2013 23
FACHBERICHT RECHT & REGELWERK<br />
Die neue HOAI 2013 - Änderungen und<br />
Auswirkungen auf die Honorare in der<br />
Kanalsanierung<br />
Die HOAI 2013 gilt seit dem 17.07.2013. Mit der Wiedereinführung der mitzuverarbeitenden Bausubstanz und dem<br />
Wesentlichkeitskriterium beim Umbau ändert sich auch die Honorarermittlung bei der Kanalsanierungsplanung. Für die<br />
Berücksichtigung der mitzuverarbeitenden Bausubstanz und des Umbauzuschlages muss auch zukünftig zwischen den<br />
Sanierungsverfahren unterschieden werden. Der Leistungsumfang wurde insbesondere mit einer verstärkten Kostenund<br />
Terminkontrolle erweitert. Die Bedarfsplanung des Auftraggebers als Grundlage der Objektplanung wurde deutlich<br />
aufgewertet. Mit einer Erhöhung der Tafelwerte von im Mittel 17 % gegenüber denen der HOAI 2009 werden zukünftig<br />
auskömmlichere Honorare zu erzielen sein.<br />
1. DIE NEUE HOAI 2013<br />
Seit 17.07.2013 gilt die HOAI 2013 [1]. Die Gliederung der<br />
HOAI 2009 wurde auch bei der HOAI 2013 beibehalten,<br />
lediglich die Anlagenstruktur wurde geändert. Für die<br />
Kanalsanierung sind die folgenden Teile, Abschnitte und<br />
Anlagen der HOAI 2013 maßgebend:<br />
»»<br />
Teil 1 – Allgemeine Vorschriften<br />
»»<br />
Teil 3 – Objektplanung, Abschnitt 3<br />
Ingenieurbauwerke<br />
»»<br />
Anlage 12.1 – Leistungsbild Ingenieurbauwerke<br />
»»<br />
Anlage 12.2 – Objektliste Ingenieurbauwerke<br />
Die folgenden Abschnitte erläutern die für die Kanalsanierung<br />
wichtigen Neuerungen der HOAI 2013.<br />
2. ÄNDERUNGEN IN TEIL 1 – ALLGEMEINE<br />
VORSCHRIFTEN<br />
§ 10 Abs. 1 HOAI 2013 – Änderung Leistungsumfang<br />
bei geänderten anrechenbaren Kosten<br />
Der neue § 10 HOAI 2013 fasst nun zentral alle Leistungsänderungen<br />
zusammen. Dafür entfallen die §§ 3 Abs. 2,<br />
7 Abs. 5 und 10 HOAI 2009.<br />
Neu ist in § 10 Abs. 1 und 2 HOAI 2013, dass sich jetzt<br />
Auftraggeber und Auftragnehmer über die Änderung<br />
des Umfangs der Leistungen einigen müssen.<br />
Mit der Formulierung „Einigung“ ist jedoch keine Weisungsbefugnis<br />
des Auftraggebers verbunden. Es besteht<br />
hier nicht die rechtliche Verpflichtung des Auftragnehmers<br />
ein neues Vertragsverhältnis zu vereinbaren. D. h.<br />
ohne Einigung keine Leistungspflicht des Auftragnehmers.<br />
Einigen sich hingegen Auftraggeber und Auftragnehmer<br />
auf eine Änderung des Leistungsumfangs mit<br />
der Folge, dass sich auch die anrechenbaren Kosten<br />
ändern, muss gem. § 10 Abs. 1 HOAI 2013 die Honorarberechnungsgrundlage<br />
angepasst und schriftlich<br />
vereinbart werden.<br />
§ 10 Abs. 2 HOAI 2013 – Wiederholung von<br />
Grundleistungen<br />
Die HOAI 2013 definiert mit dem § 10 Abs. 2 HOAI 2013<br />
zum ersten Mal überhaupt, dass Planungsänderungen wiederholte<br />
Grundleistungen darstellen und als solche auch<br />
zu vergüten sind. Dies kann sowohl ganze Leistungsphasen<br />
als auch nur Teilleistungen umfassen. So ist jetzt die<br />
Änderung der Ausführungsplanung eine Wiederholung von<br />
Grundleistungen der Leistungsphase 5. Eine Vergütung der<br />
Änderung der Ausführungsplanung nach anderen Abrechnungsvereinbarungen,<br />
wie z. B. nach Stundenansätzen, ist<br />
damit nicht mehr konform zur HOAI.<br />
§ 11 Abs. 1 HOAI 2013 – Objektweise Abrechnung<br />
bei Auftrag über mehrere Objekte<br />
Der bisherige § 11 HOAI 2009 wurde mit der Neufassung in<br />
der HOAI 2013 neu strukturiert. Der § 11 Abs. 1 HOAI 2013<br />
besteht jetzt nur noch aus einem Satz und gibt den Regelfall<br />
der objektweisen Abrechnung bei mehreren Objekten<br />
in einem Auftrag vor. Getrennte Objekte liegen dann vor,<br />
wenn jedes seine bestimmungsgemäße Funktion eigenständig<br />
erfüllen kann.<br />
§ 11 Abs. 2 HOAI 2013 – Zusammengefasste Abrechnung<br />
bei Auftrag über mehrere Objekte<br />
Der neu formulierte § 11 Abs. 2 HOAI 2013 ersetzt die<br />
schwer verständlichen §§ 11 Abs. 1 Satz 2 und 11 Abs. 2<br />
HOAI 2009.<br />
Dieser gilt nun für vergleichbare Objekte mit gleicher<br />
Gründung, baulicher Gestaltung und Nutzung sowie derselben<br />
Honorarzone, die als Teil einer Gesamtmaßnahme<br />
geplant und errichtet werden. Liegen diese Bedingungen<br />
vor, sind die anrechenbaren Kosten zu addieren.<br />
Dies könnte z. B. auch bei der Kanalsanierung eines Stadtteils<br />
zutreffen, die im Rahmen einer Gesamtmaßnahme<br />
geplant und ausgeführt werden würde. Der zeitliche und<br />
örtliche Zusammenhang ist jedoch immer einzelfallbezogen<br />
zu prüfen.<br />
24 10 | 2013
RECHT & REGELWERK FACHBERICHT<br />
3. ÄNDERUNGEN IN TEIL 1 – ALLGEMEINE<br />
VORSCHRIFTEN – PLANEN UND BAUEN IM<br />
BESTAND<br />
§ 2 Abs. 5 HOAI 2013 – Umbauten<br />
Gemäß Verordnungsbegründung zu § 4 Abs. 3 HOAI 2013<br />
hatte sich die Umbauregelung der HOAI 2009 in der Praxis<br />
nicht bewährt. Daher erfolgte eine Rückführung der<br />
Regelungen der HOAI 1996/2002. In § 2 Abs. 5 HOAI 2013<br />
wurde deshalb wieder das Wesentlichkeitskriterium eingeführt.<br />
Demnach sind Planungsleistungen nur als Umbau einzuordnen,<br />
sofern das Objekt umgestaltet wird und dabei ein<br />
wesentlicher Eingriff in Konstruktion oder Bestand erfolgt.<br />
Soweit in der Kanalsanierungsplanung eine Umgestaltung<br />
mit wesentlichen Eingriffen in den bestehenden Kanal<br />
erfolgt, ist die Planung als Umbau einzuordnen. Das trifft<br />
in der Regel dann zu, wenn bestehenbleibende Bauteile<br />
des zu sanierenden Kanals zusammen mit neuen Bauteilen<br />
nach der Sanierung insgesamt ein neues Bauwerk „Kanal“<br />
bilden. Das trifft bei Renovierungsverfahren, die in Verbindung<br />
mit dem Altrohr ein neues dichtes und standsicheres<br />
Kanalbauwerk ergeben, in der Regel zu. Reparaturverfahren<br />
ohne planerische Umgestaltung der vorhandenen Substanz<br />
sind hingegen nicht als Umbauten einzuordnen.<br />
§ 2 Abs. 7 HOAI 2013 – Mitzuverarbeitende<br />
Bausubstanz<br />
Mit der Wiedereinführung des Wesentlichkeitskriteriums<br />
beim Umbau wurde<br />
auch die Mitzuverarbeitende Bausubstanz<br />
wieder eingeführt.<br />
Kanalsanierungsmaßnahmen sind<br />
immer Planungs- und Bauleistungen im<br />
Bestand. Dementsprechend kann Mitzuverarbeitende<br />
Bausubstanz, sofern diese<br />
durch Planungs- oder Überwachungsleistungen<br />
technisch mitverarbeitet wird,<br />
bei Kanalsanierungsplanungen dem<br />
Grunde nach immer angesetzt werden.<br />
Hierbei ist jedoch die technische Mitverarbeitung<br />
im Rahmen der Planung/Bauüberwachung<br />
als Abgrenzungskriterium<br />
für deren Berücksichtigung/Nichtberücksichtigung<br />
näher zu betrachten.<br />
Sanierungsverfahren für die Beseitigung<br />
örtlicher begrenzter Schäden, also<br />
i. d. R. Reparaturverfahren, „bearbeiten“<br />
nur die vorhandene Bausubstanz. Der<br />
Sollzustand soll dabei wiederhergestellt<br />
werden. Die vorhandene Bausubstanz<br />
wird dabei nicht technisch umgestaltet<br />
oder verändert. Folglich kann Mitzuverarbeitende<br />
Bausubstanz bei Reparaturverfahren<br />
grundsätzlich nicht berücksichtigt<br />
werden.<br />
Bei Sanierungsverfahren, die jedoch<br />
eine nachhaltige Gebrauchswerterhöhung<br />
und eine Verlängerung der Nutzungsdauer zum Ziel<br />
haben, wird hingegen die vorhandene Kanalsubstanz als<br />
ein Bestandteil des neuen Bauwerks technisch mitverarbeitet.<br />
Zusammen mit neuem Material wird die vorhandene<br />
Bausubstanz zu einem neuen Kanalbauwerk umgestaltet.<br />
Dies ist i. d. R. bei Renovierungsverfahren gegeben. Entsprechend<br />
ist Mitzuverarbeitende Bausubstanz bei Renovierungsverfahren<br />
meist zu berücksichtigen.<br />
§ 4 Abs. 3 HOAI 2013 – Berücksichtigung der Mitzuverarbeitenden<br />
Bausubstanz<br />
Nach § 4 Abs. 3 HOAI 2013 muss die Mitzuverarbeitende<br />
Bausubstanz zum Zeitpunkt der Kostenberechnung schriftlich<br />
vereinbart werden. Das ist insofern nachvollziehbar, da<br />
erst am Ende der Leistungsphase 3 der genaue Umfang<br />
der Mitzuverarbeitenden Bausubstanz bekannt ist.<br />
Der Wert der Mitzuverarbeitenden Bausubstanz ist gem.<br />
Ziffer 3.3.6 der DIN 276-1:2008-12 [2] in den betreffenden<br />
Kostengruppen auszuweisen und damit in die Kostenschätzung<br />
und Kostenberechnung aufzunehmen. Deren<br />
Wert ist bspw. mit den Parametern Fläche, Volumen oder<br />
als Bauteile oder Kostenanteile mit ortsüblichen Preisen<br />
zu ermitteln. Gem. der bisherigen BGH-Rechtsprechung<br />
(BGH, 27.02.2003 – VII ZR 11/02) zu § 10 Abs. 3a HOAI<br />
10 | 2013 25
FACHBERICHT RECHT & REGELWERK<br />
1996/2002 ist die Mitzuverarbeitende Bausubstanz mit<br />
einem Wertfaktor (< 1) aufgrund von Beeinträchtigungen/Schäden<br />
und einem Leistungsfaktor (< 1) für die<br />
Mitverarbeitung in den einzelnen Leistungsphasen zu<br />
beaufschlagen.<br />
§ 6 Abs. 2 HOAI 2013 – Umbauzuschlag<br />
Sofern eine Umbaumaßnahme vorliegt, regelt nun § 6 Abs. 2<br />
HOAI 2013 die Vereinbarung des Umbauzuschlages dem Grunde<br />
nach. Die Höhe des Umbauzuschlages wird in den Honorarregelungen<br />
der Leistungsbilder der Teile 3 und 4 geregelt.<br />
Sofern keine schriftliche Vereinbarung über den Umbauzuschlag<br />
erfolgt, gilt im Leistungsbild Ingenieurbauwerke nun<br />
erst ab Honorarzone III ein Zuschlag von 20 %. Diese Regelung<br />
stellt keinen Mindestumbauzuschlag, sondern eine Auffangregelung<br />
dar.<br />
§ 12 Abs. 2 HOAI 2013 – Instandsetzungszuschlag<br />
Mit der Neufassung des § 36 Abs. 1 HOAI 2009 wird nun<br />
klargestellt, dass der Prozentsatz für die Leistungsphase 8<br />
(Objektüberwachung oder Bauoberleitung) um bis zu 50 %<br />
erhöht werden kann. Der Instandsetzungszuschlag gilt nicht<br />
für die Örtliche Bauüberwachung im Leistungsbild Ingenieurbauwerke,<br />
da deren Honorar in der HOAI 2013 weiterhin frei<br />
vereinbar bleibt.<br />
4. ÄNDERUNGEN IN ANLAGE 12.1 – LEISTUNGSBILD<br />
INGENIEURBAUWERKE<br />
Leistungsphase 1<br />
Die im zweiten Satzteil neu formulierte Teilleistung a) fordert<br />
nun Vorgaben oder eine Bedarfsplanung des Auftraggebers<br />
(bspw. nach DIN 18205:1996-04 [4]) vor Beginn der<br />
objektbezogenen Planung. Diese Untersuchungen sind nicht<br />
Bestandteil der Leistungsphase 1, siehe hierzu Kaufhold [5]. In<br />
der Kanalsanierung stellen Generalentwässerungsplanungen,<br />
die die baulichen und hydraulischen Defizite von Kanälen<br />
oder Kanalsystemen aufzeigen, die Bedarfplanung dar. Ohne<br />
Vorgaben oder einer Bedarfsplanung vom Auftraggeber ist<br />
der Auftragnehmer in seiner Leistungserbringung behindert.<br />
Statt § 3 Abs. 8 HOAI 2009 wurde nun jeweils in den Leistungsphasen<br />
1 bis 3 das „Zusammenfassen, Erläutern und<br />
Dokumentieren der Ergebnisse“ verordnet.<br />
Leistungsphase 2<br />
In der Teilleistung h) erfolgt beim Mitwirken der Erläuterung<br />
des Planungskonzeptes gegenüber Dritten erstmals eine<br />
Begrenzung auf bis zu zwei Termine. Mit „Dritten“ sind hier<br />
z. B. Stadtwerke, Versorgungsunternehmen oder Bürger<br />
gemeint.<br />
Leistungsphase 3<br />
Bereits in der Leistungsphase 3 sind jetzt die wesentlichen<br />
Bauphasen unter Beachtung von Verkehrslenkungsmaßnahmen<br />
und der Aufrechterhaltung des Betriebs zu ermitteln.<br />
Ebenso sind mit der Teilleistung i) nun Bauzeiten- und Kostenpläne<br />
zu erarbeiten.<br />
Leistungsphase 6<br />
Zukünftig sind mit der Teilleistung e) die Leistungsverzeichnisse<br />
zu verpreisen. Mit der Teilleistung f) sind die bepreisten<br />
Leistungsverzeichnisse mit der Kostenberechnung zu<br />
vergleichen.<br />
Leistungsphase 7<br />
Als weitere Kostenkontrolle sind im Rahmen der Teilleistung<br />
g) die Ausschreibungsergebnisse mit den bepreisten<br />
LV und der Kostenberechnung zu vergleichen.<br />
Leistungsphase 8<br />
Die letzte Leistung der Teilleistung a), das „Prüfen von Plänen“<br />
wurde nun auf ein einmaliges Prüfen im Rahmen der<br />
Grundleistung begrenzt. Mit „fachlich Beteiligten“ sind hier<br />
die anderen Planer gemeint, nicht Dritte.<br />
In der Teilleistung j) wurde die bisherige Teilleistung d) der<br />
Leistungsphase 9 der Anlage 12 HOAI 2009, das Zusammenstellen<br />
der Dokumentation der Maßnahme, nun in die<br />
Leistungsphase 8 vorgezogen.<br />
Das „Prüfen von Nachträgen“ ist nun wie die Örtliche Bauüberwachung<br />
eine Besondere Leistung der Leistungsphase 8.<br />
Leistungsphase 9<br />
In der Teilleistung a) der Leistungsphase 9 soll nun eine „fachliche<br />
Bewertung der festgestellten Mängel innerhalb der<br />
Verjährungsfristen“ erfolgen. Die Verordnungsbegründung<br />
führt hierzu aus, dass damit in erster Linie die Zuordnung<br />
des Mangels zu einem Bau- oder Planungsbeteiligten aus<br />
fachlicher Sicht sichergestellt werden soll. Eine Bewertung<br />
mit der Qualität und Ausführlichkeit eines Sachverständigengutachtens<br />
sei nicht Gegenstand dieser Grundleistung.<br />
Die Überwachung der Mängelbeseitigung wurde aus den<br />
Grundleistungen der Leistungsphase 9 in die Besonderen<br />
Leistungen verschoben. Damit ist das Honorar für diese Leistung<br />
frei vereinbar.<br />
§ 44 Abs. 1 HOAI 2013 – Änderungen Tafelwerte<br />
Die Erhöhungen der Tafelwerte im Leistungsbild Ingenieurbauwerke<br />
gegenüber den Tafelwerten der HOAI 2009 reichen<br />
von +4,13 % bis +34,06 %, siehe [6].<br />
§ 44 Abs. 6 HOAI 2013 – Umbauzuschlag<br />
Der Umbauzuschlag kann im Leistungsbild Ingenieurbauwerke<br />
bei Vorliegen der Honorarzone III mit bis zu 33 %<br />
vereinbart werden. Die Zuschlagshöhe bei Vorliegen der<br />
Honorarzonen I, II, IV und V ist nicht geregelt. Ein Mindestumbauzuschlag<br />
ist nicht verordnet, was so in der Verordnungsbegründung<br />
mehrfach erläutert wird.<br />
5. FAZIT<br />
Auch in der HOAI 2013 ist nur die objektbezogene Planung<br />
bei Kanalsanierungen verordnet. Die im Vorfeld dieser Planung<br />
durch den Auftraggeber zu erstellende Bedarfsplanung<br />
erfährt mit der Nennung in der Leistungsphase 1, Teilleistung<br />
a) eine deutliche Aufwertung als Grundlage der Objektplanung<br />
des Auftragnehmers.<br />
26 10 | 2013
RECHT & REGELWERK FACHBERICHT<br />
www.<strong>3R</strong>-Rohre.de<br />
Jetzt bestellen!<br />
Bei der wieder eingeführten Mitzuverarbeitenden Bausubstanz<br />
und auch beim Umbauzuschlag ist weiterhin zwischen<br />
den Sanierungsverfahren abzugrenzen: Nur bei Renovierungsverfahren<br />
wird die vorhandene Bausubstanz i. d. R.<br />
technisch mitverarbeitet und umgestaltet, was zu deren Anrechenbarkeit<br />
und zur Berücksichtigung des Umbauzuschlags<br />
führt. Bei Reparaturverfahren sind diese Voraussetzungen in<br />
der Regel nicht gegeben.<br />
Der Leistungsumfang wurde insbesondere mit einer verstärkten<br />
Kosten- und Terminkontrolle ab der Leistungsphase 2 und<br />
insbesondere in den Leistungsphasen 6 und 7 erweitert. Die<br />
Tafelwerte werden im Mittel um 17 % gegenüber denen der<br />
HOAI 2009 erhöht.<br />
LITERATUR<br />
[1] Bundesgesetzblatt Jahrgang 2013 Teil I Nr. 37, Seite 2276:<br />
Verordnung über die Honorare für Architekten- und<br />
Ingenieurleistungen (Honorarordnung für Architekten und<br />
Ingenieure – HOAI) vom 10. Juli 2013, Bonn, 16.07.2013<br />
[2] DIN 276-1:2008-12, DIN 276-4:2009-04: Kosten im Bauwesen, Teil<br />
1: Hochbau, Teil 4: Ingenieurbau, Deutsches Institut für Normung<br />
e. V., Berlin, 2008/2009<br />
[3] Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung:<br />
Evaluierung HOAI - Aktualisierung der Leistungsbilder -<br />
Abschlussbericht, 02.11.2011<br />
[4] DIN 18205:1996-04: Bedarfsplanung im Bauwesen, Deutsches<br />
Institut für Normung e. V., Berlin, 1996<br />
[5] Kaufhold, W.: Ingenieurleistungen und Honorare bei der<br />
Kanalsanierung, Heft Nr. H1 der Schriftenreihe der Gütestelle<br />
Honorar- und Vergaberecht e. V. (GHV), 4. Ausgabe, Stand<br />
03.08.2012<br />
[6] GWT, Technische Universität Dresden, Börgers Rechtsanwälte,<br />
Arch.- u. Ing.-Büro Dipl.-Ing. W. Kalusche, Siemon Sachverständige<br />
+ Ingenieure GmbH: Aktualisierungsbedarf zur Honorarstruktur der<br />
Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) – Studie im<br />
Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie,<br />
Dresden, Cottbus, Kassel, 12.201<br />
Sichere und effiziente<br />
Rohrleitungssysteme<br />
Nutzen Sie das Know-how der führenden Fachzeitschrift<br />
für die Entwicklung, den Einsatz und Betrieb von Rohrleitungen,<br />
Komponenten und Verfahren im Bereich der<br />
Gas- und Wasserversorgung, der Abwasserentsorgung,<br />
der Nah- und Fernwärmeversorgung, des Anlagenbaus<br />
und der Pipelinetechnik.<br />
Wählen Sie einfach das Bezugsangebot, das Ihnen zusagt:<br />
als Heft, ePaper oder Heft + ePaper!<br />
AUTOREN<br />
Dipl.-Ing. PETER KALTE<br />
Gütestelle Honorar- und Vergaberecht<br />
(GHV) gemeinnütziger e. V., Mannheim,<br />
Tel. +49 621 860 861-0<br />
E-Mail: kalte@ghv-guetestelle.de<br />
www.ghv-guetestelle.de<br />
Dipl.-Ing. ARNULF FELLER<br />
Gütestelle Honorar- und Vergaberecht<br />
(GHV) gemeinnütziger e. V., Mannheim,<br />
Tel. +49 621 860 861-0<br />
E-Mail: feller@ghv-guetestelle.de<br />
www.ghv-guetestelle.de<br />
<strong>3R</strong> erscheint in der Vulkan-Verlag GmbH, Huyssenallee 52-56, 45128 Essen<br />
10 | 2013 27
FACHBERICHT RECHT & REGELWERK<br />
Neue Technische Regeln für<br />
Steinzeugrohre DIN EN 295 – 2013<br />
Die Neuausgabe der DIN EN 295 Steinzeugrohrsysteme für Abwasserleitungen und -känale wurde am 1. Mai 2013 als<br />
europäische Norm in Deutschland veröffentlicht; die Umsetzung in nationale Normen der anderen europäischen Länder<br />
erfolgt zeitgleich. Die Überarbeitung der Normenreihe DIN EN 295 erfolgte komplett für alle sieben Teile (Tabelle 1).<br />
DIN EN 295 Teil 1<br />
DIN EN 295 Teil 2<br />
DIN EN 295 Teil 3<br />
DIN EN 295 Teil 4<br />
DIN EN 295 Teil 5<br />
DIN EN 295 Teil 6<br />
DIN EN 295 Teil 7<br />
Änderungen an Rohre, Formstücke und Verbindungen<br />
Bewertung der Konformität und Probenahme<br />
Prüfverfahren<br />
Tab. 1: Überarbeitete Normenreihe<br />
Anforderungen an Übergangs- und Anschlussbauteile und flexible Kupplungen<br />
Anforderungen an gelochte Rohre und Formstücke<br />
Anforderungen an Bauteile für Einstieg- und Inspektionsschächte<br />
Anforderungen an Rohre und Verbindungen für Rohrvertrieb<br />
DIN EN 295 Datum / Fristen Zeitpunkt<br />
Zeitbunkt der Verfügbarkeit<br />
DAV (date of availability)<br />
Zeitpunkt der spätesten Ankündigung<br />
DOA (date of latest announcement)<br />
Zeitpunkt der spätesten Veröffentlichung<br />
DOP (date of latest publication)<br />
Zeitpunkt der Zurückziehung der<br />
früheren Ausgabe<br />
DOW (date of withfrawal)<br />
Februar 2013 Februar 2013<br />
Der Teil 3 der DIN EN 295 „Prüfverfahren“ erschien bereits<br />
im März 2012, da er ausschließlich Prüfverfahren enthält<br />
und nicht unter das Mandat zur Erarbeitung europäischer<br />
harmonisierter Normen fällt. Die Gültigkeit wurde so geregelt,<br />
dass sie erst mit der Veröffentlichung aller anderen<br />
Teile beginnt.<br />
Derzeit ist noch ein technischer Bericht CEN/TR 16626<br />
„Steinzeugrohrsysteme für Abwasserleitungen und -kanäle<br />
– Leitfaden für Verfahren zur freiwilligen Fremdüberwachung“<br />
bei CEN in Bearbeitung und wird voraussichtlich<br />
Ende 2013/Anfang 2014 erscheinen. Die Angaben hierzu<br />
waren bislang in Teil 2 erschienen. Aufgrund europäischer<br />
Regeln mussten aus DIN EN 295 Teil 2 alle Verweise und<br />
Regelungen zur Fremdüberwachung herausgenommen werden.<br />
Diese werden nun mit gleichem Inhalt in einem eigenen<br />
europäischen technischen Bericht bei CEN veröffentlicht.<br />
Auch dieser Teil wird Teil des nationalen Normenwerks.<br />
Damit sind dann wieder für alle Hersteller zur freiwilligen<br />
Anwendung die Grundlagen zur Fremdüberwachung gegeben.<br />
Alle europäischen Steinzeugrohr-Hersteller haben diese<br />
Regelung mitgetragen und wenden diese auch an.<br />
Mit dieser Normenreihe steht Bauherren, Planern, Bauunternehmern<br />
und Herstellern nun ein aktuelles und komplettes<br />
Normenwerk zur Verfügung.<br />
Die Bearbeitung der Normenteile erfolgte im Technischen<br />
Komitee TC 165 „Abwassertechnik“ in der Arbeitsgruppe<br />
WG 2 (CEN TC 165/WG2).<br />
Zum Überblick der Stimmengewichte bei europäischen Normungen<br />
siehe Bild 1, zur Übersicht der Beteiligung an der<br />
„Gemeinschaftsaufgabe Normung“ siehe Bild 2 und zur<br />
„Normung und den Standards“ siehe Bild 3.<br />
Stand DIN<br />
Deutschland<br />
DAV + 3 Monate Mai 2013 Mai 2013<br />
DAV + 6 Monate<br />
6 Monate nach<br />
DOP<br />
Tab. 2: Veröffentlichung der DIN EN 295 durch CEN<br />
November<br />
2013<br />
Erledigt<br />
Mai 2014 Mai 2014<br />
DIE FRISTEN ZUR UMSETZUNG<br />
Für die Fristen zur Umsetzung der europäischen<br />
Normen (DIN EN 295) in nationale<br />
Normen (DIN EN 295) werden von<br />
CEN klare Regeln vorgegeben. Die Daten<br />
in Tabelle 2 beziehen sich auf die Veröffentlichung<br />
der DIN EN 295 durch CEN<br />
mit Datum von Februar 2013.<br />
Diese Fristen wirken sich auf die Rohrherstellung<br />
im Werk und den Einbau auf<br />
der Baustelle, aber insbesondere auf die<br />
Planung und Ausschreibung von Bauleistungen<br />
aus. Mit der Veröffentlichung der<br />
DIN EN 295 im Mai 2013 durch DIN ist<br />
klar, dass die neue Norm verfügbar ist,<br />
dass sie angewendet werden kann, und<br />
dass die Verwendung von Bauteilen nach<br />
dieser neuen Norm zu empfehlen ist.<br />
GRUNDSÄTZE ZUR<br />
STEINZEUG-NORM<br />
Steinzeugrohre und -formstücke für die<br />
offene und geschlossene Bauweise sind<br />
einschließlich der Rohrverbindungen in<br />
der DIN EN 295 genormt. Ein wesentlicher<br />
Grundsatz dieser Norm ist, dass<br />
keine Anforderung ohne die zugehörige<br />
Prüfung festgelegt ist, und dass für eine<br />
Vielzahl technischer Lieferbedingungen<br />
28 10 | 2013
RECHT & REGELWERK FACHBERICHT<br />
die Mindestanforderungen mit einer Öffnungsklausel für<br />
weitergehende Anforderungen versehen sind. Die Bearbeitung<br />
der Norm erfolgt grundsätzlich und konsequent<br />
in Zusammenarbeit mit den Anwendern.<br />
Europäische Normen sind im Wesentlichen dadurch gekennzeichnet,<br />
dass statt der Vorgabe von Einzelbestimmungen<br />
Anforderungen und Prüfungen festgelegt werden. Normen<br />
stellen in Form von Mindestanforderungen ein nicht zu<br />
unterschreitendes Anforderungsniveau dar.<br />
Ein wichtiger Bestandteil von Normen ist der Anwendungsbereich<br />
und der Verweis darauf, dass Auftraggeber/Kunden<br />
selbstverständlich eigene Anforderungen hinsichtlich der<br />
in der Norm enthaltenen unterschiedlichen Tragfähigkeitsklassen,<br />
Verbindungssysteme, Baulängen und Formstücke<br />
formulieren können. Europäische Normen können und müssen<br />
den gesamten europäischen Raum abdecken und sind<br />
daher mit der Bezugnahme auf einzelne, länderbezogene<br />
Anforderungen eingeschränkt. Deshalb müssen seitens<br />
der Anwender Entscheidungen hinsichtlich der speziellen<br />
technischen Anforderungen getroffen werden.<br />
ÄNDERUNGEN IN DER NEUAUSGABE 2013<br />
Werkstoff (Tabelle 3)<br />
Die Nachweise an den Werkstoff Steinzeug wurden aufgrund<br />
der Anforderungen an die Kanalisation erweitert,<br />
das Qualitätsniveau damit deutlich erhöht. Mit der neuen<br />
Norm gilt für Steinzeugbauteile, dass die Wasseraufnahme<br />
maximal 6 % beträgt. Dieser wichtige Grenzwert war<br />
in der Vorgängerversion nicht enthalten. Damit wird ein<br />
wesentlicher Beitrag zum Nachweis des Langzeitverhaltens<br />
hinsichtlich der Dauerhaftigkeit erdverlegter Steinzeugbauteile<br />
geleistet.<br />
•Entstehung von europäischen Normen (3)<br />
•DIN Deutsches Institut für Normung e. V.<br />
•Bulgarien<br />
•Österreich<br />
•Schweden<br />
•Schweiz<br />
•Belgien<br />
•Griechenland<br />
•Portugal<br />
•Tschech. Rep.<br />
•Ungarn<br />
•Dänemark<br />
•Finnland<br />
•Irland<br />
•Kroatien<br />
•Litauen<br />
•Norwegen<br />
•Slowakei<br />
•10<br />
•Ehemalige<br />
jugoslawische<br />
•Republik Mazedonien<br />
•Estland<br />
•Lettland<br />
•Luxemburg<br />
•Slowenien<br />
•7<br />
•12<br />
•4<br />
•1<br />
3<br />
•Island<br />
•Malta<br />
•Zypern<br />
•3<br />
•Niederlande<br />
•Rumänien<br />
•2<br />
7<br />
•29<br />
•Schlussabstimmung<br />
•Polen<br />
•Spanien<br />
•Deutschland<br />
•Frankreich<br />
•Italien<br />
•Ver. Königreich<br />
•Türkei<br />
Bild 1: Stimmengewichte •Stimmengewichte der Länder bei der Länder Entstehung von<br />
europäischen Normen<br />
•Gemeinschaftsaufgabe Normung<br />
•DIN Deutsches Institut für Normung e. V.<br />
•Eine demokratische Legitimation der Normung erfordert das<br />
Engagement aller interessierten Kreise<br />
•Anwender<br />
•Wissenschaft<br />
•und Forschung<br />
•Umweltschutz<br />
•Wirtschaft<br />
• • •<br />
• • •<br />
•NORMUNG<br />
•<br />
•Gewerkschaften<br />
• •<br />
•Öffentliche<br />
Hand<br />
•Regelsetzende<br />
•Institutionen<br />
•Arbeitsschutz<br />
Festigkeit (Tabelle 3)<br />
Mit der erfolgten Neugliederung der Tragfähigkeitsklassen<br />
der verschiedenen Steinzeugrohre konnte die Gruppe L<br />
entfallen, da die hier definierten geringen Tragfähigkeiten<br />
nicht mehr den statischen und bautechnischen Anforderungen<br />
entsprachen. Den Herstellern wurde die Möglichkeit<br />
eingeräumt, ab der Nennweite DN 700 – entsprechend den<br />
Marktanforderungen – Rohre mit höheren Scheiteldruckfestigkeiten<br />
herzustellen; die Schrittweite der Erhöhungen ist<br />
jetzt auf 10 kN/m festgelegt (bisher 40). Daraus resultieren<br />
verbesserte Produktionsmöglichkeiten und kostenoptimierte<br />
Anwendungen im Kanalbau.<br />
Verbesserte Festigkeiten sind auch im Abschnitt für die<br />
Vortriebsrohre eingearbeitet: Ihre Mindest-Druckfestigkeit<br />
errechnet sich nun mit einer spezifischen Druckfestigkeit<br />
von 100 N/mm2, der bisherige Wert von 75 N/mm2 wird<br />
damit deutlich überschritten. Folglich entstehen einerseits<br />
höhere Vortriebskräfte, andererseits auch höhere Reserven<br />
bei Beanspruchungen. Das zugehörige Prüfverfahren<br />
wurde mit der Vorgabe dahingehend erweitert, dass die<br />
Prüfkörper ab DN 400 über den Wandquerschnitt verteilt<br />
zu entnehmen sind. Damit entsteht eine deutliche<br />
Qualitätsverbesserung.<br />
•Verbraucherschutz<br />
Bild 3: Normung und deren Standards<br />
•Prüfinstitute<br />
Bild 2: Übersicht der Beteiligung an der Gemeinschaftsaufgabe<br />
Normung<br />
10 | 2013 29
FACHBERICHT RECHT & REGELWERK<br />
Dichtheit (Tabelle 3)<br />
Der Wert für die Wasserzugabe bei der Dichtheitsprüfung<br />
wurde von 0,07 l/m2 auf 0,04 l/m2 bei Steinzeugbauteilen<br />
reduziert. Damit gelingt ein weiterer Schritt in<br />
Richtung verbesserter Produkteigenschaften. Die Anforderungen<br />
an die Prüfung mit Luftdruck sind unverändert.<br />
Werkstoffeigenschaften<br />
Wesentliche Eigenschaften für den Betrieb von Abwasserkanälen<br />
sind nun in Teil 1 enthalten und mit Mindestanforderungen<br />
definiert:<br />
»»<br />
Wandrauheit<br />
- Typische k-Werte für die hydraulische Rauheit<br />
der Steinzeugoberfläche: zwischen 0,02 mm und<br />
0,05 mm<br />
»»<br />
Oberflächenhärte<br />
- Die Steinzeugoberfläche: Härte nach Mohs von 7<br />
»»<br />
Abriebfestigkeit<br />
- Abrieb der Steinzeugoberfläche: maximal 0,25 bis<br />
0,50 mm nach Prüfung mit 100.000 Lastwechseln<br />
»»<br />
Beständigkeit gegen Hochdruckwasserstrahl<br />
- Prüfung mit den Mindestanforderungen von<br />
12 MPa (120 bar) bei beweglicher Düse, 28 MPa<br />
(280 bar) bei stationärer (punktförmiger)<br />
Belastung<br />
Mit den Vorgaben aus dem Mandat der Europäischen<br />
Kommission sind begrüßenswerter Weise nun auch Angaben<br />
enthalten zu:<br />
»»<br />
Brandverhalten (Klasse F ohne weitere Nachweise),<br />
das heißt:<br />
- Steinzeug ist nicht brennbar<br />
- der Anteil der Verbindungen ist besonders klein;<br />
keine Brandübertragung durch die Verbindungen<br />
an der Innen- oder Außenseite<br />
»»<br />
Dauerhaftigkeit (Erfahrungen über eine lange Zeit),<br />
das heißt:<br />
- die Dauerhaftigkeit ist durch die Erfüllung der<br />
Eigenschaften in EN 295 und die Erfahrungen mit<br />
dem Werkstoff Steinzeug gegeben<br />
»»<br />
Gefährlichen Substanzen (Verweis auf europäische<br />
Anforderungen), das heißt:<br />
MJ/kg Steinzeug<br />
% kg co2<br />
/kg Steinzeug<br />
%<br />
Strom prim. 1,42 20 0,085 20<br />
Bereitstellung<br />
Brennstoffe<br />
Verbrauch<br />
Brennstoffe<br />
Bereitstellung<br />
Rohstoffe<br />
0,58 8 0,033 8<br />
4,98 69 0,286 68<br />
0,20 3 0,015 4<br />
Summe 7,18 100 0,419 100<br />
Tab. 3: Spezifischer Energieaufwand und spezifische<br />
CO 2<br />
- Emissionen für Steinzeugrohre<br />
- Rohstoffe sind naturrein und ohne gefährliche<br />
Substanzen<br />
- keine Verwendung gefährlicher Stoffe bei der Verarbeitung<br />
- keine Abgabe gefährlicher Stoffe bei der Nutzung an<br />
Boden / Grundwasser / Abwasser<br />
Maße<br />
Die Austauschbarkeit von Verbindungen von Steinzeugrohren<br />
und -formstücken ist weiterhin gegeben über die<br />
vollständige Angabe von:<br />
»»<br />
Innendurchmesser (DN)<br />
»»<br />
Verbindungssystem (C oder F)<br />
»»<br />
Scheiteldruckfestigkeit (kN/m)<br />
»»<br />
Tragfähigkeitsklasse (TKL)<br />
Die Kennzeichnung der Bauteile enthält diese Angaben.<br />
Entfallen sind die Verbindungssysteme A und B, die seit<br />
vielen Jahren in Europa nicht mehr produziert werden.<br />
EMPFEHLUNGEN FÜR PLANUNG, EINBAU UND<br />
BETRIEB (ANHANG B)<br />
Dieses Kapitel in Teil 1 der DIN EN 295 im Anhang B ist<br />
neu. Es enthält für Planer und Betreiber grundlegende,<br />
maßgebliche Daten und Fakten für Steinzeugrohrsysteme:<br />
»»<br />
Hydraulische Auslegung (u.a. Wandrauheit)<br />
»»<br />
Statische Berechnungen (u.a. biegesteifes<br />
Verhalten)<br />
»»<br />
Einbau (u. a. Verweis auf DIN EN 1610)<br />
»»<br />
Betrieb und Wartung (u. a. Reinigung und<br />
Reparaturmöglichkeiten)<br />
»»<br />
Wirtschaftlichkeit (u. a. Nutzungsdauer)<br />
»»<br />
Umweltbezogene Eigenschaften (u. a. Energieverbrauch<br />
und Recycling)<br />
Wesentliche Punkte daraus sind:<br />
1. Die Eigenschaften von Rohren und Formstücken, die<br />
den Anforderungen der vorliegenden Norm entsprechen,<br />
sind unveränderlich während der gesamten<br />
Nutzungsdauer von Abwasserleitungen und -kanälen.<br />
2. Die Werte der Wandrauheit sind für die Langzeitberechnungen<br />
ausgelegt.<br />
3. Steinzeugrohre und -formstücke werden als biegesteif<br />
klassifiziert und können aufgrund ihrer eigenen<br />
Tragfähigkeit unmittelbar Erd- und Verkehrslasten<br />
aufnehmen. Rohrverformungen oder Änderungen<br />
des Rohrdurchmessers treten während der gesamten<br />
Nutzungsdauer von Abwasserleitungen und -kanälen<br />
weder unter äußerer noch unter innerer Lasteinwirkung<br />
auf. Die statische Berechnung beruht auf der<br />
Tragfähigkeit (Scheiteldruckkraft) unter Berücksichtigung<br />
der Erd- und Verkehrslasten sowie anderer<br />
Lasteinwirkungen.<br />
4. Die Festigkeit von Steinzeugrohren und -formstücken<br />
ist unveränderlich während der gesamten Nutzungsdauer<br />
von Abwasserleitungen und -kanälen.<br />
5. Steinzeugrohre sind darüber hinaus widerstandsfähig<br />
gegenüber Wechselbeanspruchung durch Straßen- und<br />
Schienenverkehr.<br />
30 10 | 2013
RECHT & REGELWERK FACHBERICHT<br />
6. Der Einbau von Steinzeugrohren und -formstücken<br />
erfolgt entsprechend den Anforderungen nach<br />
DIN EN 1610 in offener Bauweise, nach DIN EN 12889<br />
in geschlossener (grabenloser) Bauweise.<br />
7. Die Beweglichkeit von Entwässerungssystemen aus<br />
Steinzeugrohren und -formstücken wird durch den<br />
Einbau flexibler Verbindungen erreicht. Dadurch<br />
werden Setzungen und andere Bodenbewegungen<br />
aufgenommen.<br />
8. Entwässerungs- und Abwassersysteme aus Steinzeugrohren<br />
und -formstücken erfüllen die Anforderungen<br />
nach EN 752, EN 12056-2 und EN 12056-3. Sie werden<br />
als jederzeit betriebsbereit und voll funktionsfähig<br />
angesehen aufgrund von:<br />
- hoher chemischer Beständigkeit von Steinzeugrohren<br />
und -Formstücken und deren Verbindungen<br />
- unveränderlicher Funktionseigenschaften im<br />
Abwasser<br />
- leichter Beseitigung vorhandener Ablagerungen<br />
- hoher Beständigkeit gegenüber Reinigung mit<br />
Hochdruckwasserstrahl<br />
- hoher Beständigkeit gegenüber den Auswirkungen<br />
mechanischer Reinigungsausrüstung und anderer<br />
Wartungsgeräte<br />
- hoher mechanischer Beständigkeit gegen<br />
Abriebbeanspruchungen<br />
- nicht notwendigen Einschränkungen bei der Anwendung<br />
üblicher Sanierungsverfahren durch den Austausch<br />
von Rohren in offener oder in geschlossener<br />
(grabenloser) Bauweise, oder durch Reparatur- oder<br />
Renovierungsverfahren<br />
Besonders hervorzuheben ist Punkt 9 „Wirtschaftlichkeit“:<br />
9. Wirtschaftlichkeit (Anhang B 6). Die Langzeiterfahrungen<br />
mit Steinzeugrohren und -formstücken für Entwässerungs-<br />
und Abwassersysteme entsprechend den<br />
Anforderungen der Normenreihe EN 295 belegen, dass<br />
sie für eine übliche Nutzungsdauer von mindestens<br />
100 Jahren zuverlässig sind. Diese Langlebigkeit liegt<br />
in den mineralogischen Eigenschaften von Steinzeug<br />
begründet:<br />
- diese bleiben nach der Rohrherstellung unverändert<br />
- konstante Festigkeit unter Betriebsbedingungen<br />
- Dauerhaftigkeit des Systems<br />
- umfangreiche Erfahrungen aus dem Langzeitverhalten<br />
sowie Punkt:<br />
10. Umweltbezogene Eigenschaften (Anhang B 7). Die<br />
umweltbezogenen Eigenschaften von Steinzeugrohren<br />
und -formstücken beinhalten:<br />
»»<br />
den geringen Energieverbrauch bei der Herstellung<br />
»»<br />
die Herstellung unter Berücksichtigung umweltbezogener<br />
Aspekte<br />
»»<br />
den Schutz von Boden und Grundwasser unter<br />
Betriebsbedingungen<br />
»»<br />
die lange Nutzungsdauer von Abwasserleitungen<br />
und -kanälen<br />
»»<br />
die unproblematische, vollständige Verwertung<br />
Der spezifische Energieverbrauch bei der Herstellung von<br />
Steinzeugrohren ist Tabelle 3 [1] zu entnehmen.<br />
Bewertung der Konformität und Probenahme<br />
Für die Hersteller von Steinzeugrohrsystemen ist der<br />
Nachweis der Konformität und die Gütesicherung aus<br />
Eigen- und Fremdüberwachung selbstverständlich und<br />
unverzichtbar. Die Anwender erwarten zudem den Nachweis<br />
einer fremd überwachenden Stelle. Allerdings sehen<br />
die europäischen Vorgaben hier nur noch ein freiwilliges<br />
Vorgehen vor. Daher mussten, wir neue Wege gehen, um<br />
sicherzustellen, dass unsere Leistungen durch Eigen- und<br />
Fremdüberwachung belegt und dokumentiert werden.<br />
Dies erfolgt über die Zusammenarbeit mit DIN Certco<br />
und die Zertifizierung der Produkte auf der Grundlage<br />
der ZP WN 295.<br />
Kennzeichnung der Bauteile nach DIN EN 295-1<br />
Für jedes Steinzeugbauteil gilt die Angabe seiner wesentlichen<br />
technischen Merkmale in dauerhafter Weise auf<br />
dem Produkt. Folgende Daten sind für die Verwendung<br />
der Bauteile und Verbindungen unverzichtbar:<br />
»»<br />
Europäische Norm DIN EN 295<br />
»»<br />
Herstellerkennzeichen<br />
»»<br />
Herstellungsdatum<br />
»»<br />
Verbindungssystem<br />
»»<br />
Nennweite<br />
»»<br />
Tragfähigkeit<br />
Auf freiwilliger Basis beruht die Kennzeichnung durch den<br />
Fremdüberwacher und dessen Grundlagen.<br />
Die Kennzeichnung mit dem CE-Zeichen richtet sich an<br />
Behörden, nicht aber an Verbraucher. Sie bestätigt die<br />
vollständige Einhaltung der „Grundlegenden Sicherheitsanforderungen“,<br />
die in den EU-Richtlinien festgelegt sind;<br />
das CE-Zeichen ist kein Qualitätszeichen.<br />
LITERATUR<br />
[1] Lorenz, Specht: Vergleich der kumulativen spezifischen CO 2<br />
-<br />
Emissionen von Steinzeug mit anderen Werkstoffen am Beispiel<br />
der Herstellung von Abwasserrohren, in: Keramische Zeitschrift<br />
01/2012<br />
Bauass. Dipl.-Ing. KARL-HEINZ FLICK<br />
AUTOR<br />
FVST Fachverband Steinzeugindustrie e.V.,<br />
Frechen<br />
Tel. +49 2234 507-271<br />
E-Mail: info@fachverband-steinzeug.com<br />
www.fachverband@steinzeug.com<br />
10 | 2013 31
FACHBERICHT RECHT & REGELWERK<br />
Änderung von Rohrleitungen - Teil 3:<br />
Die Änderung von Rohrfernleitungen<br />
zum Befördern wassergefährdender<br />
Stoffe, § 20 Abs. 2 S. 4 UVPG<br />
Rohrfernleitungen zum Befördern wassergefährdender Stoffe unterliegen nicht hinsichtlich der materiellen<br />
Zulassungsvoraussetzungen, aber hinsichtlich der formellen Anforderungen engeren Zulassungserfordernissen als sonstige<br />
Rohrfernleitungen. Das soll mit diesem Fachbericht dargelegt werden. Zuvor sollen kurz die Historie der gesetzlichen Regelung<br />
von Rohrfernleitungen zum Befördern wassergefährdender Stoffe sowie die Frage, wann überhaupt eine Rohrleitungsanlage<br />
zum Befördern wassergefährdender Stoffe vorliegt, behandelt werden.<br />
HISTORIE<br />
Rohrleitungen zum Befördern wassergefährdender Stoffe<br />
und ihre Genehmigung waren ursprünglich in §§ 19a ff.<br />
WHG geregelt. Errichtung und Betrieb sowie die wesentliche<br />
Änderung von Rohrleitungen zum Transport wassergefährdender<br />
Stoffe erforderten seit dem Jahr 1964 ein<br />
Genehmigungsverfahren auf Grundlage des § 19a Abs. 1<br />
S. 1 WHG. 1 Im Jahre 1990 wurde mit dem UVPG in seiner<br />
ersten Fassung zur Umsetzung der UVP-Richtlinie 85/337/<br />
EWG zunächst nur die UVP-Pflicht von Errichtung und<br />
Betrieb sowie der wesentlichen Änderung von Rohrleitungsanlagen<br />
für den Ferntransport von Öl und Gas, die<br />
einer Genehmigung nach § 19a WHG bedurften, geregelt.<br />
Die Umweltverträglichkeitsprüfung wurde im Genehmigungsverfahren<br />
nach § 19a WHG durchgeführt.<br />
Mit der UVP-Änderungsrichtlinie 97/11/EG wurde der Katalog<br />
UVP-pflichtiger Rohrleitungen erweitert. Öl-, Gas- und<br />
Chemikalienpipelines mit einem Durchmesser > 800 mm<br />
und einer Länge > 40 km waren nunmehr zwingend UVPpflichtig.<br />
2 Sonstige Anlagen der Industrie zum Transport<br />
von Gas, Dampf und Warmwasser 3 sowie sonstige Öl- und<br />
Gaspipelines und Wasserfernleitungen 4 wurden als fakultativ<br />
UVP-pflichtig geregelt. Der deutsche Gesetzgeber<br />
musste daher den Katalog UVP-pflichtiger Rohrleitungen<br />
erweitern. Dem kam er mit Gesetz vom 27.07.2001 nach,<br />
indem in Ziffer 19 des Anhangs 1 des UVPG alle UVPpflichtigen<br />
Leitungsvorhaben aufgeführt wurden. Für diese<br />
Leitungsvorhaben fehlte es weitgehend an einem Zulassungsverfahren<br />
als Trägerverfahren für die Umweltverträglichkeitsprüfung.<br />
Deshalb entschloss sich der Gesetzgeber,<br />
in § 20 Abs. 1 UVPG ein Trägerverfahren, nämlich das<br />
Planfeststellungsverfahren für Rohrfernleitungsvorhaben<br />
1 §§ 19a ff. WHG wurden durch Gesetz vom 06.08.1964,<br />
BGBl I S. 611, eingefügt.<br />
2 Anhang I Nr. 16 der Richtlinie 97/11/EG.<br />
3 Anhang II Nr. 3b der Richtlinie 97/11/EG.<br />
4 Anhang II Nr. 10i u. j der Richtlinie 97/11/EG.<br />
zu implementieren. Dieses ersetzte ab dem 03.08.2001<br />
das bisherige, auf Rohrleitungen zum Transport wassergefährdender<br />
Stoffe beschränkte Genehmigungsverfahren<br />
des § 19a WHG und galt auch für Rohrfernleitungen zum<br />
Transport anderer Stoffe. Allein für Gasversorgungsleitungen<br />
und für Hochspannungsfreileitungen wurde das Trägerverfahren<br />
der Umweltverträglichkeitsprüfung außerhalb<br />
des UVPG und innerhalb des für diese Anlagen gültigen<br />
speziellen Gesetzes, dem EnWG geregelt.<br />
ABGRENZUNG ROHRLEITUNGSANLAGE ZUM<br />
BEFÖRDERN UND ZUM UMGANG<br />
Rohrfernleitungsanlagen zum Befördern wassergefährdender<br />
Stoffe sind von Rohrleitungsanlagen zum Umgang<br />
mit wassergefährdenden Stoffen abzugrenzen. Dies richtet<br />
sich nach den unterschiedlichen Funktionsschwerpunkten<br />
beider Anlagen: Beförderungszweck auf der einen<br />
oder Umgangszweck im Zusammenhang mit betrieblichen<br />
Tätigkeiten auf der anderen Seite. Abhängig von<br />
der Zuordnung einer Rohrleitungsanlage als Anlage zum<br />
Befördern oder zum Umgang gelten unterschiedliche Kriterien<br />
zur Bestimmung wassergefährdender Stoffe und<br />
unterschiedliche Auslegungsanforderungen.<br />
Leitungen, die das Werksgelände nicht überschreiten,<br />
Zubehör- und Verbindungsleitungen<br />
Ausdrücklich aus der Begrifflichkeit von Rohrleitungsanlagen<br />
zum Befördern wassergefährdender Stoffe ausgenommen<br />
sind in Ziffer 19.3 der Anlage 1 des UVPG Rohrleitungsanlagen,<br />
die<br />
• den Bereich eines Werksgeländes nicht überschreiten,<br />
• Zubehör einer Anlage zum Umgang mit wassergefährdenden<br />
Stoffen sind oder<br />
• Anlagen verbinden, die in einem engen räumlichen<br />
und betrieblichen Zusammenhang miteinander stehen<br />
und kurzräumig durch landgebundene Verkehrswege<br />
getrennt sind.<br />
32 10 | 2013
RECHT & REGELWERK FACHBERICHT<br />
Diese Rohrleitungsanlagen sind in etwa von der Auflistung des<br />
§ 62 Abs. 1 S. 2 WHG als Rohrleitungsanlagen, die<br />
• den Bereich eines Werksgeländes nicht überschreiten,<br />
• Zubehör einer Anlage zum Umgang mit wassergefährdenden<br />
Stoffen sind oder<br />
• Anlagen verbinden, die in einem engen räumlichen und<br />
betrieblichen Zusammenhang miteinander stehen<br />
erfasst und stellen Rohrleitungsanlagen zum Umgang mit<br />
wassergefährdenden Stoffen dar.<br />
Das Werksgelände wird durch ein räumlich zusammengehörendes<br />
und nach außen als einheitliches Werk wahrgenommenes<br />
Gelände gekennzeichnet. Nicht erforderlich<br />
ist, dass das Gelände von einem Betreiber genutzt wird.<br />
Auch Chemie- oder Industrieparks können ein einheitliches<br />
Werksgelände darstellen, wenn das Gelände nach außen<br />
als einheitliches Werk wahrgenommen wird. Eine Unterbrechung<br />
eines Werksgeländes durch öffentliche Verkehrswege<br />
oder sonstige Flächen führt dann nicht zur Teilung eines<br />
Werksgeländes in mehrere Gelände, wenn der betriebliche<br />
Zusammenhang der Anlagen trotz kurzräumiger Trennung<br />
gewahrt und wahrnehmbar bleibt. 5<br />
Werden dagegen verschiedene Werksgelände durch eine<br />
Rohrleitung verbunden, handelt es sich um eine Verbindungsleitung,<br />
wenn die durch die Rohrleitung verbundenen<br />
Anlagen in einem räumlichen und betrieblichen Zusammenhang<br />
stehen. Während aber Ziffer 19.3 der Anlage 1 des<br />
UVPG nur eine kurzräumige Trennung durch öffentliche<br />
Verkehrswege zulässt, nennt § 62 Abs. 1 S. 1 WHG das einschränkende<br />
Kriterium einer kurzräumigen Trennung durch<br />
öffentliche Verkehrswege nicht (mehr) 6 . Das bedeutet,<br />
dass auf Grundlage der derzeitigen Gesetzeslage Rohrleitungen,<br />
die Anlagen auf verschiedenen Werksgeländen<br />
verbinden, Rohrfernleitungen i.S.d. Ziffer 19.3 der Anlage<br />
1 des UVPG darstellen, wenn sie durch andere Grundstücke<br />
als solche, auf denen sich öffentliche Verkehrswege<br />
befinden, getrennt sind, obwohl § 62 Abs. 1 WHG diese<br />
Rohrleitungen als Verbindungsleitungen erfassen will.<br />
Dieses Ungleichgewicht entsteht nur dann nicht, wenn<br />
die verbundenen Anlagen – gleichgültig, durch welche<br />
Grundstücke sie getrennt werden – sich trotz Trennung auf<br />
einem einheitlichen Werksgelände befinden. Anderenfalls<br />
löst in Nordrhein-Westfalen der Erlass des Ministeriums für<br />
Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz<br />
vom 28.08.2013 das Ungleichgewicht zugunsten<br />
des § 62 Abs. 1 WHG: Rohrleitungsanlagen, die Anlagen auf<br />
verschiedenen Werksgeländen in einem engen räumlichen<br />
und betrieblichen Zusammenhang verbinden, sind nach<br />
Maßgabe des § 62 Abs. 1 WHG zu behandeln, unabhängig<br />
davon, welcher Nutzung trennende Grundstücke dienen.<br />
5 Czychowski/Reinhardt, WHG, 10. Aufl. 2010, § 62 Rn. 34; Gößl in<br />
Sieder/Zeitler, WHG/AbwAG, 44. Erg.-Lfg. 2012, § 62 Rn. 6.<br />
6 Mit der Novelle des WHG im Jahre 2009 entschied sich der Gesetzgeber<br />
bewusst, das einschränkende Kriterium einer nur kurzräumigen Trennung<br />
durch Verkehrswege, das in § 19g WHG a.F. noch enthalten war,<br />
aufzugeben, um Leitungen, die Anlagen auf verschiedenen Werksgeländen<br />
verbinden, dann wenn ein räumlicher und betrieblicher Zusammenhang<br />
zwischen den verbundenen Anlagen besteht, denselben Regelwerken zu<br />
unterwerfen, wie Rohrleitungen, die Anlagen verbinden, die auf demselben<br />
Werksgelände liegen; vgl. BT-Drs. 16/12275, S. 70 f.<br />
Diese Wertung ist zutreffend. Zwar kann ein ministerieller<br />
Erlass keine formellen Gesetze und damit auch nicht das<br />
UVPG überregeln. Der Gesetzgeber selbst hat aber mit der<br />
Neufassung des § 62 Abs. 1 WHG im Jahre 2009 betont,<br />
dass er Verbindungsleitungen unabhängig davon, durch<br />
welche Grundstücke verbundene Anlagen getrennt werden,<br />
nicht dem Anwendungsbereich des UVPG unterwerfen<br />
will, sondern dem Anwendungsbereich des WHG. Der<br />
Erlass beinhaltet damit eine in Würdigung des Willens des<br />
Gesetzgebers gesetzeskonforme Auslegung.<br />
Zubehörleitungen schließlich, die aus dem Anwendungsbereich<br />
der Ziffer 19.3 der Anlage 1 des UVPG ausgenommen<br />
und von § 62 WHG erfasst sind, sind durch ihre<br />
dienende Funktion für die Betriebszwecke einer Hauptanlage<br />
gekennzeichnet.<br />
Sind die einschränkenden Kriterien der Ziffer 19.3 der<br />
Anlage 1 des UVPG i.V.m. des § 62 Abs. 1 S. 2 WHG<br />
erfüllt, handelt es sich bei einer solchen Rohrleitungsanlage<br />
nicht um eine Anlage zum Befördern wassergefährdender<br />
Stoffe i.S.d. UVPG. Die Rohrleitungsanlage<br />
unterliegt damit nicht dem Planfeststellungs- oder Plangenehmigungserfordernis<br />
des § 20 Abs. 1 u. 2 UVPG. Erforderlich<br />
ist allein eine behördliche Eignungsfeststellung<br />
oder eine gleichwertige Zertifizierung gem. § 63 Abs. 1<br />
u. 3 WHG i.V.m. den materiellen Kriterien der landesrechtlichen<br />
Regelungen in Verordnungen über Anlagen<br />
zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, wenn die<br />
Anlage dem Umgang mit wassergefährdenden Stoffen<br />
i.S.d. § 62 Abs. 3 WHG dient.<br />
Wassergefährdende Stoffe<br />
Ziffer 19.3 der Anlage 1 des UVPG verweist hinsichtlich der<br />
Klassifizierung wassergefährdender Stoffe auf § 21 Abs. 4 S. 7<br />
UVPG. § 21 Abs. 4 S. 7 UVPG wiederum regelt, dass in einer<br />
von der Bundesregierung mit Zustimmung des Bundesrats<br />
zu erlassenden Rechtsverordnung die Stoffe, die geeignet<br />
sind, die Wasserbeschaffenheit nachteilig zu verändern, d. h.<br />
wassergefährdende Stoffe, bestimmt werden können. Auf<br />
Grundlage dieser Ermächtigung wurde zur Bestimmung wassergefährdender<br />
Stoffe für Rohrfernleitungen eine abschließende<br />
Regelung in § 2 Abs. 1 S. 2 RohrFltgV getroffen. Dort<br />
ist geregelt, dass es sich bei wassergefährdenden Stoffen<br />
handelt um:<br />
• brennbare Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt kleiner als<br />
100 °C sowie brennbaren Flüssigkeiten, die bei Temperaturen<br />
gleich oder oberhalb ihres Flammpunktes befördert<br />
werden (§ 2 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 RohrFLtgV),<br />
• Stoffe mit den R-Sätzen R 14, R 14/15, R 29, R 50, R 50/53<br />
und R 51/53 (§ 2 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 RohrFLtgV) und<br />
• Stoffe mit den Gefahrenmerkmalen T, T+ oder C (§ 2 Abs. 1<br />
S. 2 RohrFLtgV).<br />
Diese Aufzählung ist abschließend. Wassergefährdende<br />
Stoffe i.S.d. Ziffer 19.3 der Anlage 1 des UVPG sind damit<br />
alle (aber auch allein) die in § 2 Abs. 1 S. 2 i.V.m. S. 1<br />
Nrn. 1 u. 3 RohrFLtgV aufgeführten Stoffe, ohne dass dies<br />
einer Disposition der Behörde oder des Vorhabenträgers<br />
unterläge. Die Vorgaben des § 2 Abs. 1 S. 2 RohrFLtgV sind<br />
10 | 2013 33
FACHBERICHT RECHT & REGELWERK<br />
Bild 1: Errichtung und Betrieb einer Rohrfernleitung zum Befördern wassergefährdender Stoffe<br />
entscheidend für die Bewertung einer Rohrleitung als Rohrfernleitung<br />
zum Befördern wassergefährdender Stoffe 7 .<br />
Die nicht für Rohrfernleitungen, sondern allein für Rohrleitungsanlagen,<br />
die das Werksgelände nicht überschreiten<br />
oder Zubehör- oder Verbindungsleitungen darstellen, maßgebliche<br />
Definition wassergefährdender Stoffe enthält § 62<br />
Abs. 3 WHG. Danach sind wassergefährdende Stoffe feste,<br />
flüssige und gasförmige Stoffe, die geeignet sind, dauernd<br />
oder in einem nicht nur unerheblichen Ausmaß nachteilige<br />
Veränderungen der Wasserbeschaffenheit herbeizuführen.<br />
§ 62 Abs. 3 WHG beinhaltet aufgrund der Öffnungsklausel<br />
„die geeignet sind“ keinen abschließenden Katalog wassergefährdender<br />
Stoffe. Vielmehr bedarf es auf Grundlage<br />
des § 62 Abs. 3 WHG einer wertenden Beurteilung im<br />
Einzelfall, ob ein Stoff wassergefährdend ist, gemessen an<br />
dem unbestimmten Kriterium der Eignung eines Stoffs, eine<br />
nicht nur unerhebliche nachteilige Veränderung der Wasserbeschaffenheit<br />
herbeizuführen. Dies richtet sich bisher<br />
nach den für Anlagen und Betriebsplätze zum Umgang<br />
mit wassergefährdenden Stoffen maßgeblichen Kriterien<br />
landesrechtlicher Verordnungen über wassergefährdende<br />
Stoffe und den dortigen Regelungen verschiedener Wassergefährdungsklassen<br />
und soll zukünftig in einer bundesrechtlichen<br />
Verordnung über Anlagen zum Umgang mit<br />
wassergefährdenden Stoffen (VAUwS) 8 bundeseinheitlich<br />
geregelt werden.<br />
Materielle Vorgaben<br />
Die technischen Anforderungen an Rohrfernleitungen zum<br />
Befördern wassergefährdender Stoffe i.S.d. § 2 Abs. 1 S. 2<br />
RohrFltgV, die den Bereich eines Werksgelände überschreiten<br />
und weder eine Verbindungs- noch eine Zubehörleitung<br />
7 Ebenso auch der Erlass des MKUNV des Landes NRW vom 28.08.2013.<br />
8 Ein Entwurf einer Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden<br />
Stoffen liegt mit Stand vom 27.01.2012 vor.<br />
darstellen, ergeben sich aus der RohrFLtgV.<br />
Das gilt sowohl für Rohrfernleitungen, die<br />
aufgrund UVP-Pflicht gem. § 20 Abs. 1 UVPG<br />
planfeststellungspflichtig sind, als auch für<br />
Rohrfernleitungen, die keine UVP und nur<br />
eine Plangenehmigung gem. § 20 Abs. 2<br />
UVPG erfordern und folgt aus den in § 21<br />
Abs. 1 Nr. 1 UVPG geregelten Zulassungsvoraussetzungen,<br />
deren Konkretisierung die<br />
RohrFLtgV dient.<br />
Rohrleitungsanlagen zum Umgang mit wassergefährdenden<br />
Stoffen i.S.d. § 62 Abs. 1<br />
S. 2 WHG sind dagegen nicht Planfeststellungs-<br />
oder Plangenehmigungspflichtig gem.<br />
§ 20 UVPG. Sie unterliegen daher nicht der<br />
RohrFLtgV, da deren Anwendungsbereich<br />
ausweislich § 2 Abs. 2 Nrn. 1 u. 2 RohrFLtgV<br />
Rohrfernleitungen zum Befördern wassergefährdender<br />
Stoffe nur dann erfasst, wenn<br />
sie nach § 20 UVPG eine Planfeststellung<br />
oder Plangenehmigung erfordern. Die von<br />
diesen Rohrleitungsanlagen einzuhaltenden<br />
Regeln der Technik ergeben sich aus den Verordnungen<br />
der Länder über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden<br />
Stoffen.<br />
»»<br />
Rohrfernleitungen zum Befördern wassergefährdender<br />
Stoffe können nur solche Leitungen sein, die den<br />
Bereich eines Werkegeländes überschreiten und keine<br />
Zubehör- und Verbindungsleitungen sind.<br />
»»<br />
Die Kriterien wassergefährdender Stoffe ergeben sich<br />
für Rohrfernleitungen aus § 2 Abs. 1 S. 2 RohrFLtgV<br />
und für Rohrleitungsanlagen zum Umgang mit wassergefährdeten<br />
Stoffen aus § 60 Abs. 3 WHG.<br />
»»<br />
Die einzuhaltenden Regeln der Technik folgen für<br />
Rohrfernleitungen zum Befördern wassergefährdender<br />
Stoffe aus der RohrFLtgV und für Rohrleitungsanlagen<br />
zum Umgang mit wassergefährdenden<br />
Stoffen aus den Verordnungen der Länder über den<br />
Umgang mit wassergefährdenden Stoffen.<br />
ZULSSUNGSERFORDERNISSE DER ÄNDERUNG VON<br />
ROHRFERNLEITUNGEN ZUM BEFÖRDERN WASSER-<br />
GEFÄHRDENDER STOFFE<br />
Errichtung und Betrieb von Rohrfernleitungen zum Befördern<br />
wassergefährdender Stoffe erfordern, wie in Ausgabe <strong>3R</strong><br />
3/2013 ausgeführt, dann, wenn sie gemessen an den Schwellenwerten<br />
der Ziffer 19.3 der Anlage 1 des UVPG ggf. nach<br />
Vorprüfung UVP-pflichtig sind, eine Planfeststellung gem. § 20<br />
Abs. 1 UVPG. Ist eine UVP entbehrlich, entfällt das in § 20<br />
Abs. 1 UVPG geregelte Planfeststellungserfordernis. Errichtung<br />
und Betrieb einer Rohrfernleitung zum Befördern wassergefährdender<br />
Stoffe erfordern dann gem. § 20 Abs. 2 S. 1 u. 4<br />
UVPG zwingend eine Plangenehmigung. Die Entbehrlichkeit<br />
einer Plangenehmigung in Fällen unwesentlicher Bedeutung<br />
gem. § 20 Abs. 2 S. 2 u. 3 UVPG gilt, wie ebenfalls bereits<br />
in Ausgabe <strong>3R</strong> 3/2013 dargelegt, für Rohrfernleitungen zum<br />
Befördern wassergefährdender Stoffe – anders als für sonstige<br />
34 10 | 2013
RECHT & REGELWERK FACHBERICHT<br />
Rohrfernleitungen i.S.d. Ziffern 19.4 bis 19.8 der<br />
Anlage 1 des UVPG – bei erstmaliger Errichtung<br />
nicht. Dies ergibt sich aus der Sonderregelung in<br />
§ 20 Abs. 2 S. 4 UVPG.<br />
Änderungen einer Rohrfernleitung zum Befördern<br />
wassergefährdender Stoffe können dagegen –<br />
wenn sie nicht UVP-pflichtig sind und damit keine<br />
Planfeststellung gem. § 20 Abs. 1 UVPG erfordern<br />
– plangenehmigungsfrei sein. Dies ergibt sich aus<br />
einer Rückausnahme in § 20 Abs. 2 S. 4 UVPG, die<br />
allerdings schwer verständlich ist. Um die Schwierigkeiten<br />
zu verdeutlichen, ist § 20 Abs. 2 UVPG<br />
in seiner Gesamtheit abzudrucken:<br />
„Sofern keine Verpflichtung zur Durchführung<br />
einer Umweltverträglichkeitsprüfung besteht,<br />
bedarf das Vorhaben der Plangenehmigung. Die<br />
Plangenehmigung entfällt in Fällen von unwesentlicher<br />
Bedeutung. Diese liegen vor, wenn die<br />
Prüfwerte nach § 3c UVPG für Größe und Leistung,<br />
die die Vorprüfung eröffnen, nicht erreicht<br />
werden oder die Voraussetzungen des § 74 Abs. 7<br />
Satz 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes erfüllt<br />
sind; § 3b Abs. 2 und 3 UVPG gilt entsprechend.<br />
Die Sätze 2 und 3 gelten nicht für Errichtung,<br />
Betrieb und Änderung von Rohrleitungsanlagen<br />
zum Befördern wassergefährdender Stoffe sowie<br />
für Änderungen ihres Betriebs, ausgenommen<br />
Änderungen von unwesentlicher Bedeutung.“<br />
ERRICHTUNG UND BETRIEB ERFORDERN ZWINGEND<br />
EINE PLANGENEHMIGUNG<br />
Gemäß § 20 Abs. 2 S. 4 UVPG gelten Sätze 2 und 3 und<br />
damit die Befreiung von einer Plangenehmigung in Fällen<br />
unwesentlicher Bedeutung nicht für Errichtung und Betrieb<br />
einer Rohrfernleitung zum Befördern wassergefährdender<br />
Stoffe; umgekehrt gewendet: Errichtung und Betrieb einer<br />
Rohrfernleitung zum Befördern wassergefährdender Stoffe<br />
erfordern auch in Fällen unwesentlicher Bedeutung zwingend<br />
eine Plangenehmigung.<br />
Plangenehmigungsfreiheit nur einer unwesentlichen<br />
Änderung des Betriebs oder auch der Rohrleitung<br />
selbst?<br />
Auch für Änderungen von Rohrfernleitungen zum Befördern<br />
wassergefährdender Stoffe sowie für Änderungen ihres<br />
Betriebs gelten Sätze 2 und 3 und damit die Ausnahme von<br />
dem Plangenehmigungserfordernis in Fällen unwesentlicher<br />
Bedeutung gem. § 20 Abs. 2 S. 4, Halbsatz 1 UVPG nicht:<br />
„Die Sätze 2 und 3 gelten nicht für Errichtung, Betrieb und<br />
Änderung von Rohrleitungsanlagen zum Befördern wassergefährdender<br />
Stoffe sowie für Änderungen ihres Betriebs<br />
…“. Davon ausgenommen sind gemäß Satz 4, Halbsatz 2<br />
allerdings Fälle unwesentlicher Bedeutung: „… ausgenommen<br />
Änderungen von unwesentlicher Bedeutung.“ Satz 4 Halbsatz<br />
2 beinhaltet damit eine Rückausnahme.<br />
Ob diese Rückausnahme mit der Konsequenz einer Befreiung<br />
vom Plangenehmigungserfordernis bei Änderungen von<br />
Bild 2: Änderung einer Rohrfernleitung zum Befördern wassergefährdender Stoffe<br />
unwesentlicher Bedeutung nur für unwesentliche Änderungen<br />
des Betriebs einer Rohrfernleitung zum Befördern wassergefährdender<br />
Stoffe gilt, oder sowohl für unwesentliche Änderungen<br />
des Betriebs als auch für unwesentliche Änderungen<br />
der Rohrfernleitungsanlage als solcher, d. h. ihrer baulichen<br />
Ausgestaltung und ihrer Trassierung, ist nach dem Wortlaut<br />
fraglich.<br />
Grammatikalisch bietet sich zunächst an, die Rückausnahmeregelung<br />
in Satz 4, 2. Halbsatz nur auf die unmittelbar<br />
davor aufgeführten Änderungen des Betriebs einer<br />
Rohrfernleitung zum Befördern wassergefährdender Stoffe<br />
zu beziehen. 9 Da sich eine entsprechende Beschränkung<br />
aber nicht ausdrücklich in Satz 4, 2. Halbsatz findet,<br />
ist grammatikalisch ebenso eine dahingehende Lesart<br />
möglich, dass unwesentliche Änderungen generell und damit<br />
sowohl dann, wenn es sich um unwesentliche Änderungen<br />
des Betriebs, als auch dann, wenn es sich um unwesentliche<br />
Änderungen der Rohrfernleitung selbst handelt, plangenehmigungsfrei<br />
sind. 10<br />
Der Wortlaut des Satzes 4 ist nicht eindeutig. Zur Auslegung<br />
ergänzend heranzuziehen ist daher der in der amtlichen<br />
Begründung des Gesetzes erklärte Wille des Gesetzgebers.<br />
Ausweislich der amtlichen Begründung des § 20 UVPG<br />
9 So wohl Beckmann in: Hoppe/Beckmann, UVPG, 4. Auflage 2012,<br />
§ 20 Rn. 41.<br />
10 So ohne detaillierte Auseinandersetzung mit dem Wortlaut des § 20<br />
Abs. 2 S. 4 UVPG Zeitler in: Sieder/Zeitler, WHG/AbwAG, 44. Erg.-Lfg.<br />
2012, § 19a WHG a.F. Rn. 49r; gänzlich ohne Differenzierung zwischen<br />
Änderungen des Betriebs und der baulichen Gestaltung spricht Hagmann<br />
von der Plangenehmigungsfreiheit von Änderungen von unwesentlicher<br />
Bedeutung, in Landmann/Rohmer, Umweltrecht, 68. Erg.-Lfg. 2013,<br />
§ 20 Rn. 40.<br />
10 | 2013 35
FACHBERICHT RECHT & REGELWERK<br />
Themenübersicht 2013<br />
Zulassungsverfahren für Errichtung und Betrieb von Rohrfernleitungen<br />
- Teil 1: Gasversorgungsleitungen im Sinne des EnWG<br />
<strong>3R</strong>, Ausgabe 1-2/2013, S. 36-41<br />
Zulassungsverfahren für Errichtung und Betrieb von Rohrfernleitungen -<br />
Teil 2: Rohrfernleitungen i.S.d. Ziffern 19.3 bis 19.8 der Anlage 1 des UVPG<br />
<strong>3R</strong>, Ausgabe 3/2013, S. 36-39<br />
Zulassungsverfahren für Errichtung und Betrieb von Rohrfernleitungen<br />
- Teil 3: Anforderungen des Bundesberggesetzes (BBergG) und des<br />
Kohlendioxidspeichergesetzes (KSpG)<br />
<strong>3R</strong>, Ausgabe 4-5/2013, S. 44-49<br />
Änderung von Rohrfernleitungen - Teil 1: Zulassungserfordernisse<br />
und Zulassungsverfahren<br />
<strong>3R</strong>, Ausgabe 7-8/2013, S. 34-42<br />
Änderung von Rohrfernleitungen - Teil 2: Die UVP-Relevanz von<br />
Änderungen<br />
<strong>3R</strong>, Ausgabe 9/2013, S. 24-32<br />
Änderung von Rohrfernleitungen - Teil 3: Die Änderung von<br />
Rohrfernleitungen zum Befördern wassergefährdender Stoffe,<br />
§ 20 Abs. 2 S. 4 UVPG<br />
<strong>3R</strong>, Ausgabe 10/2013, Erscheinungstermin 23. Oktober 2013<br />
Konversion - Wo verläuft die Grenze zwischen Änderung und Aliud?<br />
<strong>3R</strong>, Ausgabe 11-12/2013, Erscheinungstermin 12. November 2013<br />
wurde die Norm dem ursprünglich maßgeblichen § 19a<br />
WHG nachempfunden; in der amtlichen Begründung heißt<br />
es: „Absatz 2 Satz 4 stellt sicher, dass im Hinblick auf Rohrleitungsanlagen<br />
zum Befördern wassergefährdender Stoffe,<br />
für die bereits nach dem bisherigen § 19a Abs. 1 und Abs.<br />
3 WHG ein Genehmigungserfordernis besteht, in jedem Fall<br />
ein Plangenehmigungsverfahren durchgeführt wird.“ 11 § 19a<br />
Abs. 1 S. 1 WHG regelte eine Genehmigungspflicht von<br />
Errichtung und Betrieb sowie der wesentlichen Änderung<br />
einer Rohrleitungsanlage und ihres Betriebs: „Die Errichtung,<br />
der Betrieb und die wesentliche Änderung einer Rohrleitungsanlage<br />
zum Befördern wassergefährdender Stoffe<br />
sowie die wesentliche Änderung ihres Betriebs bedürfen<br />
der Genehmigung der für das Wasser zuständigen Behörde,<br />
wenn der Genehmigungsantrag vor dem 3. August 2001<br />
gestellt wurde.“ 12 Unwesentliche Änderungen sowohl des<br />
Betriebs als auch der Rohrleitung waren damit auf Grundlage<br />
des § 19a Abs. 1 S. 1 WHG genehmigungsfrei.<br />
Es ist nicht ersichtlich, dass der Gesetzgeber mit der Neuregelung<br />
des § 20 Abs. 2 S. 4 UVPG eine Verschärfung der<br />
bis dahin maßgeblichen Genehmigungspflicht des § 19a<br />
Abs. 1 S. 1 WHG bewirken wollte. Im Gegenteil spricht<br />
die Inbezugnahme der früheren Regelung des § 19a WHG<br />
11 BR-Drs. 674/00, S. 97.<br />
12 Auf Genehmigungsanträge ab dem 03.08.2001 findet § 20 UVPG Anwendung.<br />
in der amtlichen Begründung des § 20 UVPG dafür, dass<br />
die dortigen Vorgaben beibehalten bleiben sollten, d.h.<br />
Errichtung und Betrieb einer Rohrfernleitungsanlage zum<br />
Befördern wassergefährdender Stoffe sowie die wesentliche<br />
Änderung sowohl der Rohrleitung als auch ihres Betriebs<br />
zulassungspflichtig sein sollen, unwesentliche Änderungen<br />
aber unabhängig von ihrem Bezugspunkt des Betriebs oder<br />
der Anlage zulassungsfrei sind.<br />
Bei diesem Verständnis beinhaltet § 20 Abs. 2 S. 4 UVPG<br />
eine zwingende Plangenehmigungspflicht der erstmaligen<br />
Errichtung und des Betriebs einer Rohrfernleitung zum<br />
Befördern wassergefährdender Stoffe sowie nachträglicher<br />
wesentlicher Änderungen von Errichtung oder Betrieb,<br />
nicht aber von Änderungen von unwesentlicher Bedeutung,<br />
gleichgültig, ob diese die Rohrfernleitungsanlage oder ihren<br />
Betrieb betreffen.<br />
KRITERIEN EINER UNWESENTLICHEN ÄNDERUNG<br />
Wann eine Änderung von unwesentlicher Bedeutung<br />
vorliegt, ergibt sich grundsätzlich aus den Kriterien des<br />
§ 20 Abs. 2 S. 3 UVPG. Danach liegt eine unwesentliche<br />
Änderung vor, wenn entweder die Schwellenwerte,<br />
die gem. § 3c UVPG eine Vorprüfung eröffnen, nicht<br />
erreicht werden (1. Alt.), oder die Voraussetzungen des<br />
§ 74 Abs. 7 S. 2 VwVfG erfüllt sind (2. Alt.); dazu bereits<br />
in <strong>3R</strong> 7-8/2013 unter Punkt 3, S. 38.<br />
Ob allerdings beide Alternativen des § 20 Abs. 2 S. 3<br />
UVPG auf Rohrfernleitungen zum Befördern wassergefährdender<br />
Stoffe anwendbar sind, ist fraglich.<br />
Die erste Alternative (Schwellenwerte der Vorprüfung<br />
werden unterschritten) ist, wie in Ausgabe <strong>3R</strong> 7-8/2013<br />
ausgeführt, auf Änderungen nicht solitär anwendbar.<br />
Nicht jede Änderung, die solitär betrachtet die Schwellenwerte<br />
einer Vorprüfung unterschreitet, ist unwesentlich.<br />
Vielmehr gilt dies nur dann, wenn in additiver Betrachtung<br />
von Änderung und vorhandenem Bestand die<br />
Schwellenwerte der Vorprüfung unterschritten werden.<br />
In einem solchen Fall war grundsätzlich – außer im Falle<br />
einer Rohrleitung zum Befördern wassergefährdender<br />
Stoffe – bereits die Errichtung plangenehmigungsfrei.<br />
Auch eine spätere Änderung, die nicht zu einem Überschreiten<br />
der Schwellenwerte der Vorprüfung führt, ist<br />
dann plangenehmigungsfrei.<br />
Rohrfernleitungen zum Befördern wassergefährdender<br />
Stoffe erfordern dagegen bei ihrer erstmaligen Errichtung<br />
auch dann eine Plangenehmigung, wenn die Schwellenwerte<br />
einer Vorprüfung unterschritten werden. Die bei<br />
anderen Rohrleitungen geltende Ausgangslage ist damit<br />
auf Rohrfernleitungen zum Befördern wassergefährdender<br />
Stoffe nicht übertragbar. Deshalb ist zweifelhaft,<br />
ob eine Änderung einer Rohrfernleitung zum Befördern<br />
wassergefährdender Stoffe allein deshalb, weil sie nicht<br />
zu einem Erreichen der Schwellenwerte führt, als unwesentlich<br />
gewertet werden kann.<br />
Damit ist noch nicht gesagt, dass eine Änderung einer<br />
Rohrfernleitung zum Befördern wassergefährdender Stoffe,<br />
die nicht zu einem Erreichen der Schwellenwerte führt,<br />
36 10 | 2013
RECHT & REGELWERK FACHBERICHT<br />
zwingend wesentlich wäre. Ein taugliches Kriterium zur<br />
Prüfung der Unwesentlichkeit einer Änderung ergibt sich<br />
auch für Rohrfernleitungen zum Befördern wassergefährdender<br />
Stoffe jedenfalls aus der zweiten Alternative des<br />
§ 20 Abs. 2 S. 3 UVPG und dem dortigen Verweis auf<br />
§ 74 Abs. 7 S. 2 VwVfG. Denn dieses Kriterium erfordert<br />
keine Gesamtbetrachtung der Rohrfernleitung,<br />
sondern kann im Falle einer Änderung mit Blick allein<br />
auf die Änderung gewürdigt werden. Unwesentlich ist<br />
eine Änderung danach dann, wenn durch die Änderung<br />
andere öffentliche Belange nicht berührt werden oder die<br />
erforderlichen behördlichen Entscheidungen vorliegen<br />
und der Änderung nicht entgegenstehen (§ 74 Abs. 7<br />
S. 2 Nr. 1 VwVfG) und Rechte anderer nicht beeinflusst<br />
werden oder mit den Betroffenen entsprechende Vereinbarungen<br />
getroffen worden sind. Die Anforderungen des<br />
§ 74 Abs. 7 S. 2 VwVfG sind, wie bereits in <strong>3R</strong> 1-2/2013,<br />
unter Punkt 4, S. 40 f. dargelegt, eng. Eine Beeinflussung<br />
von Rechten Dritter ist bereits dann zu bejahen, wenn<br />
Rechte Dritter in mehr als nur geringfügiger Weise negativ<br />
berührt werden; ein unmittelbarer Eingriff in Rechte Dritter<br />
ist dafür nicht erforderlich. Eine Berührung öffentlicher<br />
Belange ist bereits dann zu bejahen, wenn etwa Belange<br />
der kommunalen Planungshoheit, Umweltbelange oder<br />
Belange des Wasserschutzes negativ tangiert werden<br />
und damit umgekehrt nur dann zu verneinen, wenn ein<br />
Vorhaben unter keinem denkbaren Gesichtspunkt Einfluss<br />
auf andere öffentliche Belange haben kann.<br />
Damit dürften die Fälle unwesentlicher Änderungen von<br />
Rohrfernleitungen zum Befördern wassergefährdender Stoffe<br />
eng zu umgrenzen sein. Nur ein derart enges Verständnis<br />
steht auch in Übereinstimmung mit der jüngsten Änderung<br />
der RohrFLtgV vom 14.08.2013. Mit der Änderung wurde<br />
nunmehr in § 4a RohrFLtgV auch die wesentliche Änderung<br />
von Rohrfernleitungsanlagen, die die Schwellenwerte der<br />
Vorprüfung unterschreiten und damit keiner Planfeststellung<br />
und keiner Plangenehmigung bedürfen, geregelt. Die noch<br />
in Ausgabe <strong>3R</strong> 7-8/2013 unter Punkt 3, S. 39, geschilderte<br />
Einschränkung des Anzeigeverfahrens des § 4a RohrFLtgV<br />
auf Errichtung und Betrieb ist damit Makulatur. Die nunmehrige<br />
Ausdehnung des Anzeigeverfahrens auf wesentliche<br />
Änderungen gilt aber nur für Rohrfernleitungen i.S.d.<br />
ebenfalls neu gefassten § 2 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 RohrFLtgV<br />
und damit nur für Rohrfernleitungen i.S.d. Ziffern 19.4<br />
bis 19.6 der Anlage 1 des UVPG, die die Schwellenwerte<br />
einer Vorprüfung unterschreiten und nicht auch für Rohrfernleitungen<br />
zum Befördern wassergefährdender Stoffe<br />
i.S.d. Ziffer 19.3 der Anlage 1 des UVPG. Rohrfernleitungen<br />
zum Befördern wassergefährdender Stoffe sind ausweislich<br />
der amtlichen Begründung des Verordnungsgebers<br />
deshalb aus § 2 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 RohrFLtgV gestrichen<br />
worden, weil diese unabhängig von den Schwellenwerten<br />
der UVP-Pflicht ohnehin mindestens einer Plangenehmigung<br />
bedürfen und daher aufgrund § 2 Abs. 1 RohrFLtgV<br />
unter den Anwendungsbereich der Verordnung fallen. 13<br />
13 BR-Drs. 55/1/13, S. 5.<br />
Das ist für Errichtung und Betrieb zutreffend. Für Änderungen<br />
gelten, wie dargelegt, Ausnahmen von der Plangenehmigungspflicht.<br />
Nur wenn diese Ausnahmen eng<br />
umgrenzt sind, führt der Umstand, dass Änderungen von<br />
Rohrfernleitungen zum Befördern wassergefährdender<br />
Stoffe keinesfalls über § 4a RohrFLtgV anzeigepflichtig<br />
sind, nicht dazu, dass es zu einem Missverhältnis im<br />
Vergleich zu anzeigepflichtigen Änderungen sonstiger<br />
Rohrfernleitungen kommt.<br />
ZUSAMMENFASSUNG<br />
Das Zulassungsverfahren von Rohrfernleitungen zum<br />
Befördern wassergefährdender Stoffe ist insoweit gegenüber<br />
den Zulassungsverfahren sonstiger Rohrfernleitungen<br />
erschwert, als Errichtung und Betrieb gem. § 20<br />
Abs. 2 S. 4 UVPG mindestens und ohne Ausnahme plangenehmigungspflichtig<br />
sind, wenn nicht aufgrund UVP-<br />
Pflicht ohnehin das vorrangige Planfeststellungsverfahren<br />
durchzuführen ist. Für Änderungen sowohl des Betriebs<br />
als auch der Rohrleitungsanlage selbst gilt dagegen nach<br />
hiesiger Auffassung trotz des komplizierten Wortlauts des<br />
§ 20 Abs. 2 S. 4 UVPG der Grundsatz der Plangenehmigungsfreiheit<br />
bei unwesentlicher Bedeutung der Änderung<br />
ebenso wie für sonstige Rohrfernleitungen. Fälle<br />
von unwesentlicher Bedeutung dürften aber nur dann<br />
vorliegen, wenn die Voraussetzungen des § 20 Abs. 2 S. 3<br />
2. Alternative UVPG erfüllt sind. Gegen eine Anwendbarkeit<br />
der 1. Alternative des § 20 Abs. 2 S. 3 UVPG spricht,<br />
dass diese Alternative – anders als die 2. Alternative –<br />
eine Gesamtschau des vorhandenen Bestands und der<br />
Änderung erfordert und über diese Gesamtschau nicht<br />
negiert werden kann, dass Errichtung und Betrieb einer<br />
Rohrfernleitung trotz Unterschreitens der Schwellenwerte<br />
einer Vorprüfung plangenehmigungspflichtig sind;<br />
allein der Umstand, dass eine nachträgliche Änderungen<br />
nicht zu einem Überschreiten der Schwellenwerte führt,<br />
scheint daher kaum geeignet, ihre Unwesentlichkeit zu<br />
begründen.<br />
Dr. BETTINA KEIENBURG<br />
Kümmerlein Rechtsanwälte & Notare, Essen<br />
Tel. +49 201 1756-624<br />
E-Mail: bettina.keienburg@kuemmerlein.de<br />
Dr. MICHAEL NEUPERT<br />
Kümmerlein Rechtsanwälte & Notare, Essen<br />
Tel. +49 201 1756-624<br />
AUTOREN<br />
E-Mail: michael.neupert@kuemmerlein.de<br />
10 | 2013 37
DVGW RECHT & REGELWERK<br />
Regelwerk<br />
W 400-3-B1 Entwurf „Technische Regeln Wasserverteilungs anlagen<br />
(TRWV); Teil 3: Betrieb und Instandhaltung - Beiblatt 1: Inspektion<br />
und Wartung von Ortsnetzen“<br />
Einspruchsfrist 31.12.2013<br />
NEUERSCHEINUNG<br />
Inspektion und Wartung dienen sowohl dem technisch<br />
sicheren und zuverlässigen als auch dem wirtschaftlichen<br />
Betrieb von Rohrnetzen, wobei das Beiblatt W 400-3-B1<br />
nicht nur Rohrleitungen und ihre Bauteile, sondern auch<br />
deren unmittelbare Umgebung und zugehörige Einrichtungen<br />
(Schachtbauwerke, Straßenkappen, Schutzstreifen,<br />
Hinweisschilder) berücksichtigt.<br />
Das Beiblatt übernimmt und aktualisiert somit die Ausführungen<br />
zur Inspektion und Wartung im DVGW-Arbeitsblatt<br />
W 392 vom Mai 2003. Es wird bei der zukünftigen Überarbeitung<br />
des DVGW-Arbeitsblatts W 400-3 „Technische<br />
Regeln Wasserverteilungsanlagen (TRWV); Teil 3: Betrieb<br />
und Instandhaltung“ integriert. Allerdings bedeutet hier<br />
„aktualisiert“ eine ziemlich weitreichende Neuerung!<br />
Bereits die alte W 392 enthält das Schlagwort „zustandsorientierte<br />
Instandhaltung“. Sie stellt bei der Inspektion<br />
des Rohrnetzes konkret aber nur auf den Wasserverlust ab<br />
und bleibt im Zusammenhang mit der Schadensrate vage.<br />
Ansonsten, insbesondere zu Armaturen und Hydranten,<br />
bietet die alte W 392 nur interpretationsbedürftige Hinweise,<br />
die wiederum ausschließlich auf mögliche Fristverkürzungen<br />
zielen.<br />
Zwar kann das Beiblatt nicht die ganze Vielfalt inspektionsund<br />
wartungsrelevanter Faktoren in einem Fristenschema<br />
erfassen, das gleichzeitig einfach, übersichtlich und einzelfallgerecht<br />
ist. Doch wie die Tabelle beispielhaft am Rohrnetz<br />
zeigt, nehmen die zustandsorientierten Vorgaben wesentlich<br />
deutlichere Konturen an. Dabei sind der Wasserverlust nach<br />
W 392 und die Schadensrate nach einer weiteren Tabelle<br />
des Beiblatts zu bewerten.<br />
Das Beiblatt enthält erstmalig auch eine Tabelle mit Richtwerten<br />
für die jeweiligen Schadensraten und den Inspektionsturnus<br />
von Absperrarmaturen und Hydranten. Im Übrigen<br />
gilt für Fern- und Zubringerleitungen weiterhin das DVGW-<br />
Arbeitsblatt W 392-2.<br />
Ausgabe 8/2013, EUR 17,27 für DVGW-Mitglieder, EUR 23,03<br />
für Nicht-Mitglieder<br />
Einspruchsfrist 31.12.2013<br />
W 392 Entwurf „Wasserverlust in Rohrnetzen - Ermittlung,<br />
Überwachung, Bewertung, Wasserbilanz, Kennzahlen“<br />
NEUERSCHEINUNG<br />
Mit seinen Ausführungen zu Inspektion und Wartung<br />
behandelt das DVGW-Arbeitsblatt W 392 vom Mai 2003<br />
zwei Kernaspekte des im September 2006 erschienenen<br />
DVGW-Arbeitsblatts W 400-3 „Technische Regeln Wasserverteilungsanlagen<br />
(TRWV); Teil 3: Betrieb und Instandhaltung“.<br />
Im Hinblick auf die weitere Entwicklung des Regelwerks<br />
und seine Anwenderfreundlichkeit liegt es somit<br />
nahe, alle konkreten Ausführungen zur Instandhaltung<br />
zukünftig in W 400-3 zusammenzufassen. So wurden nun<br />
die Ausführungen der alten W 392 zu Inspektion und Wartung<br />
grundlegend revidiert und in ein Beiblatt zur W 400-3<br />
ausgegliedert („W 400-3-B1“), das bei der zukünftigen<br />
Überarbeitung von W 400-3 integriert wird.<br />
Die neue W 392 konzentriert sich folglich ganz auf den<br />
Rohrnetz-Wasserverlust, seine Ermittlung, Überwachung<br />
und Bewertung. Dazu gehören die Erstellung der Wasserbilanz<br />
und die Bildung von Kennzahlen. Hier findet sich der<br />
eigentliche Anlass zur Überarbeitung des Regelwerks. Die<br />
alte W 392 basiert auf dem „spezifischen realen Wasserverlust“<br />
qVR). Die International Water Association (IWA)<br />
verwendet jedoch den „Infrastructure Leakage Index“ (ILI),<br />
um die Dichtheit von Netzen der öffentlichen Trinkwasserversorgung<br />
zu beurteilen. In der neuen W 392 wird<br />
deshalb der ILI zusätzlich aufgenommen und die Beziehung<br />
zwischen qVR und ILI dargestellt.<br />
Der ILI berücksichtigt neben der Länge der Haupt- und Versorgungsleitungen<br />
zusätzlich auch die Länge und Zahl der<br />
Anschlussleitungen, den durchschnittlichen Betriebsdruck<br />
sowie einen „unvermeidbaren jährlichen realen Verlust“.<br />
Was in Bezug auf Wasserverlust unvermeidbar ist, wird<br />
letztlich durch Erkennungs- und Eingriffsmöglichkeiten vorgegeben.<br />
Nach der neuen W 392 werden dieser unvermeidbare<br />
jährliche reale Verlust auf Basis einer internationalen<br />
Konvention berechnet und der ILI als Verhältnis des (tatsächlichen)<br />
jährlichen realen Verlusts zum unvermeidbaren<br />
jährlichen realen Verlust definiert.<br />
So kann es dazu kommen (besonders bei neuen Netzen),<br />
dass das „vermeintliche“ Minimum - ILI = 1,0 - sogar unterschritten<br />
wird. Setzt man allerdings ein viele Jahrzehnte<br />
bestehendes und immer nur schrittweise rehabilitierbares<br />
Netz voraus, das höchstens marginal ausgebaut wird, ist<br />
die Erreichung und Einhaltung dieses Minimums durchaus<br />
anspruchsvoll bzw. eine dauerhafte, deutliche Unterschreitung<br />
eher unrealistisch. Im Ergebnis ist der ILI bezüglich<br />
38 10 | 2013
RECHT & REGELWERK DVGW<br />
seiner Einflussfaktoren deutlich umfassender und realitätsnäher<br />
als der qVR. Demnach ist davon auszugehen, dass<br />
sich der ILI als aussagefähigere Kennzahl durchsetzen wird.<br />
Im Gegensatz zu qVR und ILI berücksichtigt der in der<br />
öffentlichen Diskussion meistens benutzte reale Wasserverlust<br />
in Prozent der Netzeinspeisung keinerlei Netzfaktoren<br />
(Netzlänge etc.). So führen bei gleichem absolutem<br />
Wasserverlust (in m 3 ) hohe Netzeinspeisungen (z. B. in Städten<br />
mit hohen Netzabgaben je Netzlänge) zu niedrigen<br />
Prozentwerten, geringe Netzeinspeisungen (z. B. auf dem<br />
Land mit niedrigen Netzabgaben je Netzlänge) zu hohen<br />
Prozentwerten. Im Vergleich erscheint daher ein Versorgungsunternehmen<br />
mit hoher spezifischer Netzeinspeisung<br />
besser als eines mit niedrigerer spezifischer Netzeinspeisung.<br />
Demzufolge ist der reale Wasserverlust in Prozent der<br />
Netzeinspeisung für Vergleiche (Benchmarks) ungeeignet.<br />
Auch anhand qVR und ILI können Versorgungsunternehmen<br />
mit unterschiedlichen Rohrnetzeinspeisungen nur bedingt<br />
verglichen werden. Vor diesem Hintergrund werden im<br />
neuen W 392 Äquivalenzwerte gebildet, die den qVR und<br />
ILI gewissermaßen auf eine einheitliche Rohrnetzeinspeisung<br />
(in diesem Fall 40 000 m³/a) normieren, um numerische<br />
Bewertungen und Vergleiche sowohl dieser beiden Verlustkennzahlen<br />
untereinander als auch zwischen verschiedenen<br />
Rohrnetzen/Versorgungsunternehmen angemessen<br />
zu ermöglichen.<br />
Die neue W 392 folgt also bezüglich der Berechnung des<br />
ILI der internationalen Konvention, orientiert sich aber<br />
hinsichtlich der Bewertung an der alten W 392. Denn die<br />
Überarbeitung soll durchaus einen internationalen Vergleich<br />
von Wasserverlusten ermöglichen, jedoch nicht den hiesigen<br />
Standard preisgeben. Welche Schlüsse aus einer konkreten<br />
Bewertung hinsichtlich Verlustvermeidung bzw. Netzinstandhaltung<br />
zu ziehen sind, hängt allerdings von weiteren<br />
Randbedingungen ab: Wasserdargebot und -beschaffenheit,<br />
Betriebsmanagement, Netzfaktoren, Umgebungsbedingungen.<br />
Dieser Aspekt wird jedoch nicht in W 392<br />
vertieft, sondern ist W 400-3 zugeordnet.<br />
Der Begriff Wasserverlustmanagement wird weder in der<br />
alten, noch in der neuen W 392 verwendet. Er beinhaltet<br />
nämlich in der internationalen Diskussion zur Minimierung<br />
des Wasserverlusts u.a. die gezielte Drucksteuerung (mit<br />
Druckabsenkungen in Zeiten niedrigen Bedarfs bis hin zu<br />
temporären Lieferunterbrechungen) und widerspricht insofern<br />
dem Anspruch einer hochwertigen, möglichst störungsfreien<br />
Wasserversorgung. Dessen ungeachtet bietet die<br />
neue W 392 auch weiterhin eine Basis für die Festlegung<br />
Bild: Lokalisation des Lecks mit einem Korrelator<br />
(Fotoquelle: Hermann Sewerin GmbH, Gütersloh)<br />
von Maßnahmen im Hinblick auf eine langfristige Minimierung<br />
des Wasserverlusts.<br />
Wie so oft, gilt hier ebenfalls: Die Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit<br />
der verantwortlichen Personen ist ausschlaggebend<br />
für die Güte der Wasserbilanz und Kennzahlberechnung.<br />
Schließlich sind einige Wasserentnahmen und weitere<br />
Faktoren abzuschätzen, die grundsätzlich nicht bzw. nur<br />
mit unverhältnismäßigem Aufwand direkt messbar sind.<br />
Die Abschätzung konkreter Werte bei Mess-, Ablese- und<br />
Abgrenzungsfehlern erfordert gleichfalls eine gründliche<br />
Plausibilitätskontrolle. Diese Fehler können im Einzelnen<br />
nur begrenzt minimiert werden, sollten sich aber über die<br />
Jahre ausgleichen.<br />
Die Ausführungen zu den genannten Fehlern wurden revidiert<br />
und nach Möglichkeit präzisiert, so dass die Wasserbilanz<br />
eine solidere Grundlage erhält. Im gleichen Sinne<br />
wurden die Methoden zur Überwachung des Wasserdurchflusses<br />
und zur Leckortung dem Stand der Technik angepasst.<br />
Zu guter Letzt kann die neue W 392 analog auch<br />
auf nichtöffentliche Netze (Arealnetze) sowie Roh- und<br />
Brauchwassernetze angewendet werden.<br />
Ausgabe 7/2013, EUR 22,27 für DVGW-Mitglieder, EUR 29,69<br />
für Nicht-Mitglieder<br />
Betrieb und Instandhaltung von Rohrnetzen<br />
Auslegen / Berechnen / Analysieren / Optimieren<br />
Fahrweisen / Regelungen / Zusammenhänge / Dynamik / Druckstoß<br />
Asset-Strategien / Spülplanung / Zielnetzplanung / Energieeffizienz<br />
3S Consult GmbH — mehr als 25 Jahre Engineering und Software — www.3sconsult.de<br />
10 | 2013 39
DVGW RECHT & REGELWERK<br />
GW 306 „Verbinden von Blitzschutzsystemen mit metallenen Gasund<br />
Trinkwasser-Installationen“<br />
NEUERSCHEINUNG<br />
Dieses Arbeitsblatt wurde gemeinschaftlich vom DVGW Deutscher<br />
Verein des Gas- und Wasserfaches e.V. und VDE Verband<br />
der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V.,<br />
Ausschuss für Blitzschutz und Blitzforschung (ABB) erarbeitet.<br />
Das Arbeitsblatt ist dem neuesten Stand der technischen und<br />
wissenschaftlichen Erkenntnisse angepasst.<br />
Zielgruppen sind:<br />
»»<br />
Fachbetriebe Gas- und Trinkwasser-Installation<br />
»»<br />
Gas- und Wasserversorger<br />
»»<br />
Fachbetriebe Blitzschutz<br />
»»<br />
Betreiber der Installation<br />
Gegenüber DVGW-Arbeitsblatt GW 306:1982-08 wurden<br />
folgende Änderungen vorgenommen:<br />
a) Aktualisierung der Verweise<br />
b) Anpassung an den Stand der Technik<br />
c) Aufführung von Hinweisen für die Praxis<br />
Ausgabe 9/2013, EUR 17,27 für DVGW-Mitglieder, EUR 23,03<br />
für Nicht-Mitglieder (Frühere Ausgaben: DVGW GW 306:1982-<br />
08, DVGW GW 306:1968, DVGW GW 306:1953, DVGW GW<br />
306:1937, DVGW GW 306:1932, DVGW GW 306:1921)<br />
GW 309 „Elektrische Überbrückung bei Rohrtrennungen“<br />
NEUERSCHEINUNG<br />
Dieses Arbeitsblatt wurde vom Projektkreis „Elektrotechnische<br />
Fragestellungen“ im Technischen Komitee „Außenkorrosion“<br />
überarbeitet. Die Überarbeitung wurde notwendig,<br />
da zu Grunde liegende, andere technische Regelwerke<br />
überarbeitet wurden.<br />
In den Erläuterungen werden auch Hinweise auf die Verfahrensweise<br />
in Sonderfällen gegeben. Zur Erleichterung für<br />
den Anwender wurde eine Checkliste erstellt.<br />
Gegenüber DVGW-Arbeitsblatt GW 309:1986-11 wurden<br />
folgende Änderungen<br />
vorgenommen:<br />
a) Aktualisierung der Verweise<br />
b) Anpassung an den Stand der Technik<br />
c) Aufführung von Hinweisen für die Praxis<br />
Ausgabe 9/2013, EUR 17,27 für DVGW-Mitglieder, EUR<br />
23,03 für Nicht-Mitglieder (Frühere Ausgaben DVGW GW<br />
309:1986-11)<br />
GW 381 Entwurf „Bauunternehmen im Leitungstiefbau<br />
- Mindestanforderungen“<br />
Einspruchsfrist 31.12.2013<br />
NEUERSCHEINUNG<br />
Das Arbeitsblatt wurde von einem Projektkreis erarbeitet,<br />
in dem die Sparten Fernwärme, Gas, Strom, Telekommunikation<br />
und Trinkwasser vertreten waren. Seitens der<br />
verschiedenen Sparten und Straßenbaulastträger haben<br />
sich im Lauf der Zeit die jeweiligen Anforderungsprofile<br />
für Bauunternehmen im Leitungstiefbau eigenständig<br />
entwickelt. Dabei stimmen die meisten Aspekte des Leitungstiefbaus<br />
vom Straßenaufbruch über die Grabenerstellung<br />
und -verfüllung bis zur Wiederherstellung der<br />
Straßenoberfläche und der begleitenden Verkehrssicherung<br />
für die verschiedenen Sparten überein, auch unter<br />
Berücksichtigung der einschlägigen Rechtsvorschriften.<br />
Somit lag es auf der Hand, eine Zusammenfassung der<br />
formalen, personellen und sachlichen Mindestanforderungen<br />
sowie von optionalen Kriterien vorzunehmen und<br />
eine einheitliche Bezugsgrundlage zu schaffen.<br />
Für den Bau der Leitung selbst und die diesbezüglichen<br />
Aspekte (insbesondere hinsichtlich sparten- und bauweisenspezifischer<br />
Kabel/Rohre/Umhüllungsmaterialien,<br />
Verbindungen, Überdeckungshöhen, Abstände, Bettungsbedingungen<br />
sowie zugehöriger Einbau-/Montagetechnologien,<br />
Gefahrenabwehrmaßnahmen und Qualifikationsanforderungen)<br />
gelten weiterhin uneingeschränkt die<br />
einschlägigen technischen Regeln und Rechtsvorschriften.<br />
Dies gilt nicht nur im Zusammenhang mit der offenen<br />
Bauweise, sondern insbesondere auch für die verschiedenen<br />
grabenlosen Bauweisen, mit denen zum Teil besondere<br />
Anforderungen hinsichtlich der oben genannten<br />
Aspekte verbunden sind. Schließlich werden verschiedene<br />
Bauweisen oftmals kombiniert (z. B. offene Bauweise für<br />
Versorgungsleitungen und Bodenverdrängungshammer<br />
für Anschlussleitungen).<br />
Man sieht den neun Textseiten (samt Vorwort) nicht an,<br />
wie viel an Arbeit und Abstimmung dahinter steht. Der<br />
unvorbelastete Leser kann mit hoher Wahrscheinlichkeit<br />
davon ausgehen, dass an Stellen, über die er stolpert,<br />
40 10 | 2013
RECHT & REGELWERK DVGW<br />
wo er sich ein Mehr - oder vielleicht auch Weniger -<br />
an Inhalt, Deutlichkeit oder Verbindlichkeit wünschen<br />
würde, der Projektkreis hart und gelegentlich mehrfach<br />
um den ausgewogenen Kompromiss gerungen hat. Im<br />
Mittelpunkt stand allzeit die Frage, wie man das wirklich<br />
Unverzichtbare, den gemeinsamen Nenner der zahllosen<br />
denkbaren Baustellen klar herausarbeitet und dennoch<br />
vermeidet, dass den vielen, oft auf lokale Bedürfnisse<br />
spezialisierten Tiefbauunternehmen irgendwelche unnötigen<br />
Steine in den Weg gelegt werden. Leitbild: Am<br />
Ende müssen alle Leitungen und Verkehrswegeflächen<br />
gemäß den Anforderungen der Leitungsbetreiber bzw.<br />
Straßenbaulastträger dauerhaft gebrauchstauglich sein.<br />
Dabei unterscheidet man zwei Arten von Mindestanforderungen.<br />
Nämlich solche, wonach das Tiefbauunternehmen<br />
ohne Wenn und Aber über einen gewissen Bestand<br />
an Personal und Ausstattung uneingeschränkt verfügen<br />
können muss, unabhängig davon, ob das Unternehmen<br />
an einem bestimmten Gerät etwa das volle Eigentumsrecht<br />
hat oder dieses „nur“ least. Und solche, wonach<br />
bestimmte Geräte auch durch einen Vertragspartner<br />
bereitgestellt bzw. entsprechende Leistungen durch Einsatz<br />
eines Nachunternehmers erbracht werden können.<br />
Im ersten Fall denke man schlicht an Geräte, die praktisch<br />
zu jeder Baustelle gehören, also tägliches Handwerkszeug<br />
bilden (z. B. Geräte zum Grabenverbau und zur Verdichtung<br />
der Grabenverfüllung). Im zweiten Fall geht es um<br />
Geräte, deren Bedeutung von lokalen Umständen und<br />
Bedürfnissen geprägt ist (z. B. zum Leerrohreinbau oder<br />
zur Oberflächenwiederherstellung).<br />
So erscheint folgender Hinweis im Vorwort theoretisch<br />
selbstverständlich, praktisch ist er es keineswegs: „Die<br />
Einhaltung der einschlägigen technischen Regeln und<br />
Rechtsvorschriften mit entsprechend qualifiziertem Personal<br />
und geeigneten Arbeitsmitteln für die Ausführung der<br />
Leistungen steht außer Frage.“ Denn genau dieser Hinweis<br />
offenbart den Rahmen, der bei der Auslegung der<br />
oben genannten Unterscheidung nicht verlassen werden<br />
darf. Er bildet die Richtschnur dafür, wie im konkreten<br />
Fall Fragen danach zu beantworten sind, wie etwa der<br />
folgende zentrale Satz des Arbeitsblattes auszulegen<br />
ist: „Die Ausstattungselemente nach Tabelle 5 bis 18<br />
sind nach Art, Anzahl und sonstigem Umfang jeweils so<br />
zu wählen/bemessen, dass alle betroffenen Baustellen/<br />
Mitarbeiter bedient bzw. berücksichtigt werden und diese<br />
Personen wiederum für die Bedienung der jeweiligen<br />
Ausstattung geeignet sind.“<br />
Auftraggeber erhalten damit nicht einfach ein Werkzeug,<br />
um ungeeignete Anbieter auszusieben. Zertifizierungsstellen<br />
und Gütegemeinschaften steht es frei, ihre<br />
Dienstleistungen anzubieten und sich dafür akkreditieren<br />
zu lassen. Doch unabhängig davon, ob ein Auftraggeber<br />
das Arbeitsblatt zur Präqualifikation nutzt bzw. Konformitätsbewertungen<br />
Dritter in Anspruch nimmt, gilt<br />
immer folgender Satz des Anwendungsbereichs: „Der<br />
Begriff Mindestanforderungen bedeutet hier, dass sich<br />
aus technischen Regeln und Rechtsvorschriften weitergehende<br />
Anforderungen ergeben können bzw. dass<br />
der Auftraggeber, insbesondere aufgrund besonderer<br />
Merkmale, Schutzbedürfnisse und sonstiger Randbedingungen,<br />
weitergehende Anforderungen stellen kann.<br />
Die optionalen Kriterien sind insofern, ohne Anspruch<br />
auf Vollständigkeit, als Hinweise für den Auftraggeber<br />
zu betrachten, der die Notwendigkeit weitergehender<br />
Anforderungen prüfen muss.“<br />
Nicht zuletzt offenbart sich der Anspruch des Arbeitsblatts<br />
in folgender Unterscheidung des Anwendungsbereichs:<br />
„Sofern ein Bauunternehmen mehrere Organisationseinheiten<br />
hat, gilt das Arbeitsblatt für die Organisationseinheiten,<br />
die mit Leitungstiefbau befasst sind,<br />
insbesondere gilt das Arbeitsblatt in Gänze für eigenständige<br />
Niederlassungen. Eigenständigkeit ist anzunehmen,<br />
wenn die Niederlassung den tatsächlichen Betriebsablauf<br />
maßgeblich selbst bestimmt bzw. wenn der Hauptbetrieb<br />
die Beaufsichtigung der Mitarbeiter und Baustellen<br />
nicht im gesamten erforderlichen Umfang leisten kann.“<br />
Spartenspezifische Aspekte wurden während der Arbeitsblatterarbeitung<br />
erwogen (etwa im Hinblick auf die Tatsache,<br />
dass viele Tiefbauunternehmen auch den Kabelzug<br />
anbieten), letztlich aber doch hier nicht weiter verfolgt.<br />
Ausgabe 8/2013, EUR 17,27 für DVGW-Mitglieder, EUR 23,03<br />
für Nicht-Mitglieder<br />
G 415 - Entwurf „Leitfaden für Planung, Bau und Betrieb von<br />
Biogasleitungen bis 5 bar Betriebsdruck“<br />
Einspruchsfrist 29.11.2013<br />
NEUERSCHEINUNG<br />
Dieses Arbeitsblatt wurde vom Projektkreis „Biogasleitungen“<br />
des Technischen Komitees „Gasverteilung“<br />
erarbeitet. In diesem DVGW-Arbeitsblatt sind in Form<br />
eines Leitfadens die Mindestanforderungen aus den<br />
DVGW-Regelwerken zusammenfassend dargestellt, die<br />
bei Planung, Bau und Betrieb von Gasleitungen, in denen<br />
Rohbiogas oder teilaufbereitetes Biogas fortgeleitet wird,<br />
von Planungsbüros, den bauausführenden Fachfirmen,<br />
den Betreibern und beteiligten Behörden zu beachten<br />
sind.<br />
Ausgabe 9/2013, EUR 22,27 für DVGW-Mitglieder, EUR<br />
29,69 für Nicht-Mitglieder<br />
10 | 2013 41
DVGW / DWA RECHT & REGELWERK<br />
G 451 „Bodenschutz bei Planung und Errichtung von<br />
Gastransportleitungen“<br />
NEUERSCHEINUNG<br />
Dieses Merkblatt wurde vom Projektkreis „G-PK-1-1-5<br />
Leitungsbau in Kulturböden“ im Technischen Komitee<br />
„G-TK-1-1 Gastransportleitungen“ erarbeitet.<br />
Bei der Errichtung von Gastransportleitungen sind zur<br />
Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben die Belange des<br />
Bodenschutzes zu berücksichtigen. Bereits bei ersten<br />
Planungsschritten wie Raumordnungsverfahren (ROV)<br />
und Umweltverträglichkeitsuntersuchung (UVU) sind aussagekräftige<br />
Angaben zur Inanspruchnahme und Erhaltung<br />
des Bodens als Produktionsfaktor für die Land- und<br />
Forstwirtschaft und als eigenständiges Schutzgut mit<br />
definierten Funktionen erforderlich. In den jeweiligen<br />
Planungen müssen diese Angaben konkretisiert und in<br />
den Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierungen abgearbeitet<br />
werden.<br />
In den privatrechtlichen Vereinbarungen mit den Grundstückseigentümern<br />
und -bewirtschaftern müssen zur<br />
Akzeptanz von Rohrleitungsbauvorhaben fachlich fundiert<br />
der Ablauf der Baumaßnahmen und die Wiederherstellungsmaßnahmen<br />
im Hinblick auf die Erhaltung der<br />
Böden niedergeschrieben und bei der Baudurchführung<br />
umgesetzt werden.<br />
Die Berücksichtigung der Hinweise in diesem Merkblatt<br />
hilft negative Auswirkungen auf Böden zu verhindern<br />
und insgesamt einen positiven wirtschaftlichen Beitrag<br />
bei entsprechenden Vorhaben sicherzustellen.<br />
Die nachfolgenden Ausführungen zur Planung und Durchführung<br />
von Rohrleitungsbaumaßnahmen berücksichtigen,<br />
dass bei Umsetzung der Anforderungen dieses<br />
Merkblattes der Aufwand für Meliorationsmaßnahmen<br />
gemindert und die Akzeptanz für die Errichtung von<br />
Gastransportleitungen erhöht wird.<br />
Eine angemessene Berücksichtigung der Bodenschutzbelange<br />
erfordert entsprechende Kenntnisse der Bodenkunde<br />
und der Rekultivierungsmaßnahmen. Diese Kenntnisse<br />
können durch eigenes Personal oder externe Fachleute<br />
eingebracht werden.<br />
Ausgabe 9/2013, EUR 22,27 für DVGW-Mitglieder,<br />
EUR 29,69 für Nicht-Mitglieder<br />
M 806 „Nachträge – Handreichungen zu Vergütungsanpassungen<br />
bei VOB-Verträgen“<br />
NEUERSCHEINUNG<br />
Im Verlauf der praktischen Umsetzung eines Bauvorhabens<br />
kommt es häufig vor, dass zusätzliche oder geänderte<br />
Leistungen erbracht werden müssen. In diesem Fall sind<br />
die Bauverträge anzupassen. Daraus können sich Vergütungsänderungen<br />
ergeben. Das Merkblatt DWA-M 806<br />
soll einen partnerschaftlichen Weg aufzeigen, wie Vergütungen<br />
für Nachtragsleistungen auf der Basis der VOB/B<br />
zwischen Bauherren und Unternehmer vereinbart werden<br />
können. Ziel ist es, die Kommunikation zwischen den<br />
Vertragspartnern bis zum einvernehmlichen Abschluss<br />
einer Vergütungsvereinbarung durch die Bereitstellung<br />
von Beispielen und Mustern zu verbessern. Das Merkblatt<br />
richtet sich an Unternehmer und Bauherren. Es befasst<br />
sich damit, wann und wie Vergütungsanpassungen – die<br />
sogenannten „Nachträge“ – notwendig werden, und<br />
wie der Weg zu einer Vereinbarung effizient gemanagt<br />
werden kann.<br />
Ausgabe 8/2013, 51 Seiten, ISBN 978-3-944328-04-1, EUR 61<br />
Newsletter bestellen: > www.<strong>3R</strong>-Rohre.de > Navigation „<strong>3R</strong> News > „Newsletter“<br />
INFO<br />
Der neue Newsletter –<br />
jetzt abonnieren<br />
GAS | WASSER | ABWASSER | PIPELINEBAU | SANIERUNG | KORROSIONSSCHUTZ | FERNWÄRME | ANLAGENBAU
RsV-Regelwerke<br />
RSV Merkblatt 1<br />
renovierung von entwässerungskanälen und -leitungen<br />
mit vor Ort härtendem Schlauchlining<br />
2011, 48 Seiten, DIN A4, broschiert, € 35,-<br />
RSV Merkblatt 2<br />
renovierung von Abwasserleitungen und -kanälen mit<br />
rohren aus thermoplastischen Kunststoffen durch<br />
Liningverfahren ohne ringraum<br />
2009, 38 Seiten, DIN A4, broschiert, € 29,-<br />
RsV Merkblatt 2.2<br />
renovierung von Abwasserleitungen und -kanälen mit<br />
vorgefertigten rohren durch TIP-Verfahren<br />
2011, 32 Seiten DIN A4, broschiert, € 29,-<br />
RsV Merkblatt 3<br />
renovierung von Abwasserleitungen und -kanälen durch<br />
Liningverfahren mit ringraum<br />
2008, 40 Seiten, DIN A4, broschiert, € 29,-<br />
RsV Merkblatt 4<br />
reparatur von drucklosen Abwässerkanälen und<br />
rohrleitungen durch vor Ort härtende Kurzliner (partielle Inliner)<br />
2009, 20 Seiten, DIN A4, broschiert, € 29,-<br />
RsV Merkblatt 5<br />
reparatur von entwässerungsleitungen und Kanälen<br />
durch roboterverfahren<br />
2007, 22 Seiten, DIN A4, broschiert, € 27,-<br />
RsV Merkblatt 6<br />
Sanierung von begehbaren entwässerungsleitungen und<br />
-kanälen sowie Schachtbauwerken - Montageverfahren<br />
2007, 23 Seiten, DIN A4, broschiert, € 29,-<br />
RECHT www.vulkan-verlag.de<br />
& REGELWERK DVGW<br />
RsV Merkblatt 6.2<br />
Sanierung von Bauwerken und Schächten<br />
in entwässerungssystemen<br />
2012, 41 Seiten, DIN A4, broschiert, € 35,-<br />
RsV Merkblatt 7.1<br />
renovierung von drucklosen Leitungen /<br />
Anschlussleitungen mit vor Ort härtendem Schlauchlining<br />
2009, 30 Seiten, DIN A4, broschiert, € 29,-<br />
RsV Merkblatt 7.2<br />
Hutprofiltechnik zur einbindung von Anschlussleitungen –<br />
reparatur / renovierung<br />
2009, 31 Seiten, DIN A4, broschiert, € 30,-<br />
RsV Merkblatt 8<br />
erneuerung von entwässerungskanälen und -anschlussleitungen<br />
mit dem Berstliningverfahren<br />
2006, 27 Seiten, DIN A4, broschiert, € 29,-<br />
RsV Merkblatt 10,<br />
Kunststoffrohre für grabenlose Bauweisen<br />
2008, 55 Seiten, DIN A4, broschiert, € 37,-<br />
RsV information 11<br />
Vorteile grabenloser Bauverfahren für die erhaltung und<br />
erneuerung von Wasser-, Gas- und Abwasserleitungen<br />
2012, 42 Seiten DIN A4, broschiert, € 9,-<br />
Auch als<br />
eBook<br />
erhältlich!<br />
Jetzt bestellen!<br />
Wissen für DIe<br />
Zukunft<br />
faxbestellschein an: +49 201 / 82002-34 Deutscher Industrieverlag oder GmbH abtrennen | Arnulfstr. und 124 im | fensterumschlag 80636 München einsenden<br />
Ja, ich / wir bestelle(n) gegen rechnung:<br />
___ ex. rSV-M 1 € 35,-<br />
___ ex. rSV-M 2 € 29,-<br />
___ ex. rSV-M 2.2 € 29,-<br />
___ ex. rSV-M 3 € 29,-<br />
___ ex. rSV-M 4 € 29,-<br />
___ ex. rSV-M 5 € 27,-<br />
___ ex. rSV-M 6 € 29,-<br />
Ich bin rSV-Mitglied und erhalte 20 % rabatt<br />
auf die gedruckte Version (Nachweis erforderlich!)<br />
___ ex. rSV-M 6.2 € 35,-<br />
___ ex. rSV-M 7.1 € 29,-<br />
___ ex. rSV-M 7.2 € 30,-<br />
___ ex. rSV-M 8 € 29,-<br />
___ ex. rSV-M 10 € 37,-<br />
___ ex. rSV-I 11 € 9,-<br />
zzgl. Versandkosten<br />
firma/Institution<br />
Vorname, Name des empfängers<br />
Straße / Postfach, Nr.<br />
Land, PLZ, Ort<br />
Telefon<br />
Telefax<br />
Antwort<br />
Vulkan-Verlag GmbH<br />
Versandbuchhandlung<br />
Postfach 10 39 62<br />
45039 Essen<br />
e-Mail<br />
Branche / Wirtschaftszweig<br />
Bevorzugte Zahlungsweise Bankabbuchung rechnung<br />
Bank, Ort<br />
Widerrufsrecht: Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B.<br />
Brief, fax, e-Mail) oder durch rücksendung der Sache widerrufen. Die frist beginnt nach erhalt dieser Belehrung in Textform.<br />
Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache an die Vulkan-Verlag GmbH,<br />
Versandbuchhandlung, Huyssenallee 52-56, 45128 essen.<br />
Bankleitzahl<br />
Ort, Datum, Unterschrift<br />
Kontonummer<br />
nutzung personenbezogener Daten: für die Auftragsabwicklung und zur Pflege der laufenden Kommunikation werden personenbezogene Daten erfasst und gespeichert. Mit dieser Anforderung erkläre ich mich damit einverstanden, dass ich<br />
von DIV Deutscher 10 | 2013 Industrieverlag oder vom Vulkan-Verlag per Post, per Telefon, per Telefax, per e-Mail, nicht über interessante, fachspezifische Medien und Informationsangebote informiert und beworben werde.<br />
43<br />
Diese erklärung kann ich mit Wirkung für die Zukunft jederzeit widerrufen.<br />
✘<br />
XfrSVM1212
PRODUKTE & VERFAHREN<br />
Wettercockpit für die Bauwirtschaft<br />
Planungssicherheit und eine präzise Begleitkalkulation sind für<br />
Bauunternehmen die zentralen erfolgskritischen Faktoren, um<br />
Termine und Budgets einzuhalten. Deshalb ist die virtic GmbH<br />
& Co. KG, Anbieter von mobilen Zeitwirtschaftslösungen aus<br />
Dortmund, jetzt Partner des Planungs- und Risikomanagementtools<br />
construction.weather-cockpit.com des Bauindustrieverbandes<br />
NRW. Das Wetterportal für die Bauwirtschaft wurde<br />
zusammen mit dem privaten Schweizer Wetterdienstleister<br />
mminternational entwickelt. Es ermöglicht die bessere Planung<br />
der Bauphasen, eine lückenlose Wetterdokumentation und die<br />
Minimierung von wetterbedingten Risiken.<br />
Das Wetter bestimmt am Bau wann, woran und wie lange<br />
gearbeitet werden kann. Schlechtwetterphasen verzögern den<br />
Zeitplan. Extreme Wetterereignisse können Schäden verursachen.<br />
Mit den präzisen Prognosen und Unwetterwarnungen<br />
des Wettercockpits können Gefahrensituationen frühzeitig<br />
erkannt werden. Die relevanten Wetterinformationen für einen<br />
bestimmten Ort können auch von mobilen Endgeräten wie<br />
Tablet-PCs und Smartphones abgerufen werden.<br />
Tool liefert Messdaten, Prognosen und<br />
Entscheidungshilfen<br />
Daneben lassen sich Spezialdarstellungen wie die Wetterampel<br />
für bestimmte Tätigkeiten und Gewerke vom Nutzer individuell<br />
konfigurieren. Bis zu 15 verschiedene Wetterparameter können<br />
beispielsweise für die Tätigkeit „Betonieren“ abgefragt<br />
werden. In diesem Fall zeigt die Ampel in dreistündiger Auflösung,<br />
wann in den nächsten drei bis fünf Tagen die Tätigkeit<br />
„Betonieren“ möglich ist. Professor Beate Wiemann, Hauptgeschäftsführerin<br />
des Bauindustrieverbandes NRW, ist dementsprechend<br />
stolz auf das neue System: „Mit diesem Dienst<br />
stellen wir der Bauwirtschaft ein wirksames Planungs- und<br />
Risikomanagementinstrument zur Verfügung, das technisch<br />
auf dem neuesten Stand ist und keine Wünsche offen lässt.“<br />
Neben der Planungssicherheit für die nächsten Tage ist für die<br />
Baubranche auch die Dokumentation gegenüber Dritten, seien<br />
es der Bauherr, Behörden oder Versicherungen, von eminenter<br />
Bedeutung. Mit den präzisen Daten, die das Wettercockpit<br />
für das Bautagebuch liefert, kann der Bauunternehmer eine<br />
lückenlose Dokumentation vorlegen und damit der Sorgfaltspflicht<br />
tagesaktuell nachkommen.<br />
Wetter und Personalkosten: erfolgskritische Faktoren<br />
am Bau<br />
Disponenten können die <strong>Vorschau</strong>-Daten des Wettercockpits<br />
für die Planung der Personal- und Maschineneinsätze<br />
auf ihren Baustellen nutzen und beispielsweise ihre Arbeit<br />
mit der virtic-Online-Disposition optimieren: Im „Dispo-<br />
Tool“ werden Termine komfortabel und übersichtlich<br />
mit der Maus angelegt, Mitarbeiter können ihre Termine<br />
über ihr Smartphone oder den PC abrufen. So erhält die<br />
Arbeitsvorbereitung eine neue Qualität.<br />
Für die Projektverantwortlichen und ihr Projektcontrolling<br />
liefert virtic tagesaktuelle Arbeitszeitdaten, mit denen<br />
eine unmittelbare Begleitkalkulation möglich wird. Hierzu<br />
erhalten die Mitarbeiter der Bauunternehmen Handys<br />
oder Smartphones. Über diese Mobiltelefone erfassen<br />
sie ihre Arbeitszeiten, die online auf die virtic-Server<br />
übertragen werden. Der Erfassungsdialog wird dabei so<br />
gestaltet, dass er einerseits sehr einfach ist, andererseits<br />
die erfassten Arbeitszeiten automatisiert zu vollständigen<br />
Stundenzetteln, Zeitkonten, Reisekostenabrechnungen<br />
verarbeitet und für das Controlling verwendet werden<br />
können.<br />
Das für Verbandsmitglieder kostenlose Tool ist ab sofort<br />
unter der Domain construction.weather-cockpit.com<br />
abrufbar.<br />
Korrosionsschutz von Klöpperböden<br />
Die HS-CAP ist ein speziell für den Korrosionsschutz von<br />
Klöpperböden entwickeltes wärmeschrumpfendes Formteil.<br />
Neu im Programm ist die HS-CAP-DN 300-400, die Rohrgrößen<br />
von DN 300 bis 400 abdeckt. Weiterhin erhältlich<br />
sind Endkappen der Nennweiten DN 40 bis DN 250. Charakteristisch<br />
für diese Produktfamilie ist der große Schrumpfbereich,<br />
der eine geringe Lagerhaltung ermöglicht. Besondere<br />
Merkmale sind:<br />
»»<br />
Keine Grundierung als Haftvermittler erforderlich<br />
»»<br />
Die Montage erfolgt direkt auf die gereinigte und vorgewärmte<br />
Rohroberfläche<br />
»»<br />
Einfache und schnelle Demontage<br />
»»<br />
Gute Verträglichkeit mit handelsüblichen<br />
Werksumhüllungen<br />
KONTAKT: HSP GmbH, Castrop-Rauxel<br />
44 10 | 2013
PRODUKTE & VERFAHREN<br />
Bohranlagen und Zubehör für jeden Untergrund<br />
HDD-Bohrungen treffen nicht immer auf vorhersehbare<br />
Baugrundverhältnisse. Bodenschichten aus Ton, Sand und<br />
Kies, gelegentlich mit eingelagertem grobem Schotter<br />
und Steinen, mit Abschnitten aus festen Sedimenten oder<br />
Festgestein kommen oft in wechselnder Reihenfolge und<br />
Erstreckung vor. Bohranlage und Bohrzubehör müssen in<br />
diesen stark variierenden Verhältnissen effektiv arbeiten.<br />
Die Lösung der TRACTO-TECHNIK GmbH für diese<br />
anspruchsvollen Baugrundherausforderungen ist die Bohranlage<br />
18 ACS (All Condition System). Diese Allround-Bohranlage<br />
ist für Standardbohrungen mit dem TD-Bohrgestänge<br />
und für rasch wechselnde felsige Formationen mit<br />
einem Doppelrohrgestänge ausgerüstet. Abgestimmt auf<br />
die jeweiligen spezifischen Anforderungen steht zudem<br />
durchgängig kompatibles Werkzeug und Zubehör zur<br />
Verfügung.<br />
Der 1,55 m lange Rockbreaker für die Pilotbohrung gehört<br />
zum zentralen Bestandteil der Felsbohrausrüstung. Er wird<br />
über das Außenrohr angetrieben und gesteuert. Der Neigungswinkel<br />
(Bent sub) lässt sich werksseitig stufenlos von<br />
1,75° bis 2,25° einstellen. Die Rollenmeißel an der Spitze<br />
sind in mehreren Varianten erhältlich und werden mit maximal<br />
2.500 Nm bei bis zu 350 U 1/min über das Innenrohr<br />
angetrieben, dessen Steckdrehverbindungen einfach und<br />
zeitsparend fixierbar sind. Ortung und Steuerung können<br />
mit dem direkt hinter den Rollenmeißeln montierten Sender<br />
präziser und bereits nach kurzer Bohrdistanz vorgenommen<br />
werden. Der geringe Bentonitverbrauch (von 20-50 l/ min)<br />
bei gleichzeitig hoher Bohrleistung reduziert Kosten für<br />
Beschaffung, Aufbereitung und Entsorgung der Bohrspülung.<br />
Direkt nach der Pilotbohrung kann mit einem 6“<br />
Holeopener – in der Endstufe bis 20“ – aufgeweitet werden.<br />
Für den bestmöglichen Bohrfortschritt in jedem Boden<br />
bietet TT eine breite Palette an Bohrköpfen und Räumwerkzeugen,<br />
die robust und langlebig konstruiert sind.<br />
Durch Formgebung und Bestückung lassen sich feinsandige<br />
bis felsige Formationen abbauen und von der Bohrspülung<br />
unterstützt gut austragen. Für eine erfolgreiche<br />
und effiziente Bohrung liefert TT neben dem Equipment<br />
für Zugkraftmessungen auch eine Software, mit der die<br />
Trasse zunächst exakt vorausberechnet und später präzise<br />
dokumentiert wird.<br />
KONTAKT: TRACTO-TECHNIK GmbH & Co. KG, Lennestadt,<br />
Tel. +49 2723 8080, www-hdd-bohrzubehoer.de<br />
PP-Rohrmaterial mit verbesserten Eigenschaften<br />
Mit dem Werkstoff SABIC ® PP RELY 61EK61 PS bringt<br />
Sabic ein Rohrmaterial auf Polypropylenbasis auf den<br />
Markt, das den steigenden Anforderungen an Rohrmaterialien<br />
im Rohrleitungstiefbau entsprechen soll. Die<br />
neue Güteklasse ist eine Erweiterung der fortschrittlichen<br />
RELY-Produktreihe von SABIC, die bislang SABIC ®<br />
PP RELY und SABIC ® Vestolen A RELY umfasst und zu<br />
einer nachhaltigeren Produktion und Verwendung von<br />
Druckrohren beiträgt. Das neue Material ist das Ergebnis<br />
mehrerer Jahre umfangreicher Forschung zur Herstellung<br />
einer PP-Rohr-Güteklasse mit hohem Molekulargewicht<br />
und individueller Kautschukpartikelverteilung. Dabei<br />
profitieren verarbeitende Unternehmen von den intrinsischen<br />
Eigenschaften des Produkts, die in schwierigen<br />
Umgebungen, in denen die Bodenbedingungen Materialien<br />
mit hohem Steifigkeitsgrad erfordern, aufrechterhalten<br />
werden. Zu diesen Eigenschaften zählen ein<br />
breites Verarbeitungsfenster sowie eine hohe Steifigkeit<br />
in Kombination mit hoher<br />
Schlagzähigkeit selbst bei<br />
niedrigen Temperaturen.<br />
Das in Europa produzierte<br />
SABIC ® PP RELY<br />
61EK61 PS erfüllt überdies<br />
die strengen Vorgaben<br />
der Branche,<br />
EN 3476 und EN 1852<br />
für Rohrleitungssysteme<br />
mit profilierter Wandung<br />
und kompakte<br />
Vollwandrohrleitungssysteme<br />
für verschiedene<br />
Rohrleitungsmaße.<br />
KONTAKT: Sabic Europe, Sittard (Niederlande)<br />
10 | 2013 45
PRODUKTE & VERFAHREN<br />
DIBt-Zulassung für PERFECT-Liner erteilt<br />
Mehrere namhafte deutsche Prüfinstitute waren in den<br />
vergangenen Monaten involviert, um das neue Rohrsystem<br />
PERFECT PIPE von Beton Müller als Ganzes und<br />
einzelne Bestandteile des Systems im Speziellen auf ihre<br />
Einsatztauglichkeit für die Abwasserableitung zu testen.<br />
Während in der Frühphase der Produktentwicklung<br />
begleitende Tests zur Optimierung des Systems herangezogen<br />
wurden, bildeten zahlreiche zuletzt durchgeführte<br />
Teststellungen die Grundlage für die Zulassung durch das<br />
Deutsche Institut für Bautechnik. Sowohl die chemische<br />
als auch die physikalische Eignung des Liners mussten in<br />
allen relevanten Aspekten nachgewiesen werden, da es<br />
sich bei dem Beton-Kunststoff-Verbundrohr mit HDPE-<br />
Liner und Steckverbindung um eine Neuerung für den<br />
Rohrleitungsbau handelt, die nicht durch bereits erteilte<br />
Zulassungen abgedeckt wurde. Als besonders beachtensund<br />
damit auch prüfenswert erachtet wurde die dauerhafte<br />
Verbindung des PERFECT HDPE-Liners mit dem<br />
Betonrohr. Diese feste Verbindung der beiden Werkstoffe<br />
ist es auch, die letztlich die beiden wesentlichen Merkmale<br />
des Rohres – die dauerhafte Korrosionsbeständigkeit<br />
und die hohe statische Belastbarkeit – ausmacht.<br />
KONTAKT: Bernhard Müller GmbH, Achern<br />
Brandschutzmanschette durch Handel und Praxis<br />
ausgezeichnet<br />
Am 20. September wurde die Brandschutzmanschette<br />
Curaflam ® SMPro in diesem Jahr erneut preisgekrönt. Sie<br />
wurde im Rahmen der MEMO Fach-Messe der Mosecker<br />
GmbH in Münster mit dem Innovationspreis ausgezeichnet.<br />
Der Award wird von einer unabhängigen Jury vergeben.<br />
Die jeweiligen Preisträger werden aus einer Fülle von Produktinnovationen<br />
in den Kategorien Technik, Design und<br />
Installationstechnik ermittelt. Ein großer Teil der Jurymitglieder<br />
besteht aus Planern oder aus erfahrenen Inhabern<br />
namhafter Fachhandwerksbetriebe.<br />
Daher stand der technisch-innovative Ansatz und der praktische<br />
Nutzen der Brandschutzmanschette SMPro klar im<br />
Vordergrund: „Handel und Praxis“ haben den Ausschlag für<br />
diese positive Entscheidung gegeben. Neben Bewertungskriterien<br />
wie Anwendernutzen und hohe Qualität wurde<br />
auch außergewöhnliches Design bewertet. Denn die besondere<br />
Stärke der Curaflam ® SMPro ist ihre einfache Handhabung<br />
und hohe Praxistauglichkeit: Ausgestattet mit der<br />
zukunftsweisenden, modularen Segment-Technik zeichnet<br />
sich die Brandschutzmanschette durch hohe Flexibilität aus.<br />
Viele gängige Rohrsysteme mit Rohraußendurchmessern<br />
von 32 bis 160 mm können problemlos und zügig abgeschottet<br />
werden. Das heißt, das Brandschutzprodukt kann<br />
Curaflam ® Segmentmanschette SMPro – Manschette, Box mit<br />
Segmenten und Zubehör<br />
vor Ort an die jeweiligen Baustellenbedingungen angepasst<br />
werden, eine langwierige Vorauswahl des Produktes entfällt<br />
für den Ausführenden.<br />
KONTAKT: Doyma GmbH & Co, Durchführungssysteme, Oyten,<br />
Tel. +49 4207-9166-270, E-Mail: pr@doyma.de, www.doyma.de<br />
46 10 | 2013
PRODUKTE & VERFAHREN<br />
Variabler Ausgleichsring für Rohrverbindungen<br />
Ein Bauteil für viele verschiedene Verbindungen: Der Flexring<br />
von Flexseal realisiert den schnellen und einfachen<br />
Übergang von Steinzeugrohren auf andere Rohrarten<br />
(z. B. KG, SML, GGG, GFK, Eternit). Der bauaufsichtlich<br />
zugelassene Ausgleichsring meistert nahezu jede Herausforderung<br />
in der Rohrverbindungstechnik. Mit den<br />
praktischen FlexPack-Sets, bestehend aus einem oder<br />
zwei Flexringen und passender Manschette, lassen sich<br />
alle Rohre der Nennweitenklassen 100, 150 und 200<br />
miteinander verbinden.<br />
Flexring ist aus einem hochwertigen Elastomer nach<br />
DIN 681-1 gefertigt und entspricht in vollem Umfang der<br />
DIN EN 295-4. Dank moderner Fertigungstechniken verfügen<br />
die Flexseal-Ausgleichsringe über einen speziellen<br />
Querschnitt, der<br />
die Abdichtung bei<br />
rauen Rohroberflächen<br />
verbessert.<br />
Der erhöhte<br />
Dichtungsdruck<br />
bewirkt vor<br />
allem bei Niederdruckrohren<br />
eine<br />
besonders hohe<br />
Dichtleistung.<br />
KONTAKT: Flexseal<br />
GmbH, Eschwege<br />
Universelle Rohrkupplung für Abwasserrohrleitungen<br />
Mit der AWADUKT FLEX-CONNECT-Rohrkupplung bietet<br />
Rehau eine sichere und wirtschaftliche Alternative zu klassischen<br />
Manschettendichtungen. Für die Sanierung von Kanalleitungen<br />
ist vor allem aufgrund der hohen Anzahl unterschiedlicher<br />
Werkstoffe eine universelle und vor allem wirtschaftliche<br />
Lösung gefragt, wenn es um die Verbindung neuer<br />
und bestehender Leitungen geht. Die neue Rohrkupplung von<br />
Rehau verspricht nicht nur eine schnelle und einfache Lösung<br />
des Problems, sondern sorgt auch für erhebliche Einsparungen:<br />
Mit nur acht Produktvarianten für den Abmessungsbereich<br />
DN 110 bis DN 630 ist die Rohrkupplung für jeden Anwendungsfall<br />
gewappnet. Unabhängig von Werkstoff, Oberflächenstruktur,<br />
Wanddicke und Außendurchmesser können<br />
Leitungen miteinander verbunden werden.<br />
Der Einsatz erstklassiger Werkstoffe<br />
wie PP, EPDM und Edelstahl sowie<br />
die zusätzliche Q-TE-C Dichtung<br />
sorgen für eine zuverlässige<br />
Verbindungsqualität. Die Einstecktiefe<br />
der Kupplung bis zu<br />
20 % größer als bei herkömmlichen<br />
Standardkupplungen. Eine<br />
geprüfte Dichtheit bis 2,5 bar<br />
sowie extra breite Edelstahlbänder<br />
bieten zusätzliche Sicherheit.<br />
Die DIBt-Zulassung wurde beantragt.<br />
KONTAKT: REHAU AG + Co, Erlangen<br />
Endlos schwenkbarer Fräsarm mit 360° drehbarer<br />
Kamera<br />
Die selbstfahrenden Fräsroboter der Reihe IBG HydroCut 150<br />
und 200 haben ein funktionales Facelift bekommen. Sie sind<br />
nun mit einer Kamera (480 TV-Linie) am Fräsarm ausgestattet,<br />
die sich um 360° drehen lässt. Die hochauflösenden LEDs<br />
sorgen zudem für eine verbesserte Beleuchtung am Ort des<br />
Geschehens und machen ein noch präziseres Arbeiten möglich.<br />
Eine weitere Entwicklung stellt<br />
die neu verarbeitete hydraulische<br />
Drehdurchführung für das Hochdruckwasser<br />
bis maximal 250 bar mit<br />
Schleifring am Fräsarm dar, die die<br />
Beweglichkeit erweitert. Der Fräsarm<br />
ist nun endlos schwenkbar.<br />
KONTAKT: IBG HydroTech GmbH, Büdingen<br />
10 | 2013 47
FACHBERICHT ABWASSERENTSORGUNG / SANIERUNG<br />
Auswirkungen und Folgekosten<br />
unzureichender Planung, Ausschreibung<br />
und Ausführung bei Kanalsanierungen<br />
Je nach Sanierungsverfahren werden Nutzungsdauern bis zu 50 Jahre, teilweise noch länger angesetzt. Diese langen<br />
Nutzungsdauern werden aber nur erreicht, wenn Planung, Ausschreibung und Ausführung optimal durchgeführt werden.<br />
Gibt es in einer dieser Phasen Defizite, kann sich die Nutzungsdauer erheblich reduzieren, was entsprechende Folgekosten<br />
nach sich zieht. Defizite werden oft erst zu einem Zeitpunkt festgestellt, wenn seitens des Kanalnetzbetreibers keine Ansprüche<br />
mehr geltend gemacht werden können. Im nachfolgenden Beitrag werden diese Zusammenhänge beschrieben und an einigen<br />
Zahlenbeispielen aufgezeigt, welche Folgekosten entstehen können.<br />
EINLEITUNG<br />
Die Kanalisation in Deutschland ist schadhaft und es besteht<br />
teils erheblicher Sanierungsbedarf. Die festgestellten Mängel<br />
beruhen sehr oft auf Planungs-, Ausführungs- oder Überwachungsfehlern,<br />
die frühzeitig erhebliche Investitionen erforderlich<br />
machen, ohne dass die Verantwortlichen in Regress<br />
genommen werden können. Die finanziellen Mittel sind<br />
begrenzt, so dass diese möglichst effizient eingesetzt werden<br />
müssen.<br />
Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, sind folgende<br />
äußerst wichtige Voraussetzungen unabdingbar:<br />
»»<br />
fachgerechte Sanierungsplanung durch speziell dafür<br />
ausgebildete Fachleute<br />
»»<br />
rechtskonforme und qualifizierte Ausschreibung auf<br />
Basis von VOB-konformen Vertragsbedingungen und<br />
Anforderungen<br />
»»<br />
Ausführung der Sanierungsleistung durch Fachfirmen<br />
»»<br />
intensive Bauüberwachung<br />
Bild 1: Kanaltrasse mit großer Höhendifferenz<br />
GRUNDLAGEN<br />
Es ist Aufgabe des Sanierungsplaners, dem jeweiligen Schadenszustand<br />
bzw. Entwässerungsobjekt die geeignete Sanierungstechnik<br />
zuzuweisen. Hierbei müssen zunächst die Leistungsanforderungen<br />
der DIN EN 752 [1] (Anforderungen an<br />
ein saniertes System sind prinzipiell identisch mit den Anforderungen<br />
an ein neues System) in den Blick genommen werden:<br />
»»<br />
die hydraulische Leistungsfähigkeit darf durch die Sanierung<br />
nicht unverträglich reduziert werden<br />
»»<br />
der Betrieb und die Unterhaltung dürfen nach der Sanierung<br />
nicht eingeschränkt sein<br />
»»<br />
die Werkstoffauswahl (Sanierungsmaterialien) muss den<br />
chemischen Anforderungen genügen<br />
»»<br />
die Standsicherheit muss gewährleistet werden<br />
»»<br />
die Werterhaltung der baulichen Anlage muss berücksichtigt<br />
werden<br />
»»<br />
Auswirkungen auf die Umwelt dürfen in negativer Hinsicht<br />
nicht entstehen<br />
Zur Sanierung von Schäden in Kanälen gibt es meistens mehrere<br />
technische Möglichkeiten, die sich in die Hauptgruppen<br />
Reparatur, Renovierung und Erneuerung einteilen lassen. In<br />
der DIN EN 15885 [2] ist die Zuordnung und Einteilung der<br />
Sanierungstechniken geregelt.<br />
Das ideale, universell einsetzbare Sanierungsverfahren gibt es<br />
nicht. Jedes Sanierungsverfahren hat Einsatzgrenzen, die durch<br />
das Schadensbild selbst, die speziellen Gegebenheiten der<br />
Kanalhaltung selber und die Umgebungssituation vorgegeben<br />
sind und über die Eignung oder Einsetzbarkeit eines Verfahrens<br />
im jeweiligen Fall entscheiden. Darüber hinaus haben die<br />
Sanierungsverfahren auch unterschiedliche Nutzungsdauern.<br />
Die Qualitätssicherung für eine erfolgreiche Kanalsanierungsmaßnahme<br />
fängt bereits bei der Auswahl eines geeigneten<br />
Planers an, geht über eine fach- und sachgerechte Planung und<br />
Ausschreibung, sowie die Auswahl einer geeigneten Fachfirma<br />
bis hin zur qualifizierten Bauüberwachung.<br />
Fehler, die im frühen Stadium (z. B. durch die Auswahl eines<br />
ungeeigneten Planers) gemacht werden, können später nicht<br />
mehr ausgeglichen werden. Es ist ein Trugschluss anzunehmen,<br />
dass eine unzureichende Planung und Ausschreibung<br />
48 10 | 2013
ABWASSERENTSORGUNG / SANIERUNG FACHBERICHT<br />
Bild 2: Nicht fachgerecht angeschlossener Zulauf mit großem<br />
Ausbruch<br />
Bild 3: Nicht fachgerecht angeschlossener Zulauf mit<br />
GW-Zutritt<br />
durch die Auswahl einer Fachfirma ausgeglichen werden kann.<br />
Die ausführenden Firmen unterliegen alle dem Wettbewerb<br />
und liefern nur, was vertraglich bestellt wurde. Die VSB-Empfehlung<br />
Nr. 0.1 [3] beschreibt ausführlich, welche Schritte bei<br />
einer Sanierungsplanung durchzuführen sind.<br />
SANIERUNGSPLANUNG<br />
Unter Sanierungsplanung ist nicht nur die bloße Zuweisung<br />
eines Sanierungsverfahrens zu einem Schaden zu verstehen.<br />
Die Sanierungsplanung ist Grundlage für Ausschreibung und<br />
Ausführung und muss alle relevanten Randbedingungen<br />
berücksichtigen und so detailliert aufgebaut sein, dass ein Bieter<br />
auf dieser Basis VOB-konform ein Angebot erarbeiten und<br />
später damit die Abwicklung der Maßnahme erfolgen kann.<br />
Um beurteilen zu können, ob ein bestimmter Schaden mit<br />
einem Sanierungsverfahren behoben werden kann, ist<br />
umfangreiches Wissen über die am Markt vorhandenen<br />
Sanierungsverfahren erforderlich. Weiterhin müssen alle<br />
planungsrelevanten Randbedingungen bei der Kanalsanierungsplanung<br />
berücksichtigt werden. So kann z.B. schon die<br />
Lage oder Größe von Schächten ein Sanierungsverfahren<br />
ausschließen.<br />
Ohne diese Kenntnisse ist der Sanierungsplaner nicht in der<br />
Lage zu beurteilen, ob ein Sanierungsverfahren geeignet ist<br />
oder nicht. Diese Entscheidung darf auch nicht der ausführenden<br />
Firma überlassen werden. Im günstigen Fall kommt es<br />
später zu einem berechtigten Nachtrag, wenn das ausführende<br />
Unternehmen vor der Durchführung der Sanierung feststellt,<br />
dass das auf Basis der Ausschreibung angebotene Verfahren<br />
im speziellen Fall ungeeignet ist. Im ungünstigen Fall wird eine<br />
Sanierung durchgeführt, die die an sie gestellten Anforderungen<br />
nicht erfüllt und frühzeitig versagt.<br />
AUSSCHREIBUNG<br />
Öffentliche Auftraggeber sind auf Grundlage der Vergabeverordnung<br />
[4] zur Anwendung der VOB [5] verpflichtet.<br />
Ausgeschriebene Leistungen sind nach §7 VOB/A umfassend<br />
und für jeden gleichermaßen verständlich (interpretationsfrei)<br />
zu beschreiben und ohne umfangreiche Vorarbeiten (z. B.<br />
Ortsbegehungen) kalkulierbar zu machen.<br />
Dem Auftragnehmer darf dabei kein ungewöhnliches Wagnis<br />
aufgebürdet werden für Umstände und Ereignisse, auf die er<br />
keinen Einfluss hat und deren Einwirkung auf die Preise und<br />
Fristen er nicht im Voraus abschätzen kann.<br />
Wettbewerbseinschränkende Vorgaben, z. B. dass warmwasserhärtende<br />
Schlauchliner nicht angeboten werden dürfen,<br />
sind unzulässig, es sei denn es gibt technische Gründe hierfür<br />
(z. B. die Topografie, hier die große Höhendifferenz, Bild 1).<br />
Diese Grundanforderungen bedingen im Vorfeld eine qualifizierte,<br />
verbindliche Fachplanung.<br />
Eine Ausschreibung muss also so aufgebaut sein, dass der Bieter<br />
anhand der zur Verfügung gestellten Unterlagen alle Informationen<br />
bekommt, um ein verbindliches Angebot erstellen zu<br />
können und nicht spekulieren muss.<br />
Würde der Planer beispielsweise bei den in den Bildern 2 und 3<br />
dargestellten Stutzen jeweils eine „Standard-Stutzensanierung“<br />
vorsehen und ausschreiben, wären bei der Ausführung Nachträge<br />
vorprogrammiert, da diese beiden Stutzen nicht mit allen<br />
am Markt vorhandenen Stutzensanierungsverfahren sanierbar<br />
sind. Bei dem Stutzen in Bild 2 gibt es Einschränkungen wegen<br />
der starken Undichtigkeit im Ringspalt und bei dem Stutzen in<br />
Bild 3 schränkt das Rohrmaterial die Möglichkeiten ein.<br />
Für Schlauchlining gibt es bereits Allgemeine Technische Vertragsbedingungen<br />
(ATV) in der DIN 18326 VOB/C [5], die bei<br />
Vereinbarung der VOB als Vertragsgrundlage Vertragsbestandteil<br />
werden. Als Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen<br />
(ZTV) kann das Merkblatt DWA-M 144-3 [6] vereinbart werden.<br />
In weiteren Vertragsbedingungen, sowie in den Positionstexten<br />
werden dann die auf die spezielle Baumaßnahme<br />
abgestimmten Vorgaben definiert und beschrieben. Für<br />
andere Sanierungsverfahren muss das Anforderungsprofil<br />
objektbezogen selbst definiert werden, z. B. auf Basis der<br />
VSB-Empfehlungen.<br />
Im Abschnitt 0 der DIN 18326 [5] wird vorgegeben, welche<br />
Angaben der Ausschreibende zu machen hat. Hierzu gehören<br />
z.B. Angaben zur Wassermenge (minimal und maximal),<br />
10 | 2013 49
FACHBERICHT RECHT & REGELWERK<br />
Verkehrssicherung, Vorflutsicherung, Statik, Wanddicke, erforderliche<br />
Vorarbeiten, Angaben zu den Schächten, Lage und<br />
Anschlusswinkel von Zuläufen, usw. Analog kann diese Auflistung<br />
objektbezogen auch für andere Sanierungsverfahren<br />
angewendet werden.<br />
Bild 4 zeigt ein Beispiel, wie die haltungsbezogenen Informationen<br />
zusammenfassend den Bietern zur Angebotsbearbeitung<br />
zur Verfügung gestellt werden können.<br />
Bild 4: Mögliche zusammenfassende Darstellung des<br />
Planungsergebnisses<br />
Bild 5: Abhängigkeit der erforderlichen Wanddicke von der<br />
örtlichen Vorverformung<br />
Fehler und Konsequenzen<br />
Erneuerung<br />
Schlauchlinereinbau<br />
Erneuerung<br />
Bild 6: Verlauf Projektkostenbarwert geplant<br />
Erneuerung<br />
11.04.2013 Dipl.-Ing. Roland Wacker 1<br />
FEHLER UND MÄNGEL BEI EINEM SCHLAUCHLINER,<br />
DIE DIE NUTZUNG BEEINTRÄCHTIGEN<br />
Bei einem Schlauchliner kann es eine Vielzahl von Fehlern und<br />
Mängel geben, die die spätere Nutzung einschränken bzw.<br />
verkürzen können, z. B.<br />
»»<br />
Schlauchlining ist das falsche Sanierungsverfahren für<br />
das vorhandene Schadensbild<br />
»»<br />
Vorarbeiten wurden nicht ordnungsgemäß ausgeführt<br />
»»<br />
Randbedingungen für Statik wurden falsch eingeschätzt<br />
»»<br />
Fertigungsfehler<br />
»»<br />
Einbaufehler (Falten, Fehlbohrungen usw.)<br />
Auf einige Punkte soll etwas detaillierter eingegangen werden<br />
und die Folgen beschrieben werden.<br />
DIN 18326 (VOB/C [5]) gibt vor, dass den Bietern die Wanddicken<br />
der Schlauchliner vorzugeben sind. Im Merkblatt<br />
DWA-M 144-3 [6], das als ZTV vereinbart werden kann, sind<br />
Regelstatiktabellen zur Vordimensionierung der Schlauchliner<br />
für den Standardfall (Altrohrzustand II, Mindestwerte der<br />
Imperfektionen entsprechend ATV-M 127-2 [8]) für verschiedene<br />
Materialkenngruppen und Grundwasserstände enthalten.<br />
Der Ausschreibende muss im Vorfeld der Ausschreibung<br />
prüfen, ob die dortigen Randbedingungen auf die konkrete<br />
Maßnahme zutreffen.<br />
Am folgenden Beispiel soll gezeigt werden, welchen Einfluss<br />
eine falsche Einschätzung auf die Wanddicke hat:<br />
Beispiel 1: Fehler bei der Wanddickenwahl<br />
Bei dem im Altrohrzustand II anzusetzenden Mindestwasseraußendruck<br />
von 1,5 m Wassersäule über Rohrsohle beträgt die<br />
erforderliche Wanddicke bei Materialkenngruppe 15 für einen<br />
Schlauchliner DN 500 entsprechend den Regelstatiktabellen<br />
im DWA-M 144-3 [6] 3,3 mm. Hierbei handelt es sich um die<br />
Verbunddicke ohne Folien und Reinharzschichten.<br />
Beträgt die örtliche Vorverformung nicht 2 %, sondern 4 %,<br />
muss die Wanddicke 4,3 mm betragen, was aber aus den<br />
Regelstatiktabellen nicht abgelesen werden kann, sondern<br />
durch Einzelberechnung nach ATV-M 127-2 [8] ermittelt werden<br />
muss. Bild 5 zeigt z.B. den Verlauf der erforderlichen<br />
Wanddicke in Abhängigkeit der örtlichen Vorverformung.<br />
Bei einem Bemessungswasseraußendruck von 3,0 m anstatt<br />
1,5 m erhöht sich die erforderliche Wanddicke auf 4,1 mm.<br />
Liegen die beiden beschriebenen geänderten Randbedingungen<br />
gleichzeitig vor, muss die Wanddicke sogar 5,4 mm<br />
betragen. Würde hier ein Schlauchliner entsprechend den<br />
Regelstatiktabellen mit 3,3 mm eingebaut, wäre dieser stark<br />
unterdimensioniert.<br />
Diese Ausführungen zeigen, dass in der Planungs- und Ausschreibungsphase<br />
größter Wert darauf gelegt werden muss,<br />
50 10 | 2013
ABWASSERENTSORGUNG / SANIERUNG FACHBERICHT<br />
dass diese Randbedingungen richtig ermittelt werden. Ein zu<br />
dünn bemessener Liner beult im Falle der statischen Überlastung<br />
ein und kann zu einem hydraulischen Problem mit Rückstauereignis<br />
und entsprechendem Schadenspotential führen.<br />
Fehler und Konsequenzen<br />
Erneuerung<br />
Erneuerung<br />
Beispiel 2: Abweichung von der geplanten<br />
Nutzungsdauer<br />
In nachfolgendem Beispiel sei ein Schlauchliner für eine Nutzungsdauer<br />
von 50 Jahren ausgelegt. Die Kosten des Schlauchliners<br />
werden mit 20.000 €, die Kosten für eine Erneuerung<br />
mit einer Nutzungsdauer von 80 Jahren werden mit 50.000 €<br />
angesetzt. Nach Ablauf der Nutzungsdauer wird jeweils eine<br />
Erneuerung angenommen. Erreicht der Liner wegen fehlerhafter<br />
Planung, unzureichender Ausschreibung oder nicht<br />
fachgerechter Ausführung die ihm zugedachte Nutzungsdauer<br />
nicht, entstehen dem Auftraggeber zusätzliche Kosten.<br />
Bild 6 zeigt im Variantenvergleich den Verlauf der Projektkostenbarwerte,<br />
bei planmäßiger Nutzungsdauer und Bild 7 den<br />
Verlauf, wenn der Liner bereits nach 20 Jahren, z. B. wegen<br />
zu geringer Wanddicke, versagen würde (nach KVR-Leitlinien<br />
[7] bei einem Realzins von 3 %).<br />
Dem Auftraggeber entstehen zusätzliche Kosten, wenn der<br />
Schlauchliner seine vorgesehene Nutzungsdauer nicht erreicht.<br />
Deshalb sollte der Kanalnetzbetreiber seine Verträge mit dem<br />
Ingenierbüro und der ausführenden Firma so gestalten, dass<br />
er die zu erwartenen Zusatzkosten vor Ausbezahlung der<br />
Schlussrechnungen geltend machen kann<br />
Beispiel 3: Mehrkosten durch Falten<br />
Ein weiteres Beispiel soll die Mehrkosten aufzeigen, die sich<br />
im Betrieb infolge von Falten (Beispiel Bild 8) im Schlauchliner<br />
ergeben können: Ein Kanalnetzbetreiber reinigt turnusgemäß<br />
alle zwei Jahre das Kanalnetz. Infolge Faltenbildung in einem<br />
Schlauchliner wird es erforderlich, den betreffenden Abschnitt<br />
jährlich zu reinigen, um Verstopfungen vorzubeugen. Für den<br />
zusätzlichen Reinigungsaufwand würden jeweils Kosten von<br />
250,00 € anfallen. Auf die Nutzungsdauer von 50 Jahren<br />
hochgerechnet sind das 25 zusätzliche Reinigungen (im Jahr 1,<br />
3, 5 usw.). Dabei entstehen kapitalisierte Kosten von ca. 3.264<br />
€ (Realzins 3 %, entsprechend KVR-Leitlinien [7]).<br />
Beispiel 4: Wertmindernde Reparaturstelle<br />
Im nächsten Beispiel sei in einem neu eingebauten Schlauchliner<br />
eine Reparaturstelle, z. B. infolge eines nicht mehr in<br />
Betrieb befindlichen Zulaufs, der nicht hätte geöffnet werden<br />
sollen (Bild 9), bei der Abnahme festgestellt worden. Diese<br />
Reparaturstelle hat eine niedrigere Nutzungsdauer als der<br />
Schlauchliner. Es wird angenommen, dass die Reparaturstelle<br />
eine Nutzungsdauer von 15 Jahren hat. Somit muss diese Stelle<br />
nach 15, 30 und 45 Jahren nachsaniert werden. Die Kosten<br />
für eine Nachsanierung würden jeweils 500,00 € betragen.<br />
Kosten = 500,00 € x (DFAKE (3,15) + DFAKE (3,30) + DFAKE<br />
(3,45)) = 500,00 € x (0,64186 + 0,41199 + 0,26444) = 659,15 €<br />
Das heißt, der Kanalnetzbetreiber müsste zum Zeitpunkt der<br />
Abnahme 659,15 € zu real 3 % anlegen, um die Folgekosten<br />
infolge der Nachsanierungen während der Nutzungsdauer<br />
des Schlauchliners bezahlen zu können. Zum Zeitpunkt der<br />
Schlauchlinereinbau<br />
Erneuerung<br />
Bild 7: Verlauf Projektkostenverlauf bei frühzeitigem<br />
Versagen des Liners<br />
11.04.2013 Dipl.-Ing. Roland Wacker 2<br />
Bild 8: Querfalte im Schlauchliner<br />
Bild 9: Reparaturstelle im Liner<br />
Nachsanierungen sind sowohl ausführende Firma als auch<br />
Ingenieurbüro aus der Gewährleistung, so dass Ansprüche<br />
dann nicht mehr geltend gemacht werden können. Das heißt,<br />
dieser Betrag müsste als Wertminderung von der Schlussrechnung<br />
in Abzug gebracht werden.<br />
Schlussfolgerungen aus den Beispielen<br />
Es ist deshalb wichtig, in den Vertragsbedingungen ein klares,<br />
eindeutiges Anforderungsprofil vertraglich festzuschreiben,<br />
also z.B., Grenzen für Falten zu definieren (wie das in der<br />
10 | 2013 51
FACHBERICHT ABWASSERENTSORGUNG / SANIERUNG<br />
ZTV DWA-M 144-3 [6] der Fall ist). Genauso wichtig ist es aber<br />
auch, die Folgen und Konsequenzen bei Überschreitung der<br />
zulässigen Grenzen in den Vertragsbedingungen vorzugeben.<br />
Auch bei reparierten Fehlstellen im Schlauchliner sollten die<br />
Folgen und Konsequenzen vertraglich klar geregelt werden, also<br />
z.B., indem eine Wertminderung (als Kostenersatz für zukünftig<br />
zu erwartende Nachsanierungen) festgeschrieben wird. Ohne<br />
eine vorherige vertragliche Festlegung wird es schwer sein,<br />
diese Ansprüche im Rahmen der Abnahme ganz oder teilweise<br />
geltend zu machen. Nach Ablauf der Frist für Mängelansprüche<br />
können sie ohnehin nicht mehr geltend gemacht werden.<br />
Auch bei den zu erreichenden Materialkennwerten und Wanddicken<br />
müssen die zulässigen Toleranzen und die Konsequenzen<br />
festgeschrieben werden. Hier macht es oft keinen Sinn, eine<br />
Wertminderung bei Unterschreitung zu vereinbaren, da bei<br />
zu starker Unterschreitung der Materialkennwerte von einer<br />
unvollständigen Aushärtung ausgegangen werden kann und<br />
bei Unterschreitung der Wanddicke die Standsicherheit nicht<br />
mehr gewährleistet ist. In beiden Fällen würde der Liner beim<br />
Bemessungslastfall versagen. Deshalb kommt hier in der Regel<br />
nur ein neuer Schlauchliner in Betracht. Nach VOB kommt<br />
eine Wertminderung nur dann in Betracht, wenn eine erneute<br />
Sanierung unverhältnismäßig wäre. Bei nicht mehr gegebener<br />
Gebrauchstauglichkeit, wozu die Standsicherheit gehört, stellt<br />
sich die Frage der Unverhältnismäßigkeit nicht.<br />
Der Vollständigkeit halber sei darauf hingewiesen, dass für<br />
reparierte Mängel bei einem Kanalneubau dasselbe gilt. Bei<br />
einer Reparaturstelle, sowohl in offener als auch in geschlossener<br />
Bauweise, werden früher oder später zusätzliche Arbeiten<br />
erforderlich werden, die zusätzliche Kosten erzeugen.<br />
Überwachung der Planung<br />
Genauso wie es die Pflicht des Planungsbüros ist, die ausführende<br />
Firma zu überwachen, ist es die Pflicht des Auftraggebers,<br />
das Planungsbüro zu überwachen. Ist er dazu fachlich<br />
oder personell nicht in der Lage, sollte er sich hierzu eines<br />
unabhängigen Fachmannes bedienen, der diese Aufgabe für<br />
ihn übernimmt.<br />
Insbesondere die TV-Abnahmebefahrung und die TV-Befahrung<br />
vor Ablauf der Frist für Mängelansprüche sollte sich der<br />
Kanalnetzbetreiber sehr intensiv anschauen, da später weder<br />
gegenüber der ausführenden Firma, noch gegenüber dem<br />
Ingenieurbüro Haftungsansprüche geltend gemacht werden<br />
können.<br />
In diesem Zusammenhang wird auf die weit verbreitete Ansicht,<br />
für „versteckte Mängel“ gelte eine Frist für Mängelbehebung<br />
von 30 Jahren, hingewiesen. Diese Meinung ist falsch, genauso<br />
wie die Ansicht, zum Ende der Frist für Mängelbehebung<br />
könnten alle Mängel geltend gemacht werden. Mängel, die bei<br />
der Abnahme schon vorhanden waren, aber nicht bemängelt<br />
wurden, können später nicht mehr geltend gemacht werden.<br />
Deshalb muss die TV-Befahrung zum Ende der Frist für Mängelbehebung<br />
immer mit der TV-Abnahmebefahrung verglichen<br />
werden, um zu beurteilen, ob die festgestellten Mängel neu<br />
hinzugekommen sind, ob sie übersehen worden sind oder ob<br />
vielleicht auch in der Zwischenzeit die Ansprüche, z. B. durch<br />
einen personellen Wechsel, gestiegen sind.<br />
ZUSAMMENFASSUNG<br />
Ein Kanalnetzbetreiber sollte Planungen und Ausschreibungen<br />
von Sanierungsleistungen nur von speziell dafür ausgebildeten<br />
Fachleuten durchführen lassen, diese aber auch selbst überwachen.<br />
Der verantwortliche Planer sollte zertifizierter Kanalsanierungs-Berater<br />
sein und darüber hinaus über mehrjährige<br />
Erfahrung verfügen.<br />
Schäden an sanierten Kanälen mit entsprechenden Folgekosten<br />
treten oft erst zu einem Zeitpunkt auf, wenn die Frist für<br />
Mängelansprüche bereits abgelaufen ist. Deshalb sollten bei der<br />
Ausschreibung klare Anforderungen an die Sanierungsleistung<br />
definiert werden und entsprechende zulässige Toleranzen mit<br />
den daraus resultierenden Folgen und Konsequenzen, ggf.<br />
auch Wertminderungen bei Über- oder Unterschreitung der<br />
zugelassenen Toleranzen vertraglich festgeschrieben werden.<br />
Literatur<br />
[1] DIN EN 752 „Entwässerungssysteme außerhalb von Gebäuden;<br />
Deutsche Fassung EN 752:2008“ (2008-04)<br />
[2] DIN EN 15885 „Klassifizierung und Eigenschaften von Techniken für<br />
die Renovierung und Reparatur von Abwasserkanälen und -leitungen;<br />
Deutsche Fassung EN 15885:2010“ (2011-03)<br />
[3] VSB-Empfehlung 0.1: Ingenieurleistungen bei der<br />
Kanalsanierungsplanung, Verband zertifizierter Sanierungs-Berater<br />
für Entwässerungssysteme e.V., Hannover, August 2009<br />
[4] Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge<br />
(Vergabeverordnung - VgV), zuletzt geändert durch Art. 1 V v.<br />
12.07.2012 | 1508<br />
[5] Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), Teile A,<br />
B, C, Ausgabe 2012, Deutscher Vergabe- und Vertragsausschuss<br />
für Bauleistungen herausgegeben vom DIN Deutsches Institut für<br />
Normung e.V., Berlin: Vertrieb Beuth Verlag GmbH<br />
[6] DWA-M 144-3 „Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen<br />
(ZTV) für die Sanierung von Entwässerungssystemen außerhalb von<br />
Gebäuden, Teil 3: Renovierung mit Schlauchliningverfahren (vor Ort<br />
härtendes Schlauchlining) für Abwasserkanäle“(2012-11)<br />
[7] Leitlinien zur Durchführung dynamischer Kostenvergleichsrechnungen<br />
(KVR-Leitlinien), DWA Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft,<br />
Abwasser und Abfall e.V. Hennef, Juli 2012<br />
[8] ATV-M 127-2 „Statische Berechnung zur Sanierung von<br />
Abwasserkanälen und -leitungen mit Lining- und Montageverfahren“<br />
(2000-01, 2. korrigierte Auflage 2010-07)<br />
Dipl.-Ing. ROLAND WACKER<br />
Ingenieurbüro Wacker, Auenwald<br />
Tel. +49 7191-367723-0<br />
E-Mail: info@wacker-ib.de<br />
AUTOR<br />
von der IHK Region Stuttgart ö.b.u.v. Sachverständiger für „Instandhaltung<br />
und Sanierung von Entwässerungsnetzen“, Zertifizierter Kanalsanierungs-Berater,<br />
Sachkundiger für Dichtheitsprüfung gem. § 61a LWG NRW<br />
52 10 | 2013
ABWASSERENTSORGUNG / SANIERUNG PROJEKT KURZ BELEUCHTET<br />
Abwasser-Pumpenschacht mit Epoxidharz-Beschichtung<br />
dauerhaft saniert<br />
Die Kanal-Schmitt GmbH, Kahl am Main, hat sich im Südwestdeutschland einen Namen als kompetenter Schacht- und<br />
Bauwerksanierer gemacht. Dabei setzt das Unternehmen, wie Schmitt-Niederlassungsleiter Dipl.-Ing. Hans-Jürgen Schneider<br />
betont, konsequent auf Problemlösungen, deren Wirtschaftlichkeit auf ihrer technischen Nachhaltigkeit beruht. Diese<br />
Betrachtungsweise hat ihn dazu bewogen, die jüngste Dienstleistung des Hauses nach einem erfolgreichen Selbstversuch<br />
an den Abwasseranlagen des eigenen Werksgeländes ins offizielle Angebots-Portfolio zu übernehmen: resiShield ist ein<br />
zwei-komponentiges Epoxidharz-Beschichtungssystem, das von der resinnovation GmbH, Rülzheim, eigens für Einsätze<br />
in feuchtem bzw. nassen Milieu entwickelt wurde.<br />
Bild: 102m 2 Betonoberfläche dauerhaft saniert<br />
In feuchtem bzw. nassem Milieu spielt das<br />
zwei-komponentige Epoxidharz-Beschichtungssystem<br />
resiShield seine extrem gute<br />
Klebewirkung als Pluspunkt aus. 3 mm stark<br />
aufgetragen, bringt es Betonkorrosion auch<br />
in chemisch hochbelasteten Schächten und<br />
Bauwerken zum Stillstand.<br />
Dabei ist das markant grüne Material, je nach<br />
(der durch Wahl des Härters einstellbaren)<br />
Viskosität in Sprühtechnik ebenso applizierbar<br />
wie als Anstrich. Es kann gegebenenfalls<br />
aber auch als Spachtel eingesetzt werden,<br />
wenn im Vorfeld der flächigen Beschichtung<br />
z. B. Fehlstellen aufprofiliert werden<br />
müssen. Die Wahl der jeweiligen Anwendungstechnik<br />
hängt daher maßgeblich von<br />
den Rahmenbedingungen in der Örtlichkeit<br />
ab. In den Schächten und Abscheidern auf<br />
dem Kanal-Schmitt-Betriebsgelände in Kahl<br />
setzte man auf den Anstrich: In der gegebenen<br />
Standardschacht-Geometrie lässt sich die manuelle<br />
Spritztechnik nur beschränkt einsetzen.<br />
Ganz anders dagegen in einem unterirdischen Bauwerk an<br />
der Peripherie von Kahl am Main. Hier wurde Kanal-Schmitt<br />
mit der Sanierung eines Abwasser-Pumpenschachtes aus<br />
Ortbeton beauftragt, in dem sich nach fast 50-jährigem<br />
Betrieb erste Korrosionserscheinungen bemerkbar machten.<br />
Das fast 6 m tiefe Bauwerk bot mit einer Grundfläche von<br />
rund 16 m 2 trotz der verbliebenen Leitungen und Armaturen<br />
genügend Bewegungsspielraum für einen resiShield-Einsatz<br />
in Sprühtechnik.<br />
Hier zahlte sich aus, dass Sprühen die „schnellere“ Technologie<br />
ist. Das zeitaufwändigste Gewerk des gesamten<br />
Projektes war daher – abgesehen vom Einbau des mehrstöckigen<br />
Baugerüstes in den Schacht – die Grundreinigung<br />
der Bauwerkswände. Dies erfolgte erst durch eine Nassreinigung<br />
mit anschließendem Sandstrahlen. 102 m 2 Wand- und<br />
Deckenflächen wurden innerhalb von knapp vier Stunden<br />
mit resiShield beschichtet. Der Fußboden des Bauwerks folgte<br />
bald darauf nach Rückbau des Gerüstes. Hierbei wurde<br />
in Anstrich-Technik gearbeitet, was zwar einen erkennbaren<br />
optischen Unterschied zur Wandbeschichtung ergibt,<br />
jedoch keinen qualitativen. Die resiShield-Beschichtung war<br />
– unabhängig von der Art der Applikation – innerhalb von<br />
rund sechs Stunden ausgehärtet und belastbar. Der Kunde<br />
verfügt nun über ca. 102 m 2 dauerhaft instandgesetzte<br />
Oberfläche in seinem Pumpwerk.<br />
Der Begriff „belastbar“ beschreibt in diesem Falle übrigens<br />
eine Klasse für sich: Wie ein aktuelles Prüfgutachen des<br />
Siebert und Knipschild-Instituts für Kunststofftechnik (Oststeinbek)<br />
zeigt, ist resiShield gemäß den Prüfvorgaben von<br />
DIN 1999-101 dauerresistent gegen Biodiesel und damit den<br />
härtesten Anforderungen gewachsen, die sich in Leichtflüssigkeit-Abscheidern<br />
in puncto Korrosion stellen. Bedenkt<br />
man nun, dass derart extremes Milieu im Pumpwerk von<br />
Kahl gar nicht herrscht, so weiß man: Dieses Bauwerk wird<br />
definitiv keine Korrosionsprobleme mehr haben, dafür aber<br />
eine sehr lange Nutzungsdauer.<br />
<br />
KONTAKT: Kanal-Schmitt GmbH, Kahl am Rhein,<br />
Hans-Jürgen Schneider,<br />
E-Mail: info@entsorgung-schmitt.de<br />
10 | 2013 53
PROJEKT KURZ BELEUCHTET ABWASSERENTSORGUNG / SANIERUNG<br />
Cottbus saniert Mischwassersammler<br />
mit GFK-Sonderprofilen<br />
Die Sanierungsbedürftigkeit von Altkanälen stellt für jede Gemeinde und die zuständigen Abwasserbetriebe eine<br />
große Herausforderung dar. Viele der Kanäle wurden noch gemauert oder bestehen oft aus Steinzeug, Beton und<br />
Stahlbeton. Doch auch der beste Kanal zeigt im Laufe seiner Nutzung Material-Ermüdungen und beginnt durchlässig<br />
zu werden. Hohe Instandhaltungskosten sind die Folge. Außerdem stellen Undichtigkeiten von Abwasserkanälen<br />
eine Gefahr für die Umwelt dar, denn austretende Stoffe können Erdreich und Grundwasser verunreinigen. Wenn<br />
nicht rechtzeitig saniert wird, steigen zusätzlich die Betriebskosten der Kläranlagen durch die zusätzliche Belastung<br />
von eindringendem Fremdwasser in die Kanalisation und Bodenausspülungen und -senkungen gefährden Gebäude.<br />
Im brandenburgischen Cottbus sorgt die Lausitzer Wasser<br />
GmbH & Co. KG (LWG) für die sichere Entsorgung<br />
des Abwassers von 130.000 Anwohnern. Das Kanalnetz<br />
umfasst ca. 900 km Leitungen, die das Abwasser zu<br />
acht Kläranlagen transportieren. Eine der wichtigsten<br />
Aufgaben der LWG ist die Instandhaltung dieses Netzwerkes.<br />
Im Jahr 2013 musste man aufgrund von erheblichen<br />
bautechnischen Schäden durch Risse und Korrosion<br />
die Sanierung eines Beton-Mischwasserkanals aus dem<br />
19. Jahrhundert in der Bautzener Straße vornehmen. Dieser<br />
dient als Hauptentwässerungskanal für den südlichen<br />
Teil von Cottbus und führt durch ein dicht besiedeltes<br />
und belebtes Gebiet. Die Planung des Projekts mit einem<br />
Budget von ca. 1,2 Mio. EUR übernahm das Ing.-Büro Lug<br />
GmbH aus Cottbus. Mit der Sanierung wurde die Firma<br />
Aarsleff Rohrsanierung GmbH, Niederlassung Dresden<br />
(ehemals Insituform) beauftragt.<br />
Nachdem die Sanierung mit bewehrtem Beton wegen der<br />
schlechten Substanz des Altkanals verworfen wurde, fiel<br />
die Wahl auf GFK-Rohre (glasfaserverstärkter Kunststoff)<br />
von HOBAS, die man bereits seit den 1990er Jahren mit<br />
sehr guten Erfahrungen in Cottbus einsetzt. Die LWG<br />
legte bei der Entscheidung besonderen Wert auf die<br />
Langlebigkeit von GFK u. a. wegen der hohen Korrosionsbeständigkeit.<br />
Auch die guten hydraulischen Eigenschaften<br />
von GFK spielten bei der Auswahl eine große<br />
Rolle, weil die Rohrleitung dadurch sehr wartungsarm ist<br />
und somit Kosten spart.<br />
Passgenaue Eiprofile<br />
Ein Ausbau des alten Kanals wäre wegen der mit starken<br />
Verkehrsbeeinträchtigungen verbundenen aufwändigeren<br />
Umsetzung sowie den daraus resultierenden höheren<br />
Kosten nicht infrage gekommen. Im Zuge der Beratungen<br />
Bild 1: Blick in den alten Betonkanal mit bereits durch die Fa. Aarsleff<br />
saniertem Abschnitt<br />
Bild 2: Lagerplatz der GFK-Profile von HOBAS<br />
54 10 | 2013
ABWASSERENTSORGUNG / SANIERUNG PROJEKT KURZ BELEUCHTET<br />
zur bestmöglichen Umsetzung der Sanierung unterstützte<br />
HOBAS das Projekt durch technische Betreuung. So entwarf<br />
man nach der Kalibrierung des Altkanals speziell für<br />
diese Baumaßnahme passgenaue Eiprofile, die dann später<br />
mittels Einzelrohrlining in den bestehenden Altkanal<br />
eingeschoben wurden. Bevor die Profile, die gemäß den<br />
Qualitätskriterien der süddeutschen Kommunen gefertigt<br />
wurden, zur Auslieferung kamen, wurden sie im HOBAS<br />
Werk geprüft und durch den Auftraggeber und das ausführende<br />
Unternehmen abgenommen.<br />
Die Baubedingungen vor Ort waren vergleichsweise<br />
schwierig, da es sich um eine schmale, viel befahrene<br />
Straße handelt. Trotz beengter Verhältnisse musste die<br />
Straße während der gesamten Arbeiten nur einseitig<br />
gesperrt werden. Bei einer Neuverlegung im offenen Graben<br />
wäre eine Vollsperrung notwendig gewesen. Durch<br />
die eingeschränkten Lagermöglichkeiten vor Ort war man<br />
auf die gut koordinierte Just-in-Time-Anlieferung durch<br />
HOBAS angewiesen. Dadurch benötigte man weniger<br />
Lagerplatz und konnte die Beeinträchtigung von Verkehr,<br />
Umwelt und Anrainern verringern.<br />
Nach der Kalibrierung des Kanals wurden Rohrverlegepläne<br />
mit der genauen Reihenfolge der Installation der<br />
GFK-Profile erstellt. Diese unterstützten die Arbeiten vor<br />
Ort maßgeblich. Damit die neuen Profile im alten Kanal<br />
zunächst in die eine und dann in die andere Richtung<br />
eingezogen werden konnten, wurden zwei verhältnismäßig<br />
kleine Baugruben mit einer Größe von 2 x 3,50 m<br />
errichtet. Diese nutzte man als Zugang, um die neuen<br />
Profile Baggers herabzulassen und mit Hilfe eines Fahrwagens<br />
in den Kanal einzuschieben. Das relativ geringe<br />
Gewicht der GFK-Produkte erlaubte eine schnelle und<br />
leichte Verlegung. Insgesamt wurden 140 m des Altkanals<br />
mit GFK-Profilen der Maße 930 mm auf 1.510 mm und<br />
660 m mit den Maßen 800 mm auf 1.330 mm saniert.<br />
Trotz des strengen Winters stellten die schwierigen Witterungsbedingungen<br />
für die Experten von Aarsleff keine<br />
große Hürde für die Sanierung dar. HOBAS GFK-Profile<br />
können auch bei niedrigen Temperaturen problemlos<br />
verlegt werden. Anfallende Laminierarbeiten und die<br />
abschließende Ringraumverfüllung verliefen ebenfalls<br />
optimal. Im Zuge der Arbeiten wurden zudem in acht<br />
Schächten neue GFK-Bauwerke eingepasst, ohne dabei<br />
die alten Schächte entfernen zu müssen. Aufgrund der<br />
Bild 3: Nach der Fertigstellung zum Neuzustand sanierter<br />
Mischwassersammler<br />
leichten Bearbeitbarkeit der GFK-Produkte und durch die<br />
langjährige Erfahrung von Aarsleff bei der Realisierung<br />
solcher Projekte konnten notwendige Anpassungsmaßnahmen<br />
vor Ort schnell und professionell durchgeführt<br />
werden.<br />
Nach der Sanierung wird die statische Belastung des<br />
Altkanals nun komplett von den neu eingebauten GFK-<br />
Bauteilen übernommen: eine Sanierung zum Neuzustand.<br />
Im Ergebnis ist der Kanal jetzt dauerhaft dicht, korrosionsbeständig,<br />
wartungsarm und langlebig. Die Abwässer<br />
der neu sanierten Leitung fließen am Ende der Bautzener<br />
Straße in den bereits 2008 mit HOBAS GFK-Rohren<br />
sanierten Kanal in der Straße der Jugend. Durch die enge<br />
Zusammenarbeit aller Beteiligten konnten die Bauarbeiten<br />
termingerecht und im vorgegebenen Kostenrahmen im<br />
April 2013 abgeschlossen werden.<br />
KONTAKT: HOBAS Rohre GmbH, Trollenhagen, Wilfried Sieweke,<br />
Tel. +49 395 4528-0, E-Mail: wilfried.sieweke@hobas.com,<br />
www.hobas.de<br />
Kunst<br />
Wir sind das Harz<br />
10 | 2013 55
FACHBERICHT ABWASSERENTSORGUNG / ABWÄRMENUTZUNG<br />
50 % weniger Primärenergie mit<br />
Kanalwärmenutzung in Bad Cannstadt<br />
Seit 2010 bezieht die Siedlung „Seelberg-Wohnen“ in Stuttgart-Bad Cannstadt Wärme aus Abwasser. Kanalwärme ist<br />
Abwärme. Diese mit Priorität zu nutzen, scheint plausibel, denn sie ist wie Solar- und Erdwärme ohnehin vorhanden<br />
– muss nicht erzeugt, sondern nur nutzbar gemacht werden. Entscheidend für die bestmögliche Wärmeversorgung<br />
ist die Auswahl der Systemkomponenten. Die Heiztechnik im vorgestellten Projekt führt zu ca. 50 % Einsparung<br />
bei Primärenergie bzw. CO 2<br />
-Emissionen. Zusätzlich konnten die Betriebskosten nach zwei Jahren Monitoring durch<br />
Korrektur der Steuerung noch um 15 % gesenkt werden.<br />
Auf dem Gelände der ehemaligen Textilmaschinenfabrik<br />
Terrot in Stuttgart-Bad Cannstatt entstand durch Sanierung<br />
und Neubau das Quartier „Seelberg-Wohnen“ mit<br />
17.500 m 2 Nutz- und Wohnfläche. Das Projekt, seit 2010<br />
mit Wärmeübertragern im Kanal und elektrisch betriebener<br />
Wärmepumpe ausgestattet, wurde analysiert und<br />
optimiert. Die Ergebnisse sind in einer von der Deutschen<br />
Bundesstiftung Umwelt (DBU) geförderten Studie dokumentiert.<br />
Bei diesem Projekt gewonnene Erkenntnisse<br />
sind übertragbar. Außergewöhnlich am Energiekonzept<br />
ist, dass der Strom für die Wärmepumpe vom Blockheizkraftwerk<br />
(BHKW) stammt und dass das Nahwärmenetz<br />
mit Heizzentrale in der Hand eines Kontraktors ist.<br />
Bild 1: Kanalwärmetauscher Therm-Liner Typ B Fabrikat Uhrig<br />
werden als 1 m lange Elemente zur Montage durch einen Schacht in<br />
den Kanal gegeben<br />
Foto: EGS-plan<br />
PROJEKTBESCHREIBUNG<br />
Sechs Mehrfamilienhäuser mit 111 Eigentumswohnungen<br />
und 10.500 m 2 Gesamtwohnfläche sind in entstanden,<br />
zusätzlich ein großer Geschossbau mit weiteren 27 Wohnungen<br />
und 4.300 m 2 Wohn-/Nutzfläche als Kombination<br />
von Pflegeheim und Betreutem Wohnen. Ein bestehendes<br />
Gebäude wurde zusätzlich saniert und erhielt<br />
einen Anbau. Dieser Komplex mit 2.910 m 2 Nutzfläche<br />
beherbergt eine Kindertagesstätte sowie 25 Wohnungen,<br />
u. a. für Senioren und Menschen mit Behinderung. Alle<br />
Gebäude wurden mit Wärmeschutz der Qualitätsstufe<br />
KfW60 ausgestattet.<br />
Die Architekten Ackermann & Raff haben den vom Bauträger<br />
Siedlungswerk Stuttgart ausgelobten Realisierungswettbewerb<br />
gewonnen, die Ingenieure von EGS-plan<br />
sind für das Energiekonzept „Heizung und Warmwasser“<br />
verantwortlich. ImmoTherm ist Kontraktor und trägt<br />
daher Investitionen und Betriebskosten der Heiztechnik<br />
und des Nahwärmenetzes. Die Kosten für die Wärme<br />
werden den Trägern der Einrichtungen bzw. den Eigentümergemeinschaften<br />
direkt in Rechnung gestellt. „Ziel<br />
war“, so Ulf Kühn, Geschäftsführer von ImmoTherm,<br />
„den Primärenergiebedarf und die CO 2<br />
-Emissionen für<br />
die Wärmeversorgung soweit zu senken, wie dies im<br />
Rahmen der kalkulierten Betriebskosten möglich und für<br />
Gebäude im KfW60-Standard nötig ist.“ Gesellschafter<br />
bei ImmoTherm sind die Stadtwerke Tübingen, das Stadtwerk<br />
am See in Friedrichshafen und das Siedlungswerk<br />
gemeinnützige Gesellschaft für Wohnungs- und Städtebau<br />
in Stuttgart.<br />
HEIZTECHNIK UND EMISSIONEN<br />
In einer Konzeptstudie hatten vor Beginn der Baumaßnahme<br />
die Fachingenieure vier Varianten in Verbindung<br />
mit einer zentralen Nahwärmeversorgung untersucht.<br />
Referenzversion waren dezentrale (je Gebäude ein) Gas-<br />
Brennwertkessel, denn mit ihnen wäre der gesetzlich<br />
geforderte ENEV-Standard erreicht worden. Im Einvernehmen<br />
mit dem Kontraktor wurde beschlossen, die zentrale<br />
Variante, bestehend aus elektrischer Wärmepumpe und<br />
Abwasserwärmetauscher sowie Gas-Blockheizkraftwerk<br />
(BHKW) und Gas-Niedertemperatur-Spitzenlastkessel,<br />
zu realisieren. Diese Version verbindet die Vorteile einer<br />
Wärmeerzeugung mit geringen Emissionen vor Ort und<br />
einer enormen Verringerung gemäß Berechnung von<br />
ca. 41 % bei Primärenergie bzw. CO 2<br />
-Emissionen. Noch<br />
größere Einsparungen an Primärenergie wären nur durch<br />
56 10 | 2013
ABWASSERENTSORGUNG / ABWÄRMENUTZUNG FACHBERICHT<br />
Foto: Uhrig<br />
Foto: Uhrig<br />
Bild 2 und Bild 3: Montage der Wärmetauscherstrecke von 76 m Länge im Kanal während der Nacht, mit engem Zeitfenster<br />
wegen begrenzter Rückstaumöglichkeit des Abwassers<br />
die Einbindung von Biomassenutzung (z. B. Holzpelletfeuerung)<br />
zu erreichen – laut DBU-Studie allerdings mit<br />
zusätzlichen Emissionen (z. B. Staub) vor Ort. Wegen der<br />
damit verbundenen Umweltbelastung für die Innenstadt<br />
wurde diese Variante nicht weiter verfolgt.<br />
Nach der Idee von EGS-plan werden etwa 90 % der<br />
Wärme durch die Kombination Wärmepumpe/BHKW<br />
erzeugt, wobei 60 % von der Wärmepumpe und 30 %<br />
vom BHKW eingespeist werden. Die restlichen 10 %<br />
liefert der Gaskessel. Der Anteil der Wärme aus dem<br />
Abwasser mit ca. 690 MWh/a an der Gesamtwärmelieferung<br />
liegt bei über 45 %. Knapp 15 % stammen<br />
aus der elektrischen Leistung des BHKW, mit der die<br />
Wärmepumpe betrieben wird.<br />
WÄRMEQUELLE ABWASSER<br />
Die Umsetzung des Projektes begann 2009 mit den ersten<br />
Hochbauten und war inklusive Anschluss der Gebäude<br />
im zweiten Bauabschnitt an das Nahwärmenetz zum<br />
Jahresende 2012 abgeschlossen. Die Inbetriebnahme<br />
der Anlage mit Wärmeversorgung im Automatikbetrieb<br />
für den ersten Bauabschnitt war bereits im April<br />
2011. Der Abwasser-Wärmetauscher (Bild 1) wurde<br />
in einem großen Abwasserkanal montiert, der in der<br />
Erschließungsstraße zum Baugebiet liegt. Für das Projekt<br />
„Seelberg-Wohnen“ sollte erstmals ein speziell für<br />
große Wassermengen entwickelter Wärmetauschertyp<br />
eingesetzt werden.<br />
Messungen der Abwassermengen im Juni und Juli 2008<br />
haben gezeigt, dass die Montage schwierig würde, da<br />
eine längere Trockenlegung des Kanalabschnittes in der<br />
Daimlerstraße mit einer Wasserhaltung nicht möglich<br />
war. Festgestellt wurde ein Durchfluss von maximal<br />
3.000 l/s am Tag bei intensivem Regenereignis und von<br />
maximal 500 l/s in der Nacht bei Trockenwetterabfluss.<br />
Also musste ein spezielles Konzept für den Einbau über<br />
Nacht gefunden werden, um im Kanal überhaupt arbeiten<br />
zu können (Bild 2 und Bild 3).<br />
MONTAGE IM ABWASSERKANAL<br />
Laut Robert Hertler von der Stadtentwässerung Stuttgart<br />
konnte nachts während ca. vier Stunden der Zufluss<br />
zum Kanalabschnitt in der Daimlerstraße ausnahmsweise<br />
abgestellt werden, wenn bei Trockenwetter zwei oberhalb<br />
liegende Regenbecken als Speicherplätze genutzt<br />
würden. Die Erfahrungen aus der Trockenlegung des<br />
Kanalabschnittes für den Einbau der Messsonden haben<br />
dies bestätigt. Nach Auswertung der Ausschreibung für<br />
Lieferung und Montage der 76 m langen Strecke mit 1 m<br />
langen Elementen wurde die Firma Uhrig Kanaltechnik<br />
GmbH aus Geisingen a. d. Donau beauftragt (Bild 2).<br />
Ihr Konzept sah den Einbau eines Podestes im Kanalabschnitt<br />
vor, auf dem die Wärmetauscher-Elemente<br />
zunächst zusammengesetzt und später in zwei bis drei<br />
Etappen während der Nacht auf die Kanalsohle abgesenkt<br />
und dort befestigt werden sollten.<br />
Die Montage dauerte mehrere Nächte und war auf die<br />
Zeit zwischen 0 und 5 Uhr beschränkt. „In einer minutiös<br />
vorbereiteten Aktion haben wir mit Hilfe der Stadtentwässerung<br />
das eng bemessene Zeitfenster genutzt,“ so<br />
Mark Biesalski von Uhrig Kanaltechnik GmbH, „und wie<br />
geplant unsere Wärmetauscherstrecke im Kanal jeweils<br />
rechtzeitig installiert, bevor der Überlauf der Regenbecken<br />
die Anlage überspülen konnte.“<br />
ENERGIEKONZEPT<br />
Die Wärmepumpe mit einer thermischen Leistung von ca.<br />
155 kWth stellt die Grundlast der Wärmeversorgung für<br />
Heizung und Warmwasser zur Verfügung. Wärmequelle<br />
ist der Abwasserkanal (Hauptsammler) in der Daimler-<br />
10 | 2013 57
FACHBERICHT ABWASSERENTSORGUNG / ABWÄRMENUTZUNG<br />
Bild 4: Fertig montierte Wärmetauscherstrecke Therm-Liner Typ B,<br />
Fabrikat Uhrig, aus 76 meterlangen Elementen zusammengesetzt<br />
straße, ca. 100 m vom Baugebiet entfernt. Mit einem<br />
auf der Kanalsohle liegenden Wärmetauscher wird dem<br />
Abwasser Energie entzogen und der Wärmepumpe zugeführt<br />
(Bild 4). Die Abwassertemperaturen von etwa 16 °C<br />
(min. 8 °C, max. 22 °C) im Jahresmittel führen zu relativ<br />
hohen Wärmequellentemperaturen. Damit sind mit der<br />
Wärmepumpe bei geeigneter Heizungsvorlauftemperatur<br />
Arbeitszahlen (Verhältnis erzeugte Wärme zu eingesetztem<br />
Antriebsstrom) von über 4,0 erreichbar.<br />
Das mit Gas betriebene BHKW erzeugt den Antriebsstrom<br />
für die Wärmepumpe, wodurch ein wesentlicher Teil der<br />
Primärenergie bzw. CO 2<br />
-Emissionen eingespart wirden<br />
Es hat eine thermische Leistung von 100 kWth und eine<br />
elektrische Leistung von 50 kWel. Zur hydraulischen Entkopplung<br />
von Wärmeverteilung und Erzeugung speisen<br />
BHKW und Wärmepumpe jeweils in einen eigenen Pufferspeicher<br />
mit 5.000 l ein. Die beiden Speicher sind in<br />
Serie geschaltet. Die Abwärme aus dem BHKW wird dazu<br />
genutzt, den Vorlauf der Kombination Wärmepumpe/<br />
BHKW durch Mischung der Vorläufe aus den beiden<br />
Pufferspeichern auf die erforderliche Systemtemperatur<br />
von ca. 70 °C für die Einspeisung in die Wärmeversorgung<br />
anzuheben. In Spitzenlastzeiten oder bei Ausfall von<br />
Wärmepumpe oder BHKW speist der mit Gas betriebene<br />
Niedertemperatur-Spitzenlastkessel mit der Leistung von<br />
575 kW in die Wärmeversorgung ein.<br />
Je kühler der Rücklauf zur Wärmepumpe, desto effektiver<br />
ist deren Betrieb. Deshalb sorgen spezielle Wärmeübergabestationen<br />
in der Heizung für eine zusätzliche<br />
Auskühlung des Rücklaufes aus der Erwärmung der<br />
Warmwasserzirkulation. Aufgabenstellung der eingangs<br />
erwähnten Studie, die von der DBU gefördert wurde, war<br />
im Wesentlichen: Die Vernetzung der Stationsregler mit<br />
der zentralen Regelungstechnik Direct Digital Control<br />
(DDC) und das Monitoring der Gesamtanlage über zwei<br />
Jahre mit dem Ziel, den Anlagenbetrieb zu optimieren.<br />
Foto: EGS-plan<br />
ERGEBNIS DER DBU-STUDIE<br />
„Das Potential zur Absenkung der Rücklauftemperaturen<br />
kann nur bei entsprechend eingestellter Steuerung maximal<br />
ausgeschöpft werden,“ erklärt Michael Guigas, Verfasser<br />
der im Januar 2013 abgeschlossenen DBU-Studie,<br />
und stellt weiter fest, dass „die maximale Reduzierung<br />
der CO 2<br />
-Emissionen durch die Integration einer elektrischen<br />
Wärmepumpe in die Nahwärmeversorgung unter<br />
optimalen Betriebsbedingungen bei 15 bis 20 % liegt mit<br />
Kombination von elektrischer Wärmepumpe und Gas-<br />
Blockheizkraftwerk bei diesem Projekt allerdings deutlich<br />
mehr als 41 % Reduzierung erreichbar sind.“ Tatsächlich<br />
gemessen wurde im zweijährigen Monitoring sogar eine<br />
Reduzierung um 54 %, also 13 % über dem zu Beginn<br />
der Planung vereinbarten Ziel.<br />
Die Heizkennzahl der Kombination Wärmepumpe/BHKW<br />
lag im Jahr 2012 bei 1,85, d. h. mit 1 kWh Gas konnten<br />
1,85 kWh Wärme erzeugt werden. Im Sinne einer<br />
wirtschaftlichen Betriebsweise ist außerdem festgestellt<br />
worden, dass die eingestellte Betriebsweise „Parallelbetrieb<br />
von Wärmepumpe und BHKW in der Grundlast,<br />
Deckung der Mittellast mit dem BHKW und Spitzenlast<br />
mit dem Gaskessel“ grundsätzlich die günstigste Lösung<br />
ist. Nur war die Auslastung der einzelnen Komponenten<br />
nicht optimal. Um sie zu verbessern, musste in erster<br />
Linie das Zusammenspiel von Wärmepumpe und BHKW<br />
justiert werden. Es galt, die Wirtschaftlichkeit soweit wie<br />
möglich zu steigern, ohne die angestrebte CO 2<br />
-Reduktion<br />
von 41 % gegenüber der Referenz (Gas-Brennwertkessel<br />
in jedem Gebäude) zu unterschreiten. Der Anteil der Wärmepumpe<br />
bzw. deren Sollwert für die Vorlauftemperatur<br />
ist daraufhin um 3 K angehoben worden.<br />
WIRTSCHAFTLICHKEIT, ÜBERTRAGBARE<br />
ERKENNTNISSE<br />
Die Anlage wurde Ende Januar 2013 komplett abgerechnet.<br />
Die Investition für die Wärmeversorgung lag nur 3 %<br />
über der Kostenschätzung von 2008. Mehrkosten für den<br />
Abwasser-Wärmetauscher sind hauptsächlich durch den<br />
aufwändigen Einbau aufgrund der großen Abwassermenge<br />
im Kanal entstanden. Auch MSR-Technik, Elektroinstallation<br />
und Planung waren etwas teurer als kalkuliert.<br />
„Beim innovativen Anlagenteil BHKW plus Wärmepumpe<br />
und Einbindung sowie bei der Nahwärme (Netz + Stationen)<br />
gab es allerdings keine Mehrkosten“, stellt Guigas<br />
fest. Dr. Boris Mahler, Projektleiter bei EGS-plan, weist<br />
auf die Übertragbarkeit der Erkenntnisse hin und bestätigt:<br />
„Die zentrale Wärmeversorgung mit elektrischer<br />
Wärmepumpe, Abwasser-Wärmenutzung, Gas-Blockheizkraftwerk<br />
und Gas-Niedertemperatur-Spitzenlastkessel ist<br />
ein gutes Konzept für innerstädtische Wohnquartiere mit<br />
hohem Einsparpotential in Bezug auf CO 2<br />
-Emissionen und<br />
Primärenergieeinsatz. Sorgfältige und detaillierte Planung<br />
vorausgesetzt, ist die Umsetzung von ähnlichen Anlagen<br />
ohne größere Probleme möglich.“<br />
Die Leistungsfähigkeit von Abwasser-Wärmetauscher<br />
und Wärmepumpe wurde im Betrieb überprüft. Nach<br />
58 10 | 2013
ABWASSERENTSORGUNG / ABWÄRMENUTZUNG FACHBERICHT<br />
Foto: EGS-plan<br />
Foto: EGS-plan<br />
Bild 5: Vergleich der Einsparung von Primärenergie bzw. CO 2<br />
-Emissionen<br />
bei den vier untersuchten Varianten für die Wärmeversorgung<br />
Bild 6: Kombination Gas-BHKW und Elektro-Wärmepumpe,<br />
Berechnung der Heizkennzahl<br />
häufigen Störungen im ersten Betriebsjahr läuft die<br />
Wärmepumpe mittlerweile nahezu störungsfrei. Dank<br />
Nachbesserung durch den Hersteller erreicht sie die<br />
in der Leistungsbeschreibung geforderten Werte. Der<br />
Abwasser-Wärmetauscher funktioniert wie geplant. Er<br />
erreicht im Betrieb die Leistung laut Ausschreibung. Die<br />
Abwasser-Wärmenutzung und der Kanalbetrieb sind<br />
seit Einbau bzw. Inbetriebnahme ohne Störungen. Die<br />
optimierte Hydraulik der Wärmeverteilung im Nahwärmenetz<br />
hilft, während des Betriebs niedrige Systemtemperaturen,<br />
insbesondere niedrige Rücklauftemperaturen<br />
zu erreichen. Die Folge sind neben guten Arbeitszahlen<br />
der Wärmepumpe extrem niedrige Verluste in der Anlage<br />
und eine hohe CO 2<br />
-Reduzierung im Vergleich zu dezentralen<br />
Einzelheizungen. Optimierungsmaßnahmen an den<br />
Wärmeübergabestationen haben den Sommerbetrieb<br />
weiter verbessert.<br />
Die Kosten für Wärmeerzeugung sind um 15 % gesunken,<br />
nachdem der Anteil der Wärmepumpe von 46 % auf<br />
55 % erhöht und der thermische Anteil des BHKW von<br />
45 % auf 40 % gesenkt wurde. Damit sank auch der Beitrag<br />
des Gas-Spitzenlastkessels von 9 % auf 5 %. In Kauf<br />
genommen wurde dafür, dass die CO 2<br />
-Reduktion statt<br />
54 % nur noch 46 % beträgt und die Arbeitszahl von 4,0<br />
auf 3,8 sinkt. Der Anschluss des zweiten Bauabschnitts<br />
und die Anhebung der Sollwerte der Wärmepumpe im<br />
Herbst 2012 haben dazu geführt, dass sowohl Wärmepumpe<br />
als auch BHKW im November und Dezember 2012<br />
zu 100 % ausgelastet waren.<br />
ZUSAMMENFASSUNG<br />
Die Betriebsergebnisse aus den ersten beiden Betriebsjahren<br />
sind positiv. Die Vorgaben aus dem Energiekonzept<br />
werden eingehalten bzw. übertroffen. Der gemessene<br />
Deckungsanteil des innovativen Anlagenteils mit Wärmepumpe,<br />
Abwasser-Wärmetauscher und Gas-Blockheizkraftwerk<br />
liegt bei über 90 %. Die Nutzung der lokalen<br />
Ressource Abwasserwärme, der Einsatz von intelligenter<br />
Technik und eine innovative Wärmeverteilung mit niedrigen<br />
Temperaturen reduzieren die CO 2<br />
-Emisssionen um<br />
bis zu 54 % bzw. ca. 180 t pro Jahr bei diesem Projekt im<br />
Vergleich zu Einzelheizungen mit Gas-Brennwertkesseln.<br />
Zur wirtschaftlichen Optimierung des Betriebs wurde die<br />
Kombination Wärmepumpe und BHKW im Parallelbetrieb<br />
verbessert durch Verschieben der jeweiligen Anteile an<br />
der Wärmeerzeugung. Das Ergebnis ist eine dauerhafte<br />
jährliche Betriebskostensenkung von 15 %.<br />
LITERATUR<br />
[1] Guigas, M.: Wärmeversorgung mit Wärmepumpe und<br />
Abwasserkanal-Wärmetauscher. DBU-Abschlussbericht zum<br />
Bauvorhaben Terrot-Areal in Stuttgart-Bad Cannstadt. EGSplan<br />
Stuttgart, 2013.<br />
[2] DWA-Regelwerk: Merkblatt DWA-M 114. Energie aus<br />
Abwasser, Wärme und Lageenergie. (Hrsg.:) DWA, Deutsche<br />
Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V.<br />
Hennef, Juni 2009.<br />
[3] Energie aus Abwasser. gwf Praxiswissen, (Hrsg.:) Christine<br />
Ziegler, Band III. Oldenbourg Industrieverlag, München, 2011.<br />
[4] Lang, J. et al: Kompendium Abwasserwärmenutzung. Ständig<br />
aktualisiertes Nachschlagewerk und Arbeitsinstrument für<br />
Wasserwirtschaft, Behörden, Planer, Wohnungswirtschaft und<br />
Industrie. Trialog Verlag Berlin, 2012.<br />
[5] www.energie-aus-abwasser.de<br />
[6] www.netzbewirtschaftung.de<br />
[7] www.e-qua.de<br />
KLAUS W. KÖNIG<br />
Architekturbüro Klaus W. König,<br />
Überlingen<br />
www.klauswkoenig.de<br />
AUTOR<br />
10 | 2013 59
FACHBERICHT WASSERVERSORGUNG<br />
Löschwasserkosten sind nicht gleich<br />
Trinkwasserkosten<br />
Spätestens seit dem Gerichtsurteil vom 02.02.2010 des Bundesgerichtshofes ist klar, dass die Kosten, die durch die<br />
Löschwasservorhaltung über die Trinkwasserversorgung verursacht werden, nicht mehr in den Wasserpreis eingerechnet<br />
werden dürfen. Da nicht jeder Verbraucher in gleichem Umfang mit Löschwasser versorgt werden kann, stellt die Verrechnung<br />
der Löschwasserkosten in den Wasserpreis ein Verstoß gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz dar. Die Löschwasservorhaltung<br />
(Grundschutz) liegt im Verantwortungsbereich der Kommunen und Städte (Ausnahme stellt hier Rheinland-Pfalz dar). Alle<br />
Wasserversorgungsunternehmen (außer Regiebetrieb) stehen daher gesetzlich nicht in der Pflicht, die Löschwasserversorgung<br />
unentgeltlich bereitzustellen. Darum sind die Wasserversorgungsunternehmen berechtigt, den Mehraufwand, resultierend aus<br />
der Löschwasservorhaltung über die Trinkwasserversorgung, den Kommunen und Städten in Rechnung zu stellen. Aufgrund<br />
dessen wurde im Rahmen einer Masterthesis eine Systematik entwickelt, die es allen Wasserversorgungsunternehmen<br />
ermöglicht, selbständig ihre Kapital- und Betriebskosten, die aus der Löschwasservorhaltung über die Trinkwasserversorgung<br />
verursacht werden, zu berechnen. Diese Systematik wurde im ersten Schritt allgemein gültig aufgestellt, so dass sie von allen<br />
Wasserversorgungsunternehmen verwendet werden kann.<br />
Bild 1: Übersicht der Urteile auf Bundesebene<br />
1. EINLEITUNG<br />
Auf Bundesebene wurden seit 2010 zwei richtungsweisende<br />
Urteile bezüglich der Zuständigkeit und der Umlage von<br />
Löschwasserkosten ausgesprochen, vgl. Bild 1.<br />
Begründet wurde der Beschluss vom 02.02.2010 damit,<br />
dass Löschwasserkosten im Wasserpreis nicht gleichermaßen<br />
auf den Verbraucher zurechenbar sind. Hier gilt der<br />
Grundsatz zum Wohl der Allgemeinheit. Außerdem wird<br />
der Kartellbehörde auf Grundlage von § 103 Abs. 5 Satz 2<br />
Nr. 2 GWB 1990 das Recht eingeräumt, Wasserpreise zu<br />
überprüfen.<br />
Der Beschluss vom 14.07.2011 beinhaltet die Übernahme<br />
der Löschwasseraufgabe bei fehlender vertraglicher Regelung<br />
zwischen der Gemeinde und dem Wasserversorgungsunternehmen<br />
(WVU). Der Bundesgerichtshof weist die Aufgabenverantwortung<br />
der Gemeinde zu, da die Aufgabe<br />
der Trinkwasserversorgung nicht zugleich die Aufgabe der<br />
Löschwasserversorgung für das WVU bedeutet.<br />
Bis heute mangelt es an einer bundesweiten, einheitlichen<br />
Regelung der folgenden Punkte:<br />
»»<br />
Unter welchen Bedingungen sind die Kosten<br />
gebührenfähig?<br />
»»<br />
Unter welchen Umständen können die Kosten auf ein<br />
WVU übertragen werden?<br />
»»<br />
Wie sind die einzelnen Kosten zu berechnen?<br />
Am 15.05.2012 wurde die Entscheidung des Oberlandesgerichts<br />
Stuttgart (OLG) aufgehoben. Das OLG hatte beschlossen,<br />
dass die Preisprüfung der WVU durch das<br />
Kartellamt anhand eines Vergleichsmarktprinzips<br />
zu erfolgen hat und nicht anhand eines anderen<br />
Verfahrens (Kostenkontrolle). Diese Entscheidung<br />
nahm der Bundesgerichtshof zurück und legte fest,<br />
dass im Rahmen der Kontrolle von Wasserpreisen<br />
die Vergleichsmarktbetrachtung nicht die einzige<br />
Art sei, wie die Kartellbehörde ermitteln kann.<br />
Durch diese Rechtsprechung besitzt das Kartellamt<br />
die Möglichkeit Kostenkontrollen durchzuführen, in<br />
welchen auch die Löschwasserkosten beleuchtet<br />
und offen gelegt werden können.<br />
Im Rahmen der Kostenkontrolle hat das Unternehmen<br />
eine nachvollziehbare und prüffähige<br />
Kalkulation darzulegen und ist bei der näheren<br />
Darlegung der Kostenstruktur mitwirkungspflichtig.<br />
Hierbei sind alle Kosten, die zur Wasserversorgung<br />
zuzuordnen sind, einschließlich angemessener<br />
kalkulatorischer Zinsen (Ertrag, Gewinn)<br />
zu berücksichtigen. Das heißt, dass für dieses<br />
Verfahren die Löschwasserkosten ausgewiesen<br />
sein müssen.<br />
60 10 | 2013
WASSERVERSORGUNG FACHBERICHT<br />
Wichtig ist es, die löschwasserrelevanten<br />
Anlagenteile zwar aus heutiger Sicht aufzunehmen,<br />
sie aber durch gezielte Fragestellungen<br />
und Recherchen hinsichtlich historischer<br />
Gesichtspunkte zu untersuchen.<br />
2. BERECHNUNGSSYSTEMATIK FÜR<br />
WASSERVERSORGUNGSUNTERNEHMEN<br />
Diese Systematik erfasst die löschwasserrelevanten<br />
Bereiche der bestehenden Trinkwasserversorgung<br />
nach den heutigen Auslegungsparametern<br />
und bewertet diese anhand<br />
historischer Gesichtspunkte.<br />
Ausschlaggebend für die Betrachtung der<br />
Löschwasserrelevanz sind diejenigen Anlagen,<br />
die durch die Bereitstellung von Löschwasser direkt betroffen<br />
und spezifisch dafür ausgelegt wurden. Daher werden<br />
in dieser Systematik folgende Anlagen der Trinkwasserversorgung<br />
näher beleuchtet:<br />
Speicheranlagen → Löschwasserreserve<br />
Trinkwasserleitung → Querschnittsvergrößerung<br />
Druckerhöhungsanlage → Erhöhung der Pumpenleistung<br />
Hydranten<br />
→ Anzahl, Grundvoraussetzungen<br />
unabhängige Wasserversorgung → Löschwasserteiche und<br />
-behälter, Zisternen<br />
Bild 2: Versorgungsschema eines WVUs - Dimensionierungswerte<br />
Je nach Art der Bebauung kann in Anlehnung an die<br />
DVGW 405 der Wert ansteigen auf:<br />
→ Wohngebiet 26,7 / 0,5 = 53,32 l/s<br />
→ Gewerbegebiet 53,4 / 0,5 = 106,8 l/s<br />
→ Industriegebiet 53,4 / 0,5 = 106,8 l/s<br />
Beispiel 1:<br />
Nicht löschwasserrelevant und somit nicht näher untersucht<br />
werden alle Anlagen (Tiefbrunnen, Wasseraufbereitung,<br />
Wasserförderung im Wasserwerk, Zubringerleitungen,<br />
etc.), die vor dem Hochbehälter angeordnet<br />
sind, vgl. Bild 2.<br />
Um den Rahmen dieses Fachberichts nicht zu sprengen,<br />
wird lediglich die Systematik zur Ermittlung des Löschwasseranteiles<br />
im Rohrleitungsnetz dargestellt. Informationen<br />
zur Systematik für Speicheranlagen, Druckerhöhungsanlagen<br />
und Hydranten können bei der RBS wave GmbH<br />
eingeholt werden.<br />
Beispiel 2:<br />
3. SYSTEMATIK ZUR ERMITTLUNG<br />
DER LÖSCH-WASSERANTEILE IM<br />
ROHRLEITUNGSNETZ<br />
3.1 Grundgedanken<br />
Der Grundgedanke besagt, ab welchem maximalen<br />
Stundenverbrauch/-bedarf das Rohrleitungsnetz<br />
in Abhängigkeit der Nutzungsart mit Löschwasser<br />
belastet wird, vgl. Bild 3. Nicht berücksichtigt<br />
wird der altersbezogene Auslegungsfaktor<br />
(f Dalt<br />
), der nachfolgend beschrieben wird. Um den<br />
Schnittpunkt von Q hmax<br />
mit den vorgeschriebenen<br />
Q F<br />
der jeweiligen Nutzungsgebiete zu erhalten,<br />
werden sie gleichgesetzt [1] = [2].<br />
Q B<br />
= Q hmax<br />
x 0,5 + Q F<br />
(1)<br />
Q B<br />
= Q hmax<br />
Q F<br />
/ 0,5 (2)<br />
→ Wohngebiet 13,3 / 0,5 = 26,66 l/s<br />
→ Gewerbegebiet 26,7 / 0,5 = 53,32 l/s<br />
→ Industriegebiet 53,4 / 0,5 = 106,8 l/s<br />
Bild 3: Löschwasserrelevante Bereiche in Abhängigkeit von Q hmax<br />
und Q B<br />
10 | 2013 61
FACHBERICHT WASSERVERSORGUNG<br />
Dabei ist<br />
Q hmax<br />
= maximaler Stundenverbrauch/-bedarf der<br />
Trinkwasserversorgung<br />
Q B<br />
= maximaler Stundenverbrauch/-bedarf im Brandfall<br />
(Q B<br />
= 0,5 x Q hmax<br />
+ Q F<br />
)<br />
3.2 Vorgehensweisen<br />
Für die Ermittlung des Löschwasseranteils im Rohrleitungsnetz<br />
müssen folgende Schritte abgearbeitet werden:<br />
1. Ermittlung der Wasserverbrauchszahlen<br />
2. Berechnung des maximalen Stundenbedarfs im Brandfall<br />
3. Erhebung der maximal möglichen Entnahmemenge<br />
4. Bildung des Faktors der historischen Überdimensionierung<br />
5. Ermittlung der um den Faktor f Dalt<br />
erweiterte maximale<br />
Stundenbedarf<br />
6. Ausgrenzung nicht löschwasserrelevanter Gebiete<br />
7. Gewichtung der Nutzungsgebiete innerhalb der jeweiligen<br />
Versorgungsgebiete/-zonen<br />
8. Bildung des Löschwasseranteile<br />
3.2.1 Ermittlung der Verbrauchszahlen<br />
Eine der wichtigsten Komponenten ist die detaillierte Ermittlung<br />
der aktuellen Verbrauchssituation in den letzten fünf bis<br />
zehn Jahren. Folgende Parameter sollten ermittelt werden:<br />
• Mittlerer Tagesverbrauch/-bedarf (Q dm<br />
)<br />
Q dm<br />
= E x q dm<br />
+ GA (3)<br />
Dabei ist<br />
E = Einwohnerzahl<br />
q dm<br />
= Pro-Kopf-Bedarf<br />
GA = Großabnehmer<br />
• Maximaler Stundenverbrauch/-bedarf (Q hmax<br />
)<br />
Da der Wasserverbrauch innerhalb eines Tages starken<br />
Schwankungen unterliegt (Spitzenzeiten/Ruhezeiten), muss<br />
der maximal auftretende Stundenbedarf ermittelt werden.<br />
Er wird für die Auslegung/Bemessung aller Versorgungsleitungen<br />
und Anlagenteilen nach dem Hochbehälter verwendet.<br />
Q hmax<br />
= Q dm<br />
x f h<br />
(4)<br />
Dabei ist<br />
Q dm<br />
= mittlerer Tagesverbrauch/-bedarf<br />
f h<br />
= Stundenspitzenfaktor (f h<br />
) ist das Verhältnis<br />
der maximalen Stundenabgabe zur mittleren<br />
Stundenabgabe: f h<br />
= Q hmax<br />
/ Q hm<br />
3.2.2 Berechnung des maximalen Stundenbedarfs im<br />
Brandfall (Q B<br />
)<br />
Der erforderliche maximale Stundenbedarf im Brandfall, muss<br />
für jede Versorgungszone/-gebiet ermittelt werden. Im Normalfall<br />
liegt der Feuerlöschbedarf (Q F<br />
) für ein Wohngebiet bei<br />
13,3 l/s und für ein Gewerbegebiet bei 26,7 l/s. Nach DVGW<br />
W 405 ist es jedoch möglich, dass aufgrund verschiedener<br />
Faktoren (Brandausbreitungsgefahr, Zahl der Vollgeschosse,<br />
Geschossflächenzahl) der Feuerlöschbedarf höher festzulegen<br />
ist.<br />
Diese Berücksichtigung erfordert eine detaillierte Aufnahme<br />
und Analyse des Gebäudebestandes und wird in der nachfolgenden<br />
Systematik nicht berücksichtigt. Die Systematik wurde<br />
aber so aufgebaut, dass der erhöhte Feuerlöschbedarf ohne<br />
Probleme mit integriert werden kann.<br />
Q B<br />
= 50 % Q hmax<br />
+ Q F<br />
(5)<br />
Dabei ist<br />
50 % Q hmax<br />
= maximale Stundenabgabe an Tagen<br />
mit durchschnittlichem Verbrauch<br />
Q F<br />
= Feuerlöschbedarf<br />
3.2.3 Erhebung der maximal möglichen Entnahmemenge<br />
Um zu überprüfen, ob der geforderte maximale Stundenbedarf<br />
im Brandfall zuzüglich 50 % der maximalen Stundenspitze,<br />
unter Berücksichtigung des Mindestdrucks von 1,5 bar im<br />
Netz, auch bereitgestellt werden kann, sollte das Wasserrohrnetz<br />
auf Basis eines kalibrierten Rechennetzmodells hydraulisch<br />
berechnet werden.<br />
3.2.4 Bildung des Faktors der historischen<br />
Dimensionierung<br />
Einer der wichtigsten Faktoren bei der Ermittlung der Löschwasseranteile<br />
im Rohrleitungsnetz besteht darin, die frühere<br />
Dimensionierung und Auslegung mit zu berücksichtigen. Es<br />
wurden in den 1970er und 1980er Jahren schwerwiegende<br />
optimistische Prognosen, bezüglich der Entwicklung des Pro-<br />
Kopf-Bedarfs für das Jahr 2000 aufgestellt. So prognostizierte<br />
das Bastelle Institut 1972 für das Jahr 2000 eine Zunahme von<br />
rund 60 %, die sie jedoch 1976 auf 45 % reduzierten. Durch<br />
die Prognose der TU Berlin 1980, die einen Zuwachs von<br />
152 l/E x d auf 219 l/E x d im Jahr 2000 vorhersagten, entstand<br />
ein weiterer Ansatz zur Überdimensionierung der Anlagen.<br />
Bild 4: Historische Prognosen der Entwicklung des Wasserverbrauchs<br />
(Quelle: Forschungsstelle Recht, Ökonomie u. Umwelt - Leibniz Universität<br />
Hannover, Die Deutschen und ihr Wasser - virtuelle und reale Probleme)<br />
3.2.4.1 Tatsächlich entwickelte sich der Pro-Kopf-Verbrauch in<br />
eine ganz andere Richtung<br />
Bedingt durch die Bevölkerungsentwicklung (Stadt/Land),<br />
Entwicklung der Haushaltsstruktur (Wechsel vom Mehrfa-<br />
62 10 | 2013
WASSERVERSORGUNG FACHBERICHT<br />
milien- zum Einpersonenhaushalt),<br />
Verhaltensänderungen<br />
der Verbraucher<br />
sowie wirtschaftliche und<br />
technische Entwicklungen,<br />
konnte im Jahr 2000 lediglich<br />
ein Pro-Kopf-Verbrauch<br />
von 129 l/E x d verzeichnet<br />
werden, vgl. Bild 4.<br />
Es wird davon ausgegangen,<br />
dass sich die<br />
damaligen Ingenieur- und<br />
Planungsbüros bei der<br />
Dimensionierung des<br />
Baujahr<br />
Rohrleitungsnetzes auf die<br />
Prognosen der einzelnen<br />
Institute gestützt haben.<br />
Das heißt, dass die Planer<br />
damals das Rohrleitungsnetz für die Trinkwasserversorgung<br />
größer dimensioniert haben, um auch im Jahr 2000 noch<br />
Trinkwasser in ausreichender Menge zur Verfügung stellen zu<br />
können. Durch diesen Verbrauchsrückgang sind die Rohrleitungen<br />
heutzutage oft überdimensioniert. Diese Überdimensionierung<br />
darf aber nicht der Löschwasservorhaltung (wird oft<br />
bei der Zielnetzplanung irrtümlicherweise angesetzt), sondern<br />
muss der Trinkwasserversorgung zugeschrieben werden.<br />
3.2.4.2 Einteilung der Prognosen in Zeiträume<br />
Länge<br />
Die historischen Dimensionierungsansätze müssen anhand<br />
der wahrscheinlichsten Dimensionierungsauslegungen der<br />
einzelnen Jahre in Zeiträume zusammengefasst werden. Wird<br />
die tatsächliche Verbrauchsentwicklung betrachtet, die einen<br />
erstmals zukunftsweisenden Rückgang ab dem Jahr 1993<br />
aufzeigt, kann davon ausgegangen werden, dass sich die<br />
Planer spätestens ab diesem Zeitpunkt anderer Dimensionierungsansätzen<br />
bedienten. Außerhalb des oben festgelegten<br />
Zeitraums sind keine zuverlässigen historischen Prognosen<br />
und Auslegungsgrundlagen vorhanden. Um diese Zeiträume<br />
mit in die Berechnung einfließen lassen zu können, bedarf es<br />
einer versorgungsspezifischen Untersuchung. Hierbei könnten<br />
Gespräche mit älteren Planern, der Baubehörde oder die Einsichtnahme<br />
in alte Bauakten Aufschluss über die damaligen<br />
Auslegungsparameter geben.<br />
3.2.4.3 Bildung eines Zuschlagsfaktors für die Trinkwasserversorgung<br />
Um einen Zuschlagsfaktor bilden zu können, müssen die einzelnen<br />
verbauten Rohrleitungslängen den oben beschriebenen<br />
Prognose-Zeiträumen zugeordnet werden. Hierzu müssen<br />
zunächst die Rohrleitungsbaujahre und deren Längen erfasst<br />
werden. Zum Teil liegen diese Daten den Wasserversorgern<br />
bereits in elektronischer Form zur Verfügung, wodurch sie<br />
leicht erfasst werden können. Schwieriger gestaltet sich die<br />
Erfassung, wenn diese händisch von alten Baudokumentationen<br />
zusammen getragen werden müssen. Stellt dies einen<br />
zu großen Aufwand dar, besteht zudem die Möglichkeit der<br />
Schätzung. Oft ist bekannt, wann das Haupt-Versorgungsnetz<br />
Prognose<br />
Verbrauch<br />
früher<br />
Verbrauch<br />
2012<br />
Jahr [m] l/EW x d l/EW x d<br />
Faktor je<br />
Zeitraum<br />
Tabelle 1: Ermittlung des Faktors der historischen Dimensionierung (f Dalt<br />
)<br />
Gewichtung<br />
gebaut wurde. Unter Annahme eines jährlichen Erneuerungsgrades<br />
kann daraufhin das Netzalter und die Netzlängen abgeschätzt<br />
werden, vgl. Tabelle 1.<br />
Aus den jeweiligen Altersgruppen und den spezifischen<br />
Längen kann anhand einer Gegenüberstellung des historischen<br />
und des heutigen Verbrauchs ein Gesamtfaktor<br />
f Dalt<br />
gebildet werden. Will man dann den Löschwasseranteil<br />
je Versorgungszone/-gebiet festlegen, müssen die<br />
Längen und Baujahre jeder Versorgungszone/-gebiet mit<br />
den damaligen Parametern in Relation gesetzt werden.<br />
Stehen die hierfür benötigten Informationen nicht zur<br />
Verfügung, kann auch ein Gesamtfaktor für die ganze<br />
Versorgungszone/-gebiet gebildet werden.<br />
Für die Versorgungszonen in der Tabelle 1 ergibt sich<br />
demnach ein Faktor (f Dalt<br />
) von 1,23. Das bedeutet, dass<br />
früher das Rohrleitungsnetz um das 1,23-fache größer<br />
für die Trinkwasserversorgung dimensioniert wurde als<br />
heute erforderlich wäre.<br />
3.2.5 Ermittlung des um den Faktor f Dalt<br />
erweiterten<br />
maximalen Stundenbedarfs<br />
Um die größere Dimensionierung, geschuldet durch die<br />
früheren Auslegungsparameter in die Systematik zu integrieren,<br />
kann anhand der Mayrischen Formel mit dem Faktor<br />
f Dalt<br />
und dem heutigen maximalen Stundenverbrauch der<br />
Versorgungszonen/-gebiete der erweiterte maximale Stundenverbrauch<br />
(Q hmax<br />
*) ermittelt werden.<br />
Q hmax<br />
* = Q hmax<br />
x f Dalt<br />
(6)<br />
Dabei ist<br />
Q hmax<br />
* = maximaler damals prognostizierte Stundenbedarf<br />
der Trinkwasserversorgung<br />
Q hmax<br />
= maximaler heutige Stundenverbrauch der<br />
Trinkwasserversorgung<br />
f Dalt<br />
= Faktor der historischen Dimensionierung<br />
Bei einer Annahme von Q hmax<br />
= 10 l/s und dem Faktor f Dalt<br />
von 1,23 ergibt sich beispielhaft ein erweiterter maximaler<br />
Stundenbedarf (damals prognostizierte Wasserbedarf) von:<br />
Q hmax<br />
* = 10 l/s x 1,23 = 12,3 l/s<br />
durch. Faktor f Dalt<br />
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]<br />
1929-1971 1319 - 1,00 1357,0<br />
1972-1976 2319 151 1,35 3133,0<br />
1977-1980 136 151 1,28 173,8<br />
1981-1988 205 151 1,45 297,8<br />
1989-1993 0 151 1,99 0,0<br />
1994-2013 115 - 1,00 115,0<br />
([3] / ([4]*100)) / 100) [2] * [5] Summe [6] / Summe [2]<br />
Gesamt 4132 5076,1<br />
1,23<br />
10 | 2013 63
FACHBERICHT WASSERVERSORGUNG<br />
3.2.6 Ausgrenzung nicht löschwasserrelevanter<br />
Nutzungsgebiete<br />
Schritt 1: Welche Nutzungsgebiete befinden sich im<br />
Versorgungsgebiet?<br />
Schritt 2: Vorhandene Löschwassermenge messen. Falls nicht<br />
ausreichend, können diejenigen Nutzungsgebiete<br />
direkt ausgegrenzt werden.<br />
Schritt 3: Vergleich Q hmax<br />
* und Q B<br />
Q hmax<br />
* > Q B<br />
> nicht löschwasserrelevant<br />
Q hmax<br />
* < Q B<br />
> löschwasserrelevant<br />
Durch den Vergleich des erweiterten maximalen Stundenbedarfs<br />
mit dem maximalen Stundenbedarf im Brandfall<br />
können Versorgungsgebiete ausgegrenzt werden,<br />
wenn der Trinkwasserbedarf größer ist als der Wasserbedarf<br />
im Brandfall. Außerdem kann anhand der maximal<br />
möglichen Entnahmemenge festgestellt werden, ob<br />
überhaupt genügend Löschwasser in dem betrachteten<br />
Gebiet zur Verfügung steht. Kann zum Beispiel lediglich<br />
13,3 l/s aus dem Rohrleitungsnetz entnommen werden<br />
(vgl. Tabelle 2, Versorgungsgebiet yx), müssen die Nutzungsgebiete<br />
mit höherem Feuerlöschbedarf (26,7 l/s<br />
und 53,3 l/s) nicht weiter betrachtet werden. Anhand<br />
des Flächennutzungsplans der Kommune ist ersichtlich,<br />
welches Gebiet welcher Nutzung zugeordnet ist. Wurde<br />
ein Nutzungsgebiet neu angesiedelt und erhöht dieses die<br />
geforderte Löschwassermenge im Brandfall, ohne dass<br />
das Rohrleitungsnetz zusätzlich nachgerüstet wurde, darf<br />
es nicht mit berücksichtigt werden. Um Fehlern bei der<br />
Berechnung entgegen zu wirken, ist noch zu erwähnen,<br />
dass bei der Berechnung von Q B<br />
der heutige maximale<br />
Stundenverbrauch ausschlaggebend ist.<br />
3.2.7 Gewichtung der Nutzungsarten innerhalb des<br />
jeweiligen Versorgungsgebietes<br />
Um den gesamten Löschwasseranteil in einem Versorgungsgebiet<br />
ermitteln zu können, muss zunächst gewichtet<br />
werden, wie viel prozentualen Anteil das Wohngebiet<br />
(13,3 l/s), die Kernstadt/Gewerbegebiet/Gemeindenutzfläche<br />
(26,7 l/s) und wie viel Anteil das Industriegebiet<br />
(53,3 l/s) im Versorgungsgebiet einnimmt. Die Grundlage<br />
hierfür liefert der Flächennutzungsplan der jeweiligen<br />
Stadt/Gemeinde. Für die Gewichtung kann man sich virtuelle<br />
Löschradien zu Hilfe nehmen.<br />
Hintergrund: Nach DVGW W 405 muss zur Brandbekämpfung<br />
im Radius von 300 m um das Brandobjekt, Löschwasser<br />
in vorgeschriebener Menge bereitgestellt werden.<br />
Die roten Kreise markieren 300 m-Radien, in welchen an<br />
mindestens einem Hydranten die vorgeschriebene Löschwassermenge<br />
für ein Wohngebiet bereitgestellt werden<br />
muss. Beispielhaft bedarf es nach Bild 5 für die Abdeckung<br />
des Wohngebietes insgesamt zweier Hydranten.<br />
Die schwarzen Kreise markieren zum einen die vorgeschriebene<br />
Löschwassermenge für das Wohngebiet und<br />
zum anderen die Gemeindenutzflächen. Hierfür benötigt<br />
man insgesamt einen Hydranten.<br />
An insgesamt drei Hydranten werden folgende Löschwassermengen<br />
benötig:<br />
2 Hydranten → Wohngebiet 13,3 l/s<br />
1 Hydrant → Gemeindenutzfläche 26,7 l/s<br />
Daraus resultieren folgende prozentuale Anteile:<br />
→ Wohngebiet = 67 %<br />
→ Gewerbe- und Gemeindenutzfläche = 33 %<br />
Berechnung des maximalen Stundenbedarfs je Nutzungsart<br />
anhand eines Beispiels eines Versorgungsgebietes mit<br />
Q hmax<br />
= 10 l/s.<br />
Q B13,3<br />
= 0,5 x 10 l/s + 13,3 = 18,3 l/s (7)<br />
Q B26,7<br />
= 0,5 x 10 l/s + 26,7 = 31,7 l/s<br />
= 0,5 x 10 l/s + 53,3 = 58,4 l/s<br />
Q B53,3<br />
Nutzungsabhängiger maximaler Stundenbedarf im<br />
Brandfall (Q BN<br />
)<br />
(8)<br />
Bild 5: Löschwasserradien in einem Versorgungsgebiet<br />
Dabei ist<br />
Q BN<br />
= nutzungsabhängiger maximaler Stundenbedarf<br />
im Brandfall<br />
Q B13,3<br />
= maximaler Stundenbedarf im Brandfall mit<br />
einem Feuerlöschbedarf von 13,3 l/s<br />
Q B26,7<br />
= maximaler Stundenbedarf im Brandfall mit<br />
einem Feuerlöschbedarf von 26,7 l/s<br />
Q B53,3<br />
= maximaler Stundenbedarf im Brandfall mit<br />
einem Feuerlöschbedarf von 53,3 l/s<br />
64 10 | 2013
WASSERVERSORGUNG FACHBERICHT<br />
N 13,3<br />
= Anteil der Nutzungsart mit Q F<br />
= 13,3 l/s,<br />
des betrachteten Versorgungsgebietes<br />
N 26,7<br />
= Anteil der Nutzungsart mit Q F<br />
= 26,7 l/s,<br />
des betrachteten Versorgungsgebietes<br />
N 53,3<br />
= Anteil der Nutzungsart mit Q F<br />
= 53,3 l/s,<br />
des betrachteten Versorgungsgebietes<br />
3.2.8 Bildung des Löschwasseranteils<br />
Unter Einsatz von den unter Abschnitt 3.2.1 bis 3.2.7<br />
erfassten Werten kann der Löschwasseranteil jedes Versorgungsgebietes<br />
ermittelt werden. Hierbei wird zuerst<br />
der nutzungsabhängige maximale Wasserbedarf im Brandfall<br />
je Versorgungszone/-gebiet ermittelt. Er setzt sich aus<br />
dem individuellen Wasserbedarf im Brandfall der jeweiligen<br />
Nutzungsgebiete und der jeweiligen prozentualen Gewichtung<br />
zusammen (Q BN<br />
). Der nutzungsabhängige maximale<br />
Stundenbedarf im Brandfall (Q BN<br />
) kann daraufhin mit dem<br />
erweiterten maximalen Stundenbedarf der Trinkwasserversorgung<br />
(Q hmax<br />
*) in Relation gesetzt werden. Der erweiterte<br />
maximale Stundenbedarf wird zu hundert Prozent der<br />
Trinkwasserversorgung, und die Differenz zwischen Q BN<br />
und<br />
Q hmax<br />
* bei Kriterienerfüllung, der Löschwasserversorgung<br />
zugeordnet.<br />
Wird diese Vorgehensweise für alle Versorgungsgebiete angewendet,<br />
so können die einzelnen Löschwasseranteile mittels<br />
der jeweiligen Rohrleitungslängen in Verhältnis gesetzt werden.<br />
Dadurch kann der gesamte Löschwasseranteil im Rohrleitungsnetz<br />
eines Wasserversorgungsunternehmens errechnet<br />
(9)<br />
werden. Beispielhaft für das Versorgungsgebiet, das unter<br />
Punkt 3.2.6 beschrieben wurde:<br />
(10)<br />
Dabei ist<br />
LW AnteilVGges = Löschwasseranteil am Rohrleitungsnetz<br />
aller Versorgungszonen/-gebiete (VG)<br />
LW AnteilVG = Löschwasseranteil am Rohrleitungsnetz<br />
des betrachteten VGs<br />
LängeRltgVG = Rohrleitungslänge des betrachteten VGs<br />
LängeRltgVGges = Rohrleitungslänge der gesamten VGs<br />
4. LÖSCHWASSERBEDINGTE KAPITALBINDUNG AM<br />
ROHRLEITUNGSNETZES<br />
Für die Ermittlung der löschwasserbedingten Kapitalbindung<br />
am Rohrleitungsnetz ist es aufgrund o.g. prozentual ermittelten<br />
Löschwasseranteils erforderlich die Kapital- und Betriebskosten<br />
mit zu berücksichtigen.<br />
4.1 Kapitalkosten<br />
Für die Löschwasserversorgung wurde die Trinkwasserleitung<br />
damals größer dimensioniert. Das heißt, bei einem angenommen<br />
Löschwasseranteil von 25 % müsste anstatt einer<br />
DN 100-Leitung eine DN 125-Leitung verlegt worden sein. Zu<br />
berücksichtigen ist hierbei, dass die Kosten der eigentlichen<br />
Baumaßnahme durch die Verwendung einer 25 % größeren<br />
Leitung nicht oder nur geringfügig beeinflusst werden. Die<br />
Versorgungsgebiet<br />
max.<br />
Stundenbedarf<br />
Q max<br />
Faktor durch<br />
historische<br />
Überdimensionierung<br />
f Dalt<br />
erweiterter<br />
maximaler<br />
Stundenbedarf<br />
Qmax*<br />
vorhand.<br />
Löschwassermenge<br />
13,3<br />
Q 8<br />
Wohngebiet, Mischgebiet<br />
LW<br />
relevant<br />
26,7<br />
LW<br />
relevant<br />
Q 8<br />
Kernstadt<br />
Gewerbegebiet,<br />
Gemeindenutzfläche<br />
26,7<br />
LW<br />
relevant<br />
Q 8<br />
Industriegebiet,<br />
Sondergebiete<br />
53,3<br />
LW<br />
relevant<br />
l/s l/s l/s l/s % l/s % l/s % l/s %<br />
Kemstadt 102 1,12 114,24 < 53,3 64,33 0 83,78 0 83,78 0 110,45 0<br />
Versorgungsgebiet x 14 1,12 15,68 ≤ 26,7 21,17 34,50 34,50 61,17 0<br />
Versorgungs gebiet y 26 1,12 29,12 53,33 27,89 0 41,22 41,22 67,89<br />
Versorgungs gebiet yx 6 1,12 6,72 13,3 16,69 0 30,02 0 30,02 0 56,69 0<br />
Versorgungs gebiet xy 10 1,12 11,2 ≤ 13,3 18,93 32,26 32,26 58,93 0<br />
ausschlaggebend Trinkwasserversorgung<br />
löschwasserrelevant<br />
Nutzungsgebiet nicht vorhanden<br />
Löschwasserversorgung nicht ausreichend<br />
Tabelle 2: Ausgrenzung nicht löschwasserrelevanter Gebiete<br />
10 | 2013 65
FACHBERICHT WASSERVERSORGUNG<br />
Bild 6: Löschwasseranteile<br />
250.000 €<br />
200.000 €<br />
150.000 €<br />
100.000 €<br />
Rohrleitungen DEA Speicheranlagen Hydranten<br />
Löschwasseranteile in % 30,0% 66,0% 9,4% 75,0%<br />
50.000 €<br />
0 €<br />
80,0%<br />
70,0%<br />
60,0%<br />
50,0%<br />
40,0%<br />
30,0%<br />
20,0%<br />
10,0%<br />
0,0%<br />
Löschwasseranteile in %<br />
Kapitalkosten Betriebskosten Gesamtkosten<br />
Hydranten 26.300 € 4.800 € 31.100 €<br />
Speicheranlagen 9.100 € 5.700 € 14.800 €<br />
DEA 2.500 € 3.300 € 5.800 €<br />
Rohrleitungen 94.700 € 59.800 € 154.500 €<br />
Bild 7: Löschwasserbedingte Kapitalbindung im Wasserversorgungssystem<br />
Hoheitsaufgabe der Trinkwasserversorgung darf bei dieser<br />
Betrachtungsweise nicht vergessen werden. Deshalb dürfen<br />
nur die Mehrkosten des Rohrmaterials in den Kapitalkosten<br />
mit berücksichtigt werden.<br />
Diese Mehrkosten sollte jedoch von jedem Wasserversorgungsunternehmen<br />
auf Grundlage ihrer hausinternen Preise<br />
ermittelt werden.<br />
4.2 Betriebskosten<br />
Da durch die größere Dimensionierung der Stagnationsanteil<br />
in der Trinkwasserleitung steigt, erhöht sich zugleich<br />
der Wartungs- und Inspektionsaufwand. Deshalb darf der<br />
Löschwasseranteil auf die Betriebskosten verrechnet werden.<br />
Zu beachten ist, dass nur die Kosten für die Wartung und<br />
Inspektion des Trinkwassernetzes angesetzt werden sollten,<br />
da die Instandsetzungskosten nur minimal durch die Löschwasservorhaltung<br />
beeinflusst werden.<br />
5. FAZIT<br />
Für die Festlegung der löschwasserbedingte Kapitalbindung<br />
in der Trinkwasserversorgung ist es erforderlich, zunächst die<br />
rechtlichen Rahmenbedingungen im Bereich der Löschwasserversorgung<br />
sowie die Grundlagen für die Ermittlung der<br />
löschwasserbedingten Kapitalbindung in löschwasserrelevanten<br />
Wasserversorgungsanlagen zu analysieren, aufzubereiten<br />
und zusammenzufassen.<br />
Dies umfasst die Analyse der Wasserverbräuche sowie die<br />
Auslegung und Bemessung der relevanten Wasserversorgungsanlagen<br />
für die Löschwasserversorgung, unter Berücksichtigung<br />
der früheren Auslegung und Bemessung der Anlagen.<br />
Im Zuge diese Vorgehensweise, sollten die Faktoren der<br />
historischen Dimensionierungsparameter gebildet und dann<br />
gewichtet werden, in Bezug auf die Tatsache, mit welcher<br />
Trinkwasser- und Löschwassermenge die Anlagen damals<br />
ausgelegt wurden.<br />
Mit dieser Abgrenzung könnten die Löschwasseranteile [%]<br />
in den einzelnen löschwasserrelevanten Wasserversorgungsanlagen<br />
festgelegt werden, vgl. Bild 6.<br />
Aufgrund dieser Löschwasseranteile [%] könnte, unter Berücksichtigung<br />
von Kapital- und Betriebskosten, die löschwasserbedingte<br />
Kapitalbindung der einzelnen Anlagen bzw. im<br />
Trinkwasserversorgungssystem ermittelt werden, vgl. Bild 7.<br />
6. LITERATUR<br />
[1] Berufsfeuerwehr Braunschweig, „Brandschutzmerkblatt Nr. 2“<br />
[2] Thomas Zawadke „Wasserversorgung“, Auflage 5, Stand 2009 Verlag<br />
für Feuerwehr und Brandschutz Stuttgart, ISBN 978-3-17-020850-6<br />
[3] Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches e. V.,<br />
„W 405 Bereitstellung von Löschwasser durch die öffentliche<br />
Trinkwasserversorgung“, Stand Februar 2008<br />
[4] Kemper „Löschwasserversorgung“, Auflage 2, Stand 2011,<br />
Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH Heidelberg, München,<br />
Landesberg, Frechen, Hamburg, ISBN 978-3-609-62405-<br />
[5] Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, „Wasserleitfaden-<br />
zur Herausbildung leistungsstarker kommunaler und<br />
gemischtwirtschaftlicher Unternehmen der Wasserver- und<br />
Abwasserentsorgung“, Stand Juli 2005<br />
[6] Feuerwehrgesetz Baden Württemberg, § 3 Abs. 2 FWG, Stand 2010<br />
[7] Kommunale Wasserwirtschaft Information 01, Löschwasserversorgung<br />
durch Wasserversorgungsunternehmen Seite 9<br />
[8] Oppenländer Rechtsanwälte, „Kartellrechtliche Kostenkontrolle von<br />
Wasserentgelten - Der Fall „Calw“, Stand 2012<br />
[9] Organ des Vereins für kommunale Wirtschaft und Umwelttechnik,<br />
„Kommunalwirtschaft“, Stand 2010<br />
[10] Verband kommunaler Unternehmen e.V, „Löschwasservorhaltung<br />
durch Wasserversorgungsunternehmen“, Stand 2008<br />
Dr.-Ing. ESAD OSMANCEVIC<br />
RBS wave GmbH, Stuttgart<br />
AUTOREN<br />
Teamleitung Netzmanagement, Lehrbeauftragter<br />
Hochschule Rottenburg/Neckar<br />
Tel. +49 711 289513-20<br />
E-Mail: e.osmancevic@rbs-wave.de<br />
STEFFEN MAYER<br />
Student Hochschule Biberach<br />
Tel. +49 711 289513-54<br />
E-Mail: s.mayer@rbs-wave.de<br />
66 10 | 2013
3. Praxistag am 29. Oktober 2013 in Essen<br />
Wasserversorgungsnetze<br />
Programm<br />
Moderation: Prof. Th. Wegener,<br />
iro Institut für Rohrleitungsbau, Oldenburg<br />
Wann und Wo?<br />
Themenblock 1: Netzbetrieb - Analysieren und Optimieren<br />
Auf zu neuen Ufern -<br />
aktuelle Fragestellungen in der Wasserversorgung<br />
Th. Rücken, Timo Wehr, Rechenzentrum für Versorgungsnetze Wehr<br />
GmbH, Düsseldorf<br />
Einflüsse auf die Entscheidungsfindung im Asset Management<br />
M. Beck, Fichtner Water & Transportation GmbH, Berlin<br />
Themenblock 2: Strategien zur Netzspülung<br />
Zustandsorientierte Spülung von Trinkwassernetzen<br />
Dr. A. Korth, TZW, Außenstelle Dresden<br />
Softwarebasierte Ermittlung von Spülprogrammen<br />
zur Unterstützung systematischer Netzspülungen<br />
Dr. J. Deuerlein, 3S Consult GmbH, Garbsen<br />
Strategische Planung von Netzspülungen mit Hilfe<br />
von Trinkwasseranalysen<br />
M. Geib, OOWV Oldenburgisch-Ostfriesischer Wasserverband, Brake<br />
Themenblock 3: Netzüberwachung<br />
Multiparameter-Sensorik und Online-Überwachung<br />
für Wasserversorgungsnetze - Einsatz im Rahmen des<br />
Forschungsprojektes IWaNet<br />
W. Geiger, GERO Meßsysteme GmbH, Braunschweig<br />
Watercloud: Neue Wege im Wasserverlustmanagement<br />
H.-P. Karle, F.A.S.T GmbH, Langenbrettach<br />
Interdisziplinäre Planung von Netzspülungen durch neue Untersuchungsmethode<br />
mit Berücksichtigung der biologischen<br />
Trinkwasserqualität<br />
M. Scheideler, Scheideler Dienstleistungen, Haltern am See<br />
Themenblock 4: Netzbetrieb - Anwendungen aus Sicht<br />
der Wasserversorger<br />
Handlungsempfehlungen zur Minimierung von Rohrschäden<br />
an Hauptleitungen des Hamburger Versorgungsnetzes<br />
K. Krieger, HAMBURG WASSER, Hamburg; Dr. Ch. Sorge, IWW, Mülheim<br />
Umsetzung einer Netzmanagementstrategie bei der RWW–<br />
Rheinisch-Westfälischen Wasserversorgung<br />
J. Erbel, RWW GmbH, Mülheim, Dr. G. Gangl, RBS Wave GmbH, Stuttgart<br />
Veranstalter:<br />
Veranstalter<br />
<strong>3R</strong>, ZfW, iro<br />
Termin: Dienstag, 29.10.2013,<br />
9:00 Uhr – 17:15 Uhr<br />
Ort:<br />
Zielgruppe:<br />
Essen, Welcome Hotel<br />
Mitarbeiter von Stadtwerken<br />
und Wasserversorgungsunternehmen,<br />
Dienstleister im Bereich<br />
Netzplanung, -inspektion und<br />
-wartung<br />
Teilnahmegebühr*:<br />
<strong>3R</strong>-Abonnenten<br />
und iro-Mitglieder: 390,- €<br />
Nichtabonnenten: 420,- €<br />
Bei weiteren Anmeldungen aus einem Unternehmen<br />
wird ein Rabatt von 10 % auf den jeweiligen<br />
Preis gewährt.<br />
Im Preis enthalten sind die Tagungsunterlagen<br />
sowie das Catering (2 x Kaffee, 1 x Mittagessen).<br />
* Nach Eingang Ihrer schriftlichen Anmeldung (auch per Internet<br />
möglich) sind Sie als Teilnehmer registriert und erhalten eine<br />
schriftliche Bestätigung sowie die Rechnung, die vor Veranstaltungsbeginn<br />
zu begleichen ist. Bei Absagen nach dem 15.<br />
Oktober 2013 oder Nichterscheinen wird ein Betrag von 100,- €<br />
für den Verwaltungsaufwand in Rechnung gestellt. Die Preise<br />
verstehen sich zzgl. MwSt.<br />
Mehr Information und Online-Anmeldung unter<br />
www.praxistag-wasserversorgungsnetze.de<br />
Fax-Anmeldung: 0201-82002-40 oder Online-Anmeldung: www.praxistag-wasserversorgungsnetze.de<br />
Ich bin <strong>3R</strong>-Abonnent<br />
Ich bin iro-Mitglied<br />
Ich bin Nichtabonnent/kein iro-Mitglied<br />
Vorname, Name des Empfängers<br />
Telefon<br />
Telefax<br />
Firma/Institution<br />
E-Mail<br />
Straße/Postfach<br />
Land, PLZ, Ort<br />
Nummer<br />
✘<br />
Ort, Datum, Unterschrift
PROJEKT KURZ BELEUCHTET WASSERVERSORGUNG<br />
Bau von drei 36 m langen DN 3000-<br />
GFK-Trinkwasserröhrenspeichern<br />
Am 10. Juni 2013 wurde ein neuer Hochbehälter der Ammertal-Schönbuchgruppe (ASG) offiziell eingeweiht. Der alte<br />
Trinkwasserspeicher von Hagelloch, einem Stadtteil der Universitätsstadt Tübingen, war in die Jahre gekommen und seine<br />
Kapazität reichte für die sichere Versorgung nicht mehr aus. Daher entschloss sich die ASG, einen neuen Speicher zu bauen.<br />
Während der Planung und dem Bau des neuen Trinkwasserhochbehälters<br />
der ASG wurden insbesondere Naturschutzund<br />
Artenschutzaspekte nach der Fauna-Flora-Habitat-<br />
Richtlinie (FFH-Richtlinie) berücksichtigt. Bei der FFH-Richtlinie<br />
handelt es sich um eine Naturschutz-Richtlinie der Europäischen<br />
Union aus dem Jahr 1992, deren genaue deutsche<br />
Bezeichnung „Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai<br />
1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der<br />
wildlebenden Tiere und Pflanzen“ lautet. Die Richtlinie hat das<br />
Ziel, wildlebende Arten, deren Lebensräume und die europaweite<br />
Vernetzung dieser Lebensräume zu sichern und zu<br />
schützen. Die Vernetzung dient der Bewahrung, Wiederherstellung<br />
und Entwicklung ökologischer Wechselbeziehungen<br />
sowie der Förderung natürlicher Ausbreitungs- und Wiederbesiedlungsprozesse.<br />
Unter Berücksichtigung dieser Aspekte<br />
hätte der Bau eines herkömmlichen Hochbehälters mit einer<br />
Bauzeit von rund einem Jahr deutlich zu viel Zeit beansprucht<br />
und Fauna und Flora zu sehr geschädigt. Daher entschied sich<br />
die Ammertal-Schönbuchgruppe gegen eine Konstruktion in<br />
klassischer Betonbauweise und erstmalig für den Einsatz des<br />
FLOWTITE-GFK-Systems der AMITECH Germany GmbH. Mit<br />
Erfolg: Aufgrund der weitest gehenden Vorfertigung aller<br />
GFK-Bauteile im Werk dauerte die Montage der Module des<br />
rund 650 m 3 fassenden Röhrenspeichers auf der Baustelle<br />
nur wenige Tage. Damit wurde nicht nur den Vorgaben<br />
der FFH-Richtlinie entsprochen. Auch unter wirtschaftlichen<br />
Gesichtspunkten hat das GFK-Trinkwasserspeichersystem den<br />
Auftraggeber überzeugt.<br />
Nach Aussage des Bauherrn sollte der neue Trinkwasserspeicher<br />
am höchsten Punkt des Ortes liegen, um die besonderen<br />
Druck- und Höhenverhältnisse in Hagelloch optimal ausgleichen<br />
zu können. Zudem war bei der Auslegung des neuen<br />
Hochbehälters eine Löschwasserreserve mit einzuplanen. Nach<br />
Abwägung aller Parameter entschied sich der Bauherr für den<br />
Bau eines Röhrenspeichers aus glasfaserverstärkten Kunststoffrohren<br />
von AMITECH. Insbesondere erwähnenswert und<br />
ein wichtiger Pluspunkt auch bei diesem Projekt: Trinkwasserspeicher<br />
aus dem FLOWTITE-GFK-System können individuell<br />
nach den Anforderungen des Bauherrn zusammengestellt,<br />
geplant und produziert werden. Die einzelnen Module, die<br />
auf der Baustelle zusammengefügt werden, haben trotz ihrer<br />
Ausmaße ein vergleichsweise geringes Gewicht und sind daher<br />
bei der Montage auf der Baustelle mit leichterem Baugerät zu<br />
bewegen. „Dies ist ein weiterer Vorzug des Systems, gerade<br />
Foto: ASG<br />
Foto: ASG<br />
Bild 1: Luftaufnahme mit Blick auf den neuen Trinkwasserröhrenspeicher<br />
von Hagelloch. Gut zu erkennen sind die drei<br />
parallelen 36,5 m langen Speicherbehälter DN 3000, die über die<br />
quer angeordnete Schieberkammer zugänglich sind. Zur Fertigstellung<br />
wurde Speichersystem noch mit rund 3.300 m 3 Erde überdeckt<br />
Bild 2: Der Zugang zur Schieberkammer wird mit einer Sicherheitstür<br />
aus Edelstahl der Widerstandsklasse WK3 gesichert<br />
68 10 | 2013
WASSERVERSORGUNG PROJEKT KURZ BELEUCHTET<br />
in Gelände mit schwerer Zugänglichkeit“, erläutert Martin<br />
Lang, Gebietsverkaufsleiter der AMITECH Germany GmbH.<br />
Hightech aus dem Baukasten<br />
Das Konzept sah den Bau von drei parallel angeordneten<br />
36,5 m langen Trinkwasser-Röhrenbehältern aus GFK-Wickelrohr<br />
DN 3000 vor, die mit anlaminierten GFK-Klöpperböden<br />
verschlossen wurden. Die mikrobiologische Eignung der Trinkwasserbehälter<br />
war durch ein vom DVGW anerkanntes Prüfinstitut<br />
entsprechend Arbeitsblatt W 270 nachzuweisen und zu<br />
dokumentieren. Für Wartungszwecke wurden in die Stirnseite<br />
der drei Trinkwasser-Röhrenbehälter Drucktüren DN 800 aus<br />
Edelstahl mit Schauluken DN 150 und Schnellverschluss installiert.<br />
Die Zulauf-, Zirkulations-, Überlauf-, Entleerungs- und<br />
Entnahmeleitung der Behälter bestehen aus V2A 1.4301. Quer<br />
zu den drei Speichern ist eine 19,2 m lange Schieberkammer<br />
DN 3000 aus GFK angeordnet, in der sich die Zu- und<br />
Ablaufleitungen sowie die notwendigen Absperr-Armaturen<br />
befinden. Die Schieberkammer ist stirnseitig mit Stahlbetonplatten<br />
verschlossen, wobei eine Sicherheitstür aus Edelstahl<br />
der Widerstandsklasse WK3 in die Eingangsseite der Kammer<br />
eingebaut wurde. Seitlich neben den Speicherbehältern sind<br />
Drainageleitungen DN 150 aus Vollsickerrohr mit 0,5 % Gefälle<br />
installiert, um anfallendes Sicherwasser aufzufangen und<br />
abzuleiten. Nach Fertigstellung des Behältersystems wurde<br />
die Anlage frostsicher mit Erde überdeckt.<br />
Fazit<br />
Dank der Vorteile des GFK-Trinkwassersystems konnte die<br />
Baumaßnahme deutlich schneller und günstiger fertiggestellt<br />
werden als dies mit herkömmlichen Konstruktionen<br />
möglich gewesen wäre. Mehr als 3.300 m 3 Erde wurden<br />
beim Einbau des 650 m 3 fassenden Trinkwasserspeichers<br />
bewegt. Die ASG hat<br />
insgesamt 800.000 €<br />
in das Projekt investiert<br />
und damit die<br />
Trinkwasserversorgung<br />
von Hagelloch<br />
langfristig sichergestellt.<br />
Die Gesamtbauzeit<br />
betrug inklusive<br />
der Vorarbeiten,<br />
des Speicherbaus, des<br />
Einbaus der technischen<br />
Anlagen sowie<br />
der anschließenden<br />
Erd- und Verkleidungsarbeiten<br />
nur<br />
rund vier Monate,<br />
die reine Bauzeit der<br />
Speicheranlage lediglich<br />
eine Woche. „Das<br />
Konzept mit dem<br />
GFK-System war für<br />
die Erneuerung des<br />
Trinkwasser-Hochbehälters<br />
in Hagelloch<br />
die ideale Lösung“, resümiert Dipl.-Verw.-Wirt.<br />
Astrid Stepanek, Geschäftsführerin der Zweckverband<br />
Ammertal-Schönbuchgruppe.<br />
KONTAKT: Amitech Germany GmbH, Mochau OT Großsteinbach,<br />
Tel. +49-3431-71820, E-Mail: info@amitech-germany.de,<br />
www.amitech-germany.de<br />
Foto: ASG<br />
Bild 3: Montage der Zulauf- und Entnahmeleitungen<br />
sowie der notwendigen Absperr-Armaturen in der<br />
Schieberkammer<br />
Asset Management - Risikobewertung im Rohrnetz<br />
Innovationstechnologie unterstützt professionelles<br />
Asset Management bei gezielter Erfassung<br />
und Steuerung von Risiken in Wasser- und<br />
Energienetzsystemen. Die Wissenschaft reagiert<br />
auf gestiegene Anforderungen in der sicherheitskritischen<br />
Infrastruktur. Zunehmendes<br />
Betriebsmittelalter, wachsende Reparaturkosten<br />
und steigende Schadensraten alarmieren<br />
Netzbetreiber und nachhaltige Rehabilitationskonzepte<br />
gewinnen zunehmend an Bedeutung.<br />
PiReM (Pipe Rehabilitation Management) ist<br />
ein dynamisches Softwaretool zur professionellen<br />
Erneuerungsplanung alterungsabhänigiger<br />
Wasser- und Energienetzsysteme. PiReM<br />
unterstützt Netzbetreiber die Vorgaben von<br />
Kontrollbehörden einzuhalten und Risiken vorzubeugen.<br />
Die professionelle Line Extension der Fachschale<br />
PiReM Trinkwasser auf die Netzsysteme<br />
Gas, Strom, Fernwärme, Abwasser und<br />
Transportleitungen zeigt hohe Praxisrelevanz<br />
und unterstützt den branchenübergreifenden<br />
Know-how Transfer und kosteneinein-<br />
sparende Effizienz für Multi Utility Anbieter.<br />
Unternehmen wie Berliner Wasserbetriebe,<br />
RWW Wasser, Fair Energie GmbH oder Erlanger<br />
Stadtwerke AG setzten bereits auf eine erfolgreiche<br />
Rehabilitationsplanung mit PiReM.<br />
Die Fachtagung Datenmanagement<br />
für optimale Asset Strategien stellt am<br />
19. November 2013 in Hamburg komplexe<br />
Entscheidungen der Netzplanung sowie Business<br />
Simulation und -Optimierung in Energie-<br />
und Wassernetzen in den Mittelpunkt.<br />
Folgende Fachthemen werden u.a. diskutiert:<br />
* Verbesserung von Netzzustandsdaten durch<br />
materialtechnische Zustandsbewertungen<br />
* Praxisbericht zur softwaregestützten Rehabilitationsplanung<br />
im Berliner Wassernetz<br />
* Zustandsbewertung in Hochdruckleitungs- und<br />
Transportnetzen<br />
* Best Practice Beispiele zur Umsetzung einer<br />
risikoorientierten Instandhaltungsstrategie<br />
* Dynamische Asset Simulation im Hamburger<br />
Stromnetz<br />
10 | 2013 69
FACHBERICHT WASSERVERSORGUNG<br />
Einflüsse auf die Entscheidungsfindung<br />
im Asset Management<br />
Asset Management, das effiziente Betreiben von Betriebsmitteln über den gesamten Lebenszyklus hinweg, ist bei<br />
Versorgungsunternehmen zwischenzeitlich ein auf verschiedenen Ebenen etabliertes Werkzeug zur Sicherstellung der<br />
Unternehmensziele. Operatives und strategisches Asset Management ergänzen sich hierbei idealerweise und kombinieren<br />
die Erkenntnisse auf Betriebsmittelsicht mit langfristigen Simulationen als Grundlage für die Unternehmensstrategie.<br />
Als Naturwissenschaftler und Techniker gehen wir davon aus, dass wir unsere Entscheidungen objektiv aufgrund<br />
harter technischer Fakten treffen. Leider sind wir beim Asset Management teils mit Datenquellen unterschiedlichster<br />
Qualität konfrontiert, die kombiniert und interpretiert werden müssen. In letzter Zeit veröffentlichte Erkenntnisse der<br />
Psychologie zeigen, dass hierbei kognitive Verzerrungen auftreten können. Diese Erkenntnisse zu kennen kann helfen,<br />
teure Fehlentscheidungen zu vermeiden.<br />
HINTERGRUND: SCHNELLES DENKEN, LANGSAMES<br />
DENKEN<br />
Populärwissenschaftliche Bücher über die Psychologie wie<br />
Kahnemanns „Schnelles Denken, langsames Denken“ zeigen,<br />
wo wir besonders häufig in systematische Denkfallen tappen.<br />
Namensgeber für das Buch ist die Theorie, dass unsere Denkprozesse<br />
auf zwei Ebenen oder in zwei Systemen ablaufen:<br />
System 1, das schnelle Denken, ist ein unbewusstes,<br />
ständig aktives und schnelles Beurteilen von Situationen,<br />
das hauptsächlich über Stereotype abläuft, d. h. ständig<br />
Muster vergleicht und darauf basierend Entscheidungen<br />
trifft. System 2, das langsame Denken, ist demgegenüber<br />
ein bewusstes Nachdenken über komplexere Probleme. Da<br />
es deutlich mehr Energie und Aufmerksamkeit bedarf, wird<br />
es nur „zugeschaltet“, wenn System 1 die Komplexität des<br />
Problems erkennt.<br />
Ein gutes Beispiel, um die Wirkungsweise von System 1 zu<br />
erkennen, ist das Schläger-und-Ball-Problem. Versuchen Sie<br />
dazu folgende Aufgabe zu lösen: „Ein Schläger und ein<br />
Ball zusammen kosten 1,10 EUR. Der Schläger kostet 1 EUR<br />
mehr als der Ball. Was kostet der Ball?“. Merken Sie, wie ihr<br />
System 1 meint, 0,10 EUR würde richtig ausschauen? Die<br />
meisten kommen erst, wenn Sie bewusst darüber nachdenken,<br />
dass dann in Summe 1,20 EUR rauskommt, auf die<br />
richtige Antwort.<br />
Selbstverständlich neigen wir dazu, anzunehmen, dass wir<br />
wichtige Entscheidungen ausschließlich mit System 2 treffen.<br />
Die im Folgenden beschriebenen Beispiele sollen zeigen,<br />
wo die Gefahr von Fehleinschätzungen besteht. Zum leichteren<br />
Verständnis wird jeweils zuerst ein Beispiel Kahnemanns<br />
oder ein „Allerweltsbeispiel“ verwendet und erst nach der<br />
Erläuterung des Problems der Bezug zum Asset Management<br />
hergestellt und mögliche Auswirkungen oder auch Gegenmaßnahmen<br />
diskutiert.<br />
FRAGEN ERSETZEN<br />
Wie George Pólya in „Schule des Denkens“ schreibt: „Wenn<br />
Du ein Problem nicht lösen kannst, dann gibt es ein einfacheres<br />
Problem, dass Du lösen kannst. Finde es.“<br />
Überlegen Sie sich dazu die Antwort auf folgende Fragen:<br />
- Wie erfolgreich wird Bayern München in zehn Jahren sein?<br />
- In welchem Zustand werden meine Stahlleitungen in zehn<br />
Jahren sein?<br />
In dieser Zusammenstellung wird einem sehr schnell klar,<br />
dass man die erste Frage zwar meint, beantworten zu<br />
können. Hinterfragt man die eigene Entscheidungsfindung<br />
zeigt sich aber, dass man eigentlich gar nicht genug<br />
weiß, um eine solche Vorhersage fundiert zu machen.<br />
Stattdessen hat man unbewusst die Frage durch eine<br />
„heuristische Frage“ ersetzt: „Wie gut ist Bayern München<br />
jetzt?“ Die Gefahr hier besteht also in der Neigung,<br />
das eigene Urteilsvermögen nicht anzuzweifeln, obwohl<br />
man für eine fundierte Beurteilung nicht ausreichende<br />
Daten hat.<br />
Die zweite Frage kann eigentlich nur sinnvoll beantwortet<br />
werden, wenn ein Alterungsmodell vorliegt, das netzabschnittsweise<br />
unter Berücksichtigung aller bekannten<br />
Einflussfaktoren Alterungsfunktionen ermittelt hat, die<br />
den zeitlichen Verlauf der Alterung erkennen lassen. Viel<br />
zu schnell wird man hier jedoch als Praktiker meinen, man<br />
könne die Frage beantworten, indem man sie durch ein<br />
„Wie viele Schäden hatten wir letztes Jahr an unseren<br />
Stahlleitungen?“ ersetzt.<br />
BASISRATENFEHLER<br />
Hierbei handelt es sich um Fehlschlüsse, die sich ergeben,<br />
wenn wir eine Fragestellung nur mit der Innensicht betrachten,<br />
also nur die Besonderheiten des Falles betrachten, anstatt<br />
auch die Außensicht anzuwenden, d. h. grundsätzliche Erfahrungen<br />
mit ähnlichen Problemen mit einzuschließen. Ein<br />
Beispiel, das Kahnemann selbst schildert, wird vermutlich<br />
jedem Projektmanager bekannt vorkommen. So hatte er<br />
zu Beginn eines Buchprojekts die Co-Autoren gefragt, wie<br />
lange sie die Projektdauer einschätzen. Hierbei kamen rund<br />
zwei Jahre raus. Nachdem er ein Teammitglied gezielt fragte,<br />
wie solche Projekte üblicherweise verlaufen, erklärte dieser<br />
jedoch, dass gerade mal 40 % überhaupt abgeschlossen<br />
werden und dann i.d.R. erst nach rund sieben Jahren.<br />
70 10 | 2013
WASSERVERSORGUNG FACHBERICHT<br />
Diese Diskrepanz ist ein Teil dessen, was Kahnemann<br />
später als Planungsfehlschluss erläutert, und was mit ein<br />
Grund dafür ist, dass Flughäfen oder Philharmonien nicht<br />
rechtzeitig fertig werden.<br />
Es ist jedoch auch ein Problem bei der Beurteilung z. B.<br />
des Zustands eines Netzes. Da man hier i.d.R. nur bei<br />
wenigen Materialgenerationen ausreichend Leitungen<br />
hat, um statistisch signifikante Aussagen ausschließlich<br />
über die Schadensrate zu erzielen, ist ein bewusstes<br />
Hinzuziehen von generellen Informationen notwendig.<br />
Erst die Kombination der beiden Sichtweisen ergibt eine<br />
realistische Einschätzung.<br />
OptNet bewertet hierzu Materialgeneration, vorgefundene<br />
Einflussfaktoren und Schadenshistorie der Einzelleitung<br />
anhand von Erfahrungswerten und stellt eine Zustandsnote<br />
zur Verfügung, die dem erwarteten Zustand entspricht<br />
(Außensicht). Durch die anschließende Kalibrierung der<br />
Alterungsfunktionen anhand der in der Materialgeneration<br />
und Durchmesserklasse aufgetretenen Schäden<br />
kommt eine Innensicht dazu. Sie zeigt die tatsächliche<br />
Entwicklung, ist aber, wenn von einer Materialgeneration<br />
nur geringe Mengen an Leitungen vorliegen ggf. durch<br />
statistische Ausreißer beeinflusst. Für die endgültige Beurteilung<br />
des Erneuerungsbudgetbedarfs werden diese<br />
beiden Informationen schließlich zusammengefasst und<br />
mit weiteren Erfahrungswerten so kombiniert, dass mit<br />
der „Bewertung Abnutzung“ eine fundierte Grundlage<br />
für Investitionsentscheidungen zur Verfügung steht.<br />
Bild 1 zeigt eine vergleichende Auswertung aus Opt-<br />
Net-L. Klar zu erkennen ist, dass nach der Kalibrierung<br />
selbst bei Leitungen mit rund 140 Jahren noch die Note<br />
„Sehr gut“ auftritt. Dies entspricht der gängigen Erfahrung,<br />
dass die letzten verbleibenden Rohrleitungen einer<br />
Materialgeneration ja „die besten ihrer Art“ sind und<br />
tatsächlich i.d.R. wenige Schäden aufweisen. Für die<br />
Entscheidung, wie viel Budget in den nächsten Jahren<br />
vorgeschlagen werden sollte, werden diese Leitungsabschnitte<br />
jedoch trotzdem als „verschlissen“ gewertet.<br />
Auch wenn sie derzeit nicht auffällig sind, ist anzunehmen,<br />
dass sie sich am Ende ihrer Lebensdauer befinden.<br />
Bereits eine Baustelle in der Nähe kann, vor allem bei<br />
den alten spröden Materialien, schnell sprunghaft die<br />
Schadensrate steigern. Für die tatsächliche Umsetzung<br />
des Budgets in Einzelmaßnahmen ist jedoch die tatsächliche<br />
Ausfallwahrscheinlichkeit, d. h. die „Zustandsnote<br />
kalibriert“ entscheidend.<br />
REGRESSION ZUM MITTELWERT<br />
Eine Eigenschaft der Statistik, die uns bewusst klar zu sein<br />
scheint, ist die „Regression zum Mittelwert“ – Extremwerte<br />
sind selten und die Wahrscheinlichkeit, dass nach<br />
dem Auftreten eines Extremwertes wieder normalere<br />
Werte auftreten hoch.<br />
Bei der Beurteilung von Schadensereignissen trifft uns<br />
diese Fehleinschätzung manchmal, wenn plötzlich in<br />
einem Jahr unerwartet viele Schadensereignisse an einer<br />
Materialart auftreten. Schnell kommt hier die Auffassung,<br />
man müsse sofort entgegensteuern.<br />
Bild 1: Vergleich von drei Zustandsnoten in OptNet<br />
10 | 2013 71
FACHBERICHT WASSERVERSORGUNG<br />
Bild 2 zeigt eine beispielhafte Auswertung von Schadensereignissen<br />
mehrerer Jahre („Keine Kategorie“ heißt<br />
hier, dass bei der Schadenserfassung die Materialart nicht<br />
erfasst wurde). Es zeigt sich, dass 1995 plötzlich eine<br />
vergleichsweise große Zahl PE-HD-Leitungen Schäden<br />
aufwies. Hier wäre es sicherlich keine gute Idee gewesen,<br />
dies sofort ernst zu nehmen und entsprechend zu<br />
handeln. Gleichzeitig zeigt sich aber auch die geringe<br />
Anzahl an Schäden insgesamt, die für eine Beurteilung<br />
zur Verfügung stehen, was zum nächsten Problem führt:<br />
AVAILABILITY BIAS<br />
In den Medien sind wir täglich mit Umfragen konfrontiert,<br />
von denen uns eigentlich bewusst ist, dass diese nicht aussagekräftig<br />
sind. Klassiker beginnen mit den Worten „Eine<br />
Umfrage unter X Passanten ergab…“. Und selbst, wenn<br />
die verwendete Stichprobe ausnahmsweise ausreichend<br />
groß ist, werden die Ergebnisse gerne so dargestellt, dass<br />
ein falscher Eindruck erweckt wird. Im einfachsten Fall,<br />
indem die Y-Achse verschoben wird, wie in Bild 3.<br />
Bild 2: Vereinzelte Schadenshäufigkeiten können getrost ignoriert werden<br />
Bild 3: Unterschiedliche Darstellung der gleichen Werte<br />
Selbstverständlich erkennen wir, dass in der unteren Darstellung<br />
eine Verzerrung der Unterschiede zwischen den<br />
einzelnen Werten aufgetreten ist, weil sich durch die<br />
Verschiebung der Y-Achse eine Änderung der Skalierung<br />
ergeben hat. Leider zeigt sich, dass unser Gehirn nach<br />
dem Motto „what you see is all there is“ arbeitet. In<br />
Ermangelung besserer Informationen wird jede Information<br />
genommen, die wir haben – auch wenn wir versuchen<br />
uns bewusst klar zu machen, dass die Stichprobengröße<br />
nicht ausreichend war, oder die bildliche Darstellung<br />
verzerrt war.<br />
Gerade bei der Bewertung von Anlagen lässt es sich nicht<br />
immer vermeiden, Entscheidungen auch mal auf Grundlage<br />
von Datenmengen zu treffen, die eigentlich zu gering<br />
sind, um statistisch signifikante Aussagen zu gewährleisten.<br />
Umso mehr ist es wichtig, sich bei entsprechenden<br />
Angaben immer die Datengrundlage zu notieren.<br />
Als hilfreich hat es sich erwiesen, Ergebnisse nicht nur in<br />
einem Bericht vorgelegt zu bekommen, sondern sich die<br />
Möglichkeit zu schaffen, selbst „mit den Zahlen zu spielen“.<br />
Es zeigt sich hier immer<br />
wieder, dass ausführliche Workshops<br />
zur gemeinsamen Datenanalyse<br />
deutlich mehr bringen,<br />
als lange Berichte.<br />
DER HANG ZUM<br />
NULL-RISIKO<br />
Eine unangenehme Erkenntnis<br />
für alle, die regelmäßig mit<br />
Statistiken und Wahrscheinlichkeiten<br />
zu tun haben ist sicherlich<br />
die, dass wir, auch wenn<br />
wir uns dies bewusst einreden,<br />
unbewusst Wahrscheinlichkeiten<br />
nicht differenzieren. So zeigten<br />
Versuchspersonen, die man<br />
an einen Schaltkreis anschloss,<br />
exakt das gleiche Ausmaß an<br />
Angst unabhängig davon ob<br />
man Ihnen mitteilte, dass Sie<br />
mit ein- oder zwanzigprozentiger<br />
Wahrscheinlichkeit einen<br />
Stromschlag bekommen würden.<br />
Die bewusste Überlegung,<br />
dass 1% sehr unwahrscheinlich<br />
ist, sorgte hier nicht für einen<br />
geringeren Anstieg zum Beispiel<br />
des Puls. Beruhigend ist<br />
ausschließlich eine Wahrscheinlichkeit<br />
von 0.<br />
Tatsächlich ist dies eine Fehleinschätzung,<br />
die bei der Erneuerungsplanung<br />
relativ häufig<br />
auftritt: Wie Bild 4 zeigt, sind<br />
die Ausfallwahrscheinlichkeiten<br />
innerhalb der Materialklas-<br />
72 10 | 2013
WASSERVERSORGUNG FACHBERICHT<br />
sen und Altersstufen in der<br />
Realität aufgrund unterschiedlicher<br />
Randbedingungen weit<br />
gestreut. Wäre dies nicht der<br />
Fall, so könnten nie besonders<br />
gefährdete Leitungsabschnitte<br />
identifiziert werden und sinnvolle<br />
Erneuerungsmaßnahmen<br />
vorgeschlagen werden.<br />
Der Fehler, der hier auftritt,<br />
ist angesichts des unteren<br />
Diagramms zu denken:<br />
„PE-HD ist so gut, da machen<br />
wir noch gar nichts“ oder „GG<br />
ist so schlecht, die sollten wir<br />
alle auswechseln“. Letzteres<br />
ist zugegebenermaßen in<br />
der realen Budgetplanung,<br />
in der ein Asset Manager<br />
seine Budgetwünsche durch<br />
griffige Erklärungen hinterlegen<br />
muss, manchmal eine hilfreiche<br />
Vorgehensweise. Wirtschaftlich<br />
ist sie jedoch nicht.<br />
Eine technisch-wirtschaftlich optimale Erneuerungsplanung<br />
wird im vorliegenden Fall zwar natürlich vor<br />
allem GG-Leitungen austauschen, aber eben vielleicht<br />
auch schon die eine oder andere besonders auffällige<br />
PE-HD-Leitung.<br />
Bild 4: Streuung der Ausfallwahrscheinlichkeiten<br />
WENIGER IST MEHR<br />
Überlegen Sie, was wahrscheinlicher ist:<br />
»»<br />
Option 1: Im nächsten Jahr findet in den USA eine<br />
gewaltige Flutkatastrophe statt, bei der mehr als<br />
1.000 Menschen sterben.<br />
»»<br />
Option 2: Im nächsten Jahr kommt es in Kalifornien<br />
zu einem Erdbeben. In den dadurch verursachten<br />
Fluten sterben mehr als 1.000 Menschen.<br />
Betrachtet man die beiden Optionen nüchtern, stellt man<br />
fest, dass bei Option 1 jede Art von Flutkatastrophe möglich<br />
ist, während es bei Option 2 eine Folge des Erdbebens<br />
sein müsste. Noch dazu ist in Option 2 die mögliche Region<br />
auf Kalifornien begrenzt. Die Wahrscheinlichkeit von<br />
Option 2 muss also ein geringer Bruchteil von Option 1<br />
sein. Dennoch lässt uns die Plausibilität eines Erdbebens<br />
in Kalifornien und die in sich stimmige Story dies nicht<br />
sofort erkennen. Übertragen auf die Netzbewertung kann<br />
dieser Effekt auftauchen, wenn man folgende Optionen<br />
miteinander vergleicht:<br />
»»<br />
Option 1: Die Gesamtzahl der Schäden nimmt<br />
nächstes Jahr absolut zu.<br />
»»<br />
Option 2: Bei Az-Leitungen bis DN 200 steigt<br />
nächstes Jahr die Schadenszahl.<br />
Hier bleibt offensichtlich nur, sich vor allzu schlüssig klingenden<br />
Stories zu hüten – der beste Schutz gegen solche<br />
Fehleinschätzungen ist auch hier eine detaillierte Analyse<br />
der zugrundeliegenden Daten.<br />
ZUSAMMENFASSUNG<br />
Die Berücksichtigung von Erkenntnissen der Psychologie zu<br />
Denkfallen und kognitiven Verzerrungen zeigt insbesondere<br />
bei der Interpretation statistischer Daten die Gefahr von<br />
Fehlentscheidungen. Insofern kann der „Blick über den Tellerrand“<br />
Entscheidungsträgern im Asset Management wertvolle<br />
Denkanstöße geben, um eigene Bewertungen kritisch zu<br />
hinterfragen.<br />
Grundlage für ein fundiertes Verständnis der Wirkungszusammenhänge<br />
im Netz ist eine detaillierte und objektive<br />
Analyse der Daten. Als hilfreich für ein Hinterfragen der Entscheidungsgrundlagen<br />
hat sich der Einsatz flexibler Datenanalysewerkzeuge<br />
erwiesen. So können, ohne große Einarbeitungszeit,<br />
die ermittelten Daten selbst analysiert werden und,<br />
teils allein durch eine Änderung der Darstellung der Daten,<br />
eine objektivere Sicht gewonnen werden als wenn nur ein<br />
vorgefertigter Bericht zur Verfügung steht.<br />
LITERATURVERZEICHNIS<br />
[1] Dobelli, R. (2011). Die Kunst des klaren Denkens: 52 Denkfehler, die<br />
Sie besser anderen überlassen. Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG.<br />
[2] Kahnemann, D. (2011). Schnelles Denken, Langsames Denken.<br />
München: Siedler Verlag.<br />
MIKE BECK<br />
Fichtner Water & Transportation GmbH,<br />
Berlin<br />
Tel.: +49 30 609765-41<br />
E-Mail: info@optnet.de<br />
AUTOR<br />
10 | 2013 73
FACHBERICHT KORROSIONSSCHUTZ<br />
Beeinflussung von Wasserleitungen<br />
durch Streuströme: Messtechnische<br />
Erfassung und Schutzmaßnahmen<br />
Die Wasserverteilnetze in städtischen Gebieten sind mit zunehmenden Herausforderungen bezüglich des<br />
Korrosionsschutzes konfrontiert. Während die hochwertigen Umhüllungssysteme die Problematik von Korrosion im<br />
Boden weitgehend eliminieren, besteht vielerorts eine zunehmende Gefährdung durch Streuströme. Diese rühren<br />
einerseits von der steigenden Leistung und den damit höheren Schienenpotentialen bei Gleichstrombahnen und<br />
andererseits von der alternden Beschichtung von kathodisch geschützten Rohrleitungen und dem damit steigenden<br />
Schutzstrombedarf her. Diese steigenden Ströme erhöhen die Korrosionsgefährdung von Drittstrukturen. Eine<br />
mögliche Vorgehensweise bei der Bewertung der Beeinflussung wird diskutiert und konkrete Schutzmaßnahmen<br />
werden untersucht und präsentiert.<br />
In vielen städtischen Versorgungsnetzen liegt eine hohe<br />
Dichte an erdverlegter metallischer Infrastruktur vor.<br />
Gleichzeigt besteht eine Streustromgefährdung durch<br />
Gleichstrombahnanlagen und durch Gasleitungsnetze,<br />
die mit einem kathodischen Korrosionsschutz [1] ausgerüstet<br />
sind. In vielen Fällen führt die steigende Leistung<br />
der Bahnanlagen zu steigenden Schienenpotentialen und<br />
somit zu verstärkten Streuströmen. Außerdem bedingen<br />
die allmähliche Alterung der Umhüllung, sowie die<br />
erhöhte Streustromgefährdung der kathodisch geschützten<br />
Gasrohrleitungen eine kontinuierliche Zunahme des<br />
Schutzstrombedarfs. Eine Erhöhung des Schutzstroms<br />
führt zwar zur Verbesserung des kathodischen Korrosionsschutzes<br />
und in den meisten Fällen ist es auch möglich,<br />
die Schutzkriterien für den kathodischen Korrosionsschutz<br />
aufrechtzuerhalten. Die Problematik besteht aber darin,<br />
dass diese Maßnahme auch zu einer Erhöhung der Korrosionsgefährdung<br />
von Drittstrukturen führt. Diese ist<br />
besonders ausgeprägt, wenn es sich um elektrisch längsleitfähige<br />
Rohrleitungen handelt. Konkret führt dies zu<br />
der Situation, dass durch den Streustrom der Bahnanlagen<br />
oder den kathodischen Korrosionsschutz von Gasleitungen<br />
die Lebensdauer der Drittstrukturen beeinträchtigt<br />
werden kann. Im Extremfall erreicht dabei die Gasleitung<br />
eine Nutzungsdauer von weit über 100 Jahren, während<br />
die benachbarte Wasserleitung bereits nach wenigen<br />
Jahrzehnten durch Korrosion perforiert wird. In einem<br />
ungünstigen Einzelfall wurde sogar beobachtet, dass die<br />
Leckage der Hochdruckwasserleitung zu einer Perforation<br />
der Gasleitung aufgrund von Erosion geführt hat.<br />
Bild 1: Streustrombeeinflussung einer Rohrleitung mit zwei<br />
identischen Fehlstellen. Die Messanordnung entspricht der<br />
EN 50162<br />
Bild 2: Kathodische Streustrombeeinflussung einer Rohrleitung mit<br />
einer asymmetrischen Verteilung der Fehlstellen, wie sie im Normalfall<br />
zu erwarten ist. Die Messanordnung entspricht der EN 50162<br />
74 10 | 2013
FACHBERICHT KORROSIONSSCHUTZ<br />
MESSUNG DER STREUSTROMBEEINFLUSSUNG<br />
Konkret stellt sich die Frage nach der Bewertung der Korrosionsgefährdung<br />
durch Fremdströme sowie die möglichen<br />
Schutzmaßnahmen. Denn bezüglich der Zustandserfassung<br />
und der Planung der Erneuerungsstrategie<br />
von erdverlegten städtischen Infrastruktureinrichtungen<br />
ist es wesentlich, die effektive Beeinflussungssituation<br />
zu erfassen. Generell sind anodische Beeinflussungen<br />
entsprechend Gleichung (1) zulässig, wobei ρ der Bodenwiderstand<br />
in Ωm und U max<br />
die maximal zulässige mittlere<br />
Potentialanhebung durch einen Streustrom in mV<br />
darstellt.<br />
U max<br />
=1.5⋅ ρ<br />
(1)<br />
Die Vorgaben der EN 50162 [2] für die Erfassung der<br />
Streustrombeeinflussung verlangen eine Potentialregistrierung<br />
gemessen gegen eine Bezugselektrode, die<br />
über der beeinflussten Struktur positioniert wird. Diese<br />
Konfiguration ist in Bild 1 für eine Rohrleitung mit zwei<br />
identisch großen Fehlstellen dargestellt. Der Streustromaustritt<br />
an der Schiene bewirkt einen Spannungsfall ΔU<br />
im Erdboden, der durch die beiden Fehlstellen in der<br />
elektrisch längsleitfähigen Rohrleitung abgegriffen wird.<br />
Da die Fehlstellen im dargestellten Fall identische Ausbreitungswiderstände<br />
haben, kann in erster Näherung davon<br />
ausgegangen werden, dass die anodische Potentialverschiebung<br />
ΔU a<br />
und die kathodische Beeinflussung ΔU k<br />
identisch sind. Demzufolge wird durch die Messung der<br />
Potentialbeeinflussung gemäß Bild 1 in der gegebenen<br />
Konfiguration tatsächlich die effektive Streustrombeeinflussung<br />
erfasst, die anhand der EN 50162 bewertet<br />
werden kann. Eine genauere Prüfung zeigt nun aber,<br />
dass die in Bild 1 dargestellte Situation nicht der typischen<br />
Konfiguration entspricht. Vielmehr muss davon<br />
ausgegangen werden, dass fern des Kreuzungsbereichs<br />
mit einer großen Zahl an Fehlstellen gerechnet werden<br />
muss. Das bedeutet, dass der Ausbreitungswiderstand<br />
im Spannungstrichter der Bahn im typischen Fall deutlich<br />
größer ist als jener der Rohrleitung außerhalb des Spannungstrichters.<br />
Diese Konfiguration ist in Bild 2 dargestellt,<br />
wobei die große Anzahl an Fehlstellen außerhalb<br />
des Spannungstrichters in Form einer einzigen großen<br />
Fehlstelle dargestellt wird. Es zeigt sich, dass sich der<br />
durch die beiden Fehlstellen abgegriffene Spannungsfall<br />
ΔU nicht mehr symmetrisch aufteilt. Vielmehr erfolgt<br />
eine starke kathodische Beeinflussung ΔU k<br />
, die zu einer<br />
gemessenen schwachen anodischen Beeinflussung ΔU a<br />
führt. Dies zeigt deutlich, dass anodische Spannungstrichter<br />
in vielen Fällen nicht zu kritischen anodischen<br />
Beeinflussungen führen, sofern die Widerstandsverhältnisse<br />
entsprechend günstig liegen.<br />
Schwieriger ist die Situation allerdings im Fall einer Beeinflussung<br />
durch einen kathodischen Spannungstrichter wie<br />
sie in Bild 3 dargestellt ist. Diese führt in der Messung<br />
zu einer leichten kathodischen Polarisation. Tatsächlich<br />
tritt aber eine starke anodische Beeinflussung auf. Daraus<br />
muss geschlossen werden, dass ohne weiterführende<br />
Betrachtungen eine Beeinflussungsmessung gemäß<br />
EN 50162 zu falschen Beurteilungen führen kann. Bei<br />
einer Situation gemäß Bild 3 ist nicht nur das Ausmaß,<br />
sondern sogar das Vorzeichen der Streustrombeeinflussung<br />
falsch. Konkret stellt sich die Frage, wie die effektive<br />
Beeinflussung überhaupt erfasst werden kann. Bei<br />
genauerer Betrachtung wird deutlich, dass die effektive<br />
Streustrombeeinflussung messtechnisch gar nicht<br />
zugänglich ist. Durch Verschieben der Bezugselektrode<br />
in Richtung der beeinflussenden Struktur (hier Gleise)<br />
wird aber generell eine bessere Erfassung der Beeinflussung<br />
möglich. Dies wird in Bild 4 für die verschiede-<br />
Bild 3: Anodische Streustrombeeinflussung einer<br />
Rohrleitung mit einer asymmetrischen Verteilung der<br />
Fehlstellen, wie sie im Normalfall zu erwarten ist. Die<br />
Messanordnung entspricht der EN 50162<br />
Bild 4: Anodische Streustrombeeinflussung einer Rohrleitung<br />
mit einer asymmetrischen Verteilung der Fehlstellen, wie sie im<br />
Normalfall zu erwarten ist. Der Einfluss des Elektrodenstandorts<br />
auf die gemessene Streustrombeeinflussung ΔU m<br />
10 | 2013 75
FACHBERICHT KORROSIONSSCHUTZ<br />
a)<br />
b)<br />
Bild 5: Auswirkung des kritischen Beeinflussungsradius einer kathodisch geschützten Rohrleitung (blau):<br />
a) wenn die Fremdstruktur (grau) außerhalb des Radius liegt, ist nicht von einer kritischen Beeinflussung auszugehen;<br />
b) wenn die Fremdstruktur innerhalb des Radius liegt, muss mit einer kritischen Streustrombeeinflussung gerechnet werden<br />
nen Elektrodenstandorte a bis d dargestellt. Aus dieser<br />
Darstellung wird deutlich, dass beim Standort a eine<br />
kathodische, beim Standort b keine, beim Standort c<br />
eine anodische und beim Standort d eine stark anodische<br />
Beeinflussung ΔU m<br />
gemessen wird. Dies ist hauptsächlich<br />
eine Folge der Bezugselektrodenpositionierung im Spannungstrichter<br />
der Gleise und nur teilweise ein Effekt der<br />
effektiven Beeinflussung des Rohrs. Angesichts dieser<br />
Argumentation wird deutlich, dass durch entsprechende<br />
Positionierung der Bezugselektrode jedes beliebige<br />
Ergebnis erhalten werden kann. In Bild 4 entspricht das<br />
gemessene ΔU m<br />
aber in keinem Fall der effektiv auftretenden<br />
Beeinflussung ΔU a<br />
der Fehlstelle. Das Problem<br />
besteht auch darin, dass beim Standort d selbst dann<br />
eine starke anodische Beeinflussung gemessen würde,<br />
wenn gar keine Fehlstelle im Spannungstrichter der Gleise<br />
vorhanden wäre.<br />
Diese kurze Diskussion der messtechnischen Probleme<br />
beim Erfassen der Streustrombeeinflussung macht deutlich,<br />
dass die effektive Beeinflussung der Rohrleitung nur<br />
bei umfassender Kenntnis der vorliegenden Situation<br />
(z. B. Art und Verteilung der Fehlstellen am Rohr) möglich<br />
ist. Da im Normalfall der Elektrodenstandort im überbauten<br />
Gebiet nicht frei gewählt werden kann, muss daher<br />
befürchtet werden, dass die effektive Beeinflussung in<br />
vielen Fällen falsch eingeschätzt wird.<br />
MÖGLICHKEITEN ZUR VERBESSERUNG DER<br />
BEEINFLUSSUNGSMESSUNG<br />
Da also die direkte messtechnische Erfassung der Beeinflussung<br />
nicht möglich ist, kann nur durch Berechnung<br />
der elektrischen Feldverteilung, unter Berücksichtigung<br />
der exakten Elektrodenpositionen, eine verbesserte Beurteilung<br />
der Streustromgefährdung vorgenommen werden.<br />
Diese Methodik ermöglich die Berechnung des kritischen<br />
Beeinflussungsradius [3, 4]. Dessen Bedeutung wird für<br />
den Fall einer Streustrombeeinflussung durch eine kathodisch<br />
geschützte Leitung in Bild 5a und b erläutert.<br />
Grundsätzlich führt jede Fehlstelle in der kathodisch<br />
geschützten Rohrleitung zu einem Schutzstromzutritt<br />
und somit zu einem Spannungsfall im Boden. Sobald<br />
eine längsleitfähige Rohrleitung in den Nahbereich der<br />
kathodisch geschützten Leitung gelangt, ist es möglich,<br />
dass diese durch den Schutzstrom korrosiv angegriffen<br />
wird. Im Fall einer kleinen Fehlstelle in der kathodisch<br />
geschützten Rohrleitung, kann dieser Radius vergleichsweise<br />
klein sein. Wenn die Drittstruktur außerhalb dieses<br />
Radius liegt (Bild 5a) muss nicht mit einer kritischen Beeinflussung<br />
gerechnet werden. Wenn im Falle eines großen<br />
Radius (Bild 5b), wie er beispielsweise bei einer großen<br />
Fehlstelle in der Umhüllung der kathodisch geschützten<br />
Leitung auftreten kann, die Drittstruktur innerhalb<br />
des Radius liegt, muss in der Folge mit einem erhöhten<br />
Korrosionsabtrag an der betroffenen Leitung gerechnet<br />
werden, da die maximal zulässige anodische Beeinflussung<br />
überschritten wird.<br />
Die Berechnung des kritischen Radius ist grundsätzlich<br />
sehr aufwändig, da einerseits die Lage der kathodisch<br />
geschützten Leitung und andererseits die Lage der<br />
Bezugselektrode relativ zur Rohrleitung exakt bekannt<br />
sein müssen. Zudem muss die Lage von Drittstrukturen<br />
relativ zur kathodisch geschützten Rohrleitung bekannt<br />
sein. Diese Informationen sind typischerweise im GIS<br />
hinterlegt. Es ist folglich naheliegend, die Messdaten<br />
der Intensivmessung zusammen mit den zugehörigen<br />
geometrischen Informationen über die Positionen der<br />
Bezugselektroden direkt in das GIS einzubringen und<br />
die entsprechende Berechnung, sowie die Beurteilung<br />
der Korrosionsgefährdung automatisch vornehmen zu<br />
lassen [3, 4].<br />
76 10 | 2013
FACHBERICHT KORROSIONSSCHUTZ<br />
SCHUTZMASSNAHMEN GEGEN<br />
STREUSTROMBEEINFLUSSUNG<br />
Die Streustrombeeinflussung an bestehenden Anlagen<br />
kann gemäß [1] durch eine gerichtete Drainage oder einen<br />
kathodischen Schutz erfolgen. Aus der obigen Diskussion<br />
wird aber deutlich, dass diese Schutzmaßnahmen die<br />
Korrosionsgefährdung für weitere Strukturen erhöhen<br />
können. In der EN 50122-2 [5] wird festgehalten, dass<br />
beim Einsatz einer Drainage nachgewiesen werden muss,<br />
dass diese keine negativen Auswirkungen auf weitere<br />
Strukturen hat. Konkret kann der Fall auftreten, dass<br />
durch diese Schutzmaßnahmen die Beeinflussung weiter<br />
verschleppt wird. Der messtechnische Aufwand wird<br />
daher noch zusätzlich erhöht.<br />
Auf Seite des Beeinflussers stehen die Erhöhung der<br />
Schienen- oder Rohrisolation sowie die Verringerung<br />
des Schienenpotentials respektive die Verschiebung des<br />
Einschaltpotentials in positive Richtung im Vordergrund.<br />
Bei bestehenden Anlagen gibt es diesbezüglich aber nur<br />
begrenzt Möglichkeiten zur Verbesserung und mit dem<br />
Alter der Anlagen und steigender Fahrzeugzahl und Leistung<br />
wird die Beeinflussung im Verlaufe der Zeit sogar<br />
eher zunehmen.<br />
Für den Betreiber von nicht kathodisch geschützten<br />
Wasser-, Abwasser- und Gasverteilnetzen besteht somit<br />
nur die Möglichkeit bereits beim Bau der Anlagen auf<br />
einen maximalen Streustromschutz zu achten. Aus Bild 5<br />
geht hervor, dass der Abstand zwischen beeinflussender<br />
und beeinflusster Struktur relevant ist. Da der Gefährdungsradius<br />
abhängig von den Betriebsbedingungen, der<br />
Isolationsqualität und dem Bodenwiderstand zwischen<br />
einigen Zentimetern bis über 10 m betragen kann, ist es<br />
nicht möglich, einen allgemeingültigen Minimalabstand<br />
zu definieren. Insbesondere ist zu befürchten, dass sich<br />
im Laufe der Zeit die äußeren Bedingungen ungünstig<br />
verändern und der Radius zunehmen kann. Angesichts<br />
der hohen Dichte an urbaner Infrastruktur ist es bereits<br />
unrealistisch, einen Minimalabstand im Bereich von 1 m<br />
zu fordern, da dieser bei der Ausführung gar nicht eingehalten<br />
werden kann.<br />
Somit stellt sich die Frage nach Schutzmöglichkeiten<br />
gegen Streustromkorrosion. Aus den Ausführungen geht<br />
klar hervor, dass der vom Rohr abgegriffene Spannungsfall<br />
derart begrenzt werden muss, dass die Vorgaben<br />
gemäß Gleichung (1) eingehalten werden können. Dies<br />
ist einerseits möglich, indem die Rohrleitung durch ein<br />
isolierendes Mantelrohr vom Streustromgradienten abgeschirmt<br />
wird (Bild 6a). Dieses muss so lang sein, dass der<br />
verbleibende Spannungsfall ausreichend klein ist. Die<br />
Alternative ist die Unterbrechung der Längsleitfähigkeit<br />
gemäß Bild 6b. Dabei müssen die einzelnen Rohrstücke<br />
so kurz gehalten werden, dass der abgegriffene Spannungsfall<br />
so klein wird, dass wiederum die Vorgaben der<br />
EN 50162 eingehalten werden.<br />
Aus betrieblicher Sicht ist die einfachste Vorgehensweise<br />
die Verwendung von Gussrohren mit elektrisch isolierenden<br />
Muffenverbindungen. Dadurch wird eine Begrenzung<br />
des abgegriffenen Spannungsfalls gemäß Bild 6b möglich.<br />
Wenn die Leitung zusätzlich mit einer mechanisch<br />
stabilen isolierenden Außenbeschichtung versehen wird,<br />
kann der Streustromeintritt in die Rohrleitung zusätzlich<br />
erschwert werden.<br />
MESSUNGEN DER ISOLATIONSWIRKUNG VON<br />
VERSCHIEDENEN MUFFENVERBINDUNGEN<br />
(GUSSROHRE GEMÄSS EN 545)<br />
Aufgrund dieser Überlegungen wurde die elektrische<br />
Längsleitfähigkeit von Muffenverbindungen mit Schubsicherung<br />
an verschiedenen Rohrsystemen messtechnisch<br />
erfasst. Dabei wurden nicht nur die leeren Rohre ohne<br />
Druckbeaufschlagung untersucht, sondern es wurden<br />
auch der Einfluss von mechanischen Kräften auf die Isolationselemente<br />
sowie die Auswirkung von möglicher<br />
Wasseraufnahme mit einbezogen. Hierzu wurden ver-<br />
a) b)<br />
Bild 6: Schutzmassnahmen gegen Streustromkorrosion durch Begrenzung des auftretenden Spannungsfalls:<br />
a) isolierendes Mantelrohr; b) Unterbrechung der Längsleitfähigkeit<br />
10 | 2013 77
FACHBERICHT KORROSIONSSCHUTZ<br />
SCHLUSSFOLGERUNG<br />
Die Diskussion der Streustrombeeinflussung<br />
von Rohrleitungen zeigt deutlich,<br />
dass die messtechnische Erfassung der<br />
Beeinflussung nicht ohne weiteres möglich<br />
ist. Die Problematik besteht darin,<br />
dass die relevanten Spannungsgradienten<br />
von der Position der Bezugselektrode<br />
sowie der Lage der verschiedenen<br />
Fehlstellen abhängig sind.<br />
Angesichts einer in Zukunft steigenden<br />
Beeinflussung stellt sich bei der Erneuerung<br />
und beim Neubau von Wasser- und<br />
Abwasserleitungen die Frage nach optimalen<br />
Schutzstrategien. Aufgrund der<br />
diskutierten Effekte stellt die Unterbre-<br />
Außenkorrosionsschutz<br />
Innenkorrosionsschutz<br />
Schubsicherung<br />
System A Passiv (Polyurethan) Polyurethan Typ A: außenliegend<br />
reibschlüssig<br />
System B Passiv (Polyurethan) Polyurethan Typ B: innenliegend<br />
reibschlüssig<br />
System C Aktiv (Zink/Bitumen) Polyurethan Typ C: innenliegend<br />
reibschlüssig<br />
System D Passiv Zement Typ D<br />
System E Aktiv Zement Typ E<br />
System F Aktiv Zement Typ F<br />
System G Aktiv Zement Typ G<br />
Tabelle 1: Zusammenstellung der geprüften Systeme (Gussrohre DN 150)<br />
schiedene Rohre und Muffenverbindungen im Anlieferungszustand<br />
ohne spezielle Vorbehandlung gemäß den<br />
Anleitungen der Hersteller installiert. Eine Beschreibung<br />
der geprüften Systeme ist in Tabelle 1 aufgeführt.<br />
Die Messungen des Widerstands über den Muffenverbindungen<br />
wurden im Leerzustand, am wassergefüllten<br />
drucklosen System und auf den Druckstufen 5, 10 und<br />
15 bar durchgeführt. Nach anschließender Auslagerung<br />
von drei Monaten unter Druck, wurden die Widerstände<br />
nochmals gemessen. Die Beurteilung der elektrischen<br />
Trennung erfolgte durch Messen des Wechselstromwiderstands<br />
und der Spannungsdifferenz über der Muffenverbindung.<br />
Die Ergebnisse der Wechselstromwiderstandsmessungen<br />
sind in Bild 7 zusammenfassend dargestellt.<br />
Vor der Befüllung mit Wasser zeigten die Systeme A und<br />
B sehr hohe Widerstandswerte (> 300 kΩ). Die Muffenverbindungen<br />
der Systeme C, D und E zeigten mittlere<br />
Werte zwischen 20 Ω und 120 Ω. Die Verbindungen der<br />
Leitungen F und G waren mit Werten unter 2 Ω bereits<br />
Bild 7: Resultate der Wechselstromwiderstandsmessungen<br />
nach der Installation als elektrisch verbunden<br />
zu betrachten. Mit der Wasserbefüllung, einer<br />
ersten Druckbelastung sowie dem Ansprechen<br />
der Schubsicherungen verschlechtern sich die<br />
Widerstandswerte sämtlicher Verbindungen. Bei<br />
den Verbindungen der Leitungen E, F und G ließ<br />
sich aufgrund der Widerstandswerte von weniger<br />
als 1 Ω auf eine direkte metallische Verbindung<br />
schließen. Diese Schlussfolgerung wird durch<br />
die geringen Spannungsdifferenzen von weniger<br />
als 0,1 mV zwischen den Rohren bestätigt.<br />
Die Verbindung der Leitung B fiel unter 100 Ω<br />
und lag somit im Bereich der beinahe unveränderten<br />
Werte der Verbindungen C und D. Einzig<br />
die Verbindung des Systems A zeigte mit über<br />
15 kΩ noch deutlich höhere Widerstandswerte.<br />
Unter steigendem Druck veränderten sich die<br />
Widerstandswerte nur geringfügig. Einzig das System<br />
A wurde beim Erreichen des Maximaldrucks nochmals<br />
niederohmiger. Der Widerstandswert von über 1 kΩ entspricht<br />
immer noch dem höchsten gemessenen Wert.<br />
Die Messungen zeigten primär, dass die elektrische<br />
Trennwirkung der verschiedenen Verbindungen nicht<br />
von der Befüllung und Druckbeaufschlagung abhängig<br />
war. Grundsätzlich wurden aber die Widerstandwerte<br />
mit steigendem Druck kleiner. In drei Fällen wurde festgestellt,<br />
dass es zu einer metallisch leitenden Verbindung<br />
über die Muffe gekommen ist.<br />
Bei den elektrisch trennenden Systemen A, B, C und D<br />
ist eine deutliche Verringerung der Korrosionsgefährdung<br />
aufgrund der verringerten Längsleitfähigkeit entsprechend<br />
dem Mechanismus in Bild 6b zu erwarten.<br />
Durch eine hochwertige isolierende Beschichtung auf<br />
der Außenseite kann die Streustromaufnahme zusätzlich<br />
verringert werden, während eine hochwertige Innenbeschichtung<br />
den Übertritt des Stroms ins Wasser weitgehend<br />
unterbindet. Dies führt zu einem nachhaltigen Korrosionsschutz<br />
im Fall von heterogener<br />
Bettung, Streustromeinwirkung und galvanischer<br />
Korrosion mit Fremdkathoden.<br />
78 10 | 2013
FACHBERICHT KORROSIONSSCHUTZ<br />
www.<strong>3R</strong>-Rohre.de<br />
Jetzt bestellen!<br />
chung der Längsleitfähigkeit eine wirksame Schutzmaßnahme<br />
dar. Durch eine zusätzliche hochwertige Innenund<br />
Außenbeschichtung, wie im Falle der Systeme A,<br />
B, C und D gegeben ist, kann die Streustromaufnahme<br />
und dessen Ausbreitung entlang des Rohrleitungssystems<br />
zusätzlich vermindert werden.<br />
7. DANK<br />
Diese Arbeit war möglich dank der Unterstützung der<br />
vonRoll hydro (suisse) ag.<br />
LITERATUR<br />
[1] W. v. Baeckmann, W. Schwenk, W. Prinz, „Handbuch des<br />
kathodischen Korrosionsschutzes Theorie und Praxis der<br />
elektrochemischen Schutzverfahren“. (VCH, 1988).<br />
[2] DIN EN 50162, „Schutz gegen Korrosion durch Streuströme<br />
aus Gleichstromanlagen;“ (2005)<br />
[3] M. Büchler, M. Meile, D. Joos, “GIS integrated analysis of a<br />
gas distribution network”, CEOCOR International Congress<br />
2012 (2012).<br />
[4] M. Büchler, D. Joos, M. Meile, „Methoden für die<br />
Erneuerungsplanung“, Aqua & Gas 91, 14 (2012).<br />
[5] EN 50122-2, „Bahnanwendungen - Ortsfeste Anlagen -<br />
Elektrische Sicherheit, Erdung und Rückleitung - Teil 2:<br />
Schutzmaßnahmen gegen Streustromwirkungen durch<br />
Gleichstrom-Zugförderungssysteme“ (2010)<br />
Sichere und effiziente<br />
Rohrleitungssysteme<br />
Nutzen Sie das Know-how der führenden Fachzeitschrift<br />
für die Entwicklung, den Einsatz und Betrieb von Rohrleitungen,<br />
Komponenten und Verfahren im Bereich der<br />
Gas- und Wasserversorgung, der Abwasserentsorgung,<br />
der Nah- und Fernwärmeversorgung, des Anlagenbaus<br />
und der Pipelinetechnik.<br />
Wählen Sie einfach das Bezugsangebot, das Ihnen zusagt:<br />
als Heft, ePaper oder Heft + ePaper!<br />
AUTOREN<br />
Dr. MARKUS BÜCHLER<br />
SGK Schweizerische Gesellschaft für<br />
Korrosionsschutz, Zürich<br />
Tel. + 41 44 213 1590<br />
E-Mail: markus.buechler@sgk.ch<br />
DAVID JOOS<br />
SGK Schweizerische Gesellschaft für<br />
Korrosionsschutz, Zürich<br />
Tel. + 41 44 213 1592<br />
E-Mail: david.joos@sgk.ch<br />
CARL-HEINZ VOÛTE<br />
SGK Schweizerische Gesellschaft für<br />
Korrosionsschutz, Zürich<br />
Tel. + 41 44 213 1596<br />
carl-heinz.voute@sgk.ch<br />
<strong>3R</strong> erscheint in der Vulkan-Verlag GmbH, Huyssenallee 52-56, 45128 Essen<br />
10 | 2013 79
FACHBERICHT KORROSIONSSCHUTZ<br />
Anwendungsbeispiele für die Prüfung<br />
von Rohrleitungen mit Guided Waves<br />
In vielen Industrien wie z. B. in der in chemischen und petrochemischen Industrie oder in Kraftwerken sind wiederkehrende<br />
Prüfungen an Rohrleitungen eine notwendige Maßnahme, um den sicheren und zuverlässigen Betrieb sowie den<br />
reibungslosen Ablauf von Prozessen zu gewährleisten. Mit dem Guided Wave-Prüfverfahren steht dem Anwender eine<br />
qualifizierte zerstörungsfreie Prüfmethode zur Verfügung, die als Screeningverfahren andere in der Industrie bereits<br />
verwendete Verfahren optimal ergänzen kann.<br />
EINFÜHRUNG<br />
Korrosion in Rohrleitungen ist ein massives Problem sowohl<br />
in der petro-chemischen als auch in anderen verwandten<br />
Industrien. Herkömmliche Prüfmethoden zur Messung der<br />
Wanddicke in Rohrleitungen (z. B. die Prüfung mit konventionellem<br />
Ultraschall) liefern Messwerte, die lokal auf den<br />
abgetasteten Bereich begrenzt sind. Obwohl das Verfahren<br />
quantitativ ist, können diese Ergebnisse keine Aussage<br />
über direkt angrenzende Bereiche machen. Messungen<br />
werden häufig punktuell an solchen Stellen einer Rohrleitung<br />
durchgeführt, wo erfahrungsgemäß eine erhöhte<br />
Wahrscheinlichkeit für eine Wanddickenminderung (beispielsweise<br />
in Bögen) besteht. Dies ist aber nicht immer<br />
der Fall, denn lokale Prüfmethoden haben aufgrund ihrer<br />
nicht ausreichenden Abtastung der Rohrleitung eine sehr<br />
niedrige Fehlerauffindwahrscheinlichkeit. Zwar kann man<br />
diese verbessern, indem man die Anzahl der Messstellen<br />
erhöht, allerdings steigt dadurch auch der Aufwand an Zeit<br />
Bild 1 a) Wanddicken- sowie Steifigkeitsänderungen in der Rohrleitung<br />
reflektiert den vom Prüfring in beide Richtungen entlang des Rohres<br />
ausgesendeten Ultraschallimpuls. Diese Reflexionen werden vom Prüfring<br />
aufgenommen. b) Die Daten werden von einer speziellen Software<br />
ausgewertet und in einem A-Bild dargestellt<br />
und Kosten. Das fällt umso mehr ins Gewicht, wenn Rohrleitungen<br />
nur schwer zugänglich oder isoliert sind. Gerade<br />
bei isolierten Leitungen ist aber nicht vorherzusagen, an<br />
welchen Stellen bevorzugt Korrosion auftreten wird, so<br />
dass man die Isolierung ganz abnehmen müsste, um die<br />
Rohrleitung vollständig zu inspizieren. In anderen Fällen<br />
ist die Leitung gar nicht vollständig zu erreichen, z. B. in<br />
Manteldurchführungen unter Straßen oder Bundwällen in<br />
Tanklagern, so dass dort gar keine lokale Prüfung durchgeführt<br />
werden kann. Eine sinnvolle Risikobewertung muss<br />
aber auch die Stellen einer Rohrleitung einbeziehen, die<br />
nicht mit herkömmlichen Prüfmethoden erfasst werden<br />
können.<br />
Mit Guided Wave (GW), einer Prüfung mittels geführter<br />
Ultraschallwellen, hat sich inzwischen eine weitere qualifizierte<br />
Prüfmethode in die Reihe der etablierten Prüfverfahren<br />
eingereiht. Ursprünglich für die Inspektion von<br />
isolierten Rohrleitungen entwickelt, besteht das Ziel der<br />
Prüfung in der Regel in der effektiven Durchführung von<br />
Prüfaufgaben, die wie oben beschrieben, nicht zufriedenstellend<br />
oder nur mit einem erheblichen Mehraufwand zu<br />
bewältigen sind.<br />
Mit GW bezeichnet man allgemein solche Wellen, die von<br />
den Grenzflächen eines Körpers geführt werden. In der<br />
standardmäßigen GW-Prüfung von Rohrleitungen benutzt<br />
man relativ niederfrequente Ultraschallwellen von etwa<br />
20-120 kHz, die sich in der Rohrwand entlang des Rohres<br />
ausbreiten. Dazu leitet ein Prüfring, mit einer Anordnung<br />
von Ultraschallwandlern, eine GW in die Rohrleitung. Diese<br />
GW wird von Diskontinuitäten, wie Schweißnähten oder<br />
Korrosion, reflektiert und vom Prüfring im Impuls-Echo-<br />
Verfahren wieder aufgenommen (siehe Bild 1). Im Unterschied<br />
zur konventionellen Ultraschallprüfung wird nicht<br />
der Bereich unterhalb des Ultraschallwandlers geprüft,<br />
sondern die gesamte Rohrleitung innerhalb der während<br />
der Prüfung zu bestimmenden Reichweite der GW. In für<br />
die GW-Prüfung besonders zuträglichen Anwendungen<br />
kann man im laufenden Betrieb von einer einzigen, dem<br />
Prüfer zugänglichen Position nicht selten mehr als 25 m<br />
Rohrleitung in jeweils beide Richtungen vom Prüfring gesehen<br />
abdecken.<br />
Hier kommt auch der Gedanke zum Tragen, der für eine<br />
GW-Prüfung in Verbindung mit einem zusätzlichen Verfah-<br />
80 10 | 2013
KORROSIONSSCHUTZ FACHBERICHT<br />
ren in vielen Anwendungen sinnvoll ist. Für eine hohe Vertrauenswürdigkeit<br />
muss eine Prüfung zwei Eigenschaften<br />
aufweisen: 1. eine hohe Fehlerauffindwahrscheinlichkeit<br />
in einem angemessenen Zeit- und Kostenrahmen; 2. die<br />
Möglichkeit zur genauen Klassifizierung der Fehlstellen in<br />
Schweregradkategorien. Kein derzeit verfügbares Verfahren<br />
zur Prüfung von Rohrleitungen über längere Strecken<br />
kann beide Anforderungen ideal erfüllen. Aber zwei oder<br />
mehrere Prüfverfahren zusammen können dies sehr wohl.<br />
Daraus leitet sich eine Prüfphilosophie ab, in der man<br />
zunächst eine Suchmethode wie GW anwendet. Wird eine<br />
Anzeige gefunden, die auf Korrosion an einer bestimmten<br />
Stelle hinweist, wird die Prüfung mit einem Verfahren<br />
zum genauen Ausmessen – d. h. zur Klassifizierung – der<br />
Fehlstelle ergänzt. Für die Klassifizierung kommen je nach<br />
Anwendung mehrere Verfahren in Frage, beispielsweise<br />
die lokale Wanddickenprüfung mittels höherfrequentem<br />
Ultraschall oder die visuelle Prüfung.<br />
GW wird nunmehr weltweit als Suchmethode zum Auffinden<br />
lokaler Korrosion eingesetzt, obwohl es sich um<br />
eine noch recht neue Technologie handelt. Die Akzeptanz<br />
dieser Prüfmethode in der Industrie lässt sich aber an mehreren<br />
bereits veröffentlichten sowie in der Vorbereitung<br />
befindlichen internationalen Standards sehen (z. B. [1], [2]).<br />
Die hier vorgestellten praktischen Anwendungsbeispiele<br />
sollen einen kurzen Überblick über die Möglichkeiten und<br />
Grenzen der GW-Prüfung geben und verdeutlichen, wie<br />
man GW als qualitative Suchmethode einsetzen kann,<br />
um den Prüfaufwand zu verringern und die Auffindwahrscheinlichkeit<br />
für Fehlstellen zu erhöhen.<br />
HINTERGRUND ZUR GUIDED WAVE-PRÜFUNG<br />
Die GW-Prüfung von Rohrleitungen wird fast ausschließlich<br />
mit Torsionswellen durchgeführt [3]. Vom Prüfring angeregt<br />
breiten sich diese in beide Richtungen entlang des Rohres aus.<br />
Aufgrund der Tatsache, dass sich die Torsionsmode über den<br />
ganzen Querschnitt der Rohrwand gleichmäßig verteilt, werden<br />
innerhalb der Reichweite der GW 100 % der Rohrwand<br />
geprüft. Sowohl interne als auch externe Fehlstellen werden<br />
daher gleichermaßen erfasst. Die Reflexionsamplitude der<br />
Torsionsmode hängt von der Form und Abmessungen des<br />
reflektierenden Merkmals ab und wird daher zur Klassifizierung<br />
von Fehlstellen herangezogen. Traditionell wird aus der<br />
Amplitude ein Querschnittsverlust errechnet.<br />
Anders als beim Körperschall, in dem es lediglich zwei Ausbreitungsmoden<br />
gibt (Transversal- und Kompressionsmode),<br />
existieren in Rohrleitungen aufgrund der Grenzflächen viele<br />
verschiedene Ausbreitungsmoden. Wird die Torsionsmode<br />
nun von einer Änderung im Rohrquerschnitt reflektiert,<br />
kommt es daher, wenn es sich um eine nicht-axisymmetrische<br />
Änderung handelt, nicht nur zur Reflektion, sondern zugleich<br />
zur Modenkonversion in sogenannte Biegemoden. Diese<br />
Tatsache macht man sich zunutze, denn man kann mit ihrer<br />
Hilfe ein C-Bild errechnen, das die Umfangsposition eines<br />
Rohrmerkmales zeigt.<br />
Bild 3 zeigt ein typisches Messergebnis. Die schwarze Messkurve<br />
im A-Bild entspricht der Torsionsmode, während die<br />
Bild 2: Typische Prüfanordung mit Prüfringen und Wavemaker-Gerät<br />
von Guided Ultrasonics Ltd. Es gibt verschiedene Prüfringvarianten für<br />
Durchmesser von DN 25-1500<br />
Bild 3: A-Bild mit schematischer Darstellung der Rohrmerkmale<br />
(unten) und C-Bild (oben) einer GW-Prüfung. Zu sehen ist das typische<br />
Erscheinungsbild einer Korrosionsstelle bei etwa -10 m. Zu beachten<br />
ist auch die unregelmäßige Form der Schweißnaht bei etwa +8m, die<br />
auf eine Fehlstelle in der Schweißnaht oder direkt dahinter hindeutet.<br />
Beidseitig des Prüfrings ergibt sich eine Totzone (grün) sowie ein<br />
Nahfeld (grau)<br />
rote Messkurve die einer Biegemode entspricht. Bei etwa -4 m<br />
befindet sich z. B. eine Schweißnaht. Da diese weitgehend axisymmetrisch<br />
ist, findet keine Modenkonversion in Biegemoden<br />
statt. Dies zeigt sich an der im Verhältnis zur Torsionsmode<br />
kleinen Amplitude. Außerdem erscheint die Schweißnaht im<br />
C-Bild gleichmäßig um den Umfang verteilt.<br />
Es ist wichtig zu beachten, dass es sich bei der GW-Methode<br />
um eine Volumenmethode handelt und demnach nur<br />
qualitative Aussagen liefert, d. h. dass es nicht möglich ist,<br />
nach dem Auffinden einer Fehlstelle eine genaue Aussage<br />
über die Restwanddicke zu machen. Obwohl man mit<br />
Hilfe der Reflexionsamplitude der Torsionsmode sowie<br />
dem C-Bild oft recht gut den Schweregrad einer Fehlstelle<br />
bestimmen kann, muss zur quantitativen Bestimmung eine<br />
lokale Prüfmethode benutzt werden.<br />
10 | 2013 81
FACHBERICHT KORROSIONSSCHUTZ<br />
Wie in der konventionellen Ultraschallprüfung werden<br />
DAC-Kurven (Distance Amplitude Correction) benutzt, um<br />
die wahre Reflexionsamplitude unabhängig von der Distanz<br />
abschätzen zu können (gestrichelte Linien in Bild 3).<br />
Innerhalb der Reichweite der GW können in der Regel<br />
Fehlstellen mit einem Querschnittsverlust von etwa 3 %<br />
gefunden werden.<br />
Für eine tiefergehende Behandlung der Möglichkeiten und<br />
Grenzen der GW-Prüfung mit einer reichen Literaturliste<br />
sei der Leser auf [4] verwiesen.<br />
Bild 4: Piperacks in Espirito Santo (Brasilien), die sonst nur<br />
lokal untersucht wurden<br />
Bild 5: Prüfung von schwer zugänglichen Leitungen in einer<br />
Flussüberquerung im Rio Grande (Brasilien)<br />
Bild 6: Pier im Nordosten Brasiliens. Innerhalb weniger Wochen<br />
wurden hier 20 km Rohrleitung überprüft<br />
3 ANWENDUNGSBEISPIELE<br />
Die folgenden Beispiele können im Rahmen dieses Fachberichts<br />
nur einen sehr kleinen Einblick in die vielfältigen<br />
Anwendungsmöglichkeiten für GW geben. Die Autoren<br />
haben für diesen Bericht drei Hauptanwendungsgebiete<br />
ausgewählt, die besonders gut den Grundgedanken der<br />
GW-Prüfung zum Tragen bringen.<br />
3.1 Rohrbrücken<br />
Rohrbrücken sind in zweierlei Hinsicht ein idealer Anwendungsbereich<br />
für GW. Erstens hat man lange Strecken,<br />
die aufgrund ihrer Installation in der Höhe und der Nähe<br />
der Rohrleitungen zueinander oft nur bedingt zugänglich<br />
sind und daher eine gründliche visuelle Prüfung sehr<br />
erschweren (siehe Bild 4, Bild 5, Bild 6). Auch konventionelle<br />
Ultraschallprüfungen können nur lokal zum<br />
Einsatz kommen. Diese Prüfung kann mit GW jedoch<br />
schnell und ohne viel Aufwand während des laufenden<br />
Betriebs durchgeführt werden. Aufgrund der normalerweise<br />
unkomplizierten Geometrie können, bei einfach<br />
gelagerten, unbeschichteten Rohren und je nach Korrosionszustand,<br />
oft zu 50 m in einer einzigen Prüfung<br />
abgedeckt werden. Unter idealen Bedingungen können<br />
so bis zu 1,5 km Rohrleitung pro Tag und pro GW-Team<br />
geprüft werden [5].<br />
Zweitens lassen sich mit der GW-Methode auch die Auflagepunkte<br />
selbst prüfen. Speziell einfache Kontaktlager<br />
lassen sich schnell in verschiedene Schadensklassen einteilen,<br />
so dass man die Komplementärprüfung einzelner<br />
Lagerpunkte priorisieren kann. Ein Beispiel für eine solche<br />
Auflagerprüfung ist in Bild 7 gegeben.<br />
Nachträglich in diesen Anwendungen wirken sich<br />
geschweißte Auflager aus, da diese die Reichweite der<br />
GW-Prüfung stark einschränken können. Die Prüfung der<br />
Rohrleitungen wird zwar nicht von flüssigen oder gasförmigen<br />
Rohrinhalten beeinflusst, wohl aber durch feste<br />
Ablagerungen im Rohr. Letzteres führt, wie Beschichtungen<br />
in unterschiedlichem Grade, zu Schalldämpfung und<br />
damit zu einer reduzierten Reichweite.<br />
3.2 Isolierte Leitungen<br />
Die Prüfung von Leitungen, bei denen vorab die Isolierung<br />
entfernt werden muss, ist mit einem erheblichen Kostenaufwand<br />
verbunden. Anstatt die Isolierung der gesamten<br />
Strecke abzunehmen, werden bei der GW-Prüfung nur<br />
einzelne Prüfpunkte von der Isolierung befreit. Sollten<br />
82 10 | 2013
KORROSIONSSCHUTZ FACHBERICHT<br />
bei der Prüfung Anzeigen gefunden werden, die auf<br />
Korrosion hinweisen, wird an diesen Stellen abisoliert<br />
und mit einer ergänzenden Prüfmethode nachgeprüft.<br />
Die Isolierung selbst hat dabei, sofern sie aus Mineralwolle<br />
oder einem akustisch ähnlichen Material besteht,<br />
auf die Reichweite der GW keinen Einfluss, so dass auch<br />
in dieser Anwendung lange Strecken von einer Position<br />
zu prüfen sind.<br />
Generell ist zu empfehlen, dass dem GW-Prüfer ein<br />
Abisolier-Team zugeteilt wird, da der Prüfer vor Ort die<br />
besten Prüfpositionen auswählen muss. Gleichzeitig<br />
können gefundene Fehlstellen dann sofort nachgeprüft<br />
werden. Es ist zu beachten, dass in bestimmten Fällen die<br />
Klammern für Begleitheizung in der Nähe der Prüfposition<br />
gelockert werden müssen, um den Prüfring anzusetzen.<br />
Eine besondere Anwendung besteht auch in der Prüfung<br />
von Fernwärmeleitungen, die nicht nur isoliert sind,<br />
sondern häufig in unzugänglichen Schächten verlaufen.<br />
3.3 Straßendurchführungen<br />
Die Situation bei Straßendurchführungen ist ähnlich der<br />
bei isolierten Leitungen. Ohne hohe Kosten und erheblichen<br />
Mehraufwand kann mit konventionellen Prüfmethoden<br />
nicht untersucht werden. Jedoch kann man mit GW<br />
abschätzen, ob der Aufwand und die Kosten notwendig<br />
sind, und ob an der gewählten Prüfposition eine weitere<br />
konventionelle Untersuchung durchgeführt werden<br />
muss. Nicht selten hat man in einer Raffinerie mehrere<br />
Hundert Rohrleitungen, die in Straßendurchführungen<br />
oder Mantelrohren wie in Bild 9 verlegt sind. Natürlich ist<br />
meist nur ein Bruchteil der Leitungen von einem Schaden<br />
betroffen. Dennoch wird oft übersehen, welchen Nutzen<br />
eine Suchmethode leisten kann, die genau diejenigen<br />
Leitungen, die keine Schäden aufweisen, aussortiert,<br />
so dass zunächst nur derjenige Bruchteil der Leitungen<br />
näher untersucht werden muss, der suspekte Anzeigen<br />
aufweist.<br />
In Bild 8 kommt dazu, dass diese oft nur mit einer Arbeitsgenehmigung<br />
für enge Räume zu betreten sind, welches<br />
bei GW zunächst entfällt. Die GW-Prüfung wird standardmäßig<br />
an beiden Eingängen der Durchführung durchgeführt,<br />
um Falschanzeigen zu verringern und die Abdeckung<br />
bei Rohren mit geschweißten Lagern zu erhöhen [6].<br />
ZUSAMMENFASSUNG<br />
GW hat sich als schnelles und präzises Prüfverfahren zum<br />
Auffinden lokaler Korrosion weltweit bewährt. Die Anwendungsgebiete<br />
sind vielfältig und reichen von den hier aufgeführten<br />
Beispielen über Risers in der Off-shore Industrie<br />
zur Überwachung der Spritzwasserzone, Bundwalldurchführungen<br />
in Tanklagern bis hin zur Prüfung von sogenannten<br />
Sphere-legs mit Feuerschutzbeschichtung.<br />
Die Reichweite, Produktivität und Anwendbarkeit der GW-<br />
Prüfung kann allerdings durch mehrere Faktoren eingeschränkt<br />
werden; dazu gehören schalldämpfende Beschichtungen<br />
wie Bitumen sowie eine hohe Dichte an Rohrmerkmalen wie<br />
Bögen, geschweißten Lagern oder Flanschen.<br />
Bild 7a: Sicht von der Prüfposition aus<br />
Bild 7b: Mit GW gefundene Fehlstelle in etwa 8 m Enfernung in<br />
positiver Prüfrichtung;<br />
Bild 7c: Das Ergebnisbild zeigt neben anderen Rohrmerkmalen die genaue<br />
Position der Fehlstelle<br />
10 | 2013 83
FACHBERICHT KORROSIONSSCHUTZ<br />
a) b)<br />
Bild 8: Lediglich 0,5 m müssen an der<br />
Prüfposition abisoliert werden<br />
Bild 9 a) Rohrleitungen in einer schwer zugänglichen Straßendurchführung, die sonst nicht<br />
geprüft, aber mit GW zu 100 % gescannt wurden, b) Rohrleitungen in Mantelrohren<br />
In allen Fällen ist zu beachten, dass es sich um ein qualitatives<br />
Prüfverfahren handelt, das durch ein quantitatives<br />
Verfahren ergänzt werden sollte. Die Kombination beider<br />
Verfahren ist wichtig, denn selten wird eine zuverlässige<br />
Inspektion mit nur einem einzigen Verfahren erreicht.<br />
Leider ist dies aber auch nicht immer unmittelbar möglich,<br />
z. B. bei der Straßendurchführung im Mantelrohr.<br />
In diesem Fall muss die GW-Prüfung allein eine relativ<br />
genaue Einschätzung über die Schwere einer vermuteten<br />
Fehlstelle abgeben. Obwohl die heutzutage zur<br />
Verfügung stehenden Werkzeuge die Interpretation der<br />
Messkurven diese Aufgabe dem Prüfer leichter machen,<br />
verlangt sie hohe Kompetenz und Erfahrung im Umgang<br />
mit GW. Neu qualifizierte Prüfer sollten daher zunächst<br />
nur solche Anwendungen angehen, wo eine direkte<br />
Nachprüfung mit einer Komplementärmethode prinzipiell<br />
möglich ist.<br />
LITERATUR<br />
[1] BS 9690-1:2011, Non-destructive Testing. Guided Wave Testing.<br />
General Guidance and Principles.<br />
[2] ASTM E2775 – 11, Standard Practice for Guided Wave Testing of<br />
Above Ground Steel Pipework Using Piezoelectric Effect Transduction.<br />
[3] D. Alleyne, T. Vogt, P. Cawley: The choice of torsional or longitudinal<br />
excitation in guided wave pipe inspection, INSIGHT, Vol. 51, pp<br />
373-377, 2009.<br />
[4] M. Lowe, P. Cawley: Long Range Guided Wave Inspection Usage<br />
– Current Commercial Capabilities and Research Directions,<br />
2009; erhältlich unter http://www3.imperial.ac.uk/pls/portallive/<br />
docs/1/55745699.PDF.<br />
[5] H. Schubert et al: A realidade pratica do ensaio por ondas guiadas no<br />
Brasil, 11a. COTEQ – Congresso sobre Tecnologia de Equipamentos<br />
– Brasil, 2011.<br />
[6] T. Vogt, D. Alleyne: Prüfung von Rohrleitung in Straßendurchführungen<br />
mit Guided Waves, DGZfP Fachtagung, 2009.<br />
AUTOREN<br />
Dipl.-Ing. HERMANN SCHUBERT<br />
GMA-Werkstoffprüfung GmbH, Düsseldorf<br />
Tel. +49 211 73094-49<br />
E-Mail: h.schubert@gma-group.com<br />
www.gma-group.com, www.mistrasgroup.com<br />
Dr. THOMAS VOGT<br />
Guided Ultrasonics Ltd.<br />
Nottingham, Großbritannien<br />
Tel. +44 20 232 9108<br />
E-Mail: thomas@guided-ultrasonics.com<br />
Richtigstellung<br />
In Ausgabe <strong>3R</strong>-9/2013 ist uns im Fachbericht von<br />
Dr. Michael Steiner und Dipl.-Ing. Albert Wißkirchen<br />
(S. 76 ff.) bedauerlicherweise ein Fehler unterlaufen.<br />
Der darin angegebene Link, der zur Langfassung<br />
dieses Fachberichts bzw. dessen pdf-Download führt,<br />
war unvollständig. Der richtige Link lautet:<br />
https://www.di-verlag.de/media/content/<strong>3R</strong>/PDF/FB_<br />
Stressdruckprufungen_Langversion.pdf.pdf<br />
Wenn Sie den nebenstehenden QR-<br />
Code mit Ihrem Smartphone einscannen,<br />
gelangen Sie direkt dorthin.<br />
84 10 | 2013
KORROSIONSSCHUTZ FACHBERICHT<br />
Save the Date<br />
8. Praxistag<br />
Korrosionsschutz<br />
am 25. Juni 2014<br />
Anmeldung / Informationen:<br />
Vulkan-Verlag GmbH, Essen<br />
Barbara Pflamm,<br />
Tel.: +49 201 82002-28<br />
E-Mail:b.pflamm@vulkan-verlag.de<br />
www.praxistag-korrosionsschutz.de<br />
<strong>Vorschau</strong>-Tipp<br />
Ausgabe 11-12/2013<br />
Erscheinungstermin: 09.12.2013<br />
PRINT PRINT<br />
Ausgabe 10/2013<br />
Erscheinungstermin: 23.10.2013<br />
Praxiserfahrungen beim passiven Korrosionsschutz<br />
Praxiserfahrungen beim passiven Korrosionsschutz<br />
In In dem Beitrag werden die die sehr sehr<br />
guten Langzeiterfahrungen mit mit<br />
3-Schichtbandsystemen der der Firma Firma<br />
Denso GmbH anhand von von Untersuchungen<br />
an an verschiedenen<br />
Gaspipelines gezeigt.<br />
Unter-<br />
gezeigt.<br />
www.<strong>3R</strong>-Rohre.de 10 | 2013 ++ www.<strong>3R</strong>-Rohre.de ++ www.<strong>3R</strong>-Rohre.de ++ www.<strong>3R</strong>-Rohre.de ++ www.<strong>3R</strong>-Rohre.de ++ www.<strong>3R</strong>-Rohre.de 85<br />
www.<strong>3R</strong>-Rohre.de ++ www.<strong>3R</strong>-Rohre.de ++ www.<strong>3R</strong>-Rohre.de ++ www.<strong>3R</strong>-Rohre.de ++ www.<strong>3R</strong>-Rohre.d
FACHBERICHT GASVERSORGUNG & PIPELINETECHNIK<br />
LDACS-Leckerkennungssystem: Mehr<br />
Sicherheit durch verteilte akustische<br />
Sensoren<br />
Die russische Firma OMEGA entwickelt und produziert multifunktionale Überwachungssysteme für räumlich ausgedehnte<br />
Prozessanlagen. Mit Hilfe von faseroptischen Sensoren zeigen diese Systeme im Online-Modus Leckagen von Öl und anderen<br />
Flüssigkeiten, sowie von Gasen und mehrphasigen Medien auf. Darüber hinaus decken diese Systeme auch den erweiterten<br />
Objektschutz ab. Das Leak Detection and Activity Control System (LDACS) ermöglicht eine präzise Ortung von Vibrationen<br />
mittels Auswertung sowie von räumlichen Versetzungen und charakteristischen Temperaturveränderungen entlang von<br />
langgestreckten Prozessanlagen wie Pipelines, Ölquellen, Eisenbahntrassen, Autobahnen und Stromleitungen. Die Firma<br />
OMEGA, die bereits mehr als 5.028 km Transneft-Pipeline (Bild 1) mit ihrem LDACS-System ausgestattet hat, optimiert<br />
stetig die Technologie der Glasfaserkabelüberwachung. Die ersten Anfänge dieser vielversprechenden Technologien<br />
liegen beinahe schon 40 Jahre zurück, jedoch gibt es immer noch ein großes Potential an Verbesserungsmöglichkeiten.<br />
LECKERKENNUNGSSYSTEM: WEITERE ÜBERLE-<br />
GUNGEN NOTWENDIG<br />
Eine vor kurzem veröffentliche Studie der Sicherheitsbehörde<br />
Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration<br />
des US-Verkehrsministeriums verweist auf eine Reihe von<br />
Störfällen in der Vergangenheit und kommt zu dem Schluss,<br />
dass weltweit nur ein kleiner Prozentsatz aller Lecks durch<br />
bestehende Leckerkennungssysteme entdeckt und bestätigt<br />
wird [1].<br />
Mit Verweis auf zahlreiche technische Berichte vertreten<br />
die Verfasser der Studie die Ansicht, dass „im Umgang mit<br />
Leck-Alarms viel mehr zusätzliche Überlegungen notwendig<br />
sind und dass die Lösung mehrfach redundante, voneinander<br />
unabhängige Leckerkennungssysteme sowie gezielte<br />
Schulungen des Überwachungspersonals zum besseren<br />
Verständnis der physikalischen Prinzipien, die den Alarmen<br />
zu Grunde liegen, sein könnten.“<br />
Diesen Punkt haben auch die Forschungs- und Entwicklungsabteilungen<br />
der Firma OMEGA erkannt, die<br />
versucht, die Wahrscheinlichkeit von Leck-Fehlalarmen,<br />
wie es sie bei entsprechenden mit LDS ausgestatteten<br />
Pipelines noch immer gibt, zu verringern. Das aktuell<br />
zum Einsatz kommende Unternehmens-Konzept umfasst<br />
zwei verteilte Sensoreinheiten, die jeweils für die Leckerkennung<br />
und für den Objektschutz konzipiert sind der<br />
verteilte Temperatursensor DTS (Distributed Temperature<br />
Sensor) und der verteilte Vibrationssensor DVS (Distributed<br />
Vibration Sensor).<br />
Bild 1: Schematische Darstellung von Transneft-Pipelines in Russland<br />
86 10 | 2013
GASVERSORGUNG & PIPELINETECHNIK FACHBERICHT<br />
Neben den traditionellen internen Leckerkennungsmethoden,<br />
bei denen der Volumenvergleich sowie die Druckund<br />
Durchflussänderungen des transportierten Mediums<br />
analysiert werden, gibt es vier etablierte Technologien<br />
zur Leckerkennung mit jeweils sehr unterschiedlichen<br />
methodischen Ansätzen: die faseroptische Sensorik, das<br />
modellbasierte Verfahren (Real-Time Transient Model,<br />
RTTM), die statistische Messwertanalyse (SA) und das<br />
Negative-Druckwellen-Verfahren (NPWA).<br />
Beim RTTM handelt es sich um ein hydraulisches Modell,<br />
das sich auf Randbedingungen stützt, die von Feldmessgeräten<br />
aus mehreren örtlich verteilten Anlagenteilen,<br />
wie z. B. Einspeisepunkte, Pump- und Kompressorstationen,<br />
übermittelt werden, während die SA verschiedene<br />
Pipeline-Prozesssignale analysiert, von denen Durchfluss,<br />
Druck und Temperatur die wichtigsten sind. Das NPWA<br />
beschäftigt sich mit der Ausprägung und Intensität des<br />
von Lecks erzeugten Druckabfalls, während die glasfaserbasierte<br />
Methode die Fähigkeit von Glasfaserkabeln ausnützt,<br />
Abweichungen im akustischen Feld und im Temperaturbereich<br />
entlang der Pipeline-Trasse zu registrieren.<br />
DAS DILEMMA DER GLASFASER-BASIERTEN<br />
LECKERKENNUNGSSYSTEME<br />
Die allgemeine, von der US-Studie bestätigte Wahrnehmung<br />
ist, dass keine der existierenden Methoden<br />
perfekt ist. „Jede der oben erwähnten Methoden<br />
hat Vor- und Nachteile; so sind z. B. die meisten der<br />
externen Leckerkennungsmethoden in der Lage, kleine<br />
Leckagen zu erkennen und deren Position genau zu<br />
bestimmen. Es kann aber sein, dass das nachträgliche<br />
Anbringen von Kabeln oder Röhren an Pipelines nicht<br />
möglich ist. Sensoren und Kameras können nur Lecks<br />
innerhalb ihrer Abtast- oder Sichtweite erkennen“, konstatierte<br />
Jun Zhang von ATMOS International auf der<br />
2013 PSIG-Konferenz in Prag [2]. „Deshalb werden die<br />
meisten externen Leckerkennungsmethoden eher für die<br />
sporadischen Routinekontrollen der Pipelines als für die<br />
kontinuierliche Überwachung verwendet. Dadurch kann<br />
es passieren, dass ein Leck bis zur nächsten Kontrolle<br />
unentdeckt bleibt.“<br />
Dieser letzte Punkt hat eine lebhafte Diskussion nach<br />
sich gezogen und eine neue Richtung für die Forschung<br />
der Firma OMEGA eröffnet, die die Präzision bei der<br />
Leckerkennung verbessern und die Anzahl der unbegründeten<br />
Leckalarme minimieren möchte. Um dieses Ziel zu<br />
erreichen, haben die Forscher die grundlegenden Vorteile<br />
der DTS- und DVS-Methoden kombiniert und damit das<br />
Leckerkennungssystem LDACS erschaffen. Die Idee war<br />
recht einfach: Ein vom Temperatursensor erzeugtes Signal<br />
eines Lecks wird durch das Signal, das Änderungen<br />
im akustischen Feld an der entsprechenden Stelle der<br />
Pipeline anzeigt, bestätigt. So wird die Verlässlichkeit des<br />
gesamten Systems grundlegend verbessert.<br />
Es ist hervorzuheben, dass OMEGA-Systeme bis jetzt hauptsächlich<br />
für Öl- und teilweise für Wasserpipelines eingesetzt<br />
werden, während in Fachkreisen die Meinung vorherrscht,<br />
Bild 2: Das neue LDACS DAS-DTS-Modul<br />
Bild 3: Eine der DAS-Möglichkeiten ist die gleichzeitige<br />
Überwachung der Position von bis zu fünf Pipeline-Molchen<br />
dass glasfaser-basierte Leckerkennungssysteme sich eher für<br />
Gaspipelines eignen, hauptsächlich aufgrund des im Joule-<br />
Thomson-Effekts beschriebenen beachtlichen Temperaturabfalls,<br />
der bei der Freisetzung von Gasen entsteht. Zudem werden<br />
auch noch kleinere Gaslecks von intensiven akustischen<br />
Vibrationen begleitet, die leicht durch die entsprechende<br />
glasfaser-basierte Sensorik erkannt werden können.<br />
10 | 2013 87
FACHBERICHT GASVERSORGUNG & PIPELINETECHNIK<br />
Ein weiterer allgemein bekannter Mangel von glasfaserbasierten<br />
Überwachungssystemen für Pipelines ist, dass<br />
es äußerst schwierig ist, diese zu testen. Um eventuelle<br />
Skeptiker zu überzeugen, verwendet OMEGA für Testzwecke<br />
speziell dafür entworfene Rohre mit Ablassventilen,<br />
die per Fernsteuerung ganz oder teilweise geöffnet<br />
werden können. Es gibt auch andere Methoden, um<br />
während der Probeläufe das Temperaturprofil an einem<br />
Leitungsabschnitt zu beeinflussen, z. B. das einfache<br />
Besprenkeln mit Wasser.<br />
GANZHEITLICHE LÖSUNG: DTS- UND DAS-<br />
SENSORIK FÜR LECKS<br />
Das russische Unternehmen hat ein neues Gerät entwickelt<br />
und vor kurzem erfolgreich an der Druschba-Ölpipeline<br />
in der Nähe der russischen Stadt Unetscha, Gebiet<br />
Brjansk, getestet. Auf Grundlage der von europäischen<br />
und amerikanischen Kollegen unterstützten Terminologie<br />
bezeichnet OMEGA das neue Produkt als verteilten akustischen<br />
Sensor (Distributed Acoustic Sensor, DAS), der<br />
eine logische Fortsetzung des verteilten Vibrationssensors<br />
darstellt, über den „<strong>3R</strong>“ 2012 berichtete [3].<br />
Der Unterschied macht es aus: Die DAS-Methode kann<br />
das reale, tatsächliche akustische Signal auf zwei 50 km<br />
langen (Leitungsabschnitten zu beiden Seiten der Auswerteeinheit<br />
messen und für den Betreiber in der Messwarte<br />
reproduzieren. Die Einheit sendet ein optisches Signal<br />
in die Faser und analysiert die natürlich auftretenden<br />
Reflexionen, die entlang des installierten Glasfaserkabels<br />
zurückgestreut werden. Durch die Analyse dieser Reflexionen<br />
und das Messen der Zeit zwischen dem Abschicken<br />
des Laserimpulses und dem Empfang des reflektierten<br />
Bild 4: Ingenieur Rustam Shakirov bereitet den Server für den Probelauf vor<br />
Signals erfasst die DAS-Methode das akustische Signal<br />
an allen Punkten entlang des faseroptischen Sensors.<br />
Der zuvor erwähnte Probelauf hat bestätigt, dass das<br />
neue DAS-basierte Leckerkennungssystem LDACS über<br />
mindestens diese Eigenschaften verfügen wird:<br />
»»<br />
maximale Reichweite mit optischem Verstärker: 50 km<br />
»»<br />
Länge des virtuellen Messkanals: 5 m und weniger<br />
»»<br />
Empfindlichkeit der Phasenumwandlung:<br />
0,1-0,2 Radiant<br />
»»<br />
Bandbreite der analysierten Frequenzen: 1-500 Hz<br />
bei einer Impulsfolge von 1 kHz.<br />
Ähnlich wie beim verteilten Vibrationssensor (DVS) verwendet<br />
die DAS-Architektur die faseroptischen Sensoren<br />
als virtuelle Mikrofone sowie als Übertragungsmedium<br />
für Messinformationen. Die DAS-Methode verwendet<br />
Coherent Optical Time Domain Reflectometry (COTDR),<br />
um die Rückstrahlung von Rayleigh-gestreutem Licht<br />
zu analysieren und um Vibrationen in vielfachen virtuellen<br />
Kanälen aufzuzeichnen, deren Anzahl in die Zehntausende<br />
gehen kann, womit ein Auflösungsverhalten<br />
sowie eine Genauigkeit von +/- 5 m erreicht wird. Hunderte<br />
Ereignisse können gleichzeitig und unabhängig<br />
voneinander erkannt und „gehört“ werden. Für kürzere<br />
Distanzen kann die herkömmliche Länge des virtuellen<br />
Mikrofons von 5 auf 3 m reduziert werden, da das<br />
neue Gerät weitreichende Möglichkeiten zur Einstellung<br />
der Arbeitsparameter bietet. Durch die Verringerung<br />
der räumlichen Auflösung können das Signal-Rausch-<br />
Verhältnis verbessert und durch das Rauschen bedingte<br />
Störungen entsprechend reduziert werden.<br />
Das neue DAS-Gerät zeichnet sich durch seine kompaktere<br />
Baugröße und sein opto-elektronisches<br />
Design aus. Es wird für das sehr viel präzisere<br />
und schnellere Messen von reflektierten<br />
Signalen verwendet. Es ermöglicht,<br />
erfasste Ereignisse akustisch aufzuzeichnen<br />
und falls nötig das Glasfaserkabel in ein<br />
akustisches Mikrofon mit einer äußerst<br />
hohen Empfindlichkeit und einem sehr<br />
guten Frequenzverhalten umzuwandeln. So<br />
entstehen auf der einen Seite neue Möglichkeiten<br />
für die Erfassung von Ereignissen<br />
und auf der anderen kann die Technologie<br />
auch für andere Bereiche der Überwachung<br />
verwendet werden. Die Anwendungsmöglichkeiten<br />
in anderen Bereichen eröffnen<br />
neue Horizonte für OMEGA, die sich nicht<br />
nur auf die Zusammenarbeit mit Öl- und<br />
Gaspipeline-Betreibern beschränkt, sondern<br />
auch den Kontakt zu Betreibern von<br />
Eisenbahnen, Stromleitungen und anderen<br />
speziell geschützten Bereichen sucht.<br />
Was den historisch gewachsenen Fokus auf<br />
die Überwachung von Öl- und Gaspipelines<br />
anbelangt, wird OMEGA das neu entwickelte<br />
DAS-System einsetzen, um die Leckerken-<br />
88 10 | 2013
GASVERSORGUNG & PIPELINETECHNIK FACHBERICHT<br />
nung und die physische Lokalisierung von Ereignissen<br />
noch sicherer und schneller zu machen. Die wichtigste<br />
neue Fähigkeit des Leckerkennungssystems LDACS ist das<br />
Duplizieren des Leckerkennungssignals, das sowohl vom<br />
verteilten Temperatursensor (DTS) als auch vom verteilten<br />
akustischen Sensor (DAS) übermittelt wird. Für diese<br />
Pionierarbeit wird in Zusammenarbeit mit führenden Wissenschaftlern<br />
der renommierten Staatlichen Universität<br />
Moskau eine spezielle Bibliothek zu akustischen Feldern<br />
von Gas- und Flüssigkeitslecks erstellt. Einer der Faktoren,<br />
der zu einer besseren Erkennung von Lecks und anderen<br />
Ereignissen führt, ist die stabile Linearität im 1-2 kHz-Frequenzbereich.<br />
So kann das lineare DAS-basierte Gerät die<br />
Form des eingehenden Rückstrahlsignals beibehalten und<br />
die morphologische Merkmalerkennung implementieren.<br />
Einer der allgemein bekannten Schwachpunkte des DVS<br />
ist die schwierige Feineinstellung bzw. Abgrenzung der<br />
einzelnen Kanäle pro Längenabschnitt, was dazu führt,<br />
dass dasselbe Ereignis vielfach mit verschiedenen Amplituden<br />
dargestellt wird. Durch die Existenz von virtuellen<br />
akustischen Mikrofonen entlang des Glasfaserkabels und<br />
durch voreingestellte Eigenschaften können alle Signale<br />
in jedem Kanal pro Längenabschnitt normalisiert werden.<br />
Das ist nicht nur der Schlüssel zur äußerst präzisen<br />
Erkennung von Ereignissen, sondern auch ein Schritt<br />
in Richtung Lösung einer anderen wichtigen Aufgabe,<br />
nämlich der Berechnung des Abstandes zwischen dem<br />
festgestellten Ereignis und dem Leitungssystem. Diese<br />
„2D“-Technologie öffnet das Tor zur Erkennung von<br />
wesentlichen Ereignissen, die nicht nur entlang der Pipeline,<br />
sondern auch senkrecht zur Pipeline (z. B. Fußgänger<br />
oder Autoverkehr) entstehen.<br />
In der zweiten Phase der algorithmischen Ereignisanalyse<br />
kann der Betreiber in der zentralen Messwarte die Entwicklung<br />
des Ereignisses verfolgen, während das Leckerkennungssystem<br />
LDACS seinerseits natürliche Ereignisse<br />
herausfiltert, die die Pipeline und ihre technischen Anlagen<br />
nicht gefährden.<br />
Ein weiterer praktischer Vorteil der DAS-Systemkomponenten<br />
ist der erweiterte Betriebstemperaturbereich des<br />
Leckerkennungssystem LDACS von +5° bis +25° C und<br />
im Falle des verteilten Vibrationssensors (DVS) von +5°<br />
bis +40° C. Aufgrund der Tatsache, dass viele Pipeline-<br />
Projekte im Nahen Osten und in Lateinamerika keine<br />
gekühlten und klimatisierten Räumlichkeiten für die Installation<br />
der Geräte bereitstellen können, wird dieser<br />
erweiterte Temperaturbereich die Kosten für Installation<br />
und Stromverbrauch senken. Die erweiterte Möglichkeit,<br />
das DAS-System sowohl für Onshore-Pipelines als auch<br />
für Offshore-Pipelines zu verwenden, ist ein weiterer<br />
wichtiger Marketingaspekt des neuen Systems.<br />
Mit der neuen Version des LDACS können auch kleinere<br />
Leckagen erkannt werden, indem die verschiedenen<br />
Methoden entsprechend kombiniert und damit verbessert<br />
werden. Dies ist wichtig für die entsprechenden technischen<br />
Anforderungen sowie für die Gesetzgebung in<br />
verschiedenen Ländern.<br />
Ein weiterer Vorteil des DAS-basierten LDACS ist dessen<br />
Unabhängigkeit vom Prozess bzw. von den Stoffparametern<br />
des transportierten Mediums sowie von betriebsbedingten<br />
dynamischen Schalthandlungen der Pipeline.<br />
Die Leckortung funktioniert für Gas, Flüssigkeiten und<br />
mehrphasige Medien schnell und hochgenau. Dabei können<br />
auch mehrere parallel auftretende Leckagen mit<br />
derselben hohen Genauigkeit erkannt werden.<br />
LITERATUR<br />
[1] U.S. Department of Transportation, Pipeline and Hazardous<br />
Materials Safety Administration, Final Report No. 12-173, “Leak<br />
Detection Study – DTPH56-11-D-000001”, Dr. David Shaw, Dr.<br />
Martin Phillips, Ron Baker, Eduardo Munoz, Hamood Rehman,<br />
Carol Gibson, Christine Mayernik, 10. Dezember 2012.<br />
[2] Review of Pipeline Leak Detection Technologies. Jun Zhang,<br />
Andy Hoffman, Keefe Murphy, John Lewis, Michael Twomey<br />
– ATMOS Internationaler Bericht von der PSIG-Konferenz in<br />
Prag, 2013.<br />
[3] <strong>3R</strong> International, Technical Journal for Piping System Integrity<br />
and Efficiency, Vulkan-Verlag, Essen Deutschland, <strong>Special</strong><br />
2/2012, p. 63-65.<br />
NATALIJA PSÖL<br />
OMEGA Company, Moskau, Russland<br />
Tel. +7 499 7998435<br />
E-Mail: PselNA@omega.mn<br />
DMITRIJ PLESCHKOW<br />
Dr. ENWER ACHMEDOV<br />
Stv. Generaldirektor OMEGA Company,<br />
Moskau, Russland<br />
Tel. +7 499 7998435<br />
E-Mail: AhmedovER@omega.mn<br />
Dr. ALEKSEY TURBIN<br />
Stv. Generaldirektor, OMEGA Company,<br />
Moskau, Russland<br />
Tel. +7 916 5661599<br />
E-Mail: Turbi60@mail.ru<br />
AUTOREN<br />
Generaldirektor OMEGA Company, Moskau,<br />
Russland<br />
Tel. +7 499 7998435<br />
E-Mail: Pleshkov@omega.mn<br />
10 | 2013 89
the gas engineer’s<br />
dictionary<br />
www.di-verlag.de<br />
Order now!<br />
Supply Infrastructure from A to Z<br />
The Gas Engineer’s Dictionary will be a standard work for all aspects of<br />
construction, operation and maintenance of gas grids.<br />
this dictionary is an entirely new designed reference book for both engineers<br />
with professional experience and students of supply engineering.<br />
the opus contains the world of supply infrastructure in a series of detailed<br />
professional articles dealing with main points like the following:<br />
• biogas<br />
• compressor stations<br />
• conditioning • corrosion protection<br />
• dispatching • gas properties<br />
• grid layout • LNG<br />
• odorization • metering<br />
• pressure regulation • safety devices<br />
• storages<br />
editor: K. Homann, r. reimert, B. Klocke<br />
1 st edition 2013, 400 pages with additional information and complete<br />
ebook, hardcover<br />
DIV Deutscher Industrieverlag GmbH, Arnulfstr. 124, 80636 München, Germany<br />
knowledge for tHe<br />
future<br />
order now by fax: +49 931 / 4170-492 or send in a letter<br />
Deutscher Industrieverlag GmbH | Arnulfstr. 124 | 80636 München<br />
Yes, I place a firm order for the technical book. Please send<br />
—<br />
copies of the The Gas Engineer’s Dictionary<br />
– Supply Infrastructure from A to Z plus ebook.<br />
1 st edition 2013 (ISBN: 978-3-8356-3214-1)<br />
at the price of € 160,- (plus postage and packing extra)<br />
Company/institution<br />
first name and surname of recipient<br />
Street/P.o. Box, No.<br />
Country, Postcode, town<br />
reply / Antwort<br />
Vulkan-Verlag GmbH<br />
Versandbuchhandlung<br />
Postfach 10 39 62<br />
45039 Essen<br />
GERMANY<br />
Phone<br />
e-mail<br />
Line of business<br />
fax<br />
Please note: According to German law this request may be withdrawn within 14 days after order date in writing<br />
to Vulkan Verlag GmbH, Versandbuchhandlung, Postfach 10 39 62, 45039 essen, Germany.<br />
Date, signature<br />
PAtGeD2013<br />
In order to accomplish your request and for communication purposes your personal data are being recorded and stored.<br />
It is approved that this data may also be used in commercial ways by mail, by phone, by fax, by email, none.<br />
this 90 approval may be withdrawn at any time.<br />
10 | 2013<br />
✘
Marktübersicht<br />
2013<br />
Rohre + Komponenten<br />
Maschinen + Geräte<br />
Korrosionsschutz<br />
Dienstleistungen<br />
Sanierung<br />
Institute + Verbände<br />
Fordern Sie weitere Informationen an unter<br />
Tel. 0201/82002-35 oder E-Mail: h.pelzer@vulkan-verlag.de<br />
www.3r-marktuebersicht.de<br />
10 | 2013 91
2013<br />
RohRe + Komponenten<br />
Marktübersicht<br />
Armaturen<br />
Armaturen + Zubehör<br />
Anbohrarmaturen<br />
Rohre<br />
Formstücke<br />
Schutzmantelrohre<br />
Kunststoff<br />
92 10| 2013
RohRe + Komponenten<br />
2013<br />
Rohrdurchführungen<br />
Marktübersicht<br />
Dichtungen<br />
Ihr „Draht“ zur Anzeigenabteilung von<br />
Helga Pelzer<br />
Tel. 0201 82002-35<br />
Fax 0201 82002-40<br />
h.pelzer@vulkan-verlag.de<br />
10 | 2013 93
2013<br />
maschinen + GeRäte<br />
Marktübersicht<br />
Kunststoffschweißmaschinen<br />
Horizontalbohrtechnik<br />
Leckageortung<br />
94 10| 2013
KoRRosionsschutz<br />
2013<br />
Kathodischer Korrosionsschutz<br />
Marktübersicht<br />
10 | 2013 95
2013<br />
KoRRosionsschutz<br />
Marktübersicht<br />
Kathodischer Korrosionsschutz<br />
96 10| 2013
KoRRosionsschutz<br />
2013<br />
Korrosionsschutz<br />
Marktübersicht<br />
Ihr „Draht“ zur Anzeigenabteilung von<br />
Helga Pelzer<br />
Tel. 0201 82002-35<br />
Fax 0201 82002-40<br />
h.pelzer@vulkan-verlag.de<br />
10 | 2013 97
2013<br />
DienstleistunGen / sanieRunG<br />
Marktübersicht<br />
Sanierung<br />
Sanierung<br />
institute + VeRbänDe<br />
Institute<br />
98 10| 2013
institute + VeRbänDe<br />
2013<br />
Verbände<br />
Marktübersicht<br />
10 | 2013 99
2013<br />
institute + VeRbänDe<br />
Marktübersicht<br />
Verbände<br />
INSERENTENVERZEICHNIS<br />
Firma<br />
28. Oldenburger Rohrleitungsforum 2014, Oldenburg 3<br />
3S Consult GmbH, Garbsen 39<br />
DOYMA GmbH & Co, Oyten 7<br />
HOBAS Rohre GmbH, Neubrandenburg<br />
Titelseite<br />
NO-DIG 2014, Moskau, Russland 11<br />
Pollutec Horizons 2013, Paris, Frankreich 13<br />
RBS Wave GmbH, Stuttgart 69<br />
resinnovation GmbH, Rülzheim 55<br />
TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG, Hannover 5<br />
Marktübersicht 91 - 100<br />
100 10| 2013
SERVICES BUCHBESPRECHUNG<br />
MANAGEMENT GROSS ANGELEGTER GRUNDSTÜCKSENTWÄSSERUNGSANLAGEN<br />
INFOS:<br />
Autor: Michael Scheffler; Fraunhofer IRB Verlag, 2013, 359<br />
Seiten, gebunden, € 69,00, auch als E-Book, ISBN: 978-3-<br />
8167-8537-8<br />
Das vorliegende Buch von Michael Scheffler ist<br />
insbesondere für Betreiber großer Grundstücksentwässerungs-(GE-)Anlagen<br />
z. B. in der Immobilien-<br />
und Wohnungswirtschaft, für große<br />
Gewerbe- und Industriebetriebe sowie Liegenschaften<br />
der öffentlichen Hand verfasst. Hintergrund<br />
des Handbuches ist die Organisation von<br />
Betrieb und Instandhaltung großer Grundstücksentwässerungsanlagen<br />
mit dem Ziel des ordnungsgemäßen<br />
und effizienten Anlagenbetriebs.<br />
Erforderliche Prozessschritte werden in strukturierte<br />
Handlungsanweisungen gefasst, durch Diagramme<br />
und Tabellen illustriert. Das Buch kann<br />
durchaus als Grundlagenquelle genutzt werden<br />
von denjenigen, die eine Zertifizierung nach<br />
DIN EN ISO 14001 ff. oder ein Qualitätsmanagement<br />
nach DIN EN ISO 9001 ff. vorbereiten. Die<br />
beiliegende CD enthält u. a. prozessunterstützende<br />
Dokumente, Formblätter und Arbeitshilfen.<br />
POWERLINES - ENERGIEPOLITISCHE ENTWICKLUNGSLINIEN EUROPAS<br />
INFOS:<br />
Herausgeber: Martin Graf (Vorstand der E-Control),<br />
Patrick Horvath (wissenschaftlicher Mitarbeiter der<br />
Arbeitsgemeinschaft für wissenschaftliche Wirtschaftspolitik<br />
(WIWIPOL)), Wolfgang Ruttenstorfer (Staatssekretär a. D.,<br />
ehem. Generaldirektor der OMV AG), 2013, 253 Seiten,<br />
gebunden, € 34,00, ISBN: 978-3-7003-1862-0<br />
In „Powerlines“ nehmen hochrangige Experten<br />
zu neuesten energiepolitischen Entwicklungslinien<br />
Europas Stellung. Ziel des Buches ist, eine öffentlichkeitswirksame<br />
Plattform für innovative Energie-Ideen<br />
anzubieten. Energiepolitik kann heute<br />
nur mehr im europäischen Kontext statt im engen<br />
nationalen Korsett verstanden werden. In „Powerlines“<br />
wird Energiepolitik als existenzielle Grundlage<br />
von Industriepolitik definiert, zusätzlich wird<br />
die soziale Dimension von Energie – Stichwort:<br />
Konsumentenschutz, leistbare Energiepreise – besonders<br />
betont. Die Vereinbarkeit mit Ökologie<br />
ist dabei eine wichtige zu bewältigende Aufgabe.<br />
Der Schlüssel zur wirtschaftlichen Zukunftsfähigkeit<br />
unseres Landes liegt im Energiebereich.<br />
„Powerlines“ will alte Denkmuster verlassen und<br />
zur breiten Diskussion über diese Energiezukunft<br />
anregen.<br />
DIE WASSERVERSORGUNG IM ANTIKEN ROM<br />
Sextus Iulius Frontinus – sein Werk in Lateinisch und Deutsch und begleitende Fachaufsätze<br />
INFOS:<br />
Herausgeber: Frontinus Gesellschaft e.V., 4. völlig neu<br />
bearbeitete, 2013, 284 Seiten, gebunden, € 89,80 ISBN:<br />
9783835671072<br />
Sextus Iulius Frontinus wurde im Jahre 97 n. Chr.<br />
durch Kaiser Nerva zum Leiter der Wasserversorgung<br />
der Stadt Rom (curator aquarum) berufen.<br />
Aus diesem Anlass verfasste er eine Schrift,<br />
die unter dem Titel „De aquaeductu urbis Romae<br />
– Die Wasserversorgung der Stadt Rom“<br />
überliefert worden ist. Frontin gibt darin einen<br />
Überblick über den Stand des Wissens bezüglich<br />
Management, Technik und Organisation<br />
der öffentlichen Wasserversorgung. Er begegnet<br />
uns als moderner Manager einer großstädtischen<br />
Wasserversorgung; seine Schrift kann<br />
als erstes Lehrbuch des Faches gelten. Die zweisprachige<br />
Ausgabe (lateinisch, deutsch) basiert<br />
auf einer sorgfältigen Überprüfung des lateinischen<br />
Textes sowie einer neuen Übersetzung ins<br />
Deutsche.<br />
13 begleitende Aufsätze, verfasst von international<br />
renommierten Vertretern der Alten Geschichte,<br />
Altphilologie und Literaturgeschichte,<br />
Archäologie und Ingenieurwissenschaften behandeln<br />
die Editionsgeschichte des Werkes, die<br />
Gestalt Frontins in ihrer politischen und sozialen<br />
Umwelt, die Organisation und Administration<br />
der Wasserversorgung, diskutieren Messtechnik<br />
und hydraulische Kenntnisse, Rohrnormung<br />
und bautechnische Fragen, und gehen ein auf<br />
die öffentlichen Bäder, Brunnenanlagen, Toiletten<br />
und Abwasserleitungen zur Zeit Frontins.<br />
Diverse Abbildungen, Karten und Tabellen ergänzen<br />
das Buch.<br />
10 | 2013 101
SERVICES AKTUELLE TERMINE<br />
brbv<br />
SPARTENÜBERGREIFENDE<br />
GRUNDLAGENSCHULUNGEN<br />
GFK-Rohrleger nach DVGW-Arbeitsblatt<br />
W 324 – Grundkurs<br />
21./22.11.2013 Gera<br />
16./17.12.2013 Rostock<br />
19./20.12.2013 Gera<br />
Baustellenabsicherung und<br />
Verkehrssicherung RSA/ZTV-SA - 1 Tag<br />
05.11.2013 Halle<br />
17.12.2013 Sulzbach<br />
GFK-Rohrleger nach DVGW-Arbeitsblatt<br />
W 324 – Nachschulung<br />
06.12.2013 Gera<br />
Stecken, Pressen und Klemmen von<br />
Kunststoffrohren<br />
14./15.11.2013 Koblenz<br />
Bauleiter (A/B) für horizontales<br />
Spülbohrverfahren nach GW 329<br />
A: 13.-24.01.2014 Oldenburg<br />
B: 13.-31.01.2014 Oldenburg<br />
INFORMATIONSVERANSTALTUNGEN<br />
Arbeitssicherheit im Tief- und Leitungsbau<br />
26.11.2013 Münster<br />
11.12.2013 Frankfurt/Main<br />
Gussrohrverlegung – aktuelle<br />
Entwicklungen und Einbauverfahren<br />
26.11.2013 München<br />
Einbau und Abdichtung von Netz- und<br />
Hausanschlüssen bei Neubau und<br />
Sanierung<br />
27.11.2013 Kassel<br />
19.12.2013 Potsdam<br />
Steuerbare horizontale Spülbohrverfahren<br />
– Weiterbildungsveranstaltung nach<br />
GW 329<br />
10.12.2013 Kassel<br />
Baurecht 2013<br />
14.11.2013 Münster<br />
05.12.2013 Berlin<br />
GAS/WASSER<br />
INFORMATIONSVERANSTALTUNGEN<br />
Kunststoffrohre in der Gas- und<br />
Wasserversorgung – Verlängerung zur<br />
GW 331<br />
07.11.2013 Frankfurt/Main<br />
10.12.2013 Karlsruhe<br />
Sachkunde GW 301 – Bau von<br />
Wasserrohrleitungen<br />
20./21.11.2013 Mannheim<br />
Sachkunde GW 301 – Bau von<br />
Gasrohrnetzen bis 16 bar<br />
05/06.11.2013 Weimar<br />
Sachkunde GW 301 – Bau von<br />
Gasrohrnetzen über 16 bar<br />
03./04.12.2013 Berlin<br />
Grabenlose Bauweisen<br />
27.11.2013 München<br />
Sachkundiger Gas bis 5 bar<br />
20.11.2013 Hannover<br />
Sachkundiger Wasser – Wasserverteilung<br />
21.11.2013 München<br />
Reinigung und Desinfektion von<br />
Wasserverteilungsanlagen<br />
19.11.2013 Magdeburg<br />
DVGW-Arbeitsblatt GW 301<br />
– Qualitätsanforderungen für<br />
Rohrleitungsbauunternehmen<br />
26.11.2013 Nürnberg<br />
PRAXISSEMINARE<br />
Arbeiten an Gasleitungen – BGR 500,<br />
Kap. 2.31 – Fachaufsicht<br />
25.-29.11.2013 Gera<br />
09.-13.12.2013 Gera<br />
Einführung in die Gasdruckregel- und<br />
Messtechnik<br />
12.-14.11.2013 Erfurt<br />
Fachwissen für Schweißaufsichten nach<br />
DVGW-Merkblatt GW 331 inkl. DVS-<br />
Abschluss 2212-1<br />
14.-15.11.2013 Dortmund<br />
12.-13.12.2013 Dortmund<br />
Qualitätssicherung bei PE-<br />
Rohrleitungen – Beurteilung von<br />
Kunststoffschweißverbindungen HS – HM<br />
nach DVS 2202/1<br />
12.11.2013 Bad Zwischenahn<br />
05.12.2013 Berlin<br />
Fachaufsicht Korrosionsschutz für<br />
Nachumhüllungsarbeiten gemäß DVGW-<br />
Merkblatt GW 15<br />
19.11.2013 Nürnberg<br />
04.12.2013 Brandenburg<br />
Druckprüfung von Wasserrohrleitungen<br />
20.11.2013 Nürnberg<br />
FERNWÄRME<br />
INFORMATIONSVERANSTALTUNGEN<br />
Aufbaulehrgang Fernwärme<br />
12.11.2013 Kerpen<br />
Rohrstatische Auslegung von<br />
Kunststoffmantelrohren<br />
12./13.11.2013 Kerpen<br />
Qualifikationen im Fernwärmeleitungsbau<br />
19.11.2013 Hannover<br />
Schweißen und Prüfen von<br />
Fernwärmeleitungen – FW 446<br />
20.11.2013 Hannover<br />
Stahlmantelrohre im<br />
Fernwärmeleitungsbau<br />
21.11.2013 Hannover<br />
Planung und Bau von<br />
Fernwärmeversorgung mit Dampf<br />
22.11.2013 Hannover<br />
Aktuelle Themen im Fernwärmeleitungsbau<br />
03./04.12.2013 Fulda<br />
SEMINARE<br />
DVGW<br />
Berechnung und Optimierung von<br />
Wasserverteilungsnetzen<br />
13./14.11.2013 Bremerhaven<br />
102 10 | 2013
AKTUELLE TERMINE SERVICES<br />
SEMINARE<br />
GWI Essen<br />
Sachkundige für Odorieranlagen - DVGW G 280<br />
12./13.11.2013 Essen<br />
Sachkundigenschulung - Instandhaltung von<br />
Gasleitungen aus Stahlrohren größer 5 bar<br />
gem. DVGW G 466-1<br />
14./15.11.2013 Essen<br />
Grundlagen, Praxis und Fachkunde von<br />
Gas-Druckregelanlagen nach DVGW G 491,<br />
G 495 und G 459-2<br />
20./21.11.2013 Essen<br />
Sicherheitstraining bei Bauarbeiten im<br />
Bereich von Versorgungsleitungen -<br />
BALSibau - DVGW GW 129<br />
22.11.2013 Essen<br />
06.12.2013 Essen<br />
Sachkundigenschulung Gasabrechnung<br />
gemäß DVGW G 685<br />
25.-27.11.2013 Essen<br />
Sachkundigenschulung - Druckbehälter<br />
und Durchleitungsdruckbehälter einschl.<br />
Erdgas-Vorwärmanlagen nach DVGW GW<br />
498 und G 499<br />
27./28.11.2013 Essen<br />
Arbeiten an Gasleitungen bei<br />
unkontrollierter Gasausströmung Schulung<br />
nach BGR 500 (gem. BGV A1 / BGI 560)<br />
03.12.2013 Essen<br />
Einstellungen, Normalbetrieb<br />
und Störungsbeseitigung an Gas-<br />
Druckregelanlagen<br />
03./04.12.2013 Essen<br />
Einstellungen, Normalbetrieb<br />
und Störungsbeseitigung an Gas-<br />
Druckregelanlagen<br />
03./04.12.2013 Essen<br />
Instandhaltung von Gasrohrnetzen<br />
10./11.12.2013 Essen<br />
Gas-Hausanschlüsse – Planung, Betrieb,<br />
Instandhaltung<br />
12./13.12.2013 Essen<br />
Druckbehälter und<br />
Durchleitungsdruckbehälter Praxis-<br />
Vertiefungsseminar/Weiterbildung der<br />
Sachkundigen nach G 498<br />
12./13.12.2013 Essen<br />
Wirtschaftliche Instandhaltung von<br />
Gasnetzen und –anlagen<br />
18.12.2013 Essen<br />
SEMINARE<br />
HDT<br />
Rohrleitungsplanung für Industrie- und<br />
Chemieanlagen<br />
14./15.11.2013 München<br />
Druckstöße, Dampfschläge und<br />
Pulsationen in Rohrleitungen<br />
02./03.12.2013 Leibstadt, Schweiz<br />
Festigkeitsmäßige Auslegung von<br />
Druckbehältern<br />
02./03.12.2013 Essen<br />
Dichtungstechnik im Rohrleitungs- und<br />
Apparatebau<br />
14.11.2013 Essen<br />
ASME-Kenntnisse für die Anfrage<br />
zu Druckgeräten, Rohrleitungen mit<br />
Zubehör und Schweißkonstruktionen im<br />
Maschinenbau<br />
19.11.2013 Essen<br />
Schweißen von Rohrleitungen im Energieund<br />
Chemieanlagenbau<br />
20./21.11.2013 Essen<br />
SEMINARE<br />
Radiodetection<br />
Aufbaumodul Kabelfehlerortung (Laufzeitund<br />
Brückenmesstechnik)<br />
26.-28.11.2013 Emmerich<br />
Grundmodul Kabel- und Leitungsortung<br />
10./11.12.2013 Emmerich<br />
Aufbaumodul Kabel- und Leitungsortung<br />
19./20.11.2013 Emmerich<br />
Grundmodul Kabelfehlersortung<br />
03.-05.12.2013 Emmerich<br />
RSV<br />
ZKS-BERATER-LEHRGÄNGE<br />
Blockschulung 2013<br />
Modulare Schulung 2013<br />
11.11.-16.11.2013 Kerpen<br />
18.11.-22.11.2013 Hamburg/Kiel<br />
02.12.-07.12.2013 Hamburg/Kiel<br />
25.11.-30.11.2013 Feuchtwangen<br />
SEMINARE<br />
SAG<br />
Grundlagen der Kanalreinigung in Theorie<br />
und Praxis<br />
09.12.2013 Lünen<br />
Fahrzeug- und Gerätetechnik im Bereich<br />
Kanalreinigung<br />
11.12.2013 Lünen<br />
Fachgerechte Reinigung von<br />
Grundstücksentwässerungsanlagen in<br />
Theorie und Praxis<br />
16.12.2013 Lünen<br />
Grundlagen der Inspektion von Kanälen<br />
und Grundstücksentwässerungsleitungen<br />
in Theorie und Praxis auf Grundlage der<br />
Europäischen Norm DIN EN 13508-2, des<br />
nationalen Regelwerks DWA-M 149, Teil<br />
2 und 5 sowie ISYBAU 2006<br />
18.11.2013 Kiel<br />
Bewertung von Schadensbildern,<br />
Zustandsklassifizierung nach DWA-M<br />
149-3, ISYBAU sowie DIN 1986-<br />
30 (02/2012), Zustandsbewertung<br />
nach DWA-M 149-3 (mit<br />
Sanierungskennzahlen) und<br />
10 | 2013 103
SERVICES AKTUELLE TERMINE<br />
Auswahl des geeigneten<br />
Sanierungsverfahrens sowie Übersicht<br />
von Sanierungsverfahren im Bereich<br />
Grundstücksentwässerung (GEA)<br />
25.11.2013 Lünen<br />
Grundlagen der Kanalsanierung privater<br />
Abwasserleitungen, Bewertung von<br />
Schadensbildern mit Zustandsklassifizierung<br />
nach DWA-M 149-3, ISYBAU 2006 und DIN<br />
1986-30 (02/2012)<br />
25.11.2013 Lünen<br />
Sachkundelehrgang Grundlagen und<br />
Anwendung des Berstliningverfahrens<br />
25.11.2013 Darmstadt<br />
27.01.2014 Lauingen<br />
SEMINARE<br />
TAH<br />
Zertifizierter Kanalsanierungs-Berater<br />
2013<br />
06.-11.01.2014 Essen<br />
17.-22.03.2014 Hannover<br />
Auf den Punkt gebracht<br />
05.11.2013 Leipzig<br />
06.11.2013 Hannover<br />
07.11.2013 Gelsenkirchen<br />
26.11.2013 Mainz<br />
27.11.2013 Stuttgart<br />
28.11.2013 München<br />
Generalentwässerungsplanung<br />
13./14.11.2013 Würzburg<br />
SEMINARE<br />
TAW<br />
Verfahrenstechnische Erfahrungsregeln bei<br />
der Auslegung von Apparaten und Anlagen<br />
25./26.11.2013 Altdorf<br />
12./13.05.2013 Wuppertal<br />
KKS-Seminar für Fortgeschrittene – Teil 1<br />
25.-27.11.2013 Wuppertal<br />
KKS-Seminar für Fortgeschrittene – Teil 2<br />
27.-29.11.2013 Wuppertal<br />
Kathodischer Korrosionsschutz<br />
unterirdischer Anlagen<br />
12.-14.03.2014 Wuppertal<br />
Urbane Sturzfluten: Analyse, Bewertung,<br />
Lösung (Zusatztermin)<br />
28.11.2013 Oberhausen<br />
KONTAKTADRESSEN<br />
Berufsförderungswerk des Rohrleitungsbauverbandes<br />
Kurt Rhode, Tel. 0221/37668-44,<br />
Fax 0221/37668-62, E-Mail: rhode@brbv.de,<br />
www.brbv.de<br />
DVGW Deutsche Vereinigung des<br />
Gas- und Wasserfaches e.V.,<br />
Tel. 0228/9188-607, Fax 0228/9188-997,<br />
E-Mail: splittgerber@dvgw.de, www.dvgw.de<br />
GWI Gas- und Wärmeinstitut<br />
Essen e.V.,<br />
Barbara Hohnhorst, Tel. 0201/3618-143,<br />
Fax 0201/3618-146, E-Mail: hohnhorst@<br />
gwi-essen.de, www.gwi-essen.de<br />
HdT<br />
Haus der Technik Essen, Tel. 0201/1803-1,<br />
E-Mail: hdt@hdt-essen.de,<br />
www.hdt-essen.de<br />
E-Mail: rd.sales.de@spx.com,<br />
www.radiodetection.com<br />
SAG-Akademie<br />
Anja Kratt, Tel. 06151/10155-111,<br />
Fax 06151/10155-155, E-Mail: Kratt@SAG-<br />
Akademie.de, www.SAG-Akademie.de<br />
Technische Akademie Hannover<br />
Dr. Igor Borovsky, Tel. 0511/39433-30,<br />
Fax 0511/39433-40, E-Mail: borovsky@tahannover.de,<br />
www.ta-hannover.de<br />
Technische Akademie Wuppertal<br />
Tel. 0202/7495-207, Fax 0202/7495-228,<br />
E-Mail: taw@taw.de, www.taw.de<br />
ZKS<br />
RSV - Rohrleitungssanierungsverband e.V.,<br />
Tel.: 05963/9810877, Fax 05963/9810878,<br />
E-Mail: rsv-ev@t-online.de, www.rsv-ev.de<br />
104 10 | 2013
IMPRESSUM<br />
IMPRESSUM<br />
Verlag<br />
© 1974 Vulkan-Verlag GmbH,<br />
Postfach 10 39 62, 45039 Essen,<br />
Telefon +49 201-82002-0, Fax -40<br />
Geschäftsführer: Carsten Augsburger, Jürgen Franke<br />
Redaktion<br />
Dipl.-Ing. N. Hülsdau, Vulkan-Verlag GmbH,<br />
Huyssenallee 52-56, 45128 Essen,<br />
Telefon +49 201-82002-33, Fax +49 201-82002-40,<br />
E-Mail: n.huelsdau@vulkan-verlag.de<br />
Kathrin Lange, Vulkan-Verlag GmbH,<br />
Telefon +49 201-82002-32, Fax +49 201-82002-40,<br />
E-Mail: k.lange@vulkan-verlag.de<br />
Barbara Pflamm, Vulkan-Verlag GmbH,<br />
Telefon +49 201-82002-28, Fax +49 201-82002-40,<br />
E-Mail: b.pflamm@vulkan-verlag.de<br />
Anzeigenverkauf<br />
Helga Pelzer, Vulkan-Verlag GmbH,<br />
Telefon +49 201-82002-66, Fax +49 201-82002-40,<br />
E-Mail: h.pelzer@vulkan-verlag.de<br />
Anzeigenverwaltung<br />
Martina Mittermayer,<br />
Vulkan-Verlag/DIV Deutscher Industrieverlag GmbH,<br />
Telefon +49 89-203 53 66-16, Fax +49 89-203 53 66-66,<br />
E-Mail: mittermayer@di-verlag.de<br />
Abonnements/Einzelheftbestellungen<br />
Leserservice <strong>3R</strong> INTERNATIONAL,<br />
Postfach 91 61, 97091 Würzburg,<br />
Telefon +49 931-4170-1616, Fax +49 931-4170-492,<br />
E-Mail: leserservice@vulkan-verlag.de<br />
Layout und Satz<br />
Dipl.-Des. Nilofar Mokhtarzada, Vulkan-Verlag GmbH<br />
E-Mail: n.mokhtarzada@vulkan-verlag.de<br />
Druck<br />
Druckerei Chmielorz, Ostring 13,<br />
65205 Wiesbaden-Nordenstadt<br />
Bezugsbedingungen<br />
<strong>3R</strong> erscheint monatlich mit Doppelausgaben im Januar/Februar,<br />
März/April und August/September · Bezugspreise: Abonnement<br />
(Deutschland): € 275,- + € 24,- Versand; Abonnement (Ausland):<br />
€ 275,- + € 28 Versand; Einzelheft (Deutschland): € 39,- + € 3,-<br />
Versand; Einzelheft (Ausland): € 39,- + € 3,50 Versand; Einzelheft<br />
als ePaper (PDF): € 39,-; Studenten: 50 % Ermäßigung auf<br />
den Heftbezugspreis gegen Nachweis · Die Preise enthalten bei<br />
Lieferung in EU-Staaten die Mehrwertsteuer, für alle übrigen<br />
Länder sind es Nettopreise.<br />
Bestellungen sind jederzeit über den Leserservice oder jede<br />
Buchhandlung möglich. Die Kündigungsfrist für Abonnementaufträge<br />
beträgt 8 Wochen zum Bezugsjahresende.<br />
Die Zeitschrift und alle in ihr enthaltenen Beiträge und Abbildungen<br />
sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb<br />
der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung<br />
des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere<br />
für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen<br />
und die Einspeicherung und Bearbeitung in elektronischen Systemen.<br />
Auch die Rechte der Wiedergabe durch Vortrag, Funkund<br />
Fernsehsendung, im Magnettonverfahren oder ähnlichem<br />
Wege bleiben vorbehalten.<br />
Jede im Bereich eines gewerblichen Unternehmens hergestellte<br />
oder benutzte Kopie dient gewerblichen Zwecken gem. § 54 (2)<br />
UrhG und verpflichtet zur Gebührenzahlung an die VG WORT,<br />
Abteilung Wissenschaft, Goethestraße 49, 80336 München, von<br />
der die einzelnen Zahlungsmodalitäten zu erfragen sind.<br />
ISSN 2191-9798<br />
Informationsgemeinschaft zur Feststellung<br />
der Verbreitung von Werbeträgern<br />
Organschaften<br />
Fachbereich Rohrleitungen im Fachverband Dampfkessel-, Behälterund<br />
Rohrleitungsbau e.V. (FDBR), Düsseldorf · Fachverband Kathodischer<br />
Korrosionsschutz e.V., Esslingen · Kunststoffrohrverband e.V.,<br />
Köln · Rohrleitungsbauverband e.V., Köln · Rohrleitungssanierungsverband<br />
e.V., Essen · Verband der Deutschen Hersteller von Gasdruck-Regelgeräten,<br />
Gasmeß- und Gasregelanlagen e.V., Köln<br />
Herausgeber<br />
H. Fastje, EWE Aktiengesellschaft, Oldenburg (Federführender Herausgeber)<br />
· Dr.-Ing. M. K. Gräf, Vorsitzender der Geschäftsführung<br />
der Europipe GmbH, Mülheim · Dipl.-Ing. R.-H. Klaer, Bayer AG, Krefeld,<br />
Vorsitzender des Fachausschusses „Rohrleitungstechnik“ der VDI-<br />
Gesellschaft Verfahrenstechnik und Chemie-Ingenieurwesen (GVC)<br />
Dipl.-Volksw. H. Zech, Geschäftsführer des Rohrleitungssanierungsverbandes<br />
e.V., Lingen (Ems)<br />
Schriftleiter<br />
Dipl.-Ing. M. Buschmann, Rohrleitungsbauverband e.V. (rbv), Köln<br />
Rechtsanwalt C. Fürst, Erdgas Münster GmbH, Münster · Dipl.‐Ing.<br />
Th. Grage, Institutsleiter des Fernwärme-Forschungsinstituts, Hemmingen<br />
Dr.-Ing. A. Hilgenstock, E.ON New Build & Technology GmbH, Gelsenkirchen<br />
(Gastechnologie und Handelsunterstützung) Dipl.-Ing. D. Homann,<br />
IKT Institut für Unterirdische Infrastruktur, Gelsenkirchen · Dipl.‐Ing.<br />
N. Hülsdau, Vulkan-Verlag, Essen · Dipl.-Ing. T. Laier, Westnetz GmbH,<br />
Dortmund · Dipl.-Ing. J. W. Mußmann, FDBR e.V., Düsseldorf<br />
Dr.-Ing. O. Reepmeyer, Europipe GmbH, Mülheim · Dr. H.-C. Sorge,<br />
IWW Rheinisch-Westfälisches Institut für Wasser, Biebesheim · Dr. J.<br />
Wüst, SKZ - TeConA GmbH, Würzburg<br />
Beirat<br />
Dr.-Ing. W. Berger, Direktor des Forschungsinstitutes für Tief-und<br />
Rohrleitungsbau e.V., Weimar · Dr.-Ing. B. Bosseler, Wissenschaftlicher<br />
Leiter des IKT – Institut für Unterirdische Infra struktur, Gelsenkirchen<br />
· Dipl.-Ing. D. Bückemeyer, Vorstand der Stadtwerke Essen AG<br />
W. Burchard, Geschäftsführer des Fachverbands Armaturen im VD-<br />
MA, Frankfurt · Bauassessor Dipl.‐Ing. K.-H. Flick, Fachverband Steinzeugindustrie<br />
e.V., Köln · Prof. Dr.-Ing. W. Firk, Vorstand des Wasserverbandes<br />
Eifel-Rur, Düren · Dipl.-Wirt. D. Hesselmann, Geschäftsführer<br />
des Rohrleitungsbauverbandes e.V., Köln · Dipl.-Ing. H.-J. Huhn,<br />
BASF AG, Ludwigshafen · Dipl.-Ing. B. Lässer, ILF Beratende Ingenieure<br />
GmbH, München · Dr. rer. pol. E. Löckenhoff, Geschäftsführer des<br />
Kunststoffrohrverbands e.V., Bonn · Dr.-Ing. R. Maaß, Mitglied des<br />
Vorstandes, FDBR Fachverband Dampfkessel-, Behälter- und Rohrleitungsbau<br />
e.V., Düsseldorf · Dipl.-Ing. R. Middelhauve, TÜV NORD<br />
Systems GmbH & Co. KG, Essen · Dipl.-Ing. R. Moisa, Geschäftsführer<br />
der Fachgemeinschaft Guss-Rohrsysteme e.V., Griesheim · Dipl.‐Berging.<br />
H. W. Richter, GAWACON, Essen · Dipl.-Ing. T. Schamer, Geschäftsführer<br />
der ARKIL INPIPE GmbH, Bottrop · Prof. Dipl.-Ing. Th. Wegener,<br />
Institut für Rohrleitungsbau an der Fachhochschule Oldenburg<br />
Prof. Dr.-Ing. B. Wielage, Lehrstuhl für Verbundwerkstoffe, Technische<br />
Universität Chemnitz-Zwickau · Dipl.-Ing. J. Winkels, Technischer<br />
Geschäftsführer der Salzgitter Mannesmann Line Pipe GmbH, Siegen<br />
und<br />
sind Unternehmen der
Clever kombiniert und<br />
doppelt clever informiert<br />
Auch als<br />
ePaper<br />
erhältlich!<br />
3r + gwf Wasser/Abwasser im Kombi-Angebot.<br />
Wählen Sie einfach das Bezugsangebot, das Ihnen zusagt: als Heft, ePaper oder Heft + ePaper!<br />
+<br />
<strong>3R</strong> erscheint in der Vulkan-Verlag GmbH, Huyssenallee 52-56, 45128 Essen<br />
gwf Wasser/Abwasser erscheint in der DIV Deutscher Industrieverlag GmbH, Arnulfstr. 124, 80636 München<br />
Wissen für DIe<br />
Zukunft<br />
Vorteilsanforderung per fax: +49 Deutscher 931 Industrieverlag / 4170-494 GmbH | Arnulfstr. oder 124 abtrennen | 80636 München und im fensterumschlag einsenden<br />
Ja, ich möchte clever kombinieren und bestelle für ein Jahr die Fachmagazine <strong>3R</strong> (8 Ausgaben)<br />
und gwf Wasser/Abwasser (11 Ausgaben) im attraktiven Kombi-Bezug.<br />
als Heft für € 556,25 zzgl. Versand (Deutschland: € 54,- / Ausland: € 63,-) pro Jahr.<br />
als ePaper (Einzellizenz) für € 556,25 pro Jahr.<br />
Für Schüler und Studenten (gegen Nachweis) zum Vorzugspreis<br />
als Heft für € 278,13 zzgl. Versand (Deutschland: € 54,- / Ausland: € 63,-) pro Jahr.<br />
als ePaper (Einzellizenz) für € 278,13 pro Jahr.<br />
firma/Institution<br />
Vorname, Name des empfängers<br />
Straße / Postfach, Nr.<br />
Land, PLZ, Ort<br />
Telefon<br />
Telefax<br />
Antwort<br />
Leserservice gwf<br />
Postfach 91 61<br />
97091 Würzburg<br />
e-Mail<br />
Branche / Wirtschaftszweig<br />
Bevorzugte Zahlungsweise Bankabbuchung rechnung<br />
Bank, Ort<br />
Widerrufsrecht: Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B.<br />
Brief, fax, e-Mail) oder durch rücksendung der Sache widerrufen. Die frist beginnt nach erhalt dieser Belehrung in Textform. Zur<br />
Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache an den Leserservice gwf, Postfach<br />
9161, 97091 Würzburg.<br />
Bankleitzahl<br />
Ort, Datum, Unterschrift<br />
Kontonummer<br />
PA3rIN0213<br />
nutzung personenbezogener Daten: für die Auftragsabwicklung und zur Pflege der laufenden Kommunikation werden personenbezogene Daten erfasst und gespeichert. Mit dieser Anforderung erkläre ich mich damit einverstanden, dass ich<br />
vom DIV Deutscher Industrieverlag oder vom Vulkan-Verlag per Post, per Telefon, per Telefax, per e-Mail, nicht über interessante, fachspezifische Medien und Informationsangebote informiert und beworben werde.<br />
Diese erklärung kann ich mit Wirkung für die Zukunft jederzeit widerrufen.