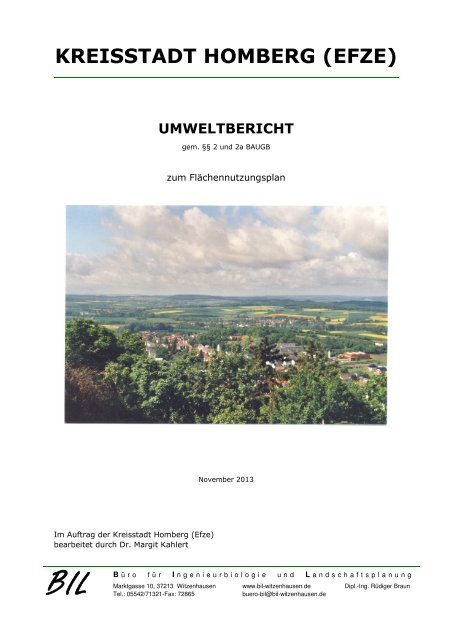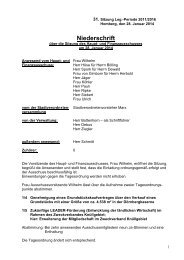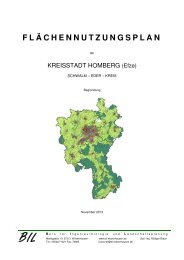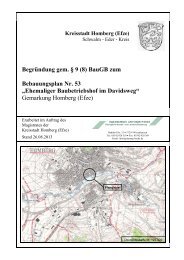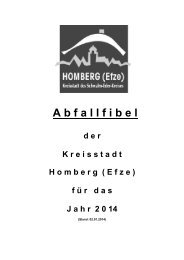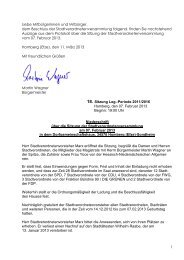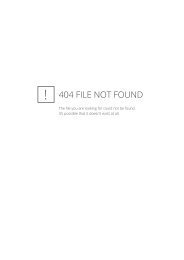Umweltbericht FNP Homberg - November 2013 - Homberg (Efze)
Umweltbericht FNP Homberg - November 2013 - Homberg (Efze)
Umweltbericht FNP Homberg - November 2013 - Homberg (Efze)
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
KREISSTADT HOMBERG (EFZE)<br />
UMWELTBERICHT<br />
gem. §§ 2 und 2a BAUGB<br />
zum Flächennutzungsplan<br />
<strong>November</strong> <strong>2013</strong><br />
Im Auftrag der Kreisstadt <strong>Homberg</strong> (<strong>Efze</strong>)<br />
bearbeitet durch Dr. Margit Kahlert<br />
B ü r o f ü r I n g e n i e u r b i o l o g i e u n d L a n d s c h a f t s p l a n u n g<br />
Marktgasse 10, 37213 Witzenhausen www.bil-witzenhausen.de Dipl.-Ing. Rüdiger Braun<br />
Tel.: 05542/71321-Fax: 72865<br />
buero-bil@bil-witzenhausen.de
K R E I S S T A D T H O M B E R G ( E F Z E )<br />
Um weltbericht zum Flächennutzungsplan<br />
Büro für<br />
Ingenieurbiologie und<br />
Landschaftsplanung<br />
Inhaltsverzeichnis<br />
S e i t e<br />
1 Beschreibung des Planungsinhaltes, Ziele der Bauleitplanung und<br />
Festsetzungen 3<br />
1.1 Inhalt und wichtige Ziele des Flächennutzungsplans 3<br />
1.2 Inhalte der Umweltprüfung 3<br />
2 Darstellung der in einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen<br />
festgelegten Ziele des Umweltschutzes und die Art und Weise der<br />
Berücksichtigung dieser Ziele 4<br />
2.1 Gesetzliche Grundlagen, Verordnungen und Richtlinien 4<br />
2.2 Schutzgebietsausweisungen 5<br />
2.3 Vorgaben von Fachplänen und bestehenden B-Plänen 8<br />
2.3.1 Darstellungen des Landschaftsrahmenplans 8<br />
2.3.2 Darstellungen des Landschaftsplans <strong>Homberg</strong> 2001 9<br />
2.3.3 Darstellungen des Regionalplans Nordhessen 2009 9<br />
2.3.4 Maßnahmenprogramm der Wasserrahmenrichtlinie 9<br />
2.3.5 Vorhandene Kompensationsflächen (im <strong>FNP</strong> dargestellt) 11<br />
2.3.6 Bisher in rechtsgültigen B-Plänen festgelegtes Monitoring 14<br />
3 Bestandsaufnahme und Beschreibung des Umweltzustandes der<br />
voraussichtlich erheblich beeinträchtigten Gebiete sowie der ermittelten<br />
voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen (Prognose,FFH-VP<br />
und Artenschutz) 17<br />
3.1 Methodisches Vorgehen der Umweltprüfung, Hinweise auf Schwierigkeiten 17<br />
3.2 Siedlungsflächen Zuwachs 18<br />
3.3 Windkraftstandorte (mit FFH-VP und Artenschutzprüfung) 37<br />
3.3.1 Ergebnisse der ornithologischen Gutachten – FFH-Verträglichkeits-prüfung 38<br />
3.3.2 Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 41<br />
4 Beschreibung der Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen<br />
Umweltauswirkungen 44<br />
5 Allgemeinverständliche Zusammenfassung 45<br />
6 Literatur und gesetzliche Grundlagen 46<br />
<strong>November</strong> <strong>2013</strong> Seite 2
K R E I S S T A D T H O M B E R G ( E F Z E )<br />
Um weltbericht zum Flächennutzungsplan<br />
Büro für<br />
Ingenieurbiologie und<br />
Landschaftsplanung<br />
1 Beschreibung des Planungsinhaltes, Ziele der Bauleitplanung<br />
und Festsetzungen<br />
1.1 Inhalt und wichtige Ziele des Flächennutzungsplans<br />
Die Erstellung des Flächennutzungsplans erfolgt unter den geänderten Rahmenbedingungen eines<br />
Rückgangs und einer Überalterung der Bevölkerung (demographischer Wandel) einerseits sowie gestiegener<br />
Anforderungen an die Erzeugung regenerativer Energien andererseits.<br />
Daraus folgt für die Flächennutzungsplanung:<br />
• Überprüfung der bisherigen Siedlungsplanung<br />
• Schwerpunktlegung auf die Ausweisung von gewerblichen Flächen und Sondergebieten<br />
• Großflächige Ausweisung von Flächen für regenerative Energien<br />
• Reduzierung der Wohnbauflächen.<br />
1.2 Inhalte der Umweltprüfung<br />
Für die Belange des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a BauGB wird gemäß § 2 Abs. 4<br />
BauGB eine Umweltprüfung durchgeführt, in der die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen<br />
der Vorhaben ermittelt und in einem <strong>Umweltbericht</strong> beschrieben werden.<br />
Es wird ein Überblick über die derzeit bestehenden Kompensationsmaßnahmen (Flächen mit rechtlicher<br />
Bindung) sowie über die in Bebauungsplänen festgelegten Monitoringmaßnahmen möglicher<br />
erheblicher Eingriffe gegeben.<br />
Ein Gesamtüberblick über alle vorhandenen B-Pläne und geplanten Vorhaben ist der Begründung zum<br />
<strong>FNP</strong> zu entnehmen.<br />
Zudem werden alle geplanten Vorhaben bezüglich ihrer Auswirkungen auf die Schutzgüter bewertet,<br />
es werden Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen vorgeschlagen und der notwendige Untersuchungsbedarf<br />
genannt.<br />
Zur Umweltprüfung der Windkraftnutzung wird auf die als Gutachten zum <strong>FNP</strong> erstellte Standortanalyse<br />
für die Windkraftnutzung verwiesen sowie auf die dazugehörende FFH-Vorprüfung bzw. FFH-<br />
Verträglichkeitsprüfung und den artenschutzrechtlichen Fachbeitrag.<br />
<strong>November</strong> <strong>2013</strong> Seite 3
K R E I S S T A D T H O M B E R G ( E F Z E )<br />
Um weltbericht zum Flächennutzungsplan<br />
Büro für<br />
Ingenieurbiologie und<br />
Landschaftsplanung<br />
2 Darstellung der in einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen<br />
festgelegten Ziele des Umweltschutzes und die Art und<br />
Weise der Berücksichtigung dieser Ziele<br />
2.1 Gesetzliche Grundlagen, Verordnungen und Richtlinien<br />
Im <strong>Umweltbericht</strong> müssen gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 sowie § 1a Abs. 2 und 3 BauGB verschiedene Umweltbelange<br />
berücksichtigt werden, die in der folgenden Tabelle aufgeführt sind.<br />
Tab. 1:<br />
Umweltbelange nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 sowie § 1a Abs. 2 und 3 BauGB<br />
Umweltbelange gemäß §§ 1 Abs. 6 Nr. 7 a) – i) und 1a<br />
Abs. 2 und 3 BauGB<br />
§ 1 Abs. 6 Nr. 7 a) BauGB:<br />
Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima<br />
und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie die Landschaft<br />
und die biologische Vielfalt.<br />
§ 1 Abs. 6 Nr. 7 b) BauGB:<br />
Erhaltungsziele und Schutzzweck der Gebiete von gemeinschaftlicher<br />
Bedeutung und der Vogelschutzgebiete im Sinne<br />
des Bundesnaturschutzgesetzes<br />
§ 1 Abs. 6 Nr. 7 c) BauGB:<br />
Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit sowie<br />
die Bevölkerung<br />
§ 1 Abs. 6 Nr. 7 d) BauGB:<br />
Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter<br />
§ 1 Abs. 6 Nr. 7 e) BauGB:<br />
Vermeidung von Emissionen sowie der sachgerechte Umgang<br />
mit Abfällen und Abwässern<br />
§ 1 Abs. 6 Nr. 7 f) BauGB:<br />
Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente<br />
Nutzung von Energie<br />
§ 1 Abs. 6 Nr. 7 g) BauGB:<br />
Darstellung von Landschaftsplänen sowie von sonstigen Plänen,<br />
insbesondere des Wasser-, Abwasser- und Immissionsschutzrechtes<br />
§ 1 Abs. 6 Nr. 7 h) BauGB:<br />
Einhaltung der bestmöglichen Luftqualität in Gebieten, in denen<br />
die durch Rechtsverordnung zur Erfüllung von bindenden Beschlüssen<br />
der Europäischen Gemeinschaft festgelegten Immissionsgrenzwerte<br />
nicht überschritten werden dürfen<br />
§ 1 Abs. 6 Nr. 7 i) BauGB:<br />
Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des<br />
Umweltschutzes nach a, c und d<br />
Zuzuordnendes Schutzgut / Kapitel<br />
- Schutzgut Tiere und Pflanzen<br />
- Schutzgut Boden<br />
- Schutzgut Wasser<br />
- Schutzgut Luft/Klima<br />
- Schutzgut Landschaftsbild<br />
- Schutzgut Tiere und Pflanzen (incl. biol.<br />
Vielfalt)<br />
- FFH-Verträglichkeitsuntersuchungen<br />
- Schutzgut Mensch<br />
- Schutzgut Kulturgüter/sonstige Sachgüter<br />
- Schutzgut Wasser<br />
- Schutzgut Boden<br />
- Schutzgut Klima/Luft<br />
- Schutzgut Mensch<br />
- Schutzgut Klima/Luft<br />
- Schutzgut Mensch<br />
Kap. 2.3.2<br />
- Schutzgut Klima/Luft<br />
- Schutzgut Mensch<br />
- Schutzgut Tiere und Pflanzen<br />
- Schutzgut Boden<br />
- Schutzgut Wasser<br />
- Schutzgut Luft/Klima<br />
- Schutzgut Landschaftsbild<br />
- Schutzgut Kulturgüter<br />
- Schutzgut Mensch<br />
<strong>November</strong> <strong>2013</strong> Seite 4
K R E I S S T A D T H O M B E R G ( E F Z E )<br />
Um weltbericht zum Flächennutzungsplan<br />
Büro für<br />
Ingenieurbiologie und<br />
Landschaftsplanung<br />
§ 1a Abs. 2 BauGB:<br />
Sparsamer und schonender Umgang mit Grund und Boden,<br />
Verringerung der zusätzlichen Flächeninanspruchnahme durch<br />
bauliche Nutzungen durch Nutzung der Möglichkeiten zur Wiedernutzbarmachung<br />
von Flächen, zur Nachverdichtung und<br />
anderer Maßnahmen zur Innenentwicklung<br />
§ 1a Abs. 2 BauGB:<br />
Vermeidung und Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beeinträchtigungen<br />
des Landschaftsbildes sowie der Leistungs- und<br />
Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes<br />
- Schutzgut Boden<br />
- Kap. 3.2<br />
Kap. 3.2<br />
Die Vorgaben des Umweltschadensgesetzes und der Umwelthaftungsrichtlinie sind zu beachten.<br />
2.2 Schutzgebietsausweisungen<br />
Tab. 2:<br />
Naturschutzgebiete<br />
Naturschutzgebiete<br />
Nr. NSG, Gemarkung Vegetation Größe Verordnung vom:<br />
1 Mosenberg<br />
2<br />
Schwärzwiesen bei<br />
Hülsa<br />
3 Eichelskopf<br />
Magerrasengesellschaft,<br />
Wachholderhutung, Felsgrusgesellschaft<br />
Feuchtwiesen, Seggenried,<br />
Quellflur, Bortsgrasrasen<br />
aufgelassener Steinbruch,<br />
ältestes NSG Hessens,<br />
Waldmeister-Buchenwald,<br />
Magerrasen<br />
65 ha<br />
15 ha<br />
2,36 ha<br />
01.Dezember 1986<br />
Staatsanzeiger 50/1986, S. 2490<br />
20. Juli 1983<br />
Staatsanzeiger 32/1983, S. 1624<br />
12.Juni 1967<br />
Staatsanzeiger 31/1967, S. 952<br />
Abb. 1:<br />
Lage des Vogelschutzgebietes 5022-401 Knüll<br />
<strong>November</strong> <strong>2013</strong> Seite 5
K R E I S S T A D T H O M B E R G ( E F Z E )<br />
Um weltbericht zum Flächennutzungsplan<br />
Büro für<br />
Ingenieurbiologie und<br />
Landschaftsplanung<br />
Abb. 2:<br />
Lage des FFH-Gebietes 4922-303 Standortübungsplatz <strong>Homberg</strong> (<strong>Efze</strong>)<br />
<strong>November</strong> <strong>2013</strong> Seite 6
K R E I S S T A D T H O M B E R G ( E F Z E )<br />
Um weltbericht zum Flächennutzungsplan<br />
Büro für<br />
Ingenieurbiologie und<br />
Landschaftsplanung<br />
Tab. 3:<br />
Ausgewiesene Naturdenkmale in <strong>Homberg</strong><br />
Kennziffer<br />
Bezeichnung, Art, Anzahl, Name des<br />
ND, Gemarkung<br />
Top.-Karte, Rechts-/ Hochwert<br />
ND 634.200 1 Pyramideneiche, <strong>Homberg</strong> TK 4922; R=35 28 10, H=56 55 05<br />
ND 634.201 1 Pyramideneiche, <strong>Homberg</strong> TK 4922; R=35 28 10, H=56 55 00<br />
ND 634.202 1 Linde, <strong>Homberg</strong> TK 4922; R=35 28 50, H=56 55 50<br />
ND 634.203 2 Linden, <strong>Homberg</strong> TK 4922; R=35 28 63, H=56 55 30<br />
ND 634.204 1 Zwillingsbuche, Allmuthshausen TK 5022; R=35 29 26, H=56 49 40<br />
ND 634.205 1 Buche, Allmuthshausen TK 5022; R=35 31 40, H=56 47 60<br />
ND 634.206<br />
Säulenbasaltklippen<br />
"Wichtelrain", Allmuthshausen<br />
TK 5022; R=35 31 15, H=56 47 12<br />
ND 634.207 1 Linde, Caßdorf TK 4922; R=35 25 97, H=56 54 02<br />
ND 634.208 1 Buche, Caßdorf TK 4922; R=35 24 28, H=56 53 27<br />
ND 634.209 1 Eiche, Caßdorf TK 4922; R=35 25 10, H=56 54 14<br />
ND 634.210 1 Linde, Caßdorf TK 4922; R=35 25 70, H=56 54 29<br />
ND 634.211 1 Linde, Caßdorf TK 4922; R=35 25 61, H=56 54 96<br />
ND 634.212 1 Linde, Caßdorf TK 4922; R=35 25 30, H=56 55 55<br />
ND 634.213 1 Linde, Dickerhausen TK 4922; R=35 32 18, H=56 58 39<br />
ND 634.214 1 Buche, Dickershausen TK 4922; R=35 32 81, H=56 59 21<br />
ND 634.215 1 Eiche, Lembach TK 4922; R=35 24 55, H=56 56 46<br />
ND 634.216 1 Eiche, Mörshausen TK 4922; R=35 30 63, H=56 58 03<br />
ND 634.217 1 Eiche, Mörshausen TK 4922; R=35 30 95, H=56 57 78<br />
ND 634.218 1 Linde, Mühlhausen TK 4922; R=35 25 39, H=56 56 82<br />
ND 634.219 1 Eiche, Rodemann TK 5022; R=35 29 60, H=56 51 08<br />
ND 634.220 1 Eiche, Sondheim TK 5022; R=35 27 16, H=56 50 42<br />
ND 634.221 1 Eiche, Sondheim TK 5022; R=35 27 78, H=56 49 84<br />
ND 634.222 1 Buche, Sondheim TK 5022; R=35 27 54, H=56 49 54<br />
ND 634.223 1 Linde, Waßmuthshausen TK 5022; R=35 29 05, H=56 51 36<br />
ND 634.224 1 Linde, Welferode TK 4922; R=35 31 65, H=56 55 16<br />
ND 634.225 1 Pyramideneiche, Wernswig TK 5022; R=35 25 50, H=56 51 05<br />
Tab. 4:<br />
Ausgewiesene Landschaftsschutzgebiete in <strong>Homberg</strong><br />
Nr. Landschaftsschutzgebiet Bemerkung Größe Verordnung vom<br />
1 LSG Schloßberg<strong>Homberg</strong> 17 ha 01.10.1975<br />
2<br />
LSG <strong>Efze</strong>tal zwischen Holzhausen und Relbehausen<br />
39 ha 10.08.1990<br />
3<br />
4<br />
5<br />
LSG Ziegenköpfchen<br />
Gem. Welferode<br />
LSG <strong>Efze</strong>pforte<br />
Gem. Mörshausen, Holzhausen,<br />
Welferode, Relbehausen, <strong>Homberg</strong><br />
Oberes Rinnetal<br />
Hülsa, Steindorf, Allmuthshausen,<br />
Rodemann<br />
aufgehoben,<br />
in LSG <strong>Efze</strong>pforte<br />
- 01.07.1970<br />
370 ha 20.12.1976<br />
2330 ha<br />
16.12.1975<br />
Staatsanzeiger<br />
19.12.1975<br />
vom<br />
<strong>November</strong> <strong>2013</strong> Seite 7
K R E I S S T A D T H O M B E R G ( E F Z E )<br />
Um weltbericht zum Flächennutzungsplan<br />
Büro für<br />
Ingenieurbiologie und<br />
Landschaftsplanung<br />
2.3 Vorgaben von Fachplänen und bestehenden B-Plänen<br />
2.3.1 Darstellungen des Landschaftsrahmenplans<br />
Im Landschaftsrahmenplan Nordhessen 2000 sind verschiedene Flächen ausgewiesen (siehe Tab 5):<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
freizuhaltende Räume aus Gründen des Landschaftsbildes oder des Klimaschutzes<br />
Pflegeräume 1. oder 2. Priorität<br />
Beeinträchtigungen<br />
Avifaunistisch wertvolle Bereiche<br />
Flächen für den Biotopverbund (in <strong>Homberg</strong> nur Einzelvorkommen).<br />
Zusätzlich sind als geologisch geschützte Objekte der Mosenberg (NSG, Nr. 15) sowie die Tongrube<br />
bei Remsfeld (Nr. 14) ausgewiesen. Der Knüll ist als Erholungsgebiet mit herausragender Bedeutung<br />
eingestuft. Der Ackeranteil an der landwirtschaftlichen Nutzfläche liegt bei 75-100 % und zeigt die guten<br />
Standortbedingungen für die Landwirtschaft sowie die intensive Nutzung insbesondere in Norden<br />
<strong>Homberg</strong>s an.<br />
Tab. 5: Ausweisungen des Landschaftsrahmenplans Nordhessen 2000<br />
Freizuhaltende Räume<br />
Nr. Bereich<br />
466 Tal der <strong>Efze</strong><br />
467 Katterbachtal<br />
468 Oberlauf der Rhünda zwischen Sippershausen und Ostheim<br />
469 Osterbachaue<br />
Tab. 6:<br />
Pflegeräume 1. oder 2. Priorität, F = freizuhaltende Bereiche<br />
Nr. Priorität Gebietsstruktur<br />
416 P II, F<br />
Hochfläche um Mörshausen, strukturreicher Bereich, Hecken, Ufergehölze, differenzierte<br />
landwirtschaftliche Nutzung, Beeinträchtigung Basaltabbau<br />
417 P II,<br />
Hochfläche um Bernshausen, durch Waldinseln strukturierter landwirtschaftlicher<br />
Bereich<br />
419 P I, F Ober- und Mittellauf der <strong>Efze</strong>, grünlandgeprägtes strukturreiches Tal<br />
421 P I, F Ohe-Bach und Zuläufe, strukturreiche Bachtäler, Waldwiesentäler<br />
422 P I, F Tal des Niederbachs; schmales durch Ufergehölze geprägtes Tal<br />
423 P I, F Rinnebachtal, strukturreichesTal, Ufergehölze, teils grünlandgeprägt<br />
424 P II, F<br />
Gebiet westlich von Steindorf, strukturreiche Grünlandfläche mit Waldinseln, Hecken,<br />
Ufergehölzen<br />
<strong>November</strong> <strong>2013</strong> Seite 8
K R E I S S T A D T H O M B E R G ( E F Z E )<br />
Um weltbericht zum Flächennutzungsplan<br />
Büro für<br />
Ingenieurbiologie und<br />
Landschaftsplanung<br />
Tab. 7:<br />
Beeinträchtigungen<br />
Nr. Bereich Beeinträchtigung Maßnahme<br />
414 Abbaufläche nordöstlich <strong>Homberg</strong><br />
415 Abbau östlich <strong>Homberg</strong> Landschaftsbild<br />
Landschaftsbild, Brut- und Rastgebiet<br />
Avifauna<br />
kein weiterer Abbau<br />
Einbindung in die<br />
Landschaft<br />
Tab. 8:<br />
AvifaunistischwertvolleBereiche<br />
Nr. Bereich Bedeutung<br />
71 Offenland bei Mühlhausen, Lembach, Lendorf rB, lR<br />
89 Knüllgebirge üB, rR<br />
96 Magerrasen östlich <strong>Homberg</strong> rB, lR<br />
rB = regional bedeutsames Brutgebiet, üB = überregional bedeutsames Brutgebiet, rR = regional bedeutsames<br />
Rastgebiet, lR = lokal bedeutsames Rastgebiet<br />
Tab. 9:<br />
Flächen für den Biotopverbund (in <strong>Homberg</strong> nur Einzelvorkommen)<br />
Nr. Bereich<br />
41 Mosenberg (NSG)<br />
97 Kleiner Mosenberg<br />
90 Drachenberg nördlich Mörshausen<br />
2.3.2 Darstellungen des Landschaftsplans <strong>Homberg</strong> (<strong>Efze</strong>) 2001<br />
An dieser Stelle wird auf den Landschaftsplan <strong>Homberg</strong> (<strong>Efze</strong>) aus dem Jahr 2000 verwiesen. Er stellt<br />
die naturräumlichen Grundlagen und die Schutzgüter ausführlich dar und zeigt die naturschutzfachlich<br />
notwendigen Maßnahmen in <strong>Homberg</strong> auf, die auch als Kompensationsmaßnahmen verwendet werden<br />
können. Der Landschaftsplan wird von der Stadt <strong>Homberg</strong> (<strong>Efze</strong>) in der Bauleitplanung als Datengrundlage<br />
genutzt und die dort gegebenen Vorgaben werden bei den einzelnen Projekten beachtet.<br />
Dies gilt auch für den hier vorliegenden <strong>Umweltbericht</strong> zum Landschaftsplan.<br />
2.3.3 Darstellungen des Regionalplans Nordhessen 2009<br />
Hierzu wird auf die Begründung zum Flächennutzungsplan verwiesen.<br />
2.3.4 Maßnahmenprogramm der Wasserrahmenrichtlinie<br />
Die Maßnahmen und die noch vorhandenen Wanderhindernisse, die in der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie<br />
aufgeführt sind, sind in der folgenden Tabelle zusammenfasst. Bei einigen Abstürzen<br />
<strong>November</strong> <strong>2013</strong> Seite 9
K R E I S S T A D T H O M B E R G ( E F Z E )<br />
Um weltbericht zum Flächennutzungsplan<br />
Büro für<br />
Ingenieurbiologie und<br />
Landschaftsplanung<br />
sind schon Maßnahmen zur Durchgängigkeit durchgeführt worden, diese wurden aber trotzdem nicht<br />
als passierbar eingestuft (siehe Anmerkungen). Insbesondere die Abstürze, die noch unpassierbar für<br />
die Aufwärtswanderung der Fische und des Makrozoobenthos sind, sollten im Rahmen des Programms<br />
„Naturnahe Gewässer“ durchgängig gemacht werden (bis zu 100 % Förderung).<br />
Tab. 10: Wanderhindernisse und Landbedarf für Maßnahmen gemäß dem Maßnahmenprogramm der WRRL<br />
in <strong>Homberg</strong> (Quelle: WRRL viewer Hessen)<br />
WRRL – Maßnahmenprogramm <strong>Efze</strong>: Gewässer 42888 - Wanderhindernisse<br />
Lage 100 m- Wanderhindernis Höhe Passierbarkeit<br />
Bemerkung<br />
Abschnitt<br />
m aufwärts/abwärts<br />
- 34nördl. Berge Kleiner Absturz 0,4 bedingt passierbar /passierbar<br />
- 44 südl. Berge Wehr, fest, rauhe<br />
Gleite, Rampe<br />
1,6 unpassierbar/bedingt passierbar<br />
- 70 südlich Mühl Absturztreppe, 0,4 unpassierbar/passierbar<br />
hausen<br />
kleiner Absturz<br />
- 103 öst. Caßdorf Wehr, fest, sehr 1,7 unpassierbar/bedingt passierbar<br />
Wasserkraftnutzung<br />
hoher Absturz<br />
- 135 östl. <strong>Homberg</strong> Rauhe Gleite 0,4 bedingt passierbar/passierbar<br />
- 138 westl. Holz Rauhe Gleite 0,5 bedingt passierbar/bedingt<br />
hausen<br />
passierbar<br />
- 141 Holzhausen Wehr, fest, sehr 1,8 weitgeh. unpassierbar/bed.<br />
Mitte<br />
hoher Absturz<br />
passierbar<br />
- 150 östl. Holz Wehr, fest, glatte 2,2 unpassierbar/bed. passierbar<br />
hausen<br />
Rampe<br />
- 167 Talmühle Wehr, fest, rauhe<br />
Bedingt passierbar/bedingt Wasserkraftnutzung<br />
Gleite<br />
passierbar<br />
WRRL Maßnahmenprogramm <strong>Efze</strong>: Gewässer 42888 –Bereitstellung von Flächen, Entwicklung naturnaher<br />
Strukturen<br />
Lage 100 m- Maßnahme Länge km Bemerkung<br />
Abschnitt<br />
- 44 bis – 86 Randstreifen und Flächen für Anlage von Auegewässern<br />
bei Mühlhausen<br />
0,4 Renaturierungsplanung<br />
„<strong>Efze</strong> vital“ der Stadt<br />
- 117 bis – 118 Flutmulde bei Hohlebachmühle 0,2<br />
- 149 bis – 175 Entwicklung naturnaher Strukturen zwischen<br />
Holzhausen und Relbehausen<br />
2,6<br />
WRRL – Maßnahmenprogramm Rinnebach: Gewässer 4288888 - Wanderhindernisse<br />
Lage 100 m-<br />
Abschnitt<br />
Wanderhindernis Höhe<br />
m<br />
Passierbarkeit<br />
aufwärts/abwärts<br />
- 2 Absturz 0,4 weitgehend unpassierbar<br />
/bedingt passierbar<br />
- 6 Massivsohle bedingt passierbar/bedingt<br />
passierbar<br />
- 7 hoher Absturz 0,6 weitgeh. unpassierbar /bed.<br />
passierbar<br />
- 12 sehr hoher Absturz 1,2 unpassierbar/weitgehend<br />
unpassierbar<br />
- 16 hoher Absturz 0,8 unpassierbar/unpassierbar<br />
- 19 Wehr, fest, glatte 1,4 unpassierbar/weitgehend<br />
Rampe<br />
unpassierbar<br />
- 32 hoher Absturz 0,8 unpassierbar/weitgehend<br />
unpassierbar<br />
- 39 Hoher Absturz 0,5 weitgeh. unpassierbar /bed.<br />
passierbar<br />
- 50 Massivsohle Bedingt passierbar/bedingt<br />
passierbar<br />
Bemerkung<br />
<strong>November</strong> <strong>2013</strong> Seite 10
K R E I S S T A D T H O M B E R G ( E F Z E )<br />
Um weltbericht zum Flächennutzungsplan<br />
Büro für<br />
Ingenieurbiologie und<br />
Landschaftsplanung<br />
- 52 Massivsohle bedingt passierbar/bedingt<br />
passierbar<br />
- 61 kleiner Absturz 0,2 weitgeh. unpassierbar /bed.<br />
passierbar<br />
- 64 Hoher Absturz 0,8 unpassierbar/unpassierbar<br />
- 65 Massivsohle, hoher<br />
Absturz<br />
0,3 weitgeh. unpassierbar /bed.<br />
passierbar<br />
- 70 Kleiner Absturz 0,3 bedingt passierbar/bedingt<br />
passierbar<br />
- 85 Kleiner Absturz 0,2 bedingt passierbar/bedingt<br />
passierbar<br />
- 140 Teich im HS, sehr 1,6 unpassierbar/unpassierbar<br />
hoher Absturz<br />
- 143 Verrohrung, Teich 2,2 unpassierbar/unpassierbar<br />
im HS, sehr hoher<br />
Absturz<br />
- 157 Verrohrung mit<br />
kleinem Absturz<br />
0,15 weitgeh. unpassierbar /bed.<br />
passierbar<br />
WRRL – Maßnahmenprogramm Niederbach: Gewässer 4288886 - Wanderhindernisse<br />
- 8 Hoher Absturz 0,7 weitgehend unpassierbar<br />
/bedingt passierbar<br />
- 17 Hoher Absturz 0,4 weitgehend unpassierbar<br />
/passierbar<br />
- 26 Verrohrung mit<br />
hohem Absturz<br />
0,4 unpassierbar/bedingt passierbar<br />
WRRL – Maßnahmenprogramm Rhünda: Gewässer 428896 - Wanderhindernisse<br />
- 130 Verrohrung in Dickershausen<br />
unpassierbar/bedingt passierbar<br />
Renaturierung in der Ortslage<br />
Rhünda notwendig!!<br />
- 129 Absturz hoch 0,4 unpassierbar/bedingt passierbar<br />
s.o.<br />
2.3.5 Vorhandene Kompensationsflächen (im <strong>FNP</strong> dargestellt)<br />
Tab. 11: Vorhandene Kompensationsflächen<br />
EXTERNE KOMPENSATIONSMAßNAHMEN (Servitutenverzeichnis)<br />
Nr. Gemarkung Flur Flurstück Maßnahme Größe Eingriff<br />
1 Allmuthshausen 8 17 Anlage Kräuterwiese Teilfläche<br />
2.867 m²<br />
Errichtung einer landwirtschaftlichen<br />
Halle zur Strohund<br />
Futterlagerung mit PV-<br />
Anlage-Aufbau<br />
2 Allmuthshausen 12 42 Anlage Kräuterwiese 4.000 m² Errichtung eines Reitplatzes<br />
3 Holzhausen 3 32 1 Anlage einer Wiesenbrache<br />
Teilfläche<br />
300 m²<br />
4 Holzhausen 3 32 1 Sukzession<br />
Teilfläche<br />
1.400 m²<br />
5 Holzhausen 2 12 4<br />
Teilfäche<br />
420 m²<br />
Bituminöse Befestigung der<br />
Zufahrt zur Thalmühle<br />
Ackerbauliche Nutzung v.<br />
Feldwegen<br />
<strong>November</strong> <strong>2013</strong> Seite 11
K R E I S S T A D T H O M B E R G ( E F Z E )<br />
Um weltbericht zum Flächennutzungsplan<br />
Büro für<br />
Ingenieurbiologie und<br />
Landschaftsplanung<br />
6 <strong>Homberg</strong> 8 54 7 Umwandlung in Extensivrasen<br />
Teilfläche<br />
insg. 1.150<br />
m²<br />
1. Aufstellung v. Dachflächen<br />
f. Solaranlage<br />
2. Erweiterung d. Filterraumgebäudes<br />
7 <strong>Homberg</strong> 8 54 9<br />
8 Hülsa 9 75 Umwandlung einer<br />
intensiv genutzten<br />
Wirtschaftswiese in<br />
eine extensiv genutzte<br />
Wirtschaftswiese<br />
8.566 m² 1. Errichtung eines Fahrsilos<br />
2. Errichtung eines Stallgebäudes<br />
3. Anbau einer Maschinenhalle<br />
9 Hülsa 10 36 2 Anlage Kräuterwiese 11.407 m² Neubau eines Jungviehstalles<br />
mit Vorgrube und Güllebehälter<br />
10 Lützelwig 3 17 1 Anlage eines Uferrandstreifens<br />
mit na-<br />
1.964 m²<br />
5.424 m²<br />
11 Lützelwig 3 30<br />
türlicher Sukzession<br />
12 Lützelwig 3 31 1 578 m²<br />
131 Lützelwig 3 37 1 302 m²<br />
14 Lützelwig 3 38 4.618 m²<br />
15 Lützelwig 3 41 484 m²<br />
16 Lützelwig 3 43 5 2.637 m²<br />
17 Lützelwig 3 51 1 694 m²<br />
18 Lützelwig 3 52 42 m²<br />
19 Lützelwig 3 53<br />
20 Mörshausen 1 83 45 Anlage einer Ackerbrache/<br />
Sukzessionsfläche<br />
59 m²<br />
Teilfäche<br />
2.000 m²<br />
21 Mörshausen 6 108 2 Anlage Wiesenbrache Teilfläche<br />
2.590 m²<br />
Neubau einer Biogasanlage<br />
mit Aufbereitung von Biogas<br />
in Erdgasqualität<br />
Neubau eines Boxenlaufstalles<br />
mit Fahrsiloanlage<br />
1. Errichtung eines Boxenlaufstalles<br />
für Milchvieh 2.<br />
Errichtung eines Güllebehälters<br />
und eines Fahrsilos<br />
22 Mühlhausen 2 103 Anlage einer extensiv<br />
genutzten Wiese<br />
Teilfäche<br />
1.000 m²<br />
1. Errichtung eines Schweinemaststalles<br />
2. Spiegelung<br />
des Stallbaus auf die<br />
andere Giebelseite<br />
3. Errichtung eines Güllebehälters<br />
23 Mühlhausen 2 142 Anlage einer Extensivwiese<br />
am <strong>Efze</strong>ufer<br />
Teilfläche<br />
500 m²<br />
Errichtung eines Maschineschuppens<br />
mit einer PV-<br />
Anlage<br />
24 Mühlhausen 3 2 1 Anlage einer Wiesenbrache<br />
Teilfäche<br />
1.900<br />
m²<br />
1. Errichtung eines Schweinemaststalles<br />
mit Güllebehälter<br />
2. Errichtung einer<br />
Futterlagerhalle mit drei<br />
Getreideaußensilos<br />
25 Mühlhausen 3 3 1<br />
Teilfläche<br />
<strong>November</strong> <strong>2013</strong> Seite 12
K R E I S S T A D T H O M B E R G ( E F Z E )<br />
Um weltbericht zum Flächennutzungsplan<br />
Büro für<br />
Ingenieurbiologie und<br />
Landschaftsplanung<br />
26 Sondheim 6 135 1<br />
27 Sondheim 6 135 2<br />
Umwandlung Acker zu<br />
einer Kräuterwiese<br />
28 Welferode 8 33 Anlage einer Kräuterwiese<br />
29 Wernswig 3 22 10 Aussaat einer Kräuterwiese<br />
1.900 m²<br />
1.000 m² Errichtung eines Reitplatzes<br />
840 m² Errichtung einer Mehrzweckhalle<br />
Teilfläche<br />
2.500 m²<br />
1. Neubau eines Güllebehälters<br />
2. Errichtung eines<br />
Fahrsilos<br />
30 Wernswig 9 22 Anlage einer extensiven<br />
Frischwiese mit<br />
Uferrandstreifen und<br />
Vernässungszone<br />
sowie Baumanpflanzungen<br />
31 Mühlhausen Renaturierung der<br />
<strong>Efze</strong>aue<br />
1.291 m² Anbau einer Mehrzweckhalle<br />
16,2 ha Anlage von Flutmulden,<br />
Hochstaudenflur, extensivebn<br />
Wiesen auf vorher<br />
intensiv genutzten landw.<br />
Flächen<br />
Hinweise zu Ausgleichsflächen<br />
Nr. Gemarkung Flur Flurstück Ausgleich<br />
1 Allmuthshausen 11 32<br />
2 Allmuthshausen 11 30<br />
3 Holzhausen 4 126,<br />
200<br />
u.232<br />
Anlage v. Dämmen aus Baumstämmen<br />
am Rinnebach (Projekt<br />
Biberdamm) Größe ?<br />
Anlage Streuobstwiese<br />
insg. ca.<br />
5.530<br />
m²<br />
4 Hülsa 8 69 Anlage v. 2 Amphibientümpel<br />
5 Waßmuthshausen 1 58 1<br />
6 Waßmuthshausen 1 58 2<br />
Renaturierung<br />
Rinnebach<br />
ca. 35 m²<br />
ca. 325 m²<br />
<strong>November</strong> <strong>2013</strong> Seite 13
K R E I S S T A D T H O M B E R G ( E F Z E )<br />
Um weltbericht zum Flächennutzungsplan<br />
Büro für<br />
Ingenieurbiologie und<br />
Landschaftsplanung<br />
2.3.6 Bisher in rechtsgültigen B-Plänen festgelegtes Monitoring<br />
An dieser Stelle wird ein Überblick über die derzeitigen Bebauungspläne gegeben, in deren <strong>Umweltbericht</strong><br />
ein Monitoring möglicher erheblicher Eingriffe festgelegt ist. Weiterhin werden die hierbei zu überprüfenden<br />
Vermeidungs-, Kompensations- und Gestaltungsmaßnahmen genannt, da deren nicht erfolgreiche<br />
Durchführung zu erheblichen Eingriffen der Maßnahme führen kann. Eine Gesamtüberblick<br />
über alle B-Pläne ist der Begründung zum <strong>FNP</strong> zu entnehmen.<br />
Tab. 12: In genehmigten B-Plänen festgelegte Monitoringmaßnahmen<br />
B-Plan<br />
Änderung Nr. 3 zur<br />
Änderung Nr. 1 zum B-<br />
Plan Nr. 13 für die<br />
Umsetzung des Parkraumkonzeptes<br />
im<br />
Bereich des Kreiskrankenhauses<br />
8. Änderung und Erweiterung<br />
Nr. 3 zum B-<br />
Plan Nr. 21 „Industriegebiet<br />
<strong>Homberg</strong> (<strong>Efze</strong>)<br />
Vermeidungs- , Kompensations- und<br />
Gestaltungsmaßnahmen<br />
Renaturierung des Rinnebachs in der Ortslage<br />
von Waßmuthshausen, 3. Bauabschnitt (Plangenehmigung<br />
vom 16.04.1998)<br />
Umbau des Wehres (Einbau einer Fischaufstiegsanlage)<br />
in der <strong>Efze</strong> Gemarkung Holzhausen<br />
Bau einer Fischaufstiegsanlage im Bereich der<br />
Wehranlage <strong>Efze</strong>/Mühlengraben in Holzhausen,<br />
Flur 5, Flurstück 331/1<br />
Vermeidung: Festsetzung von immissionswirksamen<br />
Schallleistungspegeln (IFSP).<br />
Vermeidung: Bei einem erfolgenden Ausbau<br />
der Straße sollen Amphibientunnel- und –<br />
leiteinrichtungen eingebaut werden, um die<br />
gefahrlose Querung der Ludwig-Erhard-Straße<br />
sicherzustellen. Zu diesem Zeitpunkt sollen<br />
auch neue Untersuchungen der Amphibien<br />
durchgeführt werden, um festzustellen, ob die<br />
Feuerlöschteiche noch als Lebensraum vorhanden<br />
sind (die Maßnahme somit überhaupt<br />
noch sinnvoll ist) und um die genaue fachliche<br />
Planung vornehmen zu können. Diese Maßnahme<br />
ist in einem öffentlich-rechtlichen Vertrag<br />
zwischen der Stadt <strong>Homberg</strong> (<strong>Efze</strong>) und<br />
der Unteren Naturschutzbehörde geregelt.<br />
Kompensation: Die Eingriffe durch die Erweiterung<br />
des Gewerbegebietes <strong>Homberg</strong> sollen<br />
durch Zuweisung des Bauabschnittes BA 2-C<br />
der Maßnahme „Renaturierung und Hochwasserschutz<br />
der <strong>Efze</strong>aue bei Mühlhausen“ kompensiert<br />
werden. Diese Kompensationsfläche<br />
hat eine Größe von rund 30.400 m². Sie umfasst<br />
Teile der Flurstücke 12, 13, 14 in der<br />
Gemarkung Caßdorf, Flur 5 sowie Teile der<br />
Flurstücke 264, 265, 268, 269, 272/1, 272/2,<br />
273-275, 278/1 und 278/2 in der Gemarkung<br />
<strong>Homberg</strong>, Flur 32.<br />
Gestaltung: Baumhecke B1 entlang der Rudolf-<br />
Diesel-Straße (10 m Breite)<br />
Baumhecke B2 entlang der nördlichen Grenze<br />
Monitoring durch Stadt<br />
Durchführung und Erfolgskontrolle<br />
Die Stadt informiert sich in geeigneten<br />
Zeitabständen bei der zuständigen<br />
Immissionschutzbehörde über die Einhaltung<br />
der IFSP.<br />
Die Stadt plant bzw. kontrolliert beim<br />
Ausbau der Ludwig-Erhard-Straße den<br />
Einbau der Amphibientunnel und -<br />
leiteinrichtungen und unterhält sie zur<br />
Sicherung der nachhaltigen Funktionsfähigkeit.<br />
Durchführung und Kontrolle der Renaturierungsmaßnahme<br />
BA 2-C an der<br />
<strong>Efze</strong>.<br />
Durchführung und Kontrolle der Eingrünung<br />
des Industriegebietes zeitnah<br />
zur Bebauung.<br />
<strong>November</strong> <strong>2013</strong> Seite 14
K R E I S S T A D T H O M B E R G ( E F Z E )<br />
Um weltbericht zum Flächennutzungsplan<br />
Büro für<br />
Ingenieurbiologie und<br />
Landschaftsplanung<br />
17. Änderung und 4.<br />
Erweiterung des B-<br />
Plans Nr. 21 „Industriegebiet<br />
<strong>Homberg</strong>“<br />
B-Plan Nr. 51 „Mühlhäuser<br />
Feld“ unter<br />
gleichzeitiger Änderung<br />
und Erweiterung<br />
Nr. 4 zum B-Plan Nr.<br />
11 und der Änderung<br />
der Änderung Nr. 5<br />
zum B-Plan Nr. 11<br />
<strong>Homberg</strong><br />
des Geltungsbereichs (10 m Breite)<br />
Baumhecke B 3 entlang des Entwässerungsgrabens<br />
in der Mitte des Plangebietes (8 m<br />
Breite beidseitig)<br />
Baumhecke B 4 entlang der Bundesstraße B<br />
254 (10 m Breite)<br />
Pflanzung von 20 großkronigen heimischen<br />
Laubbäumen (Hochstämme) im Bereich der<br />
neuen Erschließungsstraße.<br />
Vermeidung: Festsetzung von immissionswirksamen<br />
Schallleistungspegeln (IFSP).<br />
Vermeidung: Im Bereich des RRB verbleibt ein<br />
ungemähter bzw. nur einmal jährlich gemähter<br />
Randstreifen als Wanderkorridor für die Amphibien.<br />
Ausgleich: Die vorhandene Ausgleichsfläche<br />
hat eine Größe von 2,15 ha. Damit sie besser<br />
die Funktion als Wanderkorridor erfüllen kann,<br />
wird sie um 0,56 ha vergrößert und bis zum<br />
Bahndamm ausgedehnt. Als Nutzung wird eine<br />
einmalige Mahd angestrebt (ext. Frischwiese),<br />
alternativ wird die Fläche der Sukzession überlassen.<br />
Die vorhandene feuchte Ruderalfläche<br />
soll im bestehenden Umfang erhalten bleiben<br />
und sich sukzessiv entwickeln.<br />
Auf der ca. 2,0 ha großen Ausgleichsfläche<br />
östlich des Bahndamms, Gemarkung Sondheim<br />
Flur 9, Flurstücke Nr. 1/1 (teilw.), 3 (teilw.), 4/1<br />
(teilw.) und 49 werden Amphibienlaichgewässer<br />
gemäß Planung (BIL) angelegt.<br />
Weiterhin erfolgt die Pflanzung von 10 großkronigen<br />
heimischen Laubbäumen (Hochstämme)<br />
im Bereich der neuen Erschließungsstraße.<br />
Anlage eines naturnahen Regenrückhaltebeckens<br />
im Dauerstau (400 m 3 ).<br />
Im Bereich des immissionsschutzrechtlichen<br />
Radius um den Aussiedlerhof verbleibt eine<br />
große, bisher intensiv ackerbaulich genutzte<br />
Fläche, die mit zum Bebauungsgebiet gehört,<br />
aber nicht bebaut werden darf. Diese wird als<br />
Ausgleichsfläche genutzt (Eingrünung und<br />
Ortsrandgestaltung). Die Fläche hat eine Größe<br />
von 8.683 m 2 .<br />
Entlang der östlichen und südlichen Grenze des<br />
Neubaugebietes ist ein Streifen mit Pflanzbindung<br />
festgelegt worden im Umfang von insgesamt<br />
1.200 m 2 .<br />
Im Bereich des Parkplatzes werden mindestens<br />
2 großkronige Laubbäume angepflanzt.<br />
Auf dem Spielplatz werden ca. 8 großkronige<br />
Laubbäume angepflanzt. Als Abgrenzung zum<br />
Wohnbaugebiet wird eine Hainbuchenhecke<br />
(Länge 30 m) angepflanzt.<br />
Pflanzung von 22 großkronigen Laubbäumen<br />
Die Stadt informiert sich in geeigneten<br />
Zeitabständen bei der zuständigen<br />
Immissionschutzbehörde über die Einhaltung<br />
der IFSP.<br />
Kontrolle der Pflegemaßnahmen.<br />
Durchführung und Kontrolle<br />
Anlage der Amphibiengewässer.<br />
Durchführung und Kontrolle<br />
Die Stadt überwacht folgende mögliche<br />
Beeinträchtigungen:<br />
1. Verschärfung der Hochwassersituation<br />
an der <strong>Efze</strong>:<br />
Die Stadt erkundigt sich einmal jährlich<br />
bei der Unteren Wasserbehörde ob es<br />
an der <strong>Efze</strong> bei Mühlhausen zu einer<br />
verstärkten Hochwassersituation gekommen<br />
ist, die in Zusammenhang mit<br />
dem Neubaugebiet stehen kann.<br />
Die Gräben werden regelmäßig von der<br />
Stadt freigehalten und der Oberflächenabfluss<br />
dadurch gewährleistet.<br />
2. Mögliche Geruchsemissionen durch<br />
den Milchviehbetrieb Koch<br />
Die Stadt prüft einmal jährlich nach, ob<br />
Beschwerden wegen Belästigungen<br />
durch den landwirtschaftlichen Hof von<br />
den Bewohnern des Neubaugebietes<br />
bei der Stadt eingegangen sind.<br />
<strong>November</strong> <strong>2013</strong> Seite 15
K R E I S S T A D T H O M B E R G ( E F Z E )<br />
Um weltbericht zum Flächennutzungsplan<br />
Büro für<br />
Ingenieurbiologie und<br />
Landschaftsplanung<br />
innerhalb des Straßenraums des neuen Wohnbaugebietes,<br />
insbesondere innerhalb der breiteren<br />
als Kommunikationsraum ausgelegten<br />
Bereiche.<br />
3. Bepflanzungsmaßnahmen:<br />
Die Stadt kontrolliert ein Jahr nach der<br />
Baufertigstellung, ob die im B-Plan<br />
vorgesehenen Pflanzstreifen auf den<br />
Privatgrundstücken sowie im öffentlichen<br />
Raum angezeigt wurden und ob<br />
die Pflanzmaßnahmen durchgeführt<br />
wurden.<br />
Zuständig für die Überwachung ist das<br />
Bauamt der Stadt <strong>Homberg</strong>/<strong>Efze</strong>.<br />
B-Plan Nr. 52 “Sondergebiet<br />
Stellbergsweg“<br />
B-Plan Nr. 2 Allmuthshausen<br />
B-Plan Nr. 3 Allmuthshausen<br />
B-Plan Nr. 4 „Ausweisung<br />
eines Dorfgebietes<br />
nördlich der <strong>Homberg</strong>er<br />
Straße und<br />
östlich des Lerchenweges“<br />
in der Kreisstadt<br />
<strong>Homberg</strong>/<strong>Efze</strong>,<br />
Stadtteil Caßdorf<br />
B-Plan Nr. 6 Caßdorf<br />
B-Plan Nr. 7 Caßdorf<br />
Grünordnerische Maßnahmen zur Einbindung<br />
in das Ortsbild<br />
Gebot der Verwendung sickerfähiger Beläge für<br />
Stellflächen und Zufahrten.<br />
Bepflanzung entlang der Grundstücksgrenze.<br />
Einbau von Zisterne vorgeschrieben.<br />
Pflanzung von 15 hochstämmigen Obstbäumen,<br />
Flur 1, Flurstück 70/1 und Flur 5 Flurstück<br />
35/2 und 41/2 Gemarkung Allmuthshausen.<br />
Ökologischer Ausgleich durch Pflanzung einer<br />
Streuobstwiese im Ortsrandbereich<br />
Renaturierung der <strong>Efze</strong> auf einer Fläche von<br />
26.000 m 2 .<br />
Pflanzung von 16 hochstämmigen Obstbäumen<br />
(Streuobstwiese)<br />
Einbau von Zisternen<br />
Überwachung erheblicher Umweltauswirkungen<br />
durch Stadt.<br />
Kontrolle des Maß der baulichen Nutzung<br />
über das Bauantragsverfahren.<br />
Einbau der Zisternen überprüfen.<br />
Im Abstand von 3-5 Jahren überprüfen,<br />
ob Obstbäume dauerhaft fachgerecht<br />
erhalten und gepflegt werden.<br />
Die Obstbäume der Streuobstwiese<br />
sollen alle 5 Jahre auf Vollständigkeit,<br />
Gesundheit und Pflegezustand überprüft<br />
werden.<br />
Überwachung der Renaturierungsmaßnahme.<br />
Einbau der Zisternen überprüfen.<br />
Im Abstand von 3-5 Jahren überprüfen,<br />
ob Obstbäume dauerhaft fachgerecht<br />
erhalten und gepflegt werden und ihre<br />
Funktion der Eingrünung erfüllen.<br />
B-Plan Nr. 4 “Sondergebiet<br />
Photovoltaik“<br />
Hülsa<br />
- Über das Bauantragsverfahren wird<br />
das Maß der baulichen Nutzung und<br />
sonstige Festsetzungen kontrolliert.<br />
B-Plan Nr. 6 Waßmuthshausen<br />
Randliche Eingrünung des Baugebietes.<br />
Kontrolle des festgesetzten Einbaus<br />
von Zisternen.<br />
Alle 3-5 Jahre überprüfen, ob die Ausgleichspflanzungen<br />
ihre Funktion erfüllen.<br />
<strong>November</strong> <strong>2013</strong> Seite 16
K R E I S S T A D T H O M B E R G ( E F Z E )<br />
Um weltbericht zum Flächennutzungsplan<br />
Büro für<br />
Ingenieurbiologie und<br />
Landschaftsplanung<br />
3 Bestandsaufnahme und Beschreibung des Umweltzustandes<br />
der voraussichtlich erheblich beeinträchtigten Gebiete sowie<br />
der ermittelten voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen<br />
(Prognose, FFH-VP und Artenschutz)<br />
3.1 Methodisches Vorgehen der Umweltprüfung, Hinweise auf<br />
Schwierigkeiten<br />
Natur und Landschaft sind im Landschaftsplan beschrieben und bewertet. Die notwendigen Daten zu<br />
den Grundlagen der Schutzgüter sind somit dem Landschaftsplan zu entnehmen.<br />
Der Untersuchungsrahmen wird im Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange (Scoping)<br />
gemäß § 4 Abs. 1 mit den zuständigen Behörden abgestimmt. Die Schutzgüter im gesamten Gemeindegebiet<br />
wurden im Landschaftsplan <strong>Homberg</strong> (<strong>Efze</strong>) 2001 beschrieben und bewertet. Im <strong>Umweltbericht</strong><br />
zum <strong>FNP</strong> wird nur noch der Umweltzustand innerhalb der voraussichtlich erheblich beeinträchtigten<br />
Gebiete dargestellt. Die Datengrundlage ergibt sich aus dem Landschaftsplan, vorhandenen Fachgutachten<br />
sowie Kartierungen vor Ort.<br />
Die Schutzgüter werden einzeln betrachtet auf Grundlage vorhandener Daten (Landschaftsplan, vohandene<br />
Untersuchungen). Bewertet wird die Empfindlichkeit des Bestandes, die prognostizierten<br />
erheblichen Auswirkungen des Vorhabens auf die Schutzgüter sowie Wechselwirkungen mit anderen<br />
Schutzgütern, soweit dies im Rahmen der Flächennutzungsplanung schon möglich ist. Es werden Vorbelastungen<br />
und kumulative Wirkungen sowie die notwendigen Minimierungs- und Vermeidungsmaßnahmen<br />
dargestellt, um erhebliche Beeinträchtigungen zu minimieren oder zu vermeiden. Die Auswirkungen<br />
werden im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung, d.h. bei der Erstellung des Bebauungsplans<br />
bei Vorliegen der genauen Planung konkretisiert und neu bewertet. Die Möglichkeiten durch<br />
Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung von Beeinträchtigungen werden schon auf Ebene des<br />
<strong>FNP</strong> geprüft und Möglichkeiten zur Kompensation dargestellt. Auf einen weiteren Untersuchungsbedarf<br />
zur genauen Abschätzung erheblicher Auswirkungen wird hingewiesen.<br />
Als Schwierigkeit zur Bewertung der erheblichen Umweltauswirkungen wird auf den derzeit noch geringen<br />
Detaillierungsgrad der Vorhabensplanung und die teilweise fehlenden, zur genauen Einschätzung<br />
aber notwendigen Gutachten hingewiesen.<br />
<strong>November</strong> <strong>2013</strong> Seite 17
K R E I S S T A D T H O M B E R G ( E F Z E )<br />
Um weltbericht zum Flächennutzungsplan<br />
Büro für<br />
Ingenieurbiologie und<br />
Landschaftsplanung<br />
3.2 Siedlungsflächen Zuwachs<br />
(1) Vorhaben: Ausweisung von Sondergebieten für einen Solarpark im Bereich des ehemaligen<br />
Standortübungsplatzes <strong>Homberg</strong> (Fläche 2, 3 und 4) B-Plan Nr. 62 und<br />
Nr. 63 (Größe: 3,53 ha, 7,27 ha und 13,49 ha)<br />
Solarpark in 4 Teilflächen: B-Plan Nr. 61 (schon gültiger B-Plan, Fläche 1 Größe 17 ha), B-Plan Nr.<br />
62 (in Bearbeitung, Fläche 2 Größe 3,31 ha), B-Plan Nr. 63 (in Bearbeitung, Fläche 4 Größe 6,8 ha).<br />
Die Erschließung erfolgt durch die im B-Plan 61 schon genehmigte und ausgeglichene neue Zufahrt<br />
im Bereich westlich von Vissmann, es ist nur noch die innere Erschließung durch die geschotterten<br />
Stichwege ist auszugleichen.<br />
Lage am Rand des Vogelschutzgebietes 5022 Knüll und des FFH-Gebietes 4922.303 Standortübungsplatz<br />
<strong>Homberg</strong> (<strong>Efze</strong>). Es wurde im Jahr 2011 ein Avifaunistisches Gutachten von STÜBING<br />
zur Bewertung der Auswirkungen des Solarparks auf die Avifauna erarbeitet.<br />
Besondere Umweltziele<br />
Bau von Solaranlagen (Förderung der erneuerbaren Energien). Möglichst geringe Bodenversiegelung,<br />
weitere Nutzung des Grünlandes, Erhalt der Feldgehölze in denen Vögel brüten.<br />
Vorgaben anderer Fachplanungen<br />
Erhaltungsziele der Natura-2000-Gebiete beachten.<br />
Prüfung anderweitiger Planungsmöglichkeiten<br />
-<br />
Betroffenheit der Umweltaspekte/Schutzgüter<br />
Wohlbefinden des Menschen bzgl. Erholung/Landschaftsbild, Schutz vor Lärm u. Schadgasen<br />
Der Betrieb des Solarparks ist mit keinen Immissionen an Schadstoffen oder Lärm verbunden. Der<br />
geplante Solarpark liegt am Rand der nicht mehr genutzten Ostpreußenkaserne, die als Gewerbegebiet/Industriegebiet<br />
entwickelt werden soll. Weiterhin grenzt sie an den Bahndamm an und ist dadurch<br />
von der Wohnbebauung <strong>Homberg</strong>s optisch abgegrenzt. Im Westen grenzen die Bereiche des<br />
VSG-Gebietes mit Grünland und Wald an, die der Naherholung für <strong>Homberg</strong> dienen. Somit erfolgt<br />
eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes am Rande des Naherholungsgebietes, was durch eine<br />
Eingrünung minimiert werden kann. Im Fernbereich sind die Anlagen voraussichtlich aus höheren<br />
Bereichen (Schlossberg) sichtbar und stellen eine geringe Beeinträchtigung des Landschaftsbildes<br />
dar.<br />
Erneuerbare Energien<br />
Das Vorhaben dient der Erreichung der Klimaschutzziele der Bundesregierung durch Bereitstellung<br />
von regenerativer Energie.<br />
Boden<br />
Es erfolgt nur eine sehr geringe, nicht erhebliche Bodenversiegelung, da die Solartische auf mit Pfählen<br />
in die Erde eingelassenen Ständern installiert sind. Die Erschließung ist über die neue Zufahrt im<br />
B-Plan Nr. 61 schon gesichert, die inneren Schotterwege und Aufstellflächen für Wechselrichter verursachen<br />
nur eine geringe Neuversiegelung.<br />
Wasser<br />
Keine Beeinträchtigung<br />
Klima/Luft<br />
Keine Beeinträchtigung<br />
<strong>November</strong> <strong>2013</strong> Seite 18
K R E I S S T A D T H O M B E R G ( E F Z E )<br />
Um weltbericht zum Flächennutzungsplan<br />
Büro für<br />
Ingenieurbiologie und<br />
Landschaftsplanung<br />
Pflanzen/Tiere<br />
FFH- Natura 2000, Artenschutz § 22 und 44 BNatSchG<br />
Fauna: Brutvögel (Stübing, 2011), siehe beigefügte Karten Abb. 4<br />
Zwei Brutplätze des Baumpiepers innerhalb der randlichen Gehölze der Teilfläche 3 und 1 Brutplatz<br />
des Baumpiepers am Rand der Fläche 4.<br />
ein rufender Kuckuck in der Ostspitze der Teilfläche 4<br />
ein Grünspecht-Revier in der Ostspitze der Teilfläche 4<br />
Es werden keine erheblichen Beeinträchtigungen der Avifauna und damit der Erhaltungsziele des<br />
VSG erwartet (siehe beigefügtes Gutachten STÜBING, 2011), wenn die Vermeidungsmaßnahmen<br />
beachtet werden (siehe unten). Kuckuck und Grünspecht nutzten voraussichtlich auch die Solarflächen.<br />
Der Rotmilan jagt auch in der Solarfläche, falls er diese aber meidet, steht genug Ausweichraum<br />
zur Verfügung.<br />
Der Erhalt des Kammmolchs und der Gelbbauchunke ist Schutzziel des nahen FFH-Gebietes (Abb.<br />
5).Im FFH-Gebiet gibt es zahlreiche Tümpel als Habitate der genannten Arten. Am Rand aber außerhalb<br />
der Fläche 2 befindet sich eine alte Panzerwaschanlage, die von Kammmolchen besiedelt ist.<br />
Amphibien werden durch den Betrieb der Solaranlagen grundsätzlich nicht beeinträchtigt. Während<br />
der Bauphase mit erhöhtem LKW-Aufkommen muss allerdings auf die Wanderung der Amphibien<br />
geachtet werden, d.h. es müssen während des Baus am Rand der Straße zum FFH-Gebiet Amphibienschutzzäune<br />
errichtet werden (Ökologische Bauleitung und Betreuung notwendig).<br />
Vegetation:<br />
Auf Fläche 2 sind einige Gehölzbestände vorhanden und auch auf Fläche 4 gibt es einen alten Sportplatz,<br />
der von einem dichten Gehölz umrandet ist. Gemäß Kartierung sind auf Fläche 2 außer der<br />
Dorngrasmücke keine Brutvögel angesiedelt. Auf Fläche 4 sind die Wacholderdrossel und der Kuckuck<br />
vorhanden und der Baumpiper am Rand der Fläche.Das randliche Gebüsch mit dem Brutplatz<br />
des Baumpiepers muss erhalten bleiben. Eine Entfernung der anderen Gehölze ist bei entsprechendem<br />
Ausgleich dagegen nicht mit erheblichen Beeinträchtigungen verbunden. Fläche 3 weist verbuschenden<br />
Halbmagerrasen auf und soll nach der Planung nicht bebaut werden.<br />
Wechselwirkungen<br />
-<br />
Vorbelastungen, kumulative Wirkungen<br />
Aufgrund des angrenzenden schon ausgewiesenen Solarparks (B-Plan Nr. 61) entsteht eine große<br />
Solarfläche und eine kumulative Wirkung in Bezug auf die Sichtbarkeit im Fernbereich und damit auf<br />
das Landschaftsbild. Es ist zu beachten, dass in dem Gebiet nahe des VSG nun mehrere große Bauprojekte<br />
stattfinden, deren Eingriffe insbesondere in der Bauzeit durch eine ökologische Bauüberwachung<br />
minimiert werden sollten.<br />
Hinweise zur Vermeidung und Verringerung nachteiliger Auswirkungen<br />
In Bezug auf die Avifauna ist bei Berücksichtigung der folgenden vorgeschlagenen Einschränkungen<br />
für keine der festgestellten Arten eine erhebliche Beeinträchtigung der lokalen Population zu erwarten:<br />
Belassen der als Brutplatz genutzten Gehölze für Baumpieper, Feldsperling und Neuntöter<br />
(Fläche 4),<br />
Bauzeitbeschränkung im Umfeld der betroffenen Vorkommen von März bis Juli für Baumpieper,<br />
Neuntöter, Grau- und Grünspecht und Baumfalke,<br />
Installierung eines Amphibienschutzzauns während der Bauzeit.<br />
<strong>November</strong> <strong>2013</strong> Seite 19
K R E I S S T A D T H O M B E R G ( E F Z E )<br />
Um weltbericht zum Flächennutzungsplan<br />
Büro für<br />
Ingenieurbiologie und<br />
Landschaftsplanung<br />
Weitere Vermeidungsmaßnahmen:<br />
Niedrige Module und Begrünung zur Vermeidung von Eingriffen ins Landschaftsbild,<br />
Für Kleinsäuger durchlässige Gestaltung des Zaunes, d.h. kein Sockel, Bodenfreiheit 15 cm,<br />
Die Mindesthöhe der Module von 60 cm sorgt für ausreichende Besonnung der Bodenoberfläche,<br />
Rückbauverpflichtung mit Folgenutzung Landwirtschaft (städtebaulicher Vertrag),<br />
Dauerhafte Vegetationsdecke, extensive Wiese nach Einsaat (möglichst Schafbeweidung)<br />
oder Buntbrache,<br />
geringe Bodenversiegelung durch Wahl geständerter Anlagenteile.<br />
Hinweise zum Kompensationserfordernis für nachteilige Auswirkungen<br />
Die Kompensation dient insbesondere dem Ausgleich der Eingriffe in das Landschaftsbild und für die<br />
Entfernung der Gehölze. Es sollten Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen im FFH-Gebiet Standortübungsplatz<br />
<strong>Homberg</strong> in Zusammenarbeit mit dem Hessenforst entsprechend desvorhandenen Pflegeplans<br />
durchgeführt werden.<br />
Zusammenfassende Beurteilung der Auswirkungen/Verträglichkeit<br />
Bei Beachtung der Vermeidungsmaßnahmen und Durchführung der Ausgleichsmaßnahmen entstehen<br />
keine erheblichen nachhaltigen Beeinträchtigungen.<br />
Zusätzlicher Untersuchungsbedarf<br />
Zur Bewertung des Artenschutzes sind im Rahmen des B-Plan-Verfahrens Untersuchungen zu folgenden<br />
Arten beauftragt: Haselmaus, Reptilien, Vögel, Fledermäuse und Amphibien im Bereich Panzerwaschanlage.<br />
Genaue Untersuchungen der Beeinträchtigung des Landschaftsbildes erfolgen e-<br />
benfalls im Zuge des B-Plan-Verfahrens.<br />
Abb. 3: Sondergebiet Solarpark Fläche 1 (schon genehmigter B-Plan Nr. 61), Fläche 2, 3 und 4<br />
<strong>November</strong> <strong>2013</strong> Seite 20
K R E I S S T A D T H O M B E R G ( E F Z E )<br />
Um weltbericht zum Flächennutzungsplan<br />
Büro für<br />
Ingenieurbiologie und<br />
Landschaftsplanung<br />
<strong>November</strong> <strong>2013</strong> Seite 21
K R E I S S T A D T H O M B E R G ( E F Z E )<br />
Um weltbericht zum Flächennutzungsplan<br />
Büro für<br />
Ingenieurbiologie und<br />
Landschaftsplanung<br />
Abb. 4:<br />
Ergebnisse des avifauistischenGutachtens, 2011 (3 Karten)<br />
Abb. 5:<br />
Natis-Daten der FENA<br />
<strong>November</strong> <strong>2013</strong> Seite 22
K R E I S S T A D T H O M B E R G ( E F Z E )<br />
Um weltbericht zum Flächennutzungsplan<br />
Büro für<br />
Ingenieurbiologie und<br />
Landschaftsplanung<br />
(2) Vorhaben: Gewerbefläche Ostpreußenkaserne B-Plan Nr. 60 (Größe: 32,38 ha), sowie<br />
kleine Gewerbefläche neben der Ostpreußenkaserne (Größe 1,25 ha)<br />
Das Plangebiet umfasst die bebauten Bereiche der Ostpreußenkaserne (alte Gebäude wie auch Verkehrswege)<br />
sowie den bewaldeten Bereich zwischen den Teilflächen 2 und 3 des Solarparks mit der<br />
ehemaligen Schießanlage. Zwischen der Bebauung sind Gehölzbestände entwickelt. Das Gelände ist<br />
somit schon zu einem großen Teil versiegelt, weist aber auch Bereiche mit flächigen Gehölzbeständen<br />
auf. Geplant ist die Entwicklung zum überregionalen Gewerbegebiet. Hierzu erfolgt eine zusätzliche<br />
Versiegelung durch Bau- und Verkehrsflächen.<br />
Lage am Rand des Vogelschutzgebietes 5022 Knüll und des FFH-Gebietes 4922.303 Standortübungsplatz<br />
<strong>Homberg</strong> (<strong>Efze</strong>).<br />
Besondere Umweltziele:<br />
Erhalt der Gehölzbestände mit Vorkommen gefährdeter Vogelarten.<br />
Vorgaben anderer Fachplanungen<br />
Erhaltungsziele der Natura-2000-Gebiete beachten.<br />
Prüfung anderweitiger Planungsmöglichkeiten<br />
Die Planung stellt eine Nachnutzung des ehemaligen Kasernengeländes dar und ist daher notwendig<br />
und alternativlos.<br />
Betroffenheit der Umweltaspekte/Schutzgüter<br />
Wohlbefinden des Menschen bzgl. Erholung/Landschaftsbild, Schutz vor Lärm u. Schadgasen<br />
Das geplante Gewerbegebiet liegt am südlichen Ortsrand von <strong>Homberg</strong> (<strong>Efze</strong>) südlich der alten<br />
Bahnlinie. Es grenzt an das VSG weiter südwestlich an. Die nächste Mischbaufläche befindet sich in<br />
170 m Entfernung, die nächste Wohnbaufläche in 240 m Entfernung. Zwischen der Wohnbaunutzung<br />
und der geplanten Gewerbenutzung liegen der Bahndamm und ein Bereich, der als Sondergebiet<br />
Bund weiterhin ausgewiesen bleibt. Die Erschließung erfolgt über die K 36 und aus dem bestehenden<br />
Industriegebiet (B-Plan 21) über die neue geplante Zufahrt im Bereich der Solarfläche 1 (B-Plan 61).<br />
Eine Zufahrt durch die Stadt ist somit nicht notwendig.<br />
Es ist mit einer zusätzlichen Schadstoffbelastung zu rechnen. Bei Hauptwindrichtung aus Westen<br />
werden die Schadstoffe nach Osten verdriftet (<strong>Efze</strong>aue mit Thalmühle und Relbehausen) und in dem<br />
Bereich verdünnt, so dass eine Beeinträchtigung der nahe gelegenen Kernstadt, außer bei Südwindwetterlagen,<br />
die selten auftreten, nicht zu erwarten ist.<br />
Die Einhaltung der Lärmrichtwerte nach TA Lärm muss an den maßgeblichen Immissionspunkten<br />
(Misch- und Wohnbauflächen <strong>Homberg</strong>) gewährleistet sein. Dies erfolgt im Rahmen des B-<br />
Planverfahrens durch eine Schallprognose mit Festlegung von Schallleistungspegeln und Vergabe<br />
von Lärmkontingenten für verschiedene Bereiche des Gewerbegebietes.<br />
Eine zusätzliche Beeinträchtigung des Landschaftsbildes ist durch die Vornutzung (Vorbelastung<br />
Militärstandort) und die Lage südlich des mit Gehölzen bestandenen Bahndamms, der das Gebiet<br />
optisch von der Wohnbebauung abgegrenzt, relativ gering und ist auch aus der Fernsicht (z.B.<br />
Schlossberg) nicht zu erwarten. Um Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes und der Erholungsfunktion<br />
im angrenzenden Naherholungsgebiet (Bereich Ronneberg, FFH-Gebiet) zu minimieren,<br />
sollen soweit möglich bestehende Gehölze erhalten bleiben, bzw. wo notwendig eine hohe Baumhecke<br />
als Eingrünung entwickelt werden.<br />
Erneuerbare Energien<br />
Vorgaben des B-Plans: Zisternen, Solaranlagen auf Dächer (Ausrichtung der Gebäude dahingehend<br />
optimieren).<br />
<strong>November</strong> <strong>2013</strong> Seite 23
K R E I S S T A D T H O M B E R G ( E F Z E )<br />
Um weltbericht zum Flächennutzungsplan<br />
Büro für<br />
Ingenieurbiologie und<br />
Landschaftsplanung<br />
Boden<br />
Die zusätzliche Bodenversiegelung ist aufgrund der bestehenden Vornutzung geringer als bei einer<br />
kompletten Neuausweisung einer Gewerbefläche (Vermeidung). Die Neuversiegelung vermindert die<br />
Grundwasserneubildung und führt zum Verlust an Lebensraum für Tiere und Pflanzen.<br />
Wasser<br />
Keine Beeinträchtigung<br />
Klima/Luft<br />
Keine erhebliche Beeinträchtigung, nur evt. bei Südwind<br />
Pflanzen/Tiere<br />
FFH- Natura 2000, Artenschutz § 22 und 44 BNatSchG<br />
Fauna:<br />
Das avifaunistische Gutachten zu den Solaranlagen erfasst nur den zwischen den Teilflächen des<br />
Solarparks liegenden westlichen Randbereich des Gewerbegebietes. Er ist mit dichten Gebüschen<br />
bewachsen und beherbergt zwei Baumpieper-Reviere. Die Gehölze sollten daher auf jeden Fall erhalten<br />
bleiben. Die Gehölze im südlichen Teilbereich müssten bzgl. der Avifauna noch bewertet werden.<br />
Der Erhalt des Kammmolchs und der Gelbbauchunke ist Schutzziel des nahen FFH-Gebietes (Abb.<br />
5). Im FFH-Gebiet gibt es zahlreiche Tümpel als Habitate der genannten Arten. Im westlichen Bereich<br />
des geplanten Industriegebietes befindet sich eine alte Panzerwaschanlage, die von Kammmolchen<br />
besiedelt ist. Hierzu erfolgen noch Untersuchungen. Diese sollte – außerhalb der Laichzeit – entfernt<br />
und ein entsprechendes Ausgleichsgewässer angelegt werden.<br />
Während der Bauphase mit erhöhtem LKW-Aufkommen muss auf die Wanderung der Amphibien<br />
geachtet werden (ökologische Bauleitung notwendig). Da Wanderungen während des ganzen Jahres<br />
möglich sind, sollte in der Bauphase grundsätzlich ein Schutzzaun entlang der Straße zum FFH-<br />
Gebiet installiert werden. Dieser ist täglich von einem Fachmann zu betreuen.<br />
Vegetation:<br />
Die großflächigen Gehölzbestände innerhalb des westlichen Teilbereiches der Gewerbefläche sollten<br />
aufgrund ihrer ökologischen Wertigkeit für den Baumpieper erhalten bleiben. Bei Verlust müssen<br />
Ausgleichspflanzungen erfolgen. Die Fläche 3 soll aufgrund der hochwertigen Vegetation (Halbtrockenrasen,<br />
verbuschend) nach bisheriger Planung erhalten bleiben. Der großflächige Gehölzbestand<br />
im südlichen Teilbereich soll nach bisheriger Planung erhalten bleiben. Die Gehölzbestände zwischen<br />
den vorhandenen Gebäuden (Einzelbäume) können bei entsprechendem Ausgleich entfernt werden.<br />
Wechselwirkungen<br />
-<br />
Vorbelastungen, kumulative Wirkungen<br />
Vorbelastung durch ehemalige Kasernennutzung und durch angrenzende Solarflächen.<br />
Hinweise zur Vermeidung und Verringerung nachteiliger Auswirkungen<br />
Belassen der als Brutplatz genutzten Gehölze für Baumpieper und Neuntöter im westlichen<br />
Teil des Gewerbegebietes, evt. auch im südlichen Teil<br />
Belassen der alten Panzeranlage als Laichbiotop der Kammmolche oder Bau eines geeigneten<br />
naturnahen Laichgewässers an gleicher Stelle als Ausgleichsmaßnahme, dabei Entfernung<br />
und Entsiegelung der bestehenden Waschanlage.<br />
Bauzeitbeschränkung im Umfeld der betroffenen Vorkommen von März bis Juli für Baumpieper,<br />
Neuntöter und Amphibienwanderung (oder Schutzzaun).<br />
Innerhalb der stark befahrenen Bereiche des Gewerbegebietes sollen keine offenen Wasserflächen<br />
angelegt werden, wie Regenrückhaltebecken oder Feuerlöschteiche, um die Amphi-<br />
<strong>November</strong> <strong>2013</strong> Seite 24
K R E I S S T A D T H O M B E R G ( E F Z E )<br />
Um weltbericht zum Flächennutzungsplan<br />
Büro für<br />
Ingenieurbiologie und<br />
Landschaftsplanung<br />
bien nicht zum Laichen in die Bereiche zu locken und damit zu gefährden.<br />
Hohe Eingrünung und Durchgrünung des Industriegebietes.<br />
Hinweise zum Kompensationserfordernis für nachteilige Auswirkungen<br />
Die Kompensation dient dem Ausgleich von Neuversiegelung und Eingriffen durch Entfernung von<br />
Gehölzen. Es wird u.a. vorgeschlagen, die vorhandene Panzerwaschanlage außerhalb der Laichzeit<br />
zu entfernen und an gleicher Stelle ein neues Amphibiengewässer anzulegen. Weiterhin können<br />
Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen im FFH-Gebiet in Absprache mit dem Hessenforst und entsprechend<br />
dem vorhandenen Pflegeplan durchgeführt werden. Auch weitere Maßnahmen der <strong>Efze</strong>-<br />
Renaturierung sind als Kompensationsmaßnahme geeignet.<br />
Zusammenfassende Beurteilung der Auswirkungen/Verträglichkeit<br />
Bei Beachtung der Vermeidungsmaßnahmen und Durchführung der Ausgleichsmaßnahmen werden<br />
Eingriffe vermieden. Die zusätzlichen Eingriffe müssen ausgeglichen werden.<br />
Zusätzlicher Untersuchungsbedarf<br />
Ermittlung von Schallleistungspegeln. Es erfolgen noch faunistische Untersuchungen zur artenschutzrechtlichen<br />
Bewertung des Vorhabens (Fledermäuse in den bestehenden, teils offenen und ungenutzten<br />
Gebäuden, Reptilien, Haselmaus, Amphibien im Bereich der Panzerwaschanlage, Avifauna).<br />
Abb. 6:<br />
Gewerbefläche Ostpreußenkaserne sowie kleine Gewerbefläche neben der Ostpreußenkaserne,<br />
Darstellung des <strong>FNP</strong><br />
<strong>November</strong> <strong>2013</strong> Seite 25
K R E I S S T A D T H O M B E R G ( E F Z E )<br />
Um weltbericht zum Flächennutzungsplan<br />
Büro für<br />
Ingenieurbiologie und<br />
Landschaftsplanung<br />
Abb. 7:<br />
Lage des Gewerbegebietes Ostpreußenkaserne sowie kleine Gewerbefläche neben der Ostpreußenkaserne<br />
<strong>November</strong> <strong>2013</strong> Seite 26
K R E I S S T A D T H O M B E R G ( E F Z E )<br />
Um weltbericht zum Flächennutzungsplan<br />
Büro für<br />
Ingenieurbiologie und<br />
Landschaftsplanung<br />
(3) Vorhaben: Sondergebiet Reiten, Größe 1,25 ha<br />
Der vorhandene Reitplatz sowie eine derzeit als Pferdewiese genutzte Fläche und der vorhandene<br />
Pferdestall werden als Sondergebiet Reiten im <strong>FNP</strong> ausgewiesen. Damit wird der Bestand gesichert<br />
und der Bau von Gebäuden im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung oder eines Bauantrags<br />
ermöglicht. Die Fläche liegt unmittelbar an der <strong>Efze</strong>, sie ist rundherum mit Ufergehölzen oder mit<br />
hohen Baumhecken eingefasst.<br />
Besondere Umweltziele<br />
Erhalt der vorhandenen Gehölze, Einhaltung eines Schutzabstandes zum Gewässer.<br />
Vorgaben anderer Fachplanungen<br />
Die Vorgaben der Verordnung zum Überschwemmungsgebiet sind zu beachten.<br />
Prüfung anderweitiger Planungsmöglichkeiten<br />
-<br />
Betroffenheit der Umweltaspekte/Schutzgüter<br />
Wohlbefinden des Menschen bzgl. Erholung/Landschaftsbild, Schutz vor Lärm u. Schadgasen<br />
Durch die Ausweisung erfolgt keine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes oder der Erholungsnutzung<br />
im Gebiet.<br />
Erneuerbare Energien<br />
-<br />
Boden<br />
Ermöglicht wird eine zusätzliche Bodenversiegelung, die auszugleichen ist.<br />
Wasser<br />
Es muss ein Schutzabstand von mindestens 10 m von der <strong>Efze</strong> eingehalten werden. Dies ist schon<br />
durch den vorhandenen dichten und breiten Ufergehölzsaum aus standortgerechten Gehölzen gewährleistet.<br />
Es erfolgen somit keine Beeinträchtigungen.<br />
Klima/Luft<br />
Keine Beeinträchtigung<br />
Pflanzen/Tiere<br />
Die vorhandenen Gehölze (Ufergehölze, Baumhecke) sollen erhalten bleiben. Der Verlust an intensivem<br />
Grünland durch Versiegelung ist auszugleichen. Die Beeinträchtigungen sind bei Beachtung der<br />
Vermeidungsmaßnahmen relativ gering.<br />
Wechselwirkungen<br />
-<br />
Vorbelastungen, kumulative Wirkungen<br />
Bestand des Reitstalls<br />
Hinweise zur Vermeidung und Verringerung nachteiliger Auswirkungen<br />
Erhalt der vorhandenen Gehölze (Ufergehölze und Baumhecken)<br />
Hinweise zum Kompensationserfordernis für nachteilige Auswirkungen<br />
Kompensation der Neuversiegelung notwendig.<br />
<strong>November</strong> <strong>2013</strong> Seite 27
K R E I S S T A D T H O M B E R G ( E F Z E )<br />
Um weltbericht zum Flächennutzungsplan<br />
Büro für<br />
Ingenieurbiologie und<br />
Landschaftsplanung<br />
Zusammenfassende Beurteilung der Auswirkungen/Verträglichkeit<br />
Bei Beachtung der Vermeidungsmaßnahmen und Durchführung der Ausgleichsmaßnahmen entstehen<br />
keine erheblichen nachhaltigen Beeinträchtigungen.<br />
Zusätzlicher Untersuchungsbedarf<br />
-<br />
Abb. 8:<br />
Ausweisung des <strong>FNP</strong> Sondergebiet Reiten<br />
Abb. 9:<br />
Luftbild Bereich Sondergebiet Reiten<br />
<strong>November</strong> <strong>2013</strong> Seite 28
K R E I S S T A D T H O M B E R G ( E F Z E )<br />
Um weltbericht zum Flächennutzungsplan<br />
Büro für<br />
Ingenieurbiologie und<br />
Landschaftsplanung<br />
(4) Vorhaben: Sondergebiet Gewerbe Einzelhandel bei der Hohlebachmühle, Größe 0,8 ha<br />
Das vorhandene Gewerbegebiet (großflächiger Einzelhandel, Möbelgeschäft) soll erweitert werden.<br />
Die Erweiterungsflächen erstrecken sich westlich und nordöstlich der Hohlebachmühle und grenzen<br />
in Teilbereichen unmittelbar an Biotopflächen sowie an das Überschwemmungsgebiet der <strong>Efze</strong> an.<br />
Besondere Umweltziele<br />
Erhalt des Gehölzbestandes, Schutz des Gewässers vor Schadstoffeintrag.<br />
Vorgaben anderer Fachplanungen<br />
-<br />
Prüfung anderweitiger Planungsmöglichkeiten<br />
-<br />
Betroffenheit der Umweltaspekte/Schutzgüter<br />
Wohlbefinden des Menschen bzgl. Erholung/Landschaftsbild, Schutz vor Lärm u. Schadgasen<br />
Die Erweiterungsfläche ist schon aufgrund des vorhandenen Gehölzbestandes an der <strong>Efze</strong> gut eingegrünt.<br />
Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes sind nur in geringem Umfang zu erwarten.<br />
Erneuerbare Energien<br />
Im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung sollten Zisternen und Solaranlagen auf den Dachflächen<br />
vorgesehen werden.<br />
Boden<br />
Die Neuversiegelung ist weitestgehend zu minimieren und auszugleichen.<br />
Wasser<br />
Durch die Lage außerhalb des Überschwemmungsgebietes der <strong>Efze</strong> sind keine nachhaltigen Beeinträchtigungen<br />
der <strong>Efze</strong> zu erwarten. Durch den Erhalt der Gehölze bleibt ein weiterer Schutz vor Eintrag<br />
von Schadstoffen erhalten.<br />
Klima/Luft<br />
Keine Beeinträchtigung<br />
Pflanzen/Tiere<br />
Der ausgewiesene westliche Teilbereich der Erweiterungsfläche besteht aus Rasenfläche, begrenzt<br />
von einem alten Baumbestand, an den sich die im <strong>FNP</strong> ausgewiesene Biotopfläche (erweiterter alter<br />
Ufergehölzsaum) anschließt. Der nordöstliche Bereich besteht aus extensivem Grünland, das vom<br />
Rand her schon verbuscht sowie einer intensiv genutzten Ackerfläche. Dazwischen sowie in den<br />
Randbereichen stehen alte Baumhecken und Einzelgehölze.<br />
Die vorhandenen Gehölze sind als ökologisch hochwertig zu bewerten und sollten daher erhalten<br />
bleiben, insbesondere in den Randbereichen. Ein Verlust dieses alten Gehölzbestandes führt zu einem<br />
relativ hohen Ausgleichsbedarf. Auch das extensive Grünland ist als ökologisch hochwertig anzusehen<br />
und der Verlust muss ausgeglichen werden.<br />
Wechselwirkungen<br />
-<br />
Vorbelastungen, kumulative Wirkungen<br />
Das vorhandene Gewerbegebiet stellt eine Vorbelastung dar.<br />
Hinweise zur Vermeidung und Verringerung nachteiliger Auswirkungen<br />
Erhalt der Gehölzstrukturen, Minimierung der Neuversiegelung, keine Beanspruchung von Flächen<br />
im Überschwemmungsgebiet oder dem ausgewiesenen Biotop.<br />
<strong>November</strong> <strong>2013</strong> Seite 29
K R E I S S T A D T H O M B E R G ( E F Z E )<br />
Um weltbericht zum Flächennutzungsplan<br />
Büro für<br />
Ingenieurbiologie und<br />
Landschaftsplanung<br />
Hinweise zum Kompensationserfordernis für nachteilige Auswirkungen<br />
Hoher Kompensationsbedarf für den Verlust von extensivem Grünland und Gehölzen. Als Kompensation<br />
sollten diese Funktionen an anderer Stelle geschaffen werden (Extensivierung von Grünland,<br />
Ufergehölze anpflanzen).<br />
Zusammenfassende Beurteilung der Auswirkungen/Verträglichkeit<br />
Bei Beachtung der Vermeidungsmaßnahmen und Durchführung der Ausgleichsmaßnahmen entstehen<br />
keine erheblichen nachhaltigen Beeinträchtigungen. Die Grenze des Überschwemmungsgebietes<br />
und des Biotops darf nicht überschritten werden.<br />
Zusätzlicher Untersuchungsbedarf<br />
-<br />
Abb. 10: Ausweisung des Sondergebietes Gewerbe bei der Hohlebachmühle im <strong>FNP</strong><br />
Abb. 11: Lage des Sondergebietes Gewerbe bei der Hohlebachmühle<br />
<strong>November</strong> <strong>2013</strong> Seite 30
K R E I S S T A D T H O M B E R G ( E F Z E )<br />
Um weltbericht zum Flächennutzungsplan<br />
Büro für<br />
Ingenieurbiologie und<br />
Landschaftsplanung<br />
(5) Vorhaben: Sondergebiet Gewerbe Einzelhandel Norden, Größe 2,28 ha<br />
Das geplante Sondergebiet Einzelhandel schließt sich im Norden <strong>Homberg</strong>s westlich an die L 3224<br />
sowie an vorhandene Misch-, und Gewerbegebiete an. Es ist eine Erweiterung des Sondergebietes<br />
Einzelhandel, das östlich zwischen der L 3224 und der Umgehungsstraße angesiedelt ist. Die Fläche<br />
wird derzeit intensiv als Acker genutzt.<br />
Besondere Umweltziele<br />
Möglichst sparsamer Flächenverbrauch gemäß § 1a Abs. 2 BauGB.<br />
Vorgaben anderer Fachplanungen<br />
-<br />
Prüfung anderweitiger Planungsmöglichkeiten<br />
-<br />
Betroffenheit der Umweltaspekte/Schutzgüter<br />
Wohlbefinden des Menschen bzgl. Erholung/Landschaftsbild, Schutz vor Lärm u. Schadgasen<br />
Das geplante Sondergebiet liegt an der L3224 und erweitert das vorhandene Einzelhandelsgebiet<br />
nahe der Umgehungsstraße. Das Gebiet weist somit eine Vorbelastung auf und wird wenig zur Naherholung<br />
genutzt. Es ist schon gut verkehrlich angeschlossen, neue Erschließungsstraßen müssen<br />
nicht gebaut werden. Eine erhebliche Beeinträchtigung durch zusätzlichen Straßenverkehr oder durch<br />
Verlust an Erholungsraum ist daher nicht zu erwarten.<br />
Erneuerbare Energien<br />
Im B-Plan sollten Zisternen sowie Solarflächen auf den Dächern vorgesehen werden.<br />
Boden<br />
Als maßgeblicher Eingriff ist der Verlust an Grundwasserneubildung sowie an Lebensraum für Tiere<br />
und Pflanzen durch die Neuversiegelung festzustellen (Schutzgut Boden). Dieser Eingriff ist als erheblich<br />
zu werten und muss ausgeglichen werden.<br />
Wasser<br />
Keine Beeinträchtigung<br />
Klima/Luft<br />
Keine erhebliche Beeinträchtigung<br />
Pflanzen/Tiere<br />
Es werden keine wertvollen Biotopstrukturen beeinträchtigt. Es ist davon auszugehen, dass keine<br />
nach § 44 BNatSchG besonders oder streng geschützten Tiere und Pflanzen betroffen sind. Die Beeinträchtigung<br />
ist daher als relativ gering zu werten.<br />
Wechselwirkungen<br />
-<br />
Vorbelastungen, kumulative Wirkungen<br />
Umgehungsstraße und L 3224 (Schadstoffe, Beeinträchtigung der Erholungsfunktion).<br />
Hinweise zur Vermeidung und Verringerung nachteiliger Auswirkungen<br />
Sparsamer Flächenverbrauch z.B. durch Tiefgaragen und 2-geschössige Bauweise.<br />
Hinweise zum Kompensationserfordernis nachteiliger Auswirkungen<br />
Die Kompensation dient dem Ausgleich der Neuversiegelung (Schutzgut Boden). Hier muss ein ausreichender<br />
möglichst funktionaler Ausgleich erbracht werden.<br />
<strong>November</strong> <strong>2013</strong> Seite 31
K R E I S S T A D T H O M B E R G ( E F Z E )<br />
Um weltbericht zum Flächennutzungsplan<br />
Büro für<br />
Ingenieurbiologie und<br />
Landschaftsplanung<br />
Zusammenfassende Beurteilung der Auswirkungen/Verträglichkeit<br />
Bei Beachtung der Vermeidungsmaßnahmen und Durchführung der Ausgleichsmaßnahmen sind<br />
keine erheblichen nachhaltigen Beeinträchtigungen zu erwarten.<br />
Zusätzlicher Untersuchungsbedarf<br />
-<br />
Abb. 12: Ausweisung des Sondergebietes Einzelhandel im <strong>FNP</strong><br />
Abb. 13: Lage des Sondergebietes Einzelhandel im Norden <strong>Homberg</strong>s<br />
<strong>November</strong> <strong>2013</strong> Seite 32
K R E I S S T A D T H O M B E R G ( E F Z E )<br />
Um weltbericht zum Flächennutzungsplan<br />
Büro für<br />
Ingenieurbiologie und<br />
Landschaftsplanung<br />
(6) Vorhaben: Wernswig: Sondergebiet Altenheim , Größe 0,71 ha<br />
Die Erweiterung des vorhandenen Sondergebietes für betreutes Wohnen wurde im neuen <strong>FNP</strong> von<br />
der im alten <strong>FNP</strong> östlich angrenzenden Fläche auf die westlich angrenzende Fläche verlegt. Dies<br />
bedeutet eine bessere Ausnutzung innerörtlich liegender Flächen und damit eine bessere Ortsabrundung.<br />
Zudem wird die Fläche um 0,5 ha verkleinert. Die Fläche wird derzeit als intensive Ackerfläche<br />
genutzt.<br />
Besondere Umweltziele:<br />
Ortsabrundung, Nutzung des Innenbereichs<br />
Vorgaben anderer Fachplanungen<br />
-<br />
Prüfung anderweitiger Planungsmöglichkeiten<br />
-<br />
Betroffenheit der Umweltaspekte/Schutzgüter<br />
Wohlbefinden des Menschen bzgl. Erholung/Landschaftsbild, Schutz vor Lärm u. Schadgasen<br />
Das Altenwohnheim schließt an gleichwertige Nutzungsflächen an und liegt zudem innerhalb der bebauten<br />
Ortslage. Die Nutzung ist kaum mit einer erhöhten Verkehrsbelastung verbunden. Beeinträchtigungen<br />
der angrenzenden Wohnfunktion und der Erholungsfunktion sind daher nicht zu erwarten.<br />
Erneuerbare Energien<br />
Im B-Plan sollten Zisternen und Solaranlagen auf den Dachflächen festgelegt werden.<br />
Boden<br />
Durch die Bebauung erfolgt eine Neuversiegelung und der Verlust an Bodenfunktionen, was auszugleichen<br />
ist.<br />
Wasser<br />
Keine Beeinträchtigung<br />
Klima/Luft<br />
Keine Beeinträchtigung<br />
Pflanzen/Tiere<br />
Aufgrund der vorhandenen Nutzung als Acker sind keine ökologisch hochwertigen Biotoptypen betroffen.<br />
Es ist davon auszugehen, dass die Verbote des Artenschutzes nach § 44 BNatSchG eingehalten<br />
werden können.<br />
Wechselwirkungen<br />
-<br />
Vorbelastungen, kumulative Wirkungen<br />
Lage innerhalb der bebauten Ortslage.<br />
Hinweise zur Vermeidung und Verringerung nachteiliger Auswirkungen<br />
Vermeidung von Zersiedelung durch Nutzung von innerörtlichen Flächen.<br />
Hinweise zum Kompensationserfordernis nachteiliger Auswirkungen<br />
Die Kompensation dient dem Ausgleich der Neuversiegelung.<br />
Zusammenfassende Beurteilung der Auswirkungen/Verträglichkeit<br />
Bei Beachtung der Vermeidungsmaßnahmen und Durchführung der Ausgleichsmaßnahmen sind<br />
keine erheblichen nachhaltigen Beeinträchtigungen zu erwarten.<br />
<strong>November</strong> <strong>2013</strong> Seite 33
K R E I S S T A D T H O M B E R G ( E F Z E )<br />
Um weltbericht zum Flächennutzungsplan<br />
Büro für<br />
Ingenieurbiologie und<br />
Landschaftsplanung<br />
Zusätzlicher Untersuchungsbedarf<br />
-<br />
Abb. 14: Ausweisung des Sondergebietes Altenheim in Wernswig im <strong>FNP</strong><br />
Abb. 15: Lage des Sondergebietes Altenheim in Wernswig<br />
<strong>November</strong> <strong>2013</strong> Seite 34
K R E I S S T A D T H O M B E R G ( E F Z E )<br />
Um weltbericht zum Flächennutzungsplan<br />
Büro für<br />
Ingenieurbiologie und<br />
Landschaftsplanung<br />
(7) Vorhaben: Mischbaufläche Dickershausen<br />
Die geplante Mischbaufläche liegt zwischen vorhandener Bebauung des Dorfgebietes und stellt somit<br />
einen Lückenschluss dar. Die Fläche wird derzeit als Acker genutzt.<br />
Besondere Umweltziele:<br />
Geschlossene Bebauung, gute grünordnerische Einbindung des neuen Ortsrandes in die Landschaft.<br />
Vorgaben anderer Fachplanungen<br />
Die Zuwachsfläche wurde im Landschaftsplan <strong>Homberg</strong> schon bewertet (geringe Beeinträchtigung,<br />
Lückenschluss), als Kompensation wird die Renaturierung der Rhünda vorgeschlagen.<br />
Prüfung anderweitiger Planungsmöglichkeiten<br />
-<br />
Betroffenheit der Umweltaspekte/Schutzgüter<br />
Wohlbefinden des Menschen bzgl. Erholung/Landschaftsbild, Schutz vor Lärm u. Schadgasen<br />
Geringe zusätzliche Verkehrsbelastung durch neue Anwohner.<br />
Erneuerbare Energien<br />
Die Vorgaben des B-Plans sollten Zisternen und Solaranlagen beinhalten.<br />
Boden<br />
Die Neuversiegelung von Boden durch die Bebauung muss ausgeglichen werden.<br />
Wasser<br />
Keine Beeinträchtigung<br />
Klima/Luft<br />
Keine Beeinträchtigung<br />
Pflanzen/Tiere<br />
Es wird ausschließlich Acker beansprucht. Keine erhebliche Beeinträchtigung, da keine ökologisch<br />
hochwertigen Biotope beeinträchtigt werden.<br />
Wechselwirkungen<br />
-<br />
Vorbelastungen, kumulative Wirkungen<br />
Angrenzende Bebauung.<br />
Hinweise zur Vermeidung und Verringerung nachteiliger Auswirkungen<br />
Grünordnerische Maßnahmen zur Ortsrandgestaltung und zum Ausgleich (Obstwiese)<br />
Hinweise zum Kompensationserfordernis nachteiliger Auswirkungen<br />
Als Kompensation können Maßnahmen zur Eingrünung des neuen Ortsrandes durchgeführt werden,<br />
wie z.B. die Anlage einer Obstwiese. Insbesondere sollte aber auch die Renaturierung der Rhünda in<br />
der Ortslage (siehe Landschaftsplan) durchgeführt und als Kompensationsmaßnahme verwendet<br />
werden.<br />
Zusammenfassende Beurteilung der Auswirkungen/Verträglichkeit<br />
Bei Beachtung der Vermeidungsmaßnahmen und Durchführung der Ausgleichsmaßnahmen entstehen<br />
keine erheblichen nachhaltigen Beeinträchtigungen.<br />
Zusätzlicher Untersuchungsbedarf<br />
-<br />
<strong>November</strong> <strong>2013</strong> Seite 35
K R E I S S T A D T H O M B E R G ( E F Z E )<br />
Um weltbericht zum Flächennutzungsplan<br />
Büro für<br />
Ingenieurbiologie und<br />
Landschaftsplanung<br />
Abb. 16: Neues Wohnbaugebiet in Dickershausen, Darstellung des <strong>FNP</strong><br />
Abb. 17: Neues Wohnbaugebiet in Dickershausen, Lage<br />
<strong>November</strong> <strong>2013</strong> Seite 36
K R E I S S T A D T H O M B E R G ( E F Z E )<br />
Um weltbericht zum Flächennutzungsplan<br />
Büro für<br />
Ingenieurbiologie und<br />
Landschaftsplanung<br />
3.3 Windkraftstandorte (mit FFH-VP und Artenschutzprüfung)<br />
Im Rahmen der Standortanalyse zur Windkraftnutzung im gesamten Gemeindegebiet <strong>Homberg</strong> (<strong>Efze</strong>)<br />
erfolgte eine Überprüfung der „harten“ und „weichen“ Ausschlusskriterien gemäß RP Kassel für die<br />
Windkraftnutzung.<br />
Für die Fläche 036 Bielstein / Knüll wurde gemeinsam mit den Nachbarkommunen Schwarzenborn,<br />
Frielendorf und Neukirchen ein ornithologisches Sachverständigengutachten zu den für WEA maßgeblichen<br />
Arten nach den Vorgaben des RP und der Staatlichen Vogelschutzwarte (LAG-VSW, 2007) von<br />
STÜBING, 2012, sowie für den herbstlichen Vogelzug und den Kranichzug (STÜBING, <strong>2013</strong>) angefertigt.<br />
Weiterhin wurden die vorhandenen Daten der Grunddatenerhebung (STÜBING & KORN, Entwurf 2009)<br />
und des PNL-GUTACHTENS (2012) mit berücksichtigt. Außerhalb des Vogelschutzgebietes wurde ein<br />
1,0 km Schutzradius (Tabubereich) um die erfassten Horste von Rotmilan und Uhu gemäß den Vorgaben<br />
der Vogelschutzwarte (LAG-VSW, 2007) sowie ein 1,5 km Schutzradius um die Horste gemäß den<br />
Vorgaben der ONB im VSG als Prüfbereich angenommen. In diesem Prüfbereich muss anhand einer<br />
Raumnutzungsanalyse der Flugbewegungen der betroffenen Rotmilan- und Uhu-Brutpaare die Unerheblichkeit<br />
der Eingriffe überprüft werden. Die Raumnutzungsanalysen liegen noch nicht vor, sodass<br />
eine abschließende Bewertung der Erheblichkeit der Eingriffe derzeit nicht für alle Standorte erfolgen<br />
kann. Dies ist in der beigefügten FFH-Verträglichkeitsprüfung zum <strong>FNP</strong> genau dargestellt. Die entsprechenden<br />
Untersuchungen sollen im Jahr <strong>2013</strong> (März bis August) durchgeführt werden.<br />
In der Standortanalyse wurden vier Potentialflächen ermittelt, wobei zunächst eine aus naturschutzfachlichen<br />
Gründen entfällt. Eine genaue Beschreibung der Flächen ist der Standortanalyse zu entnehmen.<br />
Hier werden nur noch die Ergebnisse der FFH-Verträglichkeitsprüfung dargestellt, weiterhin<br />
erfolgt eine Artenschutzrechtliche Prüfung, soweit dies mit dem derzeitigen Untersuchungsumfang<br />
möglich.<br />
Folgende Windstandorte werden noch weiter überprüft:<br />
Fläche<br />
Nr.<br />
Bezeichnung<br />
m/s (Cube)<br />
Windgeschwindigkeit<br />
Windgeschwindigkeit<br />
m/s RP Karte<br />
Ertrag<br />
MWh/a<br />
% Referenzertrag<br />
Ziegenköpfchen 6,0 bis 6,6 5,5 bis 5,75 4200-5400 70-90 %<br />
HR_036 Bielstein (VSG) 6,2 bis 7,0 5,75 bis 6,0 4200-5800 75-95 %<br />
HR_019 Batzenberg 5,8 bis 6,2 5,5 bis 5,75 3800-4600 70-75 %<br />
<strong>November</strong> <strong>2013</strong> Seite 37
K R E I S S T A D T H O M B E R G ( E F Z E )<br />
Um weltbericht zum Flächennutzungsplan<br />
Büro für<br />
Ingenieurbiologie und<br />
Landschaftsplanung<br />
3.3.1 Ergebnisse der ornithologischen Gutachten – FFH-Verträglichkeitsprüfung<br />
Brutvögel, STÜBING, 2012<br />
Das südliche Gemeindegebiet von <strong>Homberg</strong> (<strong>Efze</strong>) liegt im VSG Knüll. Das Gebiet ist charakterisiert<br />
durch großflächige Buchen- und Fichtenwälder, die mit grünlandgeprägtem Offenland verzahnt sind.<br />
Es handelt sich um eines der fünf besten Gebiete für Brutvogelarten des Anhangs I und Zugvögel nach<br />
Art. 4 Abs. 2 VSR in Hessen.<br />
Die Grunddatenerhebung des RP Kassel von STÜBING & KORN von 2009 liegt derzeit im Entwurf vor.<br />
Im Jahr 2012 wurden ergänzende Kartierungen durchgeführt, die sich an den EMPFEHLUNGEN DER<br />
STAATLICHEN VOGELSCHUTZWARTE HESSEN, RHEINLAND-PFALZ UND SAARLAND vom 05.05.2007 orientieren.<br />
Im April 2012 sowie im Mai und Juni 2012 (4 Begehungen) wurden die Großvögel mit Tabu-<br />
Radien nach LAG-VSW jeweils in den Eignungsflächen und im Radius von 2 km aufgenommen. Erfasst<br />
wurden somit der Rot- und Schwarzmilan und die Flugbewegungen des Schwarzstorches. Zusätzlich<br />
wurde im Juli 2012 das Vorkommen von Baumfalke und Wespenbussard erfasst. Weiterhin<br />
wurden die maßgeblichen Eulen und Spechte jeweils in den Eignungsflächen mittels Klangattrappe mit<br />
4 Begehungen im April/Mai erfasst. Die Ergebnisse (Horste mit Abstandsradien) sind auch in Plan 2<br />
der Standortanalyse dargestellt. Das ornithologische Sachverständigengutachten liegt in der Anlage<br />
bei.<br />
Im Entwurf der Planung wurde den Empfehlungen der Vogelschutzwarte gefolgt und ein Abstand von<br />
1.000 m um die Horste des Rotmilans und des Uhus als Tabubereich für WEA (LAG-VSW, 2007) eingehalten.<br />
Auf Grundlage des Leitfadens „Berücksichtigung der Naturschutzbelange bei der Planung<br />
und Genehmigung von Windkraftanlagen (WKA) in Hessen“ des HESSISCHEN MINISTERIUMS FÜR UM-<br />
WELT, ENERGIE, LANDWIRTSCHAFT UND VERBRAUCHERSCHUTZ vom 29.11.2012 ist innerhalb des Vogelschutzgebietes<br />
ein Abstand von 1,5 km Radius um den Horst einzuhalten.<br />
Ergebnisse der FFH-Verträglichkeitsprüfung<br />
Die FFH-Verträglichkeitsprüfung betrachtet die Auswirkungen, die sich durch die Bauleitplanung zur<br />
Ausweisung von Windstandorten in <strong>Homberg</strong> (<strong>Efze</strong>) auf die Schutzziele der Natura-2000-Verordnung<br />
zum VSG „Knüll“ ergeben. Es werden auch die kumulativen Auswirkungen aus den Planungen zur<br />
Ausweisung von Windparks in den Nachbargemeinden betrachtet (siehe Anlage).<br />
Außerhalb des VSG sind durch die Einhaltung des Schutzradius von 1,0 km um die Horste von windkraftempfindlichen<br />
Brutvogelarten (Tabufläche) schon wesentliche Vermeidungsmaßnahmen getroffen<br />
worden. Es sind somit für die Fläche HR_19 Batzenberg und die Fläche Ziegenköpfchen keine<br />
erheblichen Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele des VSG Knüll zu erwarten.<br />
Im VSG dagegen sind die Bereiche der Windstandorte innerhalb des Schutzbereiches von 1,0 bis 1,5<br />
km um die Horste noch weiter zu überprüfen. Hier kann derzeit die Erheblichkeit des Eingriffes nicht<br />
<strong>November</strong> <strong>2013</strong> Seite 38
K R E I S S T A D T H O M B E R G ( E F Z E )<br />
Um weltbericht zum Flächennutzungsplan<br />
Büro für<br />
Ingenieurbiologie und<br />
Landschaftsplanung<br />
abschließend bewertet werden. Es müssen zunächst die Ergebnisse der durchzuführenden Raumnutzungsanalysen<br />
für die betroffenen Brutvogelpaare (Uhu und Rotmilan) ausgewertet werden. Dies<br />
betrifft die Fläche HR_36 Bielstein komplett.<br />
Raumnutzungsanalysen müssen ausgewertet werden für:<br />
Fläche HR_036 Bielstein:<br />
- für das Brutpaar Rotmilan am Hülsaer Köpfchen<br />
- für das Brutpaar Rotmilan nördlich des Waldknüll<br />
- für das Brutpaar Uhu im Steinbruch Bilsteinkopf<br />
Zusätzlich sind die weiteren dargestellten Maßnahmen zur Vermeidung und zum Ausgleich im Rahmen<br />
der Detailplanung zu beachten. Dies betrifft insbesondere den Schutz von Altholzbeständen und<br />
strukturreichem Buchenwald sowie von Höhlenbäumen mit einem ausreichenden Schutzabstand.<br />
Vogelzug, STÜBING, <strong>2013</strong><br />
Der herbstliche Vogelzug im Bereich des Knüllköpfchens wurde im Herbst 2012 an acht Tagen, von<br />
denen einer infolge ungünstiger Witterung kein Zuggeschehen aufwies, mit zwei Beobachtern über<br />
einen Zeitraum von insgesamt 56 Stunden erfasst (STÜBING, <strong>2013</strong>). Die Erfassung des allgemeinen<br />
Zuggeschehens während des Aktivitätsmaximums der meisten Arten in den ersten vier Stunden nach<br />
Sonnenaufgang stand im Vordergrund. Die Erfassungsmethode ist ausführlich im beigefügten Gutachten<br />
von STÜBING, <strong>2013</strong> erläutert, die Zugrouten sind in einer Karte dargestellt.<br />
Tab. 13: Termine der repräsentativen Exkursionen zur Zugvogelerfassung Herbst 2012.<br />
Datum Schwerpunkt Zähler<br />
13.09.2012 Zugvogelkontrolle C. Gelpke, S. Thorn<br />
22.09.2012 Zugvogelkontrolle C. Gelpke, S. Thorn<br />
26.09.2012 Zugvogelkontrolle C. Gelpke, S. Thorn<br />
03.10.2012 Zugvogelkontrolle C. Gelpke, S. Thorn<br />
10.10.2012 Zugvogelkontrolle C. Gelpke, S. Thorn<br />
18.10.2012 Zugvogelkontrolle C. Gelpke, S. Thorn<br />
26.10.2012 Kranichzug Christian Gelpke<br />
27.10.2012 Kranichzug Christian Gelpke<br />
31.10.2012 Zugvogelkontrolle C. Gelpke, S. Thorn<br />
14.11.2012 Kranichzug Christian Gelpke<br />
Bezüglich des Kranichzuges wurden drei separate Erhebungen im Untersuchungsgebiet mit einem<br />
Aufwand von 15 h sowie ergänzend eine umfangreiche Datenrecherche durchgeführt, um die Situation<br />
des Kranichzuges im Betrachtungsraum realistisch abbilden zu können. Die Erfassung erfolgte an<br />
starken Zugtagen der Art. Die beobachteten Kraniche wurden mit ihren Routen sowie Anzahl und Uhrzeit<br />
notiert. Aus diesen Daten und auch aus Meldungen anderer Jahre wurden besonders intensiv<br />
<strong>November</strong> <strong>2013</strong> Seite 39
K R E I S S T A D T H O M B E R G ( E F Z E )<br />
Um weltbericht zum Flächennutzungsplan<br />
Büro für<br />
Ingenieurbiologie und<br />
Landschaftsplanung<br />
überflogene Bereiche abgeleitet. Sehr starker Kranichzug im Untersuchungsgebiet fand vor allem am<br />
26. und 27.10.2012 statt. An den Tagen der Zug- und Kranichkontrollen wurde zudem das Rastgeschehen<br />
im Untersuchungsgebiet mit insgesamt 20 h erfasst.<br />
Grundsätzlich findet der Vogelzug als Breitfrontzug statt, kann also überall beobachtet werden. Aufgrund<br />
der landschaftlichen Struktur kann es aber zu Verdichtungen kommen. So bevorzugen in den<br />
Mittelgebirgen die ziehenden Vögel am Tag geschützte, in Zugrichtung führende Täler, Einschnitte<br />
oder Waldränder. Mit insgesamt 29.137 Durchzüglern aus 49 Arten und einem Durchschnitt von 1.005<br />
Individuen pro Stunde wurde ein überdurchschnittliches Zuggeschehen erfasst. Der Vogelzug verläuft<br />
aufgrund der Landschaftsstruktur vor allem entlang der Routen 2 und 4 und bündelt sich im Bereich<br />
der Fläche Bielstein mit den Routen 1 bis 3 und mehr als zwei Dritteln der insgesamt erfassten Durchzüglerzahlen<br />
(Karte mit den Routen liegt dem Gutachten STÜBING, <strong>2013</strong> bei). Mit mehr als 20.000<br />
Durchzüglern treten hier etwa zwei Drittel des Vogelzugs im Untersuchungsgebiet auf, was aufgrund<br />
des Verlaufs des Rinnebach-Tals auch topografisch plausibel ist. Die Durchzügler folgen der Senke<br />
des Rinnebach-Tals von Hülsa kommend nach Südwesten. Aufgrund der hier festgestellten Zugverdichtung<br />
ist eine Errichtung von WEA im Bereich Bielstein aus Zugvogelsicht also im Bereich des<br />
Standortes HR_36 Bielstein nicht zu empfehlen (STÜBING, <strong>2013</strong>).<br />
Die Erfassung des Kranichzuges ergab am 26.10. etwa 6.670 und am 27.10. ca. 6.320 Kraniche, die<br />
den Bereich des Knüllköpfchens sowie die bis zu 5 km nach Norden und Süden angrenzenden Flächen<br />
überflogen. Am 14.11. waren es 1.212 Tiere, insgesamt also 14.202 Kraniche. Der konkrete Verlauf<br />
des Durchzuges kann von Jahr zu Jahr anders sein, insgesamt ist aber ein hohes Durchzugsaufkommen<br />
im Gebiet dokumentiert. Dabei hat das Knüllköpfchen eine große Bedeutung als Landmarke<br />
bei der Orientierung der ziehenden Kraniche. Da die Kraniche bevorzugt sehr hoch fliegen (200 bis<br />
1.000 m) kommt es überwiegend nur bei ungünstigen Witterungsverhältnissen zu Konflikten mit WEA.<br />
Am Knüllköpfchen kompensieren sie das ansteigende Gelände aber relativ wenig. Da aber auch ein<br />
ausgeprägtes Meideverhalten zu beobachten ist, ist das Kollisionsrisiko auch in diesen Ausnahmesituationen<br />
als gering einzustufen, es sind nur sehr wenige Kollisionen bekannt. Trotzdem empfiehlt STÜ-<br />
BING <strong>2013</strong> ein Kranichzugmonitoring im Untersuchungsgebiet, also auch im Bereich der Fläche<br />
HR_26 Bielstein. Hierbei werden die WEA abgeschaltet und die Rotoren parallel zur Zugrichtung ausgerichtet,<br />
wenn starker Kranichzug im Gebiet mit ungünstiger Witterung und entsprechend niedrigen<br />
Flughöhen zusammenfallen, sodass Ausweichbewegungen und Kollisionsrisiko weitestgehend minimiert<br />
werden. Im Untersuchungsgebiet ist eine Abschaltung aufgrund der geringen Flughöhe nicht nur<br />
während ungünstiger Witterung, sondern während Massenzugtagen allgemein zu empfehlen (STÜBING,<br />
<strong>2013</strong>).<br />
Bei Beachtung dieser Vermeidungsmaßnahme sind keine erheblichen Beeinträchtigungen zu<br />
erwarten.<br />
<strong>November</strong> <strong>2013</strong> Seite 40
K R E I S S T A D T H O M B E R G ( E F Z E )<br />
Um weltbericht zum Flächennutzungsplan<br />
Büro für<br />
Ingenieurbiologie und<br />
Landschaftsplanung<br />
3.3.2 Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag<br />
Aus § 44 Abs. 1 BNatSchG ergeben sich die Tötungs- und Störungsverbote für besonders bzw. streng<br />
geschützte Tierarten, das Verbot der Beschädigung oder Zerstörung ihrer Lebensstätten sowie von<br />
Pflanzenarten und ihrer Standorte, die sogenannten „Zugriffsverbote“.<br />
Die Auswirkungen auf die Avifauna wurden schon in Kap. 3.3.1. beschrieben.<br />
Desweiteren sind Auswirkungen durch WEA auf die Fledermäuse möglich. Entsprechend des Untersuchungsrahmens<br />
des Leitfadens des Umweltministeriums, 2012 müssen im Rahmen des BimSch-<br />
Antrags die Fledermäuse untersucht werden.<br />
Gefährdung: Kollision und Barotrauma bei Jagd und während des Zuges<br />
Fledermäuse sind an Windkrafträdern nicht nur durch direkte Kollision mit den Rotorblättern gefährdet,<br />
sondern auch durch das sogenannte Barotrauma. Dabei reicht es aus, wenn die Tiere in den Strömungsbereich<br />
der Rotorblätter gelangen. Die starken Druckveränderungen führen dazu, dass die Tiere<br />
an inneren Blutungen sterben. In Deutschland werden zunehmend Studien bzw. Berichte über die Beeinträchtigung<br />
von Fledermäusen durch WEA veröffentlicht. BACH ET AL. (1999), DÜRR (2002, 2007)<br />
und DÜRR & BACH (2004) haben erste Erkenntnisse zu dieser Thematik publiziert. Durch Einführung<br />
einer zentralen Fundkartei (Zufallsfunde) hat sich die Zahl der gemeldeten Totfunde deutschlandweit<br />
inzwischen deutlich auf 1.915 (ITN, 2012) erhöht.<br />
Eine besondere Gefährdung von Fledermäusen durch Kollision ist zu den Zugzeiten im Frühjahr und<br />
Spätsommer zu erwarten (DÜRR, 2007). Desweiteren sind Arten betroffen, die in größeren Höhen jagen,<br />
also im Einflussbereich der Rotoren. Besonders betroffen sind der Große Abendsegler, der in<br />
großer Höhe von über 50-100 m fliegt, die Rauhautfledermaus und die Zwergfledermaus, die in<br />
Deutschland zusammen > 80% der nachgewiesenen Schlagopfer ausmachen. Die Rauhautfledermaus<br />
und der Große Abendsegler sind Arten, die in den Spätsommermonaten weite Strecken zurücklegen<br />
(Langstreckenwanderer) und die daher besonders betroffen sind.<br />
Auch der Kleine Abendsegler, die Nord-, Breitflügel- und Mückenfledermaus, die in geringerer Dichte<br />
vorkommen, verunglücken immer wieder an Windenergieanlagen. Nur wenige Totfunde wurden für die<br />
Arten wie Langohren, Mausohren, Wasser- und Bartfledermäuse gemeldet (DÜRR, 2012).<br />
Eine besondere Gefährdung wird für ziehende und hochfliegende Arten diskutiert, da Totfunde vorwiegend<br />
während der Zugzeiten und von hochfliegenden Arten vorliegen (HÖTKER et al. 2004). Darüber<br />
hinaus zeichnet sich jedoch ab, dass alle Arten während ihrer Transferflüge zwischen den Sommerbzw.<br />
Winter- und Paarungsquartieren ebenfalls gerichtet in größeren Höhen fliegen und auf diesen<br />
Flügen einem höheren Kollisionsrisiko ausgesetzt sind (RAHMEL et al., 2004).<br />
Auch durch Anlockeffekte kann es an WEA zum erhöhten Kollisionsrisiko kommen. Durch Wärmeabstrahlung<br />
oder Beleuchtung der Gondel werden Insekten und in der Folge auch Fledermäuse angelockt.<br />
<strong>November</strong> <strong>2013</strong> Seite 41
K R E I S S T A D T H O M B E R G ( E F Z E )<br />
Um weltbericht zum Flächennutzungsplan<br />
Büro für<br />
Ingenieurbiologie und<br />
Landschaftsplanung<br />
Aktuelle Auswertungen systematischer Untersuchungen von Schlagopferzahlen an WEA zeigen, dass<br />
vor allem bei Errichtung von Anlagen in Wäldern von einem besonders hohen Konfliktpotential ausgegangen<br />
werden muss (INSTITUT FÜR TIERÖKOLOGIE UND NATURBILDUNG, 2012).<br />
Die Kollisionsgefahr hängt stark von der Aktivitätsdichte ab. Diese wird im Gondelbereich im Wesentlichen<br />
durch die Faktoren Windgeschwindigkeit, Temperatur, Niederschlag und Jahres- sowie Nachtzeit<br />
bestimmt. Bei Windgeschwindigkeiten über 6 m/s wurden nur ca. 15 % der Aktivität gemessen, bei<br />
über 7 m/s nur noch 6 %. Hinsichtlich der Temperatur ist ein starker Anstieg der Aktivität bei Temperaturen<br />
zwischen 10° C und 25° C zu beobachten. Eine sehr starke Abnahme der Aktivität erfolgt bereits<br />
bei geringen Niederschlägen von 0,002 bis 0,004 mm/min (BEHR ET AL., 2011).<br />
Verlust von Jagdgebieten<br />
Neben der Gefährdung von Fledermäusen durch Kollisionen und Barotrauma kann es durch Verlärmung<br />
zum Verlust von Jagdgebieten kommen, insbesondere bei Arten, die auch akustisch jagen, wie<br />
das Große Mausohr. Die Anlagenstandorte werden dann u.U. gemieden.<br />
In den folgenden beiden Tabellen ist das Konfliktpotential für Fledermäuse durch WEA dargestellt<br />
(Quelle: LEITFADEN DES UMWELTMINISTERIUMS, 2012, ITN, 2012).<br />
Tab. 14: Räumliches Konfliktpotential von Fledermäusen (Quelle: ITN, 2012)<br />
<strong>November</strong> <strong>2013</strong> Seite 42
K R E I S S T A D T H O M B E R G ( E F Z E )<br />
Um weltbericht zum Flächennutzungsplan<br />
Büro für<br />
Ingenieurbiologie und<br />
Landschaftsplanung<br />
Tab. 15: Kollisionsrisiko und Risiko für Fortpflanzungs- und Ruhestätten von Fledermäusen<br />
Artname<br />
Wanderverhalten<br />
L= Langstrecke<br />
M=Mittelstrecke<br />
K=Kurzstrecke<br />
Kollisionsrisiko<br />
Risiko für<br />
Fortpflanzungs-<br />
und<br />
Ruhestätten<br />
Bechsteinfledermaus, Myotisbechsteinii K Gering Ja -<br />
EHZ<br />
Hessen<br />
BraunesLangohr, Plecotusauritus K Gering Ja unzureichend<br />
Breitflügelfledermaus, Eptesicusserotinus M Gering Nein günstig<br />
Fransenfledermaus, Myotisnattereri K Gering Ja günstig<br />
GrauesLangohr, Plecotusaustriacus K Gering Nein günstig<br />
Große BartfledermausMyotisbrandtii M Ja Ja unzureichend<br />
Großer Abendsegler, Nyctalusnoctula L Ja Ja günstig<br />
Großes Mausohr, Myotismyotis M Gering Nein günstig<br />
Kleine Bartfledermaus Myotismystacinus K Ja Nein günstig<br />
Kleine Hufeisennase,<br />
Rhinolophushipposideros<br />
K Gering Nein unzureichend<br />
Kleiner Abendsegler, Nyctalusleisleri L Ja Ja günstig<br />
Mopsfledermaus, Barbastellabarbastellus M Ja Ja unzureichend<br />
Mückenfledermaus, Pipistrelluspygmaeus M (analog) Ja Ja unzureichend<br />
Nordfledermaus, Eptesicusnilsonii M Ja Nein unzureichend<br />
Rauhautfledermaus, Pipistrellusnathusii L Ja Nein günstig<br />
Teichfledermaus, Myotisdasycneme M Gering Nein unzureichend<br />
Wasserfledermaus, Myotisdaubentonii M Gering Ja günstig<br />
Zweifarbfledermaus, Vespertiliomurinus L Ja Nein unzureichend<br />
Zwergfledermaus, Pipistrelluspipistrellus M Ja Nein günstig<br />
Bewertung an den Standorten:<br />
Die Natis-Daten (siehe Anlage zur Standortanalyse) enthalten Hinweise zu Fledermäusen.<br />
Im Waldrandbereich des Eichelskopfes (NSG) sind Winterquartiere der Großen Bartfledermaus, des<br />
Großen Mausohrs und der Kleinen Bartfledermaus bekannt. Für die Fläche Ziegenköpfchen ist somit<br />
nicht auszuschließen, dass die Waldränder die Funktion als Leitlinien für den Zug der Fledermäuse<br />
erfüllen und auch aufgrund des Insektenreichtums als Jagdgebiet dienen. Das intensiv landwirtschaftliche<br />
genutzte Ackerland dürfte dagegen eine geringere Bedeutung für Fledermäuse haben.<br />
Zum Vorkommen und zu den Funktionen des Gebietes für die Fledermäuse sind die Ergebnisse der<br />
fledermauskundlichen Gutachten abzuwarten bevor eine endgültige Bewertung der Zugriffsverbote<br />
<strong>November</strong> <strong>2013</strong> Seite 43
K R E I S S T A D T H O M B E R G ( E F Z E )<br />
Um weltbericht zum Flächennutzungsplan<br />
Büro für<br />
Ingenieurbiologie und<br />
Landschaftsplanung<br />
gemäß § 44 BNatSchG erfolgen kann. Eingriffe in Waldrandbereiche sind zu vermeiden. Da die Kollisionsgefahr<br />
stark von der Aktivitätsdichte abhängt bzw. von der Windgeschwindigkeit (< 6 m/s), Temperatur,<br />
Niederschlag und Jahres- sowie Nachtzeit, müssen je nach Ergebnis der Untersuchungen als<br />
Vermeidungsmaßnahme die WEA bei großer Aktivitätsdichte der Fledermäuse abgeschaltet werden.<br />
Hierzu müssen im Rahmen des BImSch-Verfahrens Abschaltalgorithmen bzw. ein Gondelmonitoring<br />
für die Fledermäuse festgelegt werden. Falls trotzdem eine Tötung nicht auszuschließen ist, wie<br />
es bei weit verbreiteten Arten wie z.B. der Zwergfledermaus möglich ist, muss eine Ausnahme beantragt<br />
werden.<br />
Bei Beachtung dieser Vermeidungsmaßnahme sind keine erheblichen Beeinträchtigungen<br />
durch die geplanten Windstandorte für die Fledermäuse zu erwarten.<br />
Bei Fläche 036 Bielstein sind aufgrund einer Gefährdung der Zugvögel, die ebenfalls nach § 44<br />
BNatSchG geschützt sind, erhebliche Beeinträchtigungen nicht auszuschließen. Die Fläche wird<br />
daher im Flächennutzungsplan nicht weiter als Standort für WEA dargestellt.<br />
4 Beschreibung der Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen<br />
Umweltauswirkungen<br />
Auf der Grundlage des Artikels 10 der Plan-UP-Richtlinie hat das EAG Bau die Gemeinden erstmals verpflichtet,<br />
die bei der Umsetzung ihrer Bauleitpläne entstehenden erheblichen Umweltauswirkungen formalisiert<br />
zu überwachen, um unvorhergesehene Auswirkungen frühzeitig zu ermitteln und in der Lage zu<br />
sein, geeignete Maßnahmen zur Abhilfe zu ergreifen (§§ 4 c, Abs. 3 sowie Nr. 3b der Anlage zu §§ 2 Ab. 4<br />
und 2a BauGB).<br />
Die einzelnen notwendigen Monitoringmaßnahmen sind im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung<br />
genau zu bestimmen und festzulegen. Mindestens beziehen sich eventuelle Überwachungsmaßnahmen<br />
auf die Durchführung der festgesetzten Maßnahmen zur Vermeidung (u.U. Kranichmonitoring, Abschaltalgorithmen<br />
für Fledermäuse) und Minderung des Eingriffs sowie zum Ausgleich der Beeinträchtigungen.<br />
Auch die Einhaltung der festgelegten Rückbauverpflichtungen von Windkraftanlagen nach Aufgabe der<br />
Nutzung ist von der Gemeinde zu kontrollieren.<br />
<strong>November</strong> <strong>2013</strong> Seite 44
K R E I S S T A D T H O M B E R G ( E F Z E )<br />
Um weltbericht zum Flächennutzungsplan<br />
Büro für<br />
Ingenieurbiologie und<br />
Landschaftsplanung<br />
5 Allgemeinverständliche Zusammenfassung<br />
Der <strong>Umweltbericht</strong> verweist in der Darstellung der fachlichen Grundlagen auf den vorhandenen Landschaftsplan.<br />
Er stellt die planerischen Aussagen anderer Fachplanungen, die derzeit festgelegten Ausgleichsflächen<br />
(im <strong>FNP</strong> kartographisch dargestellt) sowie die derzeit festgelegten Monitoringmaßnahmen<br />
zu den B-Plänen der Stadt dar. Die von der Stadt <strong>Homberg</strong> (<strong>Efze</strong>) geplanten Vorhaben werden in einem<br />
ersten Schritt gemäß der umweltfachlichen Gesetzgebung bezüglich der derzeitigen Auswirkungen der<br />
bekannten Wirkfaktoren auf die Schutzgüter überprüft, außerdem werden Maßnahmen zur Vermeidung<br />
von Beeinträchtigungen und zum Ausgleich vorgeschlagen. Eine genaue Prüfung erfolgt im Rahmen der<br />
verbindlichen Bauleitplanung sowie, bei immissionsschutzrechtlich relevanten Vorhaben, im immissionsschutzrechtlichen<br />
Genehmigungsantrag (Solar-, Windkraftanlagen). Erhebliche Beeinträchtigung der<br />
Schutzgüter sind zumeist dann nicht zu erwarten, wenn die genannten Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen<br />
durchgeführt und die noch zu erbringenden Untersuchungen erfolgen und ausgewertet werden.<br />
Bezüglich der Windstandorte ist festzustellen, dass für die Fläche HR_19 Batzenberg und die Fläche<br />
Ziegenköpfchen keine erheblichen Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele des VSG Knüll zu erwarten<br />
sind. Für die Fläche HR_036 Bielstein kann dies erst nach der Durchführung einer Raumnutzungsanalyse<br />
der Flugbewegungen der betroffenen Brutpaare von Rotmilan und Uhu abschließend<br />
bewertet werden. Aufgrund des Kollisionsrisikos beim Vogelzug empfiehlt das ornithologische Gutachten,<br />
auf WEA auf der Fläche HR_36 Bielstein zu verzichten, da Beeinträchtigungen nicht vollständig<br />
auszuschließen sind. Zur Vermeidung von Beeinträchtigungen des Kranichzuges wäre als Vermeidungsmaßnahme<br />
ein Kranichmonitoring ausreichend. Auf eine weitere Darstellung des Standortes<br />
Bielstein im Flächennutzungsplan wird aufgrund der genannten Bedenken verzichtet.<br />
Für die Bewertung der Beeinträchtigung der Fledermäuse sind die entsprechenden Gutachten noch<br />
durchzuführen. Durch geeignete Abschaltalgorithmen bzw. ein Gondelmonitoring, die bei Bedarf im<br />
BimSch-Verfahren von den Behörden festgelegt werden, können Eingriffe vermieden werden. Bei<br />
Durchführung dieser Vermeidungsmaßnahmen sind voraussichtlich keine erheblichen Beeinträchtigungen<br />
im Sinne des § 44 BNatSchG zu erwarten.<br />
<strong>November</strong> <strong>2013</strong> Seite 45
K R E I S S T A D T H O M B E R G ( E F Z E )<br />
Um weltbericht zum Flächennutzungsplan<br />
Büro für<br />
Ingenieurbiologie und<br />
Landschaftsplanung<br />
6 Literatur und gesetzliche Grundlagen<br />
ALTLASTKATASTER der Stadt sowie des Regierungspräsidiums Kassel<br />
BOHN, U., 1981: Vegetationskarte der Bundesrepublik Deutschland 1:200.000.- Potentielle natürliche<br />
Vegetation - Blatt CC 5518 Fulda, Schriftenreihe für Naturschutz, Heft 15, Bundesforschungsanstalt<br />
für Naturschutz und Landschaftsökologie, Bonn Bad-Godesberg<br />
BUNDESMINISTERIUM FÜR UMWELT, NATURSCHUTZ UND REAKTORSICHERHEIT, 2007: „Leitfaden<br />
zur Berücksichtigung von Umweltbelangen bei der Planung von PV-Freianlagen“<br />
BUNDESAMT FÜR NATURSCHUTZ, 2009: Naturschutzfachliche Bewertungsmethoden von Freilandphotovoltaikanlagen.<br />
HESSISCHES LANDESAMT FÜR BODENFORSCHUNG (HLfB), 1975: Erläuterungen zur Geologischen<br />
Karte von Hessen 1:25.000, <strong>Homberg</strong><br />
HESSISCHES LANDESAMT FÜR BODENFORSCHUNG (HLfB), 1991 Hydrogeologisches Kartenwerk<br />
Hessen 1:300.000. - Verschmutzungsempfindlichkeit des Grundwassers. - Mittlere<br />
Grundwasserergiebigkeit.<br />
HESSISCHES LANDESAMT FÜR BODENFORSCHUNG (HLfB), 1991 Hydrogeologisches Kartenwerk<br />
Hessen 1:300.000. - Hydrogeologische Einheiten grundwasserführender Gesteine.<br />
HESSISCHES LANDESAMT FÜR BODENFORSCHUNG (HLfB), 1997: Bodenkarte Hessen 1: 50.000,<br />
<strong>Homberg</strong><br />
HESSISCHES MINISTERIUM FÜR UMWELT, ENERGIE, LANDWIRTSCHAFT UND VERBRAU-<br />
CHERSCHUTZ, 2012: Leitfaden „Berücksichtigung der Naturschutzbelange bei der Planung<br />
und Genehmigung von Windkraftanlagen (WKA) in Hessen“ vom 29.11.2012<br />
HESSISCHES MINISTERIUM FÜR UMWELT, ENERGIE, LANDWIRTSCHAFT UND VERBRAU-<br />
CHERSCHUTZ, 2011: Leitfaden für die artenschutzrechtliche Prüfung in Hessen.- 2. Fassung,<br />
2011, 29 S.<br />
KLIMAATLAS HESSEN, 1975<br />
KLINK, H.J., 1969: Die naturräumlichen Einheiten auf Blatt 112 Kassel. Naturräumliche Gliederung<br />
Deutschlands, Hrsg. Institut für Landeskunde. Bundesforschungsanstalt für Landeskunde<br />
und Raumordnung.<br />
LIEDER, K. UND LUMPE, J., 2011: Vögel im Solarpark – eine Chance für den Artenschutz?: Auswertung<br />
einer Untersuchung im Solarpark Ronneburg Süd I.<br />
LANDSCHAFTSRAHMENPLAN NORDHESSEN 2000: Regierungspräsidium Kassel<br />
REGIONALPLAN NORDHESSEN (RPN), 2009: Regierungspräsidium Kassel<br />
<strong>November</strong> <strong>2013</strong> Seite 46