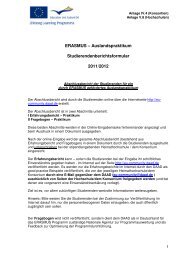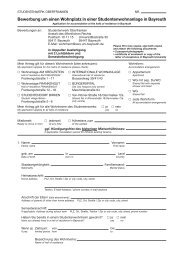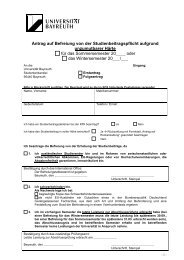Ein Erfahrungsbericht - International Office - Universität Bayreuth
Ein Erfahrungsbericht - International Office - Universität Bayreuth
Ein Erfahrungsbericht - International Office - Universität Bayreuth
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
man aber nichts generalisieren. Von einer chinesischen Dozentin weiß ich, dass sie<br />
sehr erfolgreich auch deutsche Methoden im Unterricht einsetzt und wiederum hat mir<br />
ein anderer Dozent berichtet, dass solche Methoden in seiner Klasse nicht akzeptiert<br />
wurden. Er ließ beispielsweise die Studenten grammatische Regeln für die<br />
Pluralbildung selbst ableiten, damit die Studenten sich diese Regeln leichter einprägen<br />
können, denn man kann davon ausgehen, dass das was man selbst erarbeitet setzt<br />
sich auch besser und langfristiger fest. Für die Studenten war diese Methode aber zu<br />
ungewohnt und ihrer Voreinstellung nach war es ganz klar die Aufgabe des Lehrers die<br />
Regeln zu erklären.<br />
Meinen ersten Unterricht konnte ich bei Frau Chen im Jahrgang 2002 durchführen.<br />
Thema war laut Lehrbuch „Die politische Ordnung der BRD“. Als <strong>Ein</strong>stieg zum Thema<br />
diskutierte ich mit den Studenten über zwei Gedichte aus dem Bereich der Konkreten<br />
Poesie zu Thema Ordnung und wozu eigentlich eine gesellschaftliche Ordnung<br />
notwendig sei. Anschließend gab ich einen Input und erläuterte die ersten 10 Artikel des<br />
Grundgesetzes. Darauf folgte ein Text zur Entstehung der Verfassung der BRD.<br />
Interessant an dieser Unterrichtseinheit war, dass wir auf das Thema Sozialpolitik zu<br />
sprechen kamen und die Vor – und Nachteile der Arbeitslosenhilfe diskutierten. Da ich<br />
merkte, dass die Studenten reges Interesse an dieser Thematik zeigten, entschloss ich<br />
mich entgegen meiner Unterrichtsplanung eine Art Rollenspiel durchzuführen. Dazu<br />
teilte ich die Klasse in zwei Gruppen ein und ließ pro und Kontra Argumente sammeln.<br />
Anschließend versetzte ich die Studenten in die Lage von Parlamentariern des<br />
deutschen Bundestages ließ der Diskussion quasi freien Lauf. Und tatsächlich wurden<br />
viele Argumente über das Für und Wider ausgetauscht. Bemerkenswert fand ich, dass<br />
die Studenten zum Schluss der Diskussion sich gegenseitig „Gesicht gaben“, indem sie<br />
betonten, dass verschieden Argumente in der Debatte ihrer Berechtigung hätten. Die<br />
Aggressivität, wie man sie manchmal in deutschen Debatten findet war hier nicht zu<br />
finden und fand ich persönlich als angenehm.<br />
In meinen weiteren Unterrichtsstunden habe ich dann weiterhin darauf geachtet, dass<br />
ich den Studenten zum Schluss der Stunde erklärte, warum ich eine bestimmte Didaktik<br />
angewendet habe.<br />
Dass meine Didaktik nicht immer auf ungeteilte Zustimmung traf, erklärt sich von selbst.<br />
Aber in einer interkulturellen Unterrichtskommunikation muss auch nicht immer ein<br />
harmonisches <strong>Ein</strong>verständnis erzeugt werden. Beide Seiten befinden sich manchmal in<br />
einer schwebenden Situation. Was das heißen kann, will ich an einem anderen<br />
Unterrichtsentwurf erläutern: Es ging um einen literarischen Text von Franz Kafka: „Vor<br />
dem Gesetzt“, ein Text mit so genannten Leerstellen, die offen für eine kulturspezifische