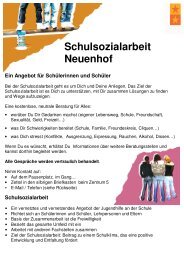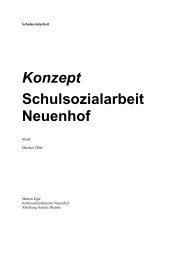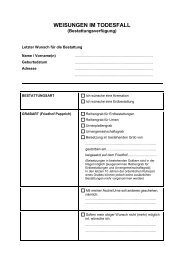Konzept Schulsozialarbeit Neuenhof - Gemeinde Neuenhof
Konzept Schulsozialarbeit Neuenhof - Gemeinde Neuenhof
Konzept Schulsozialarbeit Neuenhof - Gemeinde Neuenhof
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Schulsozialarbeit</strong><br />
<strong>Konzept</strong><br />
<strong>Schulsozialarbeit</strong><br />
<strong>Neuenhof</strong><br />
Stand:<br />
Oktober 2006<br />
Marion Egle<br />
<strong>Schulsozialarbeit</strong>erin <strong>Neuenhof</strong><br />
Abteilung Soziale Dienste
Inhaltsverzeichnis<br />
1.Einführung..............................................................................................................................1<br />
2. Planung- und Durchführung in der <strong>Gemeinde</strong> <strong>Neuenhof</strong>.................................................3<br />
3. Rechtliche Grundlagen.........................................................................................................3<br />
3.1.Gesetzliche Verankerung..........................................................................................3<br />
3.1.1.Schweizerisches Zivilgesetzbuch...............................................................3<br />
3.1.2.Schulgesetz.................................................................................................4<br />
3.1.3.Sozialhilfe und Präventionsgesetz..............................................................4<br />
3.2.Schweigepflicht und Meldepflicht............................................................................4<br />
4. Theoretische Grundlagen.....................................................................................................5<br />
4.1.Definition..................................................................................................................5<br />
4.2. Modelle der <strong>Schulsozialarbeit</strong>......................................................................5<br />
4.2.1.Grundgedanken zu den Modellen...............................................................5<br />
4.2.3.Die Modelltypen.........................................................................................6<br />
4.2.3.Das Distanzmodell......................................................................................6<br />
4.2.3.1.Kennzeichen des Distanzmodells.............................................................6<br />
4.2.3.2.Umsetzung in <strong>Neuenhof</strong>...........................................................................7<br />
5. Arbeitgeber, fachliche und räumliche Angliederung........................................................7<br />
5.1.Arbeitgeber................................................................................................................7<br />
5.2.Fachliche Angliederung............................................................................................7<br />
5.2.1.Leitung und Unterstützung.........................................................................7<br />
5.2.1.Begleitung durch die Kinder- und Jugendkommission..............................7<br />
5.3.Räumliche Angliederung..........................................................................................8<br />
5.3.1.Überlegungen zur räumlichen Angliederung.............................................8<br />
5.3.2.Büro in der <strong>Gemeinde</strong>................................................................................8<br />
5.3.3.<strong>Schulsozialarbeit</strong>szimmer an der Schule....................................................8<br />
5.3.3.1.Raumgestaltung.......................................................................................8<br />
5.3.3.2. Pädagogische Aspekte............................................................................8<br />
6.Zielgruppen und Zielsetzung................................................................................................9<br />
6.1.Überlegungen zu den Zielgruppen............................................................................9<br />
6.1.1.Schülerinnen und Schüler...........................................................................9<br />
6.1.2.Eltern..........................................................................................................9<br />
6.1.3.Lehrerinnen, Lehrer und Schulleitung........................................................9<br />
6.2.Überlegungen zur Zielsetzung..................................................................................9<br />
6.2.1.Ziele für die Arbeit mit den Schülerinnen und Schülern..........................10<br />
6.2.2.Ziele für die Arbeit mit den Eltern...........................................................10<br />
6.2.3.Ziele für die Arbeit mit den Lehrerinnen, Lehrern und Schulleitung.......10<br />
6.2.4.Sonstige Ziele...........................................................................................10<br />
7. Zusammenarbeit mit der Schule.......................................................................................11<br />
7.1.Überlegungen zur Zusammenarbeit mit der Schule...............................................11<br />
7.2.Merkmale des Systems Schule und Soziale Arbeit................................................11<br />
7.3.Gestaltung der Zusammenarbeit und des Informationsflusses...............................12<br />
7.3.1.Überlegungen zur Gestaltung d. Zusammenarbeit/ Informationsfluss.....12<br />
7.3.2.AnsprechpartnerInnen..............................................................................12
7.3.3. Teilnahme an Sitzungen und Gremien....................................................12<br />
7.3.3.1.Schulparlament......................................................................................12<br />
7.3.3.2.Stufensitzung..........................................................................................13<br />
7.3.3.3.Schulleitungssitzung..............................................................................13<br />
7.3.3.4.Schulpflegesitzung.................................................................................13<br />
7.3.3.5.Logopädiesitzung..................................................................................13<br />
7.3.3.6.Besprechung Mittagstisch.....................................................................13<br />
7.3.3.7.Projektbesprechung...............................................................................13<br />
7.3.4.Kommunikation und Kontaktpflege.........................................................14<br />
7.3.4.1.Überlegungen zur Kommunikation und Kontaktpflege.........................14<br />
7.3.4.2.Massnahmen zur Förderung von Kommunikation und Kontakt...........14<br />
7.3.5.Erreichbarkeit...........................................................................................14<br />
7.3.6.Informationsfluss......................................................................................15<br />
7.3.7.Initiative für die Inanspruchnahme des Angebots....................................16<br />
8.Grundsätze und Methoden der <strong>Schulsozialarbeit</strong>.............................................................16<br />
8.1.Grundsätze..............................................................................................................16<br />
8.1.1.Freiwilligkeit............................................................................................16<br />
8.1.2.Schweigepflicht und Meldepflicht...........................................................17<br />
8.1.3.Niederschwelligkeit..................................................................................17<br />
8.1.4.Nachhaltigkeit...........................................................................................17<br />
8.1.5.Ressourcenorientiertheit...........................................................................17<br />
8.1.6.Beziehungsarbeit......................................................................................18<br />
8.1.7.Prozessorientierung..................................................................................18<br />
8.1.8.Systemorientierung...................................................................................18<br />
8.1.9.Integration.................................................................................................18<br />
8.1.10.Triage......................................................................................................19<br />
8.1.11.Geschlechtspezifisches Angebot............................................................19<br />
8.1.12.Selbstreflexion........................................................................................19<br />
8.1.13.Neutralität...............................................................................................19<br />
8.2.Methoden................................................................................................................19<br />
8.2.1.Individualhilfe..........................................................................................20<br />
8.2.2.Soziale Gruppenarbeit .............................................................................20<br />
8.2.3.Projektarbeit.............................................................................................21<br />
8.2.4.Moderation...............................................................................................21<br />
8.2.5.Mediation.................................................................................................22<br />
9.Aufgabenfelder und Angebot.............................................................................................22<br />
9.1.Überlegungen zur den Aufgabenfeldern und Angebot...........................................22<br />
9.2.Prävention und Früherkennung...............................................................................22<br />
9.2.1.Primäre Prävention...................................................................................22<br />
9.2.2.Sekundäre Prävention...............................................................................23<br />
9.2.3.Modulssystem statt Flächendeckung........................................................23<br />
9.3.Beratung und Unterstützung von Schülerinnen und Schülern....................24<br />
9.4.Beratung und Unterstützung von Lehrpersonen und Schulleitung.........................24<br />
9.5.Beratung und Unterstützung von Eltern.................................................................24<br />
9.5.1.Elternanlässe............................................................................................24<br />
9.5.2.Elternberatung..........................................................................................25<br />
9.6.Kooperation und Vernetzung..................................................................................26<br />
9.6.1.Überlegungen zur Kooperation und Vernetzung......................................26<br />
9.6.2.Zusammenarbeit mit anderen Fachstellen................................................26
9.6.2.1.Soziale Dienste......................................................................................26<br />
9.6.2.2.Schulpsychologischer Dienst.................................................................26<br />
9.6.2.3.Jugendarbeiterin <strong>Neuenhof</strong>...................................................................26<br />
9.6.2.4.Regiolgruppe <strong>Schulsozialarbeit</strong>.............................................................27<br />
9.6.2.5.Erziehungsberatung für Mütter und Väter............................................27<br />
9.6.2.6.Kinderabteilung des Kantonsspitals Baden...........................................27<br />
9.6.2.7.Beratungszentrum Bezirk Baden...........................................................27<br />
9.6.2.8.Aargauischer Verein für Suchtprobleme...............................................27<br />
9.6.2.9.Schweizer Fachstelle für Alkohol und andere Drogenprobleme...........27<br />
9.6.2.10.Netzwerk Kulturvermittlung Baden.....................................................27<br />
9.6.2.11.Dolmetscher Dienste des Heks............................................................27<br />
9.6.2.12.Hort und Spielgruppen <strong>Neuenhof</strong>........................................................28<br />
9.6.2.13.Andere Dienste....................................................................................28<br />
9.6.2.14.Lokale Vereine.....................................................................................28<br />
10.Situations- und Bedarfanalyse und Folgerungen für die konkreten Angebote<br />
10.1.Vorgehen...............................................................................................................29<br />
10.2.Kindergartenstufe..................................................................................................29<br />
10.2.1.Ergebnisse Kindergartenstufe.................................................................29<br />
10.2.2.Angebote Kindergartenstufe...................................................................29<br />
10.3.Unterstufe..............................................................................................................30<br />
10.3.1.Ergebnisse Unterstufe ............................................................................30<br />
10.3.2.Angebote Unterstufe...............................................................................30<br />
10.4.Mittelstufe.............................................................................................................31<br />
10.4.1.Ergebnisse Mittelstufe............................................................................31<br />
10.4.2.Angebote Mittelstufe..............................................................................31<br />
10.5.Oberstufe...............................................................................................................32<br />
10.5.1.Ergebnisse Oberstufe..............................................................................32<br />
10.5.2.Angebote Oberstufe................................................................................32<br />
10.6.Übergreifendes Angebot.......................................................................................33<br />
10.7.Themen und Interessen der SchülerInnen.............................................................33<br />
11.Aufteilung und Gewichtung der Stellenprozente............................................................34<br />
11.1.Überlegungen zur Aufteilung und Gewichtung der Stellenprozente....................34<br />
11.2.Stunden Verteilung...............................................................................................34<br />
11.3.Feste Arbeitszeiten und Erreichbarkeit.................................................................35<br />
11.4.Verteilung der Stellenprozente auf die Stufen......................................................35<br />
12.Start der operativen Arbeit...............................................................................................36<br />
13.Beschreibung konkreter Module und Projekte...............................................................36<br />
13.1.Präventionsmodule................................................................................................36<br />
13.1.1.Präventionsmodule Unter- und Mittelstufe............................................36<br />
13.1.2.Präventionsmodule Oberstufe................................................................37<br />
13.2.Sinnvolle Freizeitgestaltung..................................................................................37<br />
13.3.Krisenintervention.................................................................................................37<br />
13.4.Schulausflug und Lager........................................................................................38<br />
13.5.Erste Elternmodule, Themenabend, Elternanlass..................................................38<br />
13.6.Gesamtschulprojekte.............................................................................................38<br />
13.6.1.„Schule <strong>Neuenhof</strong>- gsund und zwäg“ ....................................................38
13.6.2.Pausenhofareal........................................................................................38<br />
14.Weiterentwicklung, Qualitätssicherung und Selbstevaluation......................................39<br />
14.1.Weiterentwicklung................................................................................................39<br />
14.2.Qualitätssicherung.................................................................................................39<br />
14.3.Selbstevaluation....................................................................................................39<br />
15.Budget.................................................................................................................................40<br />
16.Ausblick und Ideen............................................................................................................41<br />
17.Literatur Verzeichnis........................................................................................................43<br />
Ablaufschema Auffälligkeiten<br />
Organigramm,<br />
Fragebogen,<br />
Diagramme,<br />
Merkblätter Lehrpersonen<br />
Ideen für den Mittwoch Nachmittag
1. Einführung<br />
Die Bevölkerung der <strong>Gemeinde</strong> <strong>Neuenhof</strong> zeichnet sich durch eine multikulturelle Mischung<br />
von Bürgerinnen und Bürgern aus, die sich in vielen Vereinen engagieren und sich in das<br />
Gemeinschaftsleben der <strong>Gemeinde</strong> einbringen. Entsprechend der Geschichte von <strong>Neuenhof</strong>,<br />
als Niederlassung für Arbeiter aus Baden, ist eine Wohnstruktur entstanden, die in einer<br />
fortlaufenden Entwicklung zu einer Ansiedlung von eher finanzschwachen Einwohnern<br />
geführt hat. Jedoch ist auch eine „gut bürgerliche“ Mittelschicht in <strong>Neuenhof</strong> ansässig.<br />
Tendenziell lässt sich eine wachsende Anzahl von Einwohnern, die einem<br />
sozialbenachteiligten und Bildungsfernen Milieu zugeordnet werden können, verzeichnen.<br />
Die Migrationhintergründe und kulturspezifischen Aspekte, die somit das Familienleben der<br />
Schülerinnen und Schüler beeinflussen, sind mannigfaltig.<br />
Diese Entwicklungen haben eine Auswirkung auf die Lebenswelt Schule, die für die Kinderund<br />
Jugendlichen ein zentraler Ort der sozialen Interaktion ist. Die Institution Schule ist als<br />
Integrationsmedium gefordert (vgl. Vogel, 2006, S.37 ff). Lehrpersonen sehen sich vermehrt<br />
mit Schülerinnen und Schülern aus sozial schwächeren Familien und somit auch mit<br />
sozialisationsbedingten Problemen konfrontiert. In zunehmendem Mass müssen Kinder in<br />
Einschulungsklassen und Kleinklassen untergebracht werden, um den individuell<br />
unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht werden zu können. Bei der Begleitung der<br />
Schülerinnen und Schüler im Lernalltag beobachten Lehrpersonen in allen Stufen immer<br />
häufiger Verwahrlosungstendenzen.<br />
Der gesellschaftliche Wandel der letzten Jahrzehnte birgt weitere Herausforderungen in sich.<br />
Auf die Schule und ihre Lehrpersonen kommen neue Aufgaben zu, die neben der<br />
ursprünglichen Funktion, dem Vermitteln von Lerninhalten, bewältigt werden müssen.<br />
Die Familien heutzutage sind den wechselnden Anforderungen in der Berufs- und Lebenswelt<br />
unterworfen. Sie erleben einen Wandel von Struktur und Beständigkeit, durch Urbanisierung,<br />
Mobilitäts- und Flexibilitätsanspruch. Eltern, die beide berufstätig sind können genauso in<br />
eine Überforderungssituation geraten, wie Alleinerziehende. Die Erziehungsaufgaben werden<br />
durch den ökonomischen und gesellschaftlichen Wandel immer anspruchsvoller. Umfassende<br />
soziale Kompetenzen, der Umgang mit Medien und Konsum, ein beständiges Mass an Halt<br />
und Orientierung, u.a. Erziehungsinhalte sollten den Heranwachsenden vermittelt werden.<br />
Diese umfangreiche Aufgabe kann nicht immer bewältigt werden. Die Lebensbedingungen<br />
der Kinder- und Jugendlichen wirken sich ebenso auf die Persönlichkeitsentwicklung wie<br />
auch auf die Lernbedingungen im Unterricht aus.<br />
Äusserungen von Lehrpersonen zur Folge sind sie von einem Mehraufwand betroffen. Neben<br />
dem Unterrichten sind sie mit der Bewältigung von Aufgaben der Sozialisation belastet.<br />
Wurde Sozialkompetenzen, wie die Einhaltung von Grundregeln im Umgang miteinander,<br />
früher als selbstverständlich vorausgesetzt, so müssen dieses Fähigkeiten von den<br />
Schülerinnen und Schülern heutzutage erst Schritt für Schritt während des Schulalltages<br />
erworben werden.<br />
Lehrpersonen sind in erster Linie in Bildung spezialisiert und stossen bei den unbewältigten<br />
familiären und sozialen Problemen ihrer Schüler an ihre Grenzen.<br />
Hier knüpft die <strong>Schulsozialarbeit</strong> in <strong>Neuenhof</strong> an. Die Lehrerschaft soll bei Problemen, die<br />
ihren Ursprung im sozialen Umfeld haben, entlastet werden. Die Arbeitsweise der Schule soll<br />
durch situationsgerechte Handlungsmethoden aus der sozialen Arbeit ergänzt werden.<br />
Schülerinnen und Schüler sollen ein unkompliziertes, niederschwelliges Angebot erhalten,<br />
dass durch das sie praktisch und Alltagsnah unterstützt werden. Mit der Hilfe der
<strong>Schulsozialarbeit</strong> sollen sie selbst Strategien entwickeln, um mit den Belastungen umgehen zu<br />
können.<br />
Waren die Entwicklungsaufgaben und die Pubertät schon seit jeher eine schwierige<br />
Lebensphase für die Jugendlichen und ihre Bezugspersonen, so ist die Lebenssituation von<br />
Jugendlichen heute noch spannungsgeladener. Sie erleben einerseits eine multioptionale<br />
Gesellschaft mit schier unbegrenzten Wahloptionen und andererseits müssen sie sich der<br />
Realität fügen. Finanziell begrenzte Ressourcen, Lehrstellenmangel, das enge Korsette der<br />
Vorstellungen der Familie und andere Faktoren üben Druck auf die jungen Menschen aus.<br />
Kinder- und Jugendliche mit Migrationshintergrund müssen darüber hinaus noch<br />
Wertekollisionen mit der Herkunftskultur lösen und dadurch entstehende innere Spannung<br />
aushalten (vgl. Hössli, 2005, S.48 ff.). Die Diskrepanz zwischen den realen Lebensbedingung<br />
und der Wunschwelt kann sich destabilisierend auf die Persönlichkeitsentwicklung der<br />
Kinder- und Jugendlichen auswirken. Oftmals schwanken sie zwischen übersteigerten<br />
Phantasien, Allmachtsgefühlen und Frustration und Niedergeschlagenheit (vgl. Drilling, 2002,<br />
S. 19 ff.).<br />
Die Reaktionen auf die hohen Anforderungen an die Kinder- und Jugendlichen können<br />
unterschiedlich ausfallen. Ein Druckventil kann auffälliges, auch aggressives Verhalten sein.<br />
Weitere Ausweichstrategien sind die Flucht in Subkulturen, in die Depression, in delinquentes<br />
Verhalten oder in die Sucht. Ferner können Erschöpfungszustände oder Psychosomatische<br />
Erkrankungen auftreten. Auch wird in den Medien vermehrt von Gewalt an den Schulen,<br />
Mobbing und Respektlosigkeit berichtet (vgl. Fricker, 2005, S.4).<br />
An dieser Stelle möchte ich vorgreifen und auf die Situations- Bedarfsanalyse hinweisen. Aus<br />
diesem Kapitel geht hervor, dass in der Schule <strong>Neuenhof</strong>, trotz strukturellen schwierigen<br />
Grundbedingungen, ein Verhältnismässig gutes Schulklima herrscht. Gewalt ist an der Schule<br />
weniger ein Thema.<br />
Dennoch zeichnet sich ab, dass viele Kinder- und Jugendliche keine adäquaten, konstruktiven<br />
Bewältigungsstrategien für ihre Probleme aus dem sozialen Umfeld entwickeln können.<br />
Um einem negativen Verlauf vorzubeugen und dem Gesamt Gesellschaftlichen Trend der<br />
Mehrbelastung an der Schule Rechnung zu tragen, entschloss sich die <strong>Gemeinde</strong>verwaltung<br />
<strong>Neuenhof</strong> die <strong>Schulsozialarbeit</strong> einzuführen.<br />
Gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern, der Schulpflege, der Schulleitung, den<br />
Lehrpersonen und den Eltern soll ein umgängliches, wertschätzendes, Ressourcen orientiertes<br />
Klima an der Schule kultiviert und gepflegt werden.
2. Planung- und Durchführung in der <strong>Gemeinde</strong> <strong>Neuenhof</strong><br />
Der Einführung der <strong>Schulsozialarbeit</strong> liegen reichliche strategische und pädagogische<br />
Überlegungen zu Grunde. Eine 2- 3 jährige Planungsphase ging dem Start der operativen<br />
Arbeit voraus.<br />
Im April 2004 erteilte der <strong>Gemeinde</strong>rat <strong>Neuenhof</strong> der Gemeinschaft für Sozialforschung<br />
„ecce“ dem Auftrag die Grundlagen für ein Kinder- und Jugendkonzept für die <strong>Gemeinde</strong> zu<br />
erarbeiten. Die Forschungsgruppe ermittelte den Bedarf von 50 Stellenprozent für die<br />
<strong>Schulsozialarbeit</strong> an der Oberstufe, da die Schule „ ... zunehmend mit Problemen konfrontiert<br />
ist, die nicht ihrem Aufgabengebiet entsprechen und für deren Lösung sie nicht die<br />
Kompetenzen hat“ (ecce Bericht, S. 23). Zeitgleich wurde eine Arbeitsgruppe gebildet, die<br />
eine Richtlinie für die Kinder- und Jugendarbeit in <strong>Neuenhof</strong> erarbeitete und Ende 2004<br />
vorlegte. Der Antrag für die Einführung der Kinder- und Jugendarbeit auf Beginn des<br />
Schuljahres 2006/2007 wurde am 28.11.2005 bewilligt. Die <strong>Schulsozialarbeit</strong> wurde den<br />
sozialen Diensten zugeordnet.<br />
Ein Grobkonzept „Kinder- und Jugendarbeit <strong>Neuenhof</strong>“ wurde im Juni 2007 von der Leiterin<br />
der sozialen Dienste, Frau Spadanuda und dem <strong>Gemeinde</strong>rat für Soziales, Herr Schibli<br />
erstellt. Dieses Grobkonzept bildet die Grundlage für das Feinkonzept der <strong>Schulsozialarbeit</strong><br />
<strong>Neuenhof</strong>. Die <strong>Schulsozialarbeit</strong>erin, Marion Egle, wurde gemäss der Stellenbeschreibung des<br />
Kinder- und Jugendarbeitskonzepts S. 24 ausgewählt und auf Anfang August 2006 eingestellt.<br />
In den ersten 3 Monaten wurde von der <strong>Schulsozialarbeit</strong>erin eine Bedürfnisabklärung und<br />
eine Bedarfsanalyse mit Hilfe quantitativer und qualitativer Befragung unter bei Bezug aller<br />
Beteiligten (Schulleitung, Lehrpersonen, Schülerschaft, SPD) vorgenommen. Auf die<br />
Ergebnisse wird unter Punkt blabla noch detaillierter eingegangen.<br />
Das Feinkonzept wird bis Ende Oktober durch die im September 2006 gebildete Kinder- und<br />
Jugendkommission und den <strong>Gemeinde</strong>rat bewilligt. Somit kann die operative Arbeit<br />
plangemäss am 1. November 2006 starten.<br />
3. Rechtliche Grundlagen<br />
3.1. Gesetzliche Verankerung<br />
<strong>Schulsozialarbeit</strong> ist aufgrund der gesetzlichen Grundlage ebenso wie strategischen<br />
Überlegungen zur Folge als eine gemeinsame, vernetzte Aufgabe von Schule, Jugendhilfe und<br />
Sozialhilfe zu sehen.<br />
Der rechtliche Rahmen für die <strong>Schulsozialarbeit</strong> stützt sich auf Grundlagen aus verschiedenen<br />
Gesetzen (vgl. Iseli, 2005, S.9 ff.).<br />
3.1.1. Schweizerisches Zivilgesetzbuch<br />
Die Zusammenarbeit mit der Jugendhilfe wird im Artikel 317 des Schweizerischen<br />
Zivilgesetzbuches geregelt.<br />
Die Kantone sichern durch geeignete Vorschriften die zweckmässige Zusammenarbeit der<br />
Behörden und Stellen auf dem Gebiet des zivilrechtlichen Kindesschutzes, des<br />
Jugendstrafrechtes und der übrigen Jugendhilfe<br />
(Im Kanton Aargau muss diese Aufgabe von den <strong>Gemeinde</strong>n wahrgenommen werden.)<br />
3.1.2. Schulgesetz<br />
Im Kanton Aargau wurde am 17 März 1981 ein Schulgesetz erlassen, das laufend modifiziert<br />
wurde.
Die <strong>Schulsozialarbeit</strong> stützt sich auf die Grundsätze die in der Teilrevision vom 1 März 2005<br />
im Artikel 61a erlassen wurden.<br />
Abs.1: Die Schulträger können eine <strong>Schulsozialarbeit</strong>erin oder einen <strong>Schulsozialarbeit</strong>er<br />
bestellen.<br />
Abs.2: Der Regierungsrat regelt die fachliche Unterstützung der <strong>Schulsozialarbeit</strong>erinnen und<br />
<strong>Schulsozialarbeit</strong>er sowie der Schulträger.<br />
3.1.3. Sozialhilfe- und Präventionsgesetz<br />
Für den Kanton Aargau wurde am 6. März 2001 das Sozialhilfe- und Präventionsgesetz<br />
verabschiedet.<br />
Art.4: Sozialhilfe (...) fördert die wirtschaftliche und persönliche Selbständigkeit und<br />
unterstützt die gesellschaftliche Integration.<br />
Art.2: Sozialhilfe umfasst immaterielle und materielle Hilfe.<br />
Art.8: Immaterielle Hilfe umfasst insbesondere Beratung, Betreuung und Vermittlung von<br />
Dienstleistungen.<br />
3.2. Schweigepflicht und Anzeigepflicht<br />
Die folgende Zusammenfassung basiert auf den Texten von Henz, Drilling/ Stäger und Iseli.<br />
Ergänzungen entsprechen der Haltung der <strong>Schulsozialarbeit</strong>erin.<br />
Die <strong>Schulsozialarbeit</strong> unterliegt der beruflichen Schweigepflicht. Von der Anzeigepflicht ist<br />
sie befreit. Von der Schweigepflicht kann die <strong>Schulsozialarbeit</strong>erin durch die Klientin/ oder<br />
den KundInnen entbunden werden. Ist das Gefährdungspotenzial hoch und fehlt eine<br />
Entbindung von der Schweigepflicht, so erstellt die <strong>Schulsozialarbeit</strong>erin eine Meldung an die<br />
Vorgesetzte der Sozialen Dienst. Diese kann die <strong>Schulsozialarbeit</strong>erin von der<br />
Schweigepflicht entbinden.<br />
Mit der Wirksamkeit einer offiziellen Entbindung von der Schweigepflicht gilt die<br />
Zeugnispflicht (StPO Kt. Aargau § 96 f.) wieder.<br />
Stossen Schule und <strong>Schulsozialarbeit</strong>erin an ihre Grenzen, so kann die Verantwortliche für<br />
Kindes- und Jugendschutz der Sozialen Dienste für die weitere Planung der Hilfeprozesse<br />
eingeschaltet werden.<br />
Die <strong>Schulsozialarbeit</strong> untersteht keiner generellen Anzeigepflicht. Bei Kenntnis von<br />
Drogenkonsum einer Schülerin, eines Schülers muss sie keine Anzeige erstatten (BetmG Art.<br />
§15 Abs. 3).<br />
Priorität im Umgang mit der Schweigepflicht hat das Kindeswohl. Demnach wird von der<br />
<strong>Schulsozialarbeit</strong>erin abgewogen, welche Informationen im Sinne einer optimalen Gestaltung<br />
des Hilfeprozesses weitergegeben werden müssen.
4. Theoretische Grundlagen<br />
4.1. Definition<br />
Es existiert keine einheitlich anerkannte Definition von <strong>Schulsozialarbeit</strong>, da diese Disziplin<br />
ein relativ neues Arbeitsfeld in der Sozial Arbeit ist. Die Vorstellung und Erwartungen an die<br />
<strong>Schulsozialarbeit</strong> bezüglich ihres Auftrages, Leistungsangebotes und ihrer Arbeitsweise<br />
divergieren dementsprechend stark.<br />
Da in der gängigen Literatur, dem Schweizer Internetforum der <strong>Schulsozialarbeit</strong><br />
„www.schulsozialarbeit.ch“ als auch in vielen <strong>Konzept</strong>en Matthias Drilling zitiert wird,<br />
möchte ich an dieser Stelle seine Definition verwenden und durch die Rahmenempfehlungen<br />
der <strong>Schulsozialarbeit</strong> von avenir social ergänzen.<br />
„<strong>Schulsozialarbeit</strong> ist ein eigenständiges Handlungsfeld der Jugendhilfe, das<br />
mit der Schule in formalisierter und institutionalisierter Form kooperiert.<br />
<strong>Schulsozialarbeit</strong> setzt sich zum Ziel, Kinder und Jugendliche im Prozess des<br />
Erwachsenwerdens zu begleiten, sie bei einer für sie befriedigenden<br />
Lebensbewältigung zu unterstützen und ihre Kompetenzen zur Lösung von<br />
persönlichen und/ oder sozialen Problemen zu fördern. Dazu adaptiert<br />
<strong>Schulsozialarbeit</strong> Methoden und Grundsätze der Sozialen Arbeit auf das<br />
System Schule.“<br />
Matthias Drilling äussert sich selbst dahingehend, „... dass es die Definition von<br />
<strong>Schulsozialarbeit</strong> nur bedingt geben kann“ (Drilling, 2002, S. 69).<br />
Die Handlungswissenschaft der <strong>Schulsozialarbeit</strong> wird in den Rahmenempfehlung von avenir<br />
social wie folgt beschrieben:<br />
„Die <strong>Schulsozialarbeit</strong> fördert und unterstützt die Integration der SchülerInnen<br />
in die Schule. Die <strong>Schulsozialarbeit</strong> bietet Unterstützung für eine erfolgreiche<br />
Bewältigung des (Schul-) Alltags. Sie trägt dazu bei, sozialen und persönlichen<br />
Problemen vorzubeugen, sie zu lindern und zu lösen. Sie fördert die<br />
Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus.“<br />
(Vorstand Schweiz avenir social, 2006, www.avenirsocial.ch)<br />
4.2. Modelle der <strong>Schulsozialarbeit</strong><br />
4.2.1. Grundgedanken zu den Modellen<br />
Die Modelle in der <strong>Schulsozialarbeit</strong>en regeln im wesentlichen die Anstellungsverhältnisse<br />
und die Form der Zusammenarbeit mit der Schule. Je nach dem, wem die<br />
<strong>Schulsozialarbeit</strong>erIn unterstellt ist, ergeben sich unterschiedliche Konfliktfelder. Oftmals<br />
existiert in der Praxis eine Mischform, die für alle Beteiligten praktikabel und sinnvoll<br />
erscheint.<br />
Im <strong>Konzept</strong> der <strong>Schulsozialarbeit</strong> der Volksschule Baden beschreibt Daniel Iseli von der HSA<br />
Bern die drei Hauptmodelle. Claudine Stäger und Matthias Drilling haben in ihrem<br />
Rahmenkonzept für die Weiterbildung in Basel Vor- und Nachteile von diesen<br />
herausgearbeitet. Die nachfolgenden Ausführungen wurden durch oben genannte Texte<br />
angeregt.
4.2.2 Die Modelltypen<br />
Es existieren drei Modelle für die <strong>Schulsozialarbeit</strong>. Das Subordinationsmodell, das<br />
Kooperationsmodell und das Distanzmodell. Letzteres wird unter Punkt 4.2.3. gesondert<br />
beschrieben, da es in <strong>Neuenhof</strong> praktiziert wird.<br />
Im Subordinationsmodell wird die <strong>Schulsozialarbeit</strong> als Bestandteil der Schule gesehen und<br />
ist in die vorhandene Hierarchie vor Ort eingegliedert. Die Erfahrungen mit diesem System<br />
zeigen, dass die <strong>Schulsozialarbeit</strong> sich weitgehend an den Bedürfnissen der Schule orientiert<br />
und in ihrer Autonomie eingeschränkt ist.<br />
Im Kooperationsmodell steht die Gleichberechtigung in der Zusammenarbeit im Vordergrund,<br />
die beiden Parteien jedoch Unabhängigkeit und Selbstständigkeit zugesteht. Es bestehen klare<br />
Arbeitsschwerpunkte der einzelnen Berufsspaten, dennoch kann es zu einer Vermischung<br />
kommen.<br />
Das Subordinations- und Kooperationsmodell gehören meistens der integrierten<br />
<strong>Schulsozialarbeit</strong> an. Das bedeutet, dass die <strong>Schulsozialarbeit</strong> ausschliesslich vor Ort tätig ist.<br />
Dieses hat zwar den Vorteil, dass sie für die SchülerInnen und Lehrpersonen<br />
niederschwelliger zu erreichen ist, jedoch den Nachteil, dass sie für die Eltern schwer<br />
zugänglicher ist.<br />
4.2.3. Das Distanzmodell<br />
4.2.3.1. Kennzeichen des Distanzmodells<br />
Im Distanzmodell ist das wesentliche Merkmal, dass Schule und <strong>Schulsozialarbeit</strong> klar von<br />
einander getrennte Arbeitsfelder haben und weitgehend unabhängig von einander handeln.<br />
Erfahrungen mit diesem System zeigen, dass die Gefahr besteht, dass die Kontakte zwischen<br />
den Lehrpersonen und der <strong>Schulsozialarbeit</strong> zu lose gestaltet werden könnten. Vorteilhaft bei<br />
diesem Ansatz ist allerdings, die Unabhängigkeit und Neutralität der <strong>Schulsozialarbeit</strong>erin.<br />
Dadurch ergibt sich bei dem Distanzmodell eine niedrigschwellige Anlaufstelle für die Eltern<br />
und andere Bezugspersonen. Zudem kann sich die <strong>Schulsozialarbeit</strong>erin leichter vom System<br />
Schule abgrenzen und als externe Fachperson agieren (vgl. Drilling/ Stäger, 1999, S.8).<br />
Bisherige Auswertungen über die <strong>Schulsozialarbeit</strong> als Disziplin der Jugendhilfe zeigen, dass<br />
eine der grössten Herausforderung der Balance Akt zwischen Schule und der eigenen<br />
Berufshaltung ist. Das Distanzmodell hat ganz klar den Vorteil, dass der Schulinternen<br />
Standpunkt zwar kennen gelernt als auch respektiert wird, aber die Gefahr nicht so hoch ist,<br />
sich von dem System Schule vereinnahmen zu lassen. Der Nutzen der <strong>Schulsozialarbeit</strong> für<br />
die Schule wäre durch eine Gleichschaltung der Interessen deutlich gemindert. Die Qualität<br />
der Zusammenarbeit entsteht durch eine konstruktive Ergänzung der beiden Arbeitsweisen.<br />
Das Distanzmodell ist in der Schweiz vorwiegend der ambulanten <strong>Schulsozialarbeit</strong><br />
zuzurechnen. Bei der ambulanten <strong>Schulsozialarbeit</strong> haben die Eltern geringere Hemmungen<br />
das Angebot wahrzunehmen. Damit das Angebot für SchülerInnen und Lehrpersonen nicht zu<br />
hochschwellig ist, muss sich die <strong>Schulsozialarbeit</strong>erin laufend bemühen, dass Angebot<br />
bekannt zu machen. Dazu ist es wichtig in der Schule Engagement zu zeigen und sich<br />
einzubringen.
4.2.3.2. Umsetzung in <strong>Neuenhof</strong><br />
Laut den Richtlinien und Vorgaben im Kinder- und Jugendarbeitskonzept soll die<br />
<strong>Schulsozialarbeit</strong> in <strong>Neuenhof</strong> auf dem Distanzmodell basieren.<br />
Da sich das <strong>Gemeinde</strong>haus unmittelbar neben der Schule befindet, und die<br />
<strong>Schulsozialarbeit</strong>erin auch einen Teil ihrer Arbeitszeit in einem Besprechungszimmer an der<br />
Schule arbeitet, handelt es sich bei der <strong>Schulsozialarbeit</strong> <strong>Neuenhof</strong> um eine Mischform<br />
zwischen der ambulanten und der integrierten Form. Ein niederschwelliges Angebot kann<br />
durch einen intensiven Kontakt und hohen Bekanntheitsgrad an der Schule, als auch durch ein<br />
Besprechungszimmer vor Ort gewährleistet werden. Ein steter Kontakt zu der Lehrerschaft ist<br />
durch die Einbindung in verschiedene Schulgremien und Präsenz in den Lehrerzimmern<br />
vorhanden.<br />
Die Bemühungen um einen engen Austausch mit der Schule sind für die <strong>Schulsozialarbeit</strong>erin<br />
von Anfang an von grosser Bedeutung.<br />
In der ersten Arbeitsphase von August- November 2006, machte die <strong>Schulsozialarbeit</strong>erin<br />
sich und die Aufgaben der <strong>Schulsozialarbeit</strong> intensiv bekannt. Sie hielt einen Fachvortrag an<br />
einer Gesamtlehrerkonferenz, und ging durch alle Schulklassen. Ferner stellte sie sich und das<br />
Angebot der Schulleitung und Schulpflege vor.<br />
5. Arbeitgeber, fachliche und räumliche Angliederung<br />
5.1. Arbeitgeber<br />
Entsprechend des Distanzmodells sind auch die Anstellungs- und Rahmenbedingungen für die<br />
<strong>Schulsozialarbeit</strong>erin gewählt. Die <strong>Schulsozialarbeit</strong> ist bei der <strong>Gemeinde</strong> angestellt. Der<br />
Arbeitgeber ist daher die <strong>Gemeinde</strong> <strong>Neuenhof</strong>. Die <strong>Schulsozialarbeit</strong> ist somit in die<br />
Jugendarbeit vor Ort eingegliedert. Einen Überblick über die Organisationsstrukturen und die<br />
Vernetzung der Jugendarbeit in <strong>Neuenhof</strong> gibt das Organigramm, das im Rahmen der ecce<br />
Studie entworfen wurde. Es ist im Anhang zu finden.<br />
5.2. Fachliche Angliederung<br />
Die fachliche Angliederung regelt wem die <strong>Schulsozialarbeit</strong>erin unterstellt ist. In der<br />
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Neuenhof</strong> ist der Bereich <strong>Schulsozialarbeit</strong> dem Ressort der Sozialen Dienste<br />
unterstellt.<br />
5.2.1. Leitung und Unterstützung<br />
Somit ist Frau Spadanuda, Leiterin der Sozialen Dienste <strong>Neuenhof</strong>, die unmittelbar<br />
Vorgesetzte der <strong>Schulsozialarbeit</strong>erin. Durch die Eingliederung der <strong>Schulsozialarbeit</strong> in die<br />
Sozialen Dienste, nimmt die <strong>Schulsozialarbeit</strong>erin an den Teamsitzungen und an der<br />
Fallbesprechung der Sozialen Dienste teil.<br />
Ausserdem untersteht die <strong>Schulsozialarbeit</strong>erin den Weisungen des <strong>Gemeinde</strong>rates.<br />
5.2.2. Begleitung durch die Kinder- und Jugendkommission<br />
Die Kinder- und Jugendkommission ist eine Stabstelle, die beratend zur Seite steht. Ihr wird<br />
das Feinkonzept vorgelegt. Die Kommission wird alle 3 Monate einberufen. Die Treffen<br />
dienen der Unterstützung, aber auch der strategischen Weiterentwicklung. Die Aufgaben der<br />
Kinder- Jugendkommission sind in dem <strong>Konzept</strong> der Kinder- Jugendarbeit <strong>Neuenhof</strong>, Juni<br />
2007 auf Seite 18 beschrieben.
5.3. Räumliche Angliederung<br />
5.3.1. Überlegungen zur räumlichen Angliederung<br />
Es soll für die <strong>Schulsozialarbeit</strong>erin möglich sein, Sprechstunden und Präsenz an der Schule<br />
zu haben. Gleichzeitig, soll sie aber durch ein Büro in der <strong>Gemeinde</strong> mit den Strukturen und<br />
dem Personal dort vertraut sein und fachlich bei den Sozialen Diensten verankert sein. Daher<br />
hat die <strong>Schulsozialarbeit</strong> in <strong>Neuenhof</strong> zwei Standorte.<br />
5.3.2. Büro in der <strong>Gemeinde</strong><br />
Für die Vorbereitung der verschiedenen Präventionsmodule oder Aktionen, sowie Fallnotizen<br />
Organisation und Administratives, steht der <strong>Schulsozialarbeit</strong>erin gemeinsam mit der<br />
Jugendarbeiterin ein Büro im <strong>Gemeinde</strong>haus zur Verfügung. Dieses Büro ist nicht für den<br />
Kundenverkehr konzipiert. Der Standort fördert den Austausch und die fachliche Anbindung<br />
an die Sozialen Dienste.<br />
5.3.3. <strong>Schulsozialarbeit</strong>szimmer an der Schule<br />
An der Schule steht der <strong>Schulsozialarbeit</strong>erin das Zimmer 501 im Zentrum 5 zur Verfügung.<br />
Das Zimmer wird am Donnerstag Nachmittag von einer Flötenlehrerin mitbenutzt.<br />
5.3.3.1. Raumgestaltung<br />
Die Ausstattung besteht aus einer Sitzgruppe, 3 Magnetwänden, einem Tisch, Stühlen und<br />
einem Klavier.<br />
Auf den Raum wird durch die schulinterne Beschilderung hingewiesen. Ausserdem ist das<br />
Zimmer gut lesbar in Blau von Aussen angeschrieben. Ein wetterfester Briefkasten steht vor<br />
dem Eingang, so dass die SchülerInnen und Lehrkräfte gut Nachrichten übermitteln können.<br />
Vor der Türe ist ein Schild angebracht, mit den Öffnungszeiten und Erreichbarkeit. Durch<br />
eine Klammer können neue Informationen leicht angebracht werden. Im Falle von<br />
Abwesenheit wird an der Aussentüre und auf dem Schild vor dem Zimmer jeweils ein<br />
Hinweis zu finden sein, wo und wie die <strong>Schulsozialarbeit</strong>erin erreicht werden kann. Die<br />
Schliessanlage wird während der Sprechstundenzeiten freigeschaltet. Im Schulhaus ist W-<br />
Lan installiert, daher kann mit einem Schullaptop eine Internet Verbindung hergestellt<br />
werden.<br />
Da das Fenster im Erdgeschoss ist und leicht eingesehen werden kann, muss hier noch eine<br />
Lösung gefunden werden.<br />
5.3.3.2. Pädagogische Aspekte<br />
Bei der Raumgestaltung wurden die Kinder- und Jugendlichen mit einbezogen und konnten<br />
aktiv mitwirken. Dies förderte ihre Eigeninitiative, ihr Selbstbewusstsein, stärkte ihr Gefühl<br />
der Selbstwirksamkeit, und die Identifikation mit dem Zimmer. Der Raum soll ein Ort sein, an<br />
dem sie sich wohlfühlen und den sie gerne aufsuchen.<br />
Die Ideen der Kinder- und Jugendlichen und ihre Mitgestaltung haben folgende Ergebnisse<br />
erbracht:<br />
Fun- Fotos als Polster, Magnet Poesie, Magnet Stimmungsbilder, Magnet Spruchblasen,<br />
Bildercollage, Tischdecke<br />
Bei der zweiten Runde durch die Klassen werden die Kinder in das Zimmer eingeladen, dann<br />
kennen sie den Weg lernen und ihre Schwellenängste verlieren.
6. Zielgruppen und Zielsetzung<br />
6.1. Überlegungen zu den Zielgruppen<br />
Die Zielgruppen der <strong>Schulsozialarbeit</strong> sind in erster Linie die Schülerinnen und Schüler.<br />
Durch den systemischen Ansatz in der <strong>Schulsozialarbeit</strong> gehört auch das familiäre, aber auch<br />
das soziale Umfeld zu den Zielgruppen. Daher findet auch ein Angebot für die Familie, oder<br />
sonstige Bezugspersonen statt. Zudem können auch Personen mit einbezogen werden, die für<br />
den Ratsuchenden von grosser Bedeutung sind. Beispielsweise ein Beziehungspartner. Die<br />
Schule als System beinhaltet nicht nur die Lehrpersonen, sondern auch die Schulleitung. Die<br />
Kindergärtnerinnen werden im ganzen <strong>Konzept</strong> als Teil der Lehrerschaft angesehen.<br />
6.1.1. Schülerinnen und Schüler<br />
Schülerinnen und Schüler sind die primäre Zielgruppe der <strong>Schulsozialarbeit</strong>. Die Schule ist<br />
für die jungen Menschen ein Ort, an dem sie ihre persönlichen, sozialen und familiären<br />
Probleme zum Ausdruck bringen. Die Hoffnungen auf Unterstützung soll durch ein<br />
vielfältiges Beratungs-, Begleitungs-. und Hilfsangebot erfüllt werden. Ausserdem soll in<br />
Konflikt- und Krisenfällen interveniert und begleitet werden.<br />
6.1.2. Eltern<br />
Eltern aller Kulturen haben gewisse Schwellenängste, sich an externe Fachstellen zu wenden.<br />
Sich einzugestehen, dass in der Familie Probleme vorherrschen ist ein langer Prozess. Diese<br />
ambivalenten Gefühle nach Aussen zu tragen und professionelle Hilfe in Anspruch zu<br />
nehmen kann einen Gesichtsverlust bedeuten. Können Eltern ihren Kindern nicht selbst die<br />
erforderliche Unterstützung bieten, so können Versagens- und Schuldgefühle auftreten.<br />
Die Arbeit mit den Eltern ist eine grosse Herausforderung, da „weder Schule noch<br />
<strong>Schulsozialarbeit</strong> derzeit über adäquate Methoden einer schulbezogenen Elternarbeit<br />
(verfügen)“ (Drilling, 2002, S.118).<br />
Trotzdem ist eine wertschätzende, Ressourcen orientierte und Selbstbefähigende<br />
Beratungsarbeit Ziel der <strong>Schulsozialarbeit</strong>.<br />
6.1.3. Lehrerinnen, Lehrer und Schulleitung<br />
Lehrpersonen beobachten Auffälligkeiten ihrer SchülerInnen und erkennen Probleme, die<br />
ausserhalb ihres Aufgabenbereiches liegen. Wie bei der Einführung erwähnt, sind<br />
Lehrerinnen und Lehrer oftmals durch die Bewältigung von Problemen, die ihren Ursprung<br />
im sozialen Umfeld haben belastet. Komplexe Persönlichkeitsprobleme der SchülerInnen oder<br />
auffälliges Sozialverhalten können Lehrpersonen zu dem an ihre Grenzen bringe. Die<br />
<strong>Schulsozialarbeit</strong> soll die Lehrer bei der Bearbeitung dieser Probleme entlasten.<br />
Die Schulleitung hat eine grosse Basis Verantwortung für die Gestaltung einer Atmosphäre an<br />
der Schule, die eine positive Entwicklung der Kinder und Jugendlichen fördert.<br />
6.2. Überlegungen zur Zielsetzung<br />
Drilling und Stäger haben sich 1999 ausführlich mit den Zielen für die verschiedenen<br />
Zielgruppen auseinandergesetzt und werden oft zitiert. Im Folgenden wird Bezug auf ihr<br />
Rahmenkonzept für die <strong>Schulsozialarbeit</strong> genommen. Ergänzungen entspringen der eigenen<br />
Zielvorstellung der <strong>Schulsozialarbeit</strong>erin. Die Umsetzung der Ziele wird durch die im<br />
weiteren Text beschriebenen Methoden und Angebote erreicht.<br />
6.2.1. Ziele für die Arbeit mit den Schülerinnen und Schülern<br />
• Schnelle, unkomplizierte Unterstützung bei persönlichen und sozialen Problemen
• Begleitung bei dem Übergang vom Kind zu einer erwachsenden Person<br />
• Probleme im Anfangsstadium erkennen<br />
• Stärkung der Problemlösungs- und Sozialkompetenz bei der Einzelfallhilfe und in der<br />
Gruppenarbeit<br />
• Umgang mit Grenzen und Frustration<br />
• Bei der Lebensbewältigung unterstützen<br />
• Üben und verinnerlichen von gewaltfreier Kommunikation<br />
• Förderung in Selbst- und Fremdwahrnehmung<br />
• Stigmatisierung, Marginalisierung und Aussonderung gefährdeter SchülerInnen<br />
entgegen wirken<br />
• Unterstützung von autonomen und selbstwirksamen Verhalten<br />
• Verinnerlichung von Basisregeln im Umgang mit einander und Selbstregulation<br />
• Förderung in der individuellen und sozialen Entwicklung der Persönlichkeit<br />
• Motivation andere Fachstellen mit ihren Hilfeleistungen in Anspruch zu nehmen<br />
6.2.2. Ziele für die Arbeit mit den Eltern<br />
• Niederschwelliges Beratungs- und Hilfsangebot<br />
• Begleitung in Krisensituation durch eine neutrale Person<br />
• Motivation andere Fachstellen mit ihren Hilfeleistungen in Anspruch zu nehmen<br />
6.2.3. Ziele für die Arbeit mit den Lehrerinnen,<br />
Lehrern und der Schulleitung<br />
• Niederschwellige Hilfestellung bei Problemen von und mit SchülerInnen<br />
• Unterstützung bei der <strong>Konzept</strong>ion und Umsetzung von Präventionsanliegen<br />
• Niederschwellige Hilfestellung bei Elternarbeit<br />
• Unterstützung bei der Inanspruchnahme von Hilfeleistungen externer Fachstellen<br />
• Unterstützung bei allen Fragestellungen sozialer Art<br />
6.2.4. Sonstige Ziele<br />
• Frühzeitiges Aufdecken von Problemen und Einfädelung der geeigneten<br />
Hilfsmassnahmen, um einschneidenden Massnahmen wie Schulausschluss und<br />
Fremdplatzierung entgegen zu wirken.<br />
• Die Entwicklung guter Lernbedingungen, sollen durch die Zusammenarbeit eines<br />
interdisziplinären Teams begünstigt werden.<br />
• Das Schulklima soll in Zusammenarbeit mit SchülerInnen, Lehrerschaft und<br />
Schulleitung verbessert werden.<br />
• Die <strong>Schulsozialarbeit</strong>erin nimmt die Öffentlichkeitsarbeit, in Absprache mit dem<br />
Ressort Leiter Daniel Schibli, war. Diese hat zum Ziel, die Qualität der Schule zu<br />
untermauern und somit die Attraktivität des Wohnortes <strong>Neuenhof</strong> zu fördern.<br />
• Optimierung der Nutzung der bestehenden Ressourcen durch eine Vernetzung der<br />
unterschiedlichen Fachstellen und Helferangeboten.<br />
7. Zusammenarbeit mit der Schule<br />
7.1. Überlegungen zur Zusammenarbeit mit der Schule<br />
Das Verhältnis zur Schule soll von einer wertschätzenden, Ressourcen orientierten Haltung<br />
geprägt sein. Schule und Soziale Arbeit sollen sich nicht als Gegner oder Konkurrenz erleben,
sondern sich mit ihren Stärken gegenseitig ergänzen. Sie haben unterschiedliche Aufgaben, zu<br />
deren Erreichung eine unterschiedliche Vorgehensweise notwendig ist. Die Methoden der<br />
Sozialen Arbeit unterscheiden sich teilweise von denen der Schule, sind aber nicht als<br />
höherwertig anzusehen. Sie dienen einer anderen Zielsetzung.<br />
Zur Vermeidung von Missverständnissen ist es unabdingbar, dass beide Seiten sich um eine<br />
offene Kommunikation bemühen.<br />
7.2. Merkmale des Systeme Schule und Soziale Arbeit<br />
Hr. Henz hat sich in seiner Diplomarbeit, die von Hr. Drilling begleitet wurde, ausführlichen<br />
mit den strukturellen und funktionsbedingten Unterschieden von Schule und Sozialer Arbeit<br />
befasst. Ebenso widmete Hr. Fricker ein Kapitel seiner Diplomarbeit diesem Thema. Ich<br />
möchte mich im Folgenden auf die beiden Arbeiten beziehen.<br />
Der Auftrag der Gesellschaft an die Schule ist in erster Linie, die Kinder auf das Leben<br />
vorzubereiten. Dies beinhaltet zwei Aspekte. Einerseits müssen die SchülerInnen auf das<br />
Erwerbsleben, andererseits auf das soziale Leben vorbereitet werden. In letzterem will die<br />
<strong>Schulsozialarbeit</strong> die Lehrpersonen unterstützen und entlasten. Es entstehen auch Spannungen<br />
und Ambivalenzen, die nicht allein durch die Schule abgefangen werden können.<br />
Kennzeichen/ Aufgaben der Schule Kennzeichen/ Aufgaben der<br />
<strong>Schulsozialarbeit</strong><br />
Qualifizierung:<br />
Vermittlung von Fähigkeiten und<br />
Kenntnissen, die zur Aufnahme jeglicher<br />
Arbeit und Teilnahme im gesellschaftlichen<br />
Leben befähigt.<br />
Selektion:<br />
Durch Prüfungen, Berechtigung und<br />
Bewertung übt die Schule die Rolle der<br />
Verteilung von Zugängen zu bestimmten<br />
Lebensmöglichkeiten für die Gesellschaft<br />
aus.<br />
Mobilisierung:<br />
Orientierung an Ressourcen,<br />
Von nicht Leistungsabhängigen Fähigkeiten<br />
Soziale Befähigung durch gestärkte<br />
Problemlösungs- und Sozialkompetenz.<br />
Integration:<br />
Verhaltensstrategien erlernen, um Integration in<br />
die Gesellschaft zu ermöglichen.<br />
Politische Funktion:<br />
Es sollen Normen und Werte auch mit Hilfe<br />
von Sanktionen vermittelt werden, um auf<br />
das gesellschaftliche Zusammenleben<br />
vorzubereiten. .<br />
Ambivalenzen<br />
Individuelle Förderung versus Auslese<br />
Soziales Lernen versus konkurrenzorientiertes<br />
Leistungsprinzip<br />
Selbständigkeit versus Anpassung und<br />
Unterordnung<br />
System:<br />
Eigener Mikrokosmos,<br />
Schulinterne Regelungen und Sanktionen<br />
Autonomie und Emanzipation:<br />
Vorbereiten des Jugendlichen auf eine<br />
eigenständige Lebensführung. Sensibilisierung<br />
auf Zusammenhänge und Konsequenzen.<br />
„Doppeltes Mandat":<br />
Unterschiedliche Auftragslagen Bedürfnisse<br />
und Wünsche.<br />
Schweigepflicht versus Wohl des Kindes<br />
Lebensweltorientierung:<br />
Eigenverantwortung und Selbstregulierung, für<br />
die Lebenswelt des Jugendlichen verständlich<br />
und praktikabel.
Kommunikation:<br />
Sachorientiert, zweckrational, bewertend<br />
Weisungsbefugnis<br />
Hoher formaler Anteil, Abläufe<br />
Kommunikation:<br />
Offen, orientiert an den Problemen der<br />
Jugendlichen, keine Bewertung, Grundsätze der<br />
Gesprächsführung und der wertschätzenden<br />
Kommunikation<br />
Freiwilligkeit<br />
Hoher Nonformaler Anteil, Flexibilität<br />
7.3. Gestaltung der Zusammenarbeit und des Informationsflusses<br />
7.3.1. Überlegungen zur Gestaltung der Zusammenarbeit<br />
und des Informationsflusses<br />
Um am Puls des Geschehens teilnehmen zu können und die anstehenden Bedürfnisse und<br />
alltäglichen Sorgen besser verstehen zu können, aber auch für einen regelmässigen und<br />
reibungslosen Informationsfluss nimmt die <strong>Schulsozialarbeit</strong>erin an schulinternen Gremien<br />
teil.<br />
7.3.2. AnsprechpartnerInnen<br />
Geht es um eine Schülerin oder einen Schüler, so sucht die <strong>Schulsozialarbeit</strong>erin zunächst die<br />
Klassenlehrperson auf. Für generelle Anliegen, oder für komplexe Entscheidungen sind der<br />
Schulleiter und die Stufenleiterinnen für die <strong>Schulsozialarbeit</strong>en vor Ort die zuständigen<br />
AnsprechpartnerInnen. Mit ihnen erfolgen auch terminliche und fachliche Absprachen.<br />
7.3.3. Teilnahme an Sitzungen und Gremien<br />
7.3.3.1. Schulparlament<br />
Die Sitzungen des Schulparlaments werden durch den Präsidenten und den Vorstand geleitet<br />
und geführt. Je 2 VertreterInnnen aus allen Klassen der Oberstufe können ihre Wünsche und<br />
Themen vorbringen. Es werden Anträge gestellt, über die abgestimmt wird. Die<br />
<strong>Schulsozialarbeit</strong>erin berät und begleitet dieses Gremium, den Vorstand und Präsidenten. Sie<br />
kann zu anderen Stellen begleiten und den Jugendlichen zur Seite stehen, strategische<br />
Überlegungen mit einbringen. Wichtig ist, dass die Jugendlichen selber die Initiative ergreifen<br />
und selbstwirksam tätig werden. Es soll keine Bevormundung stattfinden, sondern eine<br />
Unterstützung der Jugendlichen erfolgen.<br />
7.3.3.2. Stufensitzungen<br />
Mit Zustimmung der gesamten Schulleitung hat die <strong>Schulsozialarbeit</strong>erin beschlossen, jede<br />
Woche an einer der Stufensitzungen teilzunehmen. Das bedeutet, dass sie in jedem<br />
Stufenteam einmal pro Monat anwesend ist. Bei Bedarf kann auch eine ausserterminliche<br />
Abmachung getroffen werden. Zur Zeit finden die Stufensitzungen am Mittwoch über den<br />
Mittag statt. Durch die Anwesenheit an den Sitzungen ist die <strong>Schulsozialarbeit</strong>er als<br />
Ansprechpartnerin präsenter und greifbarer. Es werden eher Themen an sie herangetragen.<br />
Zudem kann das Angebot aktuellen Strömungen angepasst werden. Die Kontaktpflege und<br />
das Bekannt machen des Angebots, wie auch Beratung und Unterstützung der Lehrpersonen<br />
gehören zu den Zielen, deren Umsetzung angestrebt wird.<br />
7.3.3.3. Schulleitungssitzung<br />
Einmal im Quartal nimmt die SSA an der Schulleitungssitzung teil. Gibt es zusätzliche<br />
Themen, die besprochen werden sollen, kann die <strong>Schulsozialarbeit</strong>erin auf Bedarf angefragt
werden. Verfolgt die Teilname an den Stufensitzung das Ziel praktische und alltagsnahe<br />
Begleitung zu geben, so stehen bei der Schulleitungssitzung planerische und strategische<br />
Überlegungen im Vordergrund. Es wird nicht vom einzelnen Individuum ausgegangen,<br />
sondern die Schule als System betrachtet.<br />
7.3.3.4. Schulpflegesitzung<br />
In die Sitzungen der Schulpflege kann die <strong>Schulsozialarbeit</strong>erin zu Themen aus ihrem<br />
Aufgabengebiet eingeladen werden. Ferner kann ihre Meinung in Disziplinarangelegenheiten<br />
angefragt werden.<br />
7.3.3.5. Logopädiesitzung<br />
Bei Bedarf kann die <strong>Schulsozialarbeit</strong>erin auch in die Logopädie Sitzung eingeladen werden.<br />
Es ist zwar keine regelmässige Teilnahme geplant, aber der Austausch über einzelne Fälle und<br />
gemeinsame Ziele kann im Einzelfall von Nöten sein.<br />
7.3.3.6. Besprechung Mittagstisch<br />
Wenn ein Anliegen vorhanden ist, kann die <strong>Schulsozialarbeit</strong>erin auch für ein Treffen mit<br />
dem Mittagstisch eingeladen werden. Die Mitarbeiterinnen des Mittagstisches können sich bei<br />
fachlichen Fragen, oder für eine konkrete Unterstützung an die <strong>Schulsozialarbeit</strong>erin wenden.<br />
Auf die Bedürfnisse des Mittagstisches wird noch unter Punkt blabla eingegangen.<br />
7.3.3.7. Projektbesprechungen<br />
Bei Projekten für die Gesamtschule nimmt die <strong>Schulsozialarbeit</strong>erin teil, soweit es möglich ist<br />
und Sinn macht. Dies bietet die Möglichkeit, sich mit einem eigenen Programm einzubringen,<br />
oder Interesse an der Arbeit der SchülerInnen zu signalisieren. Ferner kann es eine Chance<br />
sein, um die Eltern mit in den Schulalltag einzubeziehen. Je nach Thema und Situation kann<br />
ein Projekt auch als konkreter Anlass für einen Öffentlichkeitswirksamen Auftritt genutzt<br />
werden.
7.3.4. Kommunikation und Kontaktpflege<br />
7.3.4.1. Überlegungen zur Kommunikation und Kontaktpflege<br />
Die <strong>Schulsozialarbeit</strong>erin kommuniziert offen und wertschätzend. Sie bemüht sich alle<br />
Beteiligten ausreichend zu informieren und mit einzubeziehen.<br />
In der Schule <strong>Neuenhof</strong> werden nicht alle Abläufe und Abmachungen formell geregelt. Viele<br />
Sachen werden situationsabhängig betrachtet. Es gibt Entscheidungen, bei denen die<br />
Stufenleiterinnen oder die Lehrperson Spielräume hat. Durch das Modell der Schulleitung mit<br />
Schulleiter und Stufenleiterinnen sind die Zuständigkeiten nicht immer gleich ersichtlich.<br />
Da die teils formell geregelten, teils informell gehandhabten Bestimmungen für eine Externe<br />
nicht immer durchschaubar sind, fragt die <strong>Schulsozialarbeit</strong>erin bei Unklarheiten nach. Eine<br />
Art „System Dolmetsching“ soll zu einer fruchtbaren und reibungslosen Zusammenarbeit<br />
beitragen.<br />
7.3.4.2. Massnahmen zur Förderung von Kommunikation und Kontakt<br />
• In der Pause hält sich die <strong>Schulsozialarbeit</strong>erin, so oft wie möglich, abwechselnd auf<br />
dem Pausenhof oder im Rotationsverfahren in den verschiedenen Lehrerzimmern auf.<br />
• Bei Gesamtanlässen der Schule markiert die <strong>Schulsozialarbeit</strong>erin Präsenz oder nimmt<br />
aktiv teil.<br />
• Findet die Durchführung eines Präventionsmoduls in einer Klasse statt, oder wurde die<br />
<strong>Schulsozialarbeit</strong>erin in einer Klasse zur Krisenintervention gerufen oder zur<br />
Teilnahme am Klassenrat eingeladen, so sollte im Rahmen der Möglichkeiten eine<br />
Vor- und Nachbesprechung mit der Lehrperson statt finden.<br />
• Bei der Begleitung und Beratung von Einzelfällen hält sich die <strong>Schulsozialarbeit</strong>erin<br />
an die Schweigepflicht. Sie fragt jedoch bei der Schülerin/ bei dem Schüler nach, ob<br />
und welche Rückmeldung an die Lehrperson weitergegeben werden kann.<br />
7.3.5. Erreichbarkeit<br />
Die Erreichbarkeit ist für die Zusammenarbeit eine zentrale Voraussetzung. Folgende<br />
Möglichkeiten sollen Klarheit darüber verschaffen, wann und wie die <strong>Schulsozialarbeit</strong>erin<br />
erreichbar ist.<br />
• Im Zentrum 6 hat die <strong>Schulsozialarbeit</strong>erin ein Fach, in dem eine Nachricht für die<br />
<strong>Schulsozialarbeit</strong>erin deponiert werden kann.<br />
• Für die SchülerInnen gibt es die Möglichkeit eine Nachricht im Briefkasten vor dem<br />
<strong>Schulsozialarbeit</strong>szimmer zu hinterlassen.<br />
• Telefonisch ist die <strong>Schulsozialarbeit</strong>erin im Büro in der <strong>Gemeinde</strong> oder über das<br />
Mobil Telefon (078 819 78 79) von Montag bis Donnerstag zu erreichen. Ist während<br />
den Sitzungen das Telefon ausgeschaltet, so kann eine Nachricht auf der Mobilbox<br />
hinterlassen werden und es erfolgt im Anschluss ein Rückruf. Am Wochenende wird<br />
das Telefon nicht bedient.<br />
• Eine zeitgemässe und unkomplizierte Form der Kontaktaufnahme ist per Email. Die<br />
Mailadresse ist: schulsozialarbeit@neuenhof.ch<br />
• In den Pausen ist die <strong>Schulsozialarbeit</strong>erin wie folgt anwesend oder erreichbar:<br />
Montag bis Donnerstag von 9.55-10.15 Uhr<br />
Montag und Dienstag von 15.15- 15.30 Uhr<br />
• Für eine Beratung in den offenen Sprechstunden sollte vorher ein Termin abgemacht<br />
werden. Es ist auch möglich kurzfristig Bescheid zu geben, oder spontan<br />
unangemeldet zu kommen. Jedoch ist dann nicht garantiert, dass ein Termin frei ist.<br />
Sprechstunden im Zimmer 501 finden wie folgt statt:<br />
Montag und Dienstag von 15.30- 18.00 Uhr.
Donnerstag von 12.30-13.30 Uhr.<br />
Auf das Angebot der Sprechstunden wird noch gesondert eingegangen.<br />
7.3.6. Informationsfluss<br />
Ein guter Informationsfluss ist die Basis auf der eine gute Nachfrage für die einzelnen<br />
Angebote erzielt werden kann. Nachstehend sind Überlegungen angeführt, die den<br />
Informationsfluss sichern sollen.<br />
• Eine „Informationsecke“ zentral gelegen, zwischen Zentrum 5 und 6 wird von der<br />
<strong>Schulsozialarbeit</strong>erin und interessierten SchülerInnen gestaltet. Dort weist ein Plakat<br />
auf die Übersicht des Standard Programms und die Sprechstunden hin. Ausserdem ist<br />
die Stelle als Plattform für aktuelle Informationen, Projekte und das Mittwoch<br />
Nachmittagsprogramm gut geeignet. In den anderen Schulhäusern werden Plakate an<br />
geeigneter Stelle platziert. So ist den SchülerInnen das Angebot stets präsent und sie<br />
haben die Möglichkeit unauffällig an die Kontaktadresse zu gelangen.<br />
• Der Text und die farbige Gestaltung des Flyers soll vor allem die Kinder- und<br />
Jugendlichen ansprechen. Einige SchülerInnen wurden bei der Erstellung des<br />
Bildmaterials mit einbezogen. Das Design und der Text werden in 2 unterschiedlichen<br />
Varianten den verschiedenen Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen angepasst.<br />
Die Flyer werden beim 2.Rundgang durch die Klassen Anfangs November verteilt.<br />
Ausserdem werden die Flyer in einer günstigeren Schwarz- Weiss Version bei der<br />
„Informationsecke“ aufliegen.<br />
• Die Eltern werden durch einen Elternbrief von ihren Kindern informiert. Der Brief<br />
wird zusammen mit den Flyers Anfangs November verteilt. Wenn ein Gesamtanlass<br />
gestaltet wird, so werden die Eltern separat mit einem Brief via ihre Kinder<br />
eingeladen.<br />
• Es existiert eine Visitenkarte, in der Standard Ausführung der <strong>Gemeinde</strong>. Diese kann<br />
für Eltern, Fachstellen, oder für die Lehrer zum Weitergeben an die Eltern von<br />
grossem Nutzen sein.<br />
• Die Schulsoziaarbeiterin ist ständig um die Bekanntmachung des Standard- und<br />
erweiterten Angebots bemüht. Im Wochenbulletin werden die Öffnungszeiten und neu<br />
erscheinende Angebotsinformationen unter allen Lehrpersonen bekannt gemacht.<br />
Zusätzlich werden die Informationen in jedem Lehrerzimmer im Vademekum Ordner<br />
zu finden sein. Wenn ein neues Präventionsprogramm eingeführt wird, so soll es in<br />
den Stufensitzungen durch die <strong>Schulsozialarbeit</strong>erin vorgestellt werden.<br />
• Auf einer Seite im Internet unter www.neuenhof.ch werden wichtige Informationen<br />
veröffentlicht. Unter anderem können dort das <strong>Konzept</strong>, der Flyer, die Sprechstunden,<br />
Kontakt, ein Lageplan, aktuelle Aktionen, Programm für den Mittwoch Nachmittag<br />
und Fotos eingesehen werden. Die Zielgruppen, Fachkollegen/ Fachkolleginnen und<br />
andere Fachstellen können sich unverbindlich informieren. Ausserdem ist es eine<br />
Homepage für die Öffentlichkeit wirksames Medium.<br />
• Die Seite ist bereits freigeschalten, erste Daten werden bis Ende November verfügbar<br />
sein.<br />
• Damit sich die Lehrpersonen gut orientieren können, werden Merkblätter entwickelt.<br />
Im Anhang sind bereits erste Anregungen zu finden.<br />
• Wird deutlich, dass die Stufenleitung über eine Klassenintervention informiert werden<br />
muss, so bittet die <strong>Schulsozialarbeit</strong>erin zunächst die Lehrperson selbst dies zu tun.<br />
Falls dies nicht erfolgt, spricht sie selbst mit der Leitung.<br />
7.3.7. Initiative für die Inanspruchnahme des Angebotes
Die Inanspruchnahme der Beratung, Begleitung und Unterstützung erfolgt grundsätzlich<br />
freiwillig. Der Erstkontakt kann durch eine Dritte Person (z.B. Lehrperson, Schul- bzw.<br />
Stufenleitung, Eltern) eingefädelt werden.<br />
Die Entwicklung des Angebots wird durch Absprache mit dem Schulleitungsteam auf die<br />
aktuelle Situation in <strong>Neuenhof</strong> angepasst. Die Durchführung der Präventionsmodule kann auf<br />
Anfrage einzelner Lehrpersonen erfolgen. Ebenso verhält es sich mit der Krisenintervention<br />
in der Klasse.<br />
Möchte eine Stufenleiterin oder die Schulleitung, dass das Angebot verpflichtend<br />
durchgeführt wird, so muss die Initiative und die Abklärung und Aussprache durch die<br />
Leitungsperson erfolgen. Die <strong>Schulsozialarbeit</strong>erin wird dann von der betroffenen Lehrperson<br />
oder der Leitung informiert.<br />
Für die SchülerInnen ist eine Teilnahme dann obligatorisch, wenn das Angebot während der<br />
Schulzeit im Rahmen einer Klassenintervention stattfindet.<br />
8. Grundsätze und Methoden der <strong>Schulsozialarbeit</strong><br />
8.1. Grundsätze<br />
Die <strong>Schulsozialarbeit</strong> handelt nach den Grundsätze und Methoden aus dem Berufsfeld der<br />
Sozialen Arbeit. Sie bilden die Basis jeglicher praktischer Arbeitsweise. Der folgende Text ist<br />
so aufgebaut, dass im ersten Schritt der theoretische Grundsatz kurz erläutert wird. Im zweiten<br />
Schritt wird dann auf die Art und Weise der Umsetzung in <strong>Neuenhof</strong> Bezug genommen.<br />
8.1.1. Freiwilligkeit<br />
Bei der Erläuterung der rechtlichen Rahmenbedingungen wurde bereits kurz auf den<br />
Grundsatz der Freiwilligkeit eingegangen. Bei der Individualhilfe kann die Anbahnung des<br />
Erstkontaktes durch eine Dritte Person initiiert werden. Gerade dann ist die<br />
<strong>Schulsozialarbeit</strong>erin dazu angehalten, ein professionelles Beratungs-Setting zu gestalten, so<br />
dass den Kindern und Jugendlichen innerhalb kurzer Zeit ein Gefühl des Verstanden-<br />
Werdens und Akzeptiert- Seins gegeben werden kann (vgl. Henz, 2005, S.22).<br />
In <strong>Neuenhof</strong> wurden einige Überlegungen angestellt, wie ein Vertrauensverhältnis gefördert<br />
werden kann, auch wenn die Erstkontaktaufnahme nicht aus eigener Initiative gestartet wurde.<br />
Der Raum ist zentral, aber von den Standard Unterrichtsräumen entfernt. Die Gestaltung weist<br />
auf einen Kontext hin, der sich von dem schulischen Lernauftrag entscheidet. Die<br />
<strong>Schulsozialarbeit</strong>erin bemüht sich darum transparent ihre Aufgabe in dem Setting<br />
darzustellen. Durch eine wertschätzende Haltung als auch das Ernst nehmen der Sicht und des<br />
Anliegen der Schülerin/ des Schülers soll eine fruchtbarer Boden für weitere Gespräche<br />
entstehen. Die <strong>Schulsozialarbeit</strong>erin motiviert zu einem weiteren Gespräch, falls es ihr<br />
notwendig erscheint. Die Entscheidung über einen erneuten Besuch liegt allerdings bei der<br />
Schülerin/ bei dem Schüler.<br />
8.1.2. Schweigepflicht und Meldepflicht<br />
Die rechtlichen Grundlagen zur Schweigepflicht sollen an dieser Stelle durch pädaogische<br />
Überlegungen ergänzt werden. Durch den Grundsatz der Schweigepflicht muss von der<br />
<strong>Schulsozialarbeit</strong> in der Situation abgewägt werden, welche Informationen weitergegeben<br />
werden müssen, um eine Gefährdungssituation zu entschärfen. Um nicht Geheimnisträger im<br />
System zu werden, sollte bei Gefährdungsproblematiken früh, mit den Kunden, die<br />
Entbindung von der Schweigepflicht thematisiert werden.
Ein gewisses Spannungsfeld entsteht auch dadurch, dass andere Beteiligte mit Informationen<br />
versorgt werden wollen. Hier gilt, dass die Schülerin/ der Schüler vorher ihr Einverständnis<br />
erteilen müssen.<br />
8.1.3. Niederschwelligkeit<br />
Das Angebot ist vor Ort vernetzt und bekannt gemacht. Es besteht in den Sprechstunden die<br />
Möglichkeit eine Beratung ohne Voranmeldung aufzusuchen. Die Wartezeiten sind gering<br />
und der formelle Aufwand (komplizierte Anmeldung/ Genehmigung) entfällt. Durch die<br />
Präsenz auf dem Pausenplatz und in den Lehrerzimmern hat die <strong>Schulsozialarbeit</strong> Züge der<br />
aufsuchenden Arbeit. Diese Komponenten ist für die Kontaktaufnahme und informelle<br />
Beratung unumgänglich. Auf die Kommunikations- und Kontaktpflege wurde in diesem<br />
<strong>Konzept</strong> bereits eingegangen.<br />
8.1.4. Nachhaltigkeit<br />
Um die Überprüfung ob, die Hilfeleistung nachhaltige Erfolge erzielt hat, nimmt die<br />
<strong>Schulsozialarbeit</strong>erin nach Interventionen oder Individualhilfe informellen Kontakt mit der<br />
ehemals ratsuchenden Person auf. Stellt sich beim informellen Austausch heraus, dass eine<br />
weitere Hilfe notwendig wäre, so empfiehlt die <strong>Schulsozialarbeit</strong>erin weitere Schritte. Sie rät<br />
zu einer weiteren Zusammenarbeit, erzwingt sie aber nicht.<br />
Bei der Durchführung von Präventions- oder Klasseninterventionsangeboten berät die<br />
<strong>Schulsozialarbeit</strong>erin dahingehend, ein weiteres Angebot in einem gewissen Abstand noch<br />
einmal durchzuführen. Damit soll der "Versandungseffekt" verhindert werden und das<br />
Gelernte gefestigt werden. Die Auseinandersetzung mit dem eigenen Verhalten ist prozesshaft<br />
und kann nicht mit einer Intervention als abgeschlossen betrachtet werden.<br />
8.1.5. Ressourcenorientierung<br />
Die Stärken und Fähigkeiten bilden die Grundlage in der Begleitung der KundInnen. Der<br />
Fokus in der Ausgangslage wird auf die Eigenschaften gelegt, über die die Person verfügt. Bei<br />
Problemen wird zusammen mit den Stärken aller Beteiligten das des Handlungskonzepts<br />
erarbeitet. Die Person wird bei in der Entwicklung von Bewältigungsstrategien unterstützt und<br />
somit selbst befähigt. Durch den eigenen Anteil am Lösungsprozess und die Beleuchtung der<br />
Stärken wird das Selbstwertgefühl gestärkt. Die Ressourcen des Gegenübers wahrzunehmen<br />
und sie mit einzubeziehen erfolgt nicht erst bei der Problemlösung, sondern in jedem Schritt<br />
des Beratungsprozesses. Sie muss sich in der Grundhaltung der <strong>Schulsozialarbeit</strong>erin<br />
wiederspiegeln.<br />
8.1.6. Beziehungsarbeit<br />
Durch das Vorleben (Modelllernen) und bewusste Gestalten einer positiven Beziehungskultur<br />
legt die <strong>Schulsozialarbeit</strong>erin den Grundstein für eine konstruktive Krisenintervention und<br />
anderweitige Hilfestellungen.<br />
Die Möglichkeit die <strong>Schulsozialarbeit</strong>erin unbefangen ansprechen zu können ist für den<br />
Vertrauens- und Beziehungsaufbau unerlässlich. Die Präsenz im Schulhaus und auf dem<br />
Pausenplatz, die Teilnahme an wichtigen Ereignissen (z.B. Wahl des Präsidenten des<br />
Schulparlaments) sind ebenso wichtig, wie informelle Gespräche auf dem Pausenhof.<br />
Ferner bietet auch das Freizeitangebot und das Mitwirken in den Klassen eine gute<br />
Möglichkeit, um die SchülerInnen kennen zu lernen. Auf der Ebene der Lehrpersonen sind<br />
Besuche in den Stufenteams, informelle Gespräche auf dem Pausenhof und in den<br />
Lehrerzimmern Bestandteil der Beziehungsarbeit.<br />
8.1.7. Prozessorientierung
Die <strong>Schulsozialarbeit</strong> ist weniger Ergebnis- als Prozessorientiert. Beim Kontakt mit einem<br />
KundInnen steht oft erstmals ein konkreter Auslöser im Vordergrund. Die eigentliche Ursache<br />
für die Problemlage ist aber oftmals „das Thema hinter dem Thema“. Die Schülerin/ der<br />
Schüler werden von der <strong>Schulsozialarbeit</strong> nicht mit einem vorgefertigten Lösungsmuster<br />
bedingt, sondern werden mit Fragen auf der Gefühlsebene zu einer eigenen Lösungssuche-<br />
Dynamik bewegt. „Erst wenn ein Schüler bzw. eine Schülerin das Gefühl hat, den Prozess<br />
selbst zu steuern, wird er bzw. sie sich auch die Erfolge zuschreiben. Damit ist ein<br />
wesentliches Ziel auf dem Weg zu einer dauerhaften Lösung erreicht“ (Drilling, 2002, S.<br />
109).<br />
Es ist darüber hinaus die Aufgabe der <strong>Schulsozialarbeit</strong>erin, alle Beteiligten für die<br />
Prozesshaftigkeit zu sensibilisieren.<br />
8.1.8. Systemorientierung<br />
Die <strong>Schulsozialarbeit</strong> sieht das Individuum als Teil eines komplexen Systems. Die Lösung<br />
kann nicht nur bei dem Problemträger gefunden werden. Deshalb sollen, wenn immer<br />
möglich alle Beteiligten mit einbezogen werden.<br />
Für eine Veränderung müssen feste, langjährige Strukturen in einem System aufgeweicht und<br />
neue organisiert werden. Bei einer massiven Problemlage muss die <strong>Schulsozialarbeit</strong>erin, in<br />
ihrer Drehscheibefunktion, an andere Fachstellen weitergeben. Dort kann dann längerfristig<br />
mit den Betroffenen gearbeitet werden.<br />
8.1.9. Integration<br />
Die Ausgrenzung an der Schule spiegelt die gesamt gesellschaftlichen Tendenzen wieder.<br />
Randgruppen oder Individuen können aufgrund ihrer Religion, ihrer Herkunft, ihres sozialen<br />
Status, ihrer sexuellen Orientierung und anderen Merkmalen ausgegrenzt werden. Mit einem<br />
integrativem Ansatz will die <strong>Schulsozialarbeit</strong> Randgruppen mit einbeziehen und ein Gefühl<br />
der Zugehörigkeit kreieren. In <strong>Neuenhof</strong> wird dieser Aspekt bereits von Seiten der Lehrer in<br />
ihre tägliche Arbeit mit einbezogen. Die <strong>Schulsozialarbeit</strong>erin will bei den bereits<br />
bestehenden Strukturen ansetzen. Mit einer integrativen Haltung, kann Mobbing Tendenzen,<br />
aber auch dem Abtriften in die Delinquenz vorgebeugt werden. Der frühzeitige Einbezug<br />
ausländischer Eltern ist die Grundvoraussetzung für die Integration der Kinder. Deshalb muss<br />
bereits im Kindergartenalter ein intensiver Kontakt zu den Eltern aufgebaut werden (vgl.<br />
Johann, 2004, S. 39 ff.)<br />
8.1.10. Triage<br />
Die <strong>Schulsozialarbeit</strong>erin fungiert in ihrer Rolle nicht nur als Beraterin, sondern hat auch eine<br />
Drehscheibenfunktion. Taucht in der Beratungssituation ein sehr spezifisches und stark<br />
ausgeprägtes Problem auf, dessen Lösung anderweitiger Hilfe bedarf, so wird an eine andere<br />
Fachstelle verwiesen. Die <strong>Schulsozialarbeit</strong>erin übernimmt in diesem Fall folgende Aufgaben:<br />
Eine ausführliche Information über das aktuelle Hilfsangebot, Unterstützung bei der Auswahl,<br />
Motivation für das Aufsuchen der gewählten Stelle und je nach Wunsch auch die Begleitung<br />
dorthin.<br />
Die <strong>Schulsozialarbeit</strong>erin ist um eine gute Zusammenarbeit mit anderen Fachstellen bemüht.<br />
Ferner ist sie über das aktuelle Angebot in der Region informiert.<br />
8.1.11. Geschlechtsspezifisches Angebot<br />
Im Freizeitangebot, wie auch bei bestimmten Themen der Prävention macht es Sinn nach<br />
geschlechtsspezifischen Aspekten zu arbeiten. Beim Freizeitangebot kann so beiden Gruppen<br />
eine Entfaltung und ein Ausleben ihrer Interessen geboten werden.<br />
Die Arbeitsansätze unterscheiden sich je nach Themengebiet. Beispielsweise wird Gewalt<br />
oftmals a priori dem männlichen Geschlecht zugeordnet. Jedoch gibt es auch eine weibliche
Form von Gewalt, der mit anderen Mitteln begegnet werden muss. Auch in der Sucht gibt es<br />
Tendenzen, dass Jungen und Mädchen aus unterschiedlichen Motiven heraus für andere<br />
Formen von Abhängigkeit gefährdet sind. Die <strong>Schulsozialarbeit</strong>erin bietet in Zusammenarbeit<br />
mit den Lehrkräften im Rahmen der Prävention oder Klassenintervention,<br />
geschlechtspezifische Gruppenarbeit an.<br />
8.1.12. Selbstreflexion<br />
Die <strong>Schulsozialarbeit</strong>erin bemüht sich um eine Reflektion der eigenen Arbeitsweise. Sie holt<br />
sich eigenständig bei anderen Fachleuten Feedback. Sie nimmt an der Fallbesprechung der<br />
sozialen Dienste aktiv teil und bringt auch eigene Fälle vor. Ein ständiges Lernen, durch<br />
eigene Initiative oder auf Anregung von anderen hin, ist ihr ein grosses Anliegen. Es ist für<br />
die Qualität der Arbeit wichtig, sich damit auseinander zu setzen, welchen Anteil die eigenen<br />
Erfahrungen und Kultur an der Sichtweise der Problemlage haben. Dies gilt insbesondere für<br />
Vermittlung im in der interkulturellen Arbeit (vgl. Haumersen, 2005, S.26 ff.).<br />
8.1.13. Neutralität<br />
Die <strong>Schulsozialarbeit</strong>erin versucht ihre neutrale Rolle aufrecht zu erhalten. Als<br />
Sozialpädagogin ist sie eine externe Fachkraft, die das System Schule kennt, aber den<br />
Berufseigenen Prinzipien folgt.<br />
8.2. Methoden<br />
An dieser Stelle sollen die Hauptmethoden der <strong>Schulsozialarbeit</strong> kurz genannt und<br />
beschrieben werden. Der folgende Text ist so aufgebaut, dass im ersten Schritt der<br />
theoretische Grundsatz kurz erläutert wird. Im zweiten Schritt wird dann auf die Art und<br />
Weise der Umsetzung in <strong>Neuenhof</strong> Bezug genommen.<br />
Die genannten Methoden werden in dem Angebot der <strong>Schulsozialarbeit</strong> angewendet und<br />
umgesetzt.
8.2.1. Individualhilfe<br />
Die Einzelfallhilfe folgt dem Motto „Befähigung zur Selbsthilfe“. In erster Linie ist sie ein<br />
Angebot für SchülerInnen, die von sozialen, familiären, schulischen oder persönlichen<br />
Problemen betroffen sind.<br />
Ausgangspunkt ist die/der Ratsuchende selbst mit seinen Verhaltensweisen, Kompetenzen,<br />
Empfindungen, Einschätzungen und Sichtweisen von der Situation. Er wird nicht losgelöst<br />
von seinem Umfeld betrachtet, sondern seine Beziehung zu seinem sozialen Umwelt stehen<br />
im Mittelpunkt.<br />
Gemeinsam mit der Schülerin/ dem Schüler wird in einem ersten Schritt die Krisensituation<br />
betrachtet und analysiert. Die subjektiven Informationen und Empfindungen spielen dabei<br />
eine grosse Rolle. Wenn es nötig ist, können weitere Sichtweisen von anderen Personen, oder<br />
Informationen von Fachstellen eingeholt werden.<br />
In einem nächsten Schritt wird die Schülerin/ der Schüler darin unterstützt ihr/ sein Vorgehen,<br />
dass eine Veränderung herbeiführen könnte in Etappen zu planen. Personen aus dem Umfeld,<br />
oder Fachstellen können hinzugezogen werden.<br />
Ziele des Hilfeprozesses sind:<br />
• Herstellung einer besseren Balance zwischen Individuum und Umwelt<br />
• Entschärfung der aktuellen Konfliktlage/ Krisensituation<br />
• Förderung der Persönlichkeitsentwicklung und der eigenen Bewältigungs-Strategien<br />
In <strong>Neuenhof</strong> muss bei der Einzelfallhilfe der kulturelle Hintergrund mit einbezogen werden.<br />
Schweizer Kinder- und Jugendliche, als auch Kinder- und Jugendliche mit<br />
Migrationshintergrund werden mit ihren individuellen Bedürfnissen ernst genommen.<br />
Das reibungslose Zusammenleben aller Gruppierungen wird durch einen aktiven<br />
Interkulturellen Austausch gefördert.<br />
Da das Kind bzw. der Jugendliche mit Migrationshintergrund im Spannungsfeld zwischen<br />
seiner Herkunftskultur und den Werten der Schweizer Gesellschaft steht, versucht die<br />
<strong>Schulsozialarbeit</strong>erin die kulturspezifischen Aspekte mit einzubeziehen. Die entwickelten<br />
Lösungsstrategien müssen mit den familiären Vorstellungen zu vereinbaren sein, um die<br />
Ratsuchende Person vor einem Loyalitätskonflikt zu schützen. Zudem entspricht es der<br />
Haltung der <strong>Schulsozialarbeit</strong>erin andere Kulturen zu respektieren.<br />
Widersprechen die familiären Auffassungen dem realistischen Wunsch des Ratsuchenden<br />
vehement, so soll dieser bei einer konstruktiven Auseinandersetzung mit der Familie<br />
unterstützt werden. Sind die Erziehungsansichten in der Familie nicht mit den Grundrechten<br />
in der Schweiz kompatibel und scheint dadurch das Kindeswohl gefährdet, so erstattet die<br />
<strong>Schulsozialarbeit</strong>erin Meldung.<br />
8.2.2. Soziale Gruppenarbeit<br />
Für Kinder, aber insbesondere für Jugendliche spielen die Gleichaltrigen eine grosse Rolle.<br />
Sie lernen untereinander und können neue Verhaltesweisen besser testen, als allein. Die<br />
Gruppe hat eine sozialisationsrelevante Funktion. Tabus können gebrochen und konstruktiv<br />
bearbeitet werden. Aus diesen Gründen eignet sich das Instrument der sozialen Gruppenarbeit<br />
insbesondere für die <strong>Schulsozialarbeit</strong>.<br />
Die folgende Beschreibung der Wesensmerkmale der sozialen Gruppenarbeit wurde von<br />
Drilling und Stäger 1999 verfasst.<br />
Die Gruppe gilt als Ort für Wachstum, Reifung und Bildung. Wird die Gruppe als Medium<br />
der Erziehung benutzt, so hat sie mit der <strong>Schulsozialarbeit</strong>erin eine klar definierte<br />
Leitungsperson. Mit gemeinsam erarbeiteten Arbeitsregeln, und nach den Leitsätzen der<br />
Gesprächsführung wird die Gruppe durch die Leitung moderiert. Im Zentrum steht nicht nur
die spezifische Problem-/ Fragestellung, sondern stets die Förderung der sozialen<br />
Funktionsfähigkeit des Einzelnen im Rahmen der Gruppenarbeit. Im Bezug auf die<br />
Problembearbeitung übernimmt die Gruppe es, über Massnahmen und weiteres Vorgehen zu<br />
entscheiden.<br />
Die Gruppe kann je nach Thema altershomogen, geschlechtsspezifisch, oder heterogen (im<br />
Bezug auf Geschlecht oder Alter) zusammengesetzt werden.<br />
Folgende Faktoren sind bei geleiteten Gruppenprozess von Bedeutung:<br />
„ (1) die Stellung des Einzelnen in der Gruppe, (2) die Rolle des Einzelnen in Abhängigkeit<br />
von der Gruppe, sowie (3) die Bindung der einzelnen Gruppenmitglieder zueinander“ (ebd.<br />
S.10).<br />
Das Arbeiten mit dem Klassenverband ist für die <strong>Schulsozialarbeit</strong>erin von grosser<br />
Bedeutung. Oftmals sind in der Klasse bestimmte Rollenverteilungen und Gruppendynamiken<br />
manifestiert. Um eine Veränderung herbeizuführen, müssen die SchülerInnen erst ein<br />
Bewusstsein für die Existenz dieser Rollen und Dynamiken entwickeln. Dann muss die<br />
Bereitschaft zu einem selbstreflektiertem Auseinandersetzen mit dem eigenen Verhalten<br />
geweckt werden, um schliesslich alternative Handlungsmethoden anzuwenden. Lösungen und<br />
Abmachungen müssen durch die Gruppe selbst entstehen und von ihnen selbst getragen<br />
werden.<br />
8.2.3. Projektarbeit<br />
Ein Projekt ist einem Thema, einer Fragestellung oder einem Problem gewidmet. Es erfolgt<br />
eine Ausrichtung auf eine vorher definierte Zielerreichung von Ist zu Soll Zustand. Ein<br />
Projekt ist ein einmaliges Vorhaben, zeitlich begrenzt, kann aber aus mehreren Einheiten<br />
bestehen (vgl. Henz, 2005, S.25).<br />
Um ein Projekt erfolgreich durchführen zu können, muss erst der zeitliche, finanzielle,<br />
personelle und konzeptionelle Rahmen geklärt werden. Um einen ganzheitlichen Erfolg zu<br />
erzielen ist es wichtig, dass alle Beteiligten mit einbezogen werden. Wer in welcher der vier<br />
Projektphasen (Projektdefinition, Projektierung, Realisierung und Evaluation) mit einbezogen<br />
werden soll, ist abhängig von den spezifischen Anforderungen des Themas.<br />
Projekte können sich in <strong>Neuenhof</strong> auch für eine schulinterne und schulexterne<br />
Öffentlichkeitsarbeit eignen. Intern wird eine Atmosphäre unterstützt, die den SchülerInnen<br />
das Gefühl vermittelt, dass an der Schule etwas läuft. Die Bereitschaft zur Identifikation mit<br />
der Schule als attraktiver Lernraum fördert die positiven Lernbedingungen. In der<br />
Öffentlichkeit wird die Attraktivität der Schule weiter erhöht.<br />
8.2.4. Moderation<br />
Ist eine Methode der neutralen Leitung eines Gespräches. Die <strong>Schulsozialarbeit</strong>erin lenkt und<br />
leitet die Kommunikation, ohne thematisch einzugreifen. In Elterngesprächen, aber auch in<br />
Diskussionsrunden kann diese Arbeitsweise gut zum Zug kommen. Ebenso findet die<br />
Methode in der Arbeit mit Klassen Anwendung.<br />
8.2.5. Mediation<br />
Die Mediation ist eine Methode der konstruktiven Konfliktlösung, die in der <strong>Schulsozialarbeit</strong><br />
bei der Vermittlung zwischen Einzelnen oder Gruppen eingesetzt werden kann. Die folgenden<br />
Informationen sind aus einem Grundlagenwerk zur Mediation von Hr. Hösl.<br />
In aller Kürze sind hier die Grundbausteine aufgeführt:
Der externe Dritte, die Eigenverantwortung, das Fall- und Problemspezifische, die<br />
Ergebnisoffenheit, die Einbeziehung aller Konfliktparteien, die Allparteilichkeit des<br />
Mediators. (Hösl, 2004, S.30 ff.)<br />
Die Grundhaltung des Mediators entsprechen der Klientenzentrierten Gesprächsführung:<br />
Das einfühlende Verstehen (Empathie), die Echtheit (Authentizität), Wertschätzung jeder<br />
Konfliktpartei und das Verstehen wollen der Konflikte aus Sicht der einzelnen Systeme.<br />
In der <strong>Schulsozialarbeit</strong> sind diese Merkmale sind die Basis für jede beratende<br />
Gesprächssituation, ob mit einer Person oder einer Gruppe.<br />
9. Aufgabenfelder und Angebot<br />
9.1. Überlegungen zu den Aufgabenfeldern und Angeboten<br />
Die <strong>Schulsozialarbeit</strong> ist ein relativ neues Angebot der Jugendhilfe. In der Schweiz und in<br />
Deutschland haben sich in der Orientierungs- und Aufbauphase dieses Bereichs die<br />
unterschiedlichsten Aufgaben entwickelt. Einige Kernaufgaben haben sich herauskristallisiert,<br />
die das Wesen der <strong>Schulsozialarbeit</strong> ausmachen. Je nach Situation der Schule, gibt es aber<br />
eine Vielfalt von Randaufgaben, die in den Arbeitsbereich der <strong>Schulsozialarbeit</strong> fallen.<br />
In diesem Kapitel werden die Aufgaben der <strong>Schulsozialarbeit</strong>erin <strong>Neuenhof</strong> genannt und kurz<br />
erläutert. Die Aufgaben sind den Vorgaben für das Feinkonzept aus dem <strong>Konzept</strong> der Kinderund<br />
Jugendarbeit in <strong>Neuenhof</strong> entnommen und von der <strong>Schulsozialarbeit</strong>erin anhand der<br />
aktuellen Situation ergänzt worden. Welche Bedürfnisse zu einer Festlegung der Aufgaben<br />
geführt hat, kann dem Teil Situation und Bedarfsanalyse, entnommen werden.<br />
Die ersten Module und Projekte werden kurz genannt. In diesem Abschnitte kann aber nicht<br />
im Detail auf sie eingegangen werden. Die Beschreibung der geplanten Projekte und ein<br />
Ausblick auf weitere mögliche Projekte erfolgen im Verlauf des <strong>Konzept</strong>s.<br />
9.2. Prävention und Früherkennung<br />
Die Prävention wird in zwei Bereiche unterschieden (vgl. Drilling, 2002, S. 105 f.)<br />
9.2.1. Primäre Prävention<br />
Ursachen die spätere Störungen/ Beeinträchtigungen auslösen könnten, sollen erkannt und<br />
beseitigt oder positiv beeinflusst werden. Bereiche der primären Prävention sind z.B.<br />
stoffliche und nichtstoffliche Sucht, Schutz vor Missbrauch, Sozialverhalten, Kommunikation<br />
und Geldmanagement.<br />
9.2.2. Sekundäre Prävention<br />
Die Früherkennung von Symptomen und Spannungszuständen soll zu einer rechtzeitigen<br />
Aufgleissung von benötigten Hilfeleistungen führen. Die Probleme sollen wenn nötig bereits<br />
eine Frühbehandlung erfahren, so dass sie nicht manifestiert werden.<br />
Bereiche der sekundären Prävention:<br />
Klassenintervention<br />
Unterstützen bei Klassenprojekten in Klassen, in denen gewisse Themen bereits aufgefallen<br />
sind.<br />
Individualhilfe
Krisenintervention<br />
9.2.3. Modulsystem statt Flächendeckung<br />
Die Präventionsangebote können als Klassenintervention in einer Krisensituation oder bei<br />
Interesse im Modulssystem gebucht werden. Dies bedeutet, dass die <strong>Schulsozialarbeit</strong>erin mit<br />
der Zeit verschiedene Präventionsbausteine entwickelt, die dann bei Bedarf gebucht werden<br />
können. Die Entscheidung vorerst kein flächendeckendes Gesamthaus Angebot zu machen<br />
viel zusammen mit dem Schulleiter und den Stufenleiterinnen. Für ein Gesamtangebot wäre<br />
es notwendig, dass sich alle Beteiligten mit der Thematik auseinander setzten würden.<br />
Ausserdem sind die Bedürfnisse der verschiedenen Altersgruppen und<br />
Klassenzusammensetzung zu unterschiedlich. Andere Unterstützungsformen, wie z.B. die<br />
Einzelfallhilfe werden als dringender angesehen.<br />
9.3. Beratung und Unterstützung von SchülerInnen<br />
SchülerInnen erhalten niederschwellige Hilfestellung bei Fragen zu persönlichen oder<br />
sozialen Problemen. Im <strong>Konzept</strong> der <strong>Schulsozialarbeit</strong> Spreitenbach, Stand 2003, sind diverse<br />
Themen zusammengestellt, zu denen Kinder- und Jugendliche Rat suchen.<br />
„Gewalt, Mobbing, Erpressung, Gruppendruck, Ausgrenzung, Einsamkeit, Schwierigkeiten<br />
mit dem/ der Freundin, Fragen zur Sexualität und zu Verhütung, Schutz vor Aids, Fragen zum<br />
Thema Suchtmittelkonsum wie Rauchen, Alkohol, weiche und harte Drogen, Schwierigkeiten<br />
innerhalb der Familie, Konflikte mit Eltern und Geschwistern, Probleme mit der Schule und<br />
dem/ der LehrerIn, psychische Schwierigkeiten, Essstörungen, Schwierigkeiten bei<br />
Lehrstellensuche, Interkulturelle Konflikte usw.“ (ebd., S.7 f.)<br />
Aufgaben:<br />
• Information über andere bestehende Angebote, Abklärung welches am geeigneten<br />
wäre und verfügbar ist, Vermittlung und Begleitung zu dieser anderen Fachstelle<br />
(Triage)<br />
• Krisenintervention<br />
Einsatz in einer Klasse, bei schwierigen Gruppendynamischen Prozessen, oder<br />
anderen aktuellen Themen, die eine sofortige Intervention notwendig machen<br />
(Beispielsweise: no- blame approach, Alsake „Mobbing ist kein Kinderspiel“)<br />
Übernahme von Gesprächen mit einer oder mehreren Personen, bei einer akuten<br />
Problemlage<br />
• Vermittlung in Konfliktsituationen zwischen allen Beteiligten, als auch zwischen<br />
Gruppen<br />
• Einzel- und Gruppenberatung<br />
• Vermittlung zwischen LehrerIn und SchülerIn unter Wahrung der neutralen Rolle<br />
• Präsenz auf dem Pausenplatz<br />
Beziehungsgestaltung, Frühzeitiges Einschreiten und Grenzen aufzeigen, als auch<br />
informelle, niederschwellige Kontaktmöglichkeit<br />
• Sinnvolle Freizeitgestaltung am Mittwoch Nachmittag, vorwiegend für die Unterstufe<br />
und Mittelstufe aber auch Angebote für die Oberstufe in Absprache oder<br />
Zusammenarbeit mit der Jugendarbeiterin.<br />
9.4. Beratung und Unterstützung von Lehrpersonen und Schulleitung
Die Lehrpersonen und die Schulleitung soll durch die <strong>Schulsozialarbeit</strong>erin als externe<br />
Fachperson in folgenden Bereichen Entlastung erfahren.<br />
• Fachberatung und Fallbesprechung<br />
In den Stufenteams kann ein Fall oder eine konkrete Anfrage zu einem bestimmten<br />
Thema vorgebracht werden.<br />
• Beratung bei Time- out<br />
Die <strong>Schulsozialarbeit</strong>erin kann in einer Helferkonferenz unterstützen und als<br />
Ratgeberin fungieren. Ferner kann sie Vorschläge für ein konkretes Vorgehen, z.B.<br />
in Anspruchnahme eines bestimmten Time Out Angebotes, oder ambulante<br />
Unterstützungsformen, ausarbeiten.<br />
• Information und Vermittlung von Ressourcen<br />
Informieren über Beratungsstellen und Betreuungsangebot<br />
• Beratung und Unterstützung in sozialen Krisensituationen in Klassen<br />
9.5. Beratung und Unterstützung von Eltern<br />
Die Elternarbeit ist ein grosses Anliegen der <strong>Schulsozialarbeit</strong>erin. Es gehört zu den grösste<br />
Herausforderungen, die Eltern in eine gute Zusammenarbeit einzubinden.<br />
9.5.1. Elternanlässe<br />
Um mit das Angebot bei den Eltern bekannt zu machen und ein Vertrauensverhältnis<br />
aufbauen zu können, muss die <strong>Schulsozialarbeit</strong>erin sich um einen Kontakt zu den Eltern<br />
bemühen. Folgende Massnahmen dienen diesem Zweck:<br />
• Teilnahme an Gesamt Elternanlässe<br />
Die <strong>Schulsozialarbeit</strong>erin nimmt an den von der Schule organisierten Gesamtelternanlässen<br />
teil. Sie stellt die <strong>Schulsozialarbeit</strong> und ihre Arbeitsfelder vor und klärt die Rolle der<br />
<strong>Schulsozialarbeit</strong>erin. Durch informelle Gespräche und professionellen Rat kann Vertrauen<br />
entstehen und die Hemmschwelle herabgesetzt werden.<br />
• Elternanlass im Rahmen einer Schulaktivität<br />
Die <strong>Schulsozialarbeit</strong> nutzt den Rahmen von Schulaktivitäten, wie etwa die<br />
Projektwoche, um ein Angebot für die Eltern zu machen.<br />
• Eltern Klassenabende<br />
Anlässlich der Klassen Elternabende können die Lehrpersonen einen Fachinput aus der<br />
Modulreihe buchen. Je nach Wunsch kann anschliessend auch eine kleine<br />
Diskussionsrunde moderiert werden.<br />
• Themenabend<br />
In einem festen Rhythmus, erst mal alle 6 Monate, soll in einem attraktiven Rahmen ein<br />
Thema Abend mit Referent für die Eltern angeboten werden.<br />
9.5.2. Elternberatung<br />
Die <strong>Schulsozialarbeit</strong> ist eine niederschwellige Anlaufstelle für diverse Fragestellungen der<br />
Eltern. Die Gesprächssituation hat je nach dem wie die Eltern motiviert sind eine andere<br />
Ausgangssituation. In jedem Fall soll die Beratung in einer wertschätzenden und Ressourcen
orientierten Art und Weise erfolgen. Folgende Motivationen können dem Aufsuchen einer<br />
Beratung zu Grunde liegen.<br />
• Eigeninitiative<br />
Der Flyer, ein Elternbrief und die Homepage weisen auf die freiwillige, kostenlose,<br />
neutrale Beratung hin. Bei komplexeren Fragestellungen oder bei spezifischen<br />
Bedürfnissen kann im Sinn einer Triage, an andere Fachstellen weiter vermittelt werden.<br />
• Fremdmotivation<br />
Tritt bei einem Gespräch zwischen Lehrpersonen und Eltern oder zwischen Schulleitung<br />
und Eltern Handlungsbedarf in einer sozialen Fragestellung auf, so kann im Sinne einer<br />
Triage an die <strong>Schulsozialarbeit</strong> verwiesen werden. Es obliegt den Eltern zu entscheiden, ob<br />
das Angebot in Anspruch nehmen möchten.<br />
• Vermittlung zwischen Lehrpersonen und Eltern<br />
Auf Anfrage der Eltern oder der Lehrperson. Nach Grundsätzen der Moderation unter<br />
Wahrung der neutralen Rolle.<br />
• Vermittlung zwischen Kindern/ Jugendlichen und ihren Eltern<br />
In Absprache mit dem Kind/ Jugendlichen werden die Eltern miteinbezogen, der<br />
systemischen Haltung entsprechend.<br />
• Disziplinar Verfahren<br />
Es obliegt den Eltern zu entscheiden, ob das Angebot in Anspruch nehmen möchten.<br />
Jedoch kann die Schulleitung auf die Konsequenzen hinweisen, die das Verweigern einer<br />
Zusammenarbeit zwischen Schule und Eltern mit sich bringt.
9.6. Kooperation und Vernetzung<br />
9.6.1. Überlegungen zur Kooperation und Vernetzung<br />
Die <strong>Schulsozialarbeit</strong>erin soll mit anderen Fachstellen kooperieren und ihr Angebot<br />
vernetzten. Die einzelnen Fachstellen mit denen die <strong>Schulsozialarbeit</strong>erin zusammen<br />
arbeitetet werden angeführt.<br />
Voraussetzungen zu einer erfolgreichen Kooperation in <strong>Neuenhof</strong> selber sind:<br />
• Information und Dokumentation über die Angebote der <strong>Schulsozialarbeit</strong><br />
Das Angebot wird auf einem Plakat beim Einwohnermeldeamt bekannt gemacht.<br />
Ausserdem stellt die <strong>Schulsozialarbeit</strong>erin ihr Angebot beim Vereinskartell und auf<br />
der Homepage vor.<br />
• Die <strong>Schulsozialarbeit</strong>erin steht der der Kinder- und Jugendkommission beratend zur<br />
Seite. Sie kann mit einbezogen werden und ist bereit die Kinder- und<br />
Jugendkommission zu unterstützen.<br />
9.6.2. Zusammenarbeit mit anderen Fachstellen<br />
9.6.2.1. Soziale Dienste<br />
Die Sozialen Dienste der <strong>Gemeinde</strong> <strong>Neuenhof</strong> haben ein breites Aufgabenfeld. Sie leisten<br />
materielle und immaterielle Hilfe, machen Abklärungen für die Vormundschaftsbehörde und<br />
führen vormundschaftliche Massnahmen aus. Ausserdem wird Jugend- und Familienberatung<br />
angeboten. Durch Angliederung und die Vielfalt ihrer Angebote sind die Sozialen Dienste bei<br />
Anliegen allgemeinerer Art die erste Anlaufstelle für die <strong>Schulsozialarbeit</strong>erin.<br />
9.6.2.2. Schulpsychologischer Dienst<br />
Die Kindesentwicklung, Förderung der Fähigkeiten und Fertigkeiten und Unterstützung der<br />
Selbstentfaltung, wie auch Beratung sind die Schwerpunkte des Angebots des SPDs. Jürg Jost<br />
ist derzeit vom Schulpsychologischen Dienst Baden für <strong>Neuenhof</strong> zuständig. Er hat einmal im<br />
Monat offene Sprechstunden. Von den Lehrpersonen wird er vermehrt wegen<br />
Leistungsabklärungen und Einschulung angefragt. Jedoch bietet er auch Fallbesprechungen in<br />
den Stufenteams an.<br />
Da sich die Arbeitsbereiche sinnvoll ergänzen können, aber auch teilweise überschneiden<br />
fanden bereits erste Sondierungsgespräche statt. Herr Jost und Frau Egle werden noch ein<br />
Protokoll verfassen, in dem eine Abmachung über eine Zusammenarbeit festgehalten wird.<br />
Eine engmaschige Zusammenarbeit und ein guter Austausch bei gemeinsamen Aufgaben ist<br />
beiden ein Anliegen.<br />
9.6.2.3. Jugendarbeiterin <strong>Neuenhof</strong><br />
Die Jugendarbeiterin Manuela Gauch hat Anfang August 2006 angefangen. Durch die<br />
gemeinsame Nutzung des Büros in der <strong>Gemeinde</strong> besteht ein reger Austausch.<br />
Die Bereiche Jugendarbeit und <strong>Schulsozialarbeit</strong> überschneiden sich im Freizeitbereich. Dort<br />
können gemeinsame Projekte stattfinden. Konkrete Abmachungen bestehen noch nicht, einige<br />
Ideen sind jedoch bereits angedacht.<br />
• Die <strong>Schulsozialarbeit</strong> stellt ihr Angebot am Vereinstag, der von der Jugendarbeiterin<br />
organisiert wird, vor.<br />
• Gemeinsame Angebote am Mittwochnachmittag, z.B. Mädchenspezifische Angebote,<br />
Comic Zeichenkurs, Vereine einladen, etc.<br />
• Unterstützung der Schule bei dem Jugendfest am Ende der Projektwoche
9.6.2.4. Regiogruppe <strong>Schulsozialarbeit</strong><br />
In den vier mal im Jahr statt findenden Treffen werden die <strong>Schulsozialarbeit</strong>er aus<br />
verschiedenen <strong>Gemeinde</strong>n des Kantons Aargau vernetzt. Die Idee ist Synergien zu nutzen,<br />
gemeinsames Vorgehen abzusprechen, Lobby Arbeit zu betreiben und Strategien zu<br />
entwickeln. Ein fachlicher Austausch findet nicht nur an den Treffen statt, sondern kann bei<br />
Bedarf via Internet eingefädelt werden. Eine Vertretung aus der Gruppe nimmt an Kantonalen<br />
Sitzungen teil. Die Teilnahme der <strong>Schulsozialarbeit</strong> und das Engagement in der Regiogruppe<br />
tragen zu einem Netzwerk bei, dessen Ressourcen für ein effizientes, qualitativ hochwertiges<br />
und Zeitsparendes Arbeiten in der Praxis genutzt werden können.<br />
9.6.2.5. Erziehungsberatung für Mütter und Väter<br />
Einmal in der Woche findet im Schulhaus Schibler am Mittwoch Nachmittag eine kostenlose<br />
Erziehungsberatung für Eltern statt. Darauf kann bei diversen Elterngesprächen verwiesen<br />
werden.<br />
9.6.2.6. Kinderabteilung des Kantonsspitals Baden<br />
Die Kinderabteilung mit ihrem interdisziplinärem Team gehört zur Kinderschutzgruppe der<br />
Kantonsspitäler des Kantons Aargau. Es können Referenten zum Thema Kindesschutz/<br />
Missbrauch etc. angefragt werden.<br />
9.6.2.7. Beratungszentrum Bezirk Baden<br />
Diese Institution verfügt über zwei Standorte. In Baden wird der Bereich Jugendberatung,<br />
illegale Suchtformen und Früherfassung angeboten. An die Stelle in Ennetbaden können<br />
Anfragen bezüglich legalen Suchtformen gestellt werden.<br />
Der Bereich Füherfassung ist für die Schule im Hinblick auf „Mobbing/ Gewalt“ und für<br />
Referenten an Elternabenden von grossem Interesse.<br />
9.6.2.8. Aargauischer Verein für Suchtprobleme<br />
Die Beratung bezüglich Suchtproblemen in allen Facetten ist dem o.g. Beratungszentrum<br />
angegliedert. In Aarau gibt es darüber hinaus eine Sucht- Info- Mediathek des avs. Auch dort<br />
können geeignete Materialien für die Arbeit in Klassen bezogen werden.<br />
9.6.2.9. Schweizer Fachstelle für Alkohol- und andere Drogenprobleme<br />
Sollen für ein Präventionsprojekt in Klassen Materialien bestellt werden, so ist hierfür die<br />
sfa/ispa eine gute Adresse.<br />
9.6.2.10. Netzwerk Kulturvermittlung der Stadt Baden<br />
Kulturvermittler aus vielen Ländern unterstützen Fachpersonen bei dem Verständnis<br />
verschiedener Kulturen. Ferner werden Menschen mit Migrationshintergrund bei der<br />
Integration in die und Orientierung in der Schweizer Kultur unterstütz. Für die Beratung<br />
fallen Kosten an. Mit der Zeit können evt. auch in <strong>Neuenhof</strong> ehrenamtliche Kontakt für die<br />
kulturelle Vermittlung geknüpft werden. Wichtig ist jedoch, dass die Neutralität gewährleistet<br />
bleibt.<br />
9.6.2.11. Dolmetscher Dienste des Heks<br />
Die Schule beansprucht in komplexen Fällen die Dolmetscher Dienste des Heks. Die<br />
<strong>Schulsozialarbeit</strong>erin kann über das Budget der Schule in Absprache und limitiert<br />
Übersetzungsdienste anfragen.<br />
9.6.2.12. Hort und Spielgruppen <strong>Neuenhof</strong>
Geht es um eine Helferkonferenz oder einen kollegialen Austausch über einen Einzelfall, so<br />
kann gegenseitig Kontakt aufgenommen werden.<br />
9.6.2.13. Andere Dienste<br />
Mit dem Schulärztlichen Dienst, dem Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienst und dem<br />
Care Team Baden, der Krebslige u.a. wird je nach Bedarf zusammengearbeitet.<br />
9.6.2.14. Lokale Vereine<br />
Die <strong>Schulsozialarbeit</strong>erin stellt sich am Vereinskartell kurz vor. Ziel ist es für ehrenamtliches<br />
Engagement zu begeistern. Für das Mittwoch Nachmittag Programm, oder auch für<br />
Prävention im Bereich Medienkonsum wird eine Zusammenarbeit mit den verschiedenen<br />
Vereinen angestrebt.<br />
10. Situations- und Bedarfsanalyse und Folgerungen für die konkreten<br />
Angebote<br />
10.1. Vorgehen<br />
Die <strong>Schulsozialarbeit</strong>erin führte Anfang des Schuljahres 2006/2007 einige<br />
Sondierungsgespräche mit dem Schulleiter, den Stufenleiterinnen und den Lehrkräften. Dabei<br />
konnte das bereits vorhandene Angebot (Atelier, „Lehrstellenengagement“ der Lehrpersonen,<br />
Aufgabenhilfe, Pausenkiosk, Mittagstisch, Bewegungstag, unterschiedliche Ansätze zur<br />
Elternzusammenarbeit etc.) kennen gelernt werden. Die bisher entwickelten Hilfsangebote<br />
stützen sich sehr stark auf das Engagement von Einzelnen. Es existiert jedoch kein festes<br />
System. Zudem kommen Lehrpersonen oftmals in einen Rollenkonflikt, oder stossen durch<br />
die zusätzliche Belastung an ihre Grenzen. Inspiriert von den ersten Eindrücken entwickelte<br />
die Schulsozialarbeierin, in Absprache mit der Schulleitung einen Fragebogen, den sie der<br />
gesamten Lehrerschaft an der Ortskonferenz am 6.9.06 präsentierte. Den Fragebogen wertete<br />
sie aus und verwendete die Ergebnisse für die Workshops mit den einzelnen Lehrerteams.<br />
Parallel dazu fand 2 Mal ein Besuch des Schulparlaments statt. Bei der je einstündigen<br />
Kontaktaufnahme in den Klassen waren die Ziele unterschiedlich. Die jüngeren Klassen<br />
lernten die <strong>Schulsozialarbeit</strong>erin spielerisch kennen, während die höheren Klassenstufen in<br />
ihren Wünschen und Anliegen für die Entwicklung des Angebots ernst genommen und mit<br />
einbezogen wurden. Die Ergebnisse der Bedürfnisanalyse der Lehrerschaft, sowie der<br />
Schülerschaft bildeten die Grundlage für einen Vorschlag für das vorläufige Angebot. Dieses<br />
wurde an der letzten Schulleitungssitzung vor den Herbstferien präsentiert. Dort wurde ein<br />
gemeinsames Vorgehen besprochen. Die Resultate aus den unternommenen Schritten dienen<br />
der Festlegung des Angebotes.<br />
Im Folgenden werden die Stufenspezifischen Ergebnisse vorgestellt. Die dazugehörigen<br />
Diagramme sind im Anhang zu finden. Am Schluss der Stufenzugehörigen Abschnitte wird<br />
auf das Angebot eingegangen. Anschliessend werden die Themen der Jugendlichen<br />
aufgegriffen.
10.2. Kindergartenstufe<br />
Die einzelnen Kindergärten sind dezentral in <strong>Neuenhof</strong> verteilt. Der Workshop mit den<br />
Kindergärtnerinnen fand im Rahmen der wöchentlichen Stufensitzung statt. Dem<br />
Kindergarten kommt eine wichtige Bedeutung zu. Eine Altersentsprechende Prävention kann<br />
die Kinder noch prägen und eine Schädigungen eindämmen. Es kann ein frühzeitiges<br />
Vertrauensverhältnis zu den Kindern und den Eltern aufgebaut werden. Dieses ist im Sinne<br />
einer nachhaltigen Arbeit zu fördern.<br />
10.2.1. Ergebnisse Kindergarten<br />
Die Reihenfolge der nachfolgenden Abschnitte entspricht der Anordnung im Hinblick auf die<br />
häufigste Nennung im Fragebogen.<br />
Übermässiger Medienkonsum<br />
Im Kindergarten ist in erster Linie der übermässige Medienkonsum als Problem aufgefallen.<br />
Die Kinder sind durch massloses Fernsehen, aber auch Spielkonsolen, Gameboy etc. in ihrer<br />
sozialen Entwicklung beeinträchtigt. Sie verbringen wenig Zeit mit Freunden oder in der<br />
Natur. Von den Kindergärtnerinnen konnten in einem grösseren Ausmass Müdigkeit,<br />
Konzentrationsstörungen, und aggressives Verhalten beobachtet werden.<br />
Lebensmanagement<br />
Kohärent mit dem Alter der Kindergartenkinder werden vor allem Schwierigkeiten im<br />
Lebensmanagement des sozialen Umfeldes wahrgenommen. Es fehlt den Kindern z.T. an<br />
einer geregelten Tagesstruktur und einem ausgewogenen System von konsequenter aber<br />
moderater Grenzsetzung. Die Kinder sind z.T. unselbständig, erhalten ungesundes Essen und<br />
weisen Defizite im Sozialverhalten auf. So haben sie z.T. eine ausgeprägt tiefe<br />
Frustrationstoleranz und können ihre Bedürfnisse nicht adäquat ohne auffälliges Verhalten<br />
anmelden.<br />
Verhaltensauffälligkeiten durch soziale Indikation<br />
Die Kindergärtnerinnen machen immer wieder die Erfahrung, dass die Eltern z.T. überfordert<br />
sind. Dies äussert sich darin, dass die Kinder z.T. Verwahrlosungstendenzen (ungewaschen,<br />
krank, etc.) haben und es immer wieder Verdacht auf Gewalt zu Hause gibt. Ansonsten sehen<br />
sie die Tendenz, dass die Eltern zwischen rigider, harter Erziehung und laissez- faire<br />
schwanken.<br />
10.2.2. Angebote in der Kindergartenstufe<br />
Folgendes Angebot findet entsprechend den Wünschen, und den Kapazitäten statt:<br />
• Kurzzeitiges Erziehungsberatungsangebot für die Eltern (ab 1. November 2006)<br />
• Elternabend Module zum buchen zu den Themen „Essen macht Laune„, „Freizeitlust<br />
statt Aggression und Frust„ (Erste Module im Januar 2007)<br />
• Begleitung von Präventionsprojekten durch Fachaustausch in der Stufensitzung (ab 1.<br />
November 2006)<br />
• Fallbesprechung in der Stufensitzung (ab 1. November 2006)<br />
• Sprechstunden für Kindergärtnerinnen und Eltern (ab 1 November 2006)<br />
• Triage zu anderen Fachstellen (ab 1.November 2006)
10.3. Unterstufe<br />
Die Unterstufe auf mehrere Schulhäuser aufgeteilt. Die Lehrpersonen der Unterstufe haben<br />
die Herausforderung, die Kinder an die Schule heranzuführen. Kinder mit besonderen<br />
Bedürfnissen werden in den Einführungsklassen untergebracht.<br />
10.3.1. Ergebnisse Unterstufe<br />
Die Reihenfolge der nachfolgenden Abschnitte entspricht der Anordnung im Hinblick auf die<br />
häufigste Nennung im Fragebogen.<br />
Übermässiger Medienkonsum<br />
Um dem übermässigen Medienkonsum der SchülerInnen der Unterstufe sinnvoll begegnen zu<br />
können, wünschen sich die Lehrpersonen im wesentlichen 3 Massnahmen. Die Eltern sollen<br />
durch eine Fachperson informiert werden. Zusammen mit ihnen sollen praktikable<br />
Kontrollmöglichkeiten zur Eindämmung und Alternativen für die Freizeit Gestaltung<br />
entwickelt werden. Für die SchülerInnen sollte zudem ein niederschwelliges Freizeitangebot<br />
vorhanden sein. Die LehrerInnen selber wünschen sich Tipps zur Behandlung des Themas<br />
innerhalb der Klasse.<br />
Verhaltensauffälligkeiten durch soziale Indikation<br />
Die Lehrpersonen wünschen sich die Teilnahme der <strong>Schulsozialarbeit</strong>erin bei<br />
Elterngesprächen und je nach dem eine weitere Begleitung der Eltern.<br />
Physische Gewalt<br />
Bei der Krisenintervention wurde der Wunsch geäussert, Kinder bei einer massiven Störung<br />
im Unterricht kurzzeitig Einzeln zu betreuen. Im Bereich der Prävention stimmten die<br />
Vorstellungen der Lehrpersonen weitgehend überein. Sie möchten Soziale Geschichten als<br />
Modell zur Konfliktlösung und soziale Spiele mit der <strong>Schulsozialarbeit</strong>erin in den Unterricht<br />
integrieren.<br />
Lebensmanagement<br />
Die <strong>Schulsozialarbeit</strong>erin soll Elternanlässe in den Bereichen Medien, Freizeitgestaltung, und<br />
erzieherische Themen gestalten.<br />
10.3.2. Angebote in der Unterstufe<br />
Folgendes Angebot findet entsprechend den Wünschen, und den Kapazitäten statt:<br />
• Krisenintervention und Notfalls kurzzeitige Einzelbetreuung vor dem Klassenzimmer oder<br />
im Besprechungszimmer der <strong>Schulsozialarbeit</strong> (ab 1. November 2006)<br />
• Klassenintervention bei einer schwierigen Gruppendynamik, zu speziellen Themen (ab 1.<br />
November 2006)<br />
• Elterngespräche, bzw. Übernahme des Bereiches Sozialverhalten und Probleme aus dem<br />
sozialen Umfeld bei den gemeinsamen Elterngesprächen, unter Wahrung der Neutralität.<br />
(ab 1. November 2006)<br />
• Buchbare Elternabend- Module zu den Themen „Freizeitlust statt Aggression und Frust„,<br />
„Erziehungs- Talk“ (erste Module im Januar 2007)<br />
• Gesamtelternanlass mit externer Fachperson im Bereich Erziehung, Ernährung (in<br />
Absprache mit Stufenleitungen)<br />
• Sprechstunden für Kinder, Eltern, Lehrpersonen (ab 1. November 2006)<br />
• Triage zu anderen Fachstellen (ab 1. November 2006)<br />
• Präventions- Module für die Arbeit in den Klassen zum Thema Sozialverhalten (erste<br />
Module ab Dezember 2006)
• Möglichkeit die <strong>Schulsozialarbeit</strong>erin für eine Mädchen- und Jungenspezifische<br />
Gruppenarbeit als Unterstützung anzufragen (ab 1. November 2006)<br />
• Freiwilliges Freizeitangebot am Mittwoch Nachmittag (ab 1. November 2006)<br />
10.4. Mittelstufe<br />
In der Mittelstufe müssen die Grundsteine für die weiterführende Schulbildung gelegt werden.<br />
Ferner müssen die Lehrpersonen die Entscheidung treffen, in welche Schullaufbahn die<br />
Kinder übertreten.<br />
10.4.1. Ergebnisse Mittelstufe<br />
Die Reihenfolge der nachfolgenden Abschnitte entspricht der Anordnung im Hinblick auf die<br />
häufigste Nennung im Fragebogen.<br />
Übermässiger Medienkonsum<br />
Aus der Vielzahl der Gedanken und Ideen der Lehrpersonen lässt sich eine klare<br />
Grundrichtung erkennen. Um dem Medienkonsum entgegenzuwirken sollte es eine Art<br />
Projekt-/ oder Aktionswoche geben. In dieser sollen auch Elternanlässe stattfinden.<br />
Verschiedene Freizeitaktivitäten sollen vorgestellt werden. Mit den Kindern könnte „eine<br />
Woche ohne Fernseher und PC“ erprobt werden. Diese mit vielen Freizeit Ideen umrahmt<br />
werden.<br />
Psychische Gewalt<br />
Bei akuten Problemen in der Klasse soll ein Klassenbesuch stattfinden. Eine neutrale<br />
aussenstehende Person soll soziale Spiele anbieten und Informationsmaterial für<br />
Lehrpersonen besorgen. Ausserdem soll die Auseinandersetzung mit der Lehrer und<br />
Lehrerinnen mit dem Thema Mobbing initiiert werden. Die Kinder sollen nach dem <strong>Konzept</strong><br />
„Fit und Stark“ gestärkt werden und für die Eltern soll ein Tripple P Training organisieren<br />
werden.<br />
10.4.2. Angebote in der Mittelstufe<br />
Folgendes Angebot findet entsprechend den Wünschen, und den Kapazitäten statt:<br />
• Krisenintervention und Notfalls kurzzeitige Einzelbetreuung vor dem Klassenzimmer oder<br />
im Besprechungszimmer der <strong>Schulsozialarbeit</strong> (ab 1. November 2006)<br />
• Klassenintervention bei einer schwierigen Gruppendynamik, zu speziellen Themen (ab 1.<br />
November 2006)<br />
• Elterngespräche, bzw. Übernahme des Bereiches Sozialverhalten und Probleme aus dem<br />
sozialen Umfeld bei den gemeinsamen Elterngesprächen, unter Wahrung der Neutralität.<br />
(ab 1. November 2006)<br />
• Begleitung der Aktionswoche „eine Woche ohne Fernseher und PC“, unter der<br />
Voraussetzung, dass ein Interesse bei den Lehrpersonen besteht und die Bereitschaft sich<br />
zu engagieren.<br />
Eine Zeitplanung kann nur in Absprache mit der zuständigen Stufenleitung und im<br />
Stufenteam erfolgen. Die <strong>Schulsozialarbeit</strong>erin kann Vorschläge für die Gestaltung der<br />
Woche erarbeiten, eine Fachperson für den Elternabend organisieren, den Elternbrief<br />
formulieren, in den Klassen je eine Einheit gestalten, die Auswertung begleiten und in der<br />
Woche für diese Altersgruppe am Mittwoch eine grössere Auswahl an Freizeitgestaltung<br />
anbieten (z.B. eine Kreativ- Zirkel, oder Vereine einladen, um ihre Angebote vorzustellen,<br />
etc.)
• Buchbare Elternabend- Module zu den Themen „Freizeitlust statt Aggression und Frust„,<br />
„Erziehungs- Talk“ erste Module im Januar 2007)<br />
• Gesamtelternanlass mit externer Fachperson<br />
Gegebenenfalls in der Aktionswoche zum Thema Medienkonsum, sonst auch anderes<br />
Thema möglich (in Absprache mit Stufenleitungen)<br />
• Sprechstunden für Kinder, Eltern, Lehrpersonen (ab 1. November 2006)<br />
• Triage zu anderen Fachstellen (ab 1. November 2006)<br />
• Präventions- Module für die Arbeit in den Klassen zum Thema Sozialverhalten (erste<br />
Module ab Dezember 2006)<br />
• Möglichkeit die <strong>Schulsozialarbeit</strong>erin für eine Mädchen- und Jungenspezifische<br />
Gruppenarbeit als Unterstützung anzufragen (ab 1. November 2006)<br />
• Freiwilliges Freizeitangebot am Mittwoch Nachmittag (ab 1. November 2006)<br />
10.5. Oberstufe<br />
In der Oberstufe müssen die SchülerInnen auf das Leben vorbereitet werden. Die<br />
SchülerInnen sind dem Druck ausgesetzt eine Lehrstelle zu finden oder eine anderen<br />
Lebensweg einzuschlagen.<br />
10.5.1. Ergebnisse Oberstufe<br />
In der Oberstufe wurde bei der Besprechung der einzelnen Themen mehr über den Bedarf<br />
allgemein diskutiert. In diesem Abschnitt werden zuerst die häufigsten Angebotswünsche aus<br />
dem Fragebogen genannt und anschliessend das Ergebnis der Diskussion niedergeschrieben.<br />
Die häufigsten Wünsche waren soziale Gruppenarbeit und Einzelfallhilfe in den Bereichen:<br />
Übermässiger Medienkonsum, Lebensmanagement, Fehlende berufliche Perspektive, Legale<br />
Drogen, Psychische Gewalt.<br />
In der Diskussion kristallisierte sich heraus, dass die Einzelfallhilfe und die<br />
Krisenintervention als am notwendigsten angesehen werden. Die Krisenintervention kann sich<br />
auf einen Einzelfall, aber auf die Klassenarbeit beziehen. So soll die <strong>Schulsozialarbeit</strong>erin<br />
situationsabhängig für eine Unterstützung in der Klasse beispielsweise bei Mobbing angefragt<br />
werden. Ausserdem würden sich einige Lehrperson bei Mädchen- und Jungenspezifischen<br />
Gruppenarbeiten gerne an die <strong>Schulsozialarbeit</strong>erin wenden.<br />
Die <strong>Schulsozialarbeit</strong>erin soll bei schwierigen sozialen Fragestellungen und bei komplexen<br />
Problemsituationen die Triage übernehmen und so die Lehrpersonen entlasten. Weniger<br />
Bedarf wird in der Projektarbeit gesehen. Altersgerechte Themen sollen im Modulsystem<br />
freiwillig buchbar sein. Diese Themen sind unter anderem „Umgang mit Geld“, „Umgang mit<br />
dem Internet“, „Übergang von Schule in das Berufsleben“, „junior mentoring“.<br />
10.5.2. Angebot in der Oberstufe<br />
Folgendes Angebot findet entsprechend den Wünschen, und den Kapazitäten statt:<br />
• Krisenintervention (ab 1. November 2006)<br />
• Klassenintervention bei einer schwierigen Gruppendynamik, zu speziellen Themen (ab 1.<br />
November 2006)<br />
• Elterngespräche, bzw. Übernahme des Bereiches Sozialverhalten und Probleme aus dem<br />
sozialen Umfeld bei den Elterngesprächen, unter Wahrung der Neutralität. (ab 1.<br />
November 2006)<br />
• Gesamtelternanlass mit externer Fachperson z.B. zum Thema Übergang von Schule in das<br />
Berufsleben (in Absprache mit Stufenleitungen, wann Zeitpunkt sinnvoll ist)
• Sprechstunden für Jugendliche, Eltern, Lehrpersonen (ab 1. November 2006)<br />
• Triage zu anderen Fachstellen (ab 1. November 2006)<br />
• Präventions- Module für die Arbeit in den Klassen zum Thema Suchtprävention (erste<br />
Module ab Dezember 2006)<br />
• Präventions- Module und/ oder Thementag für „Umgang mit Geld“ (Terminplanung im<br />
Schuljahr 2006/2007 in Absprache mit der Stufenleitung und dem Stufenteam)<br />
• Möglichkeit die <strong>Schulsozialarbeit</strong>erin für eine Mädchen- und Jungenspezifische<br />
Gruppenarbeit als Unterstützung anzufragen (ab 1. November 2006)<br />
10.6. Übergreifendes Angebot<br />
Die <strong>Schulsozialarbeit</strong>erin unterstützt und begleitet auch bestehende Projekte. Sie kann beraten<br />
oder initiieren oder auch einzelne Bereiche ganz gestalten.<br />
• Fachliche Begleitung des Mittagstisches<br />
• Pausenkiosk in Verbindung mit gesunder Ernährung<br />
• Projekttage<br />
• Beteiligung an Gesamtschulprojekten<br />
10.7. Themen und Interessen der SchülerInnen<br />
Die jüngeren SchülerInnen sammelten Ideen für die Gestaltung des Mittwoch Nachmittags,<br />
während die älteren SchülerInnen ihre Einschätzungen zum Bedarf an der Schule gaben.<br />
Die Vorschläge für die Gestaltung des Mittwoch Nachmittags sind im Anhang zu finden. Die<br />
Interessen und Themen der OberstufenschülerInnen waren sehr breit gefächert. Hier kann nur<br />
auf einige eingegangen werden. Es muss jedoch erwähnt werden, dass die unten genannten<br />
Themen für einen grossen Teil der Schülerschaft nicht als prekäre Probleme erlebt werden.<br />
Viele SchülerInnen äusserten, dass sie sich an der Schule sehr wohl fühlen.<br />
Themen der älteren SchülerInnen<br />
(Kleinklassen, Realschulklassen und Sekundarschulklassen 1-4, wenige 4 und 5 Primar)<br />
• Beleidigende, teils sexistische Bemerkungen<br />
• Provokationen, Gewalt, wenig Zusammenhalt<br />
• Rauchen, z.T. Kiffen und Alkohol<br />
• Umgang mit Geld<br />
• Figur und Schönheitskult<br />
• Freiwillige Einzelberatung, auch im Hinblick auf die Berufssuche<br />
• Pausenhof (Sitzen, Trocken, Gestaltung, Sauberkeit)<br />
Viele Wünsche bezogen sich auf den Pausenkiosk, den Winterraum, das Migros Verbot und<br />
die fehlenden trockenen Sitzmöglichkeiten auf dem Pausenhofareal.<br />
Diese Themen sind beim Schulparlament deponiert und erste Schritte sind bereits in die Wege<br />
geleitet worden. Das Schulparlament hat die Möglichkeit Anträge zu stellen.<br />
Es gab auch viele Anregungen für alternative Unterrichtsgestaltung. So schlugen ältere<br />
SchülerInnen vor, dass sie die jüngeren Klassen auch mal unterrichten könnten. Ältere<br />
Schüler im Schulparlament schlugen vor, sie könnten doch Verantwortung übernehmen, wenn<br />
sich jüngere Schüler prügeln.<br />
Ausserdem wurden thematische Wünsche geäussert, beispielsweise die verschiedenen<br />
Musikrichtungen zu besprechen und Themen vermehrt mit kurzen Filmausschnitten
einzuleiten. Populär war auch das Jugendfest, PC Angebote und der Wunsch Mittags<br />
gemeinsam essen zu können.<br />
Mit den Kindern und Jugendlichen der Mittelstufe wurde eine Soziogramm- Aufstellung zu<br />
Themen aus dem Sozialverhalten gemacht. Die SchülerInnen zeigten klar an, dass sie<br />
Ausgrenzung und verletzende Worte, aber auch gamen als Problem erleben.<br />
11. Aufteilung und Gewichtung der Stellenprozente<br />
11.1. Überlegungen zur Aufteilung der Stellenprozente und Gewichtung<br />
Da in der <strong>Schulsozialarbeit</strong> eine Vielzahl von Aufgaben bewältigt werden müssen und<br />
verschiedene Interessensgruppen unterschiedliche Bedürfnisse und Anliegen haben, werden<br />
die Ressourcen grob aufgeteilt. Im Alltag kann sich durch das laufende Geschehen und<br />
unterschiedliche Dringlichkeit von anstehenden Aufgaben eine Verschiebung ergeben.<br />
11.2. Stunden Verteilung<br />
Um ein grobes Raster für die Verteilung der Arbeitsstunden zu haben, werden die Stunden der<br />
<strong>Schulsozialarbeit</strong>erin aufgeteilt. So soll eine Übersicht erstellt werden. Wenn die Kapazitäten<br />
sinnvoll verteilt werden, können die Ressourcen optimal ausgeschöpft werden.<br />
Selbstverständlich wird sich die tatsächliche Arbeitszeitverteilung an der aktuellen Situation<br />
orientieren. Kommt es allerdings zu einer Ressourcen Knappheit und zu<br />
Interessenskollisionen so wird die <strong>Schulsozialarbeit</strong>erin zusammen mit der betreffenden<br />
Stufenleiterin Prioritäten setzen.<br />
Die Wochenarbeitszeit beträgt 33,6 Std.<br />
Eine fixe geregelte Arbeitszeit wird auf 30 Std. beschränkt, da ausserhalb dieser aufs Jahr<br />
verteilt andere Anlässe Arbeitszeit beanspruchen, die z.T. nicht in den festen Arbeitszeiten<br />
integriert werden können.<br />
Für diese Anlässe blieben 169,2 Stunden.<br />
Pflichten außerhalb der festen Arbeitszeitregelung:<br />
• 12 Std. Schulleitungssitzung im Jahr: 3 Std. im Quartal (Freitag Mittag oder Nachmittag).<br />
• 33,6 Std. (4 Arbeitstag) im Jahr für Fortbildungen<br />
• 16 Std. Fachinputs und Diskussion in den Elternabenden (3 x 2 Std. im Quartal)<br />
• 12 Std. Gesamtelternanlässe am frühen Abend, mit Vorbereitung (1 x 3Std. im Quartal)<br />
• 28 Std. Netzwerkpflege (Regionaltreffen <strong>Schulsozialarbeit</strong> 1x 4 Std. im Quartal ,<br />
Fachstellen Essen oder Aufsuchen von Fachstellen um über das aktuelle Angebot<br />
informiert zu bleiben 1x 3 Std. im Quartal)<br />
• 33,6 Std. Angebot im Rahmen von Schulausflügen oder Lager 1 Tag pro Quartal<br />
• 20 Std. Vorbereitung für grössere Aktionen (z.B. Projekttag), 5 Std. pro Quartal<br />
• 8 Std. für Öffentlichkeitswirksame Arbeit (z.B. Homepage, Presse, etc.)<br />
• 6 Std. Supervision im Jahr<br />
In den Schulferien nimmt die <strong>Schulsozialarbeit</strong>erin den Grossteil ihres Jahresurlaubs.<br />
Einzelne Tage können während der Schulzeit bezogen werden.<br />
Die Arbeitszeit, die während der Schulferien erfolgt dient u.a. folgenden Zwecken:<br />
Weiterentwicklung des Angebots, Ausarbeitung der Präventionsangebote, Sammlung und<br />
Entwicklung von Methode, Beschaffung von Material, Thematische Recherche, aufwändige<br />
Abklärungen in der Einzelfallhilfe, Netzwerkpflege, Zusammenarbeit mit der Jugendarbeit.
Die 30 Stunden fest geplante Wochenarbeitszeit beinhaltet folgende Leistungen:<br />
6 Std. Sprechstunden (KG, US, MS, OS)<br />
2 Std. Pausenpräsenz und Erreichbarkeit<br />
2,5 Std. alle 2 Wochen 5 Std. Mittwochnachmittage (vorwiegend US, MS)<br />
5,5 Std. Fixe Sitzungen:<br />
30 Min. Austausch und Koordination mit der Jugendarbeit<br />
2,5 Std. Fallbesprechung/ Teamsitzung Sozialdienst<br />
2,5 Std. Stufensitzungen und Schulparlament,<br />
bzw. Sitzungen mit dem Präsidenten des Schulparlaments oder mit der<br />
Stufenleitung<br />
0,5 Std. Begleitung bestehender Projekte (Durchschnitt)<br />
1 Std. Entwicklung Module laufend<br />
10,5 Std. Krisenintervention, Klassenrat, Präventionsmodul (US,MS,OS):<br />
2 Einheiten pro US; MS; OS plus 20 Minuten Vor- und Nachbesprechung pro<br />
Einheit<br />
1 Std. Einzelfallhilfe (Abklärungen, Elternkontakt, Fachstellen anfragen,...)<br />
1 Std. Administration<br />
11.3. Feste Arbeitszeiten und Erreichbarkeit<br />
Montag:<br />
Dienstag:<br />
Mittwoch:<br />
Donnerstag:<br />
9.00-18.00 Uhr<br />
9.00-18.00 Uhr<br />
8.30.-17.00 Uhr<br />
8.30-16.15 Uhr<br />
11.4. Verteilung der Stellenprozente auf die Stufen<br />
Die Verteilung der Stellenprozente auf die einzelnen Stufen wird bis zu der ersten grossen<br />
Auswertung gestaffelt. Die Stellenprozent sind dementsprechend ungefähr wie folgt<br />
aufgeteilt. Hier noch mal der Hinweis, dass im Alltag je nach Dringlichkeit und Situation die<br />
Arbeit erledigt wird. Die Aufteilung dient nur der Verteilung, wenn die Ressourcen knapp<br />
werden. Die Entscheidungen welches Angebot dann Vorrang hat, wird zusammen mit den<br />
Stufenleitungen getroffen.<br />
5% Kindergarten<br />
15% Unterstufe<br />
30 % Mittelstufe<br />
30 % Oberstufe<br />
12. Start der operativen Arbeit<br />
Nach der Genehmigung des Feinkonzeptes wird die <strong>Schulsozialarbeit</strong>erin ab dem 1.<br />
November die operative Arbeit aufnehmen. Es wird in jeder Stufe noch ein kurzer Workshop<br />
stattfinden, um die konkreten Angebote vorzustellen und Abläufe zu klären. Die Klassen<br />
werden in das Besprechungszimmer eingeladen. Den Schülerinnen und Schülern werden<br />
Flyer und Elternbriefe mitgegeben.<br />
Ferner wird eine Mitarbeit beim Mittagstisch stattfinden, um den Betrieb und den Ablauf<br />
besser kennen zu lernen.
Die <strong>Schulsozialarbeit</strong>erin würde sich auch gerne in der Arbeitsgruppe Projekttage einbringen.<br />
Die Gruppe ist bereits gebildet, aber es wurde noch kein konkreter Termin abgemacht.<br />
In der ersten Zeit werden weniger Präventionsmodule angeboten, da sie erst entwickelt<br />
werden müssen. Die anderen Angebote finden jedoch statt.<br />
13. Beschreibung konkreter Module und Projekte<br />
13.1. Präventionsmodule<br />
Es soll im Laufe der Jahre eine Palette von verschiedenen, altersgerechten<br />
Präventionsangeboten entwickelt werden. Ziel ist es, dass die Lehrpersonen aus einer Liste<br />
auswählen und sich anmelden können. Somit kann ein auf die Bedürfnis der Klasse<br />
massgeschneidertes Programm ausgewählt werden.<br />
13.1.1. Präventionsmodule Unterstufe und Mittelstufe<br />
Für die Unterstufe und Mittelstufe werden verschiedene Bausteine zu dem Thema<br />
„Sozialverhalten“ angeboten. Regeln im Umgang mit Einander werden spielerisch und<br />
altersgerecht vermittelt.<br />
Themen sind u.a.:<br />
• Mit Frustrationen umgehen,<br />
• Eigene Grenzen spüren und die des anderen zu akzeptieren,<br />
• Stärken des Einfühlungsvermögen,<br />
• Selbstwertgefühl, Selbstvertrauen<br />
• Gefühle erkennen und Ausleben<br />
• Konfliktslösung<br />
• Gewaltfreie Kommunikation<br />
Die Grundlagen sind u.a.<br />
• „Kinder lernen zusammen streiten und gemeinsam arbeiten“<br />
- Ein Mediations- und Gewaltpräventionsprogramm<br />
• „Schikanen unter Schülern- nein danke!“<br />
Bullying- ein Anti- Gewalt- Programm für die Schule<br />
• „Sozialtraining in der Schule“<br />
- Materialien für die Psychosoziale Praxis<br />
• Spiele Handbücher<br />
13.1.2. Präventionsmodelle Oberstufe<br />
An der Oberstufe werden verschiedene Bausteine oder Tagesangebote zu den Themen<br />
„Umgang mit Geld“, „Sucht“ angeboten.<br />
Themen sind u.a.:<br />
• Diskussionen zu eigenen Erfahrungen, oder Erfahrungen mit der Gesellschaft<br />
• Wo verläuft die Grenze zwischen Sucht und Genuss?<br />
• Schönheitskult und Rollenbilder<br />
• Konsum<br />
• Erster Lohn- Erste Ausgaben
Grundlagen sind u.a.:<br />
• Kurzer Filmeinstieg, Rollen in Filmen, Werbung, Kritische Auseinandersetzung mit<br />
eigenen Erfahrungen<br />
• Zusammenarbeit mit der Schuldenprävention und der Krebsliga<br />
• Thematische Spielkarten<br />
• „Immer gut drauf?“ – Ideen zur Jungenspezifischen Suchtprävention<br />
• „Lautstark und hoch hinaus“ – Ideen zur mädchenspezifischen Suchtprävention<br />
13.2. Sinnvolle Freizeitgestaltung<br />
Umfang:<br />
An 2 Mittwochen im Monat findet ein freiwilliges Freizeitangebot statt. Für dieses wird auf<br />
der „Informationsecke“ geworben. Ferner spricht die <strong>Schulsozialarbeit</strong>erin die Klassen an, da<br />
sie von den jüngeren Kindern eine Anmeldung von den Eltern braucht. Die Teilnehmerzahl ist<br />
bei kleineren Anlässen beschränkt und bei grösseren Anlässen unbeschränkt. Einen Teil der<br />
Anlässe bietet die <strong>Schulsozialarbeit</strong>erin alleine an, einen Teil in Zusammenarbeit mit anderen.<br />
Es wäre wünschenswert, wenn ältere SchülerInnen in die Gestaltung des Mittwoch<br />
Nachmittags mit einbezogen werden könnten.<br />
Projektaufbau:<br />
Es stehen in Absprache mit den Lehrpersonen die Klassenzimmer, der Computerraum und der<br />
Filmraum zur Verfügung. Die Turnhallen sind alle am Mittwoch Nachmittag besetzt. Der<br />
Peterskeller muss ausreichend im Voraus reserviert werden. Er darf nur für abgesprochene<br />
Angebote genutzt werden. Ansonsten besteht die Möglichkeit ein Angebot im Freien zu<br />
machen.
13.3. Krisenintervention<br />
Die <strong>Schulsozialarbeit</strong>erin kann im Notfall per Mobil Telefon zu einer Situation dazu geholt<br />
werden. In Zusammenarbeit mit der Lehrperson trägt die <strong>Schulsozialarbeit</strong>erin zu einer<br />
Deeskalation der Situation bei.<br />
Ihre Aufgabe ist es dann klärende Gespräche mit dem Schüler/ der Schülerin zu führen. Es<br />
sollen Lösungsmöglichkeiten erarbeitet werden und Handlungsalternativen aufgezeigt<br />
werden.<br />
13.4. Schulausflug und Lager<br />
Herrscht in einer Klasse ein Thema vor, dass mit der <strong>Schulsozialarbeit</strong>erin besprochen werden<br />
soll, oder soll auf eine Dynamik Einfluss genommen werden, so kann die<br />
<strong>Schulsozialarbeit</strong>erin am Schulausflug oder tageweise im Lager teilnehmen. Es erfolgt eine<br />
enge Zusammenarbeit mit den Lehrpersonen.<br />
13.5. Erste Elternmodule, Themenabend, Elternanlass<br />
Elternmodule oder die ersten Themenabende werden zu den Themen „Essen macht Laune“<br />
und „Freizeitlust- statt Aggression und Frust“ gestaltet. Ob ein „Erziehungs-Talk“ – Eltern<br />
helfen Eltern auf Interesse stösst kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abschliessend<br />
festgestellt werden.<br />
Ferner möchte die <strong>Schulsozialarbeit</strong>erin im Rahmen der Projektwoche einen Elternanlass<br />
planen. Die Projektgruppe ist bereits gegründet, hatte aber bislang noch kein Treffen. Daher<br />
ist noch nicht entschieden, ob die Beteiligung zustande kommt.<br />
Die <strong>Schulsozialarbeit</strong> würde ein eigenes Angebot organisieren. Dies könnte eine offene<br />
Kaffee Runde sein. Ferner ist angedacht nebenbei das Thema gesunde Ernährung<br />
einzubringen. Bei einem internationalen Rezeptaustausch besteht die Möglichkeit, später noch<br />
mal Kontakt aufzunehmen<br />
13.6. Gesamtschul- Projekt<br />
13.6.1. „Schule <strong>Neuenhof</strong>- gsund und zwäg“<br />
Das Projekt ist für die <strong>Schulsozialarbeit</strong>erin optional, je nach dem, ob es durch das<br />
Engagement der gesamten Schule ins Leben gerufen werden kann.<br />
Als erstes Projekt würde sich das Thema „Schule <strong>Neuenhof</strong>- gsund und zwäg“ eignen. Bei<br />
einer entsprechenden <strong>Konzept</strong>entwicklung bis zum 20 November, könnte die Schule<br />
<strong>Neuenhof</strong> sich für den Gesundheitsförderungspreis des Kanton Aargau bewerben. Das Projekt<br />
sollte im zeitlichen Rahmen zwischen Dezember 2006 und August 2007 liegen. Es könnte<br />
eine öffentlichkeitswirksame Medienveranstaltung am Ende des Projektes geplant werden.<br />
Wenn die zeitlichen und personellen Ressourcen nicht für die Teilnahme am Wettbewerb<br />
ausreichen, so kann das Projekt parallel zum Pausenkiosk zur Verwirklichung einer<br />
gesunderen Haltung an der Schule dienen.<br />
13.6.2. Pausenhofareal<br />
Die Neuorganisation der Pausenaufsicht wird von Seiten der Schule her angedacht. Die<br />
<strong>Schulsozialarbeit</strong>erin beteiligt sich an den Überlegungen und schlägt konkrete<br />
Veränderungsideen vor. Sie trägt durch eine objektive Beobachtung und Auswertung der<br />
Ausgangssituation bei, um deutlich zu machen, in welche Richtung die Veränderungen führen<br />
können. Ferner nimmt sie durch Präsenz auf dem Pausenhof Einfluss. Für eine ganzheitliche,<br />
nachhaltige Veränderung wäre es wünschenswert, wenn sich auch das Schulparlament<br />
einbringen könnte. Für eine langfristige Planung sollen die SchülerInnen selbst als<br />
Peacemaker/ Streitschlichter mit einbezogen werden.
14. Weiterentwicklung , Qualitätssicherung und Selbstevaluation<br />
14.1. Weiterentwicklung<br />
Die <strong>Schulsozialarbeit</strong> in <strong>Neuenhof</strong> ist noch in der Aufbauphase. In dieser Arbeitsphase ist es<br />
wichtig, Strömungen und Veränderungen wahrzunehmen. Das <strong>Konzept</strong> ist eine<br />
Bestandsaufnahme für die Aufnahme der operativen Arbeit. Es wird jedoch laufend überprüft<br />
und weiterentwickelt.<br />
Ein wichtiges Instrument für diese Aufgabe ist die quantitative Erfassung der<br />
Inanspruchnahme von Angeboten. Ferner leistet die Kinder- und Jugendkommission einen<br />
wichtigen Beitrag. Sie unterstützt und berät die <strong>Schulsozialarbeit</strong>erin. Wird wahrgenommen,<br />
dass die Angebote nicht mehr der aktuellen Situation entsprechen, so wird das <strong>Konzept</strong><br />
angepasst.<br />
Bei jedem Treffen der Kinder- und Jugendkommission findet eine kleine Auswertung statt. Es<br />
wird überprüft, ob das Angebot weiterhin so durchgeführt werden soll.<br />
Nach den ersten 15 Monaten findet eine grosse Auswertung statt. Zu diesem Zeitpunkt wird<br />
evaluiert, ob und durch welche Massnahmen die Ziele erreicht wurden. Auch die<br />
Zusammenarbeit mit der Schule soll beleuchtet werden. Strukturelle Probleme sollen erkannt<br />
und angegangen werden.<br />
14.2. Qualitätssicherung<br />
Durch einen Jahresbericht, der das erste Mal im Dezember 2007 fällig ist, kann die Qualität<br />
der Arbeit eruiert werden. Zum einen belegen quantitative Auswertungen, wie oft welches<br />
Angebot nachgefragt wurde, zum anderen lassen Berichte auf die inhaltlichen Schwerpunkte<br />
schliessen.<br />
Für eine gute Arbeit ist eine Weiterbildung und die Teilnahme an Fachtagungen unerlässlich.<br />
Auf den Tagungen können Synergien genutzt werden. Neue Ideen fliessen in die alltäglich<br />
Arbeit mit ein.<br />
Die <strong>Schulsozialarbeit</strong> kann in ihrem Theorie- Praxis- Transfer von den Erkenntnissen der<br />
Forschung profitieren. Zudem kann die Praktische Arbeit mit neuen Inputs auf einem hohen<br />
Niveau erhalten bleiben.<br />
14.3. Selbstevaluation<br />
Die <strong>Schulsozialarbeit</strong> evaluiert ihre eigene Arbeit und hat eine reflektierte Arbeitshaltung.<br />
Eine Unterstützung erfährt sie durch ihre Leitung und durch die Fallbesprechungen im Team.<br />
Zu dem kann sie sich von den Stufenleiterinnen und dem Schulleiter Feedback geben lassen.<br />
Ferner kann sie sich fachlich mit den <strong>Schulsozialarbeit</strong>erInnen in der Region austauschen. In<br />
diesem Rahmen soll auch eine Intervision stattfinden.<br />
Damit die <strong>Schulsozialarbeit</strong>erin sich ergiebig mit Problemen in ihrer Arbeit auseinandersetzen<br />
kann, ist es von grossem Vorteil eine externe Fachkraft beizuziehen. Diese kann zirkulierende<br />
Denkmuster aufzeigen und bei der Erarbeitung von Handlungsalternativen unterstützend
mitwirken. Dadurch kann die Arbeitsleistung der <strong>Schulsozialarbeit</strong>erin und ihre Belastbarkeit<br />
auf einem hohen Level gehalten werden.<br />
15. Budget<br />
Die <strong>Schulsozialarbeit</strong>erin verfügt über keinen definierten Geldbetrag, auf den sie für die<br />
praktische Tätigkeit zugreifen könnte. Dies erweist sich durch mehrere Faktoren als<br />
Problematisch.<br />
Es ergeben sich folgende Überlegungen:<br />
• Bezüglich Planung: Die Kinder- und Jugendkommission tagt alle 3 Monate. Wenn das<br />
Geld dann jeweils für ein Projekt bewilligt werden muss, ist keine langfristige Planung<br />
möglich.<br />
• Bezüglich Referenten für Elternanlässe oder Gesamtschulanlässe: es gibt Referenten,<br />
die Kostenlos ihre Zeit zur Verfügung stellen. Geht es jedoch um ein spezifisches<br />
Thema, ein dringliches Anliegen (Zeit), oder einen benötigten Experten, so sind<br />
Kosten unumgänglich.<br />
• Bezüglich Freizeitprogramm: Das Mittwoch Nachmittags Programm soll weitgehend<br />
kostenfrei gestaltet werden. Jedoch ist es wichtig „Highlights“ zu setzen, um die<br />
Attraktivität hoch zu halten. Es können z.T. Ehrenamtliche mit einbezogen werden,<br />
um Beispielsweise einen Märchennachmittag zu machen. Jedoch braucht es Geld für<br />
Ausflüge, oder Events wie einen Comic- Zeichen- Kurs, gemeinsames Kochen, oder<br />
eine DVD für den Kino/ Popcorn Nachmittag. Auch für kreative Tätigkeiten, wie z.B.<br />
Basteln wird eine Grundausrüstung benötigt.<br />
• Bezüglich Bekanntmachung: Flyer, Poster, Farbdrucke oder Fotos für die<br />
Informationsecke werden benötigt, um die <strong>Schulsozialarbeit</strong> und ihr Angebot<br />
ansprechend bekannt zu machen.<br />
• Bezüglich Anschaffungen: Es gibt Anschaffungen, die für die Jugendarbeit im Bereich<br />
Schule notwenig sind. Zum Beispiel ein Mobiltelefon und eine Tasche, um es im<br />
Alltag umhängen zu können. Ferner muss ein Guthaben gezahlt werden, um die<br />
Mobilbox abzuhören.<br />
• Bezüglich Präventionsangebote: Für diverse Themen (z.B. Mobbing, Sucht) gibt es<br />
hervorragendes thematisches Material, wie z.B. Kartenspiele, oder Medienpakete.<br />
Erlebnispädagogische Spiele benötigen kleinere Materialien, wie etwa ein Seil<br />
• Bezüglich Klasseninterventionen: Für Kooperations- und Soziale Spiele bedarf es oft<br />
kleiner Mittel, wie etwa Spielkarten.<br />
• Bezüglich Literatur: Um adäquate Methoden zu finden, und für eine für die fachliche<br />
Weiterentwicklung der <strong>Schulsozialarbeit</strong>erin braucht es gewisse Bücher.<br />
Beispielsweise „Mobbing ist kein Kinderspiel“.<br />
• Bezüglich Kosten für die Einzelfallhilfe: Diese können entstehen, wenn es nach<br />
gründlicher Abklärung keinen anderen Kostenträger gibt. Beispielsweise<br />
Kulturvermittler.<br />
• Bezüglich Projekte: Eine medienwirksame Öffentlichkeitsarbeit, braucht einen Anlass<br />
oder ein Thema. Ein Beispiel wäre Stoffbahnen mit Händeaufdruck zu machen. Nach<br />
dem Motto „Hand in Hand gegen .... „. Stofflaken können gesammelt werden, in<br />
einem grossen Ausmass muss jedoch vom Brockenhaus noch zusätzlich eingekauft<br />
werden.
• Bezüglich Qualitätssicherung: Supervision und die Fortbildungs- bzw. Fachtage<br />
sollten vom Arbeitgeber finanziert werden.<br />
• Bezüglich Raum: Um die Atmosphäre des Besprechungszimmers (Schulraum) in einen<br />
warmen, vertraulichen Beratungsraum umzuwandeln braucht es minimale<br />
Anschaffungen. Wie beispielsweise Decken, die dann von den Schülern mit<br />
Spraydosen angesprüht werden könnten.<br />
Der Grundsatz der kreativen Arbeit und eines konsumfernen Angebots soll erhalten bleiben.<br />
Selbstverständlich bemüht sich die <strong>Schulsozialarbeit</strong>erin darum, weitgehend kostenfrei und<br />
günstig zu arbeiten. Zudem versucht sie Sponsoren für diverse Projekte zu finden. Dennoch<br />
kann nicht auf alle Ausgaben verzichtet werden.<br />
Gewisse Posten sind kalkulierbar und können im voraus abgeklärt werden. Deshalb sollen<br />
folgende Mittel beantragt werden. Der Posten Flyer, etc. wird allerdings im nächsten Jahr<br />
geringer ausfallen.<br />
Budgetposten<br />
Fachtage/ Fortbildungen<br />
Supervision (6 Einheiten im Jahr)<br />
Programm Mittwoch Nachmittag (21)<br />
Präventionsmodule; Klassenintervention<br />
Raumgestaltung<br />
Anschaffungen, Telefonkosten Mobil<br />
Literatur<br />
Projekte<br />
Referenten<br />
Flyer, Poster, Fotos, Farbdrucke<br />
Büromaterial<br />
Spesen, Zugbillets<br />
Einzelfallhilfe<br />
Gesamtbetrag<br />
Finanzielle<br />
Mittel<br />
500,- Franken<br />
900,- Franken<br />
700,- Franken<br />
300,- Franken<br />
100,- Franken<br />
250,- Franken<br />
200,- Franken<br />
500,- Franken<br />
500,- Franken<br />
450,- Franken<br />
450,- Franken<br />
50,- Franken<br />
100,- Franken<br />
5000,- Franken<br />
16. Ausblick und Ideen<br />
Bei der Bedarfsanalyse und durch den fachlichen Austausch mit verschiedenen<br />
<strong>Schulsozialarbeit</strong>erInnen sind viele Ideen entstanden, die in der Aufbauphase noch nicht<br />
umgesetzt werden können. Einige dieser Ideen können auch deshalb nicht ad hoc umgesetzt<br />
werden, da eine Beteiligung der gesamten Schule notwendig wäre.<br />
An dieser Stelle sollen sie jedoch festgehalten werden, damit sie in der geeigneten Zeit<br />
aufgegriffen werden können. Projekte, die für später angedacht sind sollen hier nur genannt<br />
werden.<br />
• Weitere Module im Bereich der Elternangebote und im Bereich der Arbeit in den<br />
Klassen<br />
Im Bereich der Elternarbeit kann dies ein Informationsabend, oder ein<br />
Diskussionsabend mit Fachpersonen sein.<br />
• Präventions- Module und/ oder Thementag für Oberstufe
„Umgang mit dem Internet“ (Terminplanung im Schuljahr 2007/2008 in Absprache<br />
mit der Stufenleitung und dem Stufenteam)<br />
• Präventions- Module für die Arbeit in den Klassen Unterstufe und Mittelstufe zum<br />
Thema Suchtprävention (erste Module ab Anfang Schuljahr 2007/2008)<br />
• Mädchenspezifische Angebote z.B. Theatersequenzen „Hexen gestalten Lebenslust“<br />
oder Sensibilisierung für die eigene Stärke, oder „Lebenswege wagen und kreieren“,<br />
oder Sexualpädagogische Angebote<br />
• Streitschlichter/ Peacemaker<br />
Die Idee entspringt dem Ansatz der Peer Education. Schüler aus der allen<br />
Altersgruppen werden ihrem Alter entsprechend zu Streitschlichtern ausgebildet. Sie<br />
können in dem Pausenhof, auf dem Gang, oder im Klassenzimmer tätig werden. Um<br />
einer Überforderung vorzubeugen sollen sie durch die <strong>Schulsozialarbeit</strong>erin und<br />
interessierte Lehrpersonen begleitet werden.<br />
• Junior Mentoring<br />
Wird von verschiedenen Organisationen, Beispielsweise der NCBI Schweiz,<br />
vorgestellt. Die Idee ist im Lehrergremium der Oberstufe bereits präsent und auf<br />
grosses Interesse gestossen. Die Idee ist, dass ehrenamtliche gut situierte Leute<br />
SchülerInnen, ohne eigenes ausreichendes Netzwerk, bei der Lehrstellensuche<br />
unterstützen und die erste Zeit während der Ausbildung begleiten. Das Projekt ist sehr<br />
intensiv, hat eine lange Planungsphase und muss durch mehrere Personen gestützt<br />
werden.<br />
• Projektwoche zur Gestaltung der Schule und des Pausenhofes<br />
Zeitgleich mit der sanften baulichen Erneuerung der Schulanlage könnten sich die<br />
SchülerInnen einbringen. Dies würde eine Identifikation mit der Schule fördern und<br />
wäre eine gute Prävention gegen Vandalismus.<br />
• Gesamtprojekt „Gewaltfreie Schule“, oder Gesamtprojekt „Rauchfreie Schule“<br />
• Gesamtschulische Projekte zur Verstärkung des Kontaktes gegenüber der Eltern.<br />
Beispielsweise Elternrat, oder Morgen Kaffee Runde etc.
17. Literatur Verzeichnis<br />
Avenir Social,<br />
„Rahmenempfehlungen <strong>Schulsozialarbeit</strong>“, www.avenirsocial.ch, 2006<br />
Blurtschi Liliane, Schibli Daniel<br />
“Kinder- und Jugendarbeit <strong>Neuenhof</strong>”, <strong>Neuenhof</strong> 2006<br />
Drilling Matthias, Stäger Claudia,<br />
“<strong>Schulsozialarbeit</strong>- Rahmenkonzept für die <strong>Schulsozialarbeit</strong> an der<br />
Weiterbildungsschule Basel WBS I“, Basel, 1999<br />
Drilling Matthias,<br />
„<strong>Schulsozialarbeit</strong>- Antworten auf veränderte Lebenswelten“,<br />
Haupt Verlag, Bern; Stuttgart; Wien, 2002<br />
Fricker Christian,<br />
„<strong>Schulsozialarbeit</strong> im Aargau- gestern, heute, morgen“,<br />
FH Aargau,2005<br />
Haumersen Petra, Liebe Frank,<br />
„Wenn Multikulti schief läuft?“, Verlag an der Ruhr, 2005<br />
Henz Rene,<br />
„Bedürfnisserfasung und Empfehlung zur Einführung der Schul-sozialarbeit an der<br />
Sekundarschule Waldenburgtal“,<br />
Hochschule für Pädagogik und Soziale Arbeit beider Basel Departement Soziale<br />
Arbeit, 2005<br />
Hösl Gerhard,<br />
„Mediation- die erfolgreiche Konfliktlösung“, Kösel München, 2004<br />
Hössli Nina,<br />
„Muslimische Kinder in der Schule“, NCBI, K2 Verlag, 2005<br />
Iseli Daniel, Ruch Hansueli, Häberle Brigitte<br />
„<strong>Konzept</strong> <strong>Schulsozialarbeit</strong> Volksschule Baden“, Bern/ Baden 2005<br />
Johann Ellen, Michely Hildegard, Springer Monika,<br />
„Interkulturelle Pädagogik“, Cornelson, 2004<br />
Schmid Martin, Storni Marco, Gantner Ludwig,<br />
“Kinder- und Jugendkonzept für die <strong>Gemeinde</strong> <strong>Neuenhof</strong> AG”, ecce- Gemeinschaft<br />
für Sozialforschung, 2004<br />
Vogel Christian,<br />
„<strong>Schulsozialarbeit</strong>- Eine institutionsanalytische Untersuchung von Kommunikation<br />
und Kooperation“, VS- Verlag für Sozialwissenschaften, 2006<br />
Wegmann Irene, Würgler Konrad,<br />
„<strong>Konzept</strong> für die <strong>Schulsozialarbeit</strong>“, Spreitenbach 2003
18. Anhang<br />
Ablaufschema Auffälligkeiten<br />
Organigramm,<br />
Fragebogen,<br />
Diagramme,<br />
Merkblätter Lehrpersonen<br />
Ideen für den Mittwoch Nachmittag