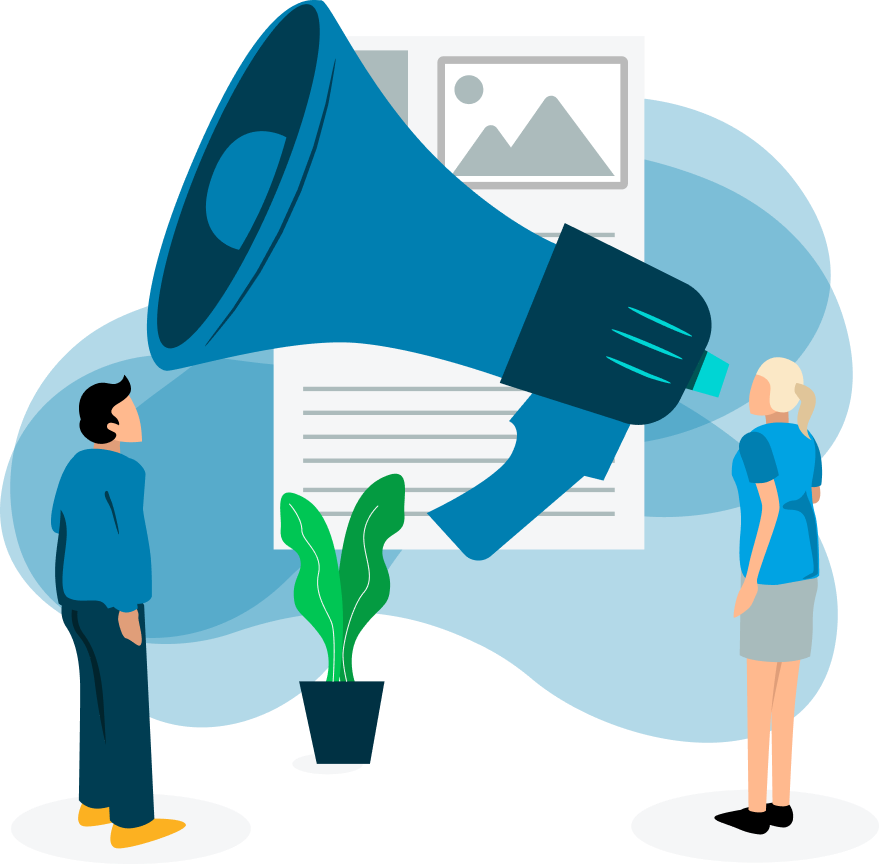Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Nº06<br />
JUNI<br />
2014<br />
€ 8.50<br />
CHF 13<br />
Minister trifft Maestro<br />
Wolfgang Schäuble und<br />
Daniel Barenboim über<br />
die Kunst <strong>des</strong> Führens<br />
Mit Beiträgen von<br />
Tomáš Sedláček,<br />
Ottfried Fischer,<br />
Herfried Münkler<br />
und Tori Amos<br />
<strong>Der</strong> <strong>letzte</strong> <strong>Sommer</strong><br />
<strong>des</strong> Rock´n´Roll<br />
Wie es mit dem Sound einer Generation weitergeht,<br />
wenn seine Väter weg sind<br />
Österreich: 8.50 €, Benelux: 9.50 €, Italien: 9.50 €<br />
Spanien: 9.50 € , Finnland: 12.80 €<br />
06<br />
4 196392 008505
ERSTER EINER NEU<br />
DER BMW i8.<br />
BMW i. BORN ELECTRIC.<br />
bmw-i.de/i8<br />
BMW i8 mit Plug-in-Hybridantrieb BMW eDrive: Energieverbrauch (kombiniert):<br />
11,9 kWh/100 km; Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 2,1 l/100 km; CO 2 -Emission<br />
(kombiniert): 49 g/km. Die Verbrauchswerte wurden auf Basis <strong>des</strong> ECE-Testzyklus<br />
ermittelt. Abbildung zeigt Sonderausstattungen. Neue BMW i Fahrzeuge sind bei<br />
jedem autorisierten BMW i Agenten erhältlich.
EN ZEIT.<br />
BMW i<br />
Freude am Fahren
ATTICUS<br />
N°-6<br />
… IS HERE TO STAY?<br />
Titelbild: Miriam Migliazzi & Mart Klein; Illustration: Anja Stiehler/Jutta Fricke Illustrators<br />
Bircher Müesli. Tony Iommi hatte am<br />
Frühstücksbuffet Bircher Müesli<br />
genommen. Bleich, mit Kinnbärtchen und<br />
viel zu schwarzem Haar stand der Vater<br />
der schleppenden Gitarre da und lud sich<br />
Makrobiotisches auf den Teller. Irgendwie<br />
hätte ich eher Blutwurst erwartet. Oder<br />
einen doppelten Whisky.<br />
Ich hatte mir das Grand Hotel gegönnt<br />
für diese Tage <strong>des</strong> Montreux-Jazz-Festivals.<br />
Historischer Boden: In einem T-förmigen<br />
Hotelflur haben Deep Purple seinerzeit<br />
not gedrungen das Album „Machine Head“<br />
eingespielt, <strong>des</strong>sen großes Riff bis heute<br />
zu Ian Gillans Gesang nachhallt: „We all<br />
came down to Montreux, on the Lake<br />
Geneva Shoreline …“<br />
Ein paar Jahre ist das her. Ronnie<br />
James Dio, der damals zu Iommis Gitarre<br />
gesungen hatte, lebt nicht mehr. Er fehlt<br />
wie J. J. Cale, Lou Reed, Jon Lord, der die<br />
schwere Hammond-Orgel spielte im<br />
Flur-T <strong>des</strong> Hotels. Tony Iommi hat seinen<br />
Krebs noch einmal zurückgedrängt und<br />
tritt weiter auf. Aber Malcolm Young von<br />
AC / DC kann nicht mehr Gitarre spielen.<br />
Diesen <strong>Sommer</strong> kommen sie wieder.<br />
Dylan, die Stones, Black Sabbath,<br />
Patti Smith. Und alle gehen noch mal hin.<br />
50 Jahre geht das schon so. Rock ’n’ Roll als<br />
Illusion der Unsterblichkeit, der eigenen<br />
ewigen Jugend. Und als Nachweis, dass es<br />
diese ewige Jugend auch gibt, wenn man<br />
seinen Körper mit Drogen schindet. Dass<br />
diese ganze öde Askese Quatsch ist.<br />
Dass es auch ohne Bircher Müesli geht.<br />
Aber sie bleiben eben doch nicht ewig.<br />
Sie sind keine griechischen Götter, die<br />
über die Musik Kontakt mit uns Sterblichen<br />
haben. Sie gehen auch.<br />
Stirbt der Rock mit seinen Gründern?<br />
Oder steht er vor einer Zeitenwende wie<br />
die Klassik, als Mozart und Beethoven weg<br />
waren? Wer soll einen Lemmy Kilmister<br />
ersetzen, eine Patti Smith?<br />
Thomas Winkler ist den lebenden<br />
Legenden und dieser Frage hinterhergefahren<br />
( ab Seite 16) . Arne Willander,<br />
Vize-Chef <strong>des</strong> deutschen Rolling Stone,<br />
sagt uns, welche Gigs der Altmeister<br />
wir in den kommenden Wochen auf keinen<br />
Fall verpassen dürfen ( Seite 28 ).<br />
<strong>Der</strong> Konzertveranstalter Marek Lieberberg<br />
redet über die revolutionäre Kraft dieser<br />
Musik, die eine ganze Generation und unsere<br />
westliche Kultur geprägt hat ( ab Seite 26 ).<br />
„Is this the end of the beginning, or<br />
the beginning of the end?“, fragt Ozzy<br />
Osbourne zu Beginn <strong>des</strong> Albums „13“,<br />
mit dem sich Black Sabbath aus der Gruft<br />
zurückgemeldet haben.<br />
Ende vom Anfang oder Anfang vom<br />
Ende? Das, lieber Ozzy Osbourne, ist<br />
genau die Frage.<br />
Mit besten Grüßen<br />
CHRISTOPH SCHWENNICKE<br />
Chefredakteur<br />
5<br />
<strong>Cicero</strong> – 6. 2014
Deutsches Historisches Museum ∙ Unter den Linden 2 ∙ 10117 Berlin<br />
www.dhm.de ∙ Täglich 10–18 Uhr<br />
29.05.–30.11.2014
INHALT<br />
Foto: Simone Cecchetti/Corbis<br />
26<br />
„BEI DEN STARS TICKT DIE UHR“<br />
Konzertagent Marek Lieberberg im Interview<br />
über Schlagzeuger auf dem Kronleuchter, neue<br />
Talente und die Sehnsüchte <strong>des</strong> Publikums<br />
Von THOMAS WINKLER<br />
TITELTHEMA<br />
16<br />
SPIELT ES NOCH EINMAL!<br />
Irgendwann kommt die <strong>letzte</strong> Zugabe.<br />
Stirbt der Rock mit seinen Gründern?<br />
Eine Reportagereise zu Deep Purple in den Alpen,<br />
Patti Smith in der Kirche und Jimmy Page<br />
im Meistersaal – und ein grundsätzlicher Mailwechsel<br />
mit Lemmy Kilmister<br />
Von THOMAS WINKLER<br />
28<br />
BLOSS NICHT VERPASSEN<br />
Hochgeschwindigkeit, Höllenlärm und Hotel<br />
California: Eine kommentierte <strong>Vorschau</strong><br />
auf den Konzertsommer der Legenden<br />
Von ARNE WILLANDER<br />
7<br />
<strong>Cicero</strong> – 6. 2014
BERLINER REPUBLIK WELTBÜHNE KAPITAL<br />
30 DIE MUTTER DER MÜTTERRENTE<br />
Dass ältere Mütter mehr Geld erhalten,<br />
liegt an der hartnäckigen<br />
CDU‐Politikerin Maria Böhmer<br />
Von HARMUT PALMER<br />
52 DER LEISETRETER<br />
Jens Stoltenberg, neuer<br />
Nato‐Generalsekretär, hat schon mal<br />
heikle Probleme mit Russland gelöst<br />
Von GUNNAR HERRMANN<br />
80 ALLEIN GEGEN DAS KAPITAL<br />
Frauke Menke ist das Hassobjekt<br />
deutscher Banker, weil die Aufseherin<br />
ihren Aufstieg verhindern kann<br />
Von MEIKE SCHREIBER und<br />
HEINZ-ROGER DOHMS<br />
32 BREAKING GOOD<br />
<strong>Der</strong> Arzt Roland Härtel-Petri<br />
ist Vorreiter im Kampf gegen<br />
die Droge Crystal Meth<br />
Von MERLE SCHMALENBACH<br />
34 IHRE WELT DANACH<br />
Niederlagen, Verletzungen –<br />
und dann? Begegnung mit der<br />
Grünen Renate Künast<br />
Von KATJA KRAUS<br />
37 FRAU FRIED FRAGT SICH …<br />
… was das Stöhnen über<br />
ständige Erreichbarkeit soll<br />
Von AMELIE FRIED<br />
38 „MUT UND DEMUT<br />
RICHTIG MISCHEN“<br />
Daniel Barenboim und Wolfgang<br />
Schäuble über die Kunst <strong>des</strong> Führens<br />
Von FRANK A. MEYER und<br />
CHRISTOPH SCHWENNICKE<br />
46 MISSTRAUT EUCH!<br />
Vertrauen ist für den Umgang mit<br />
Geheimdiensten keine Kategorie<br />
Von FRANK A. MEYER<br />
48 DER PREKÄRE FRIEDEN<br />
Die Ukrainekrise zeigt<br />
Deutschland: Es war falsch, die<br />
Wehrpflicht abzuschaffen<br />
Von KARL FELDMEYER<br />
38<br />
Wolfgang Schäuble sagt, was<br />
der ärgste Fehler eines Chefs ist<br />
54 PUTINS ALBTRAUM<br />
Journalistin, Cafébesitzerin,<br />
Aktivistin: Natalia Morar<br />
spielt in der Republik Moldau<br />
eine Schlüsselrolle<br />
Von OLIVER BILGER<br />
56 AUFRECHTEN GANGES<br />
<strong>Der</strong> Schweizer Didier Burkhalter<br />
ist ein neuer Star auf der<br />
Weltbühne. Als OSZE-Chef ist<br />
er inmitten der Ukrainekrise<br />
Von PETER HOSSLI<br />
58 MÄCHTIG REICH<br />
Zehn russische und ukrainische<br />
Oligarchen, die man kennen sollte<br />
Von MORITZ GATHMANN und MAXIM KIREEV<br />
66 „AMERIKA HAT EINE<br />
CHRONISCHE GRIPPE“<br />
George Packer analysiert das<br />
Versagen der Obama-Regierung<br />
Von ALEXANDER SCHIMMELBUSCH<br />
70 RIO VOR DEM ANPFIFF<br />
Was erwarten die Menschen<br />
in Brasilien von der<br />
Fußball-WM? Ein Fotoessay<br />
Von ISABELA PACINI<br />
70<br />
Leonardo Sant’Anna spielt sich<br />
für die WM warm<br />
82 BAUERN,<br />
DIE MINEN MACHEN<br />
Die Kulis von Familie Schneider<br />
sind so gut, dass selbst die<br />
Konkurrenz bei ihnen einkauft<br />
Von CHRISTIAN LITZ<br />
84 UNSER MANN IN BAGDAD<br />
Als Brückenbauer zwischen den<br />
Kulturen bringt Klaus Hachmeier<br />
deutsche Firmen in den Irak<br />
Von ERIC CHAUVISTRÉ<br />
86 „DIE GRIECHEN<br />
SIND DIE ÖKONOMISCHE<br />
AVANTGARDE“<br />
<strong>Der</strong> tschechische Starökonom Tomáš<br />
Sedláček fordert eine Abkehr von der<br />
Ideologie <strong>des</strong> ewigen Wachstums<br />
Von TOMÁŠ SACHER<br />
90 SCHULLANDHEIM<br />
DER MÄCHTIGEN<br />
Zum 60. Geburtstag ein Blick hinter<br />
die Kulissen der Bilderberg-Konferenz<br />
Von CONSTANTIN MAGNIS<br />
86<br />
Tomáš Sedláček erklärt, was er<br />
gegen rechteckige Tische hat<br />
Fotos: Antje Berghäuser für <strong>Cicero</strong>, Isabela Pacini, Dominik Butzmann/Laif<br />
8<br />
<strong>Cicero</strong> – 6. 2014
STIL<br />
SALON<br />
CICERO<br />
STANDARDS<br />
96 DER SIEG DER MILF<br />
Ein Begriff aus der Pornografie<br />
macht Karriere<br />
Von LENA BERGMANN<br />
98 DEIN DADA,<br />
MEIN JURA<br />
Ob Designerspielzeug<br />
oder Hitlergruß: <strong>Der</strong> Anwalt<br />
Pascal Decker hantiert mit<br />
Kunst und Gesetzen<br />
Von SARAH-MARIA DECKERT<br />
100 FERNSEHEN 2014<br />
Heimchen, Piraten,<br />
Traditionalisten oder Beamer:<br />
Zu welcher Fernsehspezies<br />
zählen Sie? Eine TV‐Typologie<br />
pünktlich zur Fußball-WM<br />
Von LENA BERGMANN<br />
106 WARUM ICH TRAGE,<br />
WAS ICH TRAGE<br />
Verletzlichkeit zeigen,<br />
aber keine Scheu.<br />
Wie funktioniert das?<br />
Von TORI AMOS<br />
100<br />
<strong>Der</strong> Pirat ist einer von vier<br />
Fernsehtypen<br />
108 DER MIT DEN BÄUMEN WÄCHST<br />
<strong>Der</strong> Regisseur Richard Linklater hat elf<br />
Jahre an dem Film „Boyhood“ gedreht<br />
Von DIETER OSSWALD<br />
110 SMART IM MAGISCHEN DREIECK<br />
<strong>Der</strong> Präsident <strong>des</strong> Deutschen<br />
Historischen Museums, Alexander<br />
Koch, wird kritisiert. Wofür eigentlich?<br />
Von ALEXANDER KISSLER<br />
114 „PUTIN MUSS SICH VERKLEIDEN“<br />
<strong>Der</strong> Politologe Herfried Münkler<br />
erwartet keinen Dritten Weltkrieg<br />
Von ALEXANDER KISSLER und<br />
ALEXANDER MARGUIER<br />
118 DE SADE LÄSST GRÜSSEN<br />
Google will die Welt verbessern und<br />
einen neuen Menschen erschaffen<br />
Von OLIVER PRIEN<br />
122 MAN SIEHT NUR,<br />
WAS MAN SUCHT<br />
<strong>Der</strong> deutsche Beitrag zur<br />
Architekturbiennale ist ein<br />
„Bungalow Germania“<br />
Von BEAT WYSS<br />
124 LITERATUREN<br />
Bücher von Chimamanda Ngozi<br />
Adichie, Alan Bennett, Kay<br />
Schiller und Alissa Ganijewa<br />
130 BIBLIOTHEKSPORTRÄT<br />
<strong>Der</strong> Schauspieler Ottfried Fischer<br />
findet in Büchern Geist und Haltung<br />
Von WOLF REISER<br />
134 HOPES WELT<br />
Klassische Musik ist für alle da<br />
Von DANIEL HOPE<br />
136 DIE LETZTEN 24 STUNDEN<br />
Ein Leichentuch von Dior<br />
Von BARBARA VINKEN<br />
05 ATTICUS<br />
Von CHRISTOPH SCHWENNICKE<br />
10 STADTGESPRÄCH<br />
12 FORUM<br />
14 IMPRESSUM<br />
138 POSTSCRIPTUM<br />
Von ALEXANDER MARGUIER<br />
Die Titelstars<br />
Auf der Titelseite sollte<br />
eine Allstarband auftreten:<br />
<strong>Cicero</strong> zeigt die ultimative<br />
Zusammenstellung<br />
lebender Gründer <strong>des</strong><br />
Rock ‘n‘ Roll, das war die<br />
Idee. Dass wir die Illustratoren<br />
Miriam Migliazzi<br />
und Mart Klein gewinnen<br />
wollten, war schnell klar.<br />
Das Casting der Musiker<br />
erschien uns zunächst<br />
auch als Genussarbeit.<br />
Ian Paice oder Neil Peart<br />
als Drummer? Angus<br />
Young oder Tony Iommi an<br />
der Gitarre? Aber Moment,<br />
was ist mit Keith Richards?<br />
Neil Young, Eric Clapton –<br />
es gibt ganz schön<br />
viele Gründerväter an der<br />
Gitarre. Und: Über Sänger,<br />
Bassist und vielleicht<br />
noch einen Keyboarder<br />
hatten wir noch gar nicht<br />
gesprochen! Es wurde sehr<br />
voll. Zu voll für eine Titelseite.<br />
Noch vor dem ersten<br />
Auftritt brach die <strong>Cicero</strong>-<br />
Allstarband auseinander.<br />
<strong>Der</strong> schmerzliche Ausweg:<br />
Nur drei und nur Sänger.<br />
Nun rocken: Mick Jagger,<br />
Ozzy Osbourne und Patti<br />
Smith (mit Rhyth musgitarre<br />
). Lemmy, Tony,<br />
Angus: Nächstes Mal seid<br />
ihr dran!<br />
Illustration: Susanne Stefanizen<br />
9<br />
<strong>Cicero</strong> – 6. 2014
CICERO<br />
Stadtgespräch<br />
Schäuble droht mit Geige, Gabriel sagt, warum er gern nach Polen reist, im<br />
Wald stehen Telefonzellen zum Verkauf. Und Schildbürger trifft man überall<br />
Schäubles Wunderwaffe:<br />
Teufelsgeiger<br />
Dabeisein ist alles:<br />
Mit Spargel zur Spitze<br />
Warum Gabriel so gern nach Polen reist:<br />
Einmal Kanzler sein<br />
In manchen Biografien von Wolfgang<br />
Schäuble steht, er spiele Geige. Das<br />
amüsiert den deutschen Finanzminister<br />
mehr als es ihn ärgert. Die Wahrheit<br />
sei, erzählte er nach dem <strong>Cicero</strong>-Foyergespräch<br />
mit dem Dirigenten und Pianisten<br />
Daniel Barenboim im Foyer <strong>des</strong><br />
Berliner Ensembles (ab Seite 38), dass<br />
er als Kind einmal einige Zeit damit<br />
traktiert wurde, Geige lernen zu sollen.<br />
Die Musikpädagogik war damals<br />
noch etwas weniger einfühlsam als<br />
heute. Ein Kind hatte eben ein Instrument<br />
zu lernen. <strong>Der</strong> kleine Wolfgang<br />
gab sich große Mühe. Er kratzte fleißig<br />
auf seiner Geige und fand dabei<br />
schnell heraus, dass sich seine unzureichende<br />
Fertigkeit als Virtuose sehr<br />
gut als Druckmittel eignete. Wenn ihn<br />
also irgendjemand in der Familie mit irgendwas<br />
allzu sehr ärgerte, machte er<br />
das ungeliebte Instrument zur Waffe.<br />
„Wenn ihr nicht aufhört, dann hol ich<br />
die Geige!“ Das war die schlimmste<br />
Drohung im Hause Schäuble. swn<br />
Je<strong>des</strong> Jahr im Juni gibt es in Berlin<br />
ein großes Gedränge. Wer links der<br />
Mitte etwas werden will, muss an Bord<br />
sein, wenn das Schiff <strong>des</strong> rechten Seeheimer<br />
Kreises zum SPD-Spargelessen<br />
ausläuft. 2010 war Joachim Gauck dabei<br />
– und wurde drei Jahre später Bun<strong>des</strong>präsident.<br />
2011 war Peer Steinbrück<br />
nicht an Bord und wurde – naja. „Esst<br />
kräftig Spargel, denn ab 2013 werden<br />
wir wieder richtig arbeiten – in der Regierung“,<br />
sagte Frank-Walter Steinmeier<br />
zur 50-Jahr-Feier der Spargelspitzen.<br />
Alles nur Zufall? Dass Spargel<br />
und Macht untrennbar miteinander verbunden<br />
sind, weiß auch die FDP. 2003<br />
wurde Guido Westerwelle Huckelrieder<br />
Spargelkönig. Laudator Wolfgang Clement<br />
rief zu einem „Bündnis für Spargel“<br />
auf. Aber dann? Seit 2009 gibt es<br />
keinen Spargelkönig mehr. Mit ihm<br />
ging das Amt. Und das Mandat. Ohne<br />
Spargel keine Macht. Mit Spargel geht’s<br />
zur Spitze. ts<br />
Sehr gerne fahre er nach Polen,<br />
scherzt Vizekanzler Sigmar Gabriel,<br />
„weil man dort die Angewohnheit<br />
hat, einen immer eine Stufe höher<br />
anzusprechen“. Das war auch bei seinem<br />
Antrittsbesuch in Warschau der<br />
Fall, wo er bei einer Veranstaltung von<br />
einem Dolmetscher als „Kanzler“ begrüßt<br />
wurde.<br />
Doch aufgepasst: Schon Edmund<br />
Stoiber musste 2005 lernen, welche Bedeutung<br />
Angela Merkel ihren Ressortchefs<br />
zumisst. <strong>Der</strong> CSU-Politiker – damals<br />
Parteichef und Ministerpräsident<br />
in Bayern und als einflussreicher Wirtschaftsminister<br />
in Berlin vorgesehen –<br />
fragte Merkel, wer <strong>letzte</strong>ndlich entscheide,<br />
wenn er mal anderer Meinung<br />
sei als sie, die Kanzlerin. „Da hilft ein<br />
Blick in die Verfassung“, antwortete<br />
Merkel trocken. Dort las Stoiber in Artikel<br />
65: „<strong>Der</strong> Bun<strong>des</strong>kanzler bestimmt<br />
die Richtlinien der Politik und trägt dafür<br />
die Verantwortung.“ Er blieb dann<br />
doch lieber in Bayern. tz<br />
Illustrationen: Jan Rieckhoff<br />
10<br />
<strong>Cicero</strong> – 6. 2014
Nostalgische Telekom:<br />
Zell(ver)teilung<br />
Es muss Ende der Neunziger gewesen<br />
sein, als man zuletzt mit Pfennigmünzen<br />
einen Telefonzellenschlitz<br />
befütterte, um sich ein Taxi zu rufen.<br />
Lange her. Heute versprüht das gute<br />
alte Telefonhäuschen seinen Retrocharme<br />
höchstens noch an gentrifizierungsfernen<br />
Straßenecken, während<br />
kleine Kinder im Vorbeigehen an Mamas<br />
Hemdsärmel zuppeln und fragend<br />
und staunend mit dem Finger auf den<br />
300-Kilo-Koloss zeigen.<br />
Wen jetzt die Nostalgie packt, der<br />
kann sich die Hände reiben. Denn die<br />
Deutsche Telekom bietet 3000 Stück<br />
zum privaten Kauf an, das gelbe Original<br />
„TelH78“ für 450 Euro, das neuere<br />
graue Modell mit magentafarbenem<br />
Dach für 350.<br />
In einem kleinen Waldstück bei<br />
Potsdam stehen die defekten oder ausrangierten<br />
Modelle aufgereiht und warten<br />
auf ein neues Zuhause.<br />
Die Telefonzelle, das unbedingte<br />
Must-have für diesen <strong>Sommer</strong>. Und so<br />
multifunktional! Wie wäre es mit der<br />
Telefonzelle als Dusche für den Garten?<br />
Noch besser: als Sauna. Auch als<br />
Gewächshaus wäre sie denkbar, als<br />
Minibar oder portables Kleinraumbüro.<br />
Als schützender Unterstand hat<br />
sie sich schon früher bewährt, vor Regen<br />
etwa oder aggressiven Vögeln<br />
(Hitchcock).<br />
Gar nicht so weit hergeholt scheint<br />
die Idee, sie auch indoor zu verwenden,<br />
als ruhigen Rückzugsort in hektischen<br />
Großraumbüros beispielsweise, um<br />
endlich ungestört telefonieren zu können<br />
– mit dem Handy. smd<br />
Schildau besiegt Schilda:<br />
Lohn der Dummheit<br />
Zwei Städte stritten jahrelang um<br />
den Ruhm, einst die Heimat der<br />
Schildbürger gewesen zu sein: Schilda<br />
(in Brandenburg) und Schildau (in<br />
Sachsen). Schildau hat gewonnen. Vera<br />
Korn, dort für den Fremdenverkehr zuständig,<br />
hat es vom Patentamt in München<br />
schriftlich: Nur Schildau darf sich<br />
„Stadt der Schildbürger“ nennen. Zumal<br />
sie früher auch Schilda hieß. „Aber<br />
Schilda hieß immer schon Schilda“, sagt<br />
Joachim Häußler, der als Bürgermeister<br />
von Schilda einst um den Titel kämpfte.<br />
Er sieht sich um den Lohn der Dummheit<br />
geprellt. Schildbürgerstreiche fördern<br />
nämlich den Fremdenverkehr.<br />
Auf einem Wanderweg in Schildau<br />
sind zwölf der bekanntesten Episoden<br />
dokumentiert: Die vom fensterlosen<br />
Rathaus, die vom Flusskrebs, den sie<br />
im Wasser ertränken, oder von der Kuh<br />
<strong>des</strong> Bürgermeisters, die sie an einem<br />
Strick zum Grasen auf die Stadtmauer<br />
ziehen wollten – und dabei erdrosselten.<br />
Zum Schluss erzählt Vera Korn gern<br />
die Geschichte von der Katze, vor der<br />
die Schildbürger so viel Angst hatten,<br />
dass sie ein Haus nach dem anderen anzündeten,<br />
um sie auszuräuchern – bis<br />
am Ende Schilda in Schutt und Asche<br />
lag, und sie auswandern mussten.<br />
Und wo sind sie geblieben? „Die<br />
meisten“, so belehrte Frau Korn kürzlich<br />
eine Besuchergruppe aus der nahen<br />
Hauptstadt, „gingen nach Berlin.“ Dort<br />
gibt es zwar kein fensterloses Rathaus.<br />
Aber einen Flughafen, auf dem man<br />
weder starten noch landen kann. <strong>Der</strong><br />
Geist von Schilda weht überall. hp<br />
Regierung online:<br />
Nachteulen im Kabinett<br />
Wer wissen will, warum unsere<br />
15 Ministerinnen und Minister<br />
in die Politik gegangen sind und<br />
was sie auch privat gern tun, muss auf<br />
www. youtube.de/Bun<strong>des</strong>regierung klicken.<br />
Hier erfährt man einiges, was<br />
sonst nicht in den Zeitungen steht.<br />
Natürlich gibt es das nicht umsonst.<br />
Jede dreiminütige Video-Botschaft<br />
kostet laut Bun<strong>des</strong>presseamt rund<br />
1600 Euro. Schon nölen Experten, hier<br />
seien Steuergelder für persönliche PR<br />
eingesetzt worden. Geklickt wird trotzdem.<br />
Am häufigsten bei Frank-Walter<br />
Steinmeier.<br />
Wo hat der Bun<strong>des</strong>außenminister<br />
nur so gut kochen gelernt? „In der Studenten-WG.“<br />
Dort fand er auch heraus,<br />
„dass es gemeinsam besser geht als<br />
alleine“. Und ein Feierabend ist dann<br />
perfekt, „wenn er vor 22 Uhr beginnt,<br />
dann noch ein interessanter Film in der<br />
Glotze läuft und es dazu ein Glas Rotwein<br />
gibt“.<br />
Die zentrale Botschaft der SPD-<br />
Familienministerin Manuela Schwesig<br />
lautet: „Ich will die Welt ein Stück<br />
besser machen.“ Außerdem verrät sie,<br />
dass sie gern die „Nachteule“ gibt, die<br />
abends lieber bis spät auf dem Sofa kuschelt,<br />
als im Morgengrauen als „früher<br />
Vogel“ aus dem Nest zu kriechen.<br />
Zur Kategorie „Nachteule“ bekennt<br />
sich auch Bun<strong>des</strong>finanzminister<br />
Wolfgang Schäuble. Und er verrät,<br />
wer sein wichtigster Berater ist: „Meine<br />
Frau.“ Und warum ist Sigmar Gabriel<br />
Politiker geworden? „Das frage ich<br />
mich auch“, sagt der Vizekanzler und<br />
lacht schallend – über sich selbst. tz<br />
11<br />
<strong>Cicero</strong> – 6. 2014
CICERO<br />
Leserbriefe<br />
FORUM<br />
Es geht um zehn Jahre <strong>Cicero</strong>, die Burka,<br />
Europa und erneut um Luthers Antisemitismus<br />
Zum Jubiläumsheft „Zehn Jahre <strong>Cicero</strong>“, Mai 2014<br />
„Da stimmt einfach alles“<br />
Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich viel zu spät in meinem Leben zu<br />
Ihrer Zeitschrift gefunden habe und nun Ihr regelmäßiger Leser bin, und habe<br />
einfach das Bedürfnis, Ihnen meine Begeisterung für dieses Blatt mitzuteilen.<br />
Da stimmt einfach alles: Sprache, Themen, Gehalt, Stil, Textlänge, Text-Bild-<br />
Verhältnis, überhaupt das Layout, die Differenzierung nach Themengruppen, die<br />
anregende und nie ermüdende Textgestaltung und so weiter …<br />
Ich weiß wirklich nicht, was ich kritisieren sollte, und das tue ich eigentlich<br />
sehr gerne. Da soll noch einer sagen, die Printmedien seien am Ende! Danke für<br />
diese wunderbare Zeitschrift und weiterhin allen guten Erfolg!<br />
Jürgen Lambrecht, Baden-Baden<br />
Zahnlos geworden<br />
Zehn Jahre sind eine lange Zeit.<br />
Was als hoffnungsvolles politisches<br />
Magazin begonnen hat, wurde im<br />
Lauf dieser Zeit leider zum zahnlosen<br />
System-Medium. Schade drum.<br />
Albert Keller, München<br />
Zum Beitrag „Frau Fried fragt sich, ob<br />
Individualisten in Gruppen reisen sollten“<br />
von Amelie Fried, Mai 2014<br />
Nur ein Konstrukt<br />
Ich vermute, dass die von Frau<br />
Fried geschilderte Busreise ein Konstrukt<br />
ist, das es ihr ermöglicht,<br />
ihre Gehässigkeiten stellvertretend<br />
imaginierten Mitreisenden in den<br />
Mund zu legen. Ihr Artikel wird<br />
mich nicht von einer möglichen<br />
Busreise abhalten. Ich würde mich<br />
allein schon darüber freuen, dass<br />
sehr wahrscheinlich ein erfahrener<br />
Profi am Steuer sitzt. Und dass die<br />
Möglichkeit, Frau Fried als Reisegefährtin<br />
zu haben, approximativ<br />
gleich null ist.<br />
Klaus R. B. Schmitt, Kehl<br />
Zum Beitrag „Sie spielen mit<br />
Konfliktstoff“ von Katharina Pfannkuch,<br />
Mai 2014<br />
Emanzipation per Burka?<br />
Wer bisher der Ansicht war, das<br />
Kopftuch stehe für die Unterdrückung<br />
von Frauen oder sei Symbol<br />
gegen eine laizistische Staatsordnung,<br />
ist jetzt endgültig eines Besseren<br />
belehrt worden.<br />
Die Bedeckung <strong>des</strong> Haares besitzt<br />
– so eine im Artikel affirmativ<br />
zitierte muslimische Bloggerin,<br />
die „vor anderthalb Jahren<br />
den Turban für sich entdeckt“ hat –<br />
eine „feministische Dimension“,<br />
da sie den Betrachter zwinge, „die<br />
Persönlichkeit jenseits der Optik<br />
wahrzunehmen“.<br />
Dieser Logik zufolge müsste<br />
die Burka kleidungsmäßig gesehen<br />
eigentlich den Höhepunkt der<br />
Emanzipation der Frau darstellen.<br />
Und sie ist es wohl nur <strong>des</strong>wegen<br />
nicht, weil sie nicht so schön „in<br />
leuchtenden Farben kunstvoll drapiert<br />
ist“.<br />
Dr. Christian Rother, Bonn<br />
Zum Beitrag „Er gehört zu uns“ von<br />
Michael Stallknecht, April 2014<br />
Verdrehte Kausalitäten<br />
Seit vielen Jahren ist die <strong>Cicero</strong>-<br />
Lektüre essenzieller Bestandteil<br />
meiner politischen und kulturellen<br />
Weiterbildung. Insbesondere die<br />
Sängerporträts in den Artikeln von<br />
Frau Baur habe ich stets als Bereicherung<br />
empfunden.<br />
<strong>Der</strong> kritische Artikel über Jonas<br />
Kaufmann ist allerdings ein für<br />
mich kaum nachvollziehbarer Verriss,<br />
den der Autor durch einen angeblichen<br />
Konsens mit den „Stimmfetischisten“<br />
legitimieren will. Über<br />
Technik und deren darstellerische<br />
Wirkung kann man sich bekanntlich<br />
streiten. Dass Kaufmann aber durch<br />
Aussagen wie „Nur wer es ins Fernsehen<br />
schafft, gilt als Star“ oder er<br />
„funktioniert perfekt als mediales<br />
Image“ zu einem medial gestützten<br />
Eventstar degradiert wird, <strong>des</strong>sen<br />
gesangliche Qualität dazu kein adäquates<br />
Gegengewicht bilde, ist verquer<br />
und beleidigt die Gesamtheit<br />
der ihm zugeneigten Rezipienten.<br />
Die Kausalitäten sind umgekehrt:<br />
Gutes Aussehen macht einen<br />
Tenor noch nicht zu einem guten<br />
Lohengrin oder Alvaro.<br />
Medienstars gab es von Wunderlich<br />
bis Domingo – im Übrigen<br />
ebenfalls ohne antiquierte Starallüren<br />
und ganz authentisch, aber mit<br />
ebenso herausragenden gesanglichen<br />
Qualitäten.<br />
Das Opernpublikum ist mitnichten<br />
so anspruchslos eindimensional,<br />
wie dies der Autor suggerieren will.<br />
Tilman Schultheiß, Leipzig<br />
12<br />
<strong>Cicero</strong> – 6. 2014
EXKLUSIVER GENUSS<br />
Die neue Lattissima Pro vereint leistungsstarke Technologie mit der Einfachheit eines Touchscreens.<br />
Genießen Sie jetzt mit nur einer Berührung auch zu Hause exzellente Kaffee-Kreationen mit frischer Milch.<br />
www.nespresso.com/lattissima-pro
IMPRESSUM<br />
VERLEGER Michael Ringier<br />
CHEFREDAKTEUR Christoph Schwennicke<br />
STELLVERTRETER DES CHEFREDAKTEURS<br />
Alexander Marguier<br />
REDAKTION<br />
TEXTCHEF Georg Löwisch<br />
CHEFIN VOM DIENST Kerstin Schröer<br />
RESSORTLEITER Lena Bergmann ( Stil ),<br />
Judith Hart ( Weltbühne ), Dr. Alexander Kissler ( Salon ),<br />
Til Knipper ( Kapital ), Constantin Magnis<br />
( Reportagen ), Dr. Frauke Meyer-Gosau ( Literaturen )<br />
CICERO ONLINE Christoph Seils ( Leitung ),<br />
Petra Sorge, Timo Stein<br />
POLITISCHER CHEFKORRESPONDENT<br />
Hartmut Palmer<br />
ASSISTENTIN DES CHEFREDAKTEURS<br />
Monika de Roche<br />
REDAKTIONSASSISTENTIN Sonja Vinco<br />
ART-DIREKTORIN Viola Schmieskors<br />
BILDREDAKTION Antje Berghäuser, Tanja Raeck<br />
PRODUKTION Utz Zimmermann<br />
VERLAG<br />
GESCHÄFTSFÜHRUNG<br />
Michael Voss<br />
VERTRIEB UND UNTERNEHMENSENTWICKLUNG<br />
Thorsten Thierhoff<br />
REDAKTIONSMARKETING Janne Schumacher<br />
NATIONALVERTRIEB/LESERSERVICE<br />
DPV Deutscher Pressevertrieb GmbH<br />
Düsternstraße 1–3, 20355 Hamburg<br />
VERTRIEBSLOGISTIK Ingmar Sacher<br />
ANZEIGEN-DISPOSITION Erwin Böck<br />
HERSTELLUNG Roland Winkler<br />
DRUCK/LITHO Neef+Stumme,<br />
premium printing GmbH & Co.KG,<br />
Schillerstraße 2, 29378 Wittingen<br />
Holger Mahnke, Tel.: +49 (0)5831 23-161<br />
cicero@neef-stumme.de<br />
SERVICE<br />
LIEBE LESERIN, LIEBER LESER,<br />
haben Sie Fragen zum Abo oder Anregungen und Kritik zu<br />
einer <strong>Cicero</strong>-Ausgabe? Ihr <strong>Cicero</strong>-Leserservice hilft Ihnen<br />
gerne weiter. Sie erreichen uns werktags von 7:30 Uhr bis<br />
20:00 Uhr und samstags von 9:00 Uhr bis 14:00 Uhr.<br />
ABONNEMENT UND NACHBESTELLUNGEN<br />
<strong>Cicero</strong>-Leserservice<br />
20080 Hamburg<br />
TELEFON 030 3 46 46 56 56<br />
TELEFAX 030 3 46 46 56 65<br />
E-MAIL abo@cicero.de<br />
ONLINE www.cicero.de/abo<br />
ANREGUNGEN UND LESERBRIEFE<br />
<strong>Cicero</strong>-Leserbriefe<br />
Friedrichstraße 140<br />
10117 Berlin<br />
E-MAIL info@cicero.de<br />
Einsender von Manuskripten, Briefen o. Ä. erklären sich mit der redaktionellen<br />
Bearbeitung einverstanden. Abopreise inkl. gesetzlicher MwSt.<br />
und Versand im Inland, Auslandspreise auf Anfrage. <strong>Der</strong> Export und Vertrieb<br />
von <strong>Cicero</strong> im Ausland sowie das Führen von <strong>Cicero</strong> in Lesezirkeln<br />
ist nur mit Genehmigung <strong>des</strong> Verlags statthaft.<br />
ANZEIGENLEITUNG<br />
( verantw. für den Inhalt der Anzeigen )<br />
Anne Sasse, Sven Bär<br />
ANZEIGENVERKAUF<br />
Svenja Zölch, Jacqueline Ziob, Stefan Seliger ( online )<br />
ANZEIGENMARKETING Inga Müller<br />
ANZEIGENVERKAUF BUCHMARKT<br />
Thomas Laschinski (PremiumContentMedia)<br />
VERKAUFTE AUFLAGE 83 395 ( IVW Q1/2014 )<br />
LAE 2013 122 000 Entscheider<br />
REICHWEITE 380 000 Leser ( AWA 2013 )<br />
CICERO ERSCHEINT IN DER<br />
RINGIER PUBLISHING GMBH<br />
Friedrichstraße 140, 10117 Berlin<br />
info@cicero.de, www.cicero.de<br />
REDAKTION Tel.: + 49 (0)30 981 941-200, Fax: -299<br />
VERLAG Tel.: + 49 (0)30 981 941-100, Fax: -199<br />
ANZEIGEN Tel.: + 49 (0)30 981 941-121, Fax: -199<br />
GRÜNDUNGSHERAUSGEBER<br />
Dr. Wolfram Weimer<br />
Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, Aufnahme in<br />
Onlinedienste und Internet und die Vervielfältigung<br />
auf Datenträgern wie CD-ROM, DVD-ROM etc. nur<br />
nach vorheriger schriftlicher Zustimmung <strong>des</strong> Verlags.<br />
Für unverlangt eingesandte Manuskripte und Bilder<br />
übernimmt der Verlag keine Haftung.<br />
Copyright © 2014, Ringier Publishing GmbH<br />
V.i.S.d.P.: Christoph Schwennicke<br />
Printed in Germany<br />
EINE PUBLIKATION DER RINGIER GRUPPE<br />
EINZELPREIS<br />
D: 8,50 €, CH: 13,– CHF, A: 8,50 €<br />
JAHRESABONNEMENT ( ZWÖLF AUSGABEN )<br />
D: 93,– €, CH: 144,– CHF, A: 96,– €<br />
Schüler, Studierende, Wehr- und Zivildienstleistende<br />
gegen Vorlage einer entsprechenden<br />
Bescheinigung in D: 60,– €, CH: 108,– CHF, A: 72,– €<br />
KOMBIABONNEMENT MIT MONOPOL<br />
D: 138,– €, CH: 198,– CHF, A: 147,– €<br />
<strong>Cicero</strong> erhalten Sie im gut sortierten<br />
Presseeinzelhandel sowie in Pressegeschäften<br />
an Bahnhöfen und Flughäfen. Falls<br />
Sie <strong>Cicero</strong> bei Ihrem Pressehändler nicht<br />
erhalten sollten, bitten Sie ihn, <strong>Cicero</strong> bei seinem<br />
Großhändler nachzubestellen. <strong>Cicero</strong> ist dann in der<br />
Regel am Folgetag erhältlich.<br />
Zum Beitrag „Die dunkle Seite <strong>des</strong><br />
Reformators“ von Christian Pfeiffer,<br />
April 2014<br />
Botschaft missachtet<br />
Christian Pfeiffer stellt am Ende<br />
seines Artikels eine sehr berechtigte<br />
Frage: „Woran liegt es, dass sowohl<br />
die große Mehrheit der Pfarrer<br />
als auch der von ihnen betreuten<br />
Christen nicht die Kraft hatte, die<br />
zentrale Botschaft ihres Glaubens<br />
umzusetzen und gegenüber den bedrohten<br />
Juden Nächstenliebe zu<br />
praktizieren?“<br />
Ralf Böhm, Berlin<br />
Luther-Bild ergänzt<br />
Wir sollten Luther nicht an seinem<br />
späten Antisemitismus … werten.<br />
Seine Schrift von 1543 muss man jedoch<br />
in die Diskussion mit einbeziehen.<br />
Deshalb vielen Dank an <strong>Cicero</strong>,<br />
durch das Gespräch mit drei Kapazitäten<br />
zur Ergänzung <strong>des</strong> Luther-<br />
Bil<strong>des</strong> beigetragen zu haben.<br />
Dr. Regina Neumann, Putzbrunn<br />
Später Sieg<br />
Da hat der <strong>Cicero</strong> nun die ganz<br />
große Enthüllungsstory geliefert:<br />
„Judenfeind Luther … der Kriminologe<br />
Pfeiffer führt Beweis“. Welch<br />
schockierende Sensation! Schade<br />
nur, dass da gar nichts zu enthüllen<br />
ist. Von Luthers unsäglichen antijüdischen<br />
Schriften ist seit Jahr und<br />
Tag in der Presse und in Büchern<br />
zu lesen. Und auch Pfeiffers Unternehmen<br />
ist nicht neu: zu beweisen,<br />
dass seit der Reformation die evangelische<br />
Kirche durch jene Schriften<br />
Luthers geprägt und so mitschuldig<br />
an den Verbrechen der Nationalsozialisten<br />
geworden sei … Pfeiffer<br />
verhilft mit seiner in einem Zitat Julius<br />
Streichers gipfelnden „Beweisführung“<br />
dem gedächtnispolitischen<br />
Programm der Nationalsozialisten<br />
zu einem späten Sieg.<br />
Prof. Dr. Johannes Wallmann, Berlin<br />
(Den vollständigen Text <strong>des</strong> umfangreichen<br />
Leserbriefs von Prof. Dr. Johannes<br />
Wallmann finden Sie im Internet unter:<br />
http://www.cicero.de/salon/wallmann)<br />
14<br />
<strong>Cicero</strong> – 6. 2014
CICERO<br />
Leserbriefe<br />
Zum Beitrag „Zehn Gründe, warum<br />
Europa eine goldene Zukunft hat“, von<br />
verschiedenen Autoren, Mai 2014<br />
Eliten müssen umdenken<br />
Die zehn aufgeführten Gründe für<br />
ein „goldenes Europa“ können nicht<br />
überzeugen. Denn letztlich hängt<br />
das Schicksal <strong>des</strong> Kontinents vor allem<br />
von einem Umdenken der Eliten<br />
ab, das sich aber kaum erkennen<br />
lässt. Da kein europäischer Spitzenpolitiker<br />
bislang den Mut gefunden<br />
hat, zum Beispiel den Kontakt<br />
mit leider zu Recht um ihre Zukunft<br />
fürchtenden jungen Demonstranten<br />
in Südeuropa zu suchen.<br />
Oder selbst Parteien, wie etwa<br />
die CDU in Schleswig-Holstein, seit<br />
jeher ein schlechtes Verhältnis zur<br />
dort ansässigen dänischen Minderheit<br />
sowie deren Vertretung SSW<br />
pflegen und damit alles andere als<br />
den europäischen Integrationsgedanken<br />
vorbildlich leben. Weswegen<br />
Zweckoptimismus nicht weiterhilft,<br />
sondern sich vielmehr etwas<br />
Grundlegen<strong>des</strong> im konkreten Handeln<br />
der Politik – und dies möglichst<br />
schnell – ändern muss!<br />
Rasmus Ph. Helt, Hamburg<br />
Zum Beitrag „Kann denn Sprudel Sünde<br />
sein“ über Scarlett Johansson, von Sylke<br />
Tempel, März 2014<br />
Zum Beitrag „Man hört mein Schwäbisch.<br />
Und?“ Interview mit Günther<br />
Oettinger, April 2014<br />
Karikatur: Hauck & Bauer<br />
Zum Leserbrief „Latent fremdenfeindlich“<br />
von Stefan Leicht, März 2014<br />
Populismus pur<br />
Herr Leicht drückt aus, alle Deutschen<br />
seien fremdenfeindlich. Das<br />
Adjektiv „latent“ als Abschwächung<br />
zu „fremdenfeindlich“ ändert nichts<br />
an der Verallgemeinerung. Eine völlig<br />
undifferenzierte/unqualifizierte<br />
Pauschalisierung. Das ist Populismus<br />
allererster Güte.<br />
Diese Formulierungen werden<br />
gezielt aus anderen politischen Motiven<br />
und Interessen als „totschlagende“<br />
Argumente eingesetzt. Klar,<br />
wenn man argumentativ nicht mehr<br />
weiterweiß, dann werden Fremdenfeindlichkeit<br />
und die Nazikeule<br />
geschwungen. Man kann die<br />
Formulierung von Herrn Seehofer<br />
„Wer bescheißt, fliegt“ sicherlich<br />
kritisieren. Ich finde dies auch<br />
populistisch. Diese Äußerung war<br />
der Beginn der Debatte.<br />
Oliver Roth, Trautskirchen<br />
Oxfam: Kein Boykott Israels<br />
In Ihrer März-Ausgabe berichten<br />
Sie über die ehemalige Oxfam-<br />
Botschafterin Scarlett Johansson.<br />
Und Sie behaupten dort, Oxfam<br />
gehöre zu den „vehementesten Unterstützern“<br />
von Boykottaufrufen<br />
gegen Israel.<br />
Das ist nicht richtig. Wir sind<br />
gegen Wirtschaftsbeziehungen mit<br />
den völkerrechtswidrigen israelischen<br />
Siedlungen im Westjordanland,<br />
u. a. weil die Siedlungspolitik<br />
zu Menschenrechtsverletzungen<br />
führt, die Armut unter Palästinensern<br />
vergrößert und eine Zweistaatenlösung<br />
behindert.<br />
Oxfam finanziert vor Ort konkrete<br />
Menschenrechtsprojekte, jedoch<br />
keine, die im Zusammenhang<br />
mit Boykottaufrufen gegen Israel<br />
stehen. Denn einen Boykott Israels<br />
lehnen wir ab. Es wäre schön, wenn<br />
solche Differenzierungen künftig<br />
nicht unter den Tisch fielen.<br />
Steffen Küßner, Leiter Pressestelle und<br />
Webteam von Oxfam Deutschland, Berlin<br />
Dreimal Oettinger im Wald<br />
Das Interview mit Oettinger war<br />
wirklich interessant zu lesen. Ein<br />
schöner Abriss seiner politischen<br />
Agenda, mit kritischen Fragen,<br />
denen er sich nicht so leicht entziehen<br />
konnte.<br />
Aber ein Wermutstropfen bleibt:<br />
Die Fotos gehen gar nicht!<br />
<strong>Der</strong> Reihe nach: Oettinger<br />
scheißt in den Wald, Oettinger<br />
verloren im Wald, Oettinger intim<br />
im Wald.<br />
Und alles mit Hochwasser in der<br />
Hose in dieser sterilen Behörden-Innenhof-Kunstfarn-Atmosphäre.<br />
Ich hoffe, der Mann hat keinen<br />
Sinn für Ästhetik, sonst war dies Ihr<br />
<strong>letzte</strong>s Interview mit ihm. Ein paar<br />
Bildchen fürs Auge sollten schon<br />
sein, aber beim nächsten Mal bitte<br />
nicht den Praktikanten bemühen.<br />
Schönen Gruß aus Hamburg.<br />
Martin Mense, Hamburg<br />
Die Redaktion behält sich vor, Leserbriefe zu kürzen.<br />
Wünsche, Anregungen und Meinungsäußerungen<br />
senden Sie bitte an redaktion@cicero.de<br />
15<br />
<strong>Cicero</strong> – 6. 2014
TITEL<br />
<strong>Der</strong> <strong>letzte</strong> <strong>Sommer</strong> <strong>des</strong> Rock ’n’ Roll<br />
SPIELT ES<br />
NOCH<br />
EINMAL!<br />
Uhuuhuuu. Noch eine Zugabe.<br />
Und noch eine. Aber irgendwann geht<br />
das Licht aus. Was passiert, wenn<br />
die Väter und Mütter <strong>des</strong> Rock ’n’ Roll<br />
weg sind? Eine Reise zu den<br />
großen Alten einer Musikgeneration<br />
Von THOMAS WINKLER<br />
16<br />
<strong>Cicero</strong> – 6. 2014
„Do it‚ til<br />
LEMMY KILMISTER<br />
Titel: „Rock ’n’ Roll Music“, 2010<br />
Album: „The Wörld is Yours“<br />
the day I die“
TITEL<br />
<strong>Der</strong> <strong>letzte</strong> <strong>Sommer</strong> <strong>des</strong> Rock ’n’ Roll<br />
Fotos: Alimdi.net (Seiten 16 bis 17), Pep Bonet/Noor/Laif<br />
Deep Purple in Rock, noch einmal Deep<br />
Purple in Rock. Die erhabenen Felsformationen<br />
der Alpen sind verhüllt, Wolken<br />
verdecken Eiger, Jungfrau und<br />
Mönch. 9000 Menschen haben sich am<br />
Fuße <strong>des</strong> Massivs versammelt, sind aus dem Tal mit<br />
der Zahnradbahn hinaufgefahren auf das Hochplateau,<br />
über ihnen die Wolken und die Berge, in ihnen<br />
die Vorfreude.<br />
Open-Air-Konzert auf der Kleinen Scheidegg<br />
im Berner Oberland. Saisonabschluss im Skigebiet.<br />
Die Passhöhe zwischen Eiger und Lauberhorn liegt<br />
2061 Meter über dem Meeresspiegel. In einer Senke<br />
<strong>des</strong> Hochtals ist eine Bühne aufgebaut, nicht weit davon<br />
steht in einem Lockschuppen ein historischer<br />
Waggon der Zahnradbahn. Rot gepolsterte Stühle,<br />
vergoldete Leuchten, dunkle Holzverkleidung. Das<br />
Museumsstück dient als Garderobe für die Musiker.<br />
Eine Pistenraupe wird sie gleich zur Bühne bringen.<br />
Ian Gillan hat noch etwas Zeit, bis es losgeht. Er<br />
sieht mit seinem bulligen Kopf und den kurzen grauen<br />
Haaren heute aus wie ein englischer Pub-Besitzer. Dieser<br />
Ian Gillan war der Mann mit dem Schrei, der Mann,<br />
der seine langen Haare in den Nacken warf und bei<br />
„Child in Time“ ein melodisches Uhuuhuuu in einen<br />
gellenden Laut umkippen ließ, die Augen zusammengekniffen,<br />
das Mikro mit dem langen Kabel dran dicht<br />
an seinen Mund gepresst. In den Partykellern hat eine<br />
ganze Generation dieser Stelle entgegengefiebert, diesem<br />
Moment nach dem filigran-feinen Vorspiel von Jon<br />
Lord an der Orgel und Ian Paice an den Drums. Langsam<br />
schwillt dieser Song an, bis sich Gillans großer<br />
Schrei entlädt. „Child in Time“, das ist der zentrale<br />
Song eines Schlüsselalbums der Band, ihr viertes von<br />
1970: „Deep Purple in Rock“. Auf dem Cover: Ian Gillan,<br />
Ritchie Blackmore, Jon Lord, Roger Glover, Ian<br />
Paice, hineingeschlagen in den Granit <strong>des</strong> Mount Rushmore,<br />
in der Pose der vier US-Präsidenten, die dort in<br />
Wahrheit zu sehen sind.<br />
Rock ’n’ Roll rules, das sagt dieses Cover,<br />
Rock ’n’ Roll regiert wie ein Präsident der Vereinigten<br />
Staaten. Und im Unterschied zu George Washington,<br />
Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt und Abraham<br />
Lincoln sind drei der fünf Ur-Purples immer noch da.<br />
„Wir wurden schon Altrocker, Rockrentner und Dinosaurier<br />
genannt“, grummelt Gillan, „aber das kümmert<br />
mich nicht mehr, das halte ich aus, ich habe ein dickes<br />
Fell. Ich fühle mich nicht wie ein Dinosaurier.“ Er ist<br />
jetzt 68 Jahre alt. „Ich verstehe das natürlich, wenn<br />
Jüngere sagen: Geh zur Seite, Opa! Stirb endlich! Ich<br />
denk mir dann halt: Fuck you.“<br />
Solche Sätze helfen für den Moment. Aber sie<br />
halten nichts auf. Jetzt kommen die lebenden Legenden<br />
alle noch einmal auf deutsche Bühnen, für einen<br />
großen <strong>Sommer</strong> <strong>des</strong> Rock. Black Sabbath, die Rolling<br />
Stones, Patti Smith, Bob Dylan. Doch die Sache<br />
dünnt aus. AC/DC wollten im Herbst auf Tournee<br />
gehen, doch jetzt ist Malcolm Young, das Riff-Metronom,<br />
der Schöpfer <strong>des</strong> in jeder Sekunde wiedererkennbaren<br />
Sounds der Band, so krank, dass er nicht mehr<br />
Gitarre spielen kann. Lemmy Kilmister, das Urviech<br />
von Motörhead, kämpft mit Diabetes und Herzproblemen.<br />
Jon Lord, der Mann, der den Sound von Deep<br />
Purple mit seiner schweren Hammond-Orgel unterlegt<br />
hat, ist schon zwei Jahre tot. Ronnie James Dio,<br />
der zeitweise bei Black Sabbath anstelle von Ozzy Osbourne<br />
zu Tony Iommis düsterer Gitarre und Geezer<br />
Butlers wummerndem Bass gesungen hatte, lebt nicht<br />
mehr. Er fehlt wie Lou Reed und J. J. Cale.<br />
Die großen Alten <strong>des</strong> Rock sterben, wenn auch<br />
später, als man es bei ihrem Lebenswandel gedacht<br />
hätte. „Rock ’n’ Roll is here to stay“, näselt Neil Young<br />
weiter. Aber je<strong>des</strong> Mal könnte das <strong>letzte</strong> Mal sein, seit<br />
einem Jahrzehnt geht das schon so. 70 Euro die Karte,<br />
80 Euro, 100 Euro. Die Best-Ager im Publikum zahlen<br />
jeden Preis für die womöglich <strong>letzte</strong> Chance.<br />
Einmal noch, und dann noch einmal und noch einmal.<br />
Aber es wird der Tag kommen, da ist es vorbei.<br />
Und dann? Was passiert mit dem Rock ’n’ Roll, wenn<br />
seine Gründerväter und -mütter weg sind?<br />
Auf der Kleinen Scheidegg trägt das Publikum<br />
atmungsaktive Anoraks statt nietenbesetzter<br />
Lederjacke, Moonboots<br />
statt Cowboystiefeln und Strickmützen<br />
statt langer Matte. Die Leute stehen seit<br />
Stunden im Schnee, aber sie haben sich mit Bier und<br />
Schnaps in Stimmung gebracht. Deep Purple ist die<br />
<strong>letzte</strong> Band dieses Nachmittags, ein Höhepunkt.<br />
Doch Deep Purple bringen die Hits nicht, sondern<br />
alte Songs, die nur echte Fans kennen, und Songs vom<br />
vergangenes Jahr erschienenen Album „Now What?!“.<br />
Das hat in der Schweiz zwar Platz zwei der Charts und<br />
in Deutschland sogar den ersten Platz erreicht, aber<br />
<strong>des</strong>sen Stücke sind hier oben trotzdem kaum jemandem<br />
geläufig. Vor allem spielen Deep Purple, so wie<br />
sie es auch schon in ihrer großen Zeit in den siebziger<br />
Jahren getan haben, ausufernde Versionen ihrer Songs.<br />
Immer wieder verschwindet Gillan hinter einem Vorhang<br />
und gibt die Bühne frei für seine Kollegen. Dann<br />
spielen die anderen ihre Soli: Gitarrist Steve Morse, 59,<br />
Keyboarder Don Airey, 65, Bassist Roger Glover, 68 –<br />
und Schlagzeuger Ian Paice, 66, der Einzige, der in allen<br />
Inkarnationen der Band seit ihrer Gründung im Jahr<br />
1968 dabei war, spielt ein Schlagzeug-Solo. Alles ein<br />
bisschen gemächlicher als früher, mit Pausen für den<br />
Sänger. Und doch: „Das ist immer noch Rock ’n’ Roll“,<br />
hat Ian Gillan im Museumswaggon gesagt.<br />
Alles im Prinzip wie vor einem halben Jahrhundert.<br />
<strong>Der</strong> Rock ’n’ Roll als Illusion der Unsterblichkeit.<br />
Nach einer langen Stunde ist das Publikum unruhig<br />
geworden. „Child in time“? Fuck you! Endlich spielen<br />
sie immerhin noch „Smoke On The Water“. Eine<br />
Mittdreißigerin in himmelblauer Allwetterjacke quiekt<br />
19<br />
<strong>Cicero</strong> – 6. 2014
TITEL<br />
<strong>Der</strong> <strong>letzte</strong> <strong>Sommer</strong> <strong>des</strong> Rock ’n’ Roll<br />
vor Freude. „Etz kummt’s!“ Sie haut ihrem Begleiter<br />
auf die daunengepolsterte Schulter.<br />
„Wir waren jung, wir waren unsterblich, wir haben<br />
uns nicht um die Zukunft gekümmert“, sagt Gillan<br />
über die Zeit, als dieses Gitarrenriff noch keine Legende<br />
war, sondern noch sehr lebendig nach Revolte<br />
und Rebellion klang. „Damals gab es eine Revolution<br />
im Denken, in der Mode, in der Kunst, in der Politik –<br />
und die Musik war die Stimme dieser Revolution. <strong>Der</strong><br />
Rock ’n’ Roll ist immer noch lebendig, aber ansonsten<br />
hat sich alles verändert.“<br />
Das kann man wohl sagen. In Woodstock<br />
schlidderten Blumenkinder durch den<br />
Matsch, auf der Kleinen Scheidegg rutschen<br />
blondierte Skihaserln auf dem Hosenboden<br />
den Hang hinunter. Früher hat<br />
Rockmusik wenn schon nicht Revolutionen ausgelöst,<br />
dann zumin<strong>des</strong>t jungen Menschen als unverzichtbares<br />
Mittel zur Identitätsfindung und Distanzierung gedient.<br />
Heute spielen junge Menschen interaktive Rollenspiele,<br />
sammeln Freunde in sozialen Netzwerken<br />
und hantieren mit verschiedenen, selbst konstruierten<br />
viralen Egos. Früher war Rock die Musik der Gegenkultur,<br />
heute hängt Barack Obama Bob Dylan einen<br />
Orden um. Vor 45 Jahren wurde die Nationalhymne<br />
der Vereinigten Staaten noch mit der Gitarre zerlegt,<br />
aus Protest gegen den Vietnamkrieg.<br />
Jimi Hendrix hatte das damals übernommen. Er<br />
erstickte 1970 in einem Londoner Hotelzimmer an seinem<br />
Erbrochenen. Er wurde 27 Jahre alt und war eines<br />
der Opfer, die Sex & Drugs & Rock ’n’ Roll in ihrer<br />
Frühzeit forderten. Viele sind früh gegangen, aber<br />
mehr, als man gedacht hätte, sind in Ehren ergraut und<br />
immer noch charismatischer geworden.<br />
So wie Patti Smith. Sie nestelt gerade eine Lesebrille<br />
aus der Tasche und liest aus „The Western Lands“<br />
von William S. Burroughs. Die 67-Jährige mit dem<br />
langen, mittlerweile schlohweißen Haar macht einen<br />
überaus lebendigen Eindruck. Sie steht in der Apos tel-<br />
Paulus-Kirche, einem neogotischen, nüchternen Backsteinbau<br />
in Berlin-Schöneberg. Die Gesangbücher sind<br />
ordentlich aufgereiht, auf einer braungrauen Stellwand<br />
sind Fotos vom <strong>letzte</strong>n Treffen der „55 Plus Seniorengruppe“<br />
der Gemeinde zu sehen. Das Publikum hat,<br />
grob geschätzt, dasselbe Durchschnittsalter. Vor dem<br />
Altar, direkt unter Christus am Kreuz, beschwört Patti<br />
Smith die Geister der Verstorbenen.<br />
Im Laufe <strong>des</strong> Konzerts würdigt sie eine repräsentative<br />
Auswahl jener Weggefährten, die schon gegangen<br />
sind, sie singt Lou Reeds „How Do You Think She<br />
Feels“ und später, als Höhepunkt <strong>des</strong> Konzerts, natürlich<br />
„Gloria“. Sie spielt den ehrwürdigen Soul-Klassiker,<br />
den Van Morrison 1964 geschrieben hat, seit<br />
Mitte der siebziger Jahre. Im ekstatischen Refrain finden<br />
die Sängerin und Dichterin, ihre Band und das Publikum<br />
endgültig zusammen. Die kalten Wände der<br />
Apostel-Paulus-Kirche wirken ein wenig wärmer, sogar<br />
der Jesus am Kreuz scheint milde zu lächeln. Vielleicht<br />
kann er sie sehen, all die Toten, die das Lied für fünf,<br />
sechs glorreiche Minuten wieder zurück ins Leben holt:<br />
Jim Morrison, Joe Strummer, Bon Scott und all die<br />
anderen, die den alten Song einmal gesungen haben.<br />
Andere leben zwar noch, veröffentlichen aber<br />
schon seit Urzeiten kein neues Material mehr, wie die<br />
Rolling Stones, die seit 2005 kein Studioalbum mehr<br />
herausgebracht haben. Viele wie Joni Mitchell oder David<br />
Bowie gehen nicht mehr auf Tournee. Leonard Cohen<br />
wagt sich zwar noch auf Konzertreisen, aber nur,<br />
weil er Millionen an Schulden abzuzahlen hat. Und im<br />
vergangenen Jahr wurde ruchbar, dass sich Lemmy<br />
Kilmister von Motörhead einen Defibrillator hat implantieren<br />
lassen, eines jener Geräte, die mit gezielten<br />
Stromstößen Herzrhythmusstörungen entgegenwirken.<br />
Die Musikergeneration, die das goldene Zeitalter<br />
der Rockmusik in den späten Sechzigern und frühen<br />
Siebzigern prägte, wird bald verstummen. Folgerichtig<br />
fragte sich Anfang <strong>des</strong> Jahres das amerikanische<br />
Magazin Classic Rock: „Is Rock Dying?“<br />
Falsche Frage, findet Lemmy Kilmister. Wer so<br />
fragt, hat nichts verstanden. „Die Gründerväter mögen<br />
eines Tages alle weg sein“, antwortet er in einer<br />
Mail. Aber deren Musik lebe fort. Überhaupt sei es immer<br />
die Sache <strong>des</strong> Einzelnen gewesen, die Botschaften<br />
<strong>des</strong> Rock ’n’ Roll zu verstehen.<br />
<strong>Der</strong> Rock ’n’ Roll lebt fort, eine fast religiöse Botschaft:<br />
Er ist in euch. Wir lösen ihn nur aus.<br />
Deshalb braucht es auch keine künstliche Wiederbelebung<br />
als Hologramm auf der Bühne, wie es<br />
nach dem Tod von Amy Winehouse ernsthaft erwogen<br />
wurde. „Ich will niemanden als Hologramm auf<br />
der Bühe sehen“, blafft Lemmy und setzt hinzu: „am<br />
wenigsten mich selbst.“<br />
Später schickt er noch eine Mail hinterher. Das mit<br />
dem Hologramm: „Nimm lieber eine Pappfigur, ist billiger.“<br />
Und ganz grundsätzlich: „Ich habe den besten<br />
Teil der Sache erlebt, nun seht ihr zu, wie ihr durch<br />
den miesen kommt.“<br />
Schaut man in die Charts, stellt man fest, dass<br />
dort kaum noch Rockmusik zu finden ist,<br />
es dominieren R&B, Hip-Hop und Elektropop.<br />
Andererseits sind Rock-Acts die Motoren<br />
<strong>des</strong> Livegeschäfts. 2013 machte mit Bon<br />
Jovi eine Rockband weltweit den größten Umsatz auf<br />
Konzertbühnen, auf Platz fünf stand der 64-jährige<br />
Bruce Springsteen. Unter den zehn umsatzstärksten<br />
Tourneen aller Zeiten sind – neben den beiden Popsirenen<br />
Madonna und Céline Dion – AC/DC, The Police,<br />
zwei Mal U2 und gleich vier Mal die Rolling Stones.<br />
„Ich bin froh, dass es Bob Dylan und Neil Young<br />
noch gibt, und die ihr Publikum auch weiterhin überraschen.<br />
Aber natürlich ist ein Ende abzusehen, die<br />
werden auch nicht jünger“, sagt Sebastian Zabel, selbst<br />
Foto: Timothy Greenfield-Sanders<br />
20<br />
<strong>Cicero</strong> – 6. 2014
„We shall<br />
PATTI SMITH<br />
Titel: Ghost Dance, 1978<br />
Album: Easter<br />
live again“
„ Dance to<br />
the beat of<br />
IGGY POP<br />
Titel: Raw Power<br />
Album: Raw Power, 1973<br />
livin´dead “
TITEL<br />
<strong>Der</strong> <strong>letzte</strong> <strong>Sommer</strong> <strong>des</strong> Rock ’n’ Roll<br />
Foto: Tibor Bozi/ Corbis<br />
49 Jahre alt. Aber, meint der Chefredakteur <strong>des</strong> deutschen<br />
Rolling Stone, „mit dem Verschwinden großer<br />
Namen verschwindet ja nicht die Rockmusik. Die Lücken<br />
auf den Bühnen und vor den Bühnen füllen die<br />
Kinder und Enkelkinder dieser Generation. Es ist vieles<br />
nachgewachsen.“<br />
<strong>Der</strong> Rolling Stone residiert in einem alten Fabrikgebäude<br />
in Berlin-Kreuzberg. Auf der gegenüberliegenden<br />
Straßenseite wird von neun Uhr morgens bis<br />
nachts um fünf Berlins berühmteste Currywurst verkauft.<br />
Ein großer Teil der frühmorgendlichen Kunden<br />
sind junge Menschen, die nächtelang in den Clubs einem<br />
Mythos nachjagen, den David Bowie, Lou Reed<br />
und Iggy Pop begründeten, Nick Cave und die Einstürzenden<br />
Neubauten weiterführten, der mit Techno<br />
wiederauflebte und seit einigen Jahren das Bild der<br />
deutschen Hauptstadt in der Welt bestimmt. Die Anziehungskraft<br />
der Partystadt Berlin ist ungebrochen,<br />
aber sie hat keinen bestimmten Rhythmus, kein festgelegtes<br />
Klangbild. Die Partypeople tanzen zu Minimal<br />
Techno und in Rockclubs. Junge Menschen hören so<br />
viel Musik wie nie zuvor, durchschnittlich bis zu zweieinhalb<br />
Stunden täglich, haben Studien ergeben, aber<br />
sie hören alles: Dance, R&B, Pop, Jazz, Electronica,<br />
Weltmusik, Metal, Blues und eben auch Rockmusik.<br />
Man darf das nicht so eng sehen, sagt Zabel: „<strong>Der</strong><br />
traditionelle Rock hat sich längst aufgefächert in viele<br />
Stile, wird transformiert und adaptiert. Das ist nun<br />
mal das Wesen der Popmusik.“ Andererseits aber erlebten<br />
wir gerade, wie die großen alten Namen „ihr<br />
eigenes Werk kanonisieren und nachstellen“. Immer<br />
mehr Rockbands gehen auf die Bühne, um dort – wie<br />
ein Symphonieorchester die Fünfte von Beethoven – eines<br />
ihrer klassischen Alben Ton für Ton nachzuspielen.<br />
„<strong>Der</strong> Sound lebt fort“, sagt Zabel, „nur das Modell<br />
Rockband mit eingeschworener Anhängerschaft,<br />
das ist ein Auslaufmodell. Aber die Rockmusik stirbt<br />
nicht, das ist Quatsch.“<br />
Selbst wenn die Protagonisten sterben: Ihre Nachfolger<br />
bewahren, interpretieren, variieren, ergänzen<br />
das Erbe. Die Rockmusik ist in ihre klassische Periode<br />
eingetreten.<br />
Beobachten lässt sich das an einem Dienstagabend<br />
in Berlin. Eine Karaoke-Bar an<br />
der Warschauer Brücke. Draußen findet<br />
das allabendliche Schaulaufen <strong>des</strong> internationalen<br />
Easyjetsets statt, drinnen haben<br />
sich vielleicht einhundert Menschen versammelt, um<br />
zu singen. Jede und jeder ist willkommen, die Bühne<br />
reicht kaum, um alle Sänger zu fassen, die Stimmung<br />
ist eher geselliges Beisammensein als konzentriertes<br />
Konzert. <strong>Der</strong> Berlin Pop Choir interpretiert keine klassischen<br />
Chorwerke, sondern Songs aus allen Phasen<br />
der Popgeschichte. Wenn sich die ungezählten, anonymen,<br />
untrainierten Stimmen vereinen, ersteht die unwiderstehliche<br />
Kraft der Popmusik aufs Neue. Dann<br />
klingt „Hold Tight“, das von Dave Dee, Dozy, Beaky,<br />
Mick & Tich im Jahr 1966 ein Top-Ten-Hit war, ebenso<br />
modern und zeitgemäß und lebendig wie „Wrecking<br />
Ball“. <strong>Der</strong> Song, mit dem Miley Cyrus im vergangenen<br />
<strong>Sommer</strong> die Charts stürmte, ist für Chorleiterin<br />
Lyndsey Cockwell „bereits ein moderner Klassiker“.<br />
<strong>Der</strong> Berlin Pop Choir ist kein Einzelfall.<br />
Überall sind Chöre und Vokal-Ensembles<br />
entstanden, die sich durch die Popund<br />
Rockgeschichte singen. Mal sind sie<br />
offen für jeden wie der Pop Choir, mal<br />
semiprofessionell wie der von der Elektronikmusikerin<br />
Barbara Morgenstern geleitete Chor der Kulturen<br />
der Welt. Mal sind es kleine, hoch motivierte Gruppen,<br />
die vor eingeschworener Fanschar auftreten, mal unüberschaubare<br />
Netzwerke, die für Freunde und Verwandte<br />
singen – und vor allem für sich selbst. „Jeder<br />
möchte ein Star sein, jeder möchte einmal auf der<br />
Bühne stehen“, beschreibt Chorleiterin Cockwell eine<br />
Motivation ihrer Sänger und Sängerinnen – und zugleich<br />
das ewige Versprechen der populären Musik,<br />
die ihren Siegeszug auch auf die Ablehnung <strong>des</strong> Elitegedankens<br />
stützte.<br />
Die Metamorphose zur klassischen Kunstform, in<br />
der die Rockmusik gerade steckt, wird bisweilen von<br />
bizarren Resonanzeffekten begleitet. Einer nennt sich<br />
„Rock meets Classic“ und ist eine Fusion aus Butterfahrt<br />
und Oldie-Show. Um 20 Uhr geht im Berliner<br />
Tempodrom das Licht aus, und über einen donnernden<br />
Brei aus E-Gitarren und Streichern schmettern vier<br />
Sänger ein herzhaftes „The show must go on“.<br />
In den folgenden zwei Stunden werden dem Publikum<br />
die größten Hits der eigenen Jugend vorgeführt<br />
wie gefährliche Tiger in einer Dressurnummer.<br />
Als Gitterkäfig fungiert das Bohemian Symphony Orchestra,<br />
das jeden Hit konsequent in Streichersauce<br />
ertränkt. Midge Ure, der Sänger von Ultravox, Kim<br />
Wilde, ein ehemaliger Sänger von Rainbow und die<br />
Reste von Uriah Heep dürfen jeweils ihre vier größten<br />
Schlager vorführen. Nur Alice Cooper, der stark<br />
geschminkte Star <strong>des</strong> Wanderzirkus, ist mit fünf Stücken<br />
dabei. Wenn die älteren Herrschaften Luft holen<br />
müssen, fiedeln sich die Böhmen durch ein paar Gassenhauer<br />
aus dem symphonischen Repertoire.<br />
„Veredelungsstrategie“ nennt es Jens Papenburg,<br />
wenn die Rockmusik die Nähe zur Klassik sucht. <strong>Der</strong><br />
Musikwissenschaftler von der Berliner Humboldt-Universität<br />
arbeitet in einem großbürgerlichen Prachtbau<br />
aus dem mittleren 19. Jahrhundert, dort hat der Lehrstuhl<br />
für Theorie und Geschichte der populären Musik<br />
seinen Sitz. Papenburg findet, dass „die Rockmusik<br />
nicht <strong>des</strong>halb ein Problem hat, weil ein paar ältere<br />
Herren das Zeitliche segnen oder andere sich nur noch<br />
selbst reproduzieren“.<br />
Papenburg ist seit 2006 Mitarbeiter am Institut, das<br />
in seiner kulturwissenschaftlichen Herangehensweise<br />
23<br />
<strong>Cicero</strong> – 6. 2014
TITEL<br />
<strong>Der</strong> <strong>letzte</strong> <strong>Sommer</strong> <strong>des</strong> Rock ’n’ Roll<br />
„ You‘re today‘s<br />
sensation,<br />
but tomorrow‘s<br />
looking bleak “<br />
THE STRYPES<br />
Titel: What The People Don‘t See<br />
Album: Snapshot, 2013<br />
an die Popmusik in Deutschland einzigartig ist. Den<br />
Abgang einer prägenden Generation von Musikern,<br />
schätzt der Wissenschaftler, kann die Rockmusik verkraften,<br />
weil „ihre Geschichte viel stärker an den Tonträger<br />
gebunden ist als die klassische Musik“. Klassik<br />
wird in Partituren festgehalten und überliefert, Rockmusik<br />
auf Tonträgern.<br />
Spätestens mit „Sgt. Peppers“, dem ersten Konzeptalbum,<br />
ist der Rock ’n’ Roll in den Rang einer Kunst<br />
aufgestiegen. Das Album wurde zur gültigen Form, in<br />
der die Musik zum Werk gerinnt. Doch diese Ära findet<br />
nun ein Ende. Soziale Netzwerke, YouTube und Streamingdienste<br />
machen das Album als prägen<strong>des</strong> Format<br />
der Rockmusik überflüssig. Die Marginalisierung<br />
<strong>des</strong> Albums ist in der Dancemusik bereits eine Tatsache<br />
und in der Popmusik weit vorangeschritten. <strong>Der</strong><br />
Rock hängt zwar noch am Album, der Fan aber hört oft<br />
einzelne Songs übers Netz. Wenn sie diesen Umbruch<br />
überleben will, wird sich die Rockmusik neu erfinden<br />
müssen – nicht nur kommerziell, auch künstlerisch.<br />
Noch läuft das Geschäft mit dem Alten. An einem<br />
sonnigen Tag hat die Warner Music Group Journalisten<br />
in den denkmalgeschützten Meistersaal in Berlin geladen.<br />
Warner stellt die Wiederveröffentlichung der drei<br />
ersten Alben von Led Zeppelin vor. Gitarrist Jimmy<br />
Page ist angekündigt, gereicht wird Finger Food von<br />
Sarah Wiener: Caipirinhalachs auf Limettenknäcker<br />
oder Hähnchenlolly mit Erdnuss-Bananen-Dip.<br />
Durchs Fenster sind das Glas und der rote Backstein<br />
<strong>des</strong> neuen Potsdamer Platzes zu sehen. Früher, als<br />
dort noch die Berliner Mauer stand, als das Gebäude<br />
am Rande <strong>des</strong> Brachlands zwischen Ost und West lag,<br />
wurde unter der Holzkassettendecke <strong>des</strong> Meistersaals<br />
Rockgeschichte geschrieben. David Bowie hat in den<br />
Hansa-Studios seine legendäre Berlin-Trilogie aufgenommen,<br />
„Heroes“ wurde mit Blick auf die Mauer<br />
geschrieben und im Meistersaal eingesungen. Auch<br />
Lou Reed, Iggy Pop, Depeche Mode, U2, R.E.M. oder<br />
Nick Cave haben hier wegweisende Alben eingespielt.<br />
Led Zeppelin waren nie in den Hansa-Studios,<br />
aber ihre ersten drei Alben, die ursprünglich in den<br />
Jahren 1969 und 1970 erschienen und nun in aufwendigen,<br />
neu abgemischten und mit reichlich Bonusmaterial<br />
ausgestatteten Werkschau-Editionen neu herausgebracht<br />
werden, kann man getrost als Meilensteine in<br />
der goldenen Ära der Rockmusik bezeichnen.<br />
Die Plattenfirmen schlachten alte Kataloge aus,<br />
das ist billiger und einfacher, als neue Attraktionen<br />
aufzubauen. Und die geburtenstarken Jahrgänge aus<br />
den fünfziger und sechziger Jahren sind mittlerweile<br />
ausreichend gut situiert, um sich Anthologien und<br />
Werkschauen leisten zu können. Die „Super Deluxe<br />
Edition Box“ von Led Zeppelin mit CDs, Vinyl-Platten<br />
und Buch kostet 118,99 Euro. Was ist das schon,<br />
wenn man sich die eigene Jugend ins Regal stellen will?<br />
<strong>Der</strong> Star im Berliner Meistersaal ist Jimmy Page.<br />
Er ist das, was man früher einen Gitarren-Gott nannte.<br />
Gott, 70, trägt heute einen eleganten schwarzen Dreiteiler,<br />
er hat die grauen Haare zum Zopf zurückgebunden<br />
und präsentiert einige der neuen Aufnahmen<br />
aus den Archiven seiner alten Band. Im launigen Gespräch<br />
mit dem ehemaligen „Rockpalast“-Moderator<br />
Alan Bangs gibt er zu, dass „momentan gerade jeder<br />
altes Material zu remastern scheint“.<br />
Ein Eindruck, der nicht trügt: Reissues und Deluxe-Box-Sets<br />
verzeichnen überdurchschnittliche Zuwachsraten<br />
in einem ansonsten bestenfalls stagnierenden<br />
Markt. Aber das Geld wird auf der Bühne verdient.<br />
Gerade mit den großen Namen <strong>des</strong> Rock ’n’ Roll.<br />
Die Alten faszinieren durch ihre rätselhafte<br />
Lebendigkeit: Wieso wiegt Jagger seine<br />
Hüften mit 70 noch so unverschämt sexy?<br />
Weshalb kann ein Whiskyfass wie Keith<br />
Richards bei seinen Gitarrenriffs noch so<br />
in die Knie gehen – und wieder hochkommen? Warum<br />
steht der sabbernde Greis Ozzy Osbourne plötzlich<br />
wieder am Mikro und trifft sogar den Ton? Diese Musik<br />
muss wie ein Elixier wirken, das ewig jung und fit<br />
hält, mehr als Aerobic und Pilates und Yoga und die<br />
anderen mühsamen Betätigungen. Burnout? „It’s better<br />
to burn out than to fade away“, singt Neil Young.<br />
Foto: Simon Sarin/Corbis<br />
24<br />
<strong>Cicero</strong> – 6. 2014
Foto: Privat (Autor)<br />
Die Faszination ergreift auch Junge. Berliner Postbahnhof,<br />
ein räudiger Club im Osten Berlins. <strong>Der</strong> Boden<br />
klebt vom Bier. Heute Abend werden The Strypes<br />
hier auftreten, die vier sind zwischen 16 und 18 Jahre<br />
alt. Vorher machen sie noch ein paar Fotos. Sie tragen<br />
enge, altmodische Anzüge, spitze Samtschuhe und Pickel<br />
im Gesicht. Wenn eine Kamera zu klicken droht,<br />
setzt Sänger Ross Farrelly seine Sonnenbrille auf.<br />
Das Quartett aus Irland spielt einen rotzigen<br />
Bluesrock. Er hat sich zu einer Sensation entwickelt.<br />
Warum spielen Minderjährige die Musik ihrer Eltern<br />
und Großeltern? Das ist die Frage, die sich alle stellen,<br />
die aber einfach zu beantworten ist: Weil The Strypes<br />
diese Musik in den Plattenschränken ihrer Eltern und<br />
Großeltern gefunden haben. Dann haben sie festgestellt,<br />
dass diese Musik irgendetwas hat, was sie vermissten<br />
an der Musik, die ihre Freunde auf Facebook<br />
teilten. „Die Songs in den Charts sind erbärmlich“, findet<br />
Josh McClorey, „Musik ist zum Produkt aus der<br />
Fabrik verkommen.“ <strong>Der</strong> Gitarrist ist das Sprachrohr<br />
der Band, Sänger Farrelly grunzt. Castingshows finden<br />
die beiden „banal“, die Pioniere wie Chuck Berry,<br />
Bo Diddley oder Dr. Feelgood aber sind ihnen heilig.<br />
Moderne Musik, sagt McClory, „hat keine Eier,<br />
keine Energie“. Die Begeisterung für ihre Band, die<br />
auch in Deutschland ankommt, erklärt er damit, „dass<br />
die Leute keinen Bock mehr haben auf den Müll, den<br />
man ihnen vorsetzt“. Klar, sagt der Gitarrist, die Ablenkungen<br />
sind heute größer als damals, natürlich<br />
spielt Rockmusik nicht mehr die frühere Rolle im Leben<br />
junger Menschen. Aber, auch das sagt McClorey:<br />
„Musik kann immer noch wichtig sein, Rock kann immer<br />
noch ein großes Fuck You! sein.“<br />
Da nimmt dann Farrelly doch noch die Sonnenbrille<br />
ab und sagt: „Eine gute Band kann immer noch<br />
dein Leben verändern. In den sechziger Jahren waren<br />
es vielleicht die Stones, heute …“ Er sinkt zurück in<br />
den Sessel, er muss ja angemessen cool wirken.<br />
Am Abend werden sie spielen, dass der Putz von<br />
der Wand bröckelt. Glatzköpfige Männer im Publikum,<br />
die min<strong>des</strong>tens doppelt so alt sind wie sie selbst,<br />
werden enthemmt tanzen, und im Raum wird sich die<br />
Kraft <strong>des</strong> Rock ’n’ Roll entfalten. „Ich weiß, es ist ein<br />
bisschen krank, das zu sagen“, raunt Josh McClorey,<br />
„aber jeder Tod bringt neues Leben hervor.“<br />
<strong>Der</strong> Rock ’n’ Roll ist tot. Es lebe der Rock ’n’ Roll.<br />
THOMAS WINKLER schreibt über Pop,<br />
Film und Sport. Sein erstes prägen<strong>des</strong><br />
Konzerterlebnis fand auf dem Nürnberger<br />
Zeppelinfeld statt. Neil Young rockte dort<br />
Anfang der achtziger Jahre<br />
Anzeige<br />
© Sebastian Gündel, Stiftung Bauhaus Dessau, 2014<br />
IKONEN<br />
DER MODERNE<br />
DAS BAUHAUS DESSAU FEIERT DIE WIEDERERÖFFNUNG DES<br />
GESAMTEN ENSEMBLES DER MEISTERHÄUSER<br />
UNESCO-<br />
WELTERBE IN<br />
DESSAU ERLEBEN:<br />
ALLE MEISTERHÄUSER<br />
SIND AB MAI 2014<br />
KOMPLETT ZU<br />
BESICHTIGEN.<br />
DIE MEISTERHAUSSIEDLUNG avancierte zum Inbegriff der Künstlerkolonie<br />
<strong>des</strong> 20. Jahrhunderts. Wegweisende künstlerische Arbeiten der<br />
Klassischen Moderne entstanden in den kubischen Wohn- und Atelierhäusern.<br />
Außerdem galt die Siedlung als eine Art Experimentallabor <strong>des</strong><br />
Bauhauses für das neue Wohnen. Mit Walter Gropius, Hannes Meyer und<br />
Ludwig Mies van der Rohe lebten hier alle drei Bauhausdirektoren Tür an<br />
Tür mit den Bauhauslehrern László Moholy-Nagy, Lyonel Feininger, Georg<br />
Muche, Oskar Schlemmer, Wassily Kandinsky sowie Paul Klee.<br />
NACH DER FEIERLICHEN WIEDERERÖFFNUNG der kriegszerstörten<br />
Meisterhäuser durch Bun<strong>des</strong>präsident Joachim Gauck, können<br />
Sie die Ikonen der Mo d erne, die UNESCO-Welterbestätten Bauhaus und<br />
Meisterhäuser sowie weitere Bauhaus-Bauten in Dessau entdecken.<br />
www.sachsen-anhalt-tourismus.de
TITEL<br />
<strong>Der</strong> <strong>letzte</strong> <strong>Sommer</strong> <strong>des</strong> Rock ’n’ Roll<br />
„BEI DEN STARS TICKT DIE UHR“<br />
<strong>Der</strong> Konzertagent Marek Lieberberg vermisst Schubkraft und<br />
Anarchie, traut der Rockmusik aber eine große Zukunft zu<br />
Mike Lee & The Echos oder The Rangers:<br />
Welche Band war besser, Herr<br />
Lieberberg?<br />
Marek Lieberberg: Die waren beide<br />
gleich schlecht, denn sie hatten denselben<br />
Leadsänger – einen gewissen Marek<br />
Lieberberg.<br />
Sie kokettieren. Im Rhein-Main-Gebiet<br />
waren Sie mal eine große Nummer.<br />
Wir verschafften uns sogar überregional<br />
Gehör. Wir sind im Star-Club in<br />
Hamburg aufgetreten zu einer Zeit, als<br />
Größen wie Fats Domino gespielt haben.<br />
Trotzdem sind Sie lieber Veranstalter<br />
geworden.<br />
Marek Lieberberg<br />
<strong>Der</strong> Konzertveranstalter aus<br />
Frankfurt/Main gründete<br />
bereits mit 24 Jahren seine<br />
erste Agentur. Er brachte unter<br />
anderem The Who, Bruce<br />
Springsteen, Bob Dylan und<br />
Madonna nach Deutschland<br />
und erfand die beiden größten<br />
Open-Air-Festivals „Rock am<br />
Ring“ und „Rock im Park“<br />
Ich wusste, dass ich Entertainer-<br />
Qualitäten hatte. Aber ich habe schnell<br />
gemerkt, dass meine stimmlichen Fähigkeiten<br />
limitiert waren. Bei den Konzerten<br />
meiner eigenen Bands konnte ich<br />
wichtige Erfahrungen sammeln. Wir füllten<br />
regelmäßig die einschlägigen Säle im<br />
Taunus. Dann habe ich für Fritz Rau als<br />
Promotion-Freelancer gearbeitet und<br />
gemeinsam mit anderen erste Konzerte<br />
organisiert.<br />
Legendär ist Ihr erstes großes selbst<br />
organisiertes Konzert: The Who am<br />
7. September 1970 in der Münsterlandhalle<br />
in Münster. Am Abend vorher<br />
mussten Sie Schlagzeuger Keith Moon<br />
Foto: POP-EYE/Nass<br />
26<br />
<strong>Cicero</strong> – 6. 2014
vom Kronleuchter der Hotel-Lobby<br />
herunterholen.<br />
Runtergeholt hat ihn mit vereinten<br />
Kräften das Personal <strong>des</strong> Schlosshotels<br />
Wilkinghege. Ich musste mit der Band<br />
nach einer neuen Bleibe suchen, aber alle<br />
Hotels im Umkreis von 100 Kilometern<br />
waren bereits vor uns gewarnt worden.<br />
Sex & Drugs & Rock ’n’ Roll. Passiert so<br />
etwas heute noch?<br />
Eher selten – jedenfalls in diesem<br />
Mix, der so typisch für die Anfänge<br />
war. Aber natürlich gibt es immer wieder<br />
Grenzsituationen. Wenn zum Beispiel<br />
Axl Rose wegen Unmuts über seine<br />
Verlobte einen Fernseher aus dem Hotelzimmerfenster<br />
wirft oder Pete Doherty<br />
aus Kalamitäten geholfen werden muss.<br />
Heute ist alles weniger exotisch und<br />
anarchisch.<br />
Die Rocker sind müde geworden?<br />
Das würde ich nicht sagen, aber viel<br />
mehr verläuft unter dem Radar als früher.<br />
Vermissen Sie die guten alten Zeiten?<br />
Ich vermisse auf jeden Fall die Aufbruchstimmung<br />
von damals. Musik war<br />
der Weg hinaus aus einer drögen Gesellschaft.<br />
Musik symbolisierte Freiheit, der<br />
Rock ’n’ Roll brach alte, verstaubte und<br />
verkrustete Strukturen auf. Man muss<br />
sich nur den Zustand der damaligen Gesellschaft<br />
in Erinnerung rufen: Ruhe war<br />
die erste Bürgerpflicht, alles muffte wie<br />
unter einer Dunstglocke vor sich hin. Die<br />
Popmusik evozierte die Vision von Freiheit,<br />
war der Motor für gesellschaftliche<br />
Veränderungen und politische Forderungen.<br />
Wir kamen uns – zu Recht oder zu<br />
Unrecht – vor wie die Speerspitze einer<br />
neuen Bewegung, die schließlich mehr<br />
Rechte für Jugendliche erkämpfte und<br />
eine eigene Kultur formte.<br />
Hat die Rockmusik heute noch diese<br />
Kraft?<br />
In gewissen Bereichen ganz sicher.<br />
Es gibt immer wieder Gruppen, die entscheidende<br />
Impulse auslösen. Aber im<br />
Großen und Ganzen ist viel von dieser<br />
Schubkraft verloren gegangen.<br />
Woran liegt das?<br />
Als die Rockmusik laufen lernte,<br />
geschah dies in einer monotonen<br />
„Popmusik<br />
evozierte<br />
Freiheit. Wir<br />
kamen uns wie<br />
die Speerspitze<br />
einer neuen<br />
Bewegung vor“<br />
Medienlandschaft mit einzelnen Monopolsendern.<br />
Weder Mobiltechnik noch<br />
Internet, Computer oder Social Media<br />
lenkten das Interesse ab. Musik traf auf<br />
die ungeteilte Aufmerksamkeit einer Jugend,<br />
die noch nicht einer Kakofonie von<br />
Myriaden Botschaften ausgesetzt war.<br />
Heute kann sich ein Song in Minutenschnelle<br />
über die ganze Welt verbreiten,<br />
während das früher viele Monate gedauert<br />
hat. Aber damals konnte ein einzelner<br />
Song im Leben der Menschen einen<br />
viel entscheidenderen Impuls auslösen.<br />
Ich will damit bestimmt nicht zum Ausdruck<br />
bringen, dass früher alles besser<br />
war. Ich sage nur: Alles verändert sich.<br />
„The times they are a-changin’.“<br />
Damals war Rock nicht nur Musik, sondern<br />
eine Lebenseinstellung, Revolte,<br />
vielleicht sogar Religion. Für Sie auch?<br />
Für mich bot sich ein Freiraum, aber<br />
für viele andere war es eine Art Ersatzreligion.<br />
<strong>Der</strong> Versuch, das Bewusstsein<br />
künstlich zu erweitern, die Drogenexperimente,<br />
denen ja nicht nur in der Musik,<br />
sondern auch in der Literatur und<br />
in der Kunst das Wort geredet wurde,<br />
das alles hatte pseudoreligiöse Züge –<br />
und kostete in <strong>letzte</strong>r Konsequenz viele<br />
Gut- und Leichtgläubige das Leben, und<br />
wenn nicht das Leben, dann zumin<strong>des</strong>t<br />
den Verstand.<br />
Ungefähr ein halbes Jahrhundert später<br />
scheint die Rockmusik in ihrer klassischen<br />
Phase angekommen zu sein.<br />
Werden von nun an vor allem die alten<br />
Werke neu interpretiert?<br />
Sicher, bei den älteren Superstars<br />
tickt unweigerlich die Uhr. Und tatsächlich<br />
muss man sagen: So viel Neues passiert<br />
nicht mehr, heutzutage wird vor allem<br />
variiert, erweitert und tradiert.<br />
Die sicherste Bank scheinen Konzerte<br />
mit Künstlern zu sein, die ihre alten<br />
Hits spielen und oft seit Jahrzehnten<br />
keine neuen Songs mehr herausgebracht<br />
haben.<br />
Das hat durchaus seine Berechtigung.<br />
Warum soll das Publikum denn nicht das<br />
bekommen, wofür es den Eintrittspreis<br />
bezahlt? Manche Stars verweigern ihre<br />
Hits oder verfremden sie so, dass man sie<br />
kaum erkennen kann. Schrecklich ist es,<br />
wenn sich etablierte Künstler neues Material<br />
herauszuquälen versuchen, das gar<br />
nicht mehr in ihnen steckt. Die Fans wollen<br />
den populären Songkanon hören und<br />
nicht die zwanghaften Bemühungen ihrer<br />
Helden um Modernität. Ebenso verpönt<br />
ist das Ranwanzen an neue Trends.<br />
Viel zu oft wird den Fans so zwangsweise<br />
obsoletes Material verabreicht. Das ist<br />
so, als würde man in der Oper die Arien<br />
eliminieren.<br />
Aber die, die für die Erfolgsarien verantwortlich<br />
sind, werden nicht jünger. Was<br />
passiert, wenn diese prägende Generation<br />
endgültig abtritt? Stirbt der Rock<br />
mit seinen <strong>letzte</strong>n Helden?<br />
Ich glaube nicht, dass die Rockmusik<br />
an Bedeutung verlieren wird oder dass<br />
es prinzipiell an neuen Talenten mangelt.<br />
Natürlich präsentieren wir nach wie vor<br />
viele Bands, die seit Jahrzehnten erfolgreich<br />
sind. Unser Angebot besteht jedoch<br />
zu einem überwiegenden Teil aus jüngeren<br />
Gruppen und Interpreten, an deren<br />
Weiterentwicklung wir arbeiten. Uns ist<br />
<strong>des</strong>halb nicht bange um den Erfolg eines<br />
sich permanent verändernden Musikbusiness.<br />
Natürlich findet ein Prozess<br />
der Auslese und der Auswahl statt, bei<br />
dem leider auch begabte Künstler scheitern.<br />
Aber keine Angst, man darf mit<br />
gespannter Zuversicht in die Zukunft<br />
schauen. Denn es gibt immer wieder herausragende<br />
Talente, die den ganz großen<br />
Sprung schaffen wie jüngst One Republic.<br />
Das Gespräch führte THOMAS WINKLER<br />
27<br />
<strong>Cicero</strong> – 6. 2014
TITEL<br />
<strong>Der</strong> <strong>letzte</strong> <strong>Sommer</strong> <strong>des</strong> Rock ’n’ Roll<br />
BLOSS NICHT VERPASSEN<br />
Eagles<br />
Seit 1979 haben sie nur ein neues Album herausgebracht,<br />
auf dem sie den Irakkrieg und<br />
die Umweltzerstörung geißeln. Einerseits geht<br />
es ihnen also nicht ums Geld, andererseits unternehmen<br />
sie seit 1994 wieder lukrative Tourneen<br />
– und die Alphamänner Don Henley und<br />
Glenn Frey warfen den nörgelnden Gitarristen<br />
Don Felder aus der Band, weil der genauso viel<br />
verdienen wollte wie sie. Die Eagles verbinden<br />
Perfektionismus und Starrsinn mit liberaler<br />
Haltung und dem sprichwörtlichen kalifornischen<br />
„Take It Easy“. Im „Hotel California“ lauert<br />
ein Monster hinter der Zimmertür.<br />
28. 6. Vechta<br />
Patti Smith<br />
Sie ist die Mythenfrau und Dichterin unter den<br />
amerikanischen Sängerinnen: 1975 begann<br />
Patti Smith mit „Horses“, einer furiosen Hommage<br />
an den Rock ’n’ Roll, an Jim Morrison und<br />
Arthur Rimbaud, sie war mit Robert Mapplethorpe<br />
liiert und mit Sam Shepard, sang mit<br />
Bruce Springsteen und zog sich nach dem Tod<br />
ihres Mannes für einige Jahre zurück. Ihre<br />
Konzerte sind heute bejubelte Weihefeste:<br />
Patti Smith, Priesterin und Charismatikerin,<br />
ist längst selbst in die Geschichte der Rockmusik<br />
eingeschrieben.<br />
5. 8. Stuttgart, 11. 8. Mainz, 12. 8. München<br />
The Rolling Stones<br />
Noch immer ist es nur Rock ’n’ Roll, aber wir<br />
mögen ihn. Im vergangenen Jahr traten die<br />
Rolling Stones im Londoner Hyde Park auf,<br />
40 Jahre nach ihrem legendären <strong>Sommer</strong>konzert,<br />
und spielten ihre großen Songs. Um Innovation<br />
geht es schon lange nicht mehr: Das<br />
<strong>letzte</strong> Studioalbum erschien im Jahr 2005, und<br />
wenn Mick Jagger auch noch immer den virilen<br />
Macho gibt, so legt sich doch Melancholie<br />
über die Konzerte. Im Publikum stehen heute<br />
auch junge Leute, die den Mount Rushmore<br />
der Rockmusik besichtigen wollen.<br />
1. 6. Zürich, 10. 6. Berlin, 19. 6. Düsseldorf<br />
Neil Young<br />
Gerade hat der kanadische Wunderkauz mit<br />
einem Aufnahmegerät von 1947 eine Platte in<br />
einer Telefonzelle eingespielt, die er mit einer<br />
Nachricht an seine tote Mutter einleitet, und<br />
das Wiedergabesystem „Pono“ erfunden, weil<br />
er den Klang der CD hasst. Neil Youngs Musik<br />
ist der Glutkern <strong>des</strong> Rock ’n’ Roll; er spielt im<br />
Konzert lange, lärmende Versionen von Songs<br />
der Beatles, von Bob Dylan und Bruce Springsteen,<br />
versammelt noch immer die verwitterten<br />
Krachbrüder von Crazy Horse um sich und<br />
verschwendet keinen Gedanken an Vermarktung<br />
und Erwartungen.<br />
20. 7. Ulm, 25. 7. Mönchengladbach,<br />
26. 7. Dresden, 28. 7. Mainz<br />
Demnächst live bei<br />
uns: zehn Legenden<br />
aus Rock, Heavy Metal,<br />
Country und Folk<br />
Bob Dylan<br />
Die unendliche Tournee dauert an: Während<br />
andere Giganten sich rar machen, tritt der<br />
größte Songschreiber von allen an jedem Ort<br />
der Welt auf. Alles ist Variation, Maske und<br />
Dekonstruktion bei Bob Dylan – man sieht<br />
fasziniert dabei zu, wie jemand sich weigert,<br />
Legende zu sein, wie er jeden Mitschunkelimpuls<br />
zerstört, die Stücke zerdehnt und verfremdet,<br />
Vers auf Vers türmt, plötzlich Keyboard<br />
spielt und nicht mehr triumphal nölt,<br />
sondern gotterbärmlich krächzt. Wer die alten<br />
Songs so hören will, wie er sie in Erinnerung<br />
hat, der kann ja die Platten auflegen.<br />
28. 6. Wien, 29. 6. Klam, 1. 7. München,<br />
3. 7. Zwickau, 7. 7. Rostock, 8. 7. Flensburg<br />
Dolly Parton<br />
In Deutschland wird sie als Blondinenwitz<br />
missverstanden, dabei ist Dolly Parton die<br />
Patin der Country-Musik: Sie schreibt Songs,<br />
spielt Gitarre, produziert ihre Alben und unterhält<br />
einen Freizeitpark. Das ist natürlich<br />
nur in Amerika denkbar: Dolly bewahrt ebenso<br />
das Erbe der Bluegrass-Folklore und Appalachenmusik,<br />
wie sie die Country-Industrie<br />
mit der Version eines Songs von Bon Jovi bedient.<br />
Ihre seltenen Konzerte in Europa sind<br />
<strong>des</strong>halb wahre Out-of-area-Einsätze.<br />
5. 7. Köln, 6. 7. Berlin<br />
Elvis Costello<br />
<strong>Der</strong> Meisterschüler und Akademiker der<br />
Rockmusik trat mit so ziemlich jeder legendären<br />
Gestalt von Roy Orbison bis Chet Baker<br />
auf. Costello, bürgerlich Declan MacManus,<br />
begann 1977 als Bilderstürmer <strong>des</strong> New Wave,<br />
versuchte sich in den achtziger Jahren in<br />
beinahe jedem Genre, schrieb Songs mit<br />
Paul McCartney, Allen Toussaint und Burt<br />
Bacharach, spielte in Filmen sich selbst und<br />
heiratete die Jazz-Pianistin Diana Krall. Zuletzt<br />
näherte er sich dem Hip-Hop.<br />
7. 10. Hamburg, 9. 10. Berlin, 10. 10. Leipzig,<br />
12. 10. Mainz, 13. 10. München, 14. 10. Stuttgart<br />
Black Sabbath<br />
Das Magma <strong>des</strong> Heavy Metal: Seit 1968 inszeniert<br />
die englische Band zähe, tief tönende<br />
schwarze Messen, sie hat mehrere Subgenres<br />
begründet und ist heute eine Art Letztbegründung<br />
<strong>des</strong> Höllenlärms. <strong>Der</strong> wahnsinnige Sänger<br />
Ozzy Osbourne hatte Black Sabbath 1979<br />
verlassen, Gitarrist Tony Iommi machte mit<br />
Ronnie James Dio und Ian Gillan weiter, doch<br />
es fehlte an Paranoia. Nach Osbournes Rückkehr<br />
erschien im vergangenen Jahr „13“, ein<br />
Album wie das Jüngste Gericht.<br />
8. 6. Berlin, 13. 6. München, 25. 6. Stuttgart,<br />
27. 6. Essen<br />
Bob Mould<br />
Mit Hüsker Dü hob er die amerikanische Rockmusik<br />
seit 1981 auf Überschallniveau: Das<br />
Gitarrenspiel von Bob Mould trieb brachiale<br />
Hochgeschwindigkeitssongs an. Neben dem<br />
Schlagzeuger Grant Hart schrieb er beseelte<br />
Lärmlieder, die immer berückender wurden.<br />
Nach seinem Solomeisterwerk „Workbook“<br />
von 1989 genoss Mould mit dem Trio Sugar<br />
kurzen Erfolg und forschte danach an der<br />
Schnittstelle zwischen sonischen Gitarren und<br />
elektronischem Klang.<br />
8. 11. Weißenhäuser Strand<br />
Lloyd Cole<br />
„Rattlesnakes“ von 1984 ist eines der wichtigsten<br />
Alben <strong>des</strong> Jahrzehnts. <strong>Der</strong> Engländer Lloyd<br />
Cole galt als grüblerischer Apoll, wollte aber<br />
lieber Literat sein und notorisch schlecht gelaunt.<br />
Von London zog er nach New York, war<br />
permanent in der Krise und veröffentlicht seit<br />
2000 sehr schöne, eloquente Songwriter-Alben.<br />
Heute lebt er in Neu-England und spielt<br />
Golf – wenn er Europa besucht, dann gibt Cole<br />
schon mal ein Konzert an der Ostseeküste.<br />
8. 11. Weißenhäuser Strand<br />
ARNE WILLANDER ist stellvertretender<br />
Chefredakteur der deutschen Ausgabe <strong>des</strong><br />
Rolling Stone. Er geht auf jeden Fall zu den<br />
Konzerten von Neil Young und Elvis Costello<br />
Foto: Jan Peter Böning/Zenit/Laif<br />
28<br />
<strong>Cicero</strong> – 6. 2014
BERLINER REPUBLIK<br />
„ Es ist nicht der Dirigent,<br />
der den Klang<br />
produziert, sondern<br />
das Orchester.<br />
Oft vergessen das<br />
die Dirigenten “<br />
Daniel Barenboim, Generalmusikdirektor der Staatsoper Unter den Linden in<br />
Berlin, im <strong>Cicero</strong>-Gespräch mit Finanzminister Wolfgang Schäuble, Seite 38<br />
29<br />
<strong>Cicero</strong> – 6. 2014
BERLINER REPUBLIK<br />
Porträt<br />
DIE MUTTER DER MÜTTERRENTE<br />
Maria Böhmer fasste einen Plan: Wer Kinder großgezogen hat, soll mehr Rente kriegen.<br />
Also ging sie in die CDU, setzte früh auf Merkel, wurde zum Machtfaktor – und gewann<br />
Von HARTMUT PALMER<br />
<strong>Der</strong> Kampf dauerte 28 Jahre. Aber<br />
als er schließlich entschieden<br />
wurde – in der Nacht auf den<br />
28. November 2013 in der <strong>letzte</strong>n Pokerrunde<br />
im Willy-Brandt-Haus – saß Maria<br />
Böhmer nicht mehr mit am Tisch, sondern<br />
draußen vor der Tür. Erst kurz nach<br />
Mitternacht erfuhr sie, dass es vollbracht<br />
und die Mütterrente im Koalitionsvertrag<br />
verankert war. Ab 1. Juli sollen nun<br />
auch ältere Mütter, die Kinder vor 1992<br />
bekommen haben, mehr Rente erhalten.<br />
Dafür hat die Vorsitzende der CDU-<br />
Frauen-Union fast ihr halbes Leben lang<br />
gestritten. Die Mütterrente ist ihr Baby.<br />
1985 hat sie es entdeckt, mit 35. Da<br />
ist sie gerade erst in die Politik geraten.<br />
Obwohl sie eigentlich Wissenschaftlerin<br />
werden will. Mathematik, Physik und Erziehungswissenschaft<br />
hat sie studiert, ihren<br />
Doktor gemacht, ihre Habilitationsschrift<br />
geschrieben. Eine Frau ruft an, die<br />
Staatssekretärin im Mainzer Sozialministerium.<br />
Ob sie Frauenbeauftragte <strong>des</strong><br />
Lan<strong>des</strong> Rheinland-Pfalz werden wolle.<br />
Frauenbeauftragte? Böhmer fragt ihren<br />
Doktorvater. <strong>Der</strong> meint, ein Jahr Lan<strong>des</strong>regierung<br />
könne nichts schaden.<br />
Sie selbst ist noch gar nicht Mitglied<br />
der Partei, als sie 1985 gebeten wird, am<br />
Leitantrag <strong>des</strong> Essener CDU-Bun<strong>des</strong>parteitags<br />
mitzuschreiben. Die Erziehungsarbeit<br />
der Mütter müsse bei der Berechnung<br />
der Rente berücksichtigt werden,<br />
verlangt Heiner Geißler, damals CDU-<br />
Generalsekretär. Bun<strong>des</strong>finanzminister<br />
Gerhard Stoltenberg blockt ab: zu teuer.<br />
Geißler wird ihr Mentor. Rita Süssmuth,<br />
von Helmut Kohl zur Frauen- und<br />
Gesundheitsministerin berufen, will<br />
sie 1986 zur Abteilungsleiterin machen.<br />
Aber da ist Maria Böhmer bereits infiziert.<br />
Abteilungsleiterin? Nein. Sie will<br />
selbst Politik machen. 1990 zieht sie über<br />
die Lan<strong>des</strong>liste in den Bonner Bun<strong>des</strong>tag.<br />
Dort trifft sie eine vier Jahre jüngere Naturwissenschaftlerin<br />
aus der Uckermark.<br />
Seitdem sind Angela Merkel und Maria<br />
Böhmer politisch ein Gespann.<br />
Es gibt viele Gemeinsamkeiten:<br />
Beide Physikerinnen, beide kennen ihre<br />
Männer seit Studienzeiten, beide sind<br />
kinderlos, und beide haben gelernt, dass<br />
es nicht genügt, gute Ideen zu haben. Um<br />
etwas zu erreichen, braucht es Macht.<br />
„Bei Frauen ist es oft so gewesen“, sagt<br />
Böhmer, „dass ihnen das Machtbewusstsein<br />
gefehlt hat. Wir haben dazugelernt<br />
und wissen, dass eine bestimmte Position<br />
nötig ist, um auch in der Sache etwas voranzubringen<br />
und durchzusetzen.“<br />
Merkel wird 2000 Parteichefin und<br />
2005 Kanzlerin. Böhmer führt von 2001<br />
an die Frauen-Union.<br />
NICHT IMMER ZIEHEN sie an einem<br />
Strang. 2003, ausgerechnet auf dem Leipziger<br />
Parteitag, als die CDU beschließt,<br />
neoliberal zu werden, setzt Böhmer gegen<br />
Merkels Bedenken die Mütterrente<br />
durch. Sie ist Chefin der Frauen‐Union,<br />
sie sieht nicht ein, warum jüngeren Müttern<br />
bei der Rente drei Erziehungsjahre<br />
angerechnet werden, älteren hingegen,<br />
die Kinder vor 1992 geboren haben, nur<br />
eines. Diese Zweiteilung hatte Stoltenberg<br />
durchgesetzt. Die Antragskommission<br />
empfiehlt Ablehnung. Böhmer bleibt<br />
hart – und siegt. Die gleiche Mütterrente<br />
für alle ist fortan Parteiprogramm.<br />
Bis sie ins Wahlprogramm kommt,<br />
dauert es aber nochmal zehn Jahre. Um<br />
das zu erreichen, nageln Frauen auf Bezirksparteitagen<br />
und Delegiertenkonferenzen<br />
die Kandidaten für die Wahl 2013<br />
darauf fest. Böhmer hat organisiert, dass<br />
sie überall die Gleichbehandlung junger<br />
und älterer Mütter fordern. Zuletzt auf<br />
dem Parteitag in Hannover, diesmal mit<br />
Merkels Segen.<br />
Es passiert das Unglaubliche: Die<br />
Mütterrente wird ein Wahlkampfhit.<br />
Fehlt in keiner Merkel-Rede, bekommt<br />
Riesenapplaus. Endlich der Koalitionsvertrag:<br />
„Wir werden ab 1. Juli 2014 für<br />
alle Mütter oder Väter, deren Kinder vor<br />
1992 geboren wurden, die Erziehungsleistung<br />
mit einem zusätzlichen Entgeltpunkt<br />
in der Alterssicherung berücksichtigen.“<br />
Ohne Böhmer gäbe es den Satz<br />
nicht. „So war das“, sagt sie und lacht.<br />
„Wir Frauen können es eben.“<br />
Sie empfängt in der CDU-Zentrale,<br />
auf vertrautem Gelände. „Wir Frauen befinden<br />
uns nicht mehr an den Rändern<br />
der Macht, sondern im Zentrum“, hat sie<br />
2005 gesagt, als Merkel Kanzlerin und<br />
sie Integrationsbeauftragte im Kanzleramt<br />
wurde. Heute ist sie Staatsministerin<br />
im Auswärtigen Amt, zuständig für Kulturpolitik<br />
und oft unterwegs, um Goethe-<br />
Institute in aller Welt zu besuchen – kein<br />
schlechter Job. Nur: Früher musste sie<br />
zwei Treppen hochgehen, um die Kanzlerin<br />
zu treffen, jetzt ist sie ein kleines<br />
Stück weiter von der Macht entfernt.<br />
„Wir haben nach wie vor einen sehr<br />
engen Kontakt. Ich kann sie anrufen,<br />
wann immer es notwendig ist, ich sehe<br />
sie auch, bin auch im kleineren Kreis mit<br />
dabei.“ Pause. „Nach einer so langen gemeinsamen<br />
Wegstrecke weiß man, dass<br />
man sich aufeinander verlassen kann.“<br />
Noch ist das Versprechen, alle Mütter<br />
in der Rente gleichzustellen, nicht<br />
ganz erfüllt. Die älteren erhalten zum<br />
1. Juli einen Entgeltpunkt mehr, nicht<br />
zwei, wie von der CDU in Aussicht gestellt.<br />
Maria Böhmer wird sich damit auf<br />
Dauer bestimmt nicht zufrieden geben.<br />
HARTMUT PALMER ist politischer<br />
Chefkorrespondent von <strong>Cicero</strong>. Er schätzt<br />
Menschen, die langfristig denken und<br />
hartnäckig sind<br />
Foto: Götz Schleser für <strong>Cicero</strong><br />
30<br />
<strong>Cicero</strong> – 6. 2014
BERLINER REPUBLIK<br />
Porträt<br />
BREAKING GOOD<br />
<strong>Der</strong> Bayreuther Arzt Roland Härtel-Petri erlebte, wie die Droge Crystal Meth aus dem<br />
benachbarten Tschechien herüberschwappte und niemand etwas tat. Da wurde er aktiv<br />
Von MERLE SCHMALENBACH<br />
Foto: Roger Hagmann für <strong>Cicero</strong><br />
Das Glück der Patientin verschwand<br />
im Nichts. Himmelhochjauchzend<br />
– dann am Boden zerstört.<br />
Sie saß im Bayreuther Bezirkskrankenhaus<br />
vor dem Arzt Roland Härtel-Petri<br />
und beschimpfte ihn. In der Psychiatrie<br />
passiert so was schon mal, aber Härtel-<br />
Petri kam der Fall merkwürdig vor. Er<br />
ging die möglichen Diagnosen durch, er<br />
sprach mit Kollegen. Es kamen andere<br />
Patienten, denen es ähnlich ging. Die<br />
meisten hatten angegeben, Drogen zu<br />
nehmen. „Sie hätten stundenlang begeistert<br />
die Fliesen mit einer Zahnbürste putzen<br />
können – und dann waren sie völlig<br />
antriebslos.“ Es war das Jahr 1997, und<br />
Härtel-Petri betrat Neuland.<br />
Anderthalb Jahrzehnte später sitzt er<br />
in einem Fernsehstudio in Berlin. Seine<br />
Miene ist ernst. Auf dem Tisch stehen Flaschen<br />
mit Rohrreiniger und Batteriesäure,<br />
Zutaten für die Droge Crystal Meth. „Es<br />
ist die gefährlichste Stimulanz, die wir<br />
momentan auf dem Markt haben“, sagt er.<br />
Er wirkt routiniert im Scheinwerferlicht.<br />
Härtel-Petri, 47, ist der bekannteste<br />
Crystal-Experte Deutschlands. Er tritt<br />
im Fernsehen auf, kürzlich erschien sein<br />
Buch „Crystal Meth – Wie eine Droge<br />
unser Land überschwemmt“. Auch vor<br />
dem Gesundheitsausschuss <strong>des</strong> Bun<strong>des</strong>tags<br />
redete er. „Ich bin nur der Einäugige<br />
unter den Blinden“, wiegelt er ab. „Ein<br />
Wald- und Wiesenpsychiater.“ Dabei hat<br />
er bislang 800 Crystal-Patienten behandelt.<br />
Das macht ihn zum Vorreiter.<br />
In Deutschland mangelt es an Daten<br />
und Studien. Die Universitäten haben<br />
das Thema lange ignoriert. Man konnte<br />
damit kein Forschungsgeld einwerben,<br />
keine Karriere vorantreiben. Härtel-Petri<br />
denkt in anderen Kategorien. Sein Kopf<br />
ist voller Einfälle, sie strömen aus ihm heraus.<br />
Er redet schnell. Als Kind ist er wild,<br />
ungestüm. Oder impulsgestört, wie er es<br />
nennt. In der Schule prügelt er sich mit älteren<br />
Schülern. Mit 16 steckt er sich eine<br />
Sicherheitsnadel ins Ohr. Beim Windsurfen<br />
schätzt er die Lage einmal so falsch<br />
ein, dass er fast ertrinkt. „Ich bin neugierig<br />
wie eine Ratte“, sagt er.<br />
Nach der Schule will er sich nicht<br />
festlegen. Er schreibt sich für Medizin ein,<br />
studiert zudem Religionswissenschaften<br />
und Ethnologie, reist nach Indien, Schweden<br />
und England. <strong>Der</strong> Hunger nach Erkenntnis<br />
treibt ihn an. Kurz überlegt<br />
er, Pharmaforscher zu werden, aber er<br />
fürchtet, dass es in der Branche nur um<br />
Profit geht. Er tut lieber, was ihn interessiert,<br />
ohne Kosten-Nutzen-Rechnungen.<br />
Es sind Menschen wie Härtel-Petri,<br />
die Debatten in Gang bringen. Die Braven,<br />
die Karriereplaner warten lieber ab.<br />
WEIL HÄRTEL-PETRI sich gern in die Welt<br />
seiner Patienten vortastet, entscheidet er<br />
sich für die Psychiatrie. 1997 fängt er in<br />
Bayreuth an, wo er die erste Crystal-Patientin<br />
trifft. Er ist alarmiert. Und neugierig.<br />
Seine Kollegen im Krankenhaus<br />
ticken ähnlich. „Junge Männer, die unerforschte<br />
Gebiete reizen“, sagt er.<br />
Hilfe bekommen sie kaum. Fachliteratur?<br />
Sie haben einen Fernleiheausweis,<br />
und Härtel-Petri wird der Fernleiheausweisbeauftragte.<br />
Die Literatur wälzen sie<br />
am Wochenende. Bald kommen Süchtige<br />
aus ganz Deutschland zu ihnen. Insider<br />
nennen Bayreuth die „Kristallstadt“.<br />
<strong>Der</strong> Stoff gelangt meist über die<br />
tschechische Grenze ins Land. Betroffen<br />
sind vor allem Bayern, Sachsen, Sachsen-<br />
Anhalt und Thüringen. 2013 beschlagnahmten<br />
Fahnder in 3847 Fällen Crystal<br />
Meth, 10 Prozent mehr als 2012.<br />
Es ist eine gefährliche Droge. Sie<br />
wird meist geschnupft und hat ein enormes<br />
Suchtpotenzial. Im schlimmsten<br />
Fall löst sie gewalttätige Psychosen und<br />
Selbstmordgedanken aus. <strong>Der</strong> Entzug ist<br />
hart, er dauert sechs bis zwölf Monate.<br />
Durch die US-Serie „Breaking Bad“, in<br />
der ein sterbenskranker Chemielehrer<br />
die Droge herstellt, wurde das Thema<br />
hierzulande bekannter. Die Droge, das<br />
ist das Tückische, steigert kurzfristig das<br />
Selbstbewusstsein. Sie löst Euphorie aus,<br />
hält tagelang wach. Sinnlose Tätigkeiten<br />
machen plötzlich Spaß. <strong>Der</strong> Sex ist intensiv.<br />
Besonders beliebt ist die Droge<br />
bei Skinheads, Hooligans und in Techno-<br />
Kreisen. Aber auch Menschen, die mitten<br />
im Leben stehen, nehmen Crystal Meth.<br />
Härtel-Petri zufolge sind vor allem jene<br />
gefährdet, die hart arbeiten müssen und<br />
am Wochenende Spaß haben wollen.<br />
Für den Arzt ist die Droge auch Ausdruck<br />
der Ego-Gesellschaft. Er geht durch<br />
seine Praxis in Bayreuth. Aus dem Regal<br />
zieht er „Schöne neue Welt“ von Aldous<br />
Huxley. Er findet das Buch aktueller denn<br />
je. <strong>Der</strong> Leistungsdruck der Gegenwart sei<br />
unerträglich. Sich hochzuputschen ist<br />
eine Flucht. Es ist still in seinen Räumen.<br />
Die Praxis hat er im Januar aufgemacht.<br />
Die Arbeit in der Klinik drohte ihn zu<br />
zerreiben. Öffentliche Auftritte dosiert<br />
er. Er will jetzt öfter Kanu fahren gehen.<br />
An einem kühlen Abend sitzt er auf<br />
einer Bühne in Bayreuth. Er blickt ins Publikum,<br />
180 Leute lauschen der Podiumsdiskussion,<br />
die Stühle sind knapp. Lehrer,<br />
aber auch Angehörige von Süchtigen sind<br />
gekommen. <strong>Der</strong> Veranstalter, ein junger<br />
Mann mit Politikambitionen, grinst wichtig.<br />
Eine Suchtberaterin kommt spontan<br />
auf die Bühne. Härtel-Petri macht Platz.<br />
Er schiebt seinen Stuhl an den Rand. Raus<br />
aus dem Scheinwerferlicht.<br />
MERLE SCHMALENBACH ist Reporterin<br />
in Berlin. In Bayreuth ließ ein Polizist<br />
sie an Crystal schnuppern – ein Geruch<br />
zwischen Putzmittel und Süßstoff<br />
33<br />
<strong>Cicero</strong> – 6. 2014
BERLINER REPUBLIK<br />
Porträt<br />
IHRE WELT DANACH<br />
Renate Künast erlitt Niederlagen und Verletzungen. Die Grünen-Politikerin ringt um<br />
Abstand. Zugleich baut sie sich einen neuen Kosmos auf. Wie funktioniert das?<br />
Von KATJA KRAUS<br />
Renate Künast ist im Aufbruch. <strong>Der</strong><br />
robuste Rollkoffer liegt offen auf<br />
dem Boden ihres noch nicht entschieden<br />
bezogenen Büros. Einen <strong>letzte</strong>n<br />
Termin wird sie an diesem sonnigen<br />
Freitagnachmittag noch erledigen, dann<br />
steigt sie in den Zug nach Schleswig-Holstein,<br />
um das Wochenende auf dem Land<br />
zu verbringen. „In meiner kleinen Datsche“,<br />
sagt sie und kokettiert dabei mit<br />
den entstehenden Bildern vom politikfreien<br />
Idyll.<br />
Ob wir auch bei einem Spaziergang<br />
zur Eisdiele sprechen können, fragt<br />
sie komplizenschaftlich. Dass die Aufzeichnung<br />
<strong>des</strong> Gesprächs damit deutlich<br />
schwerer würde, leuchtet ihr ein. Also<br />
bleibt es beim Tee im Büro.<br />
Sie hat ein neues Büro im Bun<strong>des</strong>tag,<br />
die Umzugskisten sind noch nicht<br />
ausgepackt. Die langjährige Fraktionsvorsitzende<br />
der Grünen ist jetzt,<br />
58 Jahre alt, Vorsitzende <strong>des</strong> Ausschusses<br />
für Recht und Verbraucherschutz.<br />
Die meisten Menschen wissen das nicht<br />
und auch denjenigen, die es wissen, fehlt<br />
die Vorstellung, wie sich aus dieser Position<br />
heraus Politik und Gesellschaft<br />
gestalten lassen. Renate Künast ist sich<br />
<strong>des</strong>sen bewusst. Noch hat sie sich selbst<br />
in der neuen Position ebenso wenig verortet<br />
wie den Inhalt der Kisten in ihrem<br />
Büro. Und doch statuiert sie mit Entschiedenheit:<br />
„Ich mache schon wieder<br />
richtig Politik.“<br />
RICHTIG POLITIK. Wie in den vergangenen<br />
30 Jahren. Spätestens seit Joschka<br />
Fischer 1999 wissen ließ, er stelle sich<br />
Renate Künast und Fritz Kuhn als Parteivorsitzende<br />
vor, was damals einer Anordnung<br />
gleichkam. Seitdem ging alles in<br />
„Highspeed“, erzählt sie und unterstreicht<br />
die Geschwindigkeit ihres Machtgewinns<br />
mit einer rasanten Handbewegung.<br />
14 Jahre Höchstgeschwindigkeit,<br />
erste Bun<strong>des</strong>ministerin für Landwirtschaft<br />
und Verbraucherschutz, und, nach<br />
dem Ende von Rot-Grün, Fraktionschefin<br />
im Bun<strong>des</strong>tag. Erst 2011 kamen die Niederlagen.<br />
Renate Künast hat mehrmals<br />
hintereinander verloren. Als Bürgermeisterkandidatin<br />
in Berlin, als Bewerberin<br />
für die Grünen-Spitze im Bun<strong>des</strong>tagswahlkampf,<br />
als Interessentin für das Amt<br />
der Vizepräsidentin im Parlament. Ein<br />
schmerzlicher Liebesentzug ihrer Partei.<br />
Wie geht sie damit um?<br />
Sie wirkt ganz froh, endlich mal Zeit<br />
zur Seelenregeneration zu haben. Für all<br />
die Bücher, die sie lange schon lesen will.<br />
Für ihre Patenkinder und dafür, nach<br />
dem Vorbild ihres Vaters einfach innezuhalten:<br />
„Mein Vater konnte den Rosen<br />
beim Verduften zusehen.“ Eine Fähigkeit,<br />
die ihr ehemals wunderlich und<br />
erst im hysterischen politischen Alltag<br />
erstrebenswert erschien.<br />
Wer die ehemalige Verbraucherschutzministerin<br />
in diesen Tagen erlebt,<br />
bestaunt ihre Gelassenheit. Renate<br />
Künast lächelt ein bisschen mokant über<br />
diese vermeintliche Entdeckung. Eigentlich<br />
sei sie immer schon anders gewesen<br />
als ihr öffentliches Bild. Unfröhlich, hart,<br />
ehrgeizig, zählt sie die gängigsten Zuschreibungen<br />
auf.<br />
Als sie in die Bun<strong>des</strong>politik einzog,<br />
ließ sie sich von einer befreundeten Kommunikationsexpertin<br />
beraten, um gewappnet<br />
zu sein für den Umgang mit der<br />
Aufmerksamkeit und den kausalen Verletzungen.<br />
Es sei nun mal so, dass man<br />
zwei Identitäten hat, wenn man ein politisches<br />
Leben führt. „Die, die man öffentlich<br />
ist. Und die, die man ist. Wie im<br />
Steppenwolf.“<br />
Hermann Hesses Schlüsseltext über<br />
das Ringen der verschiedenen Persönlichkeiten<br />
in einer Person: „Es war einmal<br />
einer namens Harry, genannt der Steppenwolf.<br />
Er ging auf zwei Beinen, trug<br />
Kleider und war ein Mensch, aber eigentlich<br />
war er doch eben ein Steppenwolf.“<br />
SIE MALT MIT DEM FINGER einen Kreis<br />
in die Luft: „Ein großer Kreis und das<br />
alles bin ich.“ Dann zieht sie eine Zickzacklinie<br />
und fügt hinzu: „Einen Teil<br />
davon habe ich abgetrennt, der ist ganz<br />
privat.“ Diesen Teil schützt sie sorgsam,<br />
auch wenn sie die Zacken der Linie hin<br />
und wieder im Sinne der Vermittelbarkeit<br />
der öffentlichen Renate Künast neu zieht.<br />
Sie wäre gerne eine Politikerin der<br />
Herzen. „Wer mich kennt, weiß, dass ich<br />
lustig bin.“ Aber die Vorstellung, dass<br />
eine Frau die Herausforderungen ihrer<br />
politischen Sozialisation mit Charme und<br />
Liebreiz bewältigen könnte, die scheint<br />
ihr doch allzu verwegen: „Sie müssen<br />
mal überlegen, was ich erlebt habe.“<br />
Dann erzählt sie von den Jahren als Sozialarbeiterin<br />
im Männergefängnis, von<br />
den ersten politischen Ausschüssen, in<br />
denen sie als einzige Frau und einzige<br />
Grüne gleich zweifach auf verlorenem<br />
Posten saß. Oder später als Ministerin,<br />
wenn sie schweißnass vor Bauernverbänden<br />
sprach: „6000 Leute, eine tobende,<br />
min<strong>des</strong>tens 40 Grad heiße Halle.“<br />
Sie malt jetzt detailreiche Erinnerungsbilder<br />
aus der Zeit, und freut sich<br />
sichtbar noch Jahre später daran: „Ich<br />
wusste, da gehe ich durch.“ Ein deutscher<br />
Bauer wirft nicht mit Lebensmitteln, diesen<br />
Satz hatte sie sich für das Ende ihrer<br />
Rede zurechtgelegt, um sich genau davor<br />
zu schützen. Es war dann nicht nötig, sie<br />
ging unbeschadet von der Bühne. Und<br />
bestätigt in ihrer routiniert angewandten<br />
Erfolgsformel: Be prepared.<br />
Heute sieht sie wohlig aus, durchlässiger<br />
als in der zehrenden Zeit im Fraktionsvorsitz.<br />
Oder in den Phasen, als<br />
Foto: Stefan Thomas Kröger/Laif<br />
34<br />
<strong>Cicero</strong> – 6. 2014
BERLINER REPUBLIK<br />
Porträt<br />
Erste Grüne und erste Frau an der Spitze <strong>des</strong> Landwirtschaftsministeriums. Auch<br />
später bearbeitete Renate Künast das Thema – wie 2009 im bayerischen Peiting<br />
sie dann doch noch etwas anderes sein<br />
wollte, als sie schon war. Als sie sich um<br />
das Bürgermeisterinnenamt in Berlin<br />
bewarb. Ihre größte Niederlage, wie sie<br />
heute sagt. Sie hat irgendwann gespürt,<br />
dass sie nicht gewinnen kann, lange vor<br />
dem Wahltag. Aber sie hat durchgehalten,<br />
weil man nicht aufgibt als „Kielfigur“.<br />
Auch wenn die Verletzungen tiefer<br />
waren als die, die ihr auf früheren Bühnen<br />
drohten. Vor allem diejenigen, die<br />
ihr Parteifreunde zufügten. „Schwierig<br />
wird es, wenn die eigenen Leute eine<br />
Niederlage gegen dich funktionalisieren“,<br />
beschreibt sie die Furchen dieser Erfahrungen,<br />
und zum ersten Mal stockt Renate<br />
Künasts Erzählfluss kurz. Sie wusste,<br />
dass dieses Ergebnis und vor allem die<br />
Begleitumstände ihre weitere Karriere<br />
beeinflussen würden.<br />
Im Nachhinein würde sie manches<br />
anders machen, würde nahbarer sein,<br />
viel mehr in der Begegnung mit Menschen<br />
für ihre Positionen werben als in<br />
Interviews. Zuhören statt ankündigen.<br />
Ihr alter Wegbegleiter Fritz Kuhn hat aus<br />
ihren Fehlern gelernt und es in Stuttgart<br />
besser gemacht, glaubt sie. Heute ist er<br />
Oberbürgermeister.<br />
DABEI WAR ES LANGE ihr Weg, genau zu<br />
beobachten und aus dem Verhalten der<br />
anderen Schlüsse zu ziehen. Für die Kandidatur<br />
in Berlin gab es kein Lehrbeispiel.<br />
Selbst als solches zu dienen, das hätte sie<br />
sich gern erspart.<br />
„Eigentlich will man nach so einer<br />
Erfahrung erst mal alles hinschmeißen“,<br />
sagt sie. Sie verordnete sich damals ein<br />
Restabilisierungsprogramm: „Ich musste<br />
die ganze Kiste einmal ausschalten.“ Mit<br />
Schlafen, Stricken, Kosmetik und Wellnesswochenenden<br />
fand sie zu den vegetativen<br />
Funktionen zurück.<br />
„Wenn man nicht wagt, gewinnt man<br />
nicht“, sagt sie unvermittelt laut und unterbricht<br />
mit diesem Diktum ihren Ausflug<br />
in düstere Gedanken. Vielleicht<br />
musste sie auch <strong>des</strong>halb im Herbst 2012<br />
gleich wieder antreten. Diesmal, um die<br />
Grünen als Spitzenkandidatin in den<br />
Bun<strong>des</strong>tagswahlkampf zu führen. Eine<br />
Kandidatur als Flucht nach vorne, über<br />
die wachsende Auflehnung in der Partei<br />
und das Gefühl der eigenen Antastbarkeit<br />
hinweg. „Nach der Berlin-Geschichte<br />
haben sich plötzlich Leute etwas<br />
rausgenommen, was sie sich vorher niemals<br />
getraut haben.“<br />
Die Spitzenkandidatur ging an Jürgen<br />
Trittin und Katrin Göring-Eckardt.<br />
Die Urwahl verloren zu haben, sei okay<br />
gewesen, sagt Renate Künast. Eine demokratische<br />
und damit gerechte Entscheidung.<br />
So muss sie es sehen. Erstaunt war<br />
sie schon. Aber es gab nun mal eine Bewegung<br />
in ihrer Partei, die nach neuen<br />
Führungsfiguren verlangte.<br />
Verstehen kann sie das nicht: „Jugenddebatten<br />
gibt es immer, aber Alter<br />
ist doch kein Inhalt.“ Sie verzieht indigniert<br />
das Gesicht, während sie mit ihren<br />
Worten um Abstand ringt. Aber sie versucht<br />
nicht zu verbergen, dass sie unter<br />
dem Generationswechsel leidet, und dass<br />
ihr seither das Koordinatenkreuz fehlt.<br />
„Wer steht eigentlich für was?“, fragt sie.<br />
Nach der verlorenen Bun<strong>des</strong>tagswahl<br />
hat Renate Künast ihr Interesse am<br />
Amt der Vizepräsidentin <strong>des</strong> Parlaments<br />
angemeldet. Die Position ging an Claudia<br />
Roth. Ein weiterer Verdrussmoment,<br />
den sie nicht als solchen sehen mag: „Daran<br />
hing mein Herz nicht.“ Aber es hat<br />
den Abstand zu ihrer Partei vergrößert.<br />
Jetzt möchte sie erst mal noch ein<br />
bisschen Politik machen. Akzente setzen<br />
mit den Themen, die sie bewegen, auch<br />
wenn alles viel ruhiger geworden ist um<br />
sie herum. Zwei bis drei Monate hat sie<br />
nach der Wahl gebraucht, um sich daran<br />
zu gewöhnen, „dass keine Sau anrief“.<br />
Mit der Zeit hat sie nicht mehr so<br />
oft auf das stumme Telefon geschaut und<br />
ist auch mal um 8.30 Uhr unter die Dusche<br />
gegangen, statt auf den Anruf zur<br />
Lagebesprechung zu warten. Ihr Mann<br />
Foto: Action Press<br />
36<br />
<strong>Cicero</strong> – 6. 2014
Illustration: Anja Stiehler/Jutta Fricke Illustrators<br />
hat sich inzwischen abgewöhnt, seine<br />
Fragen am Morgen mit „Was ich dich<br />
noch schnell fragen wollte“ einzuleiten.<br />
„Das Leben verändert sich, wenn<br />
man nicht mehr mittendrin ist“, resümiert<br />
sie und zitiert Churchill, der nach<br />
dem Machtverlust vor allem „Information<br />
und Transportation“ vermisste. Mit<br />
dem Transport sei das in Berlin ja nicht<br />
so problematisch, und wenn sie neuerdings<br />
mal von Termin zu Termin durch<br />
Berlin schlendert, erlebt sie ganz erstaunlich<br />
nahe Momente mit Menschen, die<br />
sie in der Hektik gar nicht wahrgenommen<br />
hätte. Die Informationen aus dem<br />
Innersten der Partei hingegen, die Gestaltungsmacht,<br />
die darin liegt, die fehlen<br />
ihr schon.<br />
Also hat sie sich ihren eigenen Kosmos<br />
geschaffen. Findet sich in der neuen<br />
Funktion ein. Sie versucht sich in einer<br />
Mischung aus inhaltlicher Arbeit und<br />
wohlgesetzter, zitierfähiger Polemik.<br />
Während es um die beiden anderen grünen<br />
Veteranen Claudia Roth und Jürgen<br />
Trittin öffentlich still geworden ist, legt<br />
sie Wert darauf, im Bild zu bleiben.<br />
Sie will sich weiter der Aufgabe widmen,<br />
die Arbeitsbedingungen der Textilarbeiterinnen<br />
in Bangla<strong>des</strong>ch zu verbessern.<br />
Seit ihrem Besuch im vergangenen<br />
Juli vor Ort sei ihr das zu einer „Herzensangelegenheit“<br />
geworden. Vor allem aber<br />
plant sie gerade lange Reisen, über die<br />
Ostertage war sie in Italien und im <strong>Sommer</strong><br />
fliegt sie nach Kanada. „Das ist das<br />
Jahr der Reisen“, postuliert sie so vehement,<br />
als müsse sie sich selbst noch ein<br />
bisschen überzeugen. Dann schaut sie mit<br />
ruhigem, fixierendem Blick auf, interpretiert<br />
die Pause und fragt: „Reicht Ihnen<br />
das nicht?“<br />
Jetzt wird es aber Zeit. Bevor sie den<br />
Koffer schließt, steckt sie noch Ulrich Tukurs<br />
Novelle „Die Spieluhr“ als Wochenendlektüre<br />
hinein. Auch eine Geschichte<br />
über den Wandel zwischen verschiedenen<br />
Welten.<br />
KATJA KRAUS spielte in der Fußball-<br />
Nationalelf. Ab 2003 Managerin beim<br />
Hamburger SV und erste Frau im Vorstand<br />
eines Bun<strong>des</strong>ligisten. 2011 verlor sie die<br />
Position, eine Erfahrung, die in ihren<br />
Bestseller „Macht – Geschichten von Erfolg<br />
und Scheitern“ einfloss. Seit Anfang Mai<br />
sitzt sie im Aufsichtsrat von Adidas<br />
FRAU FRIED FRAGT SICH …<br />
… was das Stöhnen über ständige<br />
Erreichbarkeit soll<br />
Ich wünschte, in meiner Jugend hätte es schon Smartphones gegeben.<br />
Dann wäre ich an Silvester 1984 nicht auf der falschen<br />
Party gelandet, wo ich um Mitternacht mit niemandem anstoßen<br />
konnte, weil ich keinen kannte. Sondern auf dieser Wahnsinnsparty,<br />
auf der alle meine Freunde waren. Dort hätte ich bestimmt<br />
den Mann meines Lebens kennengelernt. Vielleicht wäre<br />
ich mit ihm ausgewandert und hätte ein Hotelimperium aufgebaut.<br />
Vielleicht wäre ich auch eine berühmte Dokumentarfilmerin geworden<br />
– wenn der entscheidende Anruf <strong>des</strong> Produzenten mich<br />
erreicht hätte. Nicht auszudenken, was ich alles verpasst habe,<br />
weil es früher keine Handys gab! Ich bin sehr froh, dass ich heute<br />
nichts mehr verpasse, auch wenn der Aufbau eines Hotelimperiums<br />
nicht mehr zu meinen vorrangigen Zielen gehört.<br />
Das Gestöhne über die Diktatur der ständigen Erreichbarkeit<br />
geht mir auf die Nerven. Meistens dient es nur dazu, die eigene Unentbehrlichkeit<br />
zu demonstrieren. Diese Wichtigtuer führen sich<br />
auf, als wären Handy oder Laptop gefährliche, lebende Organismen,<br />
die sie verfolgen und ihnen gegen ihren Willen Nachrichten<br />
aufzwingen. Statusgeile Manager brüsten sich neuerdings damit,<br />
kein Handy mehr zu haben – dafür beuten sie lieber ihre allzeit erreichbaren<br />
Assistentinnen aus. Selbstständige tauchen ohne Vorankündigung<br />
in Urlaubsparadiese ohne WLAN ab, sodass ihre Geschäftspartner<br />
denken müssen, sie seien tot. Mein Hasssatz lautet:<br />
„Klar habe ich ein Handy, aber es ist meistens ausgeschaltet.“ Dann<br />
schmeiß es gleich weg, du Blödmann!<br />
Ich finde es super, erreichbar zu sein. Davon lebe ich als Freiberuflerin.<br />
Wenn ich meine Ruhe will, lese ich die Mails halt später<br />
oder gehe nicht ans Telefon, das ging doch früher auch. Deshalb muss<br />
ich nicht öffentlich den Rückzug ins Vor-Fax-Zeitalter propagieren.<br />
Die Unerreichbarkeitsapologeten sind wie Raucher, die gerade aufgehört<br />
haben: nervtötend militant. Weil die Sucht noch an ihnen nagt.<br />
Ich bin erreichbar, und ich will mich dafür nicht entschuldigen<br />
müssen. Smartphone und Laptop dienen mir, nicht ich ihnen. Sie erleichtern<br />
mein Leben.<br />
AMELIE FRIED ist Fernsehmoderatorin und Bestsellerautorin.<br />
Für <strong>Cicero</strong> schreibt sie über Männer, Frauen und was das Leben<br />
sonst noch an Fragen aufwirft<br />
37<br />
<strong>Cicero</strong> – 6. 2014
BERLINER REPUBLIK<br />
Gespräch<br />
„ MUT UND<br />
DEMUT RICHTIG<br />
MISCHEN “<br />
38<br />
<strong>Cicero</strong> – 6. 2014
Wolfgang Schäuble und Daniel Barenboim beherrschen<br />
die Kunst <strong>des</strong> Führens. Wie arbeiten Chefs auf Weltniveau?<br />
<strong>Der</strong> Finanzminister und der Dirigent im Gespräch über<br />
Einsamkeit und Ehrgeiz, über Oboen und die Kanzlerin<br />
Moderation CHRISTOPH SCHWENNICKE und FRANK A. MEYER
BERLINER REPUBLIK<br />
Gespräch<br />
Wolfgang Schäuble und Daniel<br />
Barenboim erscheinen zum<br />
<strong>Cicero</strong>-Foyergespräch auf der<br />
Bühne <strong>des</strong> Berliner Ensembles. Applaus.<br />
Das Haus ist voll besetzt.<br />
Herr Barenboim, Sie sind einmal mit<br />
dem Satz zitiert worden, dass der Dirigent,<br />
wenn er vor einem Orchester steht,<br />
die Hälfte der Leute gegen sich hat.<br />
Daniel Barenboim: Das hab ich nicht<br />
gesagt. Nicht mal gedacht. Was ich gesagt<br />
habe, ist: An dem Tag, an dem man sich<br />
entscheidet, Dirigent zu sein, muss man<br />
den Instinkt, immer geliebt zu werden,<br />
erst einmal weglassen. Mit dem Gedanken,<br />
geliebt zu werden, kann ein Dirigent<br />
nicht arbeiten.<br />
Herr Schäuble, ist das denn in der Politik<br />
auch so? Etwa, wenn man vor einer<br />
Fraktion sitzt – Sie haben das jahrelang<br />
als Chef der Union im Bun<strong>des</strong>tag getan.<br />
Wolfgang Schäuble: Eine Fraktion<br />
ist auf der einen Seite eine Gemeinschaft,<br />
die einen gemeinsamen Gegner<br />
hat und ein gemeinsames Ziel. Auf der<br />
anderen Seite ist die Binnenkonkurrenz<br />
sehr stark. Deswegen sagt man ja,<br />
dass die Steigerung von Feind Parteifreund<br />
ist.<br />
Wie bekommt man so eine Gruppe hinter<br />
sich?<br />
Schäuble: Ein bisschen Überzeugungskraft<br />
ist notwendig. Aber vor allen<br />
Dingen kommt es auf den Erfolg an. Solange<br />
man Erfolg hat, ist man stark. Hat<br />
man keinen, wird es schnell schwierig.<br />
Herr Barenboim, ein Orchester zu führen,<br />
ist ja eine Kunst für sich. Was können<br />
Sie Herrn Schäuble verraten von Ihrer<br />
Kunst?<br />
Barenboim: Es ist nicht der Dirigent,<br />
der den Klang produziert, sondern das<br />
Orchester. Das ist keine falsche Bescheidenheit.<br />
Ich kann das hier zeigen.<br />
Barenboim schweigt abrupt und führt<br />
einen Armstreich von oben nach unten<br />
an der Tischkante vorbei. Eine Dirigentengeste.<br />
Im Saal bleibt es völlig still.<br />
Barenboim: Hören Sie was?<br />
Das Publikum lacht gelöst.<br />
Barenboim: Das ist kein Witz. Oft<br />
vergessen das die Dirigenten. Ihr Ego<br />
steigt höher und höher. Aber ein Dirigent<br />
muss daran immer denken. Genau<br />
wie der Orchestermusiker. Auch er muss<br />
im Kopf behalten, dass er derjenige ist,<br />
der den Klang produziert. Er darf nicht<br />
passiv bleiben, nicht darauf warten, dass<br />
der Dirigent ihn animiert.<br />
Dirigent ist doch eine autoritäre Position.<br />
Eine Schiffssirene von der Spree trötet<br />
einen lang gezogenen Ton in den Saal.<br />
Barenboim: Hören Sie? <strong>Der</strong> Ton<br />
kommt von allein.<br />
Das Publikum reagiert amüsiert.<br />
Barenboim: Was heißt autoritäre Position?<br />
Wenn die erste Oboe nicht das<br />
tun kann oder will, um was ich sie bitte,<br />
wo ist dann meine Autorität? Man spricht<br />
zu viel über die psychologische Beziehung<br />
zwischen Dirigent und Orchester.<br />
Viel wichtiger finde ich die Frage: Was<br />
macht ein Dirigent? Viele Musikliebhaber<br />
verstehen eigentlich nicht, was der<br />
Dirigent macht. Die Orchester sind heutzutage<br />
so gut. Sie könnten einen großen<br />
Teil <strong>des</strong> Repertoires ohne Dirigent spielen.<br />
Die Aufgabe <strong>des</strong> Dirigenten ist es,<br />
aus 80 oder 90 Individuen eine Einheit<br />
zu machen.<br />
Fotos: Antje Berghäuser für <strong>Cicero</strong> (Seiten 38 bis 41)<br />
40<br />
<strong>Cicero</strong> – 6. 2014
Bun<strong>des</strong>tagsabgeordneter zu werden.<br />
Dann müssen Sie trotzdem gemeinsame<br />
Positionen vertreten. Das zu erreichen,<br />
ist eine Führungsaufgabe. Das kriegen<br />
Sie allein mit Autorität nicht hin. Sie<br />
müssen überzeugen. Und dann – das wird<br />
bei einem Orchester ähnlich sein – erleichtert<br />
Erfolg in der Kritik oder im Publikum<br />
die Sache.<br />
Das sind in der Politik die Leitartikel und<br />
die Meinungsumfragen.<br />
Schäuble: Natürlich sind die Unterschiede<br />
zwischen Musik und Politik groß.<br />
In einem Rundfunkinterview hat einmal<br />
ein Journalist, der gehört hatte, dass ich<br />
als Schüler eine Geige in der Hand hatte,<br />
versucht, die Gemeinsamkeit zwischen<br />
Anne-Sophie Mutter und mir zu entwickeln.<br />
Da habe ich gesagt, das ist ein grober<br />
Unsinn.<br />
Daniel Barenboim hat gesagt, einen<br />
großen Teil könnten die Musiker auch<br />
ohne Dirigenten spielen. Braucht eine<br />
bürgerliche Demokratie überhaupt Führung<br />
in der Politik?<br />
Schäuble: Führung brauchen Sie immer.<br />
Wie Sie sie herstellen, ist eine andere<br />
Frage. Sie müssen aus vielen Meinungen<br />
am Ende eine machen.<br />
Was heißt das?<br />
Barenboim: Das heißt, dass alle Musiker<br />
in dem Moment, in dem sie spielen,<br />
das Gleiche über die Musik denken.<br />
Herr Schäuble, das muss doch eine<br />
Kanzlerin im Koalitionskabinett genauso<br />
machen: Stars unter einen Hut<br />
bringen, die zum Teil sogar finden, dass<br />
sie es besser könnten. Wie schafft man<br />
das?<br />
Schäuble: Lassen wir die Koalition<br />
vielleicht einen Moment beiseite.<br />
Die Fraktion ist ein ganz gutes Beispiel:<br />
Alles Menschen, die ihre Eigeninteressen<br />
haben, auch ihre eigenen<br />
Fähigkeiten – es ist ja ein langer Weg,<br />
Maestro<br />
Daniel Barenboim wird 1942 in<br />
der argentinischen Hauptstadt<br />
Buenos Aires geboren als Sohn<br />
jüdisch-russischer Einwanderer.<br />
Am Klavier unterrichtet ihn seine<br />
Mutter, dann sein Vater. Mit<br />
sieben debütiert er als Pianist.<br />
1975 wird er Chefdirigent <strong>des</strong><br />
Orchestre de Paris, von 1991 bis<br />
2006 Chefdirigent <strong>des</strong> Chicago<br />
Symphony Orchestra. Seit 1992<br />
ist er Künstlerischer Leiter und<br />
Generalmusikdirektor der<br />
Staatsoper Unter den Linden in<br />
Berlin. Jüngstes Projekt: die<br />
Barenboim-Said-Akademie, an<br />
der Musiker aus dem Nahen<br />
Osten unterrichtet werden sollen<br />
Man könnte einfach abstimmen lassen.<br />
Schäuble: Wenn Sie Demokratie<br />
durch permanente Demoskopie ersetzen,<br />
erleben Sie ein ziemliches Desaster.<br />
Es ist ja schon eine intensive Führungsaufgabe,<br />
die relevanten Fragen überhaupt<br />
herauszuschälen. Schauen Sie sich die sozialen<br />
Netzwerke im Internet an. Daraus<br />
etwas zu machen, stelle ich mir schwierig<br />
vor. Brauchen wir jetzt einen Kindergarten?<br />
Brauchen wir die neue Straße oder<br />
nicht? Es muss ja zu irgendwas kommen.<br />
Die guten Musiker können zur Not auch<br />
so spielen. Obwohl es zu einem gemeinsamen<br />
Verständnis, zu einer gemeinsamen<br />
Interpretation <strong>des</strong> Stückes kommen<br />
muss, damit es Kunst wird.<br />
In Deutschland gibt es eine Skepsis der<br />
Führung gegenüber. Wie würden Sie<br />
Führung beschränken? Es gibt ja auch<br />
Lust an Führung, am eigenen Auftritt,<br />
an der charismatischen Wirkung. Waren<br />
Sie sich in dieser Hinsicht selber gegenüber<br />
schon mal skeptisch?<br />
41<br />
<strong>Cicero</strong> – 6. 2014
BERLINER REPUBLIK<br />
Gespräch<br />
Schäuble: Wir Deutschen haben es in<br />
der Geschichte schon einmal so übertrieben<br />
mit der Führung, dass auch die nachfolgenden<br />
Generationen geheilt sind. Was<br />
im Auftreten wichtig ist: Sie dürfen den<br />
Leuten keine Dinge versprechen, die Sie<br />
nie hinkriegen können. Auch wenn es die<br />
Leute hören wollen, sollten Sie da unbedingt<br />
sehr zurückhaltend sein, sonst sind<br />
die Leute hinterher enttäuscht.<br />
Herr Barenboim, Sie haben in Ihrem<br />
Buch „Klang ist Leben. Die Macht der<br />
Musik“ geschrieben, in der Musik gebe<br />
es ebenso wie im Leben eine unauflösbare<br />
Verbindung zwischen Tempo und<br />
Substanz. <strong>Der</strong> Osloer Friedensprozess<br />
zwischen Palästinensern und Israelis<br />
sei zum Scheitern verurteilt gewesen.<br />
Denn das Verhältnis von Zeit und Substanz,<br />
von Tempo und Inhalt habe nicht<br />
gestimmt.<br />
Barenboim: Wenn ich eine Bruckner-Symphonie<br />
dirigiere, muss ich eine<br />
strategische Idee entwickeln. Wie ich<br />
zum Beispiel mit der Dynamik umgehe,<br />
sonst habe ich alle zwölf Takte einen Höhepunkt.<br />
Das ist in der Musik genau wie<br />
in der Politik. Große Leute sind große<br />
Strategen, und die mittelmäßigen Leute<br />
sind nur Taktiker.<br />
Wie ist es heute mit den Verhandlungen<br />
zwischen Israelis und Palästinensern?<br />
Barenboim: Wir haben jetzt eine Versöhnung<br />
zwischen Fatah und Hamas. Niemand<br />
weiß, ob sie halten wird. In jedem<br />
Fall verstehe ich die israelische Regierung<br />
nicht. Sie sagt: Wir können mit Hamas<br />
keinen Frieden schließen, aber sie sollte<br />
ja nicht mit der Hamas allein verhandeln,<br />
sondern mit der gesamten palästinensischen<br />
Regierung. Dabei gibt es jetzt die<br />
Möglichkeit, dass die Palästinenser in<br />
Verhandlungen mit einer Zunge sprechen.<br />
Deswegen ist es ein strategischer Fehler,<br />
das Gespräch zu verweigern.<br />
Herr Schäuble, leben wir nicht in einer<br />
Zeit ausgeprägter Ungleichzeitigkeiten?<br />
Die Ukraine und Russland sind in einer<br />
anderen Zeit. Ist es nicht unser Problem,<br />
dass wir das nicht anerkennen?<br />
Schäuble: Jede Zeit hat ihre Probleme,<br />
von denen ihre Protagonisten immer<br />
denken, sie seien die allergrößten.<br />
Das Empfinden von Ungleichzeitigkeit<br />
Minister<br />
Wolfgang Schäuble wurde 1942<br />
in Hornberg im Schwarzwald<br />
geboren. Sein Vater, eine Zeit<br />
lang Landtagsabgeordneter,<br />
verlangt den drei Söhnen beste<br />
Leistungen ab. Wolfgang<br />
Schäuble wird Jurist und zieht<br />
schon mit 20 Jahren in den<br />
Bun<strong>des</strong>tag ein. Erster Bonner<br />
Führungsjob: Parlamentarischer<br />
Geschäftsführer der CDU/CSU.<br />
Danach Chef von Helmut Kohls<br />
Kanzleramt, Innenminister und<br />
fast ein Jahrzehnt Fraktionschef.<br />
Unter Merkel zunächst<br />
Innenminister. Seit 2009 und<br />
damit in der Eurokrise<br />
Bun<strong>des</strong>minister der Finanzen<br />
hat damit zu tun, dass wir durch die<br />
Verkehrs- und Kommunikationstechnologie<br />
ganz anders verbunden sind. Zugleich<br />
wollen wir aber von dem, was wir<br />
da erfahren, was auch so schnell erreichbar<br />
ist, nicht berührt werden. Wir in Europa<br />
müssen uns offenbar mit der Tatsache<br />
beschäftigen, dass die Abwesenheit<br />
von Gewalt auch in diesem Jahrhundert<br />
nicht so sicher ist, wie wir uns das vorgestellt<br />
haben. Wir können ja gar nicht<br />
glauben, was da in der Ukraine und in<br />
Russland stattfindet. Dabei sind es ganz<br />
alte Verhaltensmuster. 1994 hat – nicht<br />
so weit von hier entfernt im Schauspielhaus<br />
– François Mitterrand sich als französischer<br />
Präsident von Deutschland<br />
Foto: Antje Berghäuser für <strong>Cicero</strong><br />
42<br />
<strong>Cicero</strong> – 6. 2014
verabschiedet. Da hat er gesagt: „Le nationalisme<br />
c’est la guerre!“ – „<strong>Der</strong> Nationalismus,<br />
das ist der Krieg!“ Wir haben<br />
geglaubt, der Satz sei nicht mehr zeitgemäß.<br />
Jetzt beobachten wir: Kaum spielt<br />
man auf dem Klavier <strong>des</strong> Nationalismus,<br />
schon wird er überall lebendig.<br />
Mitterrand hat auch gesagt: „Man<br />
muss der Zeit Zeit lassen.“ In dem Problem<br />
Israel-Palästina bedarf es einer<br />
enormen Geduld. Muss sich die Politik<br />
hier entschleunigen?<br />
Barenboim: Das glaube ich überhaupt<br />
nicht. Im Gegenteil. Beide Seiten<br />
machen einen strategischen Fehler, indem<br />
sie denken, die Zeit arbeite für sie.<br />
Herr Schäuble, was macht es Politikern<br />
so schwer, langfristig zu denken?<br />
Schäuble: Gesellschaften, denen es<br />
einigermaßen gut geht, haben Angst vor<br />
Veränderungen. Deswegen sind kurzfristige<br />
Dinge am leichtesten durchsetzbar.<br />
Wenn du wenig machst, hast du es am<br />
leichtesten.<br />
Da fällt einem die Kanzlerin ein.<br />
Schäuble: Moment, langsam.<br />
Schauen Sie sich mal Meinungsumfragen<br />
an. Sie finden für jede Forderung<br />
nach Steuersenkungen Mehrheiten von<br />
80 Prozent. Sie finden für die Forderungen,<br />
keine neuen Schulden zu machen,<br />
80 Prozent. Sie finden für die meisten<br />
guten Aufgaben – mehr für Straßenbau,<br />
mehr für Kultur, mehr für soziale Sicherung<br />
– 80 Prozent in Meinungsumfragen.<br />
Machen Sie daraus einmal Politik.<br />
Sie müssen nur die Grundrechenarten<br />
außer Kraft setzen.<br />
Sie wollten auf Angela Merkel zu sprechen<br />
kommen.<br />
Schäuble: Daraus erklärt sich auch<br />
ein Effekt, den wir in den meisten Demokratien<br />
haben: Kaum ist eine Regierung<br />
gewählt, nimmt die Zustimmung ab.<br />
Barack Obama war wie eine Verheißung.<br />
Davon ist nicht so furchtbar viel geblieben.<br />
Die rühmenswerte Ausnahme haben<br />
Sie gerade genannt. Es ist ja nicht<br />
so schlecht, wenn man eine Gesellschaft<br />
in einer Zeit schwieriger Veränderungen<br />
zusammenhält. Uns sagen jetzt alle, wir<br />
müssten Europa führen. Wir wollen Europa<br />
gar nicht führen. De facto müssen<br />
„ Merkels Tempo?<br />
Nicht<br />
schleppend,<br />
aber auch nicht<br />
eilend. Oder<br />
nicht zu<br />
geschwind “<br />
Daniel Barenboim<br />
wir es ein ganzes Stück weit tun. Die<br />
Bun<strong>des</strong>kanzlerin macht das nicht mit<br />
markigen Reden und erklärt, was Europa<br />
jetzt unbedingt zu tun hat. <strong>Der</strong> Effekt<br />
wäre, dass Europa alles täte, nur nicht<br />
dieses. Angela Merkel führt viel effizienter<br />
als diejenigen meinen, die ihr so wie<br />
Sie Führungsschwäche vorwerfen.<br />
Wir haben nur versucht, Merkels Stil zu<br />
beschreiben.<br />
Schäuble: Ich hab auch gerade nur<br />
versucht, ihren Stil zu beschreiben.<br />
Wie würden Sie, Herr Barenboim, Angela<br />
Merkels Stil mit einem musikalischen<br />
Tempo umschreiben?<br />
Barenboim: Allegro ma non troppo.<br />
Nicht schleppend, aber auch nicht eilend.<br />
Oder nicht zu geschwind.<br />
Mögen Sie dieses politische Tempo?<br />
Barenboim: Wir sind etwas von unserem<br />
Hauptthema abgekommen. Ich<br />
möchte vielleicht einen Gedanken einführen.<br />
Ein Musiker erlebt ein ständiges<br />
Hin und Her zwischen Bescheidenheit<br />
und Selbstsicherheit. Wenn ich<br />
einen Klavierabend gebe in einem Saal<br />
von 2000 Leuten, werden Sie nicht sagen,<br />
dass ich bescheiden bin. Aber gegenüber<br />
den Stücken muss ich total bescheiden<br />
sein. So ist es auch in der Führung:<br />
Jeder Mensch, der führt, ist ein sehr einsamer<br />
Mensch. Es gibt eine Distanz zwischen<br />
dem Kollektiv und demjenigen,<br />
der die <strong>letzte</strong> Entscheidung treffen muss.<br />
Vielleicht ist der Erfolg beim Publikum<br />
die Kompensation für diese Einsamkeit.<br />
Herr Schäuble, wie kann ein Politiker die<br />
Balance zwischen dem Ego und der Demut<br />
gegenüber der Sache halten?<br />
Schäuble: Daniel Barenboim hat uns<br />
an einen Punkt gebracht, der mit dem<br />
Phänomen der Führung viel zu tun hat.<br />
Einerseits Respekt. Gegenüber jedem<br />
Künstler, der sein Instrument ja ziemlich<br />
gut beherrscht. Andererseits muss der Dirigent<br />
seine Interpretation durchsetzen<br />
und das Orchester dafür gewinnen.<br />
Ist das in der Politik auch so?<br />
Schäuble: Ein guter Minister ist nicht<br />
der, der am meisten von einem bestimmten<br />
Fach versteht. <strong>Der</strong> beste Politiker ist<br />
nicht der beste Experte. <strong>Der</strong> lässt sich<br />
im Zweifel nicht mehr fachlich beraten.<br />
Politik ist Entscheidung. Das Zusammenführen<br />
unterschiedlicher Gesichtspunkte<br />
und Interessen im richtigen Moment.<br />
Glück gehört auch dazu. Man muss<br />
sich die richtige Mischung aus Mut und<br />
Demut bewahren.<br />
Barenboim: Ein guter Musiker<br />
braucht Begabung. Diese Begabung<br />
bringt uns zu dem Punkt, wo wir wissen,<br />
dass wir ganz bescheiden sein müssen,<br />
um ein Stück zu verstehen und es aufführen<br />
zu können. Auf der anderen Seite<br />
gibt es die Ambition. Die Ambition darf<br />
nicht über die Begabung gehen. Die richtige<br />
Formel ist: Immer 15 Prozent weniger<br />
Ambition als Begabung.<br />
Herr Schäuble, wie arbeiten Sie als Finanzdirigent?<br />
Wann handeln Sie intuitiv,<br />
wann strategisch?<br />
Schäuble: Als ich Finanzminister<br />
geworden bin und über meine Rolle in<br />
Europa nachgedacht habe, habe ich mir<br />
vorgenommen, nicht nur das deutsche Interesse<br />
zu sehen. Sondern: Was könnte<br />
die richtige Lösung für Europa sein? Vielleicht<br />
hat das mit meiner Ausbildung als<br />
Jurist zu tun. Als Jurist muss man verhandeln<br />
können, und das kann man nur,<br />
wenn man den Verhandlungspartner versteht.<br />
Deswegen habe ich im Finanzministerium<br />
von Anfang an gesagt: Ich will<br />
nicht immer nur wissen, was aus Sicht<br />
unseres Ministeriums die beste Lösung<br />
wäre. Sondern zunächst mal: Was könnte<br />
für Europa die richtige Lösung sein?<br />
43<br />
<strong>Cicero</strong> – 6. 2014
BERLINER REPUBLIK<br />
Gespräch<br />
Wie haben Ihre deutschen Politikerkollegen<br />
darauf reagiert?<br />
Schäuble: In den ersten zwei Jahren<br />
hieß es: <strong>Der</strong> ist so romantisch für Europa,<br />
der vergisst, dass er der deutsche Finanzminister<br />
ist. Das haben sie in meiner eigenen<br />
Fraktion, na ja, nicht richtig gesagt,<br />
aber gedacht. Inzwischen ist den meisten<br />
klar: Die deutschen Interessen sind nicht<br />
das Gegenteil der europäischen Interessen.<br />
Dazu muss man seine Verhandlungspartner<br />
in Europa mit ihren Interessen<br />
und Überzeugungen begreifen.<br />
Barenboim: Ich finde sehr wichtig,<br />
was Herr Schäuble über das Verhandeln<br />
erzählt. Oft ist man in Verhandlungen<br />
von der eigenen Position viel zu sehr<br />
überzeugt. Man denkt: Am Ende wird<br />
der andere das einsehen. Dadurch sind<br />
auch viele Verhandlungen zwischen Israelis<br />
und Palästinensern gescheitert.<br />
Herr Barenboim, was macht für Sie einen<br />
großen Politiker aus?<br />
Barenboim: Große politische Persönlichkeiten<br />
brauchen eine Art moralischer<br />
Autorität. Die hat man oder<br />
man hat sie nicht. Es gibt sie nicht durch<br />
Wahlen, man kann sie auch nicht kaufen.<br />
Manchmal ist die Entscheidung kurzfristig<br />
sehr unpopulär. Aber wenn diese Persönlichkeit<br />
moralische Autorität besitzt,<br />
kann sie es trotzdem machen.<br />
Herr Schäuble, Sie müssten neidisch<br />
sein auf Herrn Barenboim, denn jeder<br />
Orchestermusiker hat seine Rolle und<br />
bekennt sich zu etwas Gemeinsamen.<br />
Sind wir nicht in einer Gesellschaft, in<br />
der sich das Bürgerliche auflöst? Ist es<br />
schwieriger geworden, in dieser Gesellschaft<br />
politisch zu führen?<br />
Schäuble: Das haben die Älteren immer<br />
so empfunden. Natürlich verändern<br />
sich Gesellschaften rasant. Dass immer<br />
alles schlechter wird, glaube ich nicht. Im<br />
Übrigen bezweifle ich, ob der Vergleich<br />
einer bürgerlichen Gesellschaft mit einem<br />
Orchester passt. Um in einem Orchester,<br />
das von Daniel Barenboim dirigiert<br />
wird, überhaupt dabei zu sein,<br />
müssen Sie unglaublich viel gearbeitet<br />
und geleistet haben.<br />
Das ist doch sehr bürgerlich.<br />
Schäuble: Diese Art von Anstrengung<br />
ist heute nicht mehr unbedingt im<br />
„ Sie sind einsam.<br />
Sie können<br />
falsch liegen.<br />
Aber Sie müssen<br />
entscheiden,<br />
sonst ist es ganz<br />
falsch “<br />
Wolfgang Schäuble<br />
Bürgerlichen inbegriffen. Nicht nur in der<br />
Beziehung gleicht eine Gesellschaft einem<br />
Symphonieorchester.<br />
Barenboim: Im Orchester ist die<br />
Minderheit auch immer am lautesten.<br />
Die Schlagzeuger.<br />
Schäuble: Aber irgendein Dirigent<br />
hat mir auch einmal erklärt, dass der<br />
Paukist ein wichtiger Partner <strong>des</strong> Dirigenten<br />
ist.<br />
Barenboim: Natürlich.<br />
Schäuble: Deswegen sitzt der auch<br />
immer in der Mitte. Demokratie heißt ja,<br />
zunächst einmal zu akzeptieren, dass jeder<br />
Mensch, der eine andere Meinung hat,<br />
auch recht haben kann. Das ist das, was<br />
ich Demut nenne. Ohne diese Grundbereitschaft,<br />
die andere Meinung zu akzeptieren,<br />
können Sie auch nicht führen.<br />
Die Diskussion wird fürs Publikum geöffnet,<br />
ein Mikrofon wird herumgereicht.<br />
Frage einer Zuschauerin: Ich bin aus<br />
Frankreich nach Berlin gekommen, um<br />
in einem deutsch-französischen Unternehmen<br />
zu arbeiten. Wie stehen Sie zu<br />
Regeln? Wie wichtig sind die Regeln?<br />
Schäuble: Eine sehr spannende<br />
Frage. Mit meinem französischen Kollegen<br />
habe ich schon mehrfach darüber<br />
geredet. Wir müssen uns besser verstehen<br />
darin, was Regeln sind und was nicht.<br />
Die Franzosen haben ihre Intellektualität.<br />
Französische Politiker schreiben im<br />
Schnitt mehr Bücher und auch bessere<br />
als ihre deutschen Kollegen. Sie formulieren<br />
wunderbar. Aber wenn es darum<br />
geht, das Formulierte umzusetzen, sind<br />
die Deutschen viel besser. Daraus entstehen<br />
Spannungen. Die einen müssen<br />
von den Stärken der anderen profitieren.<br />
Das andere ist: Solange wir in Europa<br />
bestimmte Entscheidungen nicht im Europäischen<br />
Parlament und einer europäischen<br />
Regierung treffen, müssen wir mit<br />
Verträgen arbeiten. Die setzen aber voraus,<br />
dass sie alle anwenden – so wie sie<br />
beschlossen sind. Da gibt es in Europa<br />
große Unterschiede.<br />
Barenboim: Ich bin jetzt in Berlin<br />
sehr glücklich, wo ich schon fast 22 Jahre<br />
arbeite. Und ich habe 15 sehr glückliche<br />
Jahre in Paris hinter mir. Einige Sätze<br />
französischer Musiker werde ich nie vergessen.<br />
1971 haben wir für die 9. Symphonie<br />
von Bruckner geprobt. Da gibt<br />
es am Anfang einen sehr schweren Einsatz<br />
von Holzbläsern. Oboe, Klarinette<br />
und Fagott. Tief und sehr leise. Es ist sehr<br />
schwer, Oboe tief und leise zu spielen.<br />
Die Probe hat viel Zeit in Anspruch genommen,<br />
wir haben mit viel Geduld an<br />
der Stelle gearbeitet. Am Ende habe ich<br />
gesagt: „Das ist wirklich schon sehr gut.<br />
Wäre es möglich, es noch leiser zu bekommen?“<br />
Da sagte die zweite Oboe:<br />
„Unmöglich ist nicht französisch.“ Mes<br />
compliments, Madame.<br />
Frage eines Zuschauers: Ich habe in den<br />
vergangenen Jahren versucht, in Berlin<br />
ein Unternehmen aufzubauen. Führen<br />
heißt ja auch, Entscheidungen zu<br />
treffen, die falsch sein können. Welche<br />
Fehler bei sich selbst haben Sie erkannt?<br />
Schäuble: Politiker machen ständig<br />
Fehler. Aber so ist unsere mediale Welt:<br />
Wenn Sie darüber reden, machen Sie einen<br />
größeren Fehler. <strong>Der</strong> größte Fehler,<br />
den man manchen kann, ist es, gar nicht<br />
zu entscheiden. Sie sind einsam. Sie müssen<br />
auch wissen, dass Sie falsch liegen<br />
können. Aber Sie müssen trotzdem entscheiden,<br />
sonst ist es ganz falsch.<br />
Barenboim: <strong>Der</strong> Mensch kann nicht<br />
funktionieren – weder emotional noch rational<br />
–, wenn er ängstlich ist. Die Angst,<br />
etwas falsch zu machen, die Angst vor<br />
dem Publikum, die Angst, auf die Bühne<br />
zu gehen. Das ist vielleicht der größte<br />
Kampf, den wir Künstler bestehen müssen,<br />
täglich.<br />
44<br />
<strong>Cicero</strong> – 6. 2014
HOCHK<br />
TIG<br />
CICERO FEIERT GROSSES JUBILÄUM<br />
ÄRA<br />
FAST GESCHENKT:<br />
DAS CICERO 10-MONATS-ABO!<br />
Feiern Sie mit <strong>Cicero</strong> 10-jähriges Jubiläum<br />
und beschenken Sie sich selbst mit 10 <strong>Cicero</strong>-<br />
Ausgaben zum Preis von 62,– Euro.<br />
Illustratoren: Miriam Migliazzi und Mart Klein<br />
10 x CICERO<br />
zum Preis von<br />
8 AUSGABEN<br />
Zum Preis von 62,– Euro statt 85,– Euro im Einzelkauf erhalten<br />
Sie insgesamt 10 Ausgaben <strong>Cicero</strong> frei Haus (zwei Ausgaben<br />
kostenlos sowie acht weitere Ausgaben zum Vorzugspreis von<br />
7,75 Euro). <strong>Der</strong> Bezug von <strong>Cicero</strong> endet dann automatisch, eine<br />
Kündigung ist nicht erforderlich.<br />
<strong>Cicero</strong>-Leserservice:<br />
Telefon: 030 3 46 46 56 56<br />
Telefax: 030 3 46 46 56 65<br />
E-Mail: abo@cicero.de<br />
Shop: cicero.de<br />
20080 Hamburg<br />
Bestellnr.: 1164086<br />
<strong>Cicero</strong><br />
10-Monats-Abo
BERLINER REPUBLIK<br />
Kommentar<br />
MISSTRAUT<br />
EUCH!<br />
Keine staatliche<br />
Institution verdient weniger<br />
Vertrauen als ein<br />
Nachrichtendienst und sein<br />
Chef. Deshalb darf<br />
auch nicht die Regierung entscheiden,<br />
was geheim<br />
bleiben muss<br />
Von<br />
FRANK A. MEYER<br />
Die Regierung der Bun<strong>des</strong>republik Deutschland<br />
beruft sich auf ein Gutachten der Washingtoner<br />
Kanzlei Rubin, Winston, Diercks,<br />
Harris & Cooke. Es sollte die Frage klären, ob der<br />
flüchtige Geheimdienstmitarbeiter Edward Snowden<br />
gemäß amerikanischer Rechtslage vor den NSA-Untersuchungsausschuss<br />
<strong>des</strong> Bun<strong>des</strong>tags nach Berlin geladen<br />
werden darf.<br />
Und Rubin, Winston, Diercks, Harris & Cooke<br />
klärten die Deutschen auf. Ihr Gutachter, der Kanzlei-<br />
Partner Jeffrey Harris, übermittelte Berlin eine Analyse<br />
mit der zwingenden Schlussfolgerung, dass sich<br />
jeder nach US-Recht schuldig mache, „der dazu beiträgt,<br />
dass Snowden gestohlene (als geheim) klassifizierte<br />
Informationen enthüllt“.<br />
America locuta, causa finita?<br />
Deutsche Bun<strong>des</strong>tagsabgeordnete würden also zu<br />
Kriminellen, wenn sie Grundrechtsverletzungen der<br />
US-Regierung in Deutschland aufzuklären suchten?<br />
Lilian Harveys zauberhafter Schlager „Das gibt’s<br />
nur einmal“ hebt an mit den Worten: „Wein ich? Lach<br />
ich? Träum ich? Wach ich?“ Ja, man ist ratlos wie der<br />
Star der Zwanziger und Dreißiger, liest man, was die<br />
Bun<strong>des</strong>regierung dem Parlament zumutet. Ihrer Legislative!<br />
<strong>Der</strong> gesetzgebenden Staatsgewalt!<br />
Ist größere Verachtung einer Regierung für das<br />
Parlament denkbar? Hat es diese Regierung doch zu<br />
kontrollieren, ist es ihr doch übergeordnet!<br />
Wie wär’s damit: Die Regierung der Bun<strong>des</strong>republik<br />
Deutschland erteilt einer Moskauer Anwaltskanzlei<br />
den Auftrag für ein Gutachten in Sachen Krim/Ukraine<br />
– und leitet deren völkerrechtliche Schlussfolgerungen<br />
als Regierungsbescheid an den Auswärtigen<br />
Ausschuss <strong>des</strong> Bun<strong>des</strong>tags weiter?<br />
Rossia locuta, causa finita!<br />
<strong>Der</strong> Fall Snowden/NSA entlarvt ein irritieren<strong>des</strong><br />
Demokratieverständnis der Regierung in Berlin: Sie<br />
will bestimmen, welche geheimen Unterlagen der untersuchenden<br />
Parlamentarierkommission zur Verfügung<br />
gestellt werden. Und ihre Weigerung, mehr als<br />
das absolute Minimum aus den Tresoren zu holen, wird<br />
begründet mit Staatssicherheit und Staatsräson.<br />
Wie ließ sich doch Verfassungsschutzpräsident<br />
Hans-Georg Maaßen vernehmen? „Wir müssen darauf<br />
achten, dass durch die Preisgabe von Informationen<br />
nicht die Sicherheit in Deutschland gefährdet wird.“<br />
Et voilà!<br />
Die unwiderruflich <strong>letzte</strong>, ewige Schutzbehauptung<br />
aller Geheimdienste, von Stasi und KGB bis BND<br />
und NSA: Wer Licht anknipst in unserer Dunkelkammer,<br />
vergeht sich an Volk und Vaterland.<br />
Maaßen nimmt den Knüppel gleich aus dem Sack:<br />
„Mit den Informationen der Amerikaner ist es uns in<br />
der Vergangenheit im Vorfeld gelungen, Terroranschlagspläne,<br />
die auf dem deutschen Boden verübt<br />
werden sollten, rechtzeitig aufzudecken.“<br />
Wer’s glaubt, zahlt einen Taler, wer’s nicht glaubt,<br />
erst recht.<br />
Seit dem Anschlag vom 11. September 2001 auf<br />
das New Yorker World Trade Center verschattet der<br />
Begriff Sicherheit den Begriff Freiheit – den fundamentalen<br />
Begriff demokratischen Bewusstseins. Und was<br />
heißt hier Schatten? Sicherheit erstickt Freiheit, immer<br />
öfter. Wie gerade jetzt im Deutschen Bun<strong>des</strong>tag.<br />
Wie herrlich aber reimt sich das Mantra Sicherheit<br />
auf das Mantra Vertrauen!<br />
Bun<strong>des</strong>nachrichtendienstchef Gerhard Schindler<br />
lässt es sich nach eigenem Bekunden angelegen sein,<br />
„unsere Vertrauensbasis in der Gesellschaft zu verbreitern“.<br />
In den USA firmiert der Schnüffelapparat<br />
unter der pathetischen Bezeichnung „Homeland Security“<br />
– Heimatschutz. Allein das Wort soll jedem<br />
kritischen Bürger den Widerspruch auf den Lippen<br />
Illustration: Anja Stiehler/Jutta Fricke Illustrators<br />
46<br />
<strong>Cicero</strong> – 6. 2014
Anzeige<br />
ersterben lassen: Wer dem Heimatschutz misstraut –<br />
misstraut der Heimat.<br />
Zum Wesen <strong>des</strong> demokratischen Rechtsstaats gehört<br />
Vertrauen nur sehr bedingt. Er ist vielmehr geboren<br />
aus Misstrauen gegenüber der Staatsgewalt.<br />
Dem Misstrauen verdanken wir Montesquieus geniales<br />
Staatsmodell der Gewaltenteilung, der „Checks<br />
and Balances“.<br />
So verdient eine Regierung zwar Vertrauen, das<br />
aber gleichzeitig über die parlamentarische Kontrolle<br />
durch Misstrauen einzuhegen ist. Ebenso wie das Parlament<br />
durch das Misstrauen – Neuwahlen und Abwahlen<br />
– <strong>des</strong> Volkes.<br />
Institutionalisiertes Misstrauen bildet die Hefe,<br />
welche die Demokratie aufgehen lässt.<br />
Wer aber verdient mehr Misstrauen als alle anderen<br />
staatlichen Institutionen? Die Geheimdienste!<br />
Sie sind der Demokratie wesensfremd, wenngleich<br />
notwendig – allerdings nie und nimmer in Ausmaß<br />
und Machtfülle, die sie heute für sich beanspruchen.<br />
Ihnen gegenüber ist grundsätzlich Misstrauen<br />
angebracht. Auch und insbesondere ihren Chefs<br />
gegenüber.<br />
Hans-Georg Maaßen mag ein vertrauenswürdiger<br />
Mensch sein, für seine Familie, seine Freunde, im zivilen<br />
Leben. Als Verfassungsschutzpräsident verdient<br />
er – Misstrauen.<br />
Bun<strong>des</strong>nachrichtendienstchef Gerhard Schindler<br />
mag die Verkörperung persönlicher und privater<br />
Vertrauenswürdigkeit sein. Als BND-Boss verdient<br />
er – Misstrauen!<br />
Angela Merkel hat die Kultur somnambulen Vertrauens<br />
zum politischen Erfolgsrezept gemacht. Ihr<br />
Schlusswort im TV-Wahlduell mit Peer Steinbrück eröffnete<br />
sie mit den schlichten Worten: „Sie kennen<br />
mich …“<br />
Bescheidener kann man nicht um Vertrauen werben.<br />
Das Buhlen um Vertrauen ist stets mit einer Prise<br />
Demut versetzt.<br />
Tugenden sind der demokratischen Sittlichkeit<br />
durchaus dienlich – und daher löblich. Dennoch ist<br />
die Demokratie nicht auf atmosphärischen Sand gebaut,<br />
vielmehr auf Überprüfung und Kontrolle, Sanktion<br />
und Abwahl. Laut Karl Popper, dem Philosophen<br />
der offenen Gesellschaft, beruht der demokratische<br />
Rechtsstaat auf Versuch und Irrtum – was Skepsis, was<br />
Misstrauen voraussetzt.<br />
Und wäre ein gewisses Restvertrauen in Deutschlands<br />
Sicherheitsbehörden noch bis vor wenigen Jahren<br />
allenfalls zu rechtfertigen gewesen, seit sich die<br />
Geheimdienste per Internet systematisch vernetzen,<br />
von Washington über London bis Berlin, ist impertinentes<br />
Misstrauen erste Bürgerpflicht.<br />
Demokratenpflicht.<br />
FRANK A. MEYER ist Journalist und Gastgeber der<br />
politischen Sendung „Vis-à-vis“ in 3sat<br />
Wenn ich mir vorstelle…<br />
Unbenannt-1 1 11.03.14 20:55<br />
dass ich nach meinem Unfall<br />
nicht mehr als Musiker hätte<br />
arbeiten können.<br />
Je<strong>des</strong> Jahr erleiden<br />
270.000 Menschen eine<br />
Schädelhirnverletzung.<br />
Viele Unfallopfer können<br />
nicht mehr sprechen, nicht<br />
mehr laufen, nicht mehr<br />
arbeiten.<br />
„Vorsorge und Vorsicht<br />
sind wichtig.<br />
Aber im Leben passieren<br />
leider auch Unfälle. Ich<br />
habe der Rehabilitation<br />
viel zu verdanken“.<br />
Stefan Tiefenbacher, Musiker<br />
Werden auch Sie aktiv und<br />
helfen Sie durch Ihre Spende!<br />
ZNS – Hannelore Kohl Stiftung<br />
Spendenkonto Sparkasse KölnBonn<br />
IBAN: DE31 3705 0198 0030 0038 00, BIC: COLSDE33<br />
www.hannelore-kohl-stiftung.de
BERLINER REPUBLIK<br />
Debatte<br />
DER PREKÄRE FRIEDEN<br />
Im Ukrainekonflikt<br />
zeigt uns Putin,<br />
dass wir die Fähigkeit<br />
zur Lan<strong>des</strong>- und<br />
Bündnisverteidigung<br />
wiederherstellen<br />
müssen. Inklusive<br />
Wehrpflicht<br />
Von KARL FELDMEYER<br />
Krieg“, das Wort hatte die politische<br />
Klasse mit dem Ende <strong>des</strong> Kalten<br />
Krieges aus ihrer Vorstellungswelt<br />
verbannt – nicht für den Rest der Welt,<br />
wohl aber für Europa. Deutschlands<br />
ehemaliger Außenminister Genscher<br />
fasste das nach dem Fall der Mauer in<br />
Deutschland entstandene neue Lebensgefühl<br />
in einem Satz zusammen: „Wir<br />
sind von Freunden umzingelt.“ Streitkräfte<br />
brauchen wir – wenn überhaupt –<br />
dann nur noch für Friedensmissionen in<br />
fernen Ländern: Afghanistan, Somalia,<br />
Mali, Zentralafrika und wer weiß, wo<br />
sonst noch, aber nicht für uns hier in Europa.<br />
Lan<strong>des</strong>verteidigung wurde zum alten<br />
Hut, den sich niemand mehr aufsetzen<br />
wollte. Da war die Aussetzung der<br />
Wehrpflicht nur eine selbstverständliche<br />
Konsequenz dieser Weltsicht, die vor allem<br />
einem entsprach: unseren Wünschen,<br />
mehr noch unserem Lebensgefühl.<br />
Argumente, die dieser Sicht entgegenstanden,<br />
hatten keine Chance. Die<br />
Mehrheit hatte beschlossen, die Erfahrungen<br />
der Vergangenheit hätten ausgedient:<br />
Vorsorge gegen Krieg, Verteidigungsfähigkeit,<br />
Wehrpflicht: Sie alle<br />
hatten keinen Platz mehr in unserer schönen<br />
neuen Welt.<br />
Dieser Traum ist ausgeträumt, und<br />
die Forderung nach Reaktivierung der<br />
Wehrpflicht wird schon geäußert, wenn<br />
auch nur vereinzelt und zum Entsetzen<br />
der meisten Zuhörer. <strong>Der</strong> Mann, der uns<br />
vom Irrtum <strong>des</strong> ewigen Friedens in Europa<br />
– ganz gegen unseren Willen – befreit<br />
hat, heißt Wladimir Putin. Was<br />
Anfang dieses Jahres als Protest der<br />
Westukraine gegen eine Rückkehr <strong>des</strong><br />
Lan<strong>des</strong> in den russischen Hegemonialbereich<br />
begann, hat die Ukraine und Europa<br />
an den Rand eines veritablen Krieges<br />
mit Russland geführt – und niemand<br />
weiß, wie lange der prekäre Frieden noch<br />
halten wird.<br />
Seit die Krim den Besitzer gewechselt<br />
hat und Putin auch seine militärische<br />
Macht einsetzt, um sich die Ukraine<br />
politisch gefügig zu machen – ja, möglicherweise<br />
sogar die politische Landkarte<br />
Osteuropas so zu zeichnen, wie sie zu<br />
Zeiten der Sowjetunion aussah –, hat unsere<br />
Gewissheit, Krieg in Europa sei kein<br />
Thema mehr, Risse bekommen. Bun<strong>des</strong>regierung<br />
und Nato haben zwar versichert,<br />
im Ukrainekonflikt komme für sie<br />
der Einsatz militärischer Mittel nicht in<br />
Betracht. Aber allein schon, dass sie sich<br />
zu einer derartigen Versicherung veranlasst<br />
sahen, verrät, dass dies nicht mehr<br />
selbstverständlich ist, denn über Selbstverständliches<br />
verliert man keine Worte.<br />
Dennoch: Zwischen der Überlegung,<br />
die Wehrpflicht zu reaktivieren, und einem<br />
entsprechenden Parlamentsbeschluss<br />
liegen Welten. Dafür gibt es viele<br />
Gründe und der wichtigste ist: Wir wollen<br />
es nicht. Nicht weil die Wehrpflicht<br />
bis zu ihrer 2011 verfügten Aussetzung<br />
in der Bevölkerung und bei den Wehrpflichtigen<br />
selbst auf Ablehnung gestoßen<br />
wäre, sondern weil ihre Reaktivierung<br />
unter den derzeitigen Umständen<br />
als das Eingeständnis einer Krise, ja einer<br />
möglichen Kriegsgefahr empfunden<br />
würde, als Beleg einer Veränderung zum<br />
Schlechten, gegen die wir uns vehement<br />
wehren.<br />
Ein weiterer Grund hat erhebliches<br />
Gewicht. Ein erstaunlich großer<br />
Teil unserer Bevölkerung bringt Putins<br />
Vorgehen Verständnis entgegen.<br />
„Putin-Versteher“ werden sie bissig genannt,<br />
und unter ihnen finden sich sogar<br />
die ehemaligen Bun<strong>des</strong>kanzler Schmidt<br />
und Schröder. Aber auch von Kohl kamen<br />
kritische Anmerkungen zu diesem<br />
Thema. Selbst ein Mann wie der ehemalige<br />
US-Außenminister Kissinger zeigt<br />
Verständnis für Putin und hebt hervor,<br />
dass die Ukraine für Russland nicht „irgendein<br />
beliebiges frem<strong>des</strong> Land“ sei,<br />
sondern die Wiege Russlands. „Russlands<br />
Geschichte begann mit der Kiewer<br />
Rus. Von hier aus verbreitete sich die russische<br />
Religion. Die Ukraine war jahrhundertelang<br />
ein Bestandteil Russlands“,<br />
erinnert Kissinger seine Leser.<br />
ES IST VERMUTLICH EINE ähnliche Sicht<br />
<strong>des</strong> Ukrainekonflikts in breiten Teilen<br />
unseres Lan<strong>des</strong>, die dazu führt, dass die<br />
Reaktionen auf die Krise in der Öffentlichkeit<br />
– und in der Wirtschaft – gelassen<br />
sind. Man bewertet dies quasi als innerrussische<br />
Angelegenheit, die einen selbst<br />
nichts angeht, bei der man Zuschauer ist<br />
und bleiben will. Dass die Politiker dies<br />
anders sehen, beunruhigt so lange nicht,<br />
wie sie ein militärisches Eingreifen ausschließen<br />
und keine Sanktionen stattfinden,<br />
die die eigenen Interessen tangieren.<br />
Man denke nur an<br />
Bun<strong>des</strong>verteidigungsminister<br />
Karl-Theodor zu Guttenberg<br />
am 15. Juni 2010 in einem<br />
Spiegel-Interview:<br />
„Die Notwendigkeit der<br />
Verteidigung an den Grenzen<br />
unseres Lan<strong>des</strong> ist doch heute<br />
schon auf ein Minimum geschrumpft.<br />
Die Strukturen der<br />
Bun<strong>des</strong>wehr atmen aber zum<br />
Teil noch den Geist <strong>des</strong> Kalten<br />
Krieges. Man hat sich bemüht,<br />
das zu ändern. Transformation<br />
hieß das. Gebracht hat es<br />
noch zu wenig. Deshalb habe<br />
ich jetzt eine Strukturkommission<br />
ins Leben gerufen. Das<br />
halte ich für das treffendere<br />
Wort. Wir müssen eben auch<br />
die Struk turen verändern.“<br />
48<br />
<strong>Cicero</strong> – 6. 2014
Illustration: Jens Bonnke<br />
49<br />
<strong>Cicero</strong> – 6. 2014
BERLINER REPUBLIK<br />
Debatte<br />
unsere wirtschaftlichen Beziehungen,<br />
die wir zu Russland – weit weniger dagegen<br />
zur Ukraine – haben und von denen<br />
rund 300 000 deutsche Arbeitsplätze<br />
abhängen.<br />
Anders sähe unsere Wirklichkeit aus,<br />
wenn Putin nicht nur nach der Ukraine<br />
greifen sollte, sondern – sollte er Erfolg<br />
damit haben – auch nach anderen Teilen<br />
der einstigen Sowjetunion. Ob und<br />
wie wir reagieren würden, wenn sich Putins<br />
Begehrlichkeit auf asiatische Staaten<br />
richten würde, die bis vor gut 30 Jahren<br />
von Moskau regiert wurden, lässt sich<br />
nicht voraussagen. Tadschikistan, Kasachstan,<br />
Usbekistan, Kirgisien – sie<br />
liegen uns fern, und selbst das ölreiche<br />
Aserbaidschan wäre uns wohl keine militärische<br />
Intervention wert.<br />
Bei den baltischen Staaten lägen die<br />
Dinge anders. Estland, Lettland, Litauen,<br />
die Hitler einst dem Zugriff der Roten<br />
Armee überließ, sind heute nicht nur Mitglieder<br />
der EU; sie sind seit 2004 Mitglieder<br />
der Nato. Sie sind aber auch Länder<br />
Bericht der Weizsäcker-Kommission<br />
zur Struktur der Bun<strong>des</strong>wehr<br />
im Mai 2000:<br />
„Die gegenwärtige Struktur der<br />
Bun<strong>des</strong>wehr ist während der vier<br />
Jahrzehnte politischer und militärischer<br />
Block-Konfrontation in<br />
Mitteleuropa entstanden. In den<br />
<strong>letzte</strong>n zehn Jahren hat es Anpassungen<br />
gegeben, nicht aber Reformen.<br />
Die politischen Verpflichtungen,<br />
die nationalen Interessen<br />
Deutschlands, die Entscheidungen<br />
der Partnerländer in Europa und<br />
die Entwicklungen in den verbündeten<br />
Streitkräften haben die Bedingungen<br />
deutscher Sicherheitsund<br />
Verteidigungs politik jedoch<br />
von Grund auf verändert.“<br />
Bericht der Weise-Kommission<br />
zur Struktur der Bun<strong>des</strong>wehr im<br />
Oktober 2010:<br />
„Das Ende <strong>des</strong> Kalten Krieges<br />
und der Fall der Mauer haben<br />
einen unvorhergesehenen Gewinn<br />
an Sicherheit für Deutschland<br />
gebracht. Deutschland ist<br />
heute umgeben von Partnern,<br />
viele der ehemaligen potenziellen<br />
Gegner sind heute Mitglieder<br />
in EU und NATO.“<br />
mit einer starken russischen Bevölkerung,<br />
deren Loyalität fraglich ist. In Estland<br />
sind 25 Prozent der Bevölkerung Russen.<br />
In Lettland leben 300 000 „Nichtbürger“,<br />
nämlich Russen, die die Annahme<br />
eines lettischen Passes verweigern. Was<br />
geschähe, wenn sie Putin zur Hilfe riefen?<br />
Ohne das Eingreifen der Nato würden<br />
diese Staaten wie 1940 Moskaus Opfer.<br />
Deshalb wäre Bündnissolidarität im<br />
Falle einer russischen Militäraktion eine<br />
Frage von Selbstbehauptung oder Scheitern;<br />
nicht nur für die baltischen Staaten,<br />
sondern für die Nato insgesamt. Putin<br />
hätte dann zwei Fliegen auf einmal<br />
erschlagen.<br />
Natürlich wäre ein russischer Angriff<br />
auf Estland, Lettland oder Litauen<br />
nackter Wahnsinn – für uns, aber auch<br />
für Russland. Nur: Wer kann garantieren,<br />
dass Wahnsinn nicht wieder stattfindet?<br />
Es wäre ja nicht das erste Mal. In der<br />
Anfangsphase wäre Putin zweifellos im<br />
Vorteil, denn was könnte die Nato fürs<br />
Erste aufbringen? Die Kräfte der baltischen<br />
Staaten sind zu vernachlässigen;<br />
Polen hat drei mechanisierte Divisionen,<br />
das deutsche Heer ist von einst zwölf Divisionen<br />
und 36 Brigaden auf zwei gepanzerte<br />
Divisionen und eine luftbewegliche<br />
Division aus Fallschirmjägern<br />
und Hubschraubern geschrumpft. Hinzu<br />
käme das, was Amerika zu stellen bereit<br />
wäre – und das ist ungewiss. Ob Frankreich<br />
dabei wäre, bliebe abzuwarten. Als<br />
es bis 1989 um die Verteidigung der Bun<strong>des</strong>republik<br />
ging, verweigerte sich Frankreich.<br />
Die Bun<strong>des</strong>republik war für Paris<br />
nur Glacis.<br />
Wer diese Zahlen liest, muss bedenken,<br />
dass Putin auf eine Armee von etwa<br />
einer Million Soldaten zurückgreifen<br />
könnte, darunter die 76. Sturmgruppe in<br />
Pskow (Pleskau) am Peipus‐See direkt an<br />
der Grenze mit Estland. Bis zur Universitätsstadt<br />
Tartu (Dorpat) würde dieser<br />
Eliteverband nur Minuten fliegen müssen<br />
und bis zur Hauptstadt Tallin (Reval)<br />
keine Stunde. Das zeigt: Helfen kann nur,<br />
was fertig ist, also einsatzbereit.<br />
Mit der direkten militärischen Bedrohung<br />
<strong>des</strong> Baltikums könnte der Augenblick<br />
gekommen sein, an dem hierzulande<br />
das politische Klima umschlagen<br />
würde und eine Mehrheit für die Rückkehr<br />
zur Wehrpflicht zustande käme,<br />
auch wenn das für den Ausgang <strong>des</strong> dann<br />
angelaufenen Konflikts ohne Bedeutung<br />
bleiben würde. Von <strong>Cicero</strong> und Martial<br />
stammt der einst viel zitierte Satz: „Si<br />
vis pacem, para bellum“ – „Wenn du den<br />
Frieden willst, musst du zum Krieg rüsten.“<br />
<strong>Der</strong> Satz müsste in diesem Fall für<br />
die Nato und ihre Mitglieder, zum Beispiel<br />
für Deutschland, um das Adjektiv<br />
rechtzeitig ergänzt werden. Wehrpflichtige<br />
dann einzuberufen, wenn<br />
die Hütte brennt, wäre, mit Verlaub,<br />
schwachsinnig.<br />
WAS ERGIBT SICH aus dieser Einsicht?<br />
Wenn die westliche Welt, die Nato als<br />
Ganzes, insbesondere wir und unsere<br />
Nato-Nachbarn es mit unserer Selbstbehauptung<br />
ernst meinen, dann müssen<br />
wir unsere Fähigkeit zur Lan<strong>des</strong>- und zur<br />
Bündnisverteidigung wiederherstellen –<br />
und zwar nicht nur vorübergehend, weil<br />
eine akute Gefahr droht, sondern auf<br />
Dauer als Konsequenz unserer Einsicht,<br />
dass es zum Wesen von Gefahren gehört,<br />
dass sie unerwartet kommen. Die Reaktivierung<br />
der Wehrpflicht allein aber kann<br />
nichts richten. Dazu ist eine Fülle von<br />
Maßnahmen erforderlich, insbesondere<br />
eine neue Ausrüstung, denn die alte hat<br />
die Bun<strong>des</strong>wehr verschenkt, verkauft,<br />
verschrottet.<br />
Putin hat öffentlich den Anspruch<br />
verkündet, künftig überall dort zu intervenieren,<br />
wo die Rechte von Russen –<br />
seiner Meinung nach – verletzt werden.<br />
Tut er das, so setzt er sich über das Völkerrecht<br />
und seine Verpflichtung hinweg,<br />
sich nicht in innere Angelegenheiten anderer<br />
Staaten einzumischen. Damit wird<br />
er zu einer Bedrohung und unkalkulierbaren<br />
Größe der internationalen Politik.<br />
Darauf muss man sich einstellen. Es gibt<br />
keine vernünftige Alternative zur Wiederherstellung<br />
der Fähigkeit, sich und die<br />
anderen Nato-Mitglieder verteidigen zu<br />
können. Dazu ist die Wiederherstellung<br />
<strong>des</strong>sen nötig, was die Nato bis 1991 in<br />
die Lage versetzte, den Kalten Krieg erfolgreich<br />
zu bestehen, die Wehrpflicht<br />
eingeschlossen.<br />
KARL FELDMEYER, lange Jahre<br />
Korrespondent der Frankfurter<br />
Allgemeinen Zeitung, war<br />
Doyen der sicherheitspolitischen<br />
Berichterstattung<br />
Foto: Privat<br />
50<br />
<strong>Cicero</strong> – 6. 2014
WELTBÜHNE<br />
„ Obama fehlte es an<br />
politischer Erfahrung.<br />
Er war nicht in der<br />
Lage, die Macht zu<br />
nutzen, die er als<br />
Präsident hat “<br />
George Packer, einer der profiliertesten politischen Journalisten der USA, stellt dem<br />
amerikanischen Präsidenten ein verheeren<strong>des</strong> Zeugnis aus, Interview ab Seite 58<br />
51<br />
<strong>Cicero</strong> – 6. 2014
WELTBÜHNE<br />
Porträt<br />
DER LEISETRETER<br />
Die Nato bekommt einen neuen Generalsekretär, und der russische Präsident Wladimir<br />
Putin ist verzückt. Jens Stoltenberg dürfte es freuen, gilt er doch als großer Versöhner<br />
Von GUNNAR HERRMANN<br />
Foto: Berlingske/Nissen/Laif<br />
Lob aus dem Kreml bekommt die<br />
Nato derzeit eher selten. Aber nachdem<br />
das Verteidigungsbündnis vor<br />
einigen Wochen erklärte, dass Norwegens<br />
Ex-Premier Jens Stoltenberg ab Oktober<br />
als Generalsekretär ins Brüsseler<br />
Hauptquartier wechselt, klang Wladimir<br />
Putin geradezu verzückt. Ein seriöser<br />
und verantwortungsvoller Mann sei das,<br />
mit dem er einen sehr guten, auch persönlichen<br />
Kontakt pflege, sagte der russische<br />
Präsident. Er machte klar, dass Stoltenberg<br />
ihm lieber sei als der derzeitige<br />
Amtsinhaber Anders Fogh Rasmussen.<br />
Wenn ein Staatschef, der von der<br />
Nato zurzeit eher als Gegner denn als<br />
Partner betrachtet wird, sich so offen<br />
freut, könnte das Misstrauen erregen.<br />
Aber bei dieser Personalie sind westliche<br />
Politiker, Generäle, Journalisten und Putin<br />
offenbar einer Meinung: Stoltenbergs<br />
Ernennung wurde von den großen Nato-<br />
Ländern ebenso unterstützt wie von den<br />
Medien positiv kommentiert.<br />
Alle scheinen den neuen Chef im<br />
Brüsseler Hauptquartier zu mögen. Und<br />
viele scheinen ihn vor allem <strong>des</strong>halb zu<br />
mögen, weil er so anders ist als sein Vorgänger.<br />
Dabei haben der scheidende und<br />
der werdende Generalsekretär auf den<br />
ersten Blick einiges gemeinsam: Beide<br />
kommen aus Skandinavien, waren Regierungschefs<br />
und sind bekannt geworden,<br />
als sie ihre Länder durch schwere<br />
Krisen führten, die auch sicherheitspolitische<br />
Krisen waren. <strong>Der</strong> Däne Rasmussen<br />
rückte während <strong>des</strong> Streits um die<br />
Mohammed-Karikaturen, die 2005 in der<br />
dänischen Tageszeitung Jyllands-Posten<br />
erschienen waren, ins Blickfeld der internationalen<br />
Öffentlichkeit, Stoltenberg<br />
nach den Terroranschlägen von Oslo und<br />
Utøya. Und doch erkennt man bei genauerem<br />
Hinsehen zwei Persönlichkeiten,<br />
die verschiedener kaum sein können.<br />
<strong>Der</strong> rechtsliberale Rasmussen arbeitete<br />
sich einst aus kleinen Verhältnissen<br />
an die Spitze der dänischen Politik, wo<br />
er von seinen Anhängern verehrt und<br />
von seinen Gegnern gehasst wurde. In<br />
der Außenpolitik gilt er als „Falke“, wegen<br />
seiner manchmal aggressiven Tonlage,<br />
aber auch weil er sich im Irakkrieg<br />
an die Seite von US-Präsident George<br />
W. Bush stellte. Er war immer ein Politiker,<br />
der gerne polarisiert und poltert.<br />
Was er auch jetzt bewies, wenn er in Interviews<br />
zur Ukrainekrise Russland mit<br />
Sanktionen, Abschreckung und Aufrüstung<br />
drohte.<br />
MIT JENS STOLTENBERG dürfte der Ton<br />
milder werden. Er ist ein geborener Diplomat,<br />
und das ist durchaus im Wortsinn<br />
zu verstehen. Sein Vater Thorvald Stoltenberg<br />
diente Norwegen als Botschafter<br />
und als Außenminister. Sohn Jens verbrachte<br />
große Teile seiner Kindheit im<br />
Ausland. Als Jugendlicher ging er zur sozialdemokratischen<br />
Arbeiterpartei, um<br />
in Papas Fußstapfen zu treten.<br />
Auch die Ernennung zum Nato-Generalsekretär<br />
hat er in gewisser Weise<br />
seinem Vater zu verdanken. Denn Stoltenberg<br />
senior hatte sich als Außenminister<br />
besonders um bessere Beziehungen<br />
zu Russland in der Grenzregion an der<br />
Barentssee gekümmert. Stoltenberg junior<br />
hat das Projekt als Ministerpräsident<br />
fortgeführt und mit einem diplomatischen<br />
Sieg gekrönt: Russland und Norwegen<br />
beendeten 2010 überraschend ihren<br />
jahrzehntealten Streit um ein Stückchen<br />
Eismeer, in dem große Erdgasvorkommen<br />
vermutet werden.<br />
Die Einigung gilt nun als Beleg dafür,<br />
dass er der richtige Mann ist für<br />
schwierige Verhandlungen mit Moskau,<br />
auf die sich die Nato wegen der Krisen<br />
in der Ukraine und Syrien einstellen<br />
muss. Dass ihn sogar Freundschaft mit<br />
dem russischen Präsidenten verbindet,<br />
hat Stoltenberg allerdings nicht bestätigt.<br />
„Wir haben ein gutes Arbeitsverhältnis“,<br />
kommentierte er Putins Äußerungen.<br />
So knappe Formulierungen sind<br />
typisch für den 55-Jährigen.<br />
Seinen Aufstieg hat Jens Stoltenberg<br />
vor allem seinem Ruf als fleißiger Sachpolitiker<br />
zu verdanken. Er studierte Wirtschaftswissenschaften<br />
und arbeitete im<br />
Statistikamt, bevor er sich als Finanzpolitiker<br />
profilierte. Das klingt spröde, und<br />
genauso wirkte es auch auf viele Norweger:<br />
Übermäßige Popularität zählte lange<br />
nicht zu Stoltenbergs Stärken.<br />
Das änderte sich erst nach den Terroranschlägen<br />
von Oslo und Utøya im<br />
Jahr 2011. In den Wochen nach dem Massenmord<br />
war der Regierungschef mit seinem<br />
nüchternen und doch mitfühlenden<br />
Politikstil ein Ruhepol, um den sich ein<br />
geschocktes Land sammeln konnte.<br />
Dennoch: So richtig volksnah wirkte<br />
der sachliche Diplomatensohn nie. Obwohl<br />
er sich stets darum bemühte. So<br />
konnten die Norweger ihren Regierungschef<br />
zuweilen verschwitzt auf einem<br />
Mountainbike durchs Gelände radeln<br />
sehen. Im jüngsten Wahlkampf (den er<br />
verlor) fuhr er sogar selbst ein Taxi, um<br />
mit Bürgern ins Gespräch zu kommen.<br />
Dass ein Nato-Generalsekretär sich<br />
solche Freiheiten bewahren kann, darf<br />
man bezweifeln. Beim Radfahren werde<br />
er wohl umdenken müssen, sagt Stoltenberg.<br />
In Brüssel gebe es für sein Mountainbike<br />
nicht genug Schotterwege. Er<br />
wolle jetzt aufs Rennrad umsatteln.<br />
GUNNAR HERRMANN war Nordeuropakorrespondent<br />
der Süddeutschen Zeitung.<br />
Er traf Jens Stoltenberg zum ersten Mal im<br />
<strong>Sommer</strong> 2006 im Stadtpark von Kirkenes<br />
neben einer Büste seines Vaters Thorvald<br />
53<br />
<strong>Cicero</strong> – 6. 2014
WELTBÜHNE<br />
Porträt<br />
PUTINS ALBTRAUM<br />
Russland oder EU? Vor der Frage steht die Republik Moldau. Natalia Morar ist dort eine<br />
Meinungsführerin. Sie hat sich den russischen Staatschef schon Mal zum Feind gemacht<br />
Von OLIVER BILGER<br />
Nationales Sicherheitsrisiko. Kreml-<br />
Gegnerin. Persona non grata in<br />
Russland. Diese Begriffe wollen<br />
nicht so recht passen zu der zierlichen<br />
jungen Frau. Doch all das war Natalia<br />
Morar schon mal, im Winter 2007.<br />
Morar, damals erst 23 Jahre alt,<br />
hatte sich mächtige Feinde gemacht: die<br />
Clique um Russlands Präsidenten Wladimir<br />
Putin. Als wäre das nicht genug,<br />
entfesselte die Journalistin zwei Jahre<br />
später einen Proteststurm gegen die Regierung<br />
der Republik Moldau, ihrer Heimat.<br />
Heute ist sie Fernsehmoderatorin,<br />
betreibt ein Café und beobachtet mit klarem<br />
Blick die Entwicklungen ihres Lan<strong>des</strong>.<br />
Ihre Stimme ist wieder gefragt. Ost<br />
oder West? Das ist die große Frage in der<br />
kleinen Republik zwischen der Ukraine<br />
und Rumänien. Dabei gehe es den Menschen<br />
vor allem um eines, sagt Morar<br />
heute: „Sie wollen ein besseres Leben.“<br />
Aber der Reihe nach. Im Dezember<br />
2007 kehrt Morar von einer Dienstreise<br />
zurück nach Moskau. Seit sechs Jahren<br />
lebt die gebürtige Moldauerin in der<br />
russischen Hauptstadt. Sie hat dort Soziologie<br />
studiert, es läuft ein Antrag auf<br />
die russische Staatsbürgerschaft. Neben<br />
der Uni arbeitete die junge Frau für die<br />
Stiftung von Putin-Gegner Michail Chodorkowski<br />
und das Oppositionsbündnis<br />
„Anderes Russland“. Und sie berichtet für<br />
das russische Magazin The New Times<br />
kritisch über Korruption, den Geheimdienst<br />
FSB und anlässlich der Parlamentswahl<br />
2007 über dubiose Finanzströme<br />
<strong>des</strong> Kreml – Tabuthemen in Russland.<br />
Am Flughafen endet ihr russisches<br />
Leben: Die dem FSB unterstellten Grenzbeamten<br />
lassen die Journalistin nicht<br />
mehr ins Land, es folgt die Ablehnung<br />
von Morars Gesuch auf Staatsbürgerschaft<br />
mit dem Verweis auf eine mögliche<br />
Bedrohung für den Staat. Das mächtige<br />
Russland sieht in der jungen, grazilen Frau<br />
eine Gefahr für die nationale Sicherheit.<br />
Also kehrt die Verstoßene zurück in<br />
ihre Heimat Moldau – und sorgt dort erneut<br />
für Aufsehen. Im April 2009 legt<br />
sie sich mit den regierenden Kommunisten<br />
in der Hauptstadt Chisinau an. Morar<br />
und Mitstreiter einer Oppositionsbewegung<br />
rufen über Twitter zum Protest gegen<br />
die Parlamentswahl auf. Morar rechnet<br />
mit 300 Teilnehmern. Es kommen<br />
schließlich 15 000 Menschen, die den<br />
Kommunisten Wahlfälschung vorwerfen.<br />
DER PROTEST GERÄT außer Kontrolle,<br />
Demonstranten stürmen das Parlament,<br />
es gibt Ver<strong>letzte</strong> und Tote. Morar distanziert<br />
sich von der Gewalt. Sie habe „die<br />
Wut der Menschen unterschätzt“, erklärt<br />
die Aktivistin später. Die Behörden wollen<br />
sie vor Gericht stellen. Das Wahlergebnis<br />
wird bestätigt, doch die Regierung<br />
scheitert wenig später beim Versuch, einen<br />
Präsidenten zu wählen. Eine proeuropäische<br />
Koalition gewinnt die Neuwahlen<br />
und lässt alle Anschuldigungen gegen<br />
Morar fallen. Bis heute kann sich die Regierung<br />
an der Macht halten.<br />
Heute moderiert die 30-Jährige eine<br />
Talkshow im moldauischen Fernsehen. Es<br />
geht, wie sollte es bei ihr anders sein, um<br />
Politik. Morar diskutiert energisch mit<br />
der Elite <strong>des</strong> Lan<strong>des</strong> – und zementiert<br />
ihre Meinungsführerschaft.<br />
Im Herbst wählt Moldau ein neues<br />
Parlament, und die russlandfreundlichen<br />
Kommunisten haben gute Chancen, die<br />
proeuropäische Koalition abzulösen.<br />
Dass die regierende „Allianz für europäische<br />
Integration“ beim Kampf gegen<br />
die Korruption versagt, sei „die größte<br />
Enttäuschung für die Menschen“, sagt<br />
Morar. Die Koalition habe kaum etwas<br />
erreicht, verkaufe nur den Traum von<br />
der EU-Mitgliedschaft. „Heute wissen<br />
wir, dass es in einigen Bereichen so war<br />
wie unter den Kommunisten, wenn nicht<br />
sogar schlechter.“ Aber das Land warte<br />
auf Fortschritte: weniger Armut, neue<br />
Jobs, bessere medizinische Versorgung.<br />
Moldau ist hin- und hergerissen zwischen<br />
Ost und West. In den kommenden<br />
Wochen wollen Chisinau und Brüssel ein<br />
Assoziierungsabkommen unterzeichnen.<br />
Ein solches hatte den Konflikt in der Ukraine<br />
ausgelöst. Moldaus Regierung fährt<br />
einen klaren Europakurs, Russland aber<br />
will die ehemalige Sowjetrepublik nicht<br />
aus seiner Einflusssphäre lassen, droht<br />
mit Konsequenzen. Gleichzeitig hofft<br />
die abtrünnige Region Transnistrien auf<br />
die Abspaltung von Moldau und, wie die<br />
Krim, den Anschluss an Russland. Das<br />
besorgt viele im Land.<br />
Näher ran an Europa will auch Morar.<br />
Allerdings sollte Moldau ihrer Ansicht<br />
nach nicht radikal werden gegenüber<br />
Russland. „Die russischen Interessen in<br />
der Region können wir nicht völlig vermeiden<br />
und ignorieren.“<br />
Was geschieht mit dem Westkurs <strong>des</strong><br />
Lan<strong>des</strong>, wenn die Kommunisten gewinnen?<br />
Morar glaubt nicht, dass dann der<br />
Europakurs stoppt. „Nach dem Krimreferendum<br />
können die Kommunisten<br />
nicht mehr für die Zollunion mit Russland<br />
werben“, erklärt sie. „Russland<br />
kann nicht als stabiler Partner gesehen<br />
werden. Russland macht, was es will und<br />
wann es will.“ Putin entwickele sich immer<br />
mehr zu einem Diktator.<br />
Nach Russland darf Morar seit 2012<br />
wieder einreisen. Dreimal war sie seitdem<br />
dort. Nach Moskau will sie aber<br />
nicht mehr zurück.<br />
OLIVER BILGER, freier Journalist in<br />
Moskau, lebt zurzeit in der Republik Moldau.<br />
Über Morar hat er 2007 erstmals berichtet<br />
und ist von ihrer Courage beeindruckt<br />
Foto: Ramin Mazur/n-ost für <strong>Cicero</strong><br />
54<br />
<strong>Cicero</strong> – 6. 2014
WELTBÜHNE<br />
Porträt<br />
AUFRECHTEN GANGES<br />
Eben noch galt der Schweizer Außenminister Didier Burkhalter als eitler Gockel. Nun<br />
vermittelt er in der Ukrainekrise und zeigt, dass er die Kunst der Diplomatie beherrscht<br />
Von PETER HOSSLI<br />
Haare und Schuppen bedrohen<br />
sensible Geräte. Deshalb tragen<br />
alle Besucher im Nano-Forschungszentrum<br />
der IBM im schweizerischen<br />
Rüschlikon sterile Hauben. Nur<br />
einer ziert sich: Didier Burkhalter. Keinesfalls<br />
will der Schweizer Bun<strong>des</strong>rat mit<br />
der Kopfbedeckung fotografiert werden.<br />
Ulkig sähe das aus, weiß er, und betritt<br />
das Labor als Einziger oben ohne.<br />
Die Episode, vorgefallen vor drei<br />
Jahren, stempelte Burkhalter zum eitlen<br />
Gockel. Zum abgehobenen Politiker, angetan<br />
einzig von sich selbst. Da war er<br />
bereits angezählt. Eben erst war er vom<br />
Innen- ins Außenministerium gewechselt.<br />
Geflüchtet sei er, weil er nichts bewegt<br />
habe. Das sagten nicht nur Gegner,<br />
sondern Mitglieder der eigenen Partei,<br />
der FDP.<br />
Burkhalter? Wohl gescheitert.<br />
Heute gilt der amtierende Schweizer<br />
Bun<strong>des</strong>präsident als Glücksfall. Er ist ein<br />
neuer Star auf der Weltbühne. Als Vorsitzender<br />
der Organisation für Sicherheit<br />
und Zusammenarbeit in Europa,<br />
kurz OSZE, zieht er in der Ukrainekrise<br />
diplomatisch die Fäden. Mit dem russischen<br />
Präsidenten Wladimir Putin trifft<br />
sich Burkhalter – und erntet dafür Lob.<br />
Selbstsicher begegnet der Schweizer<br />
dem Russen. Als einer, der keinen Bückling<br />
macht vor dem Mächtigen in Moskau,<br />
sich keine Blöße gibt. Weltweit verschafft<br />
sich Burkhalter Gehör. Warnt er<br />
vor neuen Sanktionen gegen Russland,<br />
horchen EU und USA auf. Gern gesehener<br />
Gast ist er in Paris, Brüssel und Berlin.<br />
Es sei „ein Glücksfall, dass die<br />
Schweiz derzeit den OSZE-Vorsitz innehat“,<br />
sagt der deutsche Altbun<strong>des</strong>kanzler<br />
Gerhard Schröder. „Die Schweiz hat das<br />
Vertrauen aller Seiten, und das kann man<br />
in der jetzigen Konfliktsituation nicht<br />
hoch genug schätzen.“<br />
Burkhalter belebt damit nicht<br />
nur seine eigene Karriere. Er rückt<br />
die seit Ende <strong>des</strong> Kalten Krieges geschwächte<br />
schweizerische Diplomatie<br />
zurück ins Rampenlicht. Die jüngst<br />
noch verschmähte Neutralität ist wieder<br />
salonfähig.<br />
BURKHALTER BEHERRSCHT die Kunst<br />
der stillen Diplomatie. Er weiß: Oft entscheiden<br />
winzige Details eine Verhandlung.<br />
Auf einer Syrienkonferenz in Genf<br />
servierte er Wein aus dem Dorf, in dem<br />
er aufwuchs. Bei der Tischrede fragte er,<br />
wie der heimatliche Wein denn munde –<br />
und brach damit das Eis zwischen gereizten<br />
Russen und nervösen Amerikanern.<br />
„Alle sagten, er hätte ihnen geschmeckt“,<br />
erzählt er später. Allerdings: „Die Amerikaner<br />
tranken Coca-Cola.“ Was er geahnt<br />
hatte – eigens für die US-Delegation<br />
ließ er braune Brause auf Eis legen.<br />
Burkhalter, 54, wuchs in der französischsprachigen<br />
Schweiz in Neuenburg<br />
auf. Er studierte Volkswirtschaft, politisierte<br />
auf dem Dorf, in der Stadt, im Kanton,<br />
beim Bund. Auf dem Fußballfeld war<br />
er der Libero.<br />
Von 2009 an ist er Mitglied <strong>des</strong> Bun<strong>des</strong>rats,<br />
der siebenköpfigen Schweizer<br />
Regierung, in der je<strong>des</strong> Jahr ein anderer<br />
als Bun<strong>des</strong>präsident den Vorsitz führt.<br />
Burkhalter ist zunächst Innenminister,<br />
ein mächtiges Ressort, aber er bleibt farblos.<br />
Nach zwei Jahren wechselt er ins Außenamt,<br />
obwohl dieses an Glanz verloren<br />
hat und im eigenen Land wenig gilt.<br />
Was er als Chance sieht. Er besinnt<br />
sich auf die Tugenden der Schweizer Diplomatie.<br />
Vermittelt im Hintergrund. Tritt<br />
höflich auf. Agiert aber bestimmt.<br />
Er setzt Schwerpunkte, um Wirkung<br />
zu erzeugen. Den Krieg in Syrien. Die<br />
Annäherung zwischen den USA und dem<br />
Iran. Und ja, Russland.<br />
Bewusst besucht er die Olympischen<br />
Spiele in Sotschi, geht nie auf Distanz zu<br />
Moskau. Er telefoniert mit Putin. Fliegt<br />
zu Putin. Telefoniert wieder.<br />
Makellos sieht er immer noch aus.<br />
Die Anzüge sitzen, die Krawatten sind<br />
modischer geworden. Spricht er Deutsch,<br />
wirkt er entwaffnend freundlich – und<br />
beißt umso härter zu.<br />
Oft reist er mit seiner Frau, der Vorarlbergerin<br />
Friedrun Burkhalter. Händchenhaltend<br />
schreitet das Paar Paraden<br />
ab, was ungewöhnlich ist in der<br />
Diplomatie, und für Aufsehen sorgt. Sie<br />
war 16 Jahre alt, er 24, als sie sich in England<br />
trafen. Heute haben sie drei Söhne<br />
und küssen sich zuweilen öffentlich innig.<br />
Die Anerkennung draußen in der<br />
Welt stärkt Burkhalter daheim. Als Außenminister<br />
soll er die für die Schweiz<br />
entscheidende Frage klären: Wie steht<br />
das Alpenland zu Europa?<br />
Am 9. Februar fiel die Schweiz in<br />
eine Schockstarre. Das Volk stimmte<br />
dafür, die Zuwanderung von EU-Bürgern<br />
zu beschränken. Statt sich zu grämen,<br />
reiste Burkhalter sofort nach Brüssel<br />
und begann zu erklären.<br />
Zu Hause regte er an, die Schweizer<br />
sollten 2016 darüber befinden, ob sie<br />
den bilateralen Weg mit Europa weiterhin<br />
beschreiten wollen. Er selbst will das<br />
Land näher an die EU führen. Damit ist<br />
er direkter Gegenspieler von Christoph<br />
Blocher von der Schweizerischen Volkspartei.<br />
<strong>Der</strong> trat jüngst als Parlamentarier<br />
zurück, um Burkhalter mit Volksinitiativen<br />
und Referenden zu kontern.<br />
<strong>Der</strong> Außenminister nimmt das gelassen.<br />
Wer Putin gewachsen ist, muss Blocher<br />
nicht fürchten.<br />
PETER HOSSLI ist Chefautor der<br />
Schweizer Blick-Gruppe<br />
Foto: Gaetan Bally/Keystone Schweiz/Laif<br />
56<br />
<strong>Cicero</strong> – 6. 2014
MÄCHTIG<br />
Aus Geld machen sie<br />
Einfluss, aus dem Einfluss<br />
wiederum Geld. Wenn<br />
es um Russland und<br />
die Ukraine geht, geht es<br />
um die Oligarchen.<br />
Hier sind die zehn, die<br />
man kennen sollte<br />
REICH<br />
Von MORITZ GATHMANN und MAXIM KIREEV<br />
58<br />
<strong>Cicero</strong> – 6. 2014
WELTBÜHNE<br />
Hintergrund<br />
Fotos: Jeremy Nicholl/Laif, Hermann Bredehorst, Action Press<br />
Michail Chodorkowski hat am eigenen Leib erfahren,<br />
was es bedeutet, sich mit Putin anzulegen<br />
MICHAIL CHODORKOWSKI<br />
DER ABGESTRAFTE<br />
Es war der 25. Oktober 2003, als die Epoche<br />
der Oligarchen in Russland ziemlich abrupt<br />
endete. Noch Ende der Neunziger galten<br />
die Herren über Russlands Wirtschaft als<br />
mächtig und unantastbar, anders als die gewählten<br />
Politiker. Doch an diesem Tag stürmten<br />
maskierte Polizisten den Privatjet <strong>des</strong><br />
Ölmagnaten Michail Chodorkowski am Flughafen<br />
in Nowosibirsk. Wenig später wurde<br />
Chodorkowski, den sein Unternehmen Yukos<br />
zum reichsten Russen mit einem geschätzten<br />
Vermögen von etwa 15 Milliarden Dollar gemacht<br />
hatte, der Prozess gemacht.<br />
Offiziell lautete die Anklage auf Steuerhinterziehung.<br />
Doch im Grunde war klar:<br />
Chodorkowski ist Putin zu widerspenstig geworden.<br />
Während Chodorkowski noch vor<br />
Gericht stand, begann der blitzschnelle Aufstieg<br />
von Igor Setschin, der damals stellvertretender<br />
Leiter der Präsidentenadministration<br />
war und öffentlich kaum bekannt.<br />
Wer als vermeintlicher Oligarch heute<br />
in der Politik mitmischen will, der kann dies<br />
nur auf Chodorkowskis Art tun – mit großem<br />
Sicherheitsabstand zu Moskau. Seit seiner<br />
Freilassung aus dem Straflager nach einer<br />
zehnjährigen Haft lebt der 50-Jährige<br />
im Ausland. Im März lud der einstige Ölmagnat<br />
die Moskauer liberale Intelligenzia<br />
nach Kiew zu einem Forum mit Vertretern<br />
der ukrainischen Elite. In der ukrainischen<br />
Hauptstadt versuchte er sich als Conférencier<br />
eines „anderen“ Russlands, das sich der<br />
aggressiven Haltung <strong>des</strong> Kremls gegenüber<br />
dem Nachbarland widersetzt.<br />
IGOR SETSCHIN<br />
PUTINS PUDEL<br />
Neun Monate nach Michail Chodorkowskis Festnahme wird Igor Setschin,<br />
53, am 27. Juli 2004 zum Vorstandsvorsitzenden <strong>des</strong> staatlichen Ölkonzerns<br />
Rosneft gewählt. Zum damaligen Zeitpunkt liegt der Konzern<br />
noch weit hinter den „Big Players“ <strong>des</strong> Ölgeschäfts wie Lukoil und Yukos.<br />
Sechs Monate später sichert sich Rosneft mittels einer Strohfirma die<br />
wichtigsten Anteile an Yukos bei einer Zwangsversteigerung und steigt<br />
fast aus dem Nichts zum größten Ölkonzern Russlands auf.<br />
Heute handeln russische Wirtschaftszeitungen Setschin, der wie Putin<br />
einst für den russischen Geheimdienst KGB gearbeitet haben soll und<br />
später bei der Stadtverwaltung in St. Petersburg anheuerte, als den einflussreichsten<br />
Russen – direkt hinter seinem Freund Wladimir Putin. Auch<br />
westliche Politiker messen Setschin großen Einfluss bei, der sich darin ausdrückt,<br />
dass er wegen der Ukrainekrise auf der US-Sanktionsliste steht.<br />
Manche russische Kommentatoren machen Setschin zudem dafür verantwortlich,<br />
kürzlich die Übernahme der russischen Facebook-Variante<br />
Vkontakte durch einen kremlnahen Investmentfonds eingefädelt zu haben.<br />
Es sind solche Geschäfte im Sinne <strong>des</strong> Kremls, mit denen die heutigen<br />
Oligarchen sich Sicherheit und Loyalität <strong>des</strong> Präsidenten erkaufen.<br />
Von der einstigen politischen Macht der Superreichen ist hingegen kaum<br />
etwas geblieben. Während zu Boris Jelzins Zeiten Oligarchen als die eigentlichen<br />
Herren im Land galten und selbst Putin seinen Aufstieg zum<br />
Teil dem damals übermächtigen und im Frühjahr 2013 unter bislang ungeklärten<br />
Umständen gestorbenen Unternehmer Boris Beresowski zu verdanken<br />
hat, sind sich heute die meisten Experten einig: Von Oligarchen<br />
im klassischen Sinn kann keine Rede mehr sein. Vom Kreml unabhängige<br />
Machtzentren sind Geschichte.<br />
Ziemlich beste Freunde sind Igor Setschin ( rechts ) und der russische<br />
Präsident – sie kennen sich noch aus St. Petersburger Tagen<br />
59<br />
<strong>Cicero</strong> – 6. 2014
WELTBÜHNE<br />
Hintergrund<br />
ROMAN ABRAMOWITSCH<br />
DER WAHL-ENGLÄNDER<br />
Die russischen Superreichen versuchen heute, sich aus dem politischen<br />
Leben herauszuhalten. In den Medien tauchen sie nur noch im Zusammenhang<br />
mit extravaganten Investitionen auf. Etwa Roman Abramowitsch, 47,<br />
<strong>des</strong>sen Vermögen sich nach Angaben <strong>des</strong> Wirtschaftsmagazins Forbes auf<br />
10,2 Milliarden Dollar beläuft. Während er sich von 2000 bis 2008 noch<br />
als Gouverneur der Region Tschukota im Nordosten Russlands in der Politik<br />
engagierte, widmet er sich heute lieber den schönen Dingen <strong>des</strong> Lebens<br />
– seinem britischen Fußballclub FC Chelsea oder seinen Superjachten.<br />
Dabei hätte der in jungen Jahren verwaiste Abramowitsch, der sein<br />
erstes Geld mit der Produktion von Gummienten und Fußbällen machte,<br />
allen Grund, sich für eine friedliche Lösung der Ukrainekrise einzusetzen.<br />
Seine Evraz-Holding besitzt im Gebiet Dnepropetrowsk zwei Eisenerz-<br />
und eine Kohlegrube sowie ein größeres Stahlwerk.<br />
Juri Kowaltschuk gehört zum engen Umfeld von<br />
Wladimir Putin – das zahlt sich aus<br />
JURI KOWALTSCHUK<br />
DER BANKER<br />
Juri Kowaltschuk, 62, gehört zur neuen<br />
Garde der grauen Eminenzen in Russland.<br />
Journalisten bezeichnen Leute wie ihn oder<br />
Eisenbahnchef Wladimir Jakunin nach der<br />
Datschenkooperative Osero. Die hatten Putin<br />
und seine Freunde – die meisten mit einer<br />
KGB-Vergangenheit – 1996 an einem kleinen<br />
See, in der Nähe von St. Petersburg gelegen,<br />
gegründet. Mit Putins Aufstieg seit seiner<br />
ersten Präsidentschaft 2000 landeten viele<br />
der Osero-Bewohner auf hohen Posten. Kowaltschuk<br />
stieg von der Öffentlichkeit kaum<br />
beachtet zu einem der größten Medienmogule<br />
<strong>des</strong> Lan<strong>des</strong> auf. Zu seiner Nationalen<br />
Mediengruppe gehören neben Teilen <strong>des</strong><br />
kremltreuen Senders Erster Kanal auch die<br />
zwei Sender RenTV und 5 Kanal, die Traditionszeitung<br />
Izvestia sowie das Boulevardportal<br />
Lifenews und der Radiosender RSN. Sie<br />
alle sind wichtige Pfeiler der Kremlpropaganda<br />
im Ukrainekonflikt. Es war allerdings<br />
die angebliche Rolle seiner Bank Rossija als<br />
Geldbörse für Putin und seinen engsten Zirkel,<br />
die ihn wie Rosneft-Chef Setschin und<br />
den Rohstoffhändler Gennadi Timtschenko<br />
auf die westliche Sanktionsliste brachte. US-<br />
Bürgern ist es verboten, mit der Bank Geschäfte<br />
zu machen. Moskau reagierte darauf<br />
demonstrativ gelassen und setzte die<br />
Destabilisierung der Ukraine fort. Ungeachtet<br />
der Auswirkungen auf die Geschäfte der<br />
Oligarchen.<br />
Roman Abramowitsch – hier mit seiner Freundin Daria Schukowa – genießt<br />
das Leben lieber in Saint Tropez an der Côte d‘Azur als in seiner Heimat<br />
Fotos: Sergey Guneev/Picture Alliance/DPA [M], DDP Images/ARSOV/SIPA<br />
60<br />
<strong>Cicero</strong> – 6. 2014
Prochorow<br />
war Putin ein<br />
bequemer<br />
politischer<br />
Sparringpartner<br />
Foto: Paul Eng/Redux/Laif<br />
MICHAIL PROCHOROW<br />
DER JUNGGESELLE<br />
Man kann als Oligarch auch Politik<br />
machen nach Art von Michail Prochorow,<br />
49. <strong>Der</strong> einstige Eigentümer <strong>des</strong> Nickelproduzenten<br />
Norilsk Nickel war Putin<br />
ein bequemer politischer Sparringpartner,<br />
der die Grenzen <strong>des</strong> Erlaubten nicht<br />
überschreitet. Prochorow, der den meisten<br />
Russen lange lediglich als reichster<br />
Junggeselle <strong>des</strong> Lan<strong>des</strong> ein Begriff war,<br />
hat sein 10,9 Milliarden Dollar großes<br />
Vermögen wie die meisten Oligarchen<br />
der Privatisierung Anfang der neunziger<br />
Jahre zu verdanken.<br />
Sein politisches Debüt kam wie<br />
aus dem Nichts: Kurz vor der Dumawahl<br />
2011 wurde Prochorow Chef der<br />
liberalen Oppositionspartei Rechte Sache.<br />
<strong>Der</strong> Verdacht: Er nimmt echten Oppositionsparteien<br />
Stimmen weg, um Putin<br />
zu stärken. Noch vor der Wahl kam<br />
es zu einem parteiinternen Putsch. Erklärt<br />
wurde das damit, dass Prochorow<br />
sich wegen einer Parteipersonalie mit<br />
dem Kreml überworfen habe, der ihn<br />
<strong>des</strong>halb flugs wieder aus dem politischen<br />
Karussell herausbefördert habe. Bei der<br />
Präsidentenwahl ein halbes Jahr später<br />
kam der Milliardär mit 8 Prozent immerhin<br />
auf den dritten Platz hinter Putin<br />
und den Kommunisten Gennadi Sjuganow.<br />
Seitdem ist es ruhig geworden<br />
um den Politiker Prochorow – offenbar<br />
werden seine Dienste im Kreml derzeit<br />
nicht benötigt.<br />
Lange kannten die Russen Michail Prochorow nur als begehrten Junggesellen.<br />
Dann stieg er in die Politik ein – und ebenso schnell wieder aus<br />
61<br />
<strong>Cicero</strong> – 6. 2014
WELTBÜHNE<br />
Hintergrund<br />
RINAT ACHMETOW<br />
DER STRIPPENZIEHER<br />
Im Gegensatz zu ihren russischen Kollegen machen die ukrainischen<br />
Oligarchen ihrem Namen noch alle Ehre. „Ein ukrainischer<br />
Oligarch“, so lautet im Volksmund eine Definition, „ist<br />
ein mutierter Geschäftsmann, der den Staat nicht politischen<br />
Zielen unterordnet, sondern wirtschaftlichen, und zwar den eigenen.“<br />
Als Paradebeispiel hierfür dient Rinat Achmetow, 47.<br />
Mit einem Vermögen von 15,4 Milliarden Dollar ist er mit Abstand<br />
der reichste Ukrainer. Zu seiner Gruppe System Capital<br />
Management gehören Stahlwerke, Kohlegruben, Fernsehsender<br />
und der Fußballclub Schachtar Donezk, 300 000 Menschen<br />
arbeiten für ihn, viele davon im Donbass. Achmetow galt als<br />
wichtigster Unterstützer von Wiktor Janukowitschs Partei der<br />
Regionen: Er finanzierte zwischen 40 und 50 Abgeordnete der<br />
Partei, wodurch er das Abstimmungsverhalten der Partei maßgeblich<br />
beeinflussen konnte.<br />
Bis zuletzt stützte Achmetow über die Partei der Regionen<br />
Präsident Wiktor Janukowitsch. Zu den Ereignissen auf dem<br />
Maidan bezog der nur während der Fußballspiele seines Clubs<br />
in der Öffentlichkeit zu sehende Achmetow nie Stellung. Statt<strong>des</strong>sen<br />
gab es nichtssagende Pressemitteilungen seines Konzerns,<br />
in denen zu Dialog und Frieden aufgerufen wurde.<br />
Nach Einschätzung Kiewer Experten hat Achmetow weiterhin<br />
die Kontrolle über die Überreste der Partei der Regionen.<br />
Als wichtiges Anzeichen dafür gilt, dass die Partei nicht<br />
den von Achmetow unabhängigen Milliardär Sergej Tigipko<br />
zum Präsidentschaftskandidaten kürte, sondern mit Michail<br />
Dobkin eine Figur, die so lenkbar und politisch schwach ist<br />
wie schon Janukowitsch.<br />
Die wichtigste Frage lautet: Welche Rolle spielt Achmetow<br />
in der politischen Krise in der Ostukraine? Örtliche Blogger<br />
vermuten, er zündele in Donezk mit Absicht, um Kiew gegenüber<br />
seine Macht zu demonstrieren – und seine Milliarden<br />
zu retten. Tatsächlich tauchte Achmetow in einer Aprilnacht<br />
kurz nach der Besetzung vor der Donezker Regionalverwaltung<br />
auf und vermittelte einen Kompromiss zwischen den Besetzern<br />
und dem Vertreter Kiews, wodurch offenbar eine gewaltsame<br />
Erstürmung verhindert wurde.<br />
Foto: Sven Simon/ Picture Alliance/DPA<br />
62<br />
<strong>Cicero</strong> – 6. 2014
Seit März ist Igor Kolomojskij Gouverneur <strong>des</strong> Gebiets<br />
Dnepropetrowsk – und er scheint seine Sache gut zu machen<br />
Foto: RIA Novosti<br />
Mit einem Vermögen<br />
von 15,4 Milliarden Dollar<br />
ist Rinat Achmetow<br />
der reichste Ukrainer.<br />
300 000 Menschen<br />
arbeiten für ihn, viele<br />
davon im Donbass<br />
Rinat Achmetow scheut die Öffentlichkeit – außer<br />
wenn sein Fußballclub Schachtar Donezk ihn feiert<br />
IGOR KOLOMOJSKIJ<br />
DER REGIONALFÜRST<br />
Während Achmetow als „König <strong>des</strong> Donbass“ gilt, liegt<br />
die Macht in der benachbarten Region Dnepropetrowsk in den<br />
Händen eines anderen Oligarchen – Igor Kolomojskij, 51. Er<br />
ist laut Forbes mit einem Vermögen von 2,4 Milliarden Dollar<br />
die Nummer 3 der ukrainischen Oligarchen. Angehäuft hat er<br />
es in den vergangenen zwei Jahrzehnten, mit seiner Großbank<br />
Privat und einem unübersichtlichen Netz von über 100 Unternehmen<br />
in unterschiedlichen Industriezweigen, unter anderen<br />
in der Stahl-, Öl-, Chemie-, Energie- und Nahrungsmittelindustrie.<br />
Zentrum seines Imperiums ist die ostukrainische<br />
Stadt Dnepropetrowsk. Dort hat Kolomojskij, der neben seinem<br />
ukrainischen auch einen israelischen Pass besitzt, sich als<br />
großzügiger Unterstützer der jüdischen Gemeinde einen Namen<br />
gemacht und mit 100 Millionen Euro das größte jüdische<br />
Gemeindezentrum Osteuropas finanziert. Kolomojskij agierte<br />
traditionell hinter den Kulissen, <strong>des</strong>halb war es eine Überraschung,<br />
als ihn die Kiewer Regierung zum Gouverneur <strong>des</strong> Gebiets<br />
Dnepropetrowsk ernannte.<br />
Doch Kolomojskij, der zeitweise einen Teil der Gehaltszahlungen<br />
an öffentliche Bedienstete und die Versorgung der<br />
Truppen in Dnepropetrowsk aus seinem Privatvermögen leistete,<br />
scheint seiner Aufgabe gewachsen: Während es in den<br />
Nachbarregionen zu bürgerkriegsähnlichen Auseinandersetzungen<br />
und Gebäudebesetzungen kam, blieb es in Dnepropetrowsk<br />
bislang ruhig. Kolomojskij ließ im April eine Bürgerwehr<br />
aus mehreren Hundert „ukrainischen Patrioten“ aufstellen und<br />
Kopfgelder auf Separatisten ausschreiben. Sein Stellvertreter<br />
drohte eventuellen Angreifern, in Dnepropetrowsk werde sie<br />
ein „zweites Stalingrad“ erwarten. Kurze Zeit später ließ Kolomojskij<br />
die Separatisten wissen: „Wer nach Russland will, dem<br />
bin ich bereit das Ticket dahin zu bezahlen. Es bleibt dann nicht<br />
sehr viel zu tun – nur Kofferpacken.“<br />
63<br />
<strong>Cicero</strong> – 6. 2014
WELTBÜHNE<br />
Hintergrund<br />
Viktor Pintschuk kämpft mit seiner Stiftung<br />
gegen Aids und fördert Kunst<br />
VIKTOR PINTSCHUK<br />
DER WOHLTÄTER<br />
<strong>Der</strong> zweite Oligarch aus Dnepropetrowsk ist Viktor<br />
Pintschuk, 53, mit einem 3,8-Milliarden-Dollar-<br />
Vermögen die Nummer 2 nach Achmetow. Er zählt allerdings<br />
zu jenen, die sich – ähnlich wie die russischen<br />
Oligarchen – zumin<strong>des</strong>t oberflächlich aus der Politik<br />
zurückgezogen haben. Das war nicht immer so.<br />
Seit 1998 stützte Pintschuk als Parlamentsabgeordneter<br />
den damaligen Präsidenten Leonid Kutschma,<br />
wenig später heiratete er <strong>des</strong>sen Tochter. Das half<br />
ihm, sein auf dem Röhrenproduzenten Interpipe begründetes<br />
Geschäftsimperium auszubauen. Zusammen<br />
mit Rinat Achmetow kaufte Pintschuk kurz vor<br />
dem Ende von Kutschmas Amtszeit den Stahlgiganten<br />
Kriworoschstal zu einem Schnäppchenpreis. Nach<br />
der orangenen Revolution wurde der Kauf rückgängig<br />
gemacht – und das Unternehmen zu einem sechsmal<br />
höheren Preis an Arcelor verkauft.<br />
Nach der Wahlschlappe von Kutschmas Nachfolger<br />
Wiktor Janukowitsch im Jahr 2004 zog Pintschuk<br />
sich aus der Politik zurück. Zwei Jahre später<br />
kehrte er in die Öffentlichkeit zurück – nun in der<br />
Rolle <strong>des</strong> Philantropen. Sein Pinchuk Art Centre im<br />
Zentrum von Kiew war zum damaligen Zeitpunkt<br />
die größte Galerie für moderne Kunst in Osteuropa.<br />
Pintschuk gründete eine Stiftung für den Kampf<br />
gegen Aids. Auf der Halbinsel Krim, im Palast, in<br />
dem einst Stalin, Churchill und Roosevelt über die<br />
Nachkriegsordnung in Europa berieten, hat Pintschuk<br />
in den vergangenen Jahren mit viel Pomp aktive<br />
Politiker und elder statesmen zu einem Forum<br />
zusammengebracht, um über den Platz der Ukraine<br />
in Europa zu beraten – noch im vergangenen September<br />
traf hier Janukowitsch russische und westliche<br />
Politiker.<br />
DMITRI FIRTASCH<br />
DER GESCHWÄCHTE<br />
Dmitri Firtasch, 49, wurde mit undurchsichtigen Gasgeschäften<br />
reich: Bis 2009 kaufte die Ukraine ihr Gas nicht direkt bei<br />
Gazprom, sondern über den Zwischenhändler Rosukrenergo, der<br />
wiederum zur Hälfte Firtasch und Gazprom gehörte. Allerdings<br />
kaufte Firtasch, dem gute Verbindungen nach Russland nachgesagt<br />
werden, auch nach 2009 Gas bei Gazprom – 2013 zu einem<br />
weit günstigeren Preis als die staatliche Naftogaz. Laut Forbes verfügt<br />
Firtasch heute über ein Vermögen von 700 Millionen Dollar.<br />
Firtaschs wichtigster Geschäftspartner war und ist Sergej<br />
Ljowotschkin, bis Januar Chef von Janukowitschs Präsidialverwaltung.<br />
Firtasch stellte während der Janukowitsch-Ära zehn Abgeordnete<br />
der Partei der Regionen. In Kiew heißt es, das Tandem<br />
mit Firtasch und Ljowotschkin, dem der Fernsehkanal Inter gehört,<br />
unterstütze Vitali Klitschkos Partei Udar; bislang hat Klitschko<br />
das jedoch dementiert.<br />
Heute ist Firtasch geschwächt wie nie: Am 12. März wurde<br />
er in Wien aufgrund eines US-Haftbefehls von einer österreichischen<br />
Spezialeinheit festgenommen. <strong>Der</strong> Vorwurf: Schmiergeldzahlungen<br />
bei einem Geschäftsdeal in Indien. Gegen eine Kaution<br />
von 125 Millionen Dollar wurde Firtasch zwar inzwischen freigelassen,<br />
allerdings droht ihm weiter die Auslieferung in die USA.<br />
Von ganz oben ist Dmitri Firtasch tief gefallen: In Wien wurde er<br />
verhaftet und gegen Zahlung von 125 Millionen Dollar freigelassen<br />
Fotos: Wolfgang Stahr/Laif, Efrem Lukatsky/Bloomberg via Getty Images<br />
64<br />
<strong>Cicero</strong> – 6. 2014
Vitali Klitschko ( rechts ) hat zugunsten von Pjotr Poroschenko auf<br />
eine Kandidatur bei den Präsidentschaftswahlen verzichtet<br />
Foto: Daniel Biskup/Laif<br />
PJOTR POROSCHENKO<br />
DER CHOCOLATIER<br />
Ein Oligarch kann sich momentan beste Hoffnungen darauf<br />
machen, bei den Wahlen am 25. Mai – so sie denn stattfinden<br />
– zum ukrainischen Präsidenten gewählt zu werden. <strong>Der</strong><br />
„Schokoladenzar“ Pjotr Poroschenko, 48. <strong>Der</strong> Sohn eines einflussreichen<br />
Sowjetfunktionärs aus der Provinzstadt Winniza<br />
unterscheidet sich von seinen Kollegen dadurch, dass die Herkunft<br />
seines Reichtums einigermaßen transparent und nicht<br />
durch die Aneignung von Filetstücken der Sowjetindustrie entstanden<br />
ist: 1996 gründete Poroschenko den Schokoladenkonzern<br />
„Roshen“, der heute einen Jahresumsatz von 1,2 Milliarden<br />
Dollar hat.<br />
Seit den neunziger Jahren ist Poroschenko zudem als Parlamentsabgeordneter<br />
persönlich in der Politik aktiv. Anfänglich<br />
unterstützte auch er Kutschma und spielte eine Schlüsselrolle<br />
bei der Gründung von Janukowitschs Partei der Regionen. Später<br />
wechselte er das Lager und zählte 2004/2005 zu den wichtigsten<br />
Unterstützern der orangenen Revolution – sein 5 Kanal<br />
half dabei, die Anhänger <strong>des</strong> Präsidentschaftskandidaten<br />
Wiktor Juschtschenko zu mobilisieren. Juschtschenko ist Taufpate<br />
von Poroschenkos Töchtern. Unter ihm wurde der Milliardär<br />
zunächst Chef <strong>des</strong> ukrainischen Sicherheitsrats, danach<br />
Direktor der Nationalbank.<br />
Aber auch unter Präsident Janukowitsch setzte Poroschenko<br />
seine politische Karriere fort, zunächst als Außen-,<br />
dann als Handelsminister. <strong>Der</strong> Bruch mit dem Präsidenten kam<br />
erst mit Beginn <strong>des</strong> Maidan-Aufstands im November 2013.<br />
Doch auch da bemühte sich Poroschenko, nicht in der ersten<br />
Reihe der Oppositionsführer auf dem Maidan zu stehen. Die<br />
Zurückhaltung zahlt sich nun aus: Während deren Popularitätswerte<br />
nach dem Ende der Maidan-Unruhen sanken, ist Poroschenko,<br />
der angekündigt hat, bei einem Wahlerfolg seinen<br />
Roshen-Konzern zu verkaufen, in Umfragen der absolute Favorit<br />
auf das Präsidentenamt. Selbst Julia Timoschenkos verbale<br />
Attacken gegen die „Macht der Oligarchen“ konnten ihm<br />
bislang nicht schaden.<br />
MORITZ GATHMANN und MAXIM KIREEV beschäftigen sich<br />
seit Jahren mit der Rolle der Oligarchen in den Nachfolgestaaten<br />
der Sowjetunion<br />
65<br />
<strong>Cicero</strong> – 6. 2014
WELTBÜHNE<br />
Interview<br />
„AMERIKA HAT EINE<br />
CHRONISCHE GRIPPE“<br />
Die Bürger haben kein Vertrauen mehr, und Obama macht zu<br />
viele Fehler. George Packers Diagnose für die USA ist verheerend<br />
66<br />
<strong>Cicero</strong> – 6. 2014
Mr. Packer, Ihr Buch „The Unwinding“<br />
zeichnet die Spaltung Amerikas nach.<br />
Lässt sich diese Entwicklung noch<br />
umkehren?<br />
George Packer: Einen zweiten New<br />
Deal wird es nicht geben, obwohl manche<br />
dies erwartet hatten, als Obama ins Amt<br />
kam. Auch weil unsere Probleme nicht so<br />
kritisch sind wie in den dreißiger Jahren.<br />
Sie sind eher chronisch. Wie eine Grippe,<br />
die man nicht loswird, im Gegensatz zur<br />
Großen Depression, die wie ein Schlaganfall<br />
wirkte. Andererseits war unsere<br />
Demokratie damals noch gesund, was<br />
man heute nicht mehr sagen kann. Unsere<br />
Institutionen – wie etwa der Kongress<br />
und die Medien – sind heute nur eingeschränkt<br />
funktionstüchtig. Auch habe<br />
ich das Gefühl, dass wir älter geworden<br />
sind, als Nation. Wir sind als Land quasi<br />
in unseren Fünfzigern und nicht mehr in<br />
den Zwanzigern, sodass uns die Tatkraft<br />
fehlt, der Optimismus. Viele junge Amerikaner<br />
spüren eine nachhaltige Entfremdung.<br />
Sie studieren, häufen dabei Schulden<br />
an und finden dann kaum Jobs in der<br />
Qualität, die sie erwarten und brauchen.<br />
Sie haben das Vertrauen in unsere Führer<br />
verloren. Sie sind zynisch und innerlich<br />
radikalisiert, aber ohne klare Richtung.<br />
der Automobilindustrie. Er war mit dem<br />
Lösen von akuten Problemen beschäftigt.<br />
Dabei büßte er irgendwann seine Fähigkeit<br />
ein, mit dem Land zu kommunizieren.<br />
Er verlor den Kontakt. Er hielt weiter<br />
Reden, drang aber nicht durch.<br />
Warum ist er nicht durchgedrungen?<br />
Obama ist allergisch gegen prägnante<br />
Zuspitzungen, was auf den ersten<br />
Blick sympathisch ist, für einen Politiker<br />
aber ein Problem. Zuspitzungen sind<br />
wichtig. „Das Einzige, was wir zu fürchten<br />
haben, ist die Furcht selbst“ – die<br />
Menschen erinnerten sich an Roosevelts<br />
Radioansprachen. Niemand erinnert sich<br />
an einen einzigen Satz aus einer Rede,<br />
die Obama als Präsident gehalten hat. Es<br />
gibt denkwürdige Zuspitzungen aus seinen<br />
Reden als Kandidat. Aber seither?<br />
Nichts mehr.<br />
Seine Gesundheitsreform Obamacare<br />
hätte ein wenig Zuspitzung vertragen.<br />
Ja, oder ein Gesicht oder eine Familie,<br />
um das Ganze mit Leidenschaft aufzuladen.<br />
Aber das ist leider nicht Obama. Nach<br />
seinem ersten Präsidentschaftswahlkampf<br />
dachte man, dass dies Obama sei, aber<br />
wie sich herausstellt, steckt mehr Jimmy<br />
Carter in ihm als Roosevelt. Ich halte ihn<br />
zwar nicht für einen gescheiterten Präsidenten,<br />
anders als Carter, vor allem <strong>des</strong>halb,<br />
weil es ihm gelungen ist, Obamacare<br />
im Gesetz festzuschreiben. Seine Präsidentschaft<br />
ist aber dennoch eine Enttäuschung.<br />
Er selbst hatte die Latte sehr hoch<br />
gelegt, er wollte eine historische Präsidentschaft<br />
haben. Ich glaube nicht, dass<br />
dies der Fall sein wird.<br />
Was hätte Obama nach seinem Amtsantritt<br />
2009 anders machen können?<br />
Was mir zum Beispiel fehlte, waren<br />
Konjunkturprogramme. Im März und<br />
April 2009 war der Arbeitsmarkt in einer<br />
verzweifelten Lage. Jeden Monat gingen<br />
Hunderttausende Jobs verloren. Das<br />
Erste wäre gewesen, den Menschen Arbeit<br />
zu geben. Was die amerikanische<br />
Infrastruktur betrifft, ist genug zu tun.<br />
Obama hat sich zu ausschließlich auf Problemlösung<br />
konzentriert, er war zu pragmatisch.<br />
Er hat es versäumt, die Krise<br />
als Folge einer strukturellen Verwerfung<br />
der amerikanischen Volkswirtschaft zu<br />
sehen, die nach Dekaden der <strong>Der</strong>egulierung<br />
auf die Interessen der Finanzindustrie<br />
zugeschnitten ist.<br />
Illustration: Matt Sesow; Foto: Michael Nagle/The New York Times/Redux/Laif<br />
Für viele Amerikaner war die Wahl Obamas<br />
2008 ein Moment der Hoffnung. Er<br />
kam mit einem klaren Mandat zur Veränderung<br />
ins Amt. Warum hat er die Erwartungen<br />
nicht erfüllen können?<br />
Einerseits liegt das an Washington,<br />
das nicht mehr mit dem Washington von<br />
1933 zu vergleichen ist. <strong>Der</strong> Präsident ist<br />
mit einer Opposition konfrontiert, die<br />
extremistisch und beinahe antidemokratisch<br />
wirkt. Diese Probleme hatte Roosevelt<br />
nicht. In den dreißiger Jahren gab es<br />
liberale Republikaner, die zu den Unterstützern<br />
<strong>des</strong> New Deal zählten.<br />
Und heute?<br />
Washington ist heute dermaßen polarisiert,<br />
dass die Hälfte der politischen<br />
Landschaft immer gegen den Präsidenten<br />
arbeitet. Andererseits fehlte es Obama<br />
an politischer Erfahrung. Er war nicht<br />
in der Lage, die Macht zu nutzen, die er<br />
als Präsident hat. Auch trat er ein schweres<br />
Erbe an, mit zwei Kriegen, einer Rezession,<br />
die ich als Depression bezeichne,<br />
einer Finanzkrise, dem Zusammenbruch<br />
George Packer<br />
ist einer der profiliertesten<br />
politischen Journalisten der USA.<br />
<strong>Der</strong> Sohn zweier Stanford-Professoren<br />
berichtete für den New<br />
Yorker aus dem Irak, aus Sierra<br />
Leone und der Elfenbeinküste,<br />
bevor er sich der Innenpolitik<br />
zuwandte. „The Unwinding: An<br />
Inner History of the New America“,<br />
für das Packer 2013 den National<br />
Book Award erhielt, erscheint<br />
im Juli in Deutschland („Die<br />
Abwicklung“, S. Fischer Verlag)<br />
Hier setzt Ihr Buch an.<br />
Mein Buch sollte vom Versuch Obamas<br />
handeln, strukturelle Ungerechtigkeiten<br />
anzugehen, auch Defizite unserer<br />
Demokratie. Mein Arbeitstitel war „Niedergang<br />
und Erneuerung“. Aber dann<br />
sah ich keine Erneuerung, auch nach den<br />
ersten paar Jahren nicht. Obama erschien<br />
mir ratlos. So weitete ich meinen Fokus,<br />
von Washington und Obama auf das<br />
ganze Land und eine ganze Reihe von<br />
Figuren, anhand derer die Kräfte sichtbar<br />
werden, die Amerika in den vergangenen<br />
35 Jahren zum Negativen verändert<br />
haben.<br />
Wie haben Sie diese Menschen gefunden,<br />
Tammy Thomas beispielsweise,<br />
die alleinerziehende Fließbandarbeiterin<br />
mit der heroinabhängigen Mutter,<br />
oder Dean Price, den ewig scheiternden<br />
Kleinunternehmer?<br />
Mit viel Glück: Dean begegnete mir<br />
am Rande einer Recherche für den New<br />
Yorker, und auf Tammy wiesen mich<br />
67<br />
<strong>Cicero</strong> – 6. 2014
WELTBÜHNE<br />
Interview<br />
Bekannte in Ohio hin, die wussten, dass<br />
ich auf der Suche nach jemandem wie<br />
ihr war, nach einer Frau aus einem abgestiegenen,<br />
ehemals industriellen Teil <strong>des</strong><br />
Lan<strong>des</strong>. Ich besuchte sie in Youngstown –<br />
die Stadt muss man sich wie Detroit vorstellen,<br />
ausgehöhlt, entvölkert –, und sie<br />
erwies sich als viel interessanter, ihr Leben<br />
erwies sich als viel dramatischer, als<br />
ich es mir vorgestellt hatte. Auch von<br />
Dean war ich gleich fasziniert, er ist ein<br />
brillanter Redner und ein seltsamer, exzentrischer<br />
Mann aus einem Teil Amerikas,<br />
den ich gar nicht kannte, stolz, eng,<br />
weiß, kampfeslustig und konservativ. <strong>Der</strong><br />
Süden. Tabak und Textilien. Mittlerweile<br />
auch Arbeitslosigkeit und Drogen.<br />
Hatten Sie Berührungsängste?<br />
Vom bourgeoisen Brooklyn hier<br />
war das alles schon sehr weit entfernt.<br />
Manchmal kam es mir weiter entfernt<br />
vor als der Irak, aus dem ich länger berichtet<br />
habe. Im Irak erwartet man einen<br />
tiefen Graben zu seinen Gesprächspartnern,<br />
auch ist jedem Iraker die Rolle klar,<br />
die man spielt: Man ist ein ausländischer<br />
Journalist, der gekommen ist, um über<br />
den Krieg zu schreiben.<br />
In den USA war das doch sicher anders.<br />
Hier in Amerika war der tiefe Graben<br />
für mich gelegentlich schockierend.<br />
Auch war meine Position schwerer zu erklären.<br />
Warum befrage ich Tammy zu<br />
ihrer Kindheit? Warum fahre ich mit<br />
Dean tagelang durch North Carolina?<br />
Warum sitze ich mit ihm spätabends auf<br />
seiner Veranda, während in der Dunkelheit<br />
die Lastwagen vorbeidonnern? Ihre<br />
Leben waren mir natürlich fremd, aber<br />
ich wusste sofort, dass sie gute Figuren<br />
sind. Man muss ein Gespür dafür entwickeln,<br />
wer einen in sein Leben hineinlassen<br />
wird, aber vor allem dafür, wer<br />
die Fähigkeit besitzt, auf fesselnde Weise<br />
von sich zu erzählen. Das können sehr<br />
wenige Menschen. Alle Figuren in meinem<br />
Buch haben außergewöhnliche Stimmen,<br />
und die Herausforderung für mich<br />
war es, diese Stimmen einzufangen, mit<br />
ihrem spezifischen Humor, ihren Rhythmen<br />
und Eigenheiten. Auch die Stimmen<br />
der Berühmtheiten in meinem Buch, das<br />
rhetorische Giftgas von Newt Gingrich,<br />
das schnelle Stakkato von Jay-Z, die falsche<br />
Bescheidenheit von Robert Rubin.<br />
„ Leider steckt<br />
in Obama<br />
mehr Jimmy<br />
Carter als<br />
Franklin<br />
Roosevel “<br />
Das Buch liest sich wie ein Roman, weil<br />
die Figuren so repräsentativ sind.<br />
Zwangsläufig. Ich brauchte Figuren,<br />
die für die verschiedenen Stränge einer<br />
Erzählung über das heutige Amerika stehen.<br />
Figuren aus Washington, von der<br />
Wall Street, vom Land, aus dem Rostgürtel<br />
und aus Silicon Valley. Die Stadt<br />
Tampa in Florida wurde allmählich selbst<br />
zur Figur, als der Ort, an dem die Immobilienblase<br />
wie auch deren Platzen am<br />
dramatischsten zu spüren war. Scheinbar<br />
unverwandte Geschichten, die durch den<br />
Zusammenbruch 2008 auf einmal als eng<br />
miteinander verwoben erscheinen. Zum<br />
Panorama eines polarisierten Lan<strong>des</strong>,<br />
das nicht mehr richtig funktioniert.<br />
Insbesondere das Ideologische an dieser<br />
Polarisierung ist befremdlich. Woher<br />
kommt etwa die offenbar prinzipielle<br />
Blockadehaltung der Republikaner?<br />
Es existiert derzeit eine politische Irrationalität<br />
in Amerika, deren Ursachen<br />
relativ klar sind. Langfristiger ökonomischer<br />
Niedergang, eine Flut an Zuwanderern<br />
und eine Republikanische Partei,<br />
deren Demagogen in den vergangenen<br />
drei Jahrzehnten stets belohnt worden<br />
sind. Die Republikaner ernähren sich<br />
mittlerweile von der Polarisierung. Sie<br />
treiben Parteispenden auf, indem sie erzählen,<br />
Obama sei ein Sozialist, <strong>des</strong>sen<br />
Ziel es sei, den amerikanischen Kapitalismus<br />
zu zerstören. Newt Gingrich, die<br />
Politikerfigur in meinem Buch, ist in dieser<br />
Hinsicht eine Schlüsselfigur, da er die<br />
<strong>des</strong>truktive Sprache erfunden hat, die republikanische<br />
Demagogen einsetzen. Er<br />
hat diese Sprache nach Washington gebracht,<br />
um die Kontrolle im Kongress zu<br />
übernehmen, auf geradezu nihilistische<br />
Weise, ohne einen Gedanken daran, ob<br />
die Institution <strong>des</strong> Kongresses dabei vielleicht<br />
Schaden nehmen könnte. Gingrich<br />
wurde für sein <strong>des</strong>truktives Verhalten belohnt,<br />
insbesondere von älteren, weißen,<br />
ländlichen Wählern, und wenn Politiker<br />
für etwas belohnt werden, machen sie damit<br />
immer weiter.<br />
Profitieren konnten die Republikaner<br />
von dieser Taktik bislang aber nicht.<br />
Die Republikaner scheinen die Grenzen<br />
ihres eigenen Extremismus zu erreichen.<br />
Die Erfolge bleiben aus. In fünf<br />
der vergangenen sechs Präsidentschaftswahlen<br />
haben die Demokraten die Mehrzahl<br />
der Stimmen erobert, auch Al Gore<br />
schaffte dies im Jahr 2000. Wenn ich Republikaner<br />
wäre, würde mir das Sorgen<br />
machen. Ich würde dies als bedenkliche<br />
Entwicklung sehen, die sich nur noch verstärken<br />
wird, weil das Land jünger und<br />
bunter wird. Und liberaler, was Dinge<br />
wie Schwulenehe betrifft. Aber es ist ein<br />
langwieriger Prozess, in einer Partei das<br />
Ruder herumzureißen.<br />
Was den Widerstand der Republikaner<br />
gegen Obamacare angeht: Steht eher<br />
die Befürchtung dahinter, dass jeder<br />
Amerikaner, der Obama seine Krankenversicherung<br />
zu verdanken hat, die Demokraten<br />
wählen wird? Oder die Überzeugung,<br />
dass man, wenn man sich<br />
keine Krankenversicherung leisten kann,<br />
auch keine verdient hat?<br />
Bei<strong>des</strong> ist der Fall. Einerseits fürchten<br />
die Republikaner, dass sich aus einer<br />
erfolgreichen Umsetzung der Reform<br />
eine langfristig stabile Mehrheit für die<br />
Demokraten ergeben könnte, wie nach<br />
der Einführung der Rentenversicherung<br />
durch Roosevelt 1935. Andererseits haben<br />
sich viele Republikaner eingeredet,<br />
dass alles, was die Regierung anfasst, den<br />
Bach runtergeht. Daher waren auch die<br />
technischen Probleme mit der healthcare.<br />
gov-Website so fatal. Lassen Sie uns ehrlich<br />
sein: Obama ist schwarz. Das ist ein<br />
großes Problem für manche Wählergruppen.<br />
Er ist ein zeitgenössischer, kulturell<br />
interessierter Mensch. Es gibt einfach<br />
Leute in Amerika, die ihm nie eine<br />
Chance geben werden.<br />
Das Gespräch führte<br />
ALEXANDER SCHIMMELBUSCH<br />
68<br />
<strong>Cicero</strong> – 6. 2014
WELT.DE/NEU<br />
Die Welt gehört denen,<br />
die lauter denken,<br />
als andere schreien.<br />
ALAN POSENER,<br />
REDAKTEUR
WELTBÜHNE<br />
Fotoessay<br />
RIO VOR<br />
DEM ANPFIFF<br />
Am Anfang herrschte ausgelassene<br />
Freude. Dann folgten gewalttätige<br />
Demonstrationen. Wie die Stimmung<br />
kurz vor Beginn der Fußball-WM in<br />
Brasilien ist, wollte die Fotografin<br />
Isabela Pacini wissen und besuchte die<br />
Gastgeber in ihrem Zuhause<br />
Leonardo Sant’Anna, 17, ist Schüler und lebt<br />
mit seiner Familie in Caxias, einem Vorort<br />
nördlich von Rio. Das kleine Schlafzimmer teilt<br />
er sich mit seiner Großmutter. Er hofft, dass<br />
Brasilien den sechsten Weltmeistertitel holt<br />
70<br />
<strong>Cicero</strong> – 6. 2014
Links: Francisca, 63, kennt man in ihrem Viertel<br />
als Dona Francisquinha. Tagsüber putzt sie<br />
Autoscheiben an der Ampel. Abends spielt sie<br />
in der Theatergruppe ihrer Favela, wie Armenviertel<br />
in Brasilien heißen. Es hilft gegen die<br />
Schüchternheit, sagt sie<br />
Oben: Luciana, die ihr Alter nicht verraten<br />
will, teilt sich mit zwölf anderen Transsexuellen<br />
die Zimmer eines Bordells in Lapa,<br />
dem hippen Altstadtviertel in Rio. Von der<br />
Fußball-Weltmeisterschaft erhofft sie sich<br />
vor allem Touristen und gutes Geld<br />
73<br />
<strong>Cicero</strong> – 6. 2014
Maria Cristina, 67, ist pensionierte Anwältin.<br />
Sie war das urbane Chaos in Rio leid und<br />
bezog ein Haus in Itanhangá, einem grünen<br />
Vorort im Südwesten der Stadt. Hier hat sie<br />
Platz für ihre Hunde, Hühner und Enten und<br />
bleibt verschont vom Trubel
Links: Vinicius Benincasa, 21, wohnt in<br />
einem der modernen Hochhauskomplexe in<br />
Barra da Tijuca. Sein Leben teilt er auf<br />
Facebook mit der Welt und träumt von einer<br />
Karriere als Model oder Star einer brasilianischen<br />
Soap<br />
Oben: Flávia Ferraz, 28, lebt nördlich von<br />
Rio in ihrem Mädchenzimmer. Die größte<br />
Mülldeponie Südamerikas, Jardim<br />
Gramacho, ist gleich nebenan. Die WM<br />
weckt in ihr den Traum, einen netten<br />
Ausländer kennenzulernen und wegzuziehen<br />
77<br />
<strong>Cicero</strong> – 6. 2014
An den Stränden von Copacabana und Ipanema<br />
schmiegt sich der Atlantik in die sanft geschwungene<br />
Promenade vor den Hügeln Rio de Janeiros.<br />
Schöne Menschen mit schönen Körpern tragen hier das<br />
schöne Leben zur Schau. Als die Fußball-Weltmeisterschaft<br />
2014 Brasilien zugesprochen wurde, tanzte das ganze Land.<br />
Endlich sollte auch das schöne Spiel, das jogo bonito der<br />
Fußball‐Nationalhelden Garrincha und Pelé, heimkehren.<br />
Doch wenige Wochen vor dem Eröffnungsspiel am<br />
12. Juni in São Paulo erstickt Nervosität die Vorfreude.<br />
Schon bei der WM-Vergabe herrschte Zweifel, ob das Land<br />
mit den prekären sozialen Verhältnissen bereit sei für das<br />
aufgeblähte Spektakel der Fifa. Milliarden Dollar flossen,<br />
um Brasilien westeuropäischen Standards anzugleichen.<br />
Dennoch stocken die Bauarbeiten an den zwölf Stadien. Die<br />
Befriedung der strategisch wichtigen Armenviertel durch<br />
die Militärpolizei gleicht einem Krieg. Polizisten liefern sich<br />
Schießereien mit Drogenkartellen und Straßenschlachten<br />
mit Demonstranten, die gegen Willkür, Korruption, Verschwendung<br />
und das Verkehrschaos protestieren.<br />
Isabela Pacini, vor 40 Jahren in Rio geboren, lebt heute<br />
in Hamburg. Im vergangenen Jahr reiste die Fotografin in<br />
ihre alte Heimat, um sich vor der WM ein Bild von den<br />
Gastgebern zu machen. Für ihre Porträtreihe besuchte sie<br />
Ronaldo de Medeiros e Albuquerque, 66, früher<br />
Anwalt, jetzt Schriftsteller, lebt mit seiner<br />
zweiten Frau, Anwältin Ana Maria, 53 , in einem<br />
Penthouse in Copacabana. Sie glaubt, dass die<br />
WM das richtige Licht auf Rio wirft. Er glaubt,<br />
dass sie Rios Wirtschaft zugutekommt<br />
22 Cariocas, wie die Einwohner Rios genannt werden, in<br />
ihren Wohnzimmern. „Bei allen sozialen und kulturellen<br />
Unterschieden, die es in diesem Land gibt, verbindet uns<br />
doch die Geselligkeit“, sagt Pacini. Mit ihrer Serie zieht sie<br />
einen Querschnitt der Protagonisten <strong>des</strong> Alltags in Rio, von<br />
den abgeschotteten Villenvierteln der Superreichen bis in<br />
die Elendsquartiere der Favelas.<br />
Zwischen der Vorfreude hört Pacini immer wieder die<br />
Unzufriedenheit der Menschen heraus. Vor allem den Ärmeren<br />
sei klar, dass der Vorwand, die WM spüle Geld ins<br />
Land, nicht für sie gelte. Trotzdem sei jeder stolz. Stolz darauf,<br />
der Welt ihre Welt zu zeigen. Das schöne Leben. Den<br />
Fußball. Es ist ihr Spiel.<br />
SARAH-MARIA DECKERT<br />
Fotos: Isabela Pacini (Seiten 70 bis 78)<br />
78<br />
<strong>Cicero</strong> – 6. 2014
KAPITAL<br />
„ Captain America ist<br />
groß, muskulär, ein<br />
blonder Superman.<br />
Die Amerikaner lieben<br />
ihn. Wir in Europa<br />
haben keinen Kapitän<br />
Europa, sondern<br />
höchstens Kafka “<br />
<strong>Der</strong> tschechische Ökonom Tomáš Sedláček im Interview ab Seite 86<br />
79<br />
<strong>Cicero</strong> – 6. 2014
KAPITAL<br />
Porträt<br />
ALLEIN GEGEN DAS KAPITAL<br />
Frauke Menke gilt als Hassobjekt deutscher Bankvorstände. Die Aufseherin lädt Banker<br />
nach der Trauerfeier zum Rapport. Passt ihr einer nicht, verhindert sie seinen Aufstieg<br />
Von MEIKE SCHREIBER und HEINZ-ROGER DOHMS<br />
Foto: Christoph Papsch/Laif<br />
Plötzlich sitzt das Phantom Ende<br />
Februar auf der Zeugenbank im<br />
Kölner Landgericht. Es ist einer<br />
der seltenen öffentlichen Auftritte von<br />
Frauke Menke. Verhandelt wird der Zusammenbruch<br />
der Privatbank Sal. Oppenheim.<br />
„Alter, Beruf?“, fragt die Richterin.<br />
„50, Juristin“, antwortet Menke.<br />
50 Jahre also, selbst ihr Alter galt bislang<br />
als Verschlusssache.<br />
Frauke Menke ist Abteilungsleiterin<br />
bei der Finanzaufsicht Bafin, verantwortlich<br />
für „Groß- und ausgewählte Kreditbanken“.<br />
Eine der einflussreichsten und<br />
umstrittensten Frauen im deutschen<br />
Wirtschaftsleben. Sie hat die Macht, Katastrophen<br />
zu verhindern. Und die Macht,<br />
Karrieren zu zerstören. Ersteres habe sie<br />
nicht geschafft, sagen Kritiker. Letzteres<br />
tue sie mit umso größerem Eifer.<br />
Die Liste ihrer Opfer ist beeindruckend:<br />
Da ist zum Beispiel Axel Wieandt,<br />
der mal als einer der talentiertesten<br />
Nachwuchsbanker <strong>des</strong> Lan<strong>des</strong> galt.<br />
Gegen seinen Sprung an die Spitze der<br />
BHF-Bank legte Menke ihr Veto ein: Angeblich<br />
hielt sie ihn für ungeeignet.<br />
Richard Walker, der Leiter der<br />
Rechtsabteilung der Deutschen Bank,<br />
wurde von Menke faktisch degradiert.<br />
Er durfte seinen Posten nur behalten,<br />
weil die Bank ihm mit Daniela Weber-<br />
Rey und Christoph von Dryander zwei<br />
deutsche Topjuristen an die Seite stellte.<br />
Dann ist da noch William Broeksmit.<br />
Deutsche-Bank-Chef Anshu Jain wollte<br />
seinen Vertrauten 2012 zum Risikochef<br />
ernennen. Doch wieder war es Menkes<br />
Abteilung, die die notwendige Zustimmung<br />
verweigerte. Broeksmit zog sich<br />
aus der Bank zurück.<br />
Überhaupt die Deutsche Bank. Sie<br />
ist Menkes Lieblingsgegner. Anfang <strong>des</strong><br />
Jahres wurde ein Zwischenbericht der<br />
Bafin zur Zinsaffäre publik, in die die<br />
Bank verwickelt ist. Er las sich wie eine<br />
Generalabrechnung mit Jain und <strong>des</strong>sen<br />
Kochef Jürgen Fitschen: Sie redeten viel<br />
von einem Kulturwandel, es entstehe<br />
aber der Eindruck, dass sie keine klaren<br />
Konsequenzen, insbesondere personeller<br />
Art, gezogen hätten. Briefe Menkes an<br />
die Bankspitze klingen, als würde eine<br />
Lehrerin zwei unbotmäßige Schüler zurechtweisen:<br />
„Ich halte es für inakzeptabel,<br />
dass Sie offensichtlich sowohl mein<br />
Haus als auch weitere Behörden über<br />
lange Zeit falsch informiert haben.“<br />
WAS TREIBT MENKE AN? Von der Bafin<br />
dazu: Kein Kommentar. Wer ein Interview<br />
mit ihr will, darf einen Fragenkatalog<br />
schicken. <strong>Der</strong> wird nicht beantwortet.<br />
Menkes Laufbahn beginnt Mitte der<br />
neunziger Jahre im Bun<strong>des</strong>aufsichtsamt<br />
für das Kreditwesen, einem Vorläufer<br />
der Bafin. Sie beschäftigt sich mit Geldwäsche.<br />
<strong>Der</strong> spätere Bafin-Chef Jochen<br />
Sanio wird ihr Mentor. Unter ihm steigt<br />
sie in der 2002 gegründeten Bafin auf,<br />
bis zur Chefkontrolleurin der Großbanken.<br />
Dann, 2007 und 2008, brechen in<br />
Deutschland die Banken zusammen. Es<br />
sind Ereignisse, die das Land verändern.<br />
Und Frauke Menke.<br />
Im März 2008 teilt sie dem Finanzministerium<br />
mit, sie halte die Hypo Real<br />
Estate für „dringend beobachtungsbedürftig“<br />
– ein halbes Jahr vor deren Beinahpleite.<br />
Ein Alarmruf Menkes oder<br />
eine Standardmeldung? Letzteres, befindet<br />
der HRE-Untersuchungsausschuss.<br />
<strong>Der</strong> Grünen-Politiker Gerhard Schick attestiert<br />
der Bafin „eklatantes Versagen“.<br />
Menke wirkt hilflos vor dem Ausschuss:<br />
„Ich verstehe nicht so ganz, was die Handlungsvorschläge<br />
hätten sein sollen.“<br />
„Die Kritik damals hat sie stark geprägt“,<br />
sagt ein Bankenanwalt. Seitdem<br />
sei sie noch härter und kompromissloser.<br />
Das zeigt sich spätestens im Fall<br />
Sal. Oppenheim. Die traditionsreichste<br />
deutsche Privatbank steckt wegen der<br />
Karstadt-Pleite in Schwierigkeiten. Zu<br />
dem wirtschaftlichen Schlag kommt ein<br />
privater: Das Oberhaupt der Bankerdynastie,<br />
die Baronin Karin von Ullmann,<br />
ist verstorben und soll beigesetzt werden.<br />
Kurz vor der Trauerfeier am 10. Juni<br />
2009 erreicht die Bankführung eine Mitteilung<br />
von Frauke Menke. Man möge<br />
sich bitte auf den Weg zur Bafin machen.<br />
Die vier Oppenheim-Partner – Matthias<br />
Graf von Krockow, Christopher Freiherr<br />
von Oppenheim, Friedrich Carl Janssen<br />
und Dieter Pfundt – halten den Marschbefehl<br />
für eine Taktlosigkeit. Und doch,<br />
so erzählt ein Beteiligter, machen sie sich<br />
gleich nach der Beisetzung auf den Weg.<br />
„Als die vier zurückkamen, waren die<br />
kleinlaut wie nie zuvor.“<br />
In den Frankfurter Bankentürmen<br />
hat Menke nur wenig Anhänger. „Die<br />
richtet Leute öffentlich hin“, meint einer<br />
aus dem Bankenlager. „Wenn die Menke<br />
eine Topjuristin wäre, hätte es sie sicher<br />
nicht zur Aufsicht verschlagen“, giftet<br />
ein anderer. Es gibt aber auch die, die<br />
sie verteidigen. „Ich würde als Aufseher<br />
genauso handeln. Nicht die Arbeit von<br />
Frau Menke ist skandalös, sondern die<br />
Zustände bei der Deutschen Bank“, sagt<br />
der Analyst Dieter Hein von Fairesearch.<br />
Kommt es demnächst zum Showdown<br />
mit der Deutschen Bank? Bis zum<br />
<strong>Sommer</strong> soll der Abschlussbericht der Bafin<br />
zur Zinsaffäre vorliegen. Dann könnte<br />
es auch für Jain und Fitschen eng werden.<br />
Frauke Menke will sich nicht noch mal<br />
„eklatantes Versagen“ vorwerfen lassen.<br />
MEIKE SCHREIBER und HEINZ-ROGER<br />
DOHMS fiel bei der Recherche auf, dass<br />
Menkes Kritiker nie zitiert werden wollten.<br />
Vielleicht ein Beleg für Menkes Macht<br />
81<br />
<strong>Cicero</strong> – 6. 2014
KAPITAL<br />
Porträt<br />
BAUERN, DIE MINEN MACHEN<br />
Die Kugelschreiber, die Familie Schneider seit drei Generationen im Schwarzwald<br />
herstellt, sind so gut, dass selbst die Konkurrenten zur Kundschaft gehören<br />
Von CHRISTIAN LITZ<br />
Wer um kurz nach fünf in der<br />
Früh auf der Landstraße 175<br />
nach Süden abbiegt, tritt unweigerlich<br />
auf die Bremse. Denn hier,<br />
wo der Schwarzwald seinem Namen alle<br />
Ehre macht, erstrahlt plötzlich, wie aus<br />
dem Nichts, die hell erleuchtete Zentrale<br />
der Schneider Schreibgeräte GmbH. Die<br />
320 Mitarbeiter sind um diese Zeit auf<br />
dem Weg zur Arbeit. Schon in den siebziger<br />
Jahren hatte der Betriebsrat mit Firmenchef<br />
Roland Schneider abgemacht:<br />
Wir fangen morgens früher an, damit<br />
wir uns nachmittags um Vieh und Acker<br />
kümmern können. Viele der Frauen und<br />
Männer, die im Schwarzenbachtal Kugelschreiber<br />
entwickeln und herstellen, waren<br />
damals noch Nebenerwerbslandwirte.<br />
Angekommen vor dem verwinkelten<br />
Firmensitz, umgeben von einem rauschenden<br />
Bach und kreischenden Vögeln,<br />
wähnt man sich in einer Stephen-King-<br />
Verfilmung. Dabei erzählt das Gebäude<br />
nur die Wachstumsgeschichte der Firma.<br />
Die Fabrik bestand anfangs, 1938, nur<br />
aus einem Haus. Gründer Christian<br />
Schneider und ein Mitarbeiter stellten<br />
Schrauben, Drehteile, Brummkreisel für<br />
Kinder her, später Schubladen-Kugellager.<br />
Ab 1947 produzierten sie Kugelschreiberminen,<br />
ab 1957 komplette Kulis.<br />
Christian Schneider war vernarrt<br />
in das damals neue Schreibgerät, hatte<br />
den Ehrgeiz, die besten Kuliminen herzustellen.<br />
So brauchte die Firma je<strong>des</strong> Jahr<br />
mehr Platz, wurde das Werk in Jahrzehnten<br />
zusammengewürfelt, zusätzliche Fläche<br />
aus dem Felsen gesprengt.<br />
Gäste verlieren in dem burgartigen<br />
Gebäude sofort die Orientierung. „Ich<br />
verlaufe mich auch noch manchmal“,<br />
sagt selbst Martina Schneider. Die Enkelin<br />
<strong>des</strong> Gründers, die schon als Schülerin<br />
in den Ferien hier arbeitete, ist heute für<br />
die Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich.<br />
Gefragt nach Zahlen, antwortet sie:<br />
„Da muss ich jetzt mal spickeln.“ Dann<br />
referiert sie aus den Unterlagen: 1,5 Millionen<br />
Kugelschreiberspitzen produziert<br />
Schneider jeden Tag. Auch für andere<br />
Hersteller, die Schneiders Spitzen in ihre<br />
Stifte einbauen. 120 verschiedene Minenspitzentypen<br />
können sie. Haben 20<br />
eigene Kulimodelle im Angebot, je<strong>des</strong> in<br />
zwölf Farben. 250 Millionen Schreibgeräte<br />
im Jahr. 60 Prozent davon gehen ins<br />
Ausland. 100 Tonnen Stahl verbraucht<br />
das Werk jährlich. Zum Umsatz macht<br />
das Familienunternehmen dagegen keine<br />
genauen Angaben.<br />
Wichtiger sind Martina Schneider<br />
andere Zahlen: Taucht bei Tests ein<br />
Fehler auf, wird die ganze Charge von<br />
15 500 Minenspitzen vernichtet. Die Mikroskope<br />
der Qualitätskontrolle zeigen<br />
Tintenkanäle von 0,03 Millimeter. Ein<br />
Menschenhaar ist dreimal dicker. Um<br />
derartige Präzision zu erreichen, verwendet<br />
das Unternehmen Maschinen,<br />
die sonst nur in der Uhrenindustrie zum<br />
Einsatz kommen.<br />
IRONIE UND BEHARRLICHKEIT gehören<br />
zu den Erfolgsgeheimnissen der Familie<br />
Schneider. „So echtes Hochdeutsch, das<br />
hört sich schon beeindruckend an“, sagt<br />
Martina Schneider, die gerne mit dem Leben<br />
in der Provinz hadert, weil hier im<br />
Tal ein „absolutes Funkloch ist“. Sie kam<br />
vor drei Jahren zurück. Davor hatte sie<br />
in den USA, in Costa Rica, Panama und<br />
Frankfurt gelebt.<br />
Sie folgte dem Beispiel ihres älteren<br />
Bruders Christian, 38. <strong>Der</strong> war auf dem<br />
besten Wege, Karriere beim Internetkonzern<br />
Ebay zu machen, bevor es ihn 2009<br />
doch ins Familienunternehmen zog. Zusammen<br />
mit Vater Roland und dem langjährigen<br />
Mitarbeiter Frank Groß bildet<br />
er die Geschäftsführung. Die Schneiders<br />
leiden alle unter dem schwäbisch-badischen<br />
Minderwertigkeitskomplex, diesem<br />
wichtigen Antrieb. Sorgt er doch immer<br />
dafür, dass sie arbeiten, als müssten<br />
sie der ganzen Welt etwas beweisen.<br />
In Sachen Präzision macht ihnen keiner<br />
etwas vor. Schneider gilt in der Branche<br />
als die Firma, die das Schwierigste,<br />
nämlich Minenspitzen, am besten kann.<br />
Dank ihres über Jahrzehnte entwickelten<br />
Spezial-Know-hows sind die Tüftler aus<br />
Tennenbronn der Konkurrenz immer ein<br />
paar Jahre voraus.<br />
Damit das so bleibt, treiben Frank<br />
Groß und Christian Schneider gerade fieberhaft<br />
weitere Neuentwicklungen voran<br />
und arbeiten die Nächte durch. „Ich habe<br />
drei Tage nicht geschlafen“, sagt Martinas<br />
Bruder, <strong>des</strong>sen schwarze Haare in<br />
alle Richtungen abstehen. Zu Hause bekommt<br />
der Vater eines Babys im Moment<br />
auch nur wenig Ruhe. Aber nächtliches<br />
Arbeiten und wenig Schlaf haben bei den<br />
Schneiders Tradition. Ob es noch viele<br />
Landwirte gibt? „Nur noch ein paar. Zum<br />
Beispiel das Tal hoch, auf der linken Seite,<br />
ein Ehepaar hat noch 50 Kühe.“<br />
CHRISTIAN LITZ erntete bei seiner<br />
Recherche leise Kritik von Familie<br />
Schneider, weil er für seine Notizen einen<br />
Senator-Kuli von der Konkurrenz benutzte<br />
MYTHOS<br />
MITTELSTAND<br />
Was hat Deutschland,<br />
was andere nicht haben?<br />
Den Mittelstand!<br />
<strong>Cicero</strong> stellt in jeder Ausgabe<br />
einen mittelständischen<br />
Unternehmer vor.<br />
Die bisherigen Porträts<br />
finden Sie unter:<br />
www.cicero.de/mittelstand<br />
Foto. Andy Ridder für <strong>Cicero</strong><br />
82<br />
<strong>Cicero</strong> – 6. 2014
KAPITAL<br />
Porträt<br />
UNSER MANN IN BAGDAD<br />
Klaus Hachmeier kennt den Irak <strong>des</strong> 10. Jahrhunderts genauso gut wie die brutale<br />
Realität von heute. Ideale Voraussetzungen, um deutsche Firmen ins Land zu bringen<br />
Von ERIC CHAUVISTRÉ<br />
Foto: Frank Schoepgens für <strong>Cicero</strong><br />
Wer sich jahrelang mit Manuskripten<br />
aus dem Mittelalter<br />
befasst, bewegt sich zwangsläufig<br />
in einer wissenschaftlichen Parallelwelt.<br />
Mancher hält dabei gar seine Abgeschiedenheit<br />
für ein Qualitätsmerkmal.<br />
Gilt die akademische Leidenschaft dann<br />
auch noch dem Erfassen tausend Jahre<br />
alter arabischer Primärquellen, dürfte<br />
die Gefahr, zum abgehobenen Gelehrten<br />
ohne Praxisbezug zu mutieren, besonders<br />
groß sein.<br />
Es fällt leicht, sich Klaus Hachmeier<br />
als aufstrebenden Arabisten an den Universitäten<br />
in Göttingen oder Oxford vorzustellen<br />
– eloquent, mit Understatement.<br />
In den neunziger Jahren hat er in beiden<br />
Städten studiert. Er war mittendrin in<br />
jener universitären Welt: Für seine Dissertation<br />
las er nicht nur diplomatische<br />
Schriften aus dem Bagdad <strong>des</strong> 10. Jahrhunderts,<br />
er entzifferte Manuskripte,<br />
ordnete sie ein, interpretierte sie.<br />
Am Ende hat er einen anderen Weg<br />
gewählt. Er führte ihn ins Bagdad <strong>des</strong><br />
21. Jahrhunderts, in die harte und brutale<br />
Realität einer Stadt, die zu den gefährlichsten<br />
Orten der Welt zählt. Statt<br />
mittelalterliche Manuskripte zu deuten,<br />
sorgt Hachmeier, 39 Jahre alt, heute dafür,<br />
dass deutsche Turbinen in irakische<br />
Kraftwerke, deutsche Gipsplatten in irakische<br />
Gebäude und deutsche Baumaschinen<br />
auf irakische Straßen kommen.<br />
Auf seiner Visitenkarte steht „Head<br />
of Commercial Office“: Seit einem Jahr<br />
vertritt er den Deutschen Industrie- und<br />
Handelskammertag DIHK im Irak. Dazu<br />
arbeitet und wohnt er auf dem bewachten<br />
Gelände der deutschen Botschaft in Bagdad.<br />
Alle zwei Monate entflieht er kurz<br />
dieser Welt. Für zwei bis drei Wochen ist<br />
er dann in Deutschland, um sich zu erholen<br />
– und um bei Unternehmen für Investitionen<br />
im Irak zu werben.<br />
In den achtziger Jahren hat er die<br />
deutsche Schule in Bagdad besucht, sein<br />
Vater war dort Diplomat. Aber seine Zuversicht<br />
basiert nicht auf Nostalgie. Hachmeier,<br />
der während seiner Promotion<br />
in Arabistik auch noch ein Studium der<br />
Volkswirtschaft abschloss, kann sie begründen:<br />
Anders als in Afghanistan gebe<br />
es relativ gefestigte staatliche Strukturen.<br />
Auch das Bildungsniveau sei trotz der Gewalt<br />
weiterhin hoch. Noch liegt der Irak<br />
mit Waren im Wert von 1,3 Milliarden<br />
Euro in der Rangliste deutscher Exporte<br />
nur auf Platz 64. Doch Hachmeier sieht<br />
das Potenzial: Schon jetzt fördert der Irak<br />
mit 3,8 Millionen Fass Erdöl pro Tag mehr<br />
als je zuvor. Wenn die Pläne der irakischen<br />
Regierung aufgehen, soll die Produktion<br />
bis Ende dieses Jahrzehnts verdoppelt –<br />
und ein Großteil der Erlöse in die marode<br />
Infrastruktur investiert werden.<br />
DIE ENTWICKLUNG in einigen Teilen <strong>des</strong><br />
Lan<strong>des</strong> nährt Hachmeiers Optimismus.<br />
Im südirakischen Basra gibt es weniger<br />
Anschläge. Im autonomen kurdischen<br />
Norden ist die Bedrohung nochmals geringer.<br />
Gefahr droht vor allem in den Gebieten<br />
nahe der syrischen Grenze und in<br />
der Gegend rund um Bagdad.<br />
Wenn er von seiner Unterkunft in<br />
der irakischen Hauptstadt erzählt, klingt<br />
das bei Hachmeier dennoch so, als ginge<br />
es um ein Reihenhäuschen in der deutschen<br />
Provinz: Ein Garten gehört dazu.<br />
Eine kleine Küche. Und eine Espresso-<br />
Maschine einschließlich großer Mengen<br />
aus Deutschland eingeführter Kaffeepads.<br />
Will er sich bewegen, geht er in das<br />
kleine Sportstudio auf dem Botschaftsgelände.<br />
Dort trifft der schmale Akademiker<br />
dann auf breitschultrige deutsche<br />
Bun<strong>des</strong>polizisten. „In der Tat sind die Lebensumstände“,<br />
sagt Hachmeier, „etwas<br />
begrenzt.“<br />
Er ist froh, dass die deutsche Botschaft<br />
nicht innerhalb der hermetisch abgeriegelten<br />
„grünen Zone“ liegt, in die<br />
Iraker nur mit Sondergenehmigung gelangen.<br />
So kann er Gesprächspartner<br />
aus Unternehmen, Verbänden oder Ministerien<br />
in seinem Büro empfangen. Zu<br />
Treffen außerhalb gelangt Hachmeier mit<br />
dem Toyota Land Cruiser einer irakischen<br />
Sicherheitsfirma: gepanzerte Sonderausstattung,<br />
goldfarbene Lackierung,<br />
abgedunkelte Scheiben. Je nach Sicherheitslage<br />
meidet er bestimmte Straßen.<br />
Im vergangenen Jahr gab es 4500 Opfer<br />
von Anschlägen. Das Auswärtige<br />
Amt warnt ausdrücklich vor Reisen in<br />
den Irak – zehn Jahre nachdem George<br />
W. Bush etwas voreilig das Ende der<br />
Kampfhandlungen verkündete.<br />
Geirrt haben sich auch jene, die damals<br />
prognostizierten, wegen der deutschen<br />
Ablehnung der US-Invasion würden<br />
deutsche Firmen beim Wiederaufbau<br />
<strong>des</strong> Lan<strong>des</strong> weniger Aufträge erhalten.<br />
Inzwischen sieht Hachmeier es sogar als<br />
Vorteil, anders als die Briten oder die<br />
Amerikaner nicht für den brutalen Bürgerkrieg<br />
mitverantwortlich gemacht zu<br />
werden.<br />
Probleme bleiben: die im Land verbreitete<br />
Korruption, der Bürokratiedschungel.<br />
Das Haupthindernis für deutsche<br />
Firmen sei nicht die Sicherheitslage,<br />
sagt Hachmeier: „Es ist eher eine gewisse<br />
behördliche Intransparenz im Irak.“<br />
Aber genau hier fühlt sich Hachmeier<br />
gefordert. Wieder kann er entschlüsseln,<br />
übersetzen, Zusammenhänge deuten und<br />
Brücken zwischen den Kulturen bauen –<br />
fast wie früher als Wissenschaftler.<br />
ERIC CHAUVISTRÉ hat die Bun<strong>des</strong>wehr<br />
in Afghanistan begleitet, den Irakkrieg aus<br />
der Ferne analysiert. Mit Klaus Hachmeier<br />
traf er sich im fast zu friedlichen Bonn<br />
85<br />
<strong>Cicero</strong> – 6. 2014
KAPITAL<br />
Interview<br />
„DIE GRIECHEN SIND DIE<br />
ÖKONOMISCHE AVANTGARDE“<br />
<strong>Der</strong> tschechische Starökonom Tomáš Sedláček lobt den Euro,<br />
fordert eine Abkehr von der Ideologie <strong>des</strong> ewigen Wachstums und<br />
träumt von einem Kapitän Europa<br />
86<br />
<strong>Cicero</strong> – 6. 2014
Herr Sedláček, im April hat Griechenland<br />
zum ersten Mal seit vier Jahren<br />
wieder Staatsanleihen an den Finanzmärkten<br />
platzieren können. Sind die<br />
Griechen jetzt gerettet?<br />
Tomáš Sedláček: Es ist eine Rettung<br />
für uns alle, weil wir damit endlich auch<br />
den Mythos „Fauler Süden versus fleißiger<br />
Norden“ zu Grabe tragen können.<br />
Ich würde sogar noch weiter gehen: Griechenland<br />
liegt nicht hinter uns, Griechenland<br />
ist uns voraus. Die Griechen sind die<br />
ökonomische Avantgarde.<br />
Woran machen Sie das fest?<br />
Stellen Sie sich doch mal vor, Griechenland<br />
wäre vor zwei Generationen in<br />
eine solche Situation geraten. Soll ich Ihnen<br />
sagen, was dann damals in den europäischen<br />
Hauptstädten diskutiert worden<br />
wäre? Man hätte überlegt, ob man das<br />
Land besetzen, aufteilen oder gleich annektieren<br />
soll. Heute spannt man einen<br />
Rettungsschirm auf. Alle haben sich gewünscht,<br />
dass Griechenland sich wieder<br />
erholt. Europäische Nachbarn wünschen<br />
sich gegenseitig Wohlstand. Das ist doch<br />
wundervoll!<br />
Foto: Dominik Butzmann/Laif<br />
Tomáš Sedláček<br />
<strong>Der</strong> tschechische Ökonom<br />
wurde 2012 mit seinem<br />
Best seller „Die Ökonomie von<br />
Gut und Böse“ weltweit<br />
bekannt. <strong>Der</strong> 37-Jährige lehrt<br />
heute an der Karls-Universität<br />
in Prag Wirtschaftsgeschichte<br />
und -philosophie. Gleichzeitig<br />
ist er als Makroökonom der<br />
tschechischen Bank CSOB tätig.<br />
Von 2001 bis 2003 arbeitete<br />
Sedláček als wirtschaftspolitischer<br />
Berater <strong>des</strong> damaligen<br />
tschechischen Präsidenten<br />
Václav Havel<br />
Ist das Ihr Ernst?<br />
Die meisten europäischen Länder<br />
werden aufgrund ihrer überschuldeten<br />
Staatshaushalte in etwa 20 Jahren wie<br />
Griechenland enden, wenn wir nicht unser<br />
Wirtschaftssystem ändern. Außerdem<br />
sind Krisen wie Karussells, in der Europäischen<br />
Union wird es zwangsläufig immer<br />
ein Land geben, dem es am besten<br />
geht, und eines, das gerade in der Krise<br />
steckt. Vor 13 Jahren war Deutschland<br />
der kranke Mann Europas, uns Tschechen<br />
ging es Anfang der Neunziger nicht<br />
gut. Finnland, Frankreich, Großbritannien,<br />
alle haben Krisen erlebt und sind<br />
gestärkt daraus hervorgegangen.<br />
Machen Sie es sich da nicht etwas zu<br />
einfach? In der Eurokrise stand die europäische<br />
Währungsunion kurz vor dem<br />
Zusammenbruch.<br />
Ja, aber die Linie, die zwischen dem<br />
„problematischen“ Süden und dem „erfolgreichen“<br />
Norden gezogen wurde, war<br />
von Anfang an falsch. Irland gehört ja<br />
nicht zu Südeuropa. Wir neigen außerdem<br />
dazu, Kausalität und Korrelation zu<br />
verwechseln. Aktuell wird uns eingeredet,<br />
dass die Krise zum Wiedererstarken<br />
<strong>des</strong> Nationalismus führt.<br />
Aber genau diese Entwicklung haben<br />
wir doch in Griechenland gesehen.<br />
Ja, aber es gab auch schon vor der<br />
Krise Jörg Haider in Österreich, in der<br />
Slowakei saßen extreme Nationalisten<br />
in der Regierung, in Tschechien hetzten<br />
die Republikaner gegen die Roma. Es gibt<br />
verschiedene Gründe für solche Phänomene<br />
in den einzelnen Ländern. Aber anders<br />
als in den dreißiger Jahren hat die<br />
Wirtschaftskrise nicht zum Wiedererstarken<br />
<strong>des</strong> Nationalismus geführt.<br />
Aber der Bail-out der Griechen, der Iren<br />
und der Portugiesen war doch kein rein<br />
altruistischer Akt?<br />
Nein, es ging mit Sicherheit auch darum,<br />
die eigenen Banken zu retten. Aber<br />
das ist ja eines der Hauptphänomene der<br />
Globalisierung, dass die Probleme der<br />
anderen zu unseren eigenen Problemen<br />
werden können. Das ist genial, weil der<br />
Anreiz fehlt, gegeneinander Krieg zu führen:<br />
Wir haben den alten Fetisch <strong>des</strong> geografischen<br />
Wachstums durch den Fetisch<br />
<strong>des</strong> Wirtschaftswachstums ersetzt.<br />
Die Griechen leiden aber noch immer<br />
unter enorm hohen Staatsschulden.<br />
Und einige Ökonomen fordern weiterhin<br />
den Ausschluss der Griechen aus dem<br />
Euro oder plädieren für einen kontrollierten<br />
Staatsbankrott.<br />
Diese Diskussion ist hysterisch. Bei<br />
uns in Tschechien gibt es das Märchen<br />
vom dummen Hans, der mit seiner Leiter<br />
auf einen Baum klettern will. Da die<br />
Leiter zu lang ist, sägt er eine Sprosse ab,<br />
aber es passt wieder nicht perfekt. Er sägt<br />
so lange Sprossen ab, bis die Leiter völlig<br />
unbrauchbar ist.<br />
Was heißt das für die EU?<br />
Wenn wir anfangen, die Länder, die<br />
in Schwierigkeiten geraten, abzusägen,<br />
ist am Ende niemand mehr in der EU.<br />
Die aktuelle Finanzkrise hat in den USA<br />
begonnen. Sie hat dort verheerende soziale<br />
Auswirkungen gehabt, weil die Sozialsysteme<br />
viel schwächer ausgebaut sind<br />
als in Europa. Trotzdem käme kein vernünftiger<br />
Amerikaner auf die Idee, eine<br />
Auflösung der Vereinigten Staaten zu fordern.<br />
Das Gleiche gilt für Japan trotz seiner<br />
seit Jahren anhaltenden Krise. Dieses<br />
87<br />
<strong>Cicero</strong> – 6. 2014
KAPITAL<br />
Interview<br />
„Brecht die EU auseinander!“, so eine<br />
kontraproduktive Forderung kann nur<br />
von uns Europäern kommen.<br />
Aber wir leben eben nicht in den Vereinigten<br />
Staaten von Europa.<br />
Ich habe kürzlich im Kino den zweiten<br />
Teil von Captain America gesehen.<br />
<strong>Der</strong> Superheld ist groß, muskulär, ein<br />
blonder Superman. Die Amerikaner lieben<br />
ihn. Wir in Europa haben keinen Kapitän<br />
Europa, sondern höchstens Kafka.<br />
Diesen amerikanischen Enthusiasmus<br />
werden wir in Europa nie teilen. Wir werden<br />
uns immer Kafka näher fühlen, mit<br />
unserer ewigen Skepsis und Kritik. Trotzdem<br />
ist Europa unser gemeinsames Haus.<br />
Sind die Europäer durch die Krise doch<br />
näher zusammengerückt?<br />
Ja, wir wachsen zu einer Familie zusammen.<br />
So einfach ist das. Und wenn<br />
die Griechen unsere Brüder und Schwestern<br />
sind, dann müssen wir ihnen helfen,<br />
wenn sie sich ein Bein gebrochen haben,<br />
und nicht fragen, wie viel es kosten wird.<br />
Deswegen bin ich für die Einführung eines<br />
Länderfinanzausgleichs in Europa.<br />
Das funktioniert doch innerhalb einzelner<br />
Mitgliedstaaten auch.<br />
Warum ist Europa so instabil?<br />
Wir haben eine Tendenz dazu, alles<br />
auf die Spitze zu treiben, alles zu maximieren,<br />
alles zu übertreiben. Die Idee<br />
der wirtschaftlichen Integration Europas<br />
ist richtig. Aber wir haben uns dabei in<br />
die Idee <strong>des</strong> ständigen Wirtschaftswachstums<br />
verliebt. Die Krise hat gezeigt, dass<br />
es uns genauso zerstören kann wie unser<br />
alter Fetisch <strong>des</strong> geografischen<br />
Wachstums.<br />
Aber Wirtschaft und Politik setzen doch<br />
weiterhin auf Wachstum.<br />
Das Argument lautet immer: Wir<br />
müssen uns jetzt höher verschulden, um<br />
die Wirtschaft anzuregen, damit wir später<br />
unsere Schulden einfacher abtragen<br />
können. Schulden mit noch mehr Schulden<br />
zu bekämpfen hat etwas Manisches.<br />
Das ist ungefähr so, als wenn Sie für einen<br />
Alkoholiker, der mit seinem Kater<br />
kämpft, ein wirksameres Schmerzmittel<br />
entwickeln. Kurzfristig helfen Sie ihm<br />
mit der Medizin, aber langfristig wird<br />
sein Alkoholproblem noch schlimmer.<br />
„Leichte<br />
Deflation ist<br />
eigentlich<br />
ganz angenehm,<br />
weil sie meine<br />
Kaufkraft erhöht<br />
und mich<br />
reicher macht“<br />
Aber kann der Kapitalismus ohne<br />
Wachstum funktionieren?<br />
Wir müssen aufhören, uns in die Tasche<br />
zu lügen. Wenn die Neuverschuldung<br />
der USA bei 7 Prozent <strong>des</strong> BIP liegt,<br />
die Wirtschaft aber nur um 1,5 Prozent<br />
wächst, kann ich das doch nicht ernsthaft<br />
als Wachstum bezeichnen. Die<br />
Krise hat gezeigt, dass wir mit unserer<br />
Verschuldungspolitik schon seit Jahren<br />
selbst in die Segel unseres Schiffes pusten,<br />
aber kein Wind weht. Wir haben<br />
unsere Stabilität verkauft, um ökonomisches<br />
Wachstum zu erzeugen. Aber dieser<br />
Wachstumskapitalismus ist ein sehr<br />
fragiles System. Nur eine kleine Störung<br />
reicht aus, um alles zusammenbrechen<br />
zu lassen.<br />
Wie bekommen wir wieder mehr Stabilität<br />
ins System?<br />
Indem wir jetzt das Gegenteil machen:<br />
Auf Wachstum verzichten und<br />
Schulden abbauen. Länder wie Spanien,<br />
Finnland und Belgien haben ihre Schuldenstände<br />
schon deutlich gesenkt.<br />
Kritiker einer solchen Sparpolitik warnen<br />
schon vor der Gefahr einer Deflation.<br />
Selbst EZB-Chef Mario Draghi<br />
achtet peinlich darauf, das Wort gar<br />
nicht erst in den Mund zu nehmen, und<br />
spricht, wenn überhaupt, vom D-Wort.<br />
Die Gefahr einer Deflation sehe ich<br />
aktuell nicht. Wir Ökonomen wissen<br />
auch gar nicht so genau, was heute bei<br />
einer Deflation passieren würde, weil das<br />
Thema nicht hinreichend untersucht ist.<br />
Nach der Theorie werden die Waren billiger,<br />
das kann dazu führen, dass Kunden<br />
ihre Einkäufe hinauszögern, weil<br />
sie auf noch weiter sinkende Preise hoffen.<br />
Ein mögliches Ergebnis wäre ein<br />
Abwärtsstrudel, wie wir ihn in den USA<br />
Anfang der dreißiger Jahre erlebt haben.<br />
Heute reagieren Konsumenten auf niedrige<br />
Preise aber eher mit Einkaufslust –<br />
nicht mit Kaufzurückhaltung. Momentan<br />
fände ich eine leichte Deflation eigentlich<br />
angenehmer, weil der Wert meines Gel<strong>des</strong><br />
und meine Kaufkraft dabei steigen.<br />
Sie macht mich reicher, während mich<br />
eine hohe Inflation verarmen ließe.<br />
Ist der Verzicht auf Wachstum auch<br />
gleichbedeutend mit dem Ende der<br />
Gier?<br />
Nein, Gier ist eine der Ureigenschaften<br />
der Menschen. Sie ist immer gleichzeitig<br />
Motor <strong>des</strong> Fortschritts, aber auch<br />
Ursache <strong>des</strong> Absturzes. Insofern ist sie<br />
auch eng mit dem Kapitalismus verbunden.<br />
Aber wenn man die klassische Ökonomie<br />
betrachtet, wird das Bild schon<br />
differenzierter. Heute werden Befürworter<br />
einer wachstumsorientierten<br />
Wirtschaft eher rechts der politischen<br />
Mitte eingeordnet. Mich amüsiert das<br />
immer, weil eigentlich der Kommunismus<br />
das System war, das immer wachsen<br />
und wetteifern wollte. Jeder Fünf-Jahres-Plan<br />
sah Wachstum vor, die Leistung<br />
je<strong>des</strong> Arbeiters wurde gemessen. In der<br />
klassischen Ökonomie war der größte<br />
Gewinn <strong>des</strong> Reichtums der Müßiggang.<br />
Kapitalisten arbeiteten also, um faul sein<br />
Foto: Dominik Butzmann/Laif<br />
88<br />
<strong>Cicero</strong> – 6. 2014
zu können. Ein historischer Treppenwitz,<br />
dass die Griechen heute für ihre Faulheit<br />
beschimpft werden. Das liegt aber<br />
auch daran, dass heute alle, die nicht<br />
von früh bis spät arbeiten wollen, sofort<br />
als eher links eingeordnet werden. Aber<br />
das kann sich auch wieder ändern, eine<br />
stärkere Tendenz zu Teilzeitjobs zeichnet<br />
sich in einigen europäischen Ländern<br />
schon ab.<br />
Sie arbeiten selbst aber auch von früh<br />
bis spät, wollten ursprünglich Historiker<br />
werden, aber Ihr Vater hat Sie überzeugt,<br />
Ökonomie zu studieren. In Ihrer<br />
Arbeit sind Sie ein Grenzgänger, beschäftigen<br />
sich mit Philosophie, Geschichte<br />
und Ökonomie, gleichzeitig<br />
arbeiten Sie als Berater für eine der<br />
größten Banken Tschechiens. Wie passt<br />
all das zusammen?<br />
Genau so, anders könnte ich gar<br />
nicht arbeiten. Ich mag es nicht, wenn<br />
man die Welt nur durch die Augen eines<br />
Bankers, eines Philosophen oder eines<br />
Künstlers sieht. Ich möchte Brücken<br />
bauen zwischen den verschiedenen Fächern.<br />
Ich beschäftige mich in meiner Arbeit<br />
mit allem, was mir Spaß macht: Film,<br />
Literatur, Ökonomie, Philosophie und<br />
Geschichte. Das ist ein Ansatz aus der<br />
Renaissance. Als das Wissen der Menschheit<br />
zu groß wurde, haben wir es aufgeteilt,<br />
damit wir es gemeinsam wieder zusammenfügen<br />
können. Das passiert aber<br />
nicht mehr. Statt<strong>des</strong>sen sind wir eine Gesellschaft<br />
von Fachidioten geworden, die<br />
die Welt nicht mehr verstehen.<br />
Anzeige<br />
LESEGENUSS BEGINNT<br />
MIT NEUG E<br />
Vorzugspreis<br />
Mit einem Abo sparen<br />
Sie gegenüber dem<br />
Einzelkauf.<br />
Ohne Risiko<br />
Sie gehen kein Risiko<br />
ein und können Ihr<br />
Abonnement jederzeit<br />
kündigen.<br />
Mehr Inhalt<br />
Monatlich mit Literaturen<br />
und zweimal im<br />
Jahr als Extra-Beilage.<br />
Ich möchte <strong>Cicero</strong> zum Vorzugspreis von 18,– Euro* kennenlernen!<br />
Bitte senden Sie mir die nächsten drei <strong>Cicero</strong>-Ausgaben für 18,– Euro* frei Haus. Wenn mir <strong>Cicero</strong> gefällt, brauche ich<br />
nichts weiter zu tun. Ich erhalte <strong>Cicero</strong> dann monatlich frei Haus zum Vorzugspreis von zurzeit 7,75 Euro/5,– Euro<br />
(für Studenten bei Vorlage der Immatrikulationsbescheinigung) pro Ausgabe inkl MwSt. (statt 8,50 Euro im Einzelverkauf).<br />
Falls ich <strong>Cicero</strong> nicht weiterlesen möchte, teile ich Ihnen dies innerhalb von zwei Wochen nach Erhalt der dritten<br />
Ausgabe mit. Verlagsgarantie: Sie gehen keine langfristige Verpflichtung ein und können das Abonnement jederzeit<br />
kündigen. <strong>Cicero</strong> ist eine Publikation der Ringier Publishing GmbH, Friedrichstraße 140, 10117 Berlin, Geschäftsführer<br />
Michael Voss. *Angebot und Preise gelten im Inland, Auslandspreise auf Anfrage.<br />
Meine Adresse:<br />
Vorname<br />
Name<br />
JETZT<br />
TESTEN!<br />
3 x <strong>Cicero</strong> nur<br />
18,– Euro*<br />
DREI<br />
Teilen Ihre Kollegen bei der Bank diesen<br />
Renaissance-Ansatz?<br />
Es ist wie bei einem Tischler, der<br />
tagsüber rechteckige Tische mit vier Beinen<br />
baut. Abends kommt er nach Hause,<br />
trinkt ein Glas Wein und beginnt herumzuphilosophieren:<br />
Brauchen Tische unbedingt<br />
vier Beine? Warum sitzen die<br />
Menschen in Asien gerne auf dem Boden?<br />
Und eines Tages fängt er an, Tische<br />
mit einem Bein zu bauen oder solche, die<br />
unter der Decke hängen. Für die Bank<br />
baue ich noch rechteckige, klassische Tische,<br />
aber es werden weniger. Und Fortschritte<br />
erzielen wir nur, wenn wir neue<br />
Sachen ausprobieren.<br />
Straße<br />
PLZ<br />
Telefon<br />
BIC<br />
IBAN<br />
Ort<br />
E-Mail<br />
Hausnummer<br />
Ich bin einverstanden, dass <strong>Cicero</strong> und die Ringier Publishing GmbH mich per Telefon oder E-Mail über interessante Angebote <strong>des</strong> Verlags<br />
informieren. Vorstehende Einwilligung kann durch das Senden einer E-Mail an abo@cicero.de oder postalisch an den <strong>Cicero</strong>-Leserservice,<br />
20080 Hamburg, jederzeit widerrufen werden.<br />
Datum<br />
Jetzt direkt bestellen!<br />
Telefon: 030 3 46 46 56 56<br />
Telefax: 030 3 46 46 56 65<br />
E-Mail: abo@cicero.de<br />
Shop: cicero.de<br />
Unterschrift<br />
<strong>Cicero</strong>-Leserservice<br />
20080 Hamburg<br />
Bestellnr.: 1140025<br />
Das Gespräch führte TOMÁŠ SACHER<br />
<strong>Cicero</strong> Test
KAPITAL<br />
Reportage<br />
SCHULLANDHEIM<br />
DER MÄCHTIGEN<br />
90<br />
<strong>Cicero</strong> – 6. 2014
Kein Treffen der Welt ist so sagenumwoben<br />
wie die Bilderberg-Konferenz. Die Mythen sind<br />
inzwischen zu einem Dickicht aus Fakt und Fiktion<br />
gewachsen. Ein Blick hinter die Kulissen zum<br />
60. Geburtstag der vermeintlichen Weltregierung<br />
Von CONSTANTIN MAGNIS<br />
Illustrationen MARCO WAGNER
KAPITAL<br />
Reportage<br />
<strong>Der</strong> Concierge ist alarmiert. „Eric“ steht auf<br />
seinem Namensschild, er hat die Augen<br />
aufgerissen und lächelt starr. Entweder<br />
liegt es daran, dass man dem Geheimnis<br />
seines Hotels auf die Spur gekommen ist.<br />
Oder aber er hält den Gast vor ihm für verrückt, der<br />
ihm von irgendwelchen „Bilderbergern“ erzählt. Einer<br />
Gruppe, die Verschwörungstheoretiker für die heimliche<br />
Weltregierung halten, die sich einmal im Jahr an<br />
einem geheimen Ort trifft. Bald soll es wieder so weit<br />
sein, Ende Mai, und zwar angeblich<br />
genau hier, in diesem Hotel,<br />
dem Marriott in Kopenhagen.<br />
„Wirklich? Das ist ja hochinteressant“,<br />
sagt Eric im Duktus<br />
angestrengt höflicher Deeskalation.<br />
„Dabei ist hier Ende<br />
Mai völlig normaler Hotelbetrieb.<br />
Aber die Geschichte klingt<br />
irre.“<br />
Zugegeben, das Hotelpersonal<br />
verhält sich widersprüchlich.<br />
Die Dame vom Restaurant stellt<br />
verwundert fest, dass am betreffenden<br />
Wochenende selbst mittags<br />
keine Tische buchbar sind,<br />
und erfährt nach kurzer Rücksprache,<br />
das komplette Haus<br />
sei tagelang geblockt, von einer<br />
„besonderen Gruppe“ mit<br />
„massenhaft Security“. <strong>Der</strong> Barkeeper lacht und sagt,<br />
Ende Mai sei hier immer Platz, definitiv keine Buchung<br />
nötig. <strong>Der</strong> Manager wiederum erklärt, im Mai sei in<br />
Dänemark Hochsaison, mit so vielen Touristen und<br />
Kreuzfahrtschiffen, dass das Hotel selbst die Lobby<br />
für Laufkundschaft schließen müsse, leider.<br />
Abgesehen davon klingt es tatsächlich außergewöhnlich:<br />
Dass sich rund 120 der einflussreichsten<br />
Figuren <strong>des</strong> Westens in Limousinen den Weg durchs<br />
Kopenhagener Fahrradgewirr bahnen sollen, um sich<br />
dann ausgerechnet hier, in einem zehnstöckigen, weithin<br />
einsehbaren Fünf-Sterne-Komplex zwischen Hafenwasser<br />
und einer vierspurigen Straße zu treffen.<br />
Dass in den nach Orangenblüte duftenden Konferenzräumen,<br />
im Dampfbad oder auf den braunen Samtquadraten<br />
der Hotelbar bald „Bilderberger“ wie die Chefs<br />
von Facebook, Coca-Cola und Goldman Sachs mit Regierungschefs<br />
und Staatsoberhäuptern zusammensitzen<br />
und das Weltgeschehen besprechen könnten.<br />
KEIN TREFFEN DER WELT ist so sagenumwoben wie die<br />
Bilderberg-Konferenz. Die Mythen sind inzwischen zu<br />
einem Dickicht aus Fakt und Fiktion gewachsen. Wir<br />
haben in den vergangenen Monaten mit Teilnehmern<br />
und Organisatoren im In- und Ausland gesprochen, um<br />
zu begreifen, welche Regeln für die Teilnehmer gelten<br />
und was auf der Konferenz vorgeht, von der man bisher<br />
vor allem Bizarres zu hören bekam. Die meisten<br />
Bilderberger sagten nur etwas, wenn ihnen zugesichert<br />
wurde, nicht direkt zitiert zu werden.<br />
In den siebziger Jahren begannen Verschwörungstheoretiker<br />
wie der Amerikaner Jim Tucker zu<br />
versuchen, die Existenz der Konferenz zu beweisen<br />
– und mit ihr die vermeintlichen Pläne der Bilderberger<br />
zur Errichtung einer neuen Weltordnung. Slobodan<br />
Milosevic soll davon genauso überzeugt gewesen<br />
sein wie Osama bin Laden. Für<br />
David Copeland, der 1999 drei<br />
Bomben in London zündete, ist<br />
Bilderberg die „jüdische Weltverschwörung“.<br />
Fidel Castro erklärte<br />
2010, Bilderberg führe die<br />
Jugend der Welt in einen „atomaren<br />
Holocaust“. Und der Ex-<br />
BBC-Fußballreporter und selbst<br />
ernannte Heiler David Icke behauptet<br />
bis heute, über Bilderberg<br />
werde die Menschheit<br />
versklavt, und zwar von außerirdischen<br />
Reptilien.<br />
Aber warum halten Diktatoren,<br />
Terroristen und Spinner<br />
die Bilderberg-Treffen für so gefährlich?<br />
Offenbar ist den Veranstaltern<br />
der Konferenz, die<br />
tatsächlich bereits seit 60 Jahren<br />
existiert, ihre Diskretion zum Verhängnis geworden.<br />
<strong>Der</strong> polnische Politikberater Józef Retinger, ein<br />
Freund Churchills und Sekretär <strong>des</strong> Schriftstellers<br />
Joseph Conrad, organisierte 1954 das erste Treffen,<br />
um im Kalten Krieg die Bindung zwischen Nordamerika<br />
und Westeuropa zu festigen. Es fand unter dem<br />
Vorsitz von Prinz Bernhard der Niederlande im holländischen<br />
Hotel de Bilderberg statt.<br />
Bei Bilderberg – das war und ist die Idee – kommen<br />
die transatlantischen „Movers and Shakers“ aus<br />
Politik, Wirtschaft und Medien zusammen, um sich<br />
über die Probleme der westlichen Welt – früher eher<br />
der drohende Atomkrieg, heute eher die Eurokrise –<br />
auszutauschen und so Konflikten vorzubeugen. Entscheidungen<br />
– heißt es – werden keine getroffen, das<br />
Ziel sei die Debatte.<br />
Zu den Gästen zählten deutsche Politiker wie Gerhard<br />
Schröder, Roland Koch, Angela Merkel, Jürgen<br />
Trittin oder Christian Lindner genau wie Amazon-<br />
Chef Jeff Bezos, NSA-Chef Keith Alexander, EU-Kommissionschef<br />
José Manuel Barroso, Microsoft-Gründer<br />
Bill Gates oder Ex-IWF-Chef Dominique Strauss-<br />
Kahn. Teilnehmer kommen explizit als Privatpersonen<br />
und nicht als Vertreter ihrer Institutionen. Gästelisten<br />
wurden früher gar nicht, heute erst unmittelbar<br />
vor der Konferenz veröffentlicht. Damit frei und offen<br />
92<br />
<strong>Cicero</strong> – 6. 2014
gesprochen wird, gilt: Niemand wird zitiert, Gesagtes<br />
bleibt privat. Diese Kombination aus Heimlichkeit<br />
und Macht hat unzählige selbsternannte „Bilderberg-<br />
Jäger“ motiviert, die „wahre Agenda“ der Bilderberger<br />
zu entlarven und ihre vorab geheimen Tagungsorte<br />
zu enttarnen. Die Bilderberg-Konferenz selbst veröffentlicht<br />
vorab auf www.bilderbergmeetings.org nicht<br />
mehr als das Gastgeberland.<br />
Es hat der Bilderberg-Legende auch nicht geschadet,<br />
dass sich Neugierige, die in früheren Jahren im<br />
Umfeld der Tagungshotels recherchierten,<br />
über teils stundenlange<br />
Polizeiverhöre beklagten<br />
– darunter der Reporter<br />
Thomas Campbell, der EU-Parlamentarier<br />
Mario Borghezio<br />
oder der Guardian-Journalist<br />
Charlie Skelton.<br />
Abenteuerlich klingt auch<br />
der Bericht <strong>des</strong> Journalisten Jon<br />
Ronson, der 1999 in Portugal auf<br />
der Suche nach dem Treffpunkt<br />
der Bilderberger von einem Geheimdienstler<br />
über Landstraßen<br />
verfolgt worden sein will,<br />
um schließlich vor dem Luxushotel<br />
Cesar Park ungläubig zu<br />
erleben, wie in Limousinen Figuren<br />
wie der Ex-US-Außenminister<br />
Henry Kissinger, der einstige<br />
Fiat-Chef Umberto Agnelli, der Milliardär David<br />
Rockefeller oder der damalige Weltbankchef James<br />
Wolfensohn an ihm vorbeirollten.<br />
In einem dieser Fahrzeuge saß damals auch Werner<br />
A. Perger, Journalist und ehemaliger stellvertretender<br />
Chefredakteur der Zeit. Er sagt heute: „So<br />
abenteuerlich ist Bilderberg von innen nicht.“ Neben<br />
Blättern wie dem Economist oder der New York<br />
Times sind traditionell meist auch Vertreter der Zeit<br />
geladen. Als Mitdiskutanten wohlgemerkt, nie als<br />
Reporter.<br />
Königin Beatrix<br />
hat kein Geld<br />
dabei. Da muss<br />
man abends an<br />
der Bar schon<br />
mal ihren<br />
Rotwein zahlen<br />
Perger erinnert sich, wie er sich eines Abends an<br />
der Hotelbar auf einmal im Plausch mit der niederländischen<br />
Königin Beatrix wiederfand: „Sie hatte kein<br />
Portemonnaie dabei, wie es sich für eine Herrscherin<br />
gehört. ‚No Problem‘, habe ich gesagt, und ihren Rotwein<br />
gezahlt.“<br />
Das wirklich Spannende an der Konferenz, sagt<br />
Perger, sei die Chance, Kontakte zu knüpfen und ungezwungen<br />
Leute zu befragen, die einem „sonst nie im<br />
Leben einen Termin geben“ würden, wie ihm der Chef<br />
einer großen Bank versicherte.<br />
„Für Journalisten der Jackpot.<br />
Aber das einzelne Event als solches<br />
ist keine Story, außer dass<br />
es stattgefunden hat“, sagt er.<br />
„Manche haben während der<br />
Debatten völlig leeres Stroh gedroschen<br />
und sich zu jedem Mist<br />
gemeldet, man merkte: Die wollen<br />
wieder eingeladen werden.“<br />
Die Auswahl der Gäste ist<br />
das Privileg <strong>des</strong> Bilderberg-<br />
Führungszirkels, <strong>des</strong> „Steering<br />
Committees“ um den Chairman,<br />
aktuell Henri de Castries,<br />
CEO <strong>des</strong> französischen Versicherungskonzerns<br />
Axa. Mit Airbus-Chef<br />
Tom Enders und Klaus<br />
Kleinfeld, Chef <strong>des</strong> US-Aluminiumherstellers<br />
Alcoa, gehören<br />
auch zwei Deutsche dazu. Die Einladung erfolgt durch<br />
den persönlichen Brief eines Komiteemitglieds, formelle<br />
Kriterien gibt es nicht.<br />
Intelligenz und Abstraktionsvermögen zählen<br />
mehr als Einfluss, Erfahrung oder Prominenz. <strong>Der</strong><br />
klassische Gast ist Aufsteiger, Marktliberaler, Transatlantiker<br />
und Lieferant aufregender Perspektiven. Stellt<br />
sich einer als „nicht sehr interessant“ heraus, war er<br />
das <strong>letzte</strong> Mal eingeladen.<br />
Je<strong>des</strong> Jahr im Herbst legt das Komitee Themen<br />
und Gäste der nächsten Konferenz fest. Im Oktober<br />
Anzeige<br />
Foto: Marc Darchinger groothuis.de<br />
Ein neues »Reich der Mitte«<br />
Xuewu Gu zeigt, wie China und der Westen voneinander lernen<br />
und ihre Gegensätze überwinden können<br />
Xuewu Gu<br />
Die Große Mauer in den Köpfen<br />
China, der Westen und die Suche nach Verständigung<br />
214 Seiten | Euro 17,– (D)<br />
Auch als E-Book erhältlich.<br />
Erhältlich im Buchhandel oder über www.edition-koerber-stiftung.de
KAPITAL<br />
Reportage<br />
2001 traf man sich dafür zu einem Dinner im New Yorker<br />
Metropolitan Museum. Dick Cheney, damals US-<br />
Vizepräsident, war nach dem Attentat vom 11. September<br />
wochenlang abgetaucht. Als Gastredner beim<br />
Bilderberg Steering Committee aber war er plötzlich<br />
wieder da und hielt im Kerzenlicht eine apokalyptische<br />
Rede über die Bedrohung durch den Terrorismus. Das<br />
Komitee finanziert ein Sekretariat an der<br />
holländischen Universität Leiden und sammelt Gelder<br />
für kommende Konferenzen. Neuerdings zahlen Teilnehmer<br />
für ihre Zimmer selbst.<br />
Bleiben die Kosten für Shuttle,<br />
Mahlzeiten, vier Tage Vollsperrung<br />
eines Fünf-Sterne Hotels,<br />
vor allem aber Sicherheitsleute,<br />
die je<strong>des</strong> Sandwich untersuchen.<br />
Die Rechnung zahlen am<br />
Ende meist Firmen, deren Chefs<br />
bereits Bilderberger sind oder<br />
mit ihrer Spende welche werden.<br />
Immer frage Bilderberg die Firmen,<br />
nie andersherum, erklärt<br />
ein Ex-Komiteemitglied: „Niemand<br />
kann sich einkaufen.“ Siemens,<br />
EADS, Axel Springer, Allianz,<br />
Shell, Daimler – auf der<br />
Gästeliste mangelt es jedenfalls<br />
nicht an potenziellen Sponsoren.<br />
„Es gibt keine andere Konferenz<br />
von diesem Kaliber ohne<br />
Öffentlichkeit“, sagt ein Teilnehmer. „Davos ist dagegen<br />
reines PR-Blabla. Hier sagen die Leute wirklich,<br />
was sie denken, das verändert die Art der Beiträge.<br />
Sie erzählen nichts komplett anderes, aber eben die<br />
paar Sätze mehr, auf die es ankommt. So lernt man<br />
unglaublich viel.“<br />
SELBST STAATSCHEFS REISEN ohne Assistenten an.<br />
So spielen sich bemerkenswerte Szenen ab, man bekommt<br />
einen Eindruck davon, wenn Bilderberger von<br />
früheren Konferenzen erzählen: Wie ein schüchterner<br />
Bill Clinton von seinem Parteifreund Vernon Jordan<br />
mit den Worten „meet our next President“ durch die<br />
Reihen geschleift wurde. Wie Colin Powell morgens<br />
nach dem Joggen verschwitzt durch die Lobby stolperte.<br />
Wie Jean-Claude Trichet als damaliger EZB-<br />
Chef ungehemmt über Europas strukturelle Verklemmung<br />
schimpfte. Einmal kriegten sich Paul Wolfowitz<br />
und Dominique de Villepin über den Irakeinsatz in die<br />
Haare, ein anderes Mal stritten Josef Ackermann und<br />
Jürgen Schrempp sich laut über das Thema Offshoring.<br />
„Wie auf einer Klassenfahrt“, sagt ein Gast.<br />
Ein Schullandheim, <strong>des</strong>sen Ablauf streng geregelt<br />
ist. Donnerstags Abholung vom Flughafen, Begrüßungscocktail<br />
und, wie jeden Abend, Dinner ohne<br />
Platzierung. Nur der Chairman und die traditionell<br />
Es gibt keine<br />
andere<br />
Konferenz dieses<br />
Kalibers. Davos<br />
ist dagegen<br />
nur reines<br />
PR-Blabla<br />
anwesende holländische Königin haben eigene Tische,<br />
an die mit einer schriftlichen Einladung gebeten wird.<br />
Bis Sonntag folgen etwa ein Dutzend Podiumsdiskussionen<br />
zu aktuellen Themen, von der Syrienkrise über<br />
EU-Reformen bis zur Energiepolitik, etwa vier Diskutanten<br />
auf der Bühne, die restlichen Gäste sitzen alphabetisch<br />
aufgereiht im Publikum davor.<br />
Samstagnachmittags unternehmen die Bilderberger<br />
Ausflüge. In Norwegen fuhren sie 2001 mit einem<br />
Dampfer durch die Fjorde. In Italien schipperten<br />
sie 2004 mit einem Boot<br />
über den Lago Maggiore. In<br />
Bayern brachte sie 2005 ein<br />
Bus auf eine Alm, wo man für<br />
sie Schuhplattler tanzte und jodelte.<br />
Und in Griechenland gingen<br />
sie 2009 zusammen im Mittelmeer<br />
schwimmen.<br />
2012 war der Spaß vorbei.<br />
Am Samstag der Konferenz<br />
bei St. Moritz ging ein kleiner<br />
Trupp, darunter Peer Steinbrück,<br />
Google-Chef Eric Schmidt und<br />
Tom Enders, in den Bergen wandern.<br />
Die Protestler, die seit Jahren<br />
die Tagungshotels umlagern,<br />
nahmen die Verfolgung auf, hielten<br />
ihnen Kameras ins Gesicht<br />
und schimpften sie mit Megafonen<br />
„Lan<strong>des</strong>verräter“, „Menschenhasser“<br />
und „Kriegsverbrecher“, bis die Wanderer<br />
ins Hotel flüchteten. „Ungeheuerlich“ fand Steinbrück<br />
das. Im Jahr darauf verließ man das Hotel gar nicht erst.<br />
Mancher sieht aufgrund der ausufernden Protestkultur<br />
bereits das Ende der Konferenz nahen. Immer<br />
öfter sagen Gäste ab, weil sie nicht pausenlos beteuern<br />
möchten, kein Teil einer Weltverschwörung zu sein.<br />
Wäre die Welt denn eine andere ohne Bilderberg?<br />
Selbst Teilnehmer wie Werner A. Perger tun sich<br />
schwer mit der Frage nach konkreten politischen Auswirkungen<br />
<strong>des</strong> Treffens. „Entscheidend sind ja oft nicht<br />
Konferenzen, sondern die Dinge, die dort angebahnt<br />
werden“, sagt er.<br />
„Jedenfalls“, sagt ein Ex-Mitglied <strong>des</strong> Steering<br />
Committees, „hat Bilderberg als Gruppe immer einen<br />
Informationsvorsprung.“ Kein Zweifel. Einen Tag nach<br />
dem Besuch im Hotel, in dem offiziell noch nie jemand<br />
von der Konferenz gehört haben will, trifft der Reporter<br />
einen <strong>letzte</strong>n Bilderberger zum Gespräch und erzählt,<br />
dass er gerade aus Kopenhagen kommt. „Das“,<br />
sagt der Herr, „wissen wir bereits.“<br />
CONSTANTIN MAGNIS ist Ressortleiter<br />
Reportagen bei <strong>Cicero</strong>. Er mag Kopenhagen<br />
und ist auf Konferenzen ein faszinierender<br />
Gesprächspartner. Ende Mai hätte er noch Zeit<br />
Foto: Privat<br />
94<br />
<strong>Cicero</strong> – 6. 2014
STIL<br />
„ Die Aura von<br />
erfolgreichen älteren<br />
und sehr souveränen<br />
Frauen irritiert<br />
Männer und jüngere<br />
Frauen. Sie fühlen<br />
sich bedroht. Auch so<br />
kann das Alter gegen<br />
uns arbeiten “<br />
Tori Amos, Sängerin, 50 Jahre alt, Seite 106<br />
95<br />
<strong>Cicero</strong> – 6. 2014
Ur-Milf: Mrs. Robinson aus<br />
„Die Reifeprüfung“, gespielt von<br />
Anne Bancroft, hier als Montage.<br />
Im Film sieht man sie nicht nackt
STIL<br />
Porträt<br />
DER SIEG DER MILF<br />
Von den Pornoseiten über die Spielplätze in die Chefinnen-Etagen: Ein fragwürdiges<br />
Kompliment findet Eingang in die Sprache: Milf – „Mother I’d Like to Fuck“<br />
Von LENA BERGMANN<br />
Foto: Anne Bancroft fantasy artwork/©Ision-Fakes.com<br />
Vor der Sicherheitskontrolle am<br />
New Yorker Flughafen ist eine<br />
Frau mittleren Alters damit beschäftigt,<br />
hektisch ihre Flasche Saft<br />
auszutrinken. Auf dieser steht in großer<br />
schwarzer Schrift: „MILF“. Und daneben,<br />
etwas kleiner: „11 Dollar“. Die<br />
Frau – blond, modisch gekleidet – hat sich<br />
den Drink etwas kosten lassen. Anscheinend<br />
ist sie auf psychologisch raffiniertes<br />
Marketing reingefallen. Denn Milf<br />
bedeutet „Mother I’d Like to Fuck“, zu<br />
Deutsch ungefähr: „Mutter, mit der ich<br />
schlafen möchte“.<br />
Zwei fröhliche Sicherheitsbeamtinnen<br />
beobachten die Frau: „Schau mal,<br />
wie der Drink heißt!“, feixt die eine.<br />
Beide kichern. „Passt zu der Milf, die<br />
ihn trinkt!“ In Amerika weiß jeder, was<br />
eine Milf ist. Längst gibt es dort ein Milf-<br />
Genre in der Pornoindustrie, Milf-Diäten<br />
und Milf-T-Shirts.<br />
Statistiken <strong>des</strong> Online-Porno-Giganten<br />
Pornhub zufolge gehören „Teen“<br />
und „Milf“ bei amerikanischen Nutzern<br />
der Seite zu den drei häufigsten Suchbegriffen<br />
– den dritten möchte ich Ihnen<br />
an dieser Stelle ersparen. Aber es<br />
ist doch bemerkenswert, dass sich zum<br />
Männerfantasie-Klassiker <strong>des</strong> Teenagermädchens<br />
nun auch deren sexy Mutter<br />
gesellt hat.<br />
Seinen Ursprung hatte der Begriff in<br />
der Pornografie. In die Popkultur eingeführt<br />
wurde er durch den lustig-primitiven<br />
Pubertäts-Blockbuster „American<br />
Pie“ von 1999, in dem die verführerische<br />
Mutter eines Schülers seinen Freunden<br />
die Köpfe verdreht. Inzwischen benutzen<br />
ihn in den USA sogar Mütter selbst, um<br />
sich Komplimente zu machen. Was sich<br />
in den USA ausbreitet, ist häufig kurz danach<br />
auch in Europa ein Begriff.<br />
Zur nachträglichen Ehren-Ur-Milf<br />
wurde schnell Mrs. Robinson gekürt, die<br />
1967 im Oscar-prämierten Skandalfilm<br />
„Die Reifeprüfung“ von Anne Bancroft<br />
dargestellt wurde. Terminologisch im<br />
Übrigen nicht ganz korrekt: Aufgrund<br />
der offensiven Art, mit der sie den College-Absolventen<br />
Benjamin in ihr Bett<br />
drängt, wunderbar passiv gespielt von<br />
Dustin Hoffman, würde man sie heute<br />
eher als „Cougar“ bezeichnen. Englisch<br />
für „Puma“, steht dieser Begriff wiederum<br />
für die Frau im fortgeschrittenen<br />
Alter, die aktiv Jagd auf junge Männer<br />
macht. Die Milf hingegen hat es als souveränes<br />
Objekt der Begierde nicht nötig,<br />
auf die Jagd zu gehen. Sie kann ganz entspannt<br />
entscheiden, wer in ihr Bett darf.<br />
IN DEUTSCHLAND ist der Terminus Milf<br />
auch schon angekommen, allerdings noch<br />
nicht in der Breite. Auf dem neuen Album<br />
der Sängerin und Mutter Judith Holofernes<br />
heißt ein Lied „M.I.L.F.“, in einem<br />
Video-Autotest auf der Website der Welt<br />
wird der neue Range Rover als „die ultimative<br />
Milf-Karre“ angepriesen, und<br />
der Moderator Jan Böhmermann lässt auf<br />
ZDF Neo als Aprilscherz den Schlagerbarden<br />
Guildo Horn als „Milf-Bachelor“<br />
auf Mütter los. Die meistgesuchte Kategorie<br />
der deutschen Pornhub-Nutzer hingegen<br />
lautet – neben dem obligatorischen<br />
„Teen“ – „German“. Beim schnellen Date<br />
mit sich selbst ergötzt sich der deutsche<br />
Mann vor dem Bildschirm also bevorzugt<br />
an heimischen Teenagern. Mütter als erotische<br />
Fantasie haben sich hierzulande<br />
noch nicht durchgesetzt.<br />
Dies erstaunt, da das öffentliche Leben<br />
in Deutschland aus Männerperspektive<br />
doch eine Vielzahl an Milf-Fantasien<br />
zu bieten hat. Angefangen bei Manuela<br />
Schwesig, 40, als Polit-Milf, über die nach<br />
all den Jahren auf dem Feld der Musik-<br />
Milfs immer noch führende Nena, 54, bis<br />
hin zur Tatort-Milf Simone Thomalla, 49.<br />
Nicht zu vergessen natürlich auch die<br />
vierfache Mutter und transatlantische<br />
Elite-Milf Heidi Klum, 40, derzeit mit<br />
dem Künstlersohn Vito Schnabel, 27, liiert.<br />
Klum ist zwar nicht gerade das beste<br />
Aushängeschild für das Land der Dichter<br />
und Denker, aber es geht ja auch nur<br />
um das Eine.<br />
Paradox ist, dass im Zeitalter politischer<br />
Korrektheit niemand Anstoß an<br />
diesem doch recht anzüglichen „Kompliment“<br />
zu nehmen scheint. Sind Mütter<br />
so glücklich darüber, auch mit Kinderwagen<br />
oder gar VW Touran noch als<br />
begehrenswert wahrgenommen zu werden,<br />
dass sie über die im Grunde ja unverschämte<br />
Objektifizierung hinwegsehen,<br />
die dem Begriff der Milf innewohnt?<br />
Machen Mütter die Folgen <strong>des</strong> Alters und<br />
der Schwerkraft so große Angst, dass sie<br />
sich über Komplimente freuen, die sie<br />
früher als Affront empfunden hätten?<br />
Oder sind berufstätige Mütter heute so<br />
selbstbewusst, dass sie sich diese irgendwie<br />
doch schmeichelhafte Objektifizierung<br />
einfach gönnen können?<br />
Vielleicht bewerten manche es doch<br />
als positiv, dass im Zeitalter <strong>des</strong> Jugendwahns<br />
auch die reife Frau die Fantasien<br />
der männlichen Internetnutzer beflügelt.<br />
Womöglich <strong>des</strong>wegen, weil junge Männer<br />
gleichaltrige Frauen heute zu sehr als<br />
Konkurrentinnen wahrnehmen. Oder äußert<br />
sich hier eine Art Fan-Phänomen?<br />
Eine Hommage an die moderne Frau:<br />
Nicht nur im Beruf, sondern auch im familiären<br />
Leben ist sie ein souveränes<br />
Überwesen, das in der Vielseitigkeit ein<br />
zeitgenössisches Leistungsideal erfüllt –<br />
und dabei auch noch sexy aussieht. Wir<br />
bleiben für Sie dran.<br />
LENA BERGMANN ist Mitte 30 und<br />
Mutter. Sie leitet das <strong>Cicero</strong>-Ressort Stil<br />
97<br />
<strong>Cicero</strong> – 6. 2014
STIL<br />
Porträt<br />
DEIN DADA, MEIN JURA<br />
Wie vertragen sich Kunst und Regeln? Das ist die Lieblingsfrage <strong>des</strong> Rechtsanwalts<br />
Pascal Decker – egal ob es um Designerspielzeug oder Meeses Hitlergruß geht<br />
Von SARAH-MARIA DECKERT<br />
Wir beginnen auf der Herrentoilette.<br />
Das mag nicht üblich<br />
sein, macht aber Sinn, wenn<br />
man Pascal Deckers Arbeit verstehen<br />
will. Dort, an einer der weiß gekachelten<br />
Wände, hängt ein kleiner schwarzer<br />
Rahmen. Darin haftet hinter dem Glas etwas<br />
erhaben ein elfenbeinfarbenes Stück<br />
Papier, auf das mit einer Reiseschreibmaschine<br />
sechs Zeilen getippt wurden:<br />
„Weißes beweißen / Schwarzes beschwärzen<br />
/ Geweißtes beschwärzen /<br />
Geschwärztes beweißen / Entweißtes beweißen<br />
/ Entschwärztes beschwärzen.“<br />
Pascal Decker lacht. Ein bisschen<br />
Dada und seine Laune hebt sich.<br />
Decker, 44, ist zuallererst Kunstliebhaber.<br />
Kunstanwalt erst in zweiter Instanz.<br />
Kunstsammler vielleicht in dritter.<br />
Die kleine Papierarbeit auf der Herrentoilette<br />
seiner Kanzlei im Pergamon-Palais<br />
in Berlin-Mitte ist eines der ersten<br />
Stücke, mit denen er vor gut zehn Jahren<br />
Kunst zu sammeln begann. Sie ist auch<br />
eines seiner liebsten, weil sie für Decker<br />
genau das beschreibt, was den Kern seiner<br />
Arbeit ausmacht. Denn das Recht ist<br />
für Pascal Decker vor allem eines: Interpretationssache.<br />
Ein Passepartout. Ein<br />
Spiel zwischen Schwarz und Weiß, das<br />
sich meistens doch immer in Grau und<br />
Grau verliert, mit Abstufungen. „Eine<br />
Sache ist fast nie nur schwarz oder weiß“,<br />
sagt er. „Meine Aufgabe ist es dann, die<br />
Dinge zu pointieren.“<br />
Den Flur geht es hinunter, vorbei an<br />
einer wandfüllenden Schwarz-Weiß-Fotografie<br />
der langen Speerschnauze eines<br />
abgetrennten Marlinfischkopfs und<br />
einem Paar Gummistiefel mit Rollen<br />
an der Sohle. Decker nimmt im großen<br />
Konferenzraum an der Stirn eines langen<br />
Holztischs Platz. Auf dem Regal hinter<br />
ihm steht eine kleine Plastik, halb Junge,<br />
halb Elefant. Decker hat ein Faible für<br />
Skurriles. Die Grenze zwischen abstrakt<br />
und konkret amüsiert ihn. Darin steckt<br />
für ihn auch eine juristische Komponente.<br />
„Als Kunstanwalt geht es nicht um die<br />
reine Rezeption von Kunst, sondern darum,<br />
Kunst in einem neuen Deutungszusammenhang<br />
zu sehen.“<br />
Decker ist im Zivilrecht zu Hause,<br />
befasst sich viel mit Streitigkeiten um<br />
Urheber- und Markenrecht. Was er am<br />
Recht mag, ist die Möglichkeit, es zu formen.<br />
So geschehen im November 2013.<br />
Vor dem Bun<strong>des</strong>gerichtshof erstritt seine<br />
Kanzlei für die Designerin eines erfolgreichen<br />
Kinderspielzeugs eine Änderung<br />
in der Rechtsprechung. <strong>Der</strong> BGH entschied<br />
damals erstmals, dass auch Spielzeug<br />
urheberrechtlichen Schutz genießen<br />
könne, und damit, dass die Designerin<br />
auch nachträglich Anspruch auf eine höhere<br />
Vergütung habe.<br />
VOR GERICHT ZÄHLT der Auftritt. Decker<br />
sieht aus wie ein smarter Anwalt aus der<br />
amerikanischen Justiz-Serie „Boston Legal“.<br />
Man nimmt ihm fast nicht ab, dass<br />
er aus einem altlinken Haushalt stammt.<br />
„Alles sehr Anti-Establishment“, wie er<br />
sagt. Heute trägt er gerne Maßgeschneidertes,<br />
fährt aber Fahrrad. 1991 kam er<br />
nach Berlin. Das, was später die deutsche<br />
Kulturhauptstadt werden sollte, war<br />
erst im Entstehen. Dann kam die erste<br />
Biennale. Pascal Decker sah die Zahl<br />
der Künstler, Galerien und Unternehmen<br />
mit Kunstsammlungen wachsen sowie<br />
den Bedarf an Rechtsberatung zu<br />
Sammlungsaufbau, Stiftungsrecht und<br />
Nachlassgestaltung. Deckers Spezialität.<br />
2004 gründete er die Kanzlei dtb<br />
Rechtsanwälte, in der er seither mittelständische<br />
Unternehmen, Verbände, Museen,<br />
Galerien, Künstler und Sammler zu<br />
allen Fragen <strong>des</strong> Kunst- und Stiftungsrechts<br />
berät.<br />
Heute ist er Teil der Szene. Mit Monika<br />
Grütters ist er Vorstand der gemeinnützigen<br />
Stiftung „Brandenburger Tor“,<br />
die innovative Vorhaben in den Bereichen<br />
Kultur, Bildung oder aber auch Forschung<br />
fördert. Spätestens seit er 2013 einen Freispruch<br />
für den Künstler Jonathan Meese<br />
erstritt, der während eines Podiumsgesprächs<br />
den rechten Arm zum Hitlergruß<br />
hob, hat ihn auch das deutsche Feuilleton<br />
auf dem Tableau. Damals berief sich Decker<br />
auf den „offenen Kunstbegriff“, bei<br />
dem Kunst keinen formalen Kriterien folgt,<br />
sondern aus dem Kontext heraus gelesen<br />
werden muss. So wurde das Podiumsgespräch<br />
zur Performance, der Hitlergruß<br />
zum Stilmittel und Meeses Freispruch<br />
ein Sieg für die Kunstfreiheit. <strong>Der</strong> Strafrechtsparagraph<br />
86a, der das Zeigen von<br />
Nazi-Symbolen verbietet, besteht zwar<br />
noch immer. Was sich aber mit Decker geändert<br />
hat, ist ein kleines Mosaiksteinchen<br />
in der Interpretation dieser Norm.<br />
Die Auseinandersetzung mit dem<br />
künstlerischen Werk, Galerie- und Atelierbesuche<br />
setzen ein Maß an Flexibilität<br />
und Sensibilität voraus. „Ich muss<br />
den Künstler in seiner Welt abholen, auch<br />
wenn ich sie nicht immer verstehe“, sagt<br />
Decker. Nicht selten prallen vor Gericht<br />
Kulturen aufeinander: Auf der einen Seite<br />
das streng formelle juristische System.<br />
Auf der anderen der Künstler, mit ganz<br />
eigenen Perspektiven. Dass sich diese<br />
Seiten manchmal nur schwer in Einklang<br />
bringen lassen, ist ihm klar. Dann denkt<br />
er wieder an das kleine Stück Papier auf<br />
der Herrentoilette und fängt an, Weißes<br />
ein bisschen zu entweißen, Schwarzes ein<br />
bisschen zu entschwärzen.<br />
SARAH-MARIA DECKERT arbeitet als<br />
freie Journalistin in Berlin. Den Satz „Wenn<br />
Sie mir nun bitte auf die Herrentoilette<br />
folgen wollen“ lässt sie sich nun rahmen<br />
Foto: Maurice Weiss/Ostkreuz für <strong>Cicero</strong><br />
98<br />
<strong>Cicero</strong> – 6. 2014
STIL<br />
Typologie<br />
FERNSEHEN 2014<br />
Von LENA BERGMANN<br />
Illustration SUSANN STEFANIZEN<br />
Zappen, Streamen, Beamen. Fernsehen ist nicht<br />
gleich Fernsehen. Unsere Autorin hat vier Zuschauertypen<br />
identifiziert, rechtzeitig zur Fußball-WM<br />
100<br />
<strong>Cicero</strong> – 6. 2014
DER PIRAT<br />
<strong>Der</strong> Pirat lebt meist allein, in einer kleinen, aber<br />
schönen Wohnung in einem rauen, aber kommenden<br />
Innenstadtquartier. Im Alter bis Anfang<br />
30 ist er Student, Grafiker, Architekt – gemeinhin<br />
das, was man heute einen Kreativen nennt. Sein Einkommen<br />
ist meist recht schmal, und so setzt er Prioritäten:<br />
Die teuersten Gegenstände in seiner Wohnung<br />
sind das klassische Rennrad von Colnago (Ebay) und<br />
das optimierte, getunte, total vernetzte neueste Mac-<br />
Book Pro von Apple mit 15-Zoll-Retina-Display.<br />
Seit über einem Jahrzehnt hat er keinen Fernseher<br />
mehr, geschweige denn einen Blick in ein Fernsehprogramm<br />
geworfen. Dennoch schaut er ungeheuer viel<br />
fern, ausschließlich auf seinem MacBook, fast nur amerikanische<br />
Serien im Original, aktuell „Game of Thrones“<br />
(HBO) und „The Americans“ (FX). „Mad Men“<br />
(AMC) findet er langweilig, und der neuen HBO-Serie<br />
„Silicon Valley“ steht er nach den ersten zwei Folgen<br />
eher skeptisch gegenüber. Manchmal fragt er sich, im<br />
Schneidersitz auf seinem dänischen Fünfziger-Jahre-<br />
Sessel (wieder Ebay): Ist die goldene Ära der Serie<br />
schon wieder over?<br />
In seinem Regal (noch Billy) steht als Buchstütze<br />
eine externe Festplatte, die LaCie Blade Runner mit<br />
vier Terabyte Speicherkapazität, in der er seine Beute<br />
hortet, <strong>des</strong>ignt von Philippe Starck. Er sammelt. Obwohl<br />
er in die erste Saison von „Mad Men“ nie mehr<br />
hineinschauen wird (und ihn die Serie, wie gesagt, anödet),<br />
legt er Wert auf die Vollständigkeit seines digitalen<br />
Archivs. Seine Gesichtshaut ist weiß, trotz<br />
Rennrad, ein Indoortyp. Zum Public Viewing geht er<br />
allerdings raus. WM bedeutet für ihn Socializing.<br />
Er ist es nicht gewohnt, im Internet für etwas zu<br />
bezahlen, schon gar nicht für Serien, deren totale Verfügbarkeit<br />
für ihn schon lange selbstverständlich ist.<br />
Auf Raubzug geht er auf wechselnden Filehoster-Sites,<br />
seit über einem Jahr nun schon bei Uploaded.net, wo er<br />
sogar Abonnent ist – „bei der Mafia“, wie er es Freunden<br />
gegenüber scherzhaft formuliert. Streaming-Sites<br />
wie movie4k.to findet er läppisch, der Phase mit Torrent-Sites<br />
wie Piratebay.se ist er längst entwachsen –<br />
er würde die Unterschiede erklären, aber man würde<br />
es nicht verstehen. Er weiß, dass er sich in einer rechtlichen<br />
Grauzone bewegt. Er hat nicht die Piraten gewählt,<br />
einerseits natürlich wegen Johannes Ponader<br />
und andererseits, weil er paradoxerweise doch an das<br />
Prinzip Urheberrecht glaubt – viele seiner Freunde sind<br />
Autoren und Musiker. Sein schlechtes Gewissen verfliegt<br />
jedoch je<strong>des</strong> Mal zuverlässig, wenn er sich seine<br />
paar Folgen für den Abend zusammenstellt. Hollywood<br />
hat genug Geld, beruhigt er sich dann.<br />
101<br />
<strong>Cicero</strong> – 6. 2014
STIL<br />
Typologie<br />
DIE HEIMCHEN<br />
Früher gingen sie viel aus, nun bleiben sie viel daheim,<br />
auch weil die Wohnung so schön ist, in einem<br />
Altbau an einem Platz, auf dem an jedem<br />
Samstagvormittag ein Markt mit regionalen Produkten<br />
stattfindet. Sogar im Schlafzimmer stehen Bücherregale,<br />
mit Romanen von Philip Roth und John Updike<br />
im amerikanischen Original. Aber zum Bücherlesen<br />
kommen sie kaum noch. Die beiden fingen mit den<br />
„Sopranos“ (HBO) an, auf DVD natürlich, auf Englisch<br />
selbstredend, von denen sie schon ganz zu Beginn, um<br />
die Jahrtausendwende muss das gewesen sein, online<br />
im New York Magazine lasen, vielleicht sogar beruflich:<br />
Beide machen – in ihren Vierzigern nun durchaus<br />
erfolgreich – „irgendwas mit Medien“.<br />
<strong>Der</strong> ganze Trend mit den illegalen Downloads war<br />
ihnen lange nicht geheuer, bis sie das sogenannte Streaming<br />
entdeckten. Dabei lädt man die betreffende Datei<br />
nicht auf seinen Computer herunter, sondern schaut<br />
sie irgendwie auf dem Server, der, wie am Lan<strong>des</strong>kürzel<br />
„.to“ zu erkennen ist, auf Tonga steht. „Dort steht<br />
er wohl nicht von ungefähr“, gibt die Frau manchmal<br />
zu bedenken. Ob das nun illegal ist? Einen Anwalt<br />
konsultiert haben sie diesbezüglich aber nicht. Außerdem<br />
nutzen sie den Streaming-Dienst ohnehin immer<br />
seltener, seit sie es geschafft haben, sich bei den amerikanischen<br />
Flatrate-Diensten Netflix und Hulu anzumelden.<br />
Das war gar nicht so einfach, sie mussten sich<br />
dafür eine IP-Adresse in den USA besorgen (My Expat<br />
Network). Die täuscht Netflix und Hulu vor, dass<br />
sie sich in den USA aufhalten, obwohl sie in Wirklichkeit<br />
in einem deutschen Bett von E 15 liegen. Mit diebischer<br />
Freude konsumieren sie auch das Angebot der<br />
Sender HBO, CBS oder ABC.<br />
Jahrelang haben sie abends zu zweit im Bett geschaut,<br />
auf seinem Arbeits-MacBook mit dem größeren<br />
Bildschirm, den sie zwischen sich auf der Matratze<br />
aufstellten, auf einem Schuhkarton. Oft haben<br />
sie sich gefragt, warum zu diesem Zweck eigentlich<br />
noch kein Möbel entworfen wurde. Dieses abendliche<br />
Ritual, das muss an dieser Stelle gesagt sein, ist aber<br />
nicht auf eine erkaltende eheliche Sexualität, sondern<br />
auf ein Frühstadium angebotsseitig bedingter Suchtkrankheit<br />
zurückzuführen.<br />
Vor einem Jahr haben sie sich mit Apple TV ein<br />
Gerät gekauft, mit dem sich die Filme ohne Kabel vom<br />
Laptop auf den Fernseher übertragen lassen (in Weiß,<br />
von Samsung). Auf diesem sind noch nicht einmal die<br />
Sender richtig eingestellt. Ob sie das zur WM ändern?<br />
102<br />
<strong>Cicero</strong> – 6. 2014
DER BEAMER<br />
Als Zahn- oder Sportarzt mit eigener Innenstadtpraxis<br />
finanziell gut gepolstert, wohnt dieser<br />
Fernsehtypus meist in der gehobenen Vorstadt,<br />
der besseren Sportmöglichkeiten wegen. Obwohl in<br />
seiner Praxis Kunst hängt, interessiert er sich mehr<br />
für Autos und Heli-Skiing, wofür er auch nicht vorhat,<br />
sich zu entschuldigen. Das hat er mit Anfang 50<br />
und einem noch vollen Kopf an silbernen Haaren auch<br />
nicht mehr nötig. Zum Wohnen bevorzugt er den Neubau,<br />
hell und weiß, mit viel Glas, am besten freistehend<br />
und mit Garten, mit modernster Haustechnik<br />
ausgestattet.<br />
<strong>Der</strong> Arzt schaut durchaus noch ab und zu den<br />
„Tatort“, auch die „Tagesthemen“, um zu sehen, ob<br />
es der FDP wieder besser geht, auf seinem „55 Compose<br />
3D“-Flatscreen von Loewe in seinem Wohnzimmer,<br />
der sich elektrisch in einer weiß lackierten<br />
Konsole versenken lässt. Auf diesem sieht er auch<br />
Filme, am liebsten Blockbuster, die im Weltraum<br />
spielen oder mit dem Weltuntergang zu tun haben.<br />
Manchmal guckt er die Filme auch in seinem Büro im<br />
Souterrain, auf seinem 27-Zoll-iMac auf seinem Le-<br />
Corbusier-Glas-Schreibtisch LC6 von Cassina, neben<br />
dem eine E-Gitarre steht, auf der er zum <strong>letzte</strong>n Mal<br />
während <strong>des</strong> Studiums gespielt hat. Er schaut Filme<br />
lieber synchronisiert, er will sich dabei schließlich<br />
entspannen. Wenn er bei Saturn vorbeikommt, kauft<br />
er sich schon mal zehn Neuheiten auf Blu-Ray. Von<br />
Torrents und Filehostern hat er noch nie gehört, aber<br />
vor kurzem hat er ein Abonnement für die deutsche<br />
Flatrate-Seite Watchever.de abgeschlossen, nachdem<br />
er in seinem SUV an einem Bauzaun vorbeigefahren<br />
ist, an dem ein Watchever-Plakat mit Til Schweiger<br />
befestigt war.<br />
In erster Linie geht es ihm ohnehin um das Fußballgucken,<br />
er ist Sky-Abonnent der ersten Stunde,<br />
mit dem vollen Bun<strong>des</strong>liga- und Champions-League-<br />
Paket. Dazu braucht er das große Format, und dazu<br />
hat er sich in seinem Wohnzimmer einen Panasonic-<br />
Beamer vom Typ PT-AH1000E installieren lassen, <strong>des</strong>sen<br />
Lichtstärke auch für einen Betrieb bei Tageslicht<br />
ausreicht. Und da das Gerät eine Bildschirmdiagonale<br />
von bis zu 760 Zentimeter bietet, schauen sich seine<br />
Freunde und er die WM auf seinen drei weißen Minotti-Sofas<br />
an – was ihm in Kombination mit dem neuseeländischen<br />
Pinot Noir von Cloudy Bay allerdings<br />
oft Momente <strong>des</strong> Stresses bereitet. Dazu bereitet er im<br />
Smoker im Garten Steaks. Dry Aged.<br />
103<br />
<strong>Cicero</strong> – 6. 2014
STIL<br />
Typologie<br />
DIE TRADITIONALISTEN<br />
Die Anachronisten sind oft frühpensionierte Lehrer<br />
oder Professoren, auch Journalisten und<br />
Anwälte findet man unter ihnen, die sich vor<br />
fast zwei Jahrzehnten einen sehr hochwertigen Fernseher<br />
angeschafft haben, der ihnen immer noch gute<br />
Dienste leistet. Dies nehmen sie immer wieder mit Erleichterung<br />
zur Kenntnis, denn einer dieser schauerlichen<br />
Flatscreens wäre für sie eine Horrorvorstellung.<br />
Sie glauben, das Gerät ist von Panasonic, müssten aber<br />
nachschauen.<br />
Darunter steht natürlich ein DVD-Player, der aber<br />
nicht mehr oft zum Einsatz kommt, seit die Videothek<br />
pleitegegangen ist. Alle paar Monate schauen die beiden<br />
nun einen Woody-Allen-Film aus dem kompletten<br />
Box-Set, das sie ihm zum 65. bei Amazon bestellt hat.<br />
Sie sind nicht von gestern, aber der Computer ist bei<br />
ihnen nicht zum Fernsehen da. Allerdings checkt er<br />
dort die WM-Ergebnisse, manchmal sogar die Spielstände<br />
im Live-Ticker von sportschau.de.<br />
Morgens beim Frühstück studieren sie – zum<br />
Schluss! – noch das Fernsehprogramm in der Süddeutschen<br />
Zeitung, die sie abonniert haben. Sie reisen<br />
und wandern gern, zum Beispiel an Ostern auf dem<br />
Peloponnes, und schauen daher neben den obligaten<br />
Kultur- und Politsendungen („ttt“, „Frontal 21“ et cetera)<br />
bevorzugt Reisedokus, von den Galapagos beispielsweise<br />
– obwohl sie so weit wohl nicht mehr fliegen<br />
werden in diesem Leben.<br />
Beinahe religiös schauen sie die „Tagesthemen“,<br />
obwohl sie über den Sittenverfall in den Chefetagen<br />
und Ministerien oft nur den Kopf schütteln können.<br />
Dabei trauern sie schon noch Gabi Bauer hinterher,<br />
was aber nicht heißt, dass sie etwas gegen Caren<br />
Miosga hätten, im Gegenteil. Ein populäres Diskussionsthema<br />
beim Grillen im Freun<strong>des</strong>kreis ist die Frage,<br />
ob die Öffentlich-Rechtlichen eigentlich überhaupt<br />
noch ihren Bildungsauftrag erfüllen.<br />
LENA BERGMANN standen als Kind nur drei<br />
Sender zur Verfügung. Erst als sie sich mit<br />
14 ein Bein brach, kauften die Eltern einen<br />
Videorekorder. Sie hat eine US-IP-Adresse und<br />
liebt „House of Cards“ und „The Americans“<br />
Foto: Jens Bösenberg<br />
104<br />
<strong>Cicero</strong> – 6. 2014
Mehr sehen. Mehr erfahren.<br />
Mehr GEO.<br />
Auch als eMagazine.<br />
www.geo.de<br />
Jetzt im Handel.
WARUM<br />
ich trage,<br />
WAS<br />
ich trage<br />
TORI AMOS<br />
STIL<br />
Kleiderordnung<br />
Foto: Thomas Kierok für <strong>Cicero</strong><br />
Als ich 50 wurde, hat meine Tochter<br />
zu mir gesagt: „Nicht zu viel<br />
Haut zeigen auf deiner Tour,<br />
nicht zu viel Pole Dancing. Du bist cool,<br />
Mama, vertrau einfach darauf! Wenn du<br />
es nicht schaffst, würdevoll zu altern, wie<br />
soll ich das dann schaffen?“ Wenn eine<br />
50-Jährige sich wie eine 15-Jährige kleidet,<br />
wirkt das verzweifelt. So will eine<br />
Tochter ihre Mutter nicht sehen.<br />
Für öffentliche Auftritte und Fototermine<br />
habe ich eine Stylistin. Wenn<br />
sie mich anzieht, fühle ich mich selbstbewusster.<br />
Doch wenn ich im Studio bin,<br />
lässt sie mich in Ruhe. Da sehe ich anders<br />
aus. Auch, weil mein Mann mich in Jeans<br />
hasst. Er mag feminine Kleidung, Röcke<br />
und Kleider. Es müssen keine Highheels<br />
sein. Er mag den intelligenten Look,<br />
selbstbewusst, nicht angestrengt sexy,<br />
einfach schick. Das finde ich romantisch.<br />
Und natürlich bin ich eine Romantikerin,<br />
das hört man ja.<br />
Doch meine Stylistin liebt mich in<br />
Hosen, weil sie mir Autorität verleihen.<br />
Außerdem wirken Hosen am Flügel viel<br />
besser! Auf der Bühne versuche ich, eine<br />
Balance zu finden zwischen Romantik<br />
und Power. Ich will Verletzlichkeit zeigen,<br />
aber keine Scheu. Und ich will keine<br />
Entschuldigungen abgeben. Manche Lieder<br />
hätte ich natürlich nicht geschrieben,<br />
wenn ich in jeder Situation selbstbewusst<br />
gewesen wäre, das schafft Identifikation.<br />
Natürlich habe ich mit dem Altern<br />
Probleme! Es sind immer neue. Ich habe<br />
mit vielen erfolgreichen Frauen darüber<br />
gesprochen. Die Aura von erfolgreichen<br />
älteren und sehr souveränen Frauen irritiert<br />
Männer und jüngere Frauen. Sie fühlen<br />
sich bedroht. Ältere Frauen können oft<br />
nicht mehr kontrolliert werden, sie können<br />
ihre Kreativität durchsetzen. Auch so<br />
Tori Amos, 50, ist eine amerikanische<br />
Singer-Songwriterin,<br />
die Klavier spielt, seit sie zwei<br />
Jahre alt ist. Gerade erschien ihr<br />
15. Album „Unrepentant Geraldines“<br />
kann das Alter gegen uns arbeiten. Eine<br />
Freundin hat zu mir gesagt: „Ich will,<br />
dass du dich als die Summe aller Songs<br />
siehst, die du je geschrieben hast. Herzlichen<br />
Glückwunsch, du bist 50! Und was<br />
machst du ab jetzt mit deiner Kreativität?<br />
Wir sprechen wieder, wenn du 80 bist!“<br />
Wenn ich dann noch fit bin, kann ich<br />
mir vorstellen, mit 80 auf der Bühne zu<br />
stehen. Meine Disziplin ist nicht Sport,<br />
sondern eine bessere Musikerin zu werden.<br />
Jeden Tag sitze ich mehrere Stunden<br />
am Piano.<br />
Erholung finde ich in der Natur,<br />
meine Meditationsrituale sind von den<br />
Indianern geprägt. Rausgehen. Beobachten.<br />
Vor allem Zuhören, nicht Reden.<br />
Die Brille ist übrigens kein Mo<strong>des</strong>tatement,<br />
ich bin kurzsichtig. Meine<br />
Noten kenne ich zwar auswendig, dafür<br />
bräuchte ich die Brille auf der Bühne<br />
nicht. Aber ich möchte sehen, für wen ich<br />
singe, wer da in den ersten Reihen sitzt.<br />
Man fühlt zwar auch die Energie im Publikum,<br />
aber ich will die Emotionen in<br />
den Gesichtern sehen.<br />
Aufgezeichnet von LENA BERGMANN<br />
106<br />
<strong>Cicero</strong> – 6. 2014
SALON<br />
„ <strong>Der</strong> wahre Souverän<br />
ist das Publikum “<br />
Alexander Koch, der Leiter <strong>des</strong> Deutschen Historischen Museums, über die<br />
Herausforderungen an sein Haus und die Ausstellung zum Ersten Weltkrieg, Seite 110<br />
107<br />
<strong>Cicero</strong> – 6. 2014
SALON<br />
Porträt<br />
DER MIT DEN BÄUMEN WÄCHST<br />
Dem amerikanischen Regisseur Richard Linklater ist mit „Boyhood“ Erstaunliches<br />
gelungen: Elf Jahre drehte er an dem Film und machte so die Zeit zum Hauptdarsteller<br />
Von DIETER OSSWALD<br />
Foto: Ben Sklar<br />
Ein Drama wie dieses war auf der<br />
Leinwand noch nicht zu erleben.<br />
Auf der jüngsten Berlinale wurde<br />
Richard Linklaters „Boyhood“ zu Recht<br />
frenetisch gefeiert. Von „Meisterwerk“<br />
und „Meilenstein“ schwärmten Kritiker,<br />
das Publikum jubelte. Allein die Jury<br />
zeigte sich pampig und speiste den Favoriten<br />
auf den „Goldenen Bären“ mit<br />
dem Trostpreis für die beste Regie ab.<br />
Die Story klingt unspektakulär: Man<br />
sieht einer gewöhnlichen Familie beim<br />
Leben und einem normalen Jungen beim<br />
Erwachsenwerden zu, drei Stunden lang.<br />
Sensationell gerät die Sache, weil die fiktive<br />
Langzeitbeobachtung sehr wahrhaftig<br />
und absolut authentisch wirkt. Im<br />
Zentrum steht der junge Mason (Ellar<br />
Coltrane), der vom siebenjährigen Schulkind<br />
zum 18-jährigen Studenten heranreift.<br />
Seine geschiedenen Eltern geben<br />
Patricia Arquette und Ethan Hawke. Sie<br />
alle altern real, trafen sich je<strong>des</strong> Jahr vor<br />
der Kamera, um am Lebenspuzzle weiterzubasteln:<br />
143 Szenen an 39 Drehtagen<br />
in elf Jahren.<br />
Hinter dem Coup steckt Richard Linklater.<br />
<strong>Der</strong> texanische Autodidakt bewies<br />
schon bei seinen ersten Filmen sein<br />
Talent als exzellenter Beobachter und<br />
frecher Erzähler. Anno 1993 versammelte<br />
er damalige Nobodys wie Matthew<br />
McConaughey, Milla Jovovich und Ben<br />
Affleck zum Generationenporträt „Dazed<br />
and Confused“, bei dem er eine<br />
Gruppe von High-School-Absolventen<br />
an ihrem <strong>letzte</strong>n Schultag begleitet. <strong>Der</strong><br />
Chef von Universal adelte die drogenselige<br />
Rebellenballade als den „sozial verantwortungslosesten<br />
Film, den das Studio<br />
je produziert hat“. Quentin Tarantino<br />
aber nahm das Werk in die Top-Ten-Liste<br />
seiner Lieblingsfilme auf.<br />
Eine Chance für die Liebe entdeckte<br />
der findige Amerikaner vor 20 Jahren in<br />
Europa. Zunächst bändelte Ethan Hawke<br />
als Rucksacktourist in Wien mit Julie<br />
Delpy an. „Before Sunrise“ hieß das<br />
Werk, weil die Turteltäubchen nur bis<br />
Sonnenaufgang Zeit hatten. Die charmante<br />
Lovestory kam blendend an, so<br />
durfte das Paar neun Jahre später in Paris<br />
mit „Before Sunset“ sich wieder aufeinander<br />
zu- und voneinander wegbewegen.<br />
Zum vorläufigen Finale versammelte<br />
sich das Duo mit „Before Midnight“ im<br />
Vorjahr in Griechenland.<br />
Nach dieser cleveren Langzeitstudie<br />
über die Liebe drehte Linklater jetzt mit<br />
„Boyhood“ das Rad der cineastischen<br />
Zeitreise radikal weiter. Einmal mehr<br />
erweist er sich dabei als Meister exzellenter<br />
Dialoge. Könnte das Pubertätsdrama<br />
zum nachgeschobenen Auftakt<br />
seiner „Before“-Trilogie taugen? „Kein<br />
schlechter Gedanke“, sagt der 53-Jährige,<br />
„in drei Jahren wird unser Held wie einst<br />
Ethan Hawke nach Wien fahren und sich<br />
dort in seinen eigenen Vater verwandeln.“<br />
GESPRÄCHE mit dem talentierten Mr. Linklater<br />
verlaufen entspannt wie seine Filme:<br />
„‚Boyhood‘ soll ein Spiegel sein, der zeigt,<br />
wie das Leben abläuft und die Zeit vergeht“,<br />
sagt der Selfmade-Regisseur. Entscheidend<br />
sei es, die Zuschauer trotz eines<br />
äußerlichen Gleichmaßes emotional<br />
zu packen. „Die meiste Zeit verläuft das<br />
Leben ruhig, selbst in Kriegsgebieten ist<br />
das so. Umso mehr erinnert man sich an<br />
jene raren Momente, in denen etwas Außergewöhnliches<br />
passiert. Nach diesem<br />
Rhythmus funktioniert unser Film.“<br />
Schlendernd, fast dokumentarisch<br />
kommt die Geschichte daher. Dennoch<br />
gab es von Anfang an ein genau festgelegtes<br />
Drehbuch. Selbst das Schlussbild<br />
war elf Jahre zuvor konzipiert. Jede Episode<br />
wurde sofort geschnitten. Das Werk<br />
wuchs wie die Jahresringe eines Baumes.<br />
Sehen durften die Darsteller das Ergebnis<br />
aber erst zum Schluss. Terminpro bleme<br />
der Stars auf dem langen Weg dorthin<br />
wurden pragmatisch gelöst: Wenn Ethan<br />
Hawke anderswo drehte, fehlte er in einer<br />
Episode. Ellar Coltrane musste ständig<br />
präsent sein.<br />
Wie kann man einen Sechsjährigen<br />
für elf Jahre verpflichten? „Mit viel<br />
Gottvertrauen in die Zukunft“, antwortet<br />
Linklater. „Wir hatten die Unterstützung<br />
seiner Eltern, die Künstler sind. Das<br />
Projekt war eine echte Familienangelegenheit.“<br />
Das gilt erst recht für Masons<br />
Filmschwester, die von Linklaters eigener<br />
Tochter Lorelei gespielt wird.<br />
Das väterliche Wissen zeigt sich<br />
prompt auf der Leinwand: „Beim Dreh<br />
der Szene, in der sie aufgeklärt wird,<br />
wusste ich, dass Lorelei in einem schwierigen<br />
Alter steckte und alles, was mit<br />
Körperlichkeit zu tun hatte, eklig fand.<br />
Diesen Widerwillen haben wir für die filmische<br />
Situation genutzt.“<br />
Großen Spielraum ließ er den Akteuren<br />
bei den Dialogen. Insbesondere<br />
bei seinem jungen Helden imitiert Linklaters<br />
Kunst das wahre Leben: „Ich gab Ellar<br />
als Hausaufgabe, bei Verabredungen<br />
aufzuschreiben, was er mit den jeweiligen<br />
Mädchen redet und wie sie reagieren.“<br />
So fand ein Gespräch an Ellars College<br />
über die NSA den Weg in den Film.<br />
„Das lag in der Luft.“<br />
Sagt Richard Linklater, der das Zerfließen<br />
der Zeit weiterhin abbilden wird<br />
und doch weiß, dass alle Zeit der Welt<br />
nicht reicht, um das Leben in Kunst zu<br />
verwandeln.<br />
DIETER OSSWALD hat aus seinen<br />
Begegnungen mit Linklater gelernt:<br />
Klug gedrechseltes Plaudern gehört zum<br />
Handwerk der Figuren wie ihres Erfinders<br />
109<br />
<strong>Cicero</strong> – 6. 2014
SALON<br />
Porträt<br />
SMART IM MAGISCHEN DREIECK<br />
<strong>Der</strong> Präsident <strong>des</strong> Deutschen Historischen Museums, Alexander Koch, wird vor der<br />
wichtigen Ausstellung über den Ersten Weltkrieg harsch kritisiert. Wofür eigentlich?<br />
Von ALEXANDER KISSLER<br />
Die stabilsten Mauern sind jene in<br />
unseren Köpfen. Als Alexander<br />
Koch einst vor einem Weltwunder<br />
stand, das die „Große Mauer“ heißt<br />
und keine solche ist, da sah und begriff<br />
er. Er schrieb später auf, was seinem<br />
Auge sich dargeboten hatte: Dass es die<br />
„Große Mauer“ gar nicht gebe, dass es<br />
sich um ein „Konglomerat von Mauern“<br />
handle und die „Vorstellung der Großen<br />
Mauer“ eine „erst in der zweiten Hälfte<br />
<strong>des</strong> 20. Jahrhunderts entwickelte Fiktion“<br />
sei. Auch habe das vielfach verschachtelte<br />
Mauersystem nicht vor feindlichen<br />
Angriffen schützen sollen. Es diente<br />
vielmehr als Kulturgrenze. Mythen aber<br />
seien zäh. Auch in China.<br />
Mit Mauern und mit Mythen kennt<br />
Alexander Koch sich nicht erst aus, seit<br />
er 2011 zum Präsidenten der Stiftung<br />
Deutsches Historisches Museum ernannt<br />
wurde. <strong>Der</strong> habilitierte Vor- und<br />
Frühgeschichtler und Archäologe muss<br />
in Berlin den Zeithistoriker ebenso geben<br />
wie den Museumsdirektor und Kulturmanager.<br />
„Ungemein bereichernd und<br />
spannend“ nennt er die Arbeit auf derart<br />
vielen Gebieten. Manchen Beobachtern<br />
erscheint es aber so, als habe der<br />
schlanke, alerte wie smarte Koch, der in<br />
der Fernsehserie „Mad Men“ eine gute<br />
Figur abgäbe, Mauern errichtet und Mythen<br />
konstruiert. Von einem vergifteten<br />
Betriebsklima ist die Rede. Von provinziellen,<br />
mutlosen Ausstellungen, die<br />
Koch wortreich verkläre. Zum Lackmustest<br />
für alle wechselseitige Zuschreibung<br />
wird nun, vom 29. Mai an, die Ausstellung<br />
„1914 – 1918. <strong>Der</strong> Erste Weltkrieg“.<br />
Ein großer Sprung ist es gewesen<br />
vom niedersächsischen Schwanewede<br />
über Zürich und Speyer nach Berlin. Im<br />
Wechsel lag die Kontinuität. Geboren<br />
1966 in Bremen, doch weil der Vater Offizier<br />
bei der Bun<strong>des</strong>wehr war, wurden im<br />
Drei-Jahres-Rhythmus die Umzugskisten<br />
gepackt. Von Schwanewede ging es nach<br />
Koblenz, nach Bremen, nach Bingen, wo<br />
Koch das Abitur machte, zum Studium<br />
nach Kiel und Mainz, ehe es ihn nach<br />
China verschlug. „Koch, Sie machen das“,<br />
sagte sein Chef am Römisch-Germanischen<br />
Zentralmuseum. So verbrachte er<br />
weite Teile der Jahre 1993 bis 1999 in<br />
China: „Wir haben vermessen, geforscht,<br />
dokumentiert und fotografiert, zugleich<br />
mit den chinesischen Kollegen kooperiert<br />
und uns ausgetauscht.“<br />
DIE ÜBERRESTE von Gräbern, Tempeln,<br />
Palästen in der Region um die alte<br />
Hauptstadt Xiang waren sein Tagewerk.<br />
Auch die darauf folgenden vier Jahre am<br />
Schweizerischen Lan<strong>des</strong>museum, der<br />
Aufstieg in die Geschäftsleitung dort, waren<br />
rückblickend ein Intermezzo. Berlin<br />
könnte der erste Ort werden in einem,<br />
so Koch, „ziemlich abwechslungsreichen,<br />
angesichts der vielen Jahre im Ausland<br />
keineswegs geradlinigen Werdegang“,<br />
an dem er Wurzeln schlägt. Theoretisch<br />
könnte er bis zum Erreichen der Pensionsgrenze<br />
2031 im Amt bleiben.<br />
An ihm soll es nicht scheitern: Diesen<br />
Eindruck vermittelt ein selbstbewusster<br />
Koch, wenn er auf sein Amt zu sprechen<br />
kommt. Vor dem Fenster <strong>des</strong> historischen<br />
Zeughauses Unter den Linden, in dem<br />
das DHM residiert, drängeln sich jenseits<br />
der Spree die Reste <strong>des</strong> klassischen Berlins,<br />
das Alte Museum, der Lustgarten,<br />
der Dom. Um die Ecke lugt das Kronprinzenpalais<br />
hervor. Mehr Mitte, mehr<br />
Historie geht nicht. <strong>Der</strong> Hausherr konstatiert<br />
eine „sehr positive Wahrnehmung“,<br />
mit einer „gewissen Zufriedenheit“<br />
blicke er auf das Erreichte. Das<br />
Haus sei heute „wesentlich moderner,<br />
offener, internationaler und besucherorientierter.<br />
Wir haben die Homepage in<br />
einem mehrjährigen Prozess komplett erneuert,<br />
wir haben neue Ausstellungsformate<br />
umgesetzt. Wir sind aktueller, wir<br />
machen Veranstaltungen inzwischen mit<br />
vielen, vielen Partnern.“ Dann folgt der<br />
erstaunliche Satz: Man dürfe die Möglichkeiten<br />
von Ausstellungen nicht pauschal<br />
überbewerten. Es handele sich um<br />
für eine bestimmte Dauer inszenierte,<br />
dreidimensionale Räume, die sich historischen<br />
Themen widmen und bestimmte<br />
Vorstellungen davon konstruieren, nicht<br />
um begehbare Bücher.<br />
Koch sieht das DHM als Forum, das<br />
auf mehreren Kanälen Geschichte vermittelt.<br />
Es solle die „Konstruktionen von<br />
Vergangenheit“ erlebbar machen. Darum<br />
ist auch für die Weltkriegsausstellung<br />
keine schnittige These zu erwarten. <strong>Der</strong><br />
Präsident kündigt ein „an der Ereignisgeschichte<br />
orientiertes Panorama europäischer<br />
und letztlich globaler Perspektiven“<br />
an. Leitend seien die Fragen nach der Gewalteskalation<br />
und deren Folgen für das<br />
gesamte weitere 20. Jahrhundert, einschließlich<br />
der beliebten „Bezüge zum<br />
Hier und Jetzt“. Sollte das Panoptikum<br />
im Untergeschoss <strong>des</strong> an das Zeughaus<br />
angrenzenden Pei-Baues sich im Schlachtengemälde<br />
erschöpfen, sähen sich die<br />
Kritiker bestärkt. Schon an den Schauen<br />
über das Nachleben Friedrichs <strong>des</strong> Großen,<br />
zur Völkerschlacht bei Leipzig und<br />
zum protestantischen Pfarrhaus war dies<br />
bemängelt worden: der Verzicht auf eine<br />
Haltung, die Flucht ins Arrangement.<br />
Ja, sagt Koch, und atmet hörbar aus,<br />
ohne den Rücken aus der Senkrechten<br />
zu bewegen, ja, es gab „unterschiedliche<br />
Auffassungen“ und manche „vorgefertigte<br />
Meinung“. Er tröste sich mit dem Fachbeirat,<br />
der „Crème de la Crème der Historiker“,<br />
die ihm das exzellente Niveau<br />
gerade dieser Ausstellung bestätigten.<br />
Auch zur Vorbereitung von „1914 – 1918“<br />
Foto: Maurice Weiss/Ostkreuz für <strong>Cicero</strong><br />
110<br />
<strong>Cicero</strong> – 6. 2014
SALON<br />
Porträt<br />
habe es drei Workshops gegeben mit vielen<br />
Dutzend Museumskollegen, etwa aus<br />
den Vereinigten Staaten, Italien, der Türkei,<br />
Großbritannien, Österreich, Frankreich,<br />
Belgien. Und außerdem: <strong>Der</strong> wahre<br />
Souverän sei das Publikum.<br />
Nicht müde wird Koch, den Dienstleistungscharakter<br />
eines Museums herauszustellen.<br />
Er spricht vom Kunden,<br />
vom Konsumenten, vom Nutzer,<br />
vom „Museum für alle und jeden“. In<br />
einem Vortrag auf der Jahrestagung<br />
<strong>des</strong> Deutschen Museumsbunds deutete<br />
Koch 2009 den „außerordentlich großen<br />
Erfolg“ <strong>des</strong> von ihm geleiteten Historischen<br />
Museums der Pfalz als „Bestpractice-Beispiel“.<br />
Man wisse in Speyer,<br />
dass es „nachfrageorientierte Produkte“<br />
anzubieten gelte. Nur dann gelinge die<br />
„Kundenbindung“ im „dreidimensionalen<br />
Erfahrungs-, Lern- und Erlebnisort“.<br />
Jedoch war das Speyerer Haus mit seinen<br />
knapp 50 Angestellten eine Jolle, verglichen<br />
mit dem großen Tanker DHM und<br />
<strong>des</strong>sen 210 Mitarbeitern. Ganz abgesehen<br />
davon, dass Koch nun, wie er selbst<br />
sagt, einen „Job mit letztlich auch politischer<br />
Dimension“ innehat.<br />
Mit ihm zog eine neue Sprache ein,<br />
die Sprache der Prozessoptimierer. Sie ist<br />
der größte Unterschied zu den Vorgängern,<br />
zu Gründungsdirektor Christoph<br />
Stölzl, dem Homme de lettres aus bestem<br />
alteuropäischen Schrot und Korn, und zu<br />
Hans Ottomeyer, der als honetter Patriarch<br />
seiner Liebe zu Kunst und Kunstgewerbe<br />
wenig Fesseln anlegte. Auf die<br />
großbürgerlichen Gentlemen folgt ein<br />
Projektmanager. Unvorstellbar, dass jene<br />
wie nun Koch dem Gast das „magische<br />
Dreieck“ aufgezeichnet hätten. Ein I,<br />
ein G, ein V malt Koch schwungvoll an<br />
die Spitzen, „Inhalt, Gestaltung und Vermittlung“,<br />
darauf komme es an: „Diese<br />
drei Punkte definieren eine Ebene. Nur<br />
wenn diese austariert ist, erreiche ich einen<br />
maximalen Erfolg.“ Bei den „Saliern“<br />
sei das wunderbar gelungen.<br />
Kochs Speyerer Abschiedsausstellung<br />
gilt als Triumph. Ein Gleichgewicht<br />
war gefunden zwischen Mitmach-Stationen,<br />
szenischer Rekonstruktion, etwa<br />
der Abteikirche von Cluny, hochrangigen<br />
Exponaten und solider Vitrinenbeschriftung.<br />
Mal ähnlich, mal minder<br />
gut funktionierten die Ausstellungen zu<br />
den „Amazonen“ und den „Hexen“, den<br />
Welche Schneisen<br />
muss das DHM<br />
in die Gegenwart<br />
schlagen, um<br />
weiter zum Gedächtnisort<br />
der Deutschen<br />
zu taugen?<br />
Das Aussondern,<br />
das Weglassen<br />
und das Deuten<br />
werden wichtiger<br />
„Wikingern“ und „Samurai“. Koch hatte<br />
sich, ehe ihn Kulturstaatsminister Bernd<br />
Neumann nach Berlin lockte, seinen Ruf<br />
als Hansdampf mit Gespür für populäre<br />
Themen ehrlich verdient. Die Überschrift<br />
seines Vortrags von 2009 war Selbstbeschreibung:<br />
„Alle im Blick, jeden im Visier“<br />
müsse ein Museumschef haben.<br />
UMSO SCHMERZLICHER, dass gerade in<br />
der Vermittlung einiges im Argen liegt.<br />
Die riesige, vom Vorgänger geerbte<br />
Dauerausstellung am DHM, in der das<br />
20. Jahrhundert einen geringen Raum<br />
einnimmt, taugte gerade als Probe auf<br />
das schlechte Exempel. In einem Buch<br />
<strong>des</strong> Philosophen und Kurators Daniel<br />
Tyradellis wider „Müde Museen“ ergießt<br />
sich der Spott über eine Schrifttafel<br />
zur „Kirche als gestaltete Lebensform“<br />
im Mittelalter. Sie sei von „Zwangscharakteren“<br />
verfasst worden. Unfreiwillig<br />
komisch zeige der Text, „was herauskommt,<br />
wenn formale Prinzipien und<br />
ein Stab von Autoren etwas zusammenquirlen,<br />
mit dem am Ende alle irgendwie<br />
leben können, in dem aber nichts mehr so<br />
richtig stimmt“. Tyradellis fordert, womit<br />
Koch sich nicht recht anfreunden mag:<br />
den Mut zu Thesen und Zuspitzungen.<br />
Bis zum Jahr 2020 will Koch die<br />
Dauerausstellung bei laufendem Betrieb<br />
komplett erneuern. Weniger Objekte soll<br />
es geben, Haupt- und Nebenstränge will<br />
er stärker abgrenzen, die Ausstellung soll<br />
bis an die Gegenwart heranreichen. Zuvor<br />
könnten Sonderausstellungen sich<br />
mit der Reformation, der maritimen Geschichte,<br />
der Kolonialgeschichte, der<br />
Russischen Revolution und der Zeit der<br />
Weimarer Republik beschäftigen. Man<br />
solle nicht vergessen, dass er seit Amtsantritt<br />
bereits 14 Ausstellungen eröffnet<br />
habe, zuletzt „Targets. Fotografien von<br />
Herlinde Koelbl“.<br />
Das deutsche Nationalmuseum verdankt<br />
sich einem Willensakt der Bun<strong>des</strong>regierung.<br />
Es soll „Ort der Selbstbesinnung<br />
und der Selbsterkenntnis durch<br />
historische Erinnerung“ sein. So formulierte<br />
es 1986 eine Sachverständigenkommission.<br />
Helmut Kohl rief das DHM ins<br />
Leben, trotz, wie es in der Schrift zum<br />
25-jährigen Jubiläum heißt, „heftigen polit-philosophischen<br />
Gegenwinds (…) aus<br />
den Feuilletons der Republik“. Da wolle<br />
der Propagandist einer „geistig-moralischen<br />
Wende“ sich ein Denkmal setzen.<br />
Die Karawane der Wohlmeinenden zog<br />
weiter, das DHM blieb bestehen. <strong>Der</strong><br />
Streit um Koch ist auch ein fernes Echo<br />
<strong>des</strong> Zwists der Anfangsjahre.<br />
Das DHM nahm die Wiedervereinigung<br />
vorweg und hat dank Stölzl und Ottomeyer<br />
seine internationale Perspektive<br />
geweitet. Heute steht das „sehr komplexe<br />
Haus“ (Koch), dieses an Basisdemokratie<br />
gewöhnte Corps der klugen Köpfe, vor<br />
einer Grundsatzentscheidung: Wie muss<br />
es sich verändern, welche Schneisen in<br />
die Gegenwart schlagen, um weiter zum<br />
Gedächtnisort der Deutschen zu taugen?<br />
Das Aussondern, das Weglassen und das<br />
Deuten werden wichtiger in einer Zeit,<br />
die auf keinen Nenner zu bringen ist. Aus<br />
dem magischen Dreieck könnte ein Viereck<br />
werden. Neben I und G und V könnte<br />
ein S treten. S wie Subjektivität.<br />
ALEXANDER KISSLER leitet bei <strong>Cicero</strong><br />
den Salon und sah schon in seiner<br />
Geburtsstadt Speyer viele Ausstellungen<br />
unter Kochs Leitung<br />
112<br />
<strong>Cicero</strong> – 6. 2014
Günther Jauch, Journalist<br />
faz.net<br />
Mit freundlicher Unterstützung durch RTL/Endemol und 2waytraffic
SALON<br />
Gespräch<br />
„PUTIN MUSS SICH<br />
VERKLEIDEN“<br />
<strong>Der</strong> Politologe Herfried Münkler hält die Gefahr eines<br />
Dritten Weltkriegs für gering. <strong>Der</strong> Blick in die Geschichte lehre,<br />
dass die Europäer Russland nicht demütigen sollten<br />
Herr Münkler, der Erste Weltkrieg begann<br />
vor 100 Jahren mit dem Attentat<br />
auf den österreichischen Thronfolger<br />
in Sarajevo, mit Schüssen am Rand <strong>des</strong><br />
russischen Imperiums. Heute erleben<br />
wir Schüsse und Geiselnahmen in der<br />
Ukraine, abermals ist Russland als starker<br />
Player involviert. Kann man die Situationen<br />
von 1914 und 2014 vergleichen?<br />
Herfried Münkler: Vergleichen kann<br />
man immer, man muss nur wissen, dass<br />
Vergleichen nicht Gleichsetzen meint. Eigentlich<br />
sind Vergleiche dazu da, Unterschiede<br />
ebenso wie Ähnlichkeiten sichtbar<br />
zu machen. <strong>Der</strong> Vergleich ist für uns<br />
Sozialwissenschaftler das, was für Naturwissenschaftler<br />
das Experiment ist.<br />
Wo sehen Sie die Unterschiede, wo die<br />
Parallelen?<br />
Ich würde eher von Analogien sprechen,<br />
nicht von Parallelen. Und da kann<br />
man sagen: So, wie das Deutsche Reich<br />
1914 unter Einkreisungsobsessionen gelitten<br />
hat, scheint es derzeit der politischmilitärischen<br />
Elite in Moskau zu ergehen.<br />
Ich rede bewusst von „Obsessionen“,<br />
denn ob die jeweils Betreffenden damals<br />
wie heute wirklich eingekreist waren<br />
oder sind, ist umstritten. Aber für<br />
das Agieren ist nicht die tatsächliche Situation<br />
ausschlaggebend, sondern eben<br />
die eigene Wahrnehmung. Und da gilt im<br />
Falle Russlands, dass die einstige Ostseemacht<br />
heute auf Kaliningrad und Sankt<br />
Petersburg beschränkt und insofern hinter<br />
die Situation unter Peter dem Großen<br />
zurückgefallen ist. Einen vergleichbaren<br />
Macht- und Einflussverlust wollte<br />
Foto: Antje Berghäuser für <strong>Cicero</strong><br />
114<br />
<strong>Cicero</strong> – 6. 2014
Russland bei der Krim und dem Zugang<br />
zum Schwarzen Meer nicht wiederholt<br />
sehen. Diesen Zusammenhang hatte die<br />
Europäische Union offenbar nicht ausreichend<br />
berücksichtigt, als sie mit der<br />
Ukraine über das Assoziierungsabkommen<br />
verhandelte. Aus Sicht der Russen<br />
hieß das: Wenn die Ukraine sich darauf<br />
einlässt, kommt zuerst die EU als ökonomischer<br />
Gatekeeper, dann die Nato und<br />
dann die Stationierung amerikanischer<br />
Raketen. So hat sich das für die Russen<br />
dargestellt.<br />
Das heißt aber auch, dass Russland immer<br />
noch vom Zerfall <strong>des</strong> zaristischen<br />
Imperiums und vom späteren Untergang<br />
der Sowjetunion traumatisiert ist?<br />
Davon bin ich überzeugt. Wobei für<br />
die handelnden Politiker das Jahr 1991<br />
natürlich prägender ist als 1917/1918.<br />
Will Putin die Kränkung wettmachen,<br />
indem er die Muskeln spielen lässt?<br />
Die Russen wissen eigentlich nicht,<br />
ob sie ein Nationalstaat oder ein Imperium<br />
sind beziehungsweise was sie sein<br />
wollen. In der Tat wird ihr Selbstverständnis<br />
von einer Mischung aus Ressentiment,<br />
dem Gefühl <strong>des</strong> Benachteiligtseins<br />
und gelegentlichen Anflügen von<br />
Aggressivität geprägt. Das alles bedient<br />
Putin zurzeit ziemlich geschickt.<br />
Inwiefern treffen mit der derzeitigen<br />
Konfrontation zwischen dem Westen<br />
und Russland auch unterschiedliche<br />
Lebensentwürfe aufeinander? Aus der<br />
Sicht Putins sind wir ja offenbar dekadent,<br />
verweichlicht, permissiv und huldigen<br />
einem homosexuellen Lifestyle –<br />
Russland hingegen gilt ihm als autoritär,<br />
viril und entschlossen.<br />
Das ist ein spannender Aspekt, weil<br />
er sich durch das Verhältnis der Russen<br />
zu Westeuropa während der vergangenen<br />
200 Jahre zieht. Die Russen hatten immer<br />
eine starke Fraktion derer, die man Westler<br />
nennt, die sich am Westen orientierten<br />
und es für nötig hielten, gegenüber<br />
dem Westen aufzuholen. Auch Lenin<br />
war ein Westler, der sich obendrein besonders<br />
stark an Deutschland orientierte.<br />
Insbesondere den Russen, die lange im<br />
Westen gelebt haben, ist die Rückständigkeit<br />
ihres eigenen Lan<strong>des</strong> oft auf die<br />
Nerven gegangen. Dem stand aber immer<br />
„Die Mission ist<br />
gerichtet gegen<br />
die westliche<br />
Dreifaltigkeit<br />
aus Prosperität,<br />
Demokratie und<br />
Bürgerrechten.<br />
Sie wird<br />
zugespitzt durch<br />
den Vorwurf der<br />
Dekadenz“<br />
Herfried Münkler<br />
<strong>Der</strong> Politikwissenschaftler legte<br />
mit „<strong>Der</strong> Große Krieg. Die Welt<br />
1914 bis 1918“ abermals einen Bestseller<br />
vor. Zuvor schrieb er unter<br />
anderem über „Imperien. Die<br />
Logik der Weltherrschaft“ und<br />
„Die neuen Kriege“. Er lehrt an<br />
der Humboldt-Universität Berlin<br />
die Gruppe der sogenannten Slawophilen<br />
gegenüber, die glaubten, eine westliche<br />
Lebensweise zerstöre die russische<br />
Seele – etwa Dostojewski oder Tolstoi,<br />
um nur zwei bekannte Namen zu nennen.<br />
Dieser Widerspruch steht heute wieder<br />
auf der Tagesordnung, und keineswegs<br />
zufällig. Wenn die Russen so etwas<br />
wie neoimperiale Ideen haben, brauchen<br />
sie auch eine Mission. Und diese – etwas<br />
aufgesetzt wirkende – Mission ist gerichtet<br />
gegen die westliche Dreifaltigkeit aus<br />
Prosperität, Demokratie, Bürgerrechten,<br />
und sie wird politisch zugespitzt durch<br />
den Vorwurf der Dekadenz.<br />
Putin zeigt sich gern als kerniger Naturbursche,<br />
etwa mit nacktem Oberkörper<br />
beim Angeln oder bei der Jagd. Kommt<br />
er mit solchen Inszenierungen bei seinen<br />
Landsleuten an?<br />
Natürlich nicht bei allen. Aber der<br />
Anstieg von Putins Popularitätswerten<br />
zeigt, dass er da etwas trifft. Im Hinblick<br />
auf die gekränkte Kollektivseele genauso<br />
wie bei Männern, die gern in homosozialen<br />
Verbänden leben – zum Beispiel<br />
bei jenen, die derzeit in der Ostukraine<br />
in spätkosakischer Manier auftreten. Im<br />
Gegensatz zum postheroischen Westen<br />
gibt es in Russland noch starke „heroische“<br />
Gemeinschaften, die zwar nicht<br />
unbedingt heroisch sind, sich aber so fühlen.<br />
Putin muss den Balanceakt bewältigen,<br />
mal als Zar, mal als Kämpfer aufzutreten,<br />
dann aber auch wieder wie ein<br />
Weltpolitiker, der sich im Kreis der Mächtigen<br />
zu bewegen weiß. Er muss sich permanent<br />
verkleiden, um dieses Spiel in allen<br />
Facetten spielen zu können.<br />
Erstaunlicherweise kommt Putin mit<br />
seinem martialisch-heroischen Gehabe<br />
nicht nur bei vielen Landsleuten gut an,<br />
sondern auch bei vielen Deutschen.<br />
Man muss unterscheiden zwischen<br />
dem Verständnis für bestimmte politische<br />
Reaktionsmuster und einer Faszination<br />
für die Person. Was das Verständnis<br />
für Putin angeht, mischen sich bei uns<br />
Formen der politischen Rationalität –<br />
etwa in Gestalt der Frage, was wir gegen<br />
Putin in der Ukraine überhaupt ausrichten<br />
können – mit Erinnerungen an<br />
die einstige Macht, aber auch die Schuld<br />
Deutschlands und einem latenten Distanzierungsbedürfnis<br />
gegenüber den USA.<br />
115<br />
<strong>Cicero</strong> – 6. 2014
SALON<br />
Gespräch<br />
Insbesondere die deutsche Linke und die<br />
Friedensbewegung scheinen Putin nicht<br />
als Aggressor sehen zu wollen, sondern<br />
als Opfer westlicher Intrigen.<br />
Was bleibt denen anderes übrig? Wer<br />
sich 40 oder 50 Jahre lang darauf versteift<br />
hat, dass es allein die Aufrüstung<br />
<strong>des</strong> Westens sei, die die Probleme schafft,<br />
ist kognitiv nicht in der Lage, die evident<br />
veränderte Situation zu erfassen. Aber<br />
im Vergleich zu den Ostermärschen zu<br />
Zeiten <strong>des</strong> Nato-Doppelbeschlusses erscheinen<br />
die Friedensbewegten von<br />
heute wie ein versprengtes Häuflein.<br />
Sie schreiben in Ihrem Buch über den<br />
Ersten Weltkrieg, dass dieser Krieg auf<br />
deutscher Seite von einigen auch als<br />
ein Kampf gegen den Weltkapitalismus<br />
gesehen wurde. In Analogie zu heute<br />
könnte man sich fragen, ob manche<br />
deutschen Linken in Putin einen Vorkämpfer<br />
gegen den westlichen Finanzkapitalismus<br />
sehen wollen.<br />
In romantischer Form mag so etwas<br />
hintergründig eine Rolle spielen – was<br />
natürlich widersinnig ist, weil der russische<br />
Kapitalismus ganz besonders unappetitlich<br />
ist. Aber im Prinzip ist es doch<br />
so, dass Deutschland sich zwischen zwei<br />
Typen von imperialer Ordnung befindet:<br />
Da sind einerseits die USA, die die<br />
Ströme von Informationen, Kapital und<br />
Gütern beherrschen – auf Grundlage einer<br />
technologisch avancierten Form von<br />
Überwachung und unter Einschluss gewaltsamen<br />
Agierens mit Kampfdrohnen.<br />
Auf der anderen Seite Russland mit einer<br />
alten territorialen Imperialität. Die<br />
neue Imperialität <strong>des</strong> Fluiden steht gegen<br />
die alte Imperialität <strong>des</strong> Festen und Geschlossenen.<br />
Die meisten Deutschen finden,<br />
dass kein Modell ihren Vorstellungen<br />
von politischer Ordnung entspricht.<br />
<strong>Der</strong> Erste Weltkrieg konnte sich zu einem<br />
Flächenbrand entwickeln, weil auf<br />
dem Balkan Stellvertreterkriege der<br />
damaligen Großmächte ausgefochten<br />
wurden. Besteht die Gefahr heute, von<br />
der Ukraine ausgehend?<br />
Tatsächlich ist es damals nicht gelungen,<br />
den Konflikt zu lokalisieren. Genau<br />
darin besteht die Aufgabe der Politik,<br />
wenn es erst einmal zu einer gewaltsamen<br />
Auseinandersetzung gekommen<br />
ist. In dieser Hinsicht kann man aus den<br />
„Im Interesse<br />
der Europäer<br />
darf es in<br />
der Ukraine<br />
nicht zu<br />
syrischen<br />
Verhältnissen<br />
kommen“<br />
Fehlern von 1914 lernen. Es muss vermieden<br />
werden, sich in eine Situation<br />
hineinzureden, bei der es nur noch darum<br />
geht, der anderen Seite die Grenzen<br />
aufzuzeigen. Auch „Gesicht wahren“ ist<br />
eine Form von Handlungszwang. Im Juli<br />
1914 hatte sich eine Eigendynamik entwickelt,<br />
die nicht mehr aufzuhalten war.<br />
Wie lautet die Lektion konkret?<br />
Dass wir Deutschen und Europäer uns<br />
nicht von den Amerikanern in eine Konstellation<br />
hineinreden lassen dürfen, die<br />
darauf hinausläuft, Putin zu demütigen.<br />
Aber müssen Putin nicht doch die Grenzen<br />
seiner Politik aufgezeigt werden?<br />
Das ist die Frage nach den Analogien.<br />
Berufen wir uns auf 1914 oder 1938? Die<br />
Appeasement-Politik gegenüber Hitler<br />
war ein Versuch, nicht in einen Mechanismus<br />
wie 1914 hineinzugeraten.<br />
Nur hatte Chamberlain mit seiner Initiative<br />
Hitler kolossal falsch eingeschätzt.<br />
Wohl wahr. Aber ich würde Putin<br />
nicht auf eine Ebene mit Hitler stellen<br />
wollen. Wenn wir über die Ukraine<br />
Foto: Antje Berghäuser für <strong>Cicero</strong><br />
116<br />
<strong>Cicero</strong> – 6. 2014
sprechen, müssen wir auch die implodierenden<br />
Staaten <strong>des</strong> Nahen und Mittleren<br />
Ostens vor Augen haben. Etwa die Unfähigkeit<br />
der USA, im Irak so etwas wie<br />
einen Staat zu errichten, der sich auf ein<br />
nationales Konzept bezieht, das stärker<br />
ist als die konfessionellen Unterschiede.<br />
In Syrien ist es ähnlich, im Libanon, irgendwann<br />
wohl auch in Jordanien. Natürlich<br />
gibt es den starken Impuls zu sagen,<br />
Grenzen dürfen nicht angetastet<br />
werden. Aber damit stellen wir andere<br />
Fragen zurück, etwa das Recht auf nationale<br />
Selbstbestimmung. Wir im Westen<br />
sollten nicht so tun, als ginge es nur<br />
um die Verwirklichung von Werten und<br />
Normen. Es handelt sich um einen politisch-pragmatischen<br />
Prozess, bei dem es<br />
darauf ankommt, Prioritäten zu setzen.<br />
Wie bewerten Sie die geopolitische Rolle<br />
der Vereinigten Staaten im Konflikt?<br />
Wenn man Großbritannien am Ende<br />
<strong>des</strong> 19. und Anfang <strong>des</strong> 20. Jahrhunderts<br />
betrachtet, wird deutlich, dass es<br />
als Weltpolizist, als „Globo-Cop“, zunehmend<br />
überfordert war. Diese Rolle<br />
war für Großbritannien schlichtweg zu<br />
teuer geworden. So ähnlich geht es heute<br />
den USA, aber keine andere Macht ist bereit,<br />
an ihre Stelle zu treten. Insofern ist<br />
das Agieren Chinas hochinteressant. Auf<br />
der einen Seite wollen die Chinesen ein<br />
Recht auf nationale Selbstbestimmung<br />
im Fall der Krim verhindern, weil ihnen<br />
solche Bestrebungen in ihrem eigenen<br />
Land auf die Füße fallen würden. Auf der<br />
anderen Seite wollen sie aber nicht ihre<br />
strategische Partnerschaft mit den Russen<br />
aufgeben, weil das bedeutete, dass sie<br />
den USA am Ende allein gegenüberstünden.<br />
Das spricht dafür, dass China regionale<br />
Interessen verfolgt, vor einem globalen<br />
Engagement aber zurückschreckt.<br />
Bei den Russen verhält es sich ähnlich,<br />
bei den Europäern ebenso. Also müssen<br />
die USA die Rolle als Globo-Cop mehr<br />
schlecht als recht weiter ausüben, allerdings<br />
ohne die frühere Überlegenheit.<br />
Schützt dieser Mangel an Überlegenheit<br />
vor einer Eskalation <strong>des</strong> Konflikts<br />
in Richtung eines Dritten Weltkriegs?<br />
Das könnte man so sehen. Die kriegsmüden<br />
Amerikaner verhalten sich in der<br />
Ukrainekrise eher zurückhaltend. Aber<br />
vermutlich hätten sie sich auch zu früheren<br />
Zeiten in einem solchen Fall mit den<br />
Russen nicht militärisch angelegt. Das<br />
Problem <strong>des</strong> Globo-Cops besteht darin,<br />
dass er eigene Interessen mit dem Kollektivgut<br />
„globale Sicherheit“ in Übereinstimmung<br />
bringen muss. Die eigenen<br />
Interessen der USA sind in Gebieten mit<br />
großen Erdölvorkommen größer als in<br />
der Ukraine. Und der Westen hat sicherlich<br />
kein Interesse, für die Ukraine in den<br />
Krieg zu ziehen.<br />
Wie sehen Sie die Zukunft der Ukraine?<br />
Entweder die Ukraine föderalisiert<br />
sich im Inneren und bleibt eine Art neutralisierter<br />
Bereich zwischen den großen<br />
Ordnungsblöcken im Westen und im<br />
Osten. Oder sie wird geteilt. Plausibler<br />
scheint mir die erste Variante, weil eine<br />
Teilung der Ukraine zu einer Fülle von<br />
zusätzlichen Problemen führen würde.<br />
Das Interesse der Europäer muss darin<br />
bestehen, dass es in der Ukraine nicht<br />
zu syrischen Verhältnissen kommt. Und<br />
da stehen wir Europäer in einem gewissen<br />
Interessenkonflikt mit den USA, denen<br />
eine Schwächung Russlands gelegen<br />
käme. Aber ein geschwächtes Russland<br />
wäre für uns Europäer alles andere als<br />
vorteilhaft – schon <strong>des</strong>halb, weil Europa<br />
angesichts der drohenden Flüchtlingsströme<br />
von der gegenüberliegenden Seite<br />
<strong>des</strong> Mittelmeers Probleme genug hat. Von<br />
instabilen Nachbarregionen wie dem Nahen<br />
Osten oder Ägypten ganz abgesehen.<br />
In Anbetracht dieser gewaltigen Herausforderungen<br />
muss Europa seine finanziellen<br />
Mittel zusammenhalten, anstatt in<br />
Russland ein neues Fass aufzumachen.<br />
Muss Europa Putin dabei helfen, sich aus<br />
der derzeitigen Situation zu befreien?<br />
Ja, indem wir die Sache entdramatisieren<br />
und nicht versuchen, Putins starkes<br />
Image bei seinen Landsleuten zu zerstören.<br />
Die Flucht Janukowitschs aus der<br />
Ukraine war ein enormer Gesichtsverlust<br />
für Putin, auf den er reagieren musste.<br />
Obama goss Öl ins Feuer, als er Russland<br />
eine „Regionalmacht“ nannte. Diese Provokation<br />
trug zur Eskalation bei.<br />
Das Gespräch führten ALEXANDER<br />
KISSLER und ALEXANDER MARGUIER<br />
Anzeige<br />
IM SOMMER<br />
15. August – 14. September 2014<br />
EXPLORE<br />
CLASSICAL<br />
MUSIC<br />
www.lucernefestival.ch
SALON<br />
Essay<br />
DE SADE LÄSST GRÜSSEN<br />
Google will die Welt verbessern,<br />
den Tod besiegen und<br />
den Menschen als Maschine<br />
erschaffen. Transhumanismus<br />
heißt das Programm<br />
Von OLIVER PRIEN<br />
Dr. Caster hat eine Vision: „Stellen Sie sich<br />
eine Maschine mit der kompletten Bandbreite<br />
menschlicher Emotionen vor. Ihre<br />
analytische Kraft wäre größer als die gebündelte<br />
Intelligenz aller Menschen seit<br />
Anbeginn der Zeit. Einige Wissenschaftler nennen sie<br />
die Singularität.“ Dr. Caster gibt es nicht. Er wird dargestellt<br />
von Johnny Depp und ist ein Held der Wissenschaft<br />
im Hollywood-Spektakel „Transcendence“. Die<br />
Vorlage aber für die Filmrolle könnte Raymond Kurzweil<br />
sein. <strong>Der</strong> „Director of Engineering“ bei Google ist<br />
Illustration: Martin Haake<br />
118<br />
<strong>Cicero</strong> – 6. 2014
einerseits ein herausragender Kopf in der Erforschung<br />
künstlicher Intelligenz, andererseits aber Prophet eines<br />
grimmigen Transhumanismus. 2029 ist die Zahl,<br />
mit der er gerade Aufsehen erregt. Computer, prognostiziert<br />
Kurzweil, werden in 15 Jahren alles können,<br />
was Menschen vermögen – nur besser.<br />
Globale Unternehmen wie Google verfügen über<br />
Forschungsetats mittlerer Industrienationen und können<br />
ihre Forschungsgelder konzentriert und strategisch<br />
verwenden. <strong>Der</strong> Multimilliardenkonzern denkt<br />
in globalen Dimensionen. Die gigantische Datenmenge,<br />
über die er gebietet, ist sein größtes Kapital. Mit seinen<br />
Rohdaten über die Welt will Google die Welt verändern.<br />
Zum Besseren, versteht sich. <strong>Der</strong> Chef Larry<br />
Page und die Seinen wollen die Demokratisierung der<br />
Welt vorantreiben, den Tod besiegen, die Fähigkeiten<br />
<strong>des</strong> menschlichen Körpers erweitern und den Geist<br />
vom Körper befreien. Sagen sie.<br />
DAS KERNGESCHÄFT der grenzenlosen Datensammlung<br />
wird konsequent fortgeführt. Ein abenteuerlich<br />
anmuten<strong>des</strong> Projekt wie „Loon“ soll mithilfe von Gasballons<br />
und solarbetriebenen Drohnen, die in der Stratosphäre<br />
treiben, die bisher weißen Flecken <strong>des</strong> Planeten<br />
mit der Google-Suche versorgen. Das strategische<br />
Ziel ist klar: Je größer die Menge an Daten, <strong>des</strong>to größer<br />
ist ihr Potenzial für neue Produkte im Weltmaßstab<br />
– im Google-internen Sprachgebrauch Google<br />
Scale genannt. Die ebenfalls irrwitzig anmutende Idee<br />
<strong>des</strong> Internetriesen, sich mit einer eigens gegründeten<br />
Unternehmenstochter Calico der Verlängerung <strong>des</strong><br />
Lebens zu widmen, hat ebenfalls einen informationstheoretischen<br />
Hintergrund. Die Geheimnisse der Welt<br />
sollen sich aus dieser allesamt herausrechnen lassen,<br />
sofern die verfügbare Datenbasis nur groß genug ist.<br />
Im Zentrum steht die Jagd nach dem heiligen Gral<br />
der Computerwissenschaft: der künstlichen Intelligenz.<br />
Sie wird von Google in bisher ungekanntem Maßstab<br />
betrieben. Wie für die anderen Projekte auch werden<br />
hierfür nicht nur Mittel, sondern auch Köpfe von<br />
Weltrang bereitgestellt. So sagte jüngst Peter Norvig,<br />
der Forschungsvorstand, sein Unternehmen beschäftige<br />
zwar „weniger als 50, aber sicher mehr als 5 Prozent“<br />
der weltweit führenden Experten auf dem Gebiet<br />
<strong>des</strong> maschinellen Lernens.<br />
Öffentliche Einrichtungen können Kreativen bei<br />
Weitem nicht die Bedingungen schaffen, wie es eine<br />
Google Inc. vermag. Geoffrey Hinton, auch er eine<br />
Koryphäe, arbeitet für Google. Er ist Pionier und Vorreiter<br />
<strong>des</strong> deep learning, bei dem es um Algorithmen<br />
zur selbsttätigen Abstraktionsfähigkeit geht – das automatische<br />
Lernen an unstrukturierten Daten. Selbst<br />
ein unabhängiger Geist wie Ray Kurzweil, quasi der<br />
Inbegriff aller Forschung zur künstlichen Intelligenz,<br />
heuerte zum ersten Mal in seinem Leben als Angestellter<br />
an. Er soll die Maschine Google in die Lage versetzen,<br />
den Sinn von Texten zu verstehen und damit<br />
Die Geheimnisse der<br />
Welt sollen sich aus<br />
dieser herausrechnen<br />
lassen, sofern die<br />
verfügbare Datenbasis<br />
nur groß genug ist<br />
schließlich, wie es aus Dr. Casters Munde heißt, „die<br />
gebündelte Intelligenz aller Menschen seit Anbeginn<br />
der Zeit“ zu erfassen.<br />
Nicht nur die materiellen Verlockungen binden<br />
Kurzweil an Google. Vielleicht hat er sogar auf Google<br />
gewartet. Die Zukunft war schon immer der Rohstoff<br />
seines Arbeitens. Nach eigenem Bekunden versuchte<br />
er stets, seine Erfindungen nicht im luftleeren Raum<br />
zu erschaffen, sondern das zu erfinden, wofür die Zeit<br />
reif war. 1999 wurde ihm dafür die „National Medal<br />
of Technology“ vom damaligen US-Präsidenten Bill<br />
Clinton verliehen. Mit seinen Prognosen für die technologische<br />
Entwicklung der Zukunft erregte Kurzweil<br />
nicht nur mediales Aufsehen, sie ermöglichten<br />
ihm auch ganz pragmatisch die Gründung mehrerer<br />
Unternehmen.<br />
NUN SCHEINT DIE ZEIT REIF für Kurzweils Vision der<br />
digitalen Unsterblichkeit. Nach der Entschlüsselung<br />
<strong>des</strong> menschlichen Genoms und demnächst auch <strong>des</strong><br />
menschlichen Gehirns wird sich die menschlich-biologische<br />
Hardware bald zu Datenmengen verflüssigt haben.<br />
Wie in der filmischen „Matrix“-Trilogie könnten<br />
dann zu Computerprogrammen <strong>des</strong>tillierte menschliche<br />
Gehirne in das weltweite Netz eingespeist werden,<br />
sich ihre Avatare frei erschaffen und erneuern. Geborgenheit<br />
heißt das Ziel in einer virtuellen Welt, die weder<br />
Leid noch Tod kennt.<br />
Ist Ray Kurzweil ein futuristischer Wirrkopf oder<br />
ein gefährlicher Protagonist menschenfeindlicher Programme?<br />
Auf einem Foto in seinem Buch „Menschheit<br />
2.0“ trägt er ein schmutziges Pappschild vor der<br />
Brust mit der Aufschrift: „The Singularity is near“.<br />
Als Prophet <strong>des</strong> Transhumanismus will er also verstanden<br />
werden.<br />
Gewiss, die Ikonografie ist selbstironisch gemeint,<br />
soll an einen Straßenprediger erinnern, der vor dem<br />
nahen Weltuntergang warnt und die Menschen zur<br />
Umkehr aufruft. Kurzweil trägt auf dem Foto außer<br />
Maßanzug und Krawatte ein joviales Lächeln zur<br />
119<br />
<strong>Cicero</strong> – 6. 2014
SALON<br />
Essay<br />
Gefährlich ist nicht<br />
der Fortschritt,<br />
sondern die Richtung.<br />
Freiheit wird als<br />
Macht definiert<br />
Schau. Seine Botschaft ist die aggressive Affirmation<br />
<strong>des</strong>sen, was da auf uns zukommt, und was nach seiner<br />
Meinung niemand mehr aufhalten kann. Das Projekt<br />
der Singularität meint die Abschaffung der Menschheit,<br />
so wie wir sie kennen, das Ende <strong>des</strong> Menschen als<br />
Gliederbündel aus Fleisch und Haut, Geist und Seele.<br />
Die Idee ist alles andere als neu. Julien Offray de<br />
La Mettries „L’homme machine“ sollte im 18. Jahrhundert<br />
das antimetaphysische Programm der Aufklärung<br />
vollenden. Raymond Kurzweil mit seinen wahlweise<br />
als absurd oder gefährlich empfundenen Ambitionen<br />
ist vorläufiger Endpunkt dieser Entwicklung, wenn er<br />
auf die Frage, ob es Gott gebe, freundlich antwortet:<br />
„Noch nicht!“<br />
Galt vor der Aufklärung und dem säkularen Humanismus<br />
der Mensch allgemein als Ebenbild Gottes,<br />
so sollte er nun in sich selbst begründet sein. Während<br />
den gemäßigten Aufklärern Gott ein Geschöpf<br />
der Fantasie <strong>des</strong> Menschen, also eine Projektion ist,<br />
kehrten die mechanischen Materialisten das alte Verhältnis<br />
von Gott und Mensch nicht einfach nur um.<br />
Sie ersetzten es vielmehr durch das Verhältnis von<br />
Mensch und Maschine: Nur der Mensch als Schöpfer<br />
der Maschine könne sich in seinem Geschöpf selbst erkennen.<br />
Seit Thomas Hobbes gilt bis hin zu den modernen<br />
Kybernetikern: „<strong>Der</strong> Mensch versteht nur das,<br />
was er selbst gemacht hat.“ Dieses Paradigma <strong>des</strong> Maschinenmenschen<br />
gilt für Naturwissenschaft und kulturelle<br />
Moderne gleichermaßen.<br />
GOOGLE UND KURZWEIL machen genau das: Sie bauen<br />
das menschliche Gehirn tatsächlich nach, damit sie<br />
es begreifen können. Das „Google Brain“ präsentiert<br />
sich in den firmeneigenen Laboren als künstliches Gehirn<br />
mit einer schnell wachsenden Zahl simulierter<br />
Synapsen. Es lernt bereits, selbstständig Objekte zu<br />
unterscheiden.<br />
Am Ende dieses Weges leuchtet das Ideal der Autopoiesis,<br />
die vollendete Emanzipation von Gott durch<br />
die Selbsterschaffung <strong>des</strong> Menschen als Maschine. Ein<br />
Ideal, das Kurzweil zwar nicht für erreichbar hält, dem<br />
man sich aber in einer „exponentiellen Explosion“ der<br />
technologischen Entwicklung unendlich nähern kann.<br />
Nur der Marquis de Sade, auch er ein Teil der französischen<br />
Aufklärung, war unerschrockener. Wenn schon<br />
die göttliche Schöpfung aus dem Nichts dem Menschen<br />
verwehrt sei, so bleibe als <strong>letzte</strong> Möglichkeit menschlicher<br />
Selbstbehauptung immerhin die creatio ad nihilo,<br />
die Schöpfung hin zum Nichts. De Sade wünschte<br />
sich, „die Natur selbst müsste man beleidigen können“,<br />
und forderte die Erfindung einer „Weltvernichtungsmaschine“.<br />
Die „virtuelle Welt“, an die wir unseren<br />
Körper verlieren sollen, ist nach der Erfindung<br />
der Neutronenbombe der nächste und vielleicht doch<br />
etwas smartere Anlauf zu einer solchen de Sade’schen<br />
Maschine.<br />
<strong>Der</strong> Transhumanismus ist also letztlich keine Idee,<br />
sondern selbst eine Maschine. Er braucht gar nicht das<br />
Engagement eines Kreativen wie Ray Kurzweil. Er bedarf<br />
keines Propheten, denn er ist seinem Wesen gemäß<br />
eine sich selbst erfüllende Prophezeiung: So und<br />
nicht anders muss es kommen. Wenn man nämlich annimmt,<br />
dass der Mensch eigentlich nur eine Maschine<br />
ist, dann ist es folgerichtig, auch die Entwicklung hin<br />
zu der Menschmaschine als eine naturgesetzliche Evolution,<br />
als einen Automatismus anzusehen.<br />
GEFÄHRLICH IST NICHT der Fortschritt, gefährlich ist<br />
<strong>des</strong>sen Richtung. Die Verbindung <strong>des</strong> Versprechens auf<br />
grenzenlose Freiheit mit der absoluten Zwangsläufigkeit,<br />
durch die es sich einlösen soll, gründet letztlich<br />
in einem fundamentalen Vorentscheid: Freiheit wird<br />
als Macht definiert.<br />
Eine solche Bestimmung, die gewissermaßen die<br />
Geschäftsgrundlage im Hause Google ist, übersieht jedoch<br />
das Entscheidende. Wahre Freiheit realisiert sich<br />
letztlich nur durch etwas, das dem modernen Denken<br />
zu einer schieren Ungeheuerlichkeit geworden ist:<br />
durch Verzicht. Schon Marc Aurel wusste das.<br />
Verzicht ist keine Kategorie der de Sa<strong>des</strong> und<br />
Kurzweils dieser Welt. In der elitären Überheblichkeit<br />
eines Larry Page, <strong>des</strong> Google-Gründers, der zudem<br />
Auftraggeber <strong>des</strong> größten Lobbyistenheeres der<br />
USA ist, lässt sich der Größenwahn der Nachfahren de<br />
Sa<strong>des</strong> gut erkennen. „Es gibt“, sagt Page, „eine Menge<br />
Dinge, die wir gern machen würden, aber nicht tun<br />
können, weil sie illegal sind. (…) Wir sollten einfach<br />
ein paar Orte haben, wo wir sicher sind. Wo wir neue<br />
Dinge ausprobieren und herausfinden können, welche<br />
Auswirkungen sie auf die Gesellschaft haben.“<br />
OLIVER PRIEN ist Biologe und<br />
Wissenschaftsjournalist und versucht mit<br />
einem eigenen Verlag, dem Ousia-Lesekreis,<br />
seiner Verwandlung in eine Maschine noch<br />
möglichst lange zu entgehen<br />
Foto: Privat<br />
120<br />
<strong>Cicero</strong> – 6. 2014
Auszeit vom Büro!<br />
Brandenburg –<br />
Die besten Ausflüge und Entdeckungen<br />
Das neue Magazin ist so vielseitig,<br />
wie das Land selbst. Es enthält 700<br />
Empfehlungen zu Sport, Kultur und<br />
Genuss, Karten mit den schönsten<br />
Ausfl ugszielen und die Highlights im<br />
Brandenburger Kulturkalender. Mit<br />
40-seitigem Brandenburg-Atlas zum<br />
Herausnehmen.<br />
180 Seiten<br />
Radfahren in Berlin und Brandenburg<br />
Kommen Sie mit auf 28 neue Touren:<br />
Zu jeder Tour erhalten Sie eine<br />
übersichtliche Karte, Smartphone-<br />
Navigation optional sowie detaillierte<br />
Routenbeschreibungen. Erfahren Sie<br />
alles über den Technik-Trend E-Bike<br />
und erhalten einen Überblick, wie<br />
es in Berlin um das Thema Fahrrad<br />
bestellt ist.<br />
132 Seiten<br />
Wandern in Berlin und Brandenburg<br />
24 Touren mit Smartphone-<br />
Navigation: Wandern Sie mit uns<br />
durch die Schorfheide, die Märkische<br />
Schweiz und den Fläming. Erkunden<br />
Sie das Elbsandsteingebirge, den<br />
Harz und die Insel Rügen. Dazu gibt<br />
es sechs ungewöhnliche Stadtwanderungen<br />
in Berlin und einen<br />
umfangreichen Service-Teil.<br />
140 Seiten<br />
Ab Ende Mai erhältlich.<br />
Für nur 8,50 € im Handel – oder gleich versandkostenfrei bestellen!<br />
Bestellhotline (030) 290 21 -520 • www.tagesspiegel.de/shop<br />
Tagesspiegel-Shop, Askanischer Platz 3 (S-Bhf. Anhalter Bahnhof), 10963 Berlin<br />
Öffnungszeiten: Mo.–Fr. 9.00 bis 18.00 Uhr • Mit eigenem Kundenparkplatz!
SALON<br />
Man sieht nur, was man sucht<br />
Frau GERMANIA wohnt<br />
hier nicht mehr Von<br />
BEAT WYSS<br />
<strong>Der</strong> deutsche Beitrag von Lehnerer & Ciriacidis<br />
zur Architekturbiennale verwickelt Adolf Hitler und<br />
Ludwig Erhard in ein Gespräch über Formen<br />
122<br />
<strong>Cicero</strong> – 6. 2014
Fotos: Bas Princen, Gaetan Bally/Keystone Schweiz/Laif [M]<br />
<strong>Der</strong> deutsche Beitrag zur diesjährigen<br />
Architekturbiennale,<br />
die am 7. Juni in Venedig<br />
eröffnet wird, rankt<br />
sich um zwei Jubiläen. Vor<br />
80 Jahren besuchte Adolf Hitler die<br />
Kunstschau in der Lagunenstadt. <strong>Der</strong><br />
deutsche Auftritt erregte sein Missfallen:<br />
<strong>Der</strong> abgewohnte Pavillon im Giardini-Park<br />
schien dem Führer unangemessen.<br />
1905 von der Münchner Secession<br />
in Auftrag gegeben, hatte der Bau von<br />
der Zierlichkeit einer überdimensionierten<br />
goethezeitlichen Teekanne im Volksmund<br />
den Namen Padiglione Bavarese<br />
erhalten. Bei aller Liebe fürs Bayerntum:<br />
Kunst war offensichtlich nicht den Künstlern<br />
zu überlassen. <strong>Der</strong> deutsche Beitrag<br />
zur Biennale Venedig wurde Chefsache.<br />
Benito Mussolini war dieser Erkenntnis<br />
zuvorgekommen. Neidvoll blickte<br />
Hitler auf jene fünf travertingrauen neuklassischen<br />
Tempelbauten, die der Duce<br />
auf dem Inselgrundstück Sant’Elena anlegen<br />
ließ. Noch vier Jahre sollte es dauern,<br />
bis das Reich stilistisch nachziehen<br />
konnte. 1938 war es so weit. Mit kolossalem<br />
Portikus pflanzte sich der deutsche<br />
Außenposten in Venedig vor den Kunstpilgern<br />
auf. Er tut es noch heute, die Inschrift<br />
„Germania“ im Gebälk ist in Stein<br />
gemeißelt. Nur der Reichsadler über der<br />
Eingangstür wurde entfernt.<br />
Seit Kriegsende wirkt der Pavillon<br />
„Germania“ als Stolperstein deutscher<br />
Selbstdarstellung im Ausland. Es<br />
gab Pläne, ihn abzureißen. Wären diese<br />
verwirklicht worden, hätte man einen<br />
fatalen Abschnitt deutscher Kunstgeschichte<br />
zur Fluchthilfe ins Vergessen<br />
verholfen. Da dies zum Glück nicht geschah,<br />
konnten die Schweizer Architekten<br />
Alex Lehnerer und Savvas Ciriacidis<br />
Viel Geschichte beiderseits der Pforte:<br />
Eingang zum für die Architekturbiennale<br />
2014 gestalteten „Bungalow<br />
Germania“<br />
den Stolperstein für die Biennale jetzt<br />
zum temporären Mahnmal umgestalten.<br />
Damit kommen wir zum zweiten Jubiläum:<br />
<strong>Der</strong> Bonner Kanzlerbungalow seligen<br />
Angedenkens, entworfen von Sep<br />
Ruf, ist heuer 50 geworden. <strong>Der</strong> Bau am<br />
Rhein wird von den ausstellenden Architekten<br />
nach Venedig zitiert über das<br />
mattschwarz gefasste flache Vordach, angebracht<br />
als eigens hergestellte Replik an<br />
Germanias Seiteneingang. Unter dem<br />
Original dieses Bauteils fuhr Ludwig Erhards<br />
schwarze Kanzlerkarosse vor, ein<br />
Merce<strong>des</strong> Benz 300d. Akkurat ist jene<br />
Kassettenverstrebung aufgeführt, unter<br />
welcher die Gäste trockenen Fußes in die<br />
Empfangsräume schreiten konnten. Nicht<br />
allen gefiel 19 Jahre nach der Stunde null<br />
jene Moderne mit amerikanischem Flair.<br />
Altkanzler Adenauer lästerte, min<strong>des</strong>tens<br />
zehn Jahre Zuchthaus hätte der Architekt<br />
dieses Scheusals verdient.<br />
Erhard schwebte fürs private Wohnen<br />
der Deutschen das mittelständische<br />
Einfamilienhaus im Grünen vor. Behaglich<br />
ist es im Innern mit Nussbaumholz<br />
verkleidet: Auf dem <strong>Vorschau</strong>foto<br />
lugt eine Wohnwand aus der pseudoionischen<br />
Tempeltür Germaniens hervor.<br />
Das zweifach geschwungene, spitz<br />
zulaufende rote Fries über dem getäfelten<br />
Interieur markiert die „imaginäre<br />
Verschneidung“, die entsteht, wenn das<br />
Bonner „Wohnzimmer der Nation“ zwischen<br />
die Flügeltüren <strong>des</strong> venezianischen<br />
Kunsttempels gestellt wird. Es entsteht<br />
so, ebenfalls nach Lehnerer und Ciriacidis,<br />
eine „doppelte Lesbarkeit“ zwischen<br />
der Rhetorik zweier Architekturen aus<br />
den sechziger und aus den dreißiger Jahren:<br />
„Bungalow Germania“ eben. Hoffen<br />
wir, dass der teutonische Stolperstein in<br />
Venedigs Giardini erhalten bleibt.<br />
Politische Ikonografie von öffentlichen<br />
Bauten darf nicht zum Verstummen<br />
gebracht werden, wenn deren Aussage<br />
nicht mehr genehm ist. Das übelste Gegenbeispiel<br />
bildet jene Siegerjustiz, die<br />
dem Berliner Palast der Republik widerfuhr.<br />
Eine intelligentere Lösung hätte<br />
Zum Autor<br />
BEAT WYSS<br />
ist einer der bekanntesten<br />
Kunsthistoriker <strong>des</strong> Lan<strong>des</strong>.<br />
Er lehrt Kunstwissenschaft<br />
und Medienphilosophie an der<br />
Staatlichen Hochschule für<br />
Gestaltung in Karlsruhe und<br />
schreibt jeden Monat in <strong>Cicero</strong><br />
über ein Kunstwerk und <strong>des</strong>sen<br />
Geschichte. Kürzlich erschien<br />
bei Philo Fine Arts sein Essay<br />
„Renaissance als Kulturtechnik“<br />
Erichs Lampenladen mit dem barocken<br />
Stülerbau vis-à-vis in ein – vielleicht<br />
zänkisches – Gespräch bringen können.<br />
„Bungalow Germania“ führt es modellhaft<br />
vor. Die Architektur der Gegenwart<br />
ist zu gut, um gegen Geschichtsklitterung<br />
eingetauscht zu werden. Man sollte Lehnerer<br />
& Ciriacidis nach Potsdam berufen<br />
mit dem Auftrag, dem Wiederaufbau der<br />
Garnisonkirche einen dekonstruktiven<br />
Gegenvorschlag zu unterbreiten. Eine<br />
feinsäuberlich durchrestaurierte Bun<strong>des</strong>republik<br />
drohte in neuwilhelminischer<br />
Geschichtsvergessenheit zu versinken.<br />
123<br />
<strong>Cicero</strong> – 6. 2014
SALON<br />
Literaturen<br />
Neue Bücher, Texte, Themen<br />
Weltliteratur<br />
Haare, Farben, Sprachen<br />
<strong>Der</strong> nigerianisch-amerikanische Roman „Americanah“ öffnet uns<br />
Augen und Ohren – auch für unsere eigene Gesellschaft<br />
Ifemelu ist Nigerianerin, und sie fällt<br />
nicht nur dadurch auf, dass sie schön<br />
ist. Ifemelu hat vor allem ihren eigenen<br />
Kopf, und sie sagt, was sie denkt, ganz<br />
spontan und ungebremst; das ist nicht nur<br />
in Nigeria ungewöhnlich. In einer Mittelschichtfamilie<br />
wächst sie in Lagos auf –<br />
der stille, auf die Einhaltung guter Manieren<br />
und die perfekte Beherrschung<br />
der englischen Sprache bedachte Vater<br />
verliert seine Arbeit, als er sich weigert,<br />
seine deutlich jüngere neue Vorgesetzte<br />
mit dem Ehrentitel „Mummy“ anzureden,<br />
die tief religiöse Mutter wechselt<br />
häufig die Sekten, deren Vorschriften<br />
sie sich jeweils inbrünstig hingibt, für<br />
je<strong>des</strong> erdenkliche Ereignis hat sie eine<br />
(zumeist ziemlich kuriose) religiöse Erklärung<br />
parat.<br />
Ifemelu wiederum erlernt von Kin<strong>des</strong>beinen<br />
an nicht nur die Stammessprache<br />
Igbo, sondern auch Nigerias Amtssprache<br />
Englisch. Und in der Schule, in<br />
der sie von ihrem beharrlichen Lehrer<br />
Mr. Agbo in der englischen Aussprache<br />
gemäß der BBC-Norm unterwiesen wird,<br />
lernt sie auch den jungen Obinze kennen.<br />
Er ist der Sohn einer Professorin,<br />
die an die Universität von Lagos strafversetzt<br />
wurde, nachdem sie sich angeblich<br />
mit einem anderen Professor geschlagen<br />
und auch noch <strong>des</strong>sen Gewand<br />
zerrissen hatte. Ihr Sohn Obinze ist ein<br />
begeisterter Leser, still, klug und sanft –<br />
wäre „Americanah“, der in den USA<br />
preisgekrönte Roman der nigerianischen<br />
Foto: Akintunde Akinleye/Reuters<br />
124<br />
<strong>Cicero</strong> – 6. 2014
Schriftstellerin Chimamanda Ngozi Adichie,<br />
nichts als die Liebesgeschichte von<br />
Ifemelu und Obinze, er würde auch dann<br />
unser Leserherz im Sturm erobern.<br />
Doch „Americanah“ erzählt noch<br />
weit mehr. Schlägt man das Buch nach<br />
605 atemlos verschlungenen Seiten zu,<br />
hat man nicht nur ganz nebenbei einen<br />
Minimalwortschatz der Igbo-Sprache erworben<br />
– der weiße Leser hat überdies<br />
verstanden, was es heißt, in unseren<br />
aufgeklärten westlichen Gesellschaften<br />
schwarz zu sein. Dies nämlich müssen<br />
auch Ifemelu und Obinze lernen – sie in<br />
den USA, er in Großbritannien –, und es<br />
ist eine Erfahrung, die beide beinahe auseinandertreibt.<br />
„Lieber nicht-amerikanischer<br />
Schwarzer“, wird Ifemelu eines<br />
Tages in ihrem Blog „Raceteenth oder<br />
ein paar Beobachtungen über schwarze<br />
Amerikaner (früher als Neger bekannt)<br />
von einer nicht-amerikanischen Schwarzen“<br />
schreiben: „Wenn du dich dafür entschei<strong>des</strong>t,<br />
nach Amerika zu kommen,<br />
wirst du schwarz.“ Einer dunkelhäutigen<br />
Dichterin, die angeblich problemlos<br />
mit einem Weißen lebt, wirft sie an<br />
den Kopf: „Ich komme aus einem Land,<br />
in dem Rasse kein Thema war. Ich habe<br />
mich selbst nicht als Schwarze gesehen,<br />
ich wurde erst schwarz, als ich nach Amerika<br />
kam.“ Und das bedeutet, Schwierigkeiten<br />
zu haben, eine qualifizierte Arbeit<br />
zu finden, es heißt, so schnell wie möglich<br />
den amerikanischen Akzent anzunehmen<br />
und – seine Haare zu glätten: Die<br />
Frisur, ob glatt, in Zöpfe geflochten oder<br />
als Afro, ist ein politisches Statement.<br />
Im Roman schickt sich die amerikanische<br />
Gesellschaft gerade an, zum<br />
ersten Mal in ihrer Geschichte einen<br />
Schwarzen zu ihrem Präsidenten zu wählen;<br />
das schärft den Blick auf die Rasseverhältnisse.<br />
Zentral aber erzählt „Americanah“<br />
von einem Prozess allmählicher<br />
Bewusstwerdung, einem unfreiwilligen<br />
learning by doing, das für Ifemelu beginnt,<br />
als sie zum Studium nach Amerika<br />
kommt. Im Laufe von 15 Jahren<br />
wird sie hier zur „Americanah“: einer<br />
Afrikanerin, die eine zweite Sozialisation<br />
in der amerikanischen Kultur durchlaufen<br />
hat, und die nach niederschmetternden<br />
Erfahrungen – in deren Verlauf<br />
sie auch den Kontakt zu Obinze, der kein<br />
Einreisevisum für die USA erhalten hat,<br />
abbricht – schließlich ganz etabliert mit<br />
„Ich komme aus<br />
einem Land, in<br />
dem Rasse kein<br />
Thema war. Ich<br />
wurde erst zur<br />
Schwarzen, als<br />
ich zu euch nach<br />
Amerika kam“<br />
Chimamanda Ngozi Adichie<br />
einem großzügigen Stipendium in Princeton<br />
lebt. Für ein paar Jahre hat sie eine<br />
eheähnliche Beziehung mit dem reichen<br />
weißen Sonnyboy Curt, später tut sie sich<br />
mit dem schwarzamerikanischen Yale-<br />
Professor Blaine zusammen und scheint<br />
in <strong>des</strong>sen Kreis schwarzer wie weißer Intellektueller<br />
und Künstler mit all ihrem<br />
Wissensdurst, ihrer Denklust und ihrem<br />
Widerspruchsgeist bestens aufgehoben.<br />
Und doch entscheidet sie sich eines<br />
Tages, die USA zu verlassen und nach<br />
Hause zurückzukehren. Damit tritt sie in<br />
die dritte Stufe ihrer Entwicklung ein: Sie<br />
muss sich in ihre Herkunftsgesellschaft<br />
neu integrieren, in der Obinze inzwischen<br />
– verheiratet und Vater einer kleinen<br />
Tochter – mit der Unterstützung eines<br />
mächtigen Mannes namens „Chief“<br />
zum vermögenden Immobilienmakler<br />
geworden ist. Die Frage ist schließlich,<br />
ob die beiden mit ihren so unterschiedlichen<br />
Erfahrungen und Prägungen künftig<br />
werden zusammenleben können.<br />
Dass es selbst jemanden mit dem offenen<br />
und selbstbewussten Naturell Ifemelus<br />
schlichtweg umwerfen kann, mit<br />
dem indirekten, oft unbewussten Rassismus<br />
in den USA Bekanntschaft zu machen,<br />
ist die eine Lektion, die der Leser<br />
hier zusammen mit Ifemelu lernt.<br />
Durch sie erhält er aber auch einen tiefen<br />
Einblick in das, was von außen unterschiedslos<br />
als „das schwarze Amerika“<br />
wahrgenommen wird: Weshalb sind die<br />
prägenden Erfahrungen für in den USA<br />
geborene Schwarze so prinzipiell anders<br />
als diejenigen zugewanderter Schwarzer?<br />
Was unterscheidet Jamaikaner oder Haitianer<br />
in ihrem Verhältnis zur neuen Gesellschaft<br />
so wesentlich von den Nachkommen<br />
der schwarzen Sklaven? Was<br />
bedeuten die unterschiedlichen Abstufungen<br />
der schwarzen Hautfarbe für die<br />
gesellschaftliche Position, wie werden<br />
sie unter den Schwarzen selbst bewertet?<br />
Und was macht die Lage einer nach<br />
Nigeria zurückgekehrten „Americanah“<br />
am Ende so besonders schwierig?<br />
Dies sind die Fragen, die im Verlauf<br />
der temporeichen Handlung gestellt und<br />
beantwortet werden. Mal sind sie Gegenstand<br />
von Ifemelus offensiven und teils<br />
sehr witzigen Blogs, mal ergeben sie sich<br />
auf Partys, in Beziehungen oder am Arbeitsplatz,<br />
dann wieder sind sie der Anlass<br />
für Selbstzweifel und Selbstreflexion.<br />
Ifemelu jedenfalls zieht eines Tages zwei<br />
Konsequenzen, die anzeigen, dass sie allmählich<br />
zu einem neuen Selbstbewusstsein<br />
unter den neuen gesellschaftlichen<br />
Bedingungen findet: Ihren mittlerweile<br />
perfekten amerikanischen Akzent legt<br />
sie zugunsten von Mr. Agbos makelloser<br />
BBC-Intonation ab und macht so mit jedem<br />
Satz, den sie spricht, deutlich, dass<br />
sie eine Fremde ist und dazu auch steht.<br />
Aus derselben Haltung heraus verweigert<br />
sie sich auch der schmerzhaften Prozedur<br />
<strong>des</strong> Haare-Glättens und legt sich erst<br />
einen eindrucksvollen Afro, dann eine<br />
Zöpfchen-Frisur zu.<br />
Von einer umwegigen Reise zum<br />
eigenen Ich erzählt „Americanah“ also,<br />
voller Komik, mit einiger Tragik und jähen<br />
Überraschungen. <strong>Der</strong> Roman verschweigt<br />
die Ängste, Nöte und Beklemmungen<br />
nicht, doch vor allem leiten<br />
ihn Ifemelus Neugier, ihre scharfe Beobachtung<br />
und ihr immer zu Kapriolen<br />
und Brüskierungen bereiter Witz.<br />
Diese Stimmung färbt schließlich auch<br />
auf den Leser ab: Plötzlich sieht er nicht<br />
nur seine eigene Gesellschaft, sondern<br />
auch sein eigenes weißes Selbst mit anderen<br />
Augen.<br />
<br />
Frauke Meyer-Gosau<br />
Chimamanda Ngozi Adichie<br />
„Americanah“<br />
Aus dem Englischen von Annette Grube<br />
S. Fischer, Frankfurt a. M. 2014. 606 S., 24,99 €<br />
125<br />
<strong>Cicero</strong> – 6. 2014
SALON<br />
Literaturen<br />
Familiengeschichte<br />
Die Kunst der<br />
Anpassung<br />
Alan Bennett erzählt vom<br />
tapferen und skurrilen<br />
Leben seiner Eltern<br />
Wie oft hat mich schon der skurrile<br />
Humor von Alan Bennett<br />
glücklich gemacht – wenn er<br />
etwa in seinem Roman „Die souveräne<br />
Leserin“ Königin Elizabeth in einem<br />
städtischen Bücherbus landen lässt, wo<br />
ihr der Küchenjunge Norman gute Bücher<br />
empfiehlt, sodass sie bei Staatsbesuchen<br />
plötzlich über Literatur plaudern<br />
möchte. Oder „Così fan tutte“, die Geschichte<br />
der Eheleute Randsome, deren<br />
Wohnung leer geräumt wird, während sie<br />
ebendiese Oper sehen. Alles, was sich in<br />
30 Jahren angesammelt hatte, ist plötzlich<br />
weg – welche Befreiung! Nun kann<br />
man noch einmal ganz unkonventionell<br />
von vorn anfangen …<br />
Alan Bennett hat Sinn für verrückte,<br />
ungewöhnliche Begebenheiten,<br />
und wenn sein neues Buch heißt „Leben<br />
wie andere Leute“, dann freut man sich<br />
schon darauf, nun wieder lauter Exzentriker<br />
kennenzulernen. Doch dann begegnet<br />
man den liebenswerten, extrem<br />
schüchternen Eltern <strong>des</strong> Autors, die immer<br />
so gern gewesen wären wie alle, und<br />
die es doch nie hingekriegt haben. Sie haben<br />
Angst vor Gesellschaften und Partys,<br />
sie wissen nicht, wie man sich kleiden<br />
soll und was ein Cocktail ist, und als<br />
sie von der kleinen Stadt aufs Dorf umziehen,<br />
bekommt die Mutter ihren ersten<br />
Angst- und Depressionsschub: Sie denkt,<br />
nun stehe sie im Mittelpunkt, nun würden<br />
alle auf sie schauen.<br />
Die Depression führt sie in eine Klinik,<br />
sie wird mit Elektroschocks behandelt,<br />
der Vater besucht seine Frau jeden<br />
Tag pünktlich die gesamte Besuchszeit<br />
lang, und plötzlich sind wir mitten in einer<br />
herzzerreißenden Liebes- und Lebensgeschichte.<br />
Ja, es gibt auch zwei<br />
verrückte Tanten, die ein bisschen Leben<br />
in die Bude bringen, aber im Grunde<br />
erzählt Bennett vor allem mit Ernst, Respekt<br />
und Liebe von diesen Eltern, die sich<br />
mit dem normalen Alltag so unbeholfen<br />
schwertun. Und wenn er beschreibt, wie<br />
es in dem Heim zugeht, in dem seine Mutter<br />
oft für Wochen und Monate landet,<br />
dann ist auf einmal gar nichts mehr exzentrisch,<br />
skurril oder komisch, sondern<br />
tiefschwarz und bitter. Lakonisch heißt<br />
es: „Die Fluktuation unter diesen Bewohnern<br />
ist ziemlich hoch, denn wer in diesen<br />
Zimmern untergebracht wird, befindet<br />
sich meist schon im fortgeschrittenen<br />
Stadium der Demenz. Doch daran sterben<br />
sie nicht direkt. Keine dieser verlorenen<br />
Frauen kann sich noch selbst ernähren,<br />
und um sie richtig zu füttern (…)<br />
brauchen sie (…) im Grunde eine Helferin<br />
pro Patientin. Da dies nicht gewährleistet<br />
werden kann, verhungern die hilflosen<br />
Wesen ganz allmählich und recht<br />
anständig.“<br />
Vater und Sohn füttern die Mutter,<br />
die an etwas leidet, was Bennett „unheilbare<br />
Unfähigkeit“ nennt – die Unfähigkeit,<br />
einfach sie selbst zu sein. Das, fürchten<br />
die Eltern, genüge eben nun mal nicht.<br />
Bennett schreibt: „Meine Eltern begriffen<br />
nie, dass die meisten Familien sich<br />
einfach irgendwie durchwurstelten“, dass<br />
also alle versuchen, wie alle zu sein, und<br />
dass doch jede auf ihre Art besonders ist –<br />
besonders vor allem, wie wir von Tolstoi<br />
wissen, in ihrem Unglück.<br />
Über das Glück und das Unglück<br />
seines Vaters hat Alan Bennett schon<br />
2005 eine Erzählung mit dem Titel<br />
„Mr. Bennett, sen.“ veröffentlicht, die<br />
vollständig in diesen Text übernommen<br />
wurde, ergänzt noch um die Geschichten<br />
der anderen Familienmitglieder.<br />
Bennett selbst, schreibt er am Schluss,<br />
lebe immer noch in diesem Dorf, mit seinem<br />
30 Jahre jüngeren Partner, „und<br />
was das Dorf davon hält, weiß ich nicht,<br />
und jetzt endlich kümmert es mich auch<br />
nicht mehr“. Er hat es geschafft, die<br />
Ängste seiner Eltern ums Angepasstsein<br />
nicht zu seinen Ängsten werden zu lassen.<br />
Auf dem Titelbild <strong>des</strong> Buches geht<br />
er vergnügt mit seinem Schwein an der<br />
Leine spazieren. Elke Heidenreich<br />
Alan Bennett<br />
„Leben wie andere Leute“<br />
Aus dem Englischen von Ingo Herzke<br />
Wagenbach, Berlin 2014. 168 S., 16,90 €<br />
Fußball und Kultur<br />
Mit Uli und Franz<br />
in eine neue Ära<br />
Kay Schiller deutet die WM<br />
von 1974 als Beginn globaler<br />
Kommerzialisierung<br />
Bei der 20. Fifa-Fußball-Weltmeisterschaft<br />
in Brasilien werden sich<br />
vom 12. Juni an Politiker aus allen<br />
Ländern auf den Tribünen drängen,<br />
die Medien rund um die Uhr berichten,<br />
die Feuilletons viel Gescheites über das<br />
Spiel mit dem runden Leder von sich geben.<br />
Aber bis der Fußball sich als alle<br />
Schichten, Generationen und Geschlechter<br />
übergreifen<strong>des</strong> Phänomen durchsetzen<br />
konnte, war es ein weiter Weg. <strong>Der</strong><br />
Historiker Kay Schiller von der englischen<br />
University of Durham zeichnet<br />
nun ebenso informativ wie unterhaltsam<br />
die fesselnde Kulturgeschichte <strong>des</strong> Fußballs<br />
nach. Dabei nutzt er die Weltmeisterschaft<br />
1974 als Brennglas, in dem sich<br />
die Transformation <strong>des</strong> Sportereignisses<br />
zum globalen Medien-, Freizeit-, Tourismus-<br />
und Werbeevent bündelt.<br />
1974 verirren sich nur wenige ranghohe<br />
Politiker in die Stadien, die von<br />
den Sportverbänden bewegten Gelder<br />
sind bescheiden. Einen grundstürzenden<br />
Wandel initiieren seit 1974 die Fifa-<br />
Präsidenten João Havelange und Sepp<br />
Blatter, die den Fußball als Werbeträger<br />
global agierender Unternehmen mit der<br />
Lizenz zum Gelddrucken ausstatten und<br />
ihn zum Global Player in Entwicklungspolitik<br />
und Hochkultur aufsteigen lassen.<br />
Mit 209 Nationalverbänden umfasst die<br />
Fifa derzeit mehr Mitglieder als die Vereinten<br />
Nationen.<br />
Parallel zu dieser expansiven Dynamik,<br />
die dem Verbandsslogan „For the<br />
Game. For the World“ gehorcht, entsteht<br />
ein neuer Spielertyp, der sich in Persönlichkeiten<br />
wie Uli Hoeneß und Franz<br />
Beckenbauer verwirklicht. Steht der eine<br />
paradigmatisch für ökonomische Professionalisierung,<br />
so reüssiert der andere in<br />
Werbung, Show, Unterhaltung. Anders<br />
als 1954 den „Helden von Bern“ geht es<br />
ihnen nicht um Kameradschaft und nationale<br />
Ehre, sondern um Spaß, Erfolg und<br />
126<br />
<strong>Cicero</strong> – 6. 2014
materielles Wohlergehen – ein kultureller<br />
Wertewandel sondergleichen.<br />
Insofern ist es konsequent, dass<br />
die 1974er-Generation nach ihrer aktiven<br />
Laufbahn ins Management wechselt<br />
und die schrankenlose Kommerzialisierung<br />
<strong>des</strong> Bun<strong>des</strong>ligafußballs vorantreibt.<br />
Ihre Prominenz macht sie interessant für<br />
Literatur und Theater, Oper, Kino und<br />
den internationalen Jetset. Sie sprengen<br />
die Grenzen der lokalen und regionalen<br />
Sportidole. <strong>Der</strong> Geist der Reformpolitik<br />
und Demokratisierung in der Ära<br />
Brandt schleift die <strong>letzte</strong>n Reste der verbliebenen<br />
militärischen Ideale ab. Ohne<br />
das 1974 von den Niederlanden zelebrierte<br />
kunstvolle Spiel wäre die Ästhetik<br />
<strong>des</strong> heutigen spanischen Fußballs<br />
oder das lustvolle deutsche Angriffsspiel<br />
undenkbar.<br />
Neue Stadien, globales Entertainment<br />
machen den Fußball seitdem für<br />
die Politik interessant. Die Chancen, die<br />
das Spiel als Bühne der Eigenwerbung<br />
bietet, entdecken zunächst afrikanische<br />
und südamerikanische Potentaten. Besucht<br />
Bun<strong>des</strong>präsident Heinemann 1974<br />
gerade mal eine Halbzeit eines Spieles,<br />
noch dazu ohne deutsche Beteiligung,<br />
so gehört seit Helmut Kohl der Kabinenbesuch<br />
zum Pflichtprogramm eines<br />
jeden Kanzlers. Vorbei sind die Zeiten,<br />
in denen Fußball als Proletensport für<br />
ein kulturfernes Publikum galt. Mit dem<br />
Ende <strong>des</strong> Kalten Krieges setzt, so Schiller,<br />
eine von starken Emotionen getragene<br />
„internationale Renationalisierung der<br />
Fußballsymbolik“ ein. Sie bringt einen<br />
„Partyotismus“ hervor, der den Nachbarn<br />
die Furcht vor deutschem Patriotismus<br />
nimmt.<br />
In sattem Blau, scharf kontrastiert,<br />
mit einem an Heiligenbilder erinnernden<br />
Glorienschein fokussiert die „Lichtgestalt“<br />
Beckenbauer jene Moderne, in<br />
die der Fußball um 1974 kulturell, wirtschaftlich<br />
und politisch aufzubrechen<br />
beginnt: so die Botschaft <strong>des</strong> stilisierten<br />
Bil<strong>des</strong> auf dem Cover dieses herausragenden<br />
Buches. Markwart Herzog<br />
Kay Schiller<br />
„WM 74. Als der Fußball<br />
modern wurde“<br />
Rotbuch, Berlin 2014. 192 S., 14,95 €<br />
Anzeige<br />
CICERO: PLAT T<br />
IN DIESEN EXKLUSIVEN<br />
HOTELS<br />
Le Méridien Stuttgart<br />
Willy-Brandt-Straße 30<br />
70173 Stuttgart<br />
Telefon 07 11/222 10<br />
www.lemeridienstuttgart.com<br />
» Le Méridien Stuttgart ist eine der ersten Adressen für Kulturveranstaltungen<br />
in Stuttgart und hat den in Deutschland<br />
einzigartigen „Troubadour“, den Stuttgarter Chanson- und<br />
Liedwettbewerb ins Leben gerufen, der in diesem Jahr zum<br />
10. Mal vom Le Méridien Stuttgart ausgerichtet wird. Da ist<br />
das <strong>Cicero</strong> Magazin eine harmonische Ergänzung für unsere<br />
an Kultur und an aktueller Politik interessierten Gäste, die<br />
Ideen und Anregungen jenseits vorherrschender Meinungsbilder<br />
schätzen. Herzliche Grüße.«<br />
Bernd Schäfer-Surén, Le Méridien Hotel Stuttgart<br />
Diese ausgewählten Hotels bieten <strong>Cicero</strong> als besonderen Service:<br />
Bad Doberan/Heiligendamm: Grand Hotel Heiligendamm · Bad Pyrmont: Steigenberger<br />
Hotel Baden-Baden: Brenners Park-Hotel & Spa · Baiersbronn: Hotel Traube Tonbach ·<br />
Bergisch Gladbach: Grandhotel Schloss Bensberg, Schlosshotel Lerbach · Berlin: Brandenburger<br />
Hof, Grand Hotel Esplanade, InterContinental Berlin, Kempinski Hotel Bristol, Hotel<br />
Maritim, The Mandala Hotel, The Mandala Suites, The Regent Berlin, The Ritz-Carlton Hotel,<br />
Savoy Berlin, Sofitel Berlin Kurfürstendamm · Binz/Rügen: Cerês Hotel · Dresden: Hotel<br />
Taschenbergpalais Kempinski · Celle: Fürstenhof Celle · Düsseldorf: InterContinental<br />
Düsseldorf, Hotel Nikko · Eisenach: Hotel auf der Wartburg · Ettlingen: Hotel-Restaurant<br />
Erbprinz · Frankfurt a. M.: Steigenberger Frankfurter Hof, Kempinski Hotel Gravenbruch ·<br />
Hamburg: Crowne Plaza Hamburg, Fairmont Hotel Vier Jahreszeiten, Hotel Atlantic<br />
Kempinski, Madison Hotel Hamburg, Panorama Harburg, Renaissance Hamburg Hotel,<br />
Strandhotel Blankenese · Hannover: Crowne Plaza Hannover · Hinterzarten: Parkhotel<br />
Adler · Keitum/Sylt: Hotel Benen-Diken-Hof Köln: Excelsior Hotel Ernst · Königstein im<br />
Taunus: Falkenstein Grand Kempinski, Villa Rothschild Kempinski · Königswinter: Steigenberger<br />
Grandhotel Petersberg · Konstanz: Steigenberger Inselhotel Magdeburg: Herrenkrug<br />
Parkhotel, Hotel Ratswaage · Mainz: Atrium Hotel Mainz, Hyatt Regency Mainz · München:<br />
King’s Hotel First Class, Le Méridien, Hotel München Palace · Neuhardenberg: Hotel Schloss<br />
Neuhardenberg · Nürnberg: Le Méridien · Rottach-Egern: Park-Hotel Egerner Höfe, Hotel<br />
Bachmair am See, Seehotel Überfahrt · Stuttgart: Le Méridien, Hotel am Schlossgarten ·<br />
Wiesbaden: Nassauer Hof · ITALIEN Tirol bei Meran: Hotel Castel · ÖSTERREICH Wien: Das<br />
Triest · SCHWEIZ Interlaken: Victoria-Jungfrau Grand Hotel & Spa · Lugano: Splendide<br />
Royale · Luzern: Palace Luzern St. Moritz: Kulm Hotel, Suvretta House · Weggis: Post Hotel<br />
Weggis · Zermatt: Boutique Hotel Alex<br />
Möchten auch Sie zu diesem exklusiven Kreis gehören?<br />
Bitte sprechen Sie uns an. E-Mail: hotelservice@cicero.de<br />
REIZ<br />
<strong>Cicero</strong>-Hotel
Anzeige<br />
SALON<br />
Literaturen<br />
Ihr Monopol<br />
auf die Kunst<br />
Gerhard<br />
Richter<br />
Exklusiv: Interview von Hans-Ulrich Obrist<br />
Zehn Jahre Monopol<br />
Wir schreiben Kunstgeschichte:<br />
2004 bis heute<br />
Jonathan Lethem<br />
...ist inspiriert von Gregory<br />
Crewdson<br />
Lassen Sie sich begeistern:<br />
Jetzt Monopol gratis lesen!<br />
Wie kein anderes Magazin spiegelt<br />
Monopol, das Magazin für Kunst und<br />
Leben, den internationalen Kunstbetrieb<br />
wider. Herausragende Porträts<br />
und Ausstellungsrezensionen, spannende<br />
Debatten und Neuigkeiten aus<br />
der Kunstwelt, alles in einer unverwechselbaren<br />
Optik.<br />
Hier bestellen:<br />
MAGAZIN FÜR KUNST UND LEBEN<br />
5/2014 MAI / EURO 9,00 / SFR 14,50<br />
Telefon 030 3 46 46 56 46<br />
www.monopol-magazin.de/probe<br />
Bestellnr.: 1140045<br />
Roman<br />
Dagestan für<br />
Anfänger<br />
Alissa Ganijewa entwirft<br />
ein schillern<strong>des</strong> Bild von<br />
kultureller Vielfalt<br />
Draußen warten Männer mit Maschinenpistolen,<br />
drinnen wirft<br />
man den Bräutigam in die Luft.<br />
Trommler jonglieren mit ihren Stöcken,<br />
junge Burschen schlagen Saltos: Man feiert<br />
Hochzeit in Machatschkala. Da ergreift<br />
ein Mann das Mikrofon und spricht<br />
von der Mauer. Die Stimmung schlägt um.<br />
In ihrem dystopischen Debütroman<br />
„Die russische Mauer“ versetzt uns Alissa<br />
Ganijewa in die Republik Dagestan. Dort<br />
kursieren Gerüchte: Moskau baue einen<br />
Grenzwall, um sich von der konfliktträchtigen<br />
Kaukasusregion zu isolieren.<br />
Schamil, der als Reporter einen<br />
„positiven Artikel“ über Kunstschmiede<br />
schreiben soll, streift gewissermaßen<br />
stellvertretend für den Leser durch die<br />
Hauptstadt Machatschkala. Beim Friseur<br />
diskutiert eine junge Frau dort über die<br />
Frage, warum kürzlich ein Bus in die Luft<br />
geflogen ist. In einer Talkshow widerlegt<br />
ein Gast Einsteins Relativitätstheorie mit<br />
einer Koransure. Im Nachtclub bewahren<br />
die Mädchen die Gaspistolen der Jungs in<br />
ihren Handtaschen auf – in der Annahme,<br />
dass sie nicht durchsucht würden. Mit jedem<br />
Kapitel, jeder Episode klappen hier<br />
neue Bilderwelten auf, und ständig wechseln<br />
die Schauplätze.<br />
Alissa Ganijewa, geboren 1985,<br />
wuchs selbst in Machatschkala auf; heute<br />
arbeitet sie als Journalistin in Moskau.<br />
Aufsehen erregte ihre Erzählung „Salam,<br />
Dalgat“, die sie bei einem Literaturwettbewerb<br />
einreichte – unter männlichem<br />
Pseudonym. Manchen gilt sie als Nestbeschmutzerin,<br />
weil sie vom Radikalismus<br />
in dieser Republik erzählt, die, was nur<br />
den wenigsten bewusst ist, zu Russland<br />
gehört. Ihr Debütroman nun erschließt<br />
eine terra incognita: Dages tan für Anfänger<br />
sozusagen. Fußnote für Fußnote führt<br />
die Autorin durch den Text, erklärt kulturelle<br />
Besonderheiten, übersetzt typische<br />
Redewendungen. „Chapur-tschapur“<br />
heißt „Unsinn“ auf Awarisch, „tsjus“ ist<br />
„richtig“ auf Kumykisch, und wenn man<br />
auf Darginisch anstoßen will, ruft man:<br />
„<strong>Der</strong>chab!“ Manchmal ist das Sprachengewirr<br />
für den Leser mühsam, doch es<br />
vermittelt eine Vorstellung davon, was<br />
„kulturelle Vielfalt“ tatsächlich bedeutet.<br />
„Wore!“ („weiter!“ auf Awarisch)<br />
wirkt wie der Leitspruch dieser Welt, in<br />
der alles in Bewegung ist. Wir treffen auf<br />
Nostalgiker, Träumer, Fundamentalisten.<br />
Doch diese sind oft nicht mehr als Sprachrohre,<br />
Vertreter gesellschaftlicher Strömungen,<br />
eindimensionale Repräsentanten<br />
religiöser Überzeugungen.<br />
„Die russische Mauer“ ist ein Roman<br />
ohne Helden. Das ist konsequent,<br />
denn der wahre Protagonist ist hier die<br />
Republik Dagestan selbst. Aus zahllosen<br />
Stimmen entsteht ihr polyphones<br />
Porträt, hitzige Dialoge spiegeln soziale<br />
Spannungen. Zudem lernt man die historischen<br />
Hintergründe aktueller Konflikte<br />
kennen, wie etwa die erzwungenen<br />
Umsiedlungen ganzer Gebirgsdörfer<br />
unter sowjetischer Herrschaft.<br />
Die allgegenwärtige Vielfalt dieses<br />
Lan<strong>des</strong> spiegelt sich nicht zuletzt auch<br />
in der Struktur <strong>des</strong> Romans. Eingewoben<br />
in den Text sind Gedichte, Tagebucheinträge,<br />
Romanfragmente, darunter auch<br />
eine schöne Parodie auf den sozialistischen<br />
Realismus: Schamil stößt zufällig<br />
auf einen Text, in dem der fröhliche Traktorist<br />
Muchtar auftritt, in dem Mädchen<br />
„leichtfüßig wie Gemsen (…) von Stein zu<br />
Stein“ springen und das Komsomolzen-<br />
Abzeichen <strong>des</strong> Mädchens Marschana mit<br />
den langen schwarzen Zöpfen „keck in<br />
der Frühlingssonne“ blitzt.<br />
Das Sinnbild der Mauer treibt die<br />
innere Radikalisierung im Land voran.<br />
Dschihadisten erstarken, Dunkelmänner<br />
zünden Theater an, die Philharmonie<br />
wird zur Schariabehörde. Doch auf<br />
den <strong>letzte</strong>n eineinhalb Seiten dieser Dystopie<br />
wird dann noch einmal Hochzeit<br />
gefeiert, nun unter neuen, positiven Vorzeichen:<br />
ein gesellschaftliches Zukunftsbild<br />
en miniature. Carmen Eller<br />
Alissa Ganijewa<br />
„Die russische Mauer“<br />
Aus dem Russischen von Christiane Körner<br />
Suhrkamp, Berlin 2014. 232 S., 22,95 €<br />
128<br />
<strong>Cicero</strong> – 6. 2014
Die ganze Welt <strong>des</strong> Wassersports<br />
auf Ihrem Tablet!<br />
GRATISAUSGABE<br />
*YACHT-Aktivierungscode:<br />
ES83RDCR<br />
*BOOTE EXCLUSIV-<br />
Aktivierungscode:<br />
GXUPYMPV<br />
Gültig bis: 30.09.2014<br />
YACHT – Europas größtes Segelmagazin und BOOTE EXCLUSIV – das Magazin der Superyachten sind ab sofort als digitales<br />
Magazin erhältlich. Zum Start schenken wir Ihnen die erste Ausgabe! Einfach die jeweilige App herunterladen und den<br />
Aktivierungscode für YACHT ES83RDCR oder für BOOTE EXCLUSIV GXUPYMPV eingeben.*<br />
So können Sie unsere Magazine immer und überall lesen:<br />
Das digitale Magazin bietet neben dem gewohnten Print-Inhalt, Bildergalerien, Videos und viele weitere interessante Features.<br />
Die kostenlose Mantel-App ist für das iPad und Android-Tablets verfügbar.<br />
Sie haben die Möglichkeit jede Ausgabe als Einzelheft zum Preis von € 4,49 (YACHT) und nur € 8,99 (BOOTE EXCLUSIV) zu<br />
erwerben. Print-Abonnenten können das Digital-Abo zum günstigen Preis beziehen. Und natürlich ist auch das reine Digital-<br />
Abo im Angebot zu finden. Neben der App-Version kann das Digital-Abo von jedem PC/Mac und mit jedem Browser unter<br />
http://digital.yacht.de oder http://digital.boote-exclusiv.com online gelesen werden.<br />
*Die Co<strong>des</strong> sind bis zum 30.09.2014 gültig. Einfach die entsprechende App auf Ihrem Tablet installieren und Aktivierungscode eingeben.<br />
<strong>Der</strong> Download der Ausgabe muss am gleichen Tag der Code-Einlösung erfolgen.
SALON<br />
Bibliotheksporträt<br />
MACH DAS MAUL AUF<br />
UND GIB NIEMALS KLEIN BEI<br />
<strong>Der</strong> Kabarettist und Schauspieler Ottfried Fischer steht trotz<br />
seiner Parkinson-Erkrankung stabil im Leben. In Büchern findet er<br />
Geist und Haltung – sofern sie nicht von Paulo Coelho stammen<br />
Von WOLF REISER<br />
Ein paar Meter vor Ottfried Fischers Stadtwohnung im Norden Schwabings,<br />
an der Münchner Leopoldstraße, quietscht es plötzlich wie im Großschlachthof.<br />
Die Tram hat eine Vollbremsung hingelegt. Das Fenster der<br />
Fahrerseite geht nach unten. „Sie, äh, du, Herr Fischer, Otti, kimm, sei so<br />
nett, für meine zwei Buben daheim …“ <strong>Der</strong> Angesprochene holt gleichmütig<br />
zwei signierte Autogrammkarten aus seinem Trenchcoat und drückt sie<br />
dem guten Mann in die Hand. „A Hund bist scho, aber a g’scheiter.“ Lob<br />
vom fahrenden Volk gibt es in Bayern sonst nur für gewesene Wesen wie<br />
Ludwig II. oder Franz Josef Strauß – oder für Franz Beckenbauer.<br />
„Don’t count the days, make the days count“: Fischer zitiert vor dem Lift<br />
hoch zu seinem Loft den Parkinson-Kollegen Muhammad Ali. Nach 170 kabarettistischen<br />
Livesendungen für den Bayerischen Rundfunk, 69 Folgen als<br />
„Bulle von Tölz“ bei Sat.1, dem charmanten Beleben von Kultfiguren wie<br />
„Sir Quickly“ in der Serie „Irgendwie und sowieso“ oder „Pfarrer Braun“,<br />
nach Hunderten von Kabarettabenden und einigen privaten Tiefschlägen<br />
steht er stabil in seiner Ringecke. „Um als großer Champion zu gelten, musst<br />
du fest daran glauben, immer der Beste zu sein. Oder zumin<strong>des</strong>t so tun, als<br />
ob.“ Also macht er auch die Schüttellähmung zum Programmpunkt. Einmal<br />
hat er einem verspätet eingetroffenen Zuschauer gesagt: „Lassen Sie<br />
mir die Schlüssel Ihres Wagens einfach da. Ich park-ihn-schon.“<br />
Zu Hause greift er zu Büchern, die einst in der elterlichen Bibliothek<br />
lagen: Rilke, Torberg, Schopenhauer, Kästner, Valentin, Feuchtwanger, die<br />
Bibel. Später sorgten in seinem Einödhof nahe Passau Walser, Böll, Handke,<br />
Grass für Diskussionen. Prägend war Siegfried Lenz mit der „Deutschstunde“.<br />
„Das Buch hat mir verdeutlicht, dass Pflicht immer nur in einer<br />
ewigen Kür altruistischer Freiwilligkeit, Liberalität und Mitmenschlichkeit<br />
gerechtfertigt ist. Jeder von uns muss sich verpflichtet fühlen, sowohl mit<br />
der Emotion der Humanitas wie der Freude am Pathos der Freiheit dafür<br />
zu brennen, jedem Mitmenschen zuzugestehen, nach seiner Fasson glücklich<br />
zu werden.“ Damit beschreibt er sein Wesen, seine kulturelle Sendung.<br />
Die, die ihn gut kennen, schätzen seine Kollegialität und Hilfsbereitschaft.<br />
130<br />
<strong>Cicero</strong> – 6. 2014
In Spürweite von Fischers Schaltzentrale liegen seine Reviere, die Studentenkneipen,<br />
Kleintheater, die „Lach- und Schieß-Gesellschaft“. Dort rief<br />
Dieter Hildebrandt den Jungkabarettisten erstmals auf die Bühne. Kurz vor<br />
Mitternacht konnte er seinem Vater und der Welt erklären: „Ich brauche<br />
kein Jurastudium. Ich habe im Tempel die Menschen zum Lachen gebracht.“<br />
In Fischers Leseraum sieht man keinen Fitzgerald, keinen Miller, Melville<br />
oder Poe. Bei Hemingway verdreht er die Augen. Fragt man nach Balzac,<br />
Zola, Camus, Houellebecq, wirkt sein Blick gequält. Zunächst ist alles<br />
sehr deutsch hier. „Ohne Bücher könnte ich mir ein Leben nicht vorstellen.<br />
Aber hier meine Reclam-Ecke, Sophokles, Schiller, Hölderlin, Horaz, Aristoteles.<br />
Hätte es in den Siebzigern schon Frischhaltefolien für Bücher gegeben,<br />
wären die meisten noch verschweißt. Ich habe es nicht so mit dem<br />
Bildungskult. Wie jeder von uns las ich lieber Jerry Cotton als ‚Peer Gynt‘.“<br />
Nach kurzer Pause: „<strong>Der</strong> ‚Faust‘ ist ein gewaltiges Gedicht, allerhöchste<br />
Kunst in Form und Inhalt, ein Wortorkan. Das Paar, der grüblerische Spießer<br />
und der durchtriebene Mephisto. Zwei Seelen in einer Brust. Faust ist<br />
meine Heimat, Goethe ist deutsche Heimat. Aber leider auch Göring.“<br />
Zwei Damen erledigen im Hintergrund Büroarbeit, während der Chauffeur<br />
einen Karton mit Fischers Autobiografie „Das Leben, ein Skandal“ wegträgt.<br />
Vor ihm stapeln sich Notizen, Manuskripte, Notenblätter. Jetzt liest<br />
er ein Gedicht vor, eine Eingabe der <strong>letzte</strong>n Nacht, reichlich melancholisch.<br />
Im Leseraum sind auch Pokale, Statuen und Trophäen lose verteilt,<br />
eine Polizeimütze der Erik-Ode-Ära und Boxhandschuhe in Goldleder. Das<br />
Ambiente erinnert an die Ästhetik Westberliner Politologiestudenten anno<br />
Dutschke.<br />
Plötzlich singt er „Ruby Tuesday“. Von den Buchrücken grüßen derweil<br />
Freud, Fromm, Fried, John le Carré, eine Menge Brecht, Peter-Frankenfeld-<br />
Sketche, die edition suhrkamp, Tucholsky, die gesammelten Werke Oskar<br />
Maria Grafs und jene von Eckhard Henscheid, speziell die umwerfende Dekonstruktion<br />
der 68er, die „Trilogie <strong>des</strong> laufenden Schwachsinns“. Kochbücher<br />
sucht man vergebens. <strong>Der</strong> Ratgeber „Abnehmen im Schlaf“ macht<br />
einen relativ unberührten Eindruck.<br />
„Ach ja“, sagt er nach „Ruby Tuesday“ übergangslos, „mit Alice Schwarzer<br />
verbindet mich eine anhaltende und überzeugte Abneigung. Ähnlich<br />
geht es mir mit der Jakobsweg-Prosa von Coelho, und bei Exupérys ‚kleinem<br />
Prinz‘ empfinde ich Schmerz über solche Jasminteesätze: ‚Die Zeit, die<br />
du für deine Rose verloren hast, sie macht deine Rose so wichtig.‘“<br />
Ein Hardcover zeigt einen lausbubenhaften Gerhard Schröder. Auf der<br />
Innenseite steht eine Widmung von 2006: „An den großen Schauspieler und<br />
Menschenfreund Ottfried Fischer.“ Ganz und gar nicht als Menschenfreund<br />
empfand Fischer Namensvetter Joschka. Mit dem ehemaligen Außenminister<br />
drehte er anno 2005 Werbespots für die Grünen: „Ich sage nur AA.<br />
Und hoffe, dass man das Kürzel auch mit anderen Worten versehen kann.“<br />
Foto: Dirk Bruniecki für <strong>Cicero</strong><br />
WOLF REISER und Fischer kennen sich seit dem Nichtvollenden ihres Studiums<br />
133<br />
<strong>Cicero</strong> – 6. 2014
SALON<br />
Hopes Welt<br />
DIESEN KLANG DER GANZEN WELT<br />
Wie ich einmal in Los Angeles erlebte, dass klassische Musik<br />
für alle da ist und nicht nur für die Reichen<br />
Von DANIEL HOPE<br />
Vor einiger Zeit flog ich zu einem Gastspiel<br />
nach Los Angeles. Als ich am Morgen<br />
nach dem Konzert aus dem Hotel kam,<br />
war mein Gepäck bereits im Taxi verstaut. Bis<br />
auf die Geige. Dem Taxifahrer fiel sie sofort auf.<br />
Nachdem er losgefahren war, rief er nach hinten:<br />
„In welcher Band spielen Sie?“ Ich war hundemüde,<br />
wollte aber nicht unfreundlich wirken.<br />
„In keiner Band“, klärte ich ihn auf, „ich spiele<br />
klassische Musik.“ Er verdrehte die Augen: „Aha.<br />
Rich people’s music!“<br />
Wenn ich an die gesalzenen Preise denke,<br />
die man für Konzert- und Opernkarten bezahlen<br />
muss, konnte ich kaum widersprechen. Trotzdem<br />
ärgerte mich die Bemerkung. Also gab ich mir einen<br />
Ruck und beugte mich zu ihm.<br />
Larry hatte seine festen Ansichten über die<br />
Kirche, die Wall Street und Obamacare. Aber<br />
auch über Musik, und er vertrat sie wortreich<br />
und intelligent. Ursprünglich hatte er Anwalt<br />
werden wollen, musste das Studium aber aufgeben,<br />
als sein Vater starb und er als Ältester für<br />
die Familie zu sorgen hatte. In Konzerte ging er<br />
nie, nicht seine Gehaltsklasse. Larry fand das<br />
nicht schlimm. Arm und Reich gab es immer,<br />
in Amerika erst recht. Wenn man Mozart oder<br />
Beethoven hören will, meinte er, lege man eine<br />
CD auf oder lade sich Aufnahmen aus dem Netz.<br />
Man spare nicht nur viel Geld, sondern könne<br />
auch zu Hause bleiben und es sich mit einem Bier<br />
auf dem Sofa bei seinem Lieblingsstück bequem<br />
machen. Wie bei einer Baseball-Übertragung im<br />
Fernsehen. Wozu noch Konzerte?<br />
„Weil das Konzert live ist und die CD nicht!“<br />
Ich erschrak über die Vehemenz, mit der ich ihm<br />
widersprach. „Das kann man niemals vergleichen.“<br />
Larry war nicht restlos überzeugt. Aber<br />
wir mussten unsere Unterhaltung beenden, der<br />
Flughafen lag schon vor uns. Ich gab ihm meine<br />
E-Mail-Adresse, und wir verabredeten ein Wiedersehen<br />
bei meinem nächsten Besuch.<br />
Dieser fand nun vor kurzem statt. Ich nahm<br />
Larry aber nicht zu meinem Konzert, sondern<br />
zu dem Projekt „Education Through Music“ mit,<br />
das von den Paramount Studios unterstützt wird.<br />
An Schulen in Problemgegenden in Los Angeles<br />
erhalten Kinder auf diese Weise kostenlos Instrumente<br />
und Musikunterricht, damit sich ihre allgemeine<br />
schulische Leistung ebenso verbessert<br />
wie ihre kreative Entwicklung.<br />
Es war berührend zu sehen, mit welcher Begeisterung<br />
die etwa 100 Kinder ihr Instrument<br />
spielten, mit welch großer Freude sie die Musik<br />
erlebten und was es für sie überhaupt bedeutete,<br />
Musik selbst zu spielen. „Rich people’s music?<br />
Nur etwas für wohlhabende alte Leute?“, fragte<br />
ich Larry, der, so schien es mir, Tränen in den<br />
Augen hatte.<br />
Jetzt, beim Anblick der vielen Kinder, die<br />
gar nichts mit einem Zirkel reicher Senioren im<br />
Sinn hatten, sondern einen Querschnitt durch<br />
alle sozialen Schichten darstellten, gab er mir<br />
recht: Klassische Musik ist für alle da, jeder kann<br />
seine Wunder mit ihr erleben. Das nächste Mal<br />
kommt Larry mit ins Konzert.<br />
DANIEL HOPE ist Violinist von Weltrang und<br />
schreibt jeden Monat in <strong>Cicero</strong>. Sein Memoirenband<br />
„Familien stücke“ war ein Bestseller. Zuletzt<br />
erschienen sein Buch „Toi, toi, toi! – Pannen und<br />
Katastrophen in der Musik“ ( Rowohlt ) und<br />
die CD „Spheres“. Er lebt in Wien<br />
Illustration: Anja Stiehler/Jutta Fricke Illustrators<br />
134<br />
<strong>Cicero</strong> – 6. 2014
NETZ<br />
LESEGENUSS MIT<br />
UNBEGREN<br />
MÖGLICHKEITEN<br />
JETZT AUCH<br />
FÜR KINDLE<br />
<strong>Cicero</strong> für Tablet und PC<br />
Profitieren Sie von den Vorteilen<br />
der digitalen <strong>Cicero</strong>-Version und<br />
lesen Sie <strong>Cicero</strong> auf Ihrem iPad,<br />
Tablet oder PC.<br />
Mehr Informationen unter<br />
www.cicero.de/digital<br />
<strong>Cicero</strong> Digital
SALON<br />
Die <strong>letzte</strong>n 24 Stunden<br />
Ein Leichentuch<br />
von Dior, voll<br />
Wärme, Licht<br />
und Glanz<br />
BARBARA<br />
VINKEN<br />
Barbara Vinken<br />
Die Literaturwissenschaftlerin<br />
und Romanistin beschäftigt sich<br />
mit Mode im Wandel der Zeit.<br />
„Angezogen. Das Geheimnis der<br />
Mode“ war 2014 für den Preis der<br />
Leipziger Buchmesse nominiert<br />
Schon als Kind habe ich mir,<br />
statt Schäfchen zu zählen, vor<br />
dem Einschlafen überlegt, wie<br />
mein Sarg aussehen soll: elfenbeinfarben<br />
lackiert, matt, mit<br />
lila Veilchen, glänzend, verziert. Sargfantasien<br />
sind in der Literatur gar nicht<br />
so selten. Denken Sie nur an den Sarg<br />
der Madame Bovary, der in seiner verschwenderischen<br />
Pracht den Untergang<br />
<strong>des</strong> Ehemanns beschleunigt. Aber Flauberts<br />
Roman habe ich erst später gelesen.<br />
Mit ihrem süßen Duft symbolisieren<br />
Veilchen Unsterblichkeit. Auch das<br />
wusste ich damals nicht.<br />
Meine Veilchen hängen wahrscheinlich<br />
mit dem Tod meiner Großmutter zusammen,<br />
die wohl um diese Zeit starb.<br />
Für mich war es unvorstellbar, dass sie<br />
nicht mehr da ist. Was würde nun mit<br />
ihrem Leichnam passieren? Jedenfalls<br />
hatte meine Oma immer verzuckerte<br />
Veilchen parat, wenn wir zu Besuch kamen.<br />
Und Veilchen in der Vase, sobald sie<br />
blühten. Obwohl ich leider nicht an das in<br />
ihnen beschlossene Versprechen der Unsterblichkeit<br />
glauben kann und Angst vor<br />
dem Nichts <strong>des</strong> schwarzen En<strong>des</strong> habe,<br />
sind sie wohl als eine schönere Hoffnung<br />
auf meinen Sarg gewandert.<br />
Bis zum 19. Jahrhundert erhielt das<br />
Leben seine endgültige Bedeutung im<br />
Moment <strong>des</strong> To<strong>des</strong>. Erst wenn wir wissen,<br />
wie wir sterben, wissen wir, wie unser<br />
Leben war. Die schauderhafte Hässlichkeit<br />
<strong>des</strong> To<strong>des</strong> zeigte ebenso wie der<br />
schöne Tod die Wahrheit eines Menschenlebens.<br />
Deswegen war früher das<br />
Leben Vorbereitung auf den Tod.<br />
Das Schlimmste, was einem passieren<br />
konnte, war das, was wir uns heute<br />
vielleicht alle wünschen: ein Tod, der<br />
einem zustößt, ohne dass man ihn bemerkt,<br />
ein unvorbereiteter Tod. Heute,<br />
denke ich, sehen wir den Tod nicht als<br />
Moment der <strong>letzte</strong>n Wahrheit. <strong>Der</strong> Moment<br />
<strong>des</strong> To<strong>des</strong> offenbart nicht mehr die<br />
Bedeutung eines ganzen Lebens; er erscheint<br />
uns eher als sinnloses Ende aller<br />
Bedeutung. Und das ist wahrscheinlich<br />
das Erschreckende.<br />
Wenn ich schwer krank sein sollte,<br />
hoffe ich, dass ich den Mut habe zu sterben<br />
und dass man mich sterben lässt. Ich<br />
möchte nicht, an Maschinen angeschlossen<br />
oder unendlich operiert, einen Tod<br />
auf Raten erleiden, der Leben doch nicht<br />
ist. Wenn ich mir einen Tod wünschen<br />
könnte, dann wäre es der ekstatische Tod<br />
der Heiligen oder der Bräute Christi. Sie<br />
erleben im Tod die Vereinigung mit dem<br />
himmlischen Bräutigam, einen ganz erfüllten<br />
Moment, in dem der erotische Tod<br />
mit dem großen Tod zusammenfällt.<br />
Wenn ich mir allerdings mein Leben<br />
so angucke, wird mir dieses Glück sicher<br />
nicht zuteil werden. Leider, denn es ist<br />
eine wunderbare To<strong>des</strong>vorstellung. Deswegen<br />
wünsche ich mir, realistischer, mit<br />
Boris Vian wenigstens „un suaire de chez<br />
Dior“, ein Leichentuch von Dior. In der<br />
<strong>letzte</strong>n Zeile seines Lie<strong>des</strong> „J’suis Snob“<br />
wünscht Vian sich ganz dandyesk genau<br />
das für seinen Tod. Um alle Transzendenz<br />
gebracht, möchte ich wenigstens<br />
dem Tod eine so schöne Figur wie möglich<br />
geben.<br />
Mein Leichentuch möchte ich aus<br />
einem weiß glänzenden Baumwollsatin:<br />
Wärme, Licht und Glanz. Die Vorstellung,<br />
mich wie Fassbinders Effi Briest<br />
am Ende jeder Einstellung in Licht aufzulösen,<br />
finde ich sehr schön. Leider ist<br />
auch das, wie die Veilchen auf dem Sarg,<br />
eine Kunstfigur.<br />
Aufgezeichnet von FLORIAN WELLE<br />
136<br />
<strong>Cicero</strong> – 6. 2014
Foto: Dirk Bruniecki für <strong>Cicero</strong><br />
137<br />
<strong>Cicero</strong> – 6. 2014
POSTSCRIPTUM<br />
N°-6<br />
LEYEN-TRUPPE<br />
Wer wissen möchte, was der vom Politologen<br />
Herfried Münkler geprägte<br />
Begriff <strong>des</strong> „postheroischen Westens“ (im<br />
Interview auf Seite 115) konkret bedeutet,<br />
konnte unlängst in der Herzschmerz-<br />
Presse fündig werden. Dort präsentierte<br />
sich die Inhaberin der Befehls- und Kommandogewalt<br />
als eine Art Supernanny, die<br />
während eines Besuchs deutscher Truppen<br />
in Afrika und im Nahen Osten den stets<br />
verständnisvollen Friedensapostel mit Dauerlächeln<br />
und blondem Engelshaar gibt.<br />
Das Gefolge Ursula von der Leyens<br />
war zu diesem Zweck handverlesen: Reporterinnen<br />
von Bunte, Gala, Tina, Laura<br />
und Brigitte sollten dafür sorgen, dass die<br />
Bun<strong>des</strong>wehr mitsamt deren ziviler Chefin<br />
als Wohlfühlkompanie erscheint, die es<br />
aus unerfindlichen Gründen in exotische<br />
Weltgegenden verschlagen hat. Abenteuer<br />
pur zum All-inclusive-Tarif: Vor der ostafrikanischen<br />
Küste haben die Männer<br />
und Frauen an Bord der Fregatte „Brandenburg“<br />
mit allerlei Unbill zu kämpfen<br />
– etwa hohen Temperaturen von bis<br />
zu 35 Grad, denen die Verteidigungsministerin<br />
„im hellgrauen Blazer mit dunkler<br />
Hose“ (Gala) trotzt, während „der Wind<br />
mit ihren schulterlangen Haaren spielt“<br />
(Bunte). Die „stets frisch und perfekt gestylte“<br />
Frau von der Leyen zeigt selbstverständlich<br />
auch in dieser Situation eiserne<br />
Selbstdisziplin: „Den Zwetschgen-Streuselkuchen<br />
mit dem Klacks Sahne lässt sie<br />
zurückgehen“, heißt es im Bunte-Fronttagebuch.<br />
Und Gala beschreibt einfühlsam,<br />
wie die „Mutter von sieben Kindern“<br />
ihre aus Unachtsamkeit für kurze Zeit auf<br />
einem Stahlhelm ruhende Hand zurückzieht,<br />
als ein Fotograf sich nähert. Denn<br />
„solche Bilder möchte sie vermeiden – auch<br />
Posieren mit Waffe oder an anderem<br />
schweren Gerät ist nicht drin“. Eine Verteidigungsministerin<br />
neben einem 76-Millimeter-Geschütz?<br />
Nicht, dass da noch<br />
jemand auf die falschen Gedanken kommt!<br />
Ursula von der Leyens Versuch, die<br />
Bun<strong>des</strong>wehr als familienfreundliche Lifestyle-Army<br />
mit angeschlossener Krabbelgruppe<br />
ins postheroisch-milde Licht zu<br />
rücken, hat nur einen Nachteil: Er wirkt<br />
vor dem aktuellen Hintergrund <strong>des</strong> geopolitischen<br />
Kräftemessens in der Ukraine<br />
geradezu grotesk. Im Vergleich zur Verkitschung<br />
der deutschen Streitkräfte durch<br />
die amtierende Ministerin nehmen sich<br />
sogar die albernen Profilierungsversuche<br />
ihres Amtsvorgängers Guttenberg beinahe<br />
staatstragend aus. Die Bun<strong>des</strong>wehr<br />
aber ist der falsche Ort für boulevar<strong>des</strong>ke<br />
Selbstinszenierungen, heute mehr denn je.<br />
Eine Frau, die gern Kanzlerin wäre, sollte<br />
das eigentlich wissen.<br />
ALEXANDER MARGUIER<br />
ist stellvertretender Chefredakteur<br />
DIE NÄCHSTE CICERO-AUSGABE ERSCHEINT AM 26. JUNI<br />
Illustration: Anja Stiehler/Jutta Fricke Illustrators<br />
138<br />
<strong>Cicero</strong> – 6. 2014
Ist Klassik<br />
der neue Pop?<br />
Sind Spanier die besseren Köche?<br />
Rettet Jack White den Rock’n’Roll?<br />
Wie blöd macht K i ff e n wirklich?<br />
Wie gut sind die Rolling Stones live?<br />
Macht Fußball noch Spaß?<br />
Welche neuen Serien muss man<br />
sich jetzt auf DVD besorgen?<br />
Die Antworten im neuen<br />
Mehr Seiten, mehr Themen, mehr Vielfalt.<br />
Ab 28. Mai am Kiosk
hermès. ein neues zeitverständnis.<br />
dressage<br />
la montre hermès dressiert die zeit, um ihr mass zu nehmen.<br />
mit einem fingerdruck beginnt die chronographensekunde ihren lauf, dem die zählerzeiger<br />
auf dem fusse folgen. unter dem zifferblatt gibt das hochwertige mechanische<br />
manufakturuhrwerk h1925 den takt an. eleganz und genauigkeit verschmelzen zu einer<br />
harmonischen einheit, die daran erinnert, dass jede sekunde einzigartig ist.<br />
Informationen unter: 089 55 21 53 0<br />
HERMES.COM