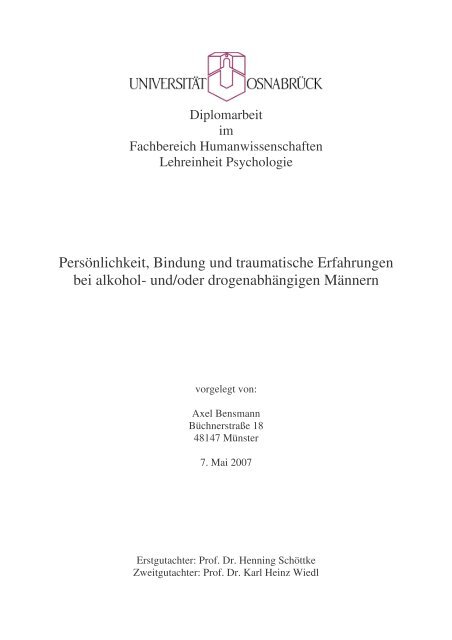Diplomarbeit Bensmann 210507 - Universität Osnabrück
Diplomarbeit Bensmann 210507 - Universität Osnabrück
Diplomarbeit Bensmann 210507 - Universität Osnabrück
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Diplomarbeit</strong><br />
im<br />
Fachbereich Humanwissenschaften<br />
Lehreinheit Psychologie<br />
Persönlichkeit, Bindung und traumatische Erfahrungen<br />
bei alkohol- und/oder drogenabhängigen Männern<br />
vorgelegt von:<br />
Axel <strong>Bensmann</strong><br />
Büchnerstraße 18<br />
48147 Münster<br />
7. Mai 2007<br />
Erstgutachter: Prof. Dr. Henning Schöttke<br />
Zweitgutachter: Prof. Dr. Karl Heinz Wiedl
DANKE!<br />
i<br />
An den Anfang der <strong>Diplomarbeit</strong> möchte ich ein Dankeswort stellen für die gute<br />
kooperative Zusammenarbeit:<br />
DANKE zuerst an die vielen Menschen, die mir ihre Zeit zur Verfügung stellten, und<br />
bereit waren, die doch recht umfangreiche Fragebogen-Batterie auszufüllen. Ohne sie<br />
wäre diese Untersuchung nicht möglich gewesen.<br />
DANKE den Pflege- und Therapeutenteams auf den Stationen 23.1, 23.2, 15.1 und<br />
Tagesklinik-Sucht der Westfälischen Klinik Münster.<br />
Mein besonderer Dank gilt hier Herrn Dr. André Lammers, Dipl-Psych., der dieses<br />
Projekt wohlwollend unterstützt und Türen geöffnet hat.<br />
DANKE den Pflege- und Therapeutenteams auf den Stationen S3, S4, S5 und<br />
Tagesklinik-Sucht des Niedersächsischen Landeskrankenhauses Osnabrück. Mein<br />
besonderer Dank gilt hier Frau Dr. Ingelore Lindemann, Dipl.-Psych., für die<br />
wohlwollende Unterstützung und keinesfalls selbstverständliche Koordination auf<br />
den Stationen.<br />
DANKE Herrn Prof. Dr. Karl-Heinz Wiedl für die Übernahme des Zweitgutachtens.<br />
DANKE besonders Herrn Prof. Dr. Henning Schöttke für manchen richtungweisenden<br />
Hinweis und für die konstruktive und insbesondere unkomplizierte Art<br />
der Betreuung.<br />
Münster, im Mai 2007<br />
Axel <strong>Bensmann</strong>
Inhaltsverzeichnis<br />
ii<br />
Inhaltsverzeichnis<br />
Abbildungs- und Tabellenverzeichnis<br />
Seite<br />
viii<br />
I. ENLEITUNG 1<br />
II. LITERATURÜBERSICHT 3<br />
1. Alkohol- und Substanzmissbrauch bzw. -abhängigkeit 3<br />
1.1 Definition von Alkoholmissbrauch und -abhängigkeit 3<br />
1.2 Definition von Drogenmissbrauch und -abhängigkeit 4<br />
1.3 Klassifikation 4<br />
1.3.1 ICD-10- GM (2004/2005) 4<br />
1.3.2 DSM-IV-TR (2003) 5<br />
1.4 Epidemiologie 5<br />
1.4.1 Alkohol 6<br />
1.4.2 Cannabis 6<br />
1.4.3 Opiate 7<br />
1.4.4 Kokain 7<br />
1.4.5 Amphetamine 7<br />
1.5 Ätiologie der Alkohol- und Drogenabhängigkeit 8<br />
1.5.1 Lerntheoretische Modelle 9<br />
1.5.2 Kognitive Modelle 10<br />
1.5.3 Diathese-Stress-Modell 12<br />
1.5.4 Das soziopsychologische Modell 12<br />
1.5.5 Psychodynamische Modelle 13<br />
1.5.6 Das Selbstachtungsmotiv als Erklärungsvariable des Drogenkonsums 15<br />
2. Persönlichkeitsstile 17<br />
2.1 Definition von Persönlichkeit und Persönlichkeitseigenschaften 17<br />
2.2 Definition Persönlichkeitsstörung 17<br />
2.3 Klassifikation 18<br />
2.3.1 ICD-10-GM (2004/2005) 18
Inhaltsverzeichnis<br />
iii<br />
Seite<br />
2.3.2 DSM-IV-TR (2003) 20<br />
2.4 Epidemiologie 21<br />
2.5 Theorien zur Entstehung von Persönlichkeitsstörungen 21<br />
2.5.1 Biologische Theorien 22<br />
2.5.2 Psychoanalytische Theorien 22<br />
2.5.3 Interpersonelle Theorien 24<br />
2.5.4 Kognitiv-behaviorale Theorien 27<br />
2.5.5 Die biosoziale Lerntheorie von Millon und Davis (1996) 27<br />
3. Bindung 30<br />
3.1 Definition von Bindung 30<br />
3.2 Ätiologie 30<br />
3.3 Die Bindungsqualitäten 32<br />
3.3.1 Die Bindungsqualitäten nach Ainsworth 32<br />
3.3.1.1 Die sichere Bindung (B) 33<br />
3.3.1.2 Die unsicher vermeidende Bindung (A) 33<br />
3.3.1.3 Die unsicher ambivalente Bindung (C) 33<br />
3.3.1.4 Die desorganisierte Bindung (D) 33<br />
3.3.2 Die Bindungsstile nach Bartholomew 34<br />
3.3.3 Beziehungsspezifische Bindungsskalen für Erwachsene 34<br />
3.4 Epidemiologie 35<br />
3.5 Sind die Bindungsmuster über die Zeit und transsituational stabil? 35<br />
4. Psychotraumatisierung 38<br />
4.1 Definition von Psychotraumatisierung 38<br />
4.2 Eine Typologie von Traumatisierungen 39<br />
4.3 Klassifikation 39<br />
4.3.1 Posttraumatische Belastungsstörung nach ICD-10-GM (2004/2005) 40<br />
4.3.2 Posttraumatische Belastungsstörung nach DSM-IV-TR (2003) 40<br />
4.3.3 Unterschiedliche Gewichtung der Kriterien in ICD-10 und DSM-IV 42<br />
4.4 Epidemiologie 43<br />
4.4.1 Häufigkeit traumatischer Ereignisse 43
Inhaltsverzeichnis<br />
iv<br />
Seite<br />
4.4.2 Art des Traumas 43<br />
4.4.3 Prävalenz der PTB nach einem traumatischen Erlebnis 44<br />
4.5 Ausgewählte Ätiologiemodelle 44<br />
4.5.1 Das Verlaufsmodell psychischer Traumatisierung von Horowitz 44<br />
4.5.2 Das Modell der chronischen PTB von Ehlers und Clark 45<br />
4.6 Persönliche Reifung durch traumatische Ereignisse 49<br />
5. Bindung und Trauma 50<br />
5.1 Bindung und Trauma in der Kindheit 50<br />
5.2 Bindungsrepräsentanzen traumatisierter und traumatisierender<br />
Erwachsener 51<br />
6. Bindung und Persönlichkeitsstörung 53<br />
6.1 Unsichere Bindung, desorganisierte Bindung und<br />
Psychopathologien 53<br />
6.2 Störungen der Selbstregulierung durch<br />
Beziehungstraumatisierungen 53<br />
6.3 Modifikationen der Repräsentanzenwelt als intrapsychische<br />
Formen der Selbstregulierung 54<br />
7. Bindung und Substanzstörung 56<br />
7.1 Unsichere Bindung als Risikofaktor für die Entwicklung einer<br />
Suchterkrankung 56<br />
7.2 Suchtmittelkonsum als Beziehungsvermeidung 57<br />
8. Trauma und Persönlichkeitsstörung 59<br />
8.1 Persönlichkeitsstörungen infolge Realtraumatisierungen 59<br />
8.2 Führen spezifische traumatische Erfahrungen zu spezifischen<br />
Persönlichkeitsstörungen? 59<br />
9. Persönlichkeits- und Substanzstörungen 62<br />
9.1 Die Antisoziale Persönlichkeitsstörung und Substanzstörung 62<br />
9.1.1 Epidemiologie Antisoziale Persönlichkeitsstörung und Substanzstörung 62
Inhaltsverzeichnis<br />
v<br />
Seite<br />
9.1.2 Ätiologie Antisoziale Persönlichkeitsstörung und Substanzstörung 62<br />
9.2 Die Borderline Persönlichkeits- und Substanzstörung 64<br />
9.2.1 Epidemiologe Persönlichkeits- und Substanzstörung 64<br />
9.2.2 Ätiologie von Borderline Persönlichkeitsstörung und Substanzstörung 64<br />
10. Posttraumatische Belastungs- und Substanzstörungen 68<br />
10.1 Epidemiologie PTBS und Substanzstörung 68<br />
10.2 Belastende Faktoren in der Kindheit und spätere<br />
Suchterkrankungen 68<br />
10.3 Ätiologie Posttraumatische Belastungs- und Substanzstörung 69<br />
10.3.1 Die Selbstmedikationshypothese 69<br />
10.3.2 Die Risikohypothese 70<br />
10.3.3 Die Vulnerabilitätshypothese 70<br />
11. Resümee 71<br />
11.1 Auflistung der abgeleiteten Hypothesen 72<br />
III. METHODEN 73<br />
12. Rekrutierung der Versuchspersonen und Ablauf der Erhebung 73<br />
12.1 Rekrutierung der Versuchspersonen Einschlusskriterien 73<br />
12.2 Einschlusskriterien 73<br />
12.3 Ablauf der Erhebung 74<br />
12.4 Ausschluss der Versuchspersonen 75<br />
12.5 Soziodemographische Daten 75<br />
13. Die eingesetzten Erhebungsinstrumente 78<br />
13.1 Der CAGE-Fragebogen 78<br />
13.2 Der Zahlen-Verbindungs-Test 78<br />
13.3 Demographische Variablen 79<br />
13.4 Der Fragebogen zum Persönlichkeits- Selbstportrait 80<br />
13.5 Die Beziehungsspezifischen Bindungsskalen für Erwachsene 81<br />
13.6 Die Posttraumatische Diagnoseskala 83
Inhaltsverzeichnis<br />
vi<br />
IV. ERGEBNISSE 85<br />
14. Personengebundene Störvariablen 85<br />
Seite<br />
15. Ergebnisse des Fragebogens zum Persönlichkeitsselbstportrait 87<br />
15.1 Mittelwertvergleiche und Gruppenunterschiede bei den<br />
Persönlichkeitsstilen des FPP 87<br />
15.2 Extremere Persönlichkeitsstilausprägungen, die eine Störung<br />
kennzeichnen 91<br />
16. Ergebnisse des Bindungsspezifischen Bindungsskalen für<br />
Erwachsene 93<br />
16.1 Dauer der Partnerschaften 93<br />
16.2 Mittelwertvergleiche und Gruppenunterschiede bei den BBE 95<br />
16.3 Bindung bei Extrempersönlichkeiten 96<br />
16.4 Reliabilitätsberechnungen der BBE 98<br />
17. Ergebnisse der PDS 100<br />
17.1 Posttraumatische Belastungsstörung 100<br />
17.2 Traumatische Ereignisse 101<br />
17.3 Spezifische traumatische Erfahrungen 102<br />
17.4 Traumatische Erfahrungen mit der größten Bedeutung 104<br />
17.5 Intrusionen, Vermeidung und psychophysiologische Erregung 104<br />
V. DISKUSSION 106<br />
18. Personengebundene Störvariable 106<br />
19. Interpretation und Diskussion der Ergebnisse des Fragebogens<br />
zum Persönlichkeitsselbstportraits 108<br />
20. Interpretation und Diskussion der Ergebnisse zu den<br />
Bindungsspezifischen Bindungsskalen für Erwachsene 112<br />
20.1 Dauer der Partnerschaft 112<br />
20.2 Mittelwertvergleiche und Gruppenunterschiede<br />
der Bindungsskalen 112
Inhaltsverzeichnis<br />
vii<br />
Seite<br />
20.3 Bindung bei Extrempersönlichkeiten 114<br />
21. Interpretation und Diskussion der Ergebnisse der<br />
Posttraumatischen Diagnose Skala 115<br />
21.1 Posttraumatische Belastungsstörung 115<br />
21.2 Unterschiedliche traumatische Ereignisse 116<br />
21.3 Spezifische traumatische Erfahrungen 116<br />
21.4 Intrusionen, Vermeidung und Erregung 117<br />
VI. ZUSAMMENFASSUNG 118<br />
VII. LITERATURVERZEICHNIS 120<br />
VIII. ANHANG 131
Abbildungs- und Tabellenverzeichnis<br />
viii<br />
Abbildungs- und Tabellenverzeichnis<br />
Seite<br />
Abbildung 1:<br />
Die affektiv-kognitiven Prozesse beim Rückfall wegen sozialer Isolation<br />
(Beck et al., 1997) 11<br />
Abbildung 2:<br />
Modell der chronischen Posttraumatischen Belastungsstörung<br />
(Ehlers & Clark, 2000) 46<br />
Abbildung 3:<br />
Komorbiditätsmodell von Borderline Persönlichkeits- und Substanzstörungen<br />
(Trull et al., 2000) 67<br />
Abbildung 4:<br />
Das Kontinuum vom Persönlichkeitsstil zur Persönlichkeitsstörung<br />
(Oldham & Morris, 1992) 80<br />
Abbildung 5:<br />
Mittelwerte der Persönlichkeitsstile des FPP aller Suchtgruppen<br />
und der Kontrollgruppe 87<br />
Tabelle: 1:<br />
Nomenklatur und Probleme der Verständigung in der Praxis<br />
(Tretter, 2000) 3<br />
Tabelle 2:<br />
Soziodemographische Daten der Stichprobe 77<br />
Tabelle 3:<br />
Gruppenunterschiede für die abhängige Variable „FPP-Subskalen“: Mittelwerte,<br />
Standardabweichungen und signifikante Gruppenunterschiede 90
Abbildungs- und Tabellenverzeichnis<br />
ix<br />
Seite<br />
Tabelle 4:<br />
Häufigkeiten, % der Persönlichkeitsstörungen nach Cut-off-Wert<br />
und Signifikanz der Unterschiede zwischen Suchtgesamt- und Kontrollgruppe 92<br />
Tabelle 5:<br />
Dauer der bestehenden Partnerschaft (in Monaten) 93<br />
Tabelle 6:<br />
Bei keiner festen Partnerschaft:<br />
Dauer der letzten festen Partnerschaft (in Monaten) 94<br />
Tabelle 7:<br />
N, Skalen-Mittelwerte, Standardabweichung der BBE pro Gruppe 96<br />
Tabelle 8:<br />
N, Skalen-Mittelwerte, Standardabweichung der BBE pro Gruppe und<br />
Signifikanzniveau 97<br />
Tabelle 9:<br />
Item-Trennschärfen pro Skala in der Bindung zur Mutter 98<br />
Tabelle 10:<br />
Item-Trennschärfen pro Skala in der Bindung zum Partner 99<br />
Tabelle 11:<br />
Anzahl und Prozentwerte der Teilnehmer, die die Kriterien<br />
einer PTBS nach DSM-IV erfüllen, pro Gruppe 100<br />
Tabelle 12:<br />
Gruppengröße, Mittelwert und Standartabweichungen der Anzahl, der mit<br />
zutreffend bewerteten „Trauma-Kategorien“ der PDS pro Gruppe 101
Abbildungs- und Tabellenverzeichnis<br />
x<br />
Tabelle 13:<br />
Verteilung der in den PDS angegebenen erfahrenen traumatischen Ereignisse,<br />
n, %, pro Gruppe; Signifikanzniveau 102<br />
Seite<br />
Tabelle 14:<br />
Welches Ereignis ist für Sie am Belastensten? Häufigkeiten, % der<br />
Kontrollgruppe, Gesamtsuchtgruppe und einzelner Subgruppen 103
I. Einleitung 1<br />
I Einleitung<br />
Dem jüngst erschienenen Drogenbericht 2006 der Bundesregierung. zufolge ist die<br />
Zahl der Erstkonsumenten harter Drogen im letzten Jahr um 3,4 % zurückgegangen.<br />
Doch darf dieser erfreuliche Trend nicht darüber hinwegtäuschen, dass<br />
Substanzstörungen immer noch mit zu den häufigsten psychischen Störungen in<br />
Deutschland zählen. Gesamt gesehen gibt es in der Bundesrepublik ca. 3,5 Millionen<br />
Menschen, die an einer Abhängigkeit von psychotropen Substanzen wie Alkohol,<br />
Medikamenten und illegalen Drogen erkrankt sind (Soyka, 1997, 1998). Zur<br />
Verdeutlichung des volksgesundheitlichen Ausmaßes: Die Anzahl der schizophren<br />
Erkrankten liegt bei knapp 800.000 Personen, die der schwer depressiv Erkrankten<br />
bei etwa 1 Million.<br />
Johann, Lange und Wodarz (2007) referieren US-amerikanische Studien, die zeigen,<br />
dass 37 % der Alkoholabhängigen und 50 % der Drogenabhängigen eine komorbide<br />
psychische Störung aufweisen. Dabei werden die komorbiden Störungen häufig<br />
unterschätzt und finden in der Therapieplanung wenig Berücksichtigung.<br />
Es ist unbestritten, dass es sich bei Substanzabhängigen hinsichtlich der Ätiologie,<br />
des Störungsverlaufs und der Therapie um eine heterogene Personengruppe handelt.<br />
Wesentlich für den Erfolg einer Therapie ist die Ergründung der Ursachen. Die<br />
Ursachen für eine psychotrope Abhängigkeit sind nach bisherigem Wissensstand<br />
multifaktoriell zu betrachten.<br />
Diese <strong>Diplomarbeit</strong> untersucht den multifaktoriellen Zusammenhang zwischen<br />
Alkohol- bzw. illegaler Drogenabhängigkeit und den damit zusammenhängenden<br />
und zurzeit am häufigsten diskutierten Faktoren des Persönlichkeitsstils, der Bindung<br />
und traumatischer Erfahrungen an einer Gruppe stationär oder teilstationär<br />
aufgenommener substanzabhängiger Männer. Die Daten werden mit denen einer<br />
nicht abhängigen Kontrollgruppe verglichen. Dabei wird die Bedeutung komorbider<br />
Störungen bei alkohol- und/oder drogenabhängigen Männern herausgearbeitet.<br />
Um einen ausgewählten Überblick über den derzeitigen Forschungsstand und den<br />
jeweiligen Grundannahmen zu geben, wird im Folgenden Abschnitt (Literatur).<br />
zunächst ein Überblick über Definitionen und Konzepte von Alkohol- und<br />
Drogenabhängigkeit geboten, von Persönlichkeit und Persönlichkeitsstilen und deren<br />
extremen Ausprägungen sowie von Bindung und traumatischen Erfahrungen.
I. Einleitung 2<br />
Die darauf folgenden Kapitel (5 – 10) verdeutlichen den Zusammenhang der Themen<br />
Persönlichkeitsstörung, Bindung und Psychotraumatisierung mit der<br />
Substanzstörung. Kapitel 11 zieht ein Resümee der dargelegten Befunde und leitet<br />
die Hypothesen der empirischen Untersuchung ab.<br />
Im dritten Abschnitt dieser Arbeit (Methoden) wird die Stichprobe, die verwandten<br />
Erhebungsinstrumente und das methodische Vorgehen bei der Datenerhebung<br />
beschrieben<br />
Im Abschnitt IV. (Ergebnisse) wird das Auswertungsvorgehen und die Ergebnisse<br />
dieser Erhebung präsentiert, die im Abschnitt V (Diskussion) interpretiert und<br />
kritisch diskutiert werden. Im VI. Abschnitt (Zusammenfassung) werden die<br />
Kernaussagen dieser Arbeit gebündelt dargestellt.
II. Literaturübersicht 3<br />
II. Literaturübersicht<br />
1. Alkohol- und Substanzmissbrauch bzw. -abhängigkeit<br />
Zum besseren Verständnis der Untersuchungsgruppe soll es in diesem ersten Kapitel<br />
zunächst um die Definition und Abgrenzung der Untersuchungsgruppe der Alkoholund<br />
Substanzmissbraucher bzw. - abhängigen gehen. Es wird hier ausschließlich auf<br />
Alkoholabhängige (1.1.1) und Abhängige von illegalen Drogen (1.1.2) Bezug<br />
genommen.<br />
1.1 Definition von Alkoholmissbrauch und -abhängigkeit<br />
Der Überbegriff Alkoholismus kann in Missbrauch (bzw. schädlichen Gebrauch) und<br />
Abhängigkeit von Alkohol differenziert werden.<br />
Die Intensität der Beziehung zum Alkohol, Häufigkeit, Menge und Dauer des<br />
Konsums ist die Grundlage der klassifikatorischen Entscheidung, ob der<br />
entsprechende Konsument Missbraucher, schädlicher Gebraucher oder Abhängiger<br />
von Alkohol ist (vgl. Tabelle 1).<br />
Grundsätzlich kann beim Vorliegen von Entzugssymptomen von körperlicher<br />
Abhängigkeit gesprochen werden, die von der psychischen Abhängigkeit als<br />
unwiderstehlichem Drang nach Alkohol abgegrenzt werden kann (Tretter, 2000).<br />
Tabelle 1: Nomenklatur und Probleme der Verständigung in der Praxis (Tretter, 2000)<br />
• Normaler Gebrauch: gelegentlich zum Essen/Genuss<br />
1-2 Gläser (20-40g Männer, 10-20g Frauen)<br />
• Missbrauch: Rauschtrinken noch kein Schaden (Kater?),<br />
überwiegt subjektiver Nutzen?<br />
• Gefährlicher Gebrauch: mit dem Konsummuster sind deutliche Risiken<br />
verbunden<br />
• Schädlicher Gebrauch: Sturz, Verkehrsdelikt negative Konsequenzen<br />
objektivierbar<br />
• Abhängigkeit: trotz negativer Konsequenzen weiterer Konsum
II. Literaturübersicht 4<br />
1.2 Definition von Drogenmissbrauch und - abhängigkeit<br />
Nach Tretter (2000) kann Drogenabhängigkeit zunächst als abhängiger Konsum<br />
illegaler Drogen definiert werden, womit auch der Missbrauch verbunden ist. Tretter<br />
betont jedoch, dass der Begriff Missbrauch hier nicht zweckmäßig ist, da es sich um<br />
verbotene Drogen handelt, die nicht gebraucht werden dürfen. Hier wird die<br />
kulturgebundene Festlegung dieser Kategorien deutlich.<br />
1.3 Klassifikation<br />
Im Folgenden wird auf die Klassifikation von Abhängigkeit näher eingegangen, da<br />
sie ein maßgebliches Kriterium der Stichprobe ist.<br />
Weltweit haben sich zwei Klassifikationssysteme durchgesetzt, das Diagnostische<br />
und Statistische Manual Psychischer Störungen (DSM) der American Psychiatric<br />
Association (APA) und die Internationale Klassifikation von Krankheiten (ICD) der<br />
Weltgesundheitsorganisation (WHO), das in Europa maßgeblich ist bei der Diagnose<br />
von Krankheiten und somit auch in unserem Gesundheitssystem zur Codierung<br />
verpflichtend eingesetzt wird, weshalb im Folgenden das derzeitige ICD-10 (Dilling,<br />
Mombour & Schmidt, 2005) ausführlicher beschreiben wird als das DSM-IV (Saß,<br />
Wittchen, Zaudig & Houben, 2003).<br />
1.3.1 ICD-10-GM (2004/2005)<br />
Im V. Kapitel der ICD-10 werden unter der Kategorie F1 Psychische und<br />
Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen (neben einer Restkategorie)<br />
neun große Gruppen psychotroper Substanzen aufgeführt: Alkohol, Opioide,<br />
Sedativa und Hypnotika, Kokain, Psychostimulanzien, Cannabinoide, Halluzinogene,<br />
Nikotin und Tabak und flüchtige Lösungsmittel.<br />
Unter F1 Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen wird<br />
die akute Intoxikation (akuter Rausch), der schädliche Gebrauch und das<br />
Abhängigkeitssyndrom unterschieden.<br />
Das Abhängigkeitssyndrom wird mit folgenden Punkten definiert:<br />
1. Ein starker Wunsch oder eine Art Zwang, psychotrope Substanzen zu<br />
konsumieren (Craving).
II. Literaturübersicht 5<br />
2. Verminderte Kontrollfähigkeit über Beginn, Beendigung und Menge der<br />
psychotropen Substanz.<br />
3. Körperliches Entzugssyndrom bei Reduktion oder Beendigung der Substanz.<br />
4. Toleranzentwicklung und dementsprechende Steigerung der Dosis.<br />
5. Substanzkonsum gerät zunehmend in den Mittelpunkt, alles andere wird dem<br />
untergeordnet. Erhöhter Zeitaufwand für die Beschaffung, Konsumierung und<br />
Erholung von dessen negativen Folgen.<br />
6. Anhaltender Substanzkonsum, obwohl dessen negative Auswirkungen dem<br />
Konsumenten bewusst sind oder sein könnten.<br />
Eine gesicherte Abhängigkeitsdiagnose kann dann gestellt werden, wenn innerhalb<br />
eines Jahres mindestens drei der o.g. Punkte gleichzeitig gegeben waren.<br />
1.3.2 DSM-IV-TR (2003)<br />
Das DSM-IV-TR klassifiziert auf der Achse I die Störungen im Zusammenhang mit<br />
Psychotropen Substanzen und differenziert (wie auch das ICD-10) die Kategorien<br />
Substanzabhängigkeit, Substanzmissbrauch und Substanzintoxikation. Da die<br />
Kriterien der Substanzabhängigkeit im DSM-IV-TM weitgehend identisch sind mit<br />
denen des ICD-10 – im DSM wird lediglich der Punkt 2 des ICD-10 erweitert um<br />
den Punkt des anhaltenden Wunsches und (erfolgloser) Versuche den<br />
Substanzkonsum zu beenden oder zu verringern – werden sie hier nicht nochmals<br />
aufgeführt.<br />
1.4 Epidemiologie<br />
In einer im Auftrag des Bundesministeriums für Gesundheit und Soziale Sicherung<br />
2003 durchgeführten „Repräsentativerhebung zum Gebrauch psychoaktiver<br />
Substanzen in Deutschland“ („Bundesstudie“) erhoben Augustin und Kraus (2005)<br />
das Konsumverhalten an einer Stichprobe von 8.061 Erwachsenen im Alter zwischen<br />
18 und 59 Jahren.<br />
Die hier im Folgenden vorgestellten epidemiologischen Daten beziehen sich auf<br />
diese Erhebung.
II. Literaturübersicht 6<br />
1.4.1 Alkohol<br />
17 % im Alter von 18 bis 59 Jahren gaben im Jahr 2003 an, in den letzten 30<br />
Monaten alkoholabstinent gewesen zu sein. Dies galt mit 21 % in höherem Maße für<br />
Frauen als für Männer (13 %).<br />
Hochgerechnet konsumierten insgesamt 12,3 % oder 5,5 Mio. Erwachsene (3,8 Mio.<br />
Männer und 1,7 Mio. Frauen) Alkohol über einen Grenzwert von 20g Reinalkohol<br />
pro Tag für Frauen und 30g Reinalkohol pro Tag für Männer.<br />
1.4.2 Cannabis<br />
Laut „Bundesstudie 2003“ ist Cannabis die am häufigsten konsumierte illegale<br />
Droge in Deutschland. 26 % der befragten 18- bis 59-Jährigen in Westdeutschland<br />
und 15 % in Ostdeutschland gaben an, mindestens einmal in ihrem Leben Cannabis<br />
konsumiert zu haben. Der Trend ist in beiden Bereichen steigend. In der Gruppe der<br />
18- bis 34-Jährigen ist die Lebenszeitprävalenz mit 37,4 % der Westdeutschen und<br />
30,3 % der Ostdeutschen deutlich größer. Am weitesten verbreitet ist der<br />
Cannabiskonsum in der Gruppe der 18- bis 24-Jährigen. Annähernd jeder Zweite<br />
(42,7 %) in Ost- und Westdeutschland gab an, Cannabis schon einmal in seinem<br />
Leben konsumiert zu haben. Die 12-Monatsprävalenzrate in dieser Altersgruppe ist<br />
in den neuen Bundesländern von 17 % im Jahr 2000 auf 19,6 % leicht gestiegen,<br />
wohingegen die Größe in den alten Bundesländern auf dem Niveau von 2000<br />
stagnierte (2000: 22 %; 2003: 22,1 %).<br />
Die 12-Monatsprävalenzrate in der Gruppe der 18- bis 59-Jährigen betrug 7 % für<br />
Ost- und 5,4 % für Westdeutschland. Die in der Gruppe der 18- bis 34-Jährigen<br />
betrug in Ostdeutschland 12,6 % und in Westdeutschland 14,6 %.<br />
Auf Gesamtdeutschland bezogen gaben 24,3 % (12-Monatsprävalenz: 6,8 %) der<br />
befragten 18- bis 59-Jährigen an, in ihrem Leben mindestens einmal Cannabis<br />
konsumiert zu haben. In der Gruppe der 18- bis 34-Jährigen waren dies 35,9 % (12-<br />
Monatsprävalenz: 14,3 %). Und auch wiederum in der Gruppe der 18- bis 24-<br />
Jährigen fand sich die weiteste Verbreitung mit 42,7 % (12-Monatsprävalenz:<br />
21,6 %).
II. Literaturübersicht 7<br />
1.4.3 Opiate<br />
Bei Opiaten wie Heroin, Methadon, Codein, Opium und Morphium ist der Konsum<br />
wenig verbreitet. Etwa 1,4 % der 18- bis 59-Jährigen gaben (2003) an, im Laufe ihres<br />
Lebens schon einmal Erfahrungen mit Opiaten gemacht zu haben. Die Angaben zur<br />
12-Monatsprävalenz sind deutlich geringer. Jedoch muss bei diesen geringen Werten<br />
beachtet werden, dass diese Konsumentengruppe statistisch schwer zu erreichen ist.<br />
Deshalb sollten diese Angaben nur als grobe Anhaltspunkte betrachtet werden und<br />
dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Opiatkonsum nach wie vor die<br />
meisten sozialen und gesundheitlichen Probleme verursacht.<br />
1.4.4 Kokain<br />
Auf Gesamtdeutschland bezogen lag die Lebenszeitprävalenz bei den 18- bis 59-<br />
Jährigen bei 3,0 % (12-Monatsprävalenz: 0,8 %). Die in der Gruppe der 18- bis 34-<br />
Jährigen lag bei 4,8 % (12-Monatsprävalenz: 1,6 %).<br />
In der Gruppe der 25- bis 29-Jährigen ist Kokain mit 5,7 % am weitesten verbreitet,<br />
gefolgt von der Gruppe der 18- bis 24-Jährigen mit 4,4 % (12-Monatsprävalenz:<br />
1,8 %).<br />
1.4.5 Amphetamine<br />
In der Gruppe der Personen im Alter zwischen 18 und 24 Jahren findet sich in<br />
Westdeutschland eine Lebenszeitprävalenz von 5,9 % (12-Monats-Prävalenz:3,1 %).<br />
In Ostdeutschland beträgt die Lebenszeitprävalenz in der gleichen Gruppe 6,4 % (12-<br />
Monats-Prävalenz: 3,4 %). In der Gruppe der 18- bis 34-Jährigen beträgt die<br />
Lebenszeitprävalenz in den alten Bundesländern 5,5 %(12-Monats-Prävalenz: 2,3 %)<br />
und in den neuen 4,7 % (12-Monats-Prävalenz:2,1 %).<br />
Im Vergleich zu der Erhebung aus dem Jahr 1990 ist beim aktuellen<br />
Konsumverhalten eine leichte Steigerung zu verzeichnen.<br />
Insgesamt können, mit Ausnahme der älteren Altersgruppen, aufgrund der<br />
demographischen Entwicklung der Drogenerfahrung in Ostdeutschland kaum mehr<br />
wesentliche Unterschiede zwischen den beiden Regionen festgestellt werden.<br />
Auf Gesamtdeutschland bezogen gaben 3,3 % der befragten 18- bis 59-Jährigen an,<br />
in ihrem Leben mindestens schon einmal Amphetamine konsumiert zu haben (12-<br />
Monats-Prävalenz: 0,9 %). In der Gruppe der 18-bis 34-Jährigen waren dies 5,4 %
II. Literaturübersicht 8<br />
(12-Monats-Prävalenz: 2,2 %). In der Gruppe der 18- bis 24-Jährigen hatten 6,0 %<br />
Lebenszeiterfahrungen mit Amphetaminen (12-Monats-Prävalenz:3,1 %).<br />
- Designerdrogen (Ecstasy etc.)<br />
Ecstasy ist auf dem bundesdeutschen Drogenmarkt erst seit Anfang der 90er Jahre<br />
bedeutsam geworden. Obwohl die Designerdroge erst gut 15 Jahre auf dem Markt<br />
ist, zeigt die Lebenszeitprävalenz von 5,4 % bei den 18- bis 24-Jährigen in<br />
Westdeutschland, dass Ecstasy in erheblichem Umfang konsumiert wird. Die<br />
Lebenszeitprävalenz in der Gruppe der 18- bis 34-Jährigen beträgt 5 %. Die<br />
Entwicklung in Westdeutschland zeigt, dass dieser Wert bei den Jungen<br />
Erwachsenen seit 1995 stabil geblieben ist, was jedoch nicht für Ostdeutschland gilt.<br />
Hier zeigt die Gruppe der 18- bis 24-Jährigen seit 1997 (2,4 %) einen Anstieg der<br />
Kokainkonsumenten auf 9,7 %. In der Gruppe der 18- bis 34-Jährigen in<br />
Ostdeutschland liegt die Lebenszeitprävalenz bei 6,3 %. Auf niedrigerem Niveau (1-<br />
2 %) findet sich diese Entwicklung auch bei der 12-Monatsprävalenz. Unterschiede<br />
in der 12-Monatsprävalenz von Ost- und Westdeutschland sind nicht festzustellen.<br />
Auf Gesamtdeutschland bezogen gaben in der Gruppe der 18- bis 59-Jährigen 2,4 %<br />
an, in ihrem Leben mindestens einmal Ecstasy konsumiert zu haben (12-<br />
Monatsprävalenz: 0,8 %). In der Gruppe der 18- bis 34-Jährigen waren dies 1,9 %<br />
und in der Gruppe der 18- bis 24-Jährigen sogar 6,3 % (12-Monatsprävalenz: 2,1 %).<br />
1.5 Ätiologie der Alkohol- und Drogenabhängigkeit<br />
Die Entwicklung einer Abhängigkeit, darüber sind sich Psychologen und Mediziner<br />
einig, ist niemals monokausal. Biologische, psychische und soziale Faktoren<br />
beeinflussen die Entwicklung einer Abhängigkeit. Es gibt auch einen großen Einfluss<br />
bestimmter Lebenssituationen. Im Folgenden werden einzelne Ätiologiemodelle<br />
vorgestellt, die – häufig schulengebunden – eine Suchtentwicklung und<br />
Aufrechterhaltung zu erklären versuchen. Dabei liegt der Fokus in dieser Arbeit auf<br />
dem Zusammenhang von Traumata, Persönlichkeitsstilen und Bindungserfahrungen<br />
mit Substanzabhängigkeit.
II. Literaturübersicht 9<br />
1.5.1 Lerntheoretische Modelle<br />
- Operante Konditionierung<br />
Ein wichtiges und in der Forschung unbestrittenes Modell der Suchtentwicklung ist<br />
das lernpsychologische Modell der Sucht (vgl. Revenstorf & Metsch, 1986; zitiert<br />
nach: Tretter & Müller, 2001) und basiert im wesentlichen auf dem bekannten<br />
„Lernen am Erfolg“ (operantes Konditionieren). Verhalten mit unmittelbaren<br />
positiven Effekten wird wiederholt, Verhalten mit unmittelbaren negativen Effekten<br />
wird vermieden.<br />
Dem Grundlagenmodell der modernen Verhaltensanalyse nach Kanfer und Saslow<br />
(1965) zufolge beruht die Suchtentwicklung auf folgendem Bedingungsgefüge (vgl.<br />
Schneider, 1985; Tretter & Müller, 2001):<br />
Situative Bedingungen (S), organismische Zustände (O), Reaktionen (R),<br />
Kontingenzen (K) und Konsequenzen (englisch: C).<br />
Besteht zwischen den Konsequenzen (C) des Verhaltens eine Kontingenz (K), dann<br />
tritt eine Verstärkung (oder ggf. Bestrafung) des Verhaltens auf, wodurch die<br />
Auftrittswahrscheinlichkeit des Verhaltens verändert wird. Dieses Modell wird kurz<br />
SORKC-Modell genannt.<br />
- Klassische Konditionierung<br />
Mit dem Prinzip der klassischen Konditionierung, also des „Signallernens“, wird die<br />
Kontextbezogenheit des Drogenkonsums durch konstante situative Faktoren<br />
verdeutlicht. Das Auftreten eines mit dem Suchtstoff konditionierten Cues kann das<br />
süchtige Verlangen (Craving) auslösen.<br />
- Lernen am Modell<br />
Neben dem „Lernen am Erfolg“ und der klassischen Konditionierung kann die<br />
Suchtentwicklung auch durch das „Lernen am Modell“ gefördert werden. Kinder<br />
können bereits den elterlichen Alkoholkonsum nachahmen – 1 % der männlichen<br />
Bevölkerung haben bereits vor dem 6. Lebensjahr Erfahrungen mit Alkohol gemacht<br />
(Feuerlein, 1989).<br />
Zusammenfassend erklärt die lernpsychologische, verhaltensanalytische Sichtweise<br />
die Suchtentwicklung mit einem selbstverstärkenden Bedingungsgefüge und betont<br />
den zunehmenden Automatismus der Suchtentwicklung.
II. Literaturübersicht 10<br />
1.5.2 Kognitive Modelle<br />
Die kognitiven Modelle betonen die Rolle von Wahrnehmung, Erwartung,<br />
automatisierten Denkabläufen, Bewertungsprozessen und intentionalem Handeln bei<br />
der Entwicklung und Steuerung von Verhalten und somit auch von süchtigem<br />
Verhalten.<br />
In der Therapie wird durch Veränderungen der Kognitionen versucht, den sich selbst<br />
verstärkenden Prozess der Suchtentwicklung zu durchbrechen. In<br />
experimentalpsychologischen Untersuchungen wurde die Bedeutung der kognitiven<br />
Faktoren (z.B. Erwartung) auf das Gesamterleben bestätigt.<br />
- Selbstwirksamkeitserwartung<br />
Eines der zentralen Modelle ist das Konzept der Selbstwirksamkeitserwartung nach<br />
Bandura (1977). Die Selbstwirksamkeitserwartung des Alkoholikers beim Versuch,<br />
eine Situation selbst und nüchtern zu bewältigen, fällt allgemein geringer aus als der<br />
erlebte Handlungseffekt unter Alkohol. In lustvollen oder unlustvollen Situationen<br />
werden die Selbstwirksamkeitserwartungen also zunächst durch Alkohol gesteigert.<br />
Die Wahrscheinlichkeit für den Alkoholismus steigt nach den Modellen der<br />
kognitiven Psychologie nach Schneider (1982; zitiert nach Tretter & Müller, 2001):<br />
1. mit dem Grad der wahrgenommenen Stressbelastung in einer Situation<br />
(Risikosituation): „Der Zustand ist unerträglich“.<br />
2. mit dem Grad der wahrgenommenen persönlichen Unfähigkeit zur Kontrolle<br />
der Situation, im Sinne der Selbstunwirksamkeitserwartung: „Ich kann nichts<br />
machen“.<br />
3. mit dem Mangel an adäquaten Bewältigungsstrategien: „Es hilft nichts“.<br />
4. mit den Wirksamkeitserwartungen des Alkoholtrinkens als alternative<br />
Bewältigungsstrategie: „Trinken tut gut“.<br />
5. mit der Verfügbarkeit des Alkohols und den Trinkzwängen: „Da gibt es was<br />
zu trinken“.<br />
In der Therapie werden sowohl die Situationswahrnehmung, die<br />
Selbstwirksamkeitsbewertung als auch Bewältigungsstrategien verändert.
II. Literaturübersicht 11<br />
- Das Sucht-Modell von Beck, Wright, Newman und Liese (1997)<br />
In dem Sucht-Modell von Beck et al. (1997) gibt es kognitive Grundannahmen, die<br />
z.B. das Selbstbild betreffen („ich tauge nichts“) und ihre besondere funktionelle<br />
Bedeutung dadurch bekommen, dass sie als Soll-Regeln wirken („die anderen sollen<br />
mich akzeptieren“) und durch das Nichterreichen als emotional belastend erfahren<br />
werden („keiner beachtet mich“) oder eben z.B. nach therapeutischer Intervention<br />
verändert werden („ich kann nicht jedem gefallen“) und dann weniger belasten.<br />
Darüber hinaus gibt es konditionale Annahmen („wenn ich mich perfekt verhalte,<br />
dann finde ich Anerkennung“), nach denen versucht wird zu handeln. Zudem werden<br />
einzelne Ereignisse bzw. Erfahrungen nun von automatischen Gedanken begleitet,<br />
die bei typischen Ereignissen, also auch bei Scheitern, auftreten („es ist egal, was ich<br />
mache, es beachtet mich niemand“). Nun werden kompensatorische Strategien<br />
realisiert, z.B. zum emotionalen Ausgleich Alkohol zu trinken, wobei bei<br />
entsprechenden Vorerfahrungen erst einmal spezifische Gedanken auftreten („ein<br />
Bier wäre jetzt gut“), die das Verlangen erzeugen. Nach dem Auftreten erlaubender<br />
Gedanken („einmal kannst du ruhig was trinken“) kommt es zu Konsumverhalten<br />
(vgl. Abb. 1).<br />
Abbildung 1: Die affektiv-kognitiven Prozesse beim Rückfall wegen sozialer Isolation<br />
(Beck et al. 1997).
II. Literaturübersicht 12<br />
Zusammenfassend zeigen die kognitiven Modelle die Bedeutung der Gedanken und<br />
Selbstannahmen für die Entwicklung einer Abhängigkeit und bieten Ansatzpunkte<br />
zur Veränderung.<br />
1.5.3 Das Diathese-Stress-Modell<br />
Das Diathese-Stress-Modell nach Ferstl (1991) geht davon aus, dass eine<br />
Veranlagung, die entweder durch genetische oder frühkindliche Erkrankungs- bzw.<br />
Lernprozesse erklärt werden kann, unter späteren Belastungsbedingungen aktiviert<br />
wird. Es ist dabei aber keineswegs ausgeschlossen, dass auch eine Diathese ein<br />
erworbener Faktor ist. Es bleibt jedoch offen, inwieweit es sich dabei um spezifische<br />
Determinanten einer späteren Fehlentwicklung handelt.<br />
1.5.4 Das soziopsychosoziale Modell<br />
Der nach Ferstl (1991) in der Verhaltenstheorie als soziopsychobiologisches Modell<br />
bezeichnete Zugang zu pathologischen Phänomenen geht in seinen Grundannahmen<br />
davon aus, dass Details, wie z.B. die Suchtproblematik, nur dann schlüssig aufgeklärt<br />
werden können, wenn die mannigfaltigen Wechselwirkungen von kognitiven,<br />
behavioralen, sozialen und biologischen Faktoren berücksichtigt werden:<br />
- Die soziale Beobachtungsebene<br />
Auf ihr werden die Kommunikations- und Interaktionsprozesse, familiäre Einflüsse,<br />
aber auch die Schichtzugehörigkeit als Einflussgrößen der Störungsgenese<br />
beschrieben.<br />
- Der kognitiv-emotionale Bereich<br />
Auf dieser Ebene finden die emotionalen und gedanklichen internen Prozesse, die als<br />
„covert events“ einer äußeren Beobachtung nur teilweise zugänglich sind, besondere<br />
Aufmerksamkeit. So ist z.B. zu beobachten, dass die erwartete Wirkung eines<br />
Suchtstoffes einen Einfluss auf die tatsächliche Wirkung hat (Marlatt & Gordon,<br />
1985).<br />
- Die Ebene der Verhaltensbeobachtung<br />
Im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit liegen auf dieser Ebene alle im Bezug einer<br />
Störung stehenden relevanten Verhaltensauffälligkeiten sowie deren auslösende
II. Literaturübersicht 13<br />
Bedingungen und Konsequenzen. Die einzelnen Teilstörungsbereiche werden also<br />
somit im Kontext ihrer sozialen, emotionalen und kognitiven Bedingungen<br />
analysiert. Im Behandlungsplan wird ihrer Rechnung getragen. Diesem liegt die<br />
Vorstellung zugrunde, dass der Patient mit seiner Verhaltensänderung und den damit<br />
verbundenen neuen Kontingenzen eine Stabilisierung seines Lebens erreichen kann.<br />
- Die biologische Beobachtungsebene<br />
Von Interesse sind hier alle bisher bekannten körperlichen Begleiterscheinungen<br />
(z.B. Zittern bei Suchtstoffentzug) und die biologischen Grundlagen (z.B. neuronale<br />
Veränderungen) einer Störung.<br />
1.5.5 Psychodynamische Modelle<br />
Verkürzt man die Ideengeschichte der Psychoanalyse auf besonders markante<br />
Begriffe, dann spiegelt sich seelisches Geschehen im wesentlichen im z.T.<br />
unbewussten Kräftefeld zwischen den psychischen Instanzen Es, Ich und Über-Ich<br />
ab: In dieser Sichtweise ist die Droge ein Hilfsmittel für das Ich, die (verdrängten)<br />
Bedürfnisse des Es gegenüber dem Über-Ich durchzusetzen. Dabei erfolgte in der<br />
moderneren psychodynamischen Konzeptualisierung eine Schwerpunktverlagerung<br />
von der trieb- zur ichpsychologischen Auffassung:<br />
- Narzissmusproblematik und Über-Ich-Pathologie<br />
Wurmser (1987) stellte diesen Aspekt gemäß dem Prinzip „Flucht vor dem<br />
Gewissen“ in Form einer Über-Ich-Psychopathologie in den Vordergrund der<br />
psychoanalytischen Theorie und Therapie der Drogensucht. Er konstatiert als<br />
Kernpunkt auch eine Narzissmusproblematik, wie sie auch bereits von Kohut (1973)<br />
stärker in den Vordergrund gestellt wurde.<br />
- Objektbeziehungstheorie nach Kernberg (1978)<br />
Gemäß der Objektbeziehungstheorie nach Kernberg (1978) sind die Erfahrungen der<br />
Person mit sich selbst in Form von affektiv-kognitiven Schematisierungen als<br />
„Selbstrepräsentanzen“ und die Erfahrung mit der Umwelt als<br />
„Objektrepräsentanzen“ gespeichert. Für die psychische Stabilität und Gesundheit<br />
sind besonders die Qualität des Selbstbildes (Selbstrepräsentanz) als auch die Bilder<br />
der Umwelt (Objektrepräsentanz), vor allem im Sinne einer zu engen, zu diffusen
II. Literaturübersicht 14<br />
oder mangelnden Objektbeziehung (z.B. Beziehung zur Mutter) mit ihren<br />
libidonösen und aggressiven Anteilen (gut und böse) von Bedeutung. Bleiben in der<br />
frühkindlichen psychosozialen Entwicklung der Person diesbezüglich hinreichende<br />
Erfahrungen versagt, führt dies zu defekten Objekt- und Selbstrepräsentanzen.<br />
Aufgrund struktureller Defizite der Objekt- und Selbstrepräsentanzen ist das Ich bei<br />
der Regulation der aktuellen psychischen Prozesse oftmals überfordert („Ich-<br />
Schwäche“). Eingesetzte Abwehrmechanismen wie Projektion, Externalisierung,<br />
Verleugnung oder Rationalisierung reichen oftmals nicht aus, so entsteht eine<br />
Reizüberflutung mit nicht identifizierbaren und schwer steuerbaren Unlustgefühlen.<br />
Dieser Prozess wird als „Affektintoleranz“ bezeichnet. Durch den Zusammenbruch<br />
der Regulierungssysteme entsteht Angst, die das gesamte Erleben ungerichtet<br />
durchdringt. Es treten Gefühle des Gescheitert-, Missachtet-, Verlassenseins und<br />
Verzweiflung, Ohnmacht und Wut auf. Reale Belastungen führen aber auch oftmals<br />
zu unverständlich massiven Enttäuschungsreaktionen und nach Rost (1986) zu<br />
typischer Frustrationsintoleranz.<br />
In dieser gestörten Informationsverarbeitung gelingt es durch Konsum von<br />
Rauschmitteln die positiven Anteile des Selbst anzuregen. Solche im Rauscherleben<br />
erfolgenden Verklärungen des Selbst verschärfen jedoch letztlich nur die realen<br />
Beziehungsstörungen mit der Umwelt in der darauf folgenden nüchternen<br />
Erlebensphase.<br />
Die unangenehmen Erfahrungen im Nüchternheitszustand fördern in der Folge<br />
wiederum Bedürfnisse nach Verschmelzung und Harmonie, die im Rauscherleben<br />
fiktiv ermöglicht sind. Das Über-Ich entwickelt jedoch bald unerträgliche<br />
Schamgefühle, mit dem Resultat, dass der Rauschmittelkonsum geleugnet wird.<br />
Zudem führt die Drogenwirkung wiederum zur angenehmen Auflösung und<br />
Inaktivierung des Über-Ichs, das Ich kann somit den Impulsen des Es nachgeben, der<br />
Teufelskreis schließt sich.<br />
- Drogenkonsum als Affektabwehr<br />
Nach Wurmser (1983) stellt Drogenkonsum einen Abwehrmechanismus dar. Im<br />
Zentrum dieses Ansatzes stehen Affekte, die ein Individuum völlig überwältigen<br />
können. „Drogen werden genommen, um Affektstürme oder ständig nagende<br />
dysphorische Stimmungen zu verhindern oder zu mildern“ (Wurmser, 1983; zitiert<br />
nach Literie & Welz, 1983). Dabei wird eine Tendenz zur Affektregression vermutet,
II. Literaturübersicht 15<br />
die sich darin zeigt, dass die Emotionen, die häufig global und undifferenziert<br />
erfahren werden, nur unzureichend in Worte oder andere symbolischen Formen<br />
ausgedrückt werden können. Der Drogenkonsum stellt somit einen Versuch dar, die<br />
emotionale Bedeutung einer Wahrnehmung der äußeren oder inneren Realität im<br />
Unbewussten, unwirksam oder irrelevant werden zu lassen.<br />
- Entwicklungsstörungen als Ursache der Sucht?<br />
Aufgrund frühkindlicher Störungen der Mutter-Kind-Interaktion erfolgt beim<br />
Suchtkranken häufig eine Spaltung der Objektrepräsentanzen und der<br />
Selbstrepräsentanzen in gute und böse Anteile einerseits und eine Verschmelzung<br />
von Objekt (Umwelt) und Selbst mit dem Ergebnis mangelnder Autonomie und<br />
persistierender Abhängigkeit. Ebenso können Phantasie-Wirklichkeitsbeziehungen<br />
entwicklungsbedingt unzulänglich abgegrenzt sein (Anspruchsdenken, überhöhte<br />
Erwartungen).<br />
Aufgrund solch einer Konfiguration des Selbstbildes und des Umweltbildes sind<br />
„Selbstwert-Regulationskrisen“ („narzisstische Krisen“) häufig, die sich wiederum in<br />
Beziehungsstörungen ausdrücken, verbunden mit der exzessiven Suche nach<br />
Anerkennung oder einer Abgrenzung gegenüber der Umwelt („Abhängigkeits-<br />
Autonomie-Konflikt“; Küfner, 1989, Heigl-Evers, 1985; zitiert nach Tretter &<br />
Müller, 2001).<br />
1.5.6 Das Selbstachtungsmotiv als Erklärungsvariable des Drogenkonsums<br />
In der Selbstachtungstheorie von Kaplan (1983) hat der Drogenkonsum die Funktion,<br />
die als subjektiv qualvoll empfundenen Selbstablehnungseinstellungen mehr oder<br />
weniger effektiv zu reduzieren. Sie basiert auf dem Postulat des<br />
Selbstachtungsmotivs, wobei davon ausgegangen wird, dass eine Person durch ihr<br />
Verhalten anstrebt, die Erfahrung positiver Selbsteinstellungen zu maximieren und<br />
die Erfahrung negativer Selbsteinstellungen zu minimieren. Dabei sind unter<br />
„Selbsteinstellungen“ die mehr oder weniger intensiven positiven und negativen<br />
emotionalen Erfahrungen bei der Wahrnehmung und Beurteilung der eigenen<br />
Eigenschaften und Verhaltensweisen gemeint. Es kommt dabei zu einer<br />
Selbstablehnung, wenn ein Individuum außer Stande ist, sich gegen Umstände, die in<br />
der Konsequenz zu Selbstabwertung führen (Missbilligung von Verhaltensweisen
II. Literaturübersicht 16<br />
und Eigenschaften und negative Bewertung des Individuums durch subjektiv<br />
bedeutsame Personen), zu wehren, sich ihnen anzupassen oder sie zu verarbeiten.<br />
Die Person verliert infolge des tatsächlichen und subjektiv erlebten Zusammenhangs<br />
zwischen vergangener Gruppenerfahrungen und der Entwicklung von stark negativen<br />
Selbsteinstellungen die Motivation, sich der Gruppennorm anzupassen, und wird<br />
motiviert, davon abzuweichen. Gleichzeitig sucht das Individuum aufgrund des<br />
unerfüllten Selbstachtungsmotiv nach Alternativen, d.h. devianten Reaktionsmustern,<br />
die eine Aussicht auf die Verringerung der negativen Erfahrungen und eine<br />
Steigerung positiver Erfahrungen der Selbsteinstellung bieten.<br />
Die Übernahme der devianten Verhaltensweise hat selbstaufwertende Konsequenzen,<br />
wenn sie die intrapsychische oder interpersonale Vermeidung von selbstabwertenden<br />
Erfahrungen fördert, die an die Zugehörigkeit zu sozial nicht abweichenden<br />
(normativen) Gruppen geknüpft waren. Das ist in gleicher Weise so, wenn sie dazu<br />
beiträgt, die normative Gruppenstruktur verkörpernden Personen und Objekte in<br />
symbolischer und/oder tatsächlicher Form zu bekämpfen. Oder aber, wenn für die<br />
Verhaltensmuster, die mit der Bildung von Selbstablehnungseinstellungen verbunden<br />
waren, Ersatzmuster mit Selbstaufwertungspotentialen zur Verfügung stehen.<br />
Ersatzbefriedigungen können durch die Identifikation mit einer Gruppe von<br />
Drogenkonsumenten erlangt werden. Sie akzeptieren das Individuum aufgrund der<br />
Anpassung an das Konsummuster. Durch die pharmakologische Wirkung der<br />
Loslösung oder Betäubung von Selbstbestrafungsgefühlen kommt es zu einer<br />
harmonischen Stimmungslage, erleichterter selbstaufwertender sozialer Interaktion<br />
und dem Gefühl, mehr Anerkennung zu bekommen.<br />
Zusammenfassend lässt sich anführen, dass in psychoanalytischer Sichtweise eine<br />
dominante Objektbeziehung zur Sicherung des narzisstischen Wohlbefindens<br />
letztlich dazu führt, dass das Ich geschwächt wird. Diese Ich-Schwäche stellt letztlich<br />
eine massive Funktionsstörung dar, da sie eine Störung der Wahrnehmung von<br />
Innen- und Außenreizen darstellt, ein Unvermögen der Affektdifferenzierung bewirkt<br />
und letztlich zu einem Zusammenbruch der gesamten Informationsverarbeitung<br />
führen kann. In dieser Konzeptualisierung ist die Sucht als ein Versuch der<br />
Selbstheilung anzusehen (vgl. Kap. 10.2.1).
II. Literaturübersicht 17<br />
2. Persönlichkeitsstile<br />
Von Interesse dieser Arbeit sind die Zusammenhänge von Persönlichkeitsstilen und<br />
deren extreme Ausprägung bzw. (spezifischen) Persönlichkeitsstörungen mit<br />
Trauma-Erfahrung und Sucht. So soll in diesem Kapitel der aktuelle Forschungsstand<br />
zum Zusammenhang von Persönlichkeitsstilen und Suchtentwicklung dargelegt<br />
werden.<br />
Im Folgenden soll daher zunächst eine allgemeine Definition von Persönlichkeit und<br />
Persönlichkeitseigenschaften vorgestellt werden. Danach werden die<br />
Einteilungskriterien der Persönlichkeitsstörungen nach ICD-10 und DSM-IV<br />
dargestellt, um daraufhin in diesem Zusammenhang ausgewählte Ätiologiemodelle<br />
aufzuzeigen.<br />
2.1 Definition von Persönlichkeit und Persönlichkeitseigenschaften<br />
Fiedler definiert schulenübergreifend „Persönlichkeit und Persönlichkeitseigenschaften<br />
eines Menschen [...] [als] Ausdruck der für ihn charakteristischen<br />
Verhaltensweisen und Interaktionsmuster, mit denen er gesellschaftlich-kulturellen<br />
Anforderungen und Erwartungen zu entsprechen und seine zwischenmenschlichen<br />
Beziehungen auf der Suche nach einer persönlichen Identität mit Sinn zu füllen<br />
versucht“ (Fiedler, 2001, S. 3).<br />
2.2 Definition Persönlichkeitsstörung<br />
Nach Dilling, Mombour und Schmidt (2005) umfassen die spezifischen<br />
Persönlichkeitsstörungen „tief verwurzelte, anhaltende Verhaltensmuster, die sich in<br />
starren Reaktionen auf unterschiedliche persönliche und soziale Lebenslagen zeigen.<br />
Dabei findet man gegenüber der Mehrheit der Bevölkerung deutliche Abweichungen<br />
im Wahrnehmen, Denken, Fühlen und in der Beziehung zu anderen. Solche<br />
Verhaltensmuster sind zumeist stabil und beziehen sich auf vielfältige Bereiche von<br />
Verhalten und psychischen Funktionen. Häufig gehen sie mit persönlichem Leiden<br />
und gestörter Funktionsfähigkeit einher“ (vgl. Dilling, Mombour & Schmidt, 2005,<br />
S. 225).<br />
Kurt Schneider betonte schon 1923, dass es sich bei Persönlichkeitsstörungen um<br />
extreme Ausprägungen von bestimmten Persönlichkeitsstilen handelt, die entweder<br />
die Person selbst oder andere stören (Schneider, 1923; zitiert nach Trautmann, 2004).
II. Literaturübersicht 18<br />
2.3 Klassifikation<br />
Im folgenden wird zunächst ein Überblick über die Klassifikation der<br />
Persönlichkeitsstörungen nach den beiden gängigen Klassifikationssysteme ICD-10<br />
der WHO und DSM-IV der APA gegeben. Siehe auch kritisch hierzu Trautmann-<br />
Sponsel und Zaudig (1997).<br />
2.3.1 ICD-10-GM (2004/2005)<br />
Im V. Kapitel der ICD-10 werden unter der Kategorie F6 Persönlichkeits- und<br />
Verhaltensstörungen kodiert. Unter F60 findet man die spezifischen<br />
Persönlichkeitsstörungen. Im einzelnen sind dies unter:<br />
F60.0 paranoide Persönlichkeitsstörung<br />
F60.1 schizoide Persönlichkeitsstörung<br />
F60.2 dissoziale Persönlichkeitsstörung<br />
F60.3 emotional instabile Persönlichkeitsstörung<br />
.30 impulsiver Typ<br />
.31 Borderliner-Typ<br />
F60.4 histrionische Persönlichkeitsstörung<br />
F60.5 anankastische (zwanghafte) Persönlichkeitsstörung<br />
F60.6 ängstliche (vermeidende) Persönlichkeitsstörung<br />
F60.7 abhängige (asthenische) Persönlichkeitsstörung<br />
F60.8 sonstige spezifische Persönlichkeitsstörungen<br />
F60.9 nicht näher bezeichnete Persönlichkeitsstörung<br />
Dabei gibt das ICD-10 allgemeine diagnostische Leitlinien für<br />
Persönlichkeitsstörungen vor, die – neben den Beschreibungen der spezifischen<br />
Störungen – vorliegen müssen, um eine Persönlichkeitsstörung diagnostizieren zu<br />
können (vgl. Dilling et al., 2005):<br />
1. Deutliche Unausgeglichenheit in den Einstellungen und im Verhalten in<br />
mehreren Funktionsbereichen wie Affektivität, Antrieb, Impulskontrolle,<br />
Wahrnehmen und Denken sowie in der Beziehung zu anderen.<br />
2. Das auffällige Verhaltensmuster ist andauernd und gleichförmig und nicht auf<br />
Episoden psychischer Krankheiten begrenzt.<br />
3. Das auffällige Verhaltensmuster ist tiefgreifend und in vielen persönlichen und<br />
sozialen Situationen eindeutig unpassend.
II. Literaturübersicht 19<br />
4. Die Störungen beginnen immer in der Kindheit oder Jugend und manifestieren<br />
sich auf Dauer im Erwachsenenalter.<br />
5. Die Störung führt zu deutlichem subjektiven Leiden, manchmal jedoch erst im<br />
späteren Verlauf.<br />
6. Die Störung ist meistens mit deutlichen Einschränkungen der beruflichen und<br />
sozialen Leistungsfähigkeit verbunden.<br />
Zudem dürfen die Zustandsbilder nicht direkt auf beträchtlichere Hirnschädigungen<br />
oder -krankheiten oder auf eine andere psychiatrische Störung zurückzuführen sein.<br />
Für die Fragestellung dieser Arbeit von Interesse ist die Kategorie F62 andauernde<br />
Persönlichkeitsänderungen, nicht Folge einer Schädigung oder Krankheit des<br />
Gehirns. Sie sollte deshalb nicht unerwähnt bleiben:<br />
Hierbei handelt es sich um Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen, die sich bei<br />
Personen ohne vorbestehende Persönlichkeitsstörung nach extremer oder übermäßig<br />
anhaltender Belastung (F62.0) entwickelt haben oder nach schwerer psychiatrischer<br />
Krankheit (F62.1). Bei grober Betrachtung werden Persönlichkeitsänderungen in der<br />
ICD-10 wie im DSM-IV ähnlich beschrieben, nämlich als<br />
Persönlichkeitsauffälligkeiten, die im Gegensatz zu den Persönlichkeitsstörungen<br />
erst im Erwachsenenalter erworben wurden und eine zuvor beobachtbare<br />
Persönlichkeitsstruktur ereignisabhängig markant verändern.<br />
Die Belastung muss dabei so extrem sein, dass eine Vulnerabilität des Individuums<br />
als Erklärung für die gravierenden Auswirkungen auf die Persönlichkeit nicht<br />
ausreicht. Als Beispiele hierfür sind zu nennen: Erlebnisse in Konzentrationslagern,<br />
Folter, Katastrophen, andauernde lebensbedrohliche Situationen (als Geisel,<br />
langandauernde Gefangenschaft mit drohender Todesgefahr). Unter dieser Kategorie<br />
ausgeschlossen sind jedoch langanhaltende Änderungen der Persönlichkeit infolge<br />
einer kurzzeitigen Lebensbedrohung wie bei einem Verkehrsunfall, da neuere<br />
Forschungsergebnisse bei solchen Entwicklungen auf eine vorbestehende psychische<br />
Vulnerabilität hinweisen (Dilling et. al., 2005).
II. Literaturübersicht 20<br />
2.3.2 DSM-IV-TR (2003)<br />
Das DSM-IV-TR klassifiziert auf der Achse II die Persönlichkeitsstörungen, die auf<br />
der Grundlage von deskriptiven Ähnlichkeiten in drei Hauptgruppen (Cluster)<br />
eingeteilt sind:<br />
Cluster A:<br />
- 301.00 (F60.0) Paranoide Persönlichkeitsstörung<br />
- 301.20 (F60.1) Schizoide Persönlichkeitsstörung<br />
- 301.22 (F21) Schizotypische Persönlichkeitsstörung<br />
Cluster B:<br />
- 301.7 (F60.2) Antisoziale Persönlichkeitsstörung<br />
- 301.83 (F60.31) Borderline Persönlichkeitsstörung<br />
- 301.50 (F60.4) Histrionische Persönlichkeitsstörung<br />
- 301.81 (F60.4) Narzisstische Persönlichkeitsstörung<br />
Cluster C:<br />
- 301.82 (F60.6) Vermeidend-Selbstunsichere Persönlichkeitsstörung<br />
- 301.6 (F60.7) Dependente Persönlichkeitsstörung<br />
- 301.4 (F60.5) Zwanghafte Persönlichkeitsstörung<br />
Um eine Persönlichkeitsstörung nach dem DSM-IV diagnostizieren zu können, muss<br />
die betreffende Person neben den störungsspezifischen Kriterien folgende allgemeine<br />
diagnostische Kriterien einer Persönlichkeitsstörung erfüllen (vgl. APA, DSM-IV-<br />
TR, 2003):<br />
A. „Ein überdauerndes Muster von innerem Erleben und Verhalten, das merklich<br />
von den Erwartungen der soziokulturellen Umgebung abweicht. Dieses Muster<br />
manifestiert sich in mindestens zwei der folgenden Bereiche:<br />
1) Kognition (also die Art, sich selbst, andere Menschen und Ereignisse<br />
wahrzunehmen und zu interpretieren),<br />
2) Affektivität (also die Variationsbreite, die Intensität, die Labilität und<br />
Angemessenheit emotionaler Reaktionen),<br />
3) Gestaltung zwischenmenschlicher Beziehungen,<br />
4) Impulskontrolle.<br />
B. Das überdauernde Muster ist unflexibel und tiefgreifend in einem weiten Bereich<br />
persönlicher und sozialer Situationen.
II. Literaturübersicht 21<br />
C. Das überdauernde Muster führt in klinisch bedeutsamer Weise zu Leiden oder<br />
Beeinträchtigungen in sozialen, beruflichen oder anderen wichtigen<br />
Funktionsbereichen.<br />
D. Das Muster ist stabil und langandauernd, und sein Beginn ist zumindest bis in die<br />
Adoleszenz oder ins frühe Erwachsenenalter zurückzuverfolgen.<br />
E. Das überdauernde Muster lässt sich nicht besser als Manifestation oder Folge<br />
einer anderen psychischen Störung erklären.<br />
F. Das überdauernde Muster geht nicht auf die direkte körperliche Wirkung einer<br />
Substanz (z.B. Droge, Medikament) oder eines medizinischen Krankheitsfaktors<br />
(z.B. Hirnverletzung) zurück.“<br />
2.4 Epidemiologie<br />
Nach Saß und Jünemann (2000) dürfte die Prävalenz von Menschen mit auffälliger<br />
Persönlichkeit in der unausgelesenen Allgemeinbevölkerung amerikanischer und<br />
deutscher Studien zufolge knapp 10 % betragen. In einer zwischen 1988 und 1990<br />
durchgeführten internationalen Studie der WHO (Loranger, Satorius & Andreoli,<br />
1994; zitiert nach Saß & Jünemann, 2000) an 716 psychiatrischen (295 stationär und<br />
421 ambulant behandelten) Patienten aus 12 verschiedenen Ländern wurde bei<br />
39,5 % mindestens eine Persönlichkeitsstörung nach ICD-10 diagnostiziert. Die<br />
geringste Häufigkeit weist mit 1,8 % die schizoide Persönlichkeitsstörung auf. Die<br />
häufigsten Störungen werden für die ängstlich-vermeidende mit 15,2 % und die<br />
emotional-instabile Persönlichkeitsstörung (Borderline Typ) mit 14,9 % verzeichnet.<br />
In Deutschland zeigen sich nach ersten Studienergebnissen ähnliche<br />
Verteilungsmuster. In einer forensisch-psychiatrischen Stichprobe fanden sich<br />
Prävalenzdaten sogar bis 80 %.<br />
2.5 Theorien zur Entstehung von Persönlichkeitsstörungen<br />
Da in dieser Arbeit die Zusammenhänge von Persönlichkeitsstilen und Sucht<br />
untersucht werden, wird im Folgenden zunächst ein kurzer Überblick geboten, wie<br />
die verschiedenen Schulen Persönlichkeitsstile bzw. in extremer Ausprägung<br />
Persönlichkeitsstörungen konzeptualisieren. Dabei ist zu beachten, dass die in der<br />
Wissenschaft vorhandenen Modellvorstellungen zur Ätiologie und Pathogenese von
II. Literaturübersicht 22<br />
Persönlichkeitsstörungen äußerst vielfältig sind und häufig ohne nennenswerte<br />
Bezugnahme konkurrierend nebeneinander stehen.<br />
2.5.1 Biologische Theorien<br />
In biologisch orientierten Theorien werden Persönlichkeitsstörungen als<br />
pathologische Zuspitzung bestimmter Persönlichkeitszüge aufgefasst. Sie werden als<br />
konsistente Muster des Verhaltens, des Erlebens und der Kognitionen aufgefasst, die<br />
für eine Person charakteristisch sind und die dabei auf genetische Faktoren,<br />
insbesondere Temperamente, aber auch Umweltfaktoren und soziales Lernen<br />
zurückzuführen sind (Rutter 1987b; zitiert nach Wöller, 2006). Unter<br />
Temperamenten werden konstitutionell angelegte und weitgehend genetisch<br />
determinierte, angeborene Dispositionen zu Reaktionsweisen auf Umweltreize<br />
verstanden, gerade auch hinsichtlich der Intensität, des Rhythmus und der Schwelle<br />
affektiver Reaktionen. Hierzu zählen auch angeborene Dispositionen zur kognitiven<br />
Organisation und zum motorischen Verhalten. Temperamente können als<br />
Verhaltensdispositionen beschrieben werden, die im Wesentlichen schon bei der<br />
Geburt vorhanden sind und auch zumeist bis ins hohe Lebensalter unverändert<br />
fortbestehen (Chess & Thomas, 1990; Maziade et al., 1990; zitiert nach Wöller,<br />
2006). Verhaltensgenetiker haben die Stärke des Zusammenhangs zwischen<br />
genetischem Einfluss und Persönlichkeitsstörungen in Zwillings- und<br />
Adoptionsstudien eindrucksvoll herausarbeiten können. Etwa die Hälfte der Varianz<br />
der meisten Persönlichkeitszüge konnte auf genetische Einflüsse zurückgeführt<br />
werden, sodass Umweltfaktoren ebenfalls 50 % der Varianz der Persönlichkeiten<br />
erklären (Plomin, DeFries & McClearn, 1990). Die Zwillingsstudien verweisen auf<br />
eine erhebliche Erblichkeit von Persönlichkeitszügen, die eine<br />
Persönlichkeitsstörung beschreiben. In einer Studie von Jang, Livesley, Vernon und<br />
Jackson (1996) fand man eine Erblichkeit bei 35 bis 56 %. Zu ähnlichen Ergebnissen<br />
kam eine Studie von Torgersen, Lygren, Oien, Skre, Onstad, Edvardsen, Tambs und<br />
Kringlen (2000) an 92 monozygoten und 129 dizygoten Zwillingspaaren.<br />
2.5.2 Psychoanalytische Theorien<br />
Die psychoanalytische Tradition spricht anstatt von „Persönlichkeitsstörungen“ meist<br />
von „Charakterpathologien“.
II. Literaturübersicht 23<br />
Die frühen psychoanalytischen Modellansätze zu schweren Charakterpathologien<br />
waren triebpsychologisch geprägt. Durch Fixierungen an bestimmten Phasen der<br />
frühen Triebentwicklung wurde die Charakterbildung bestimmt. Entsprechend<br />
wurden orale, anale oder hysterische Charaktere klassifiziert (Abraham, 1924/1969).<br />
Durch die Arbeiten Ich-psychologisch orientierter Autoren wurde man jedoch auch<br />
auf die Bedeutung der nicht triebkonfliktgesteuerten Anteile der<br />
Persönlichkeitsentwicklung aufmerksam. Ich-funktionelle Defizite sind nach dieser<br />
Auffassung ausschlaggebend für die schweren Charakterpathologien (Hartmann,<br />
1964/1965; Raport, 1967; zitiert nach Wöller, 2006). Auch unter dem Einfluss Ichpsychologischer<br />
Ansätze wurden ebenso Charaktere entsprechend ihrer<br />
charakterischen Abwehrorganisation beschrieben, je nachdem, ob eher „reife“ oder<br />
„unreife“ Abwehrmechanismen dominieren. Schwere Charakterpathologien wurden<br />
z.B. durch die Dominanz unreifer Abwehrmechanismen erklärt (Kernberg, 1996b).<br />
Vertreter der neueren Objektbeziehungstheorie zeigten, wie aus realen äußeren<br />
Beziehungserfahrungen verinnerlichte Objektbeziehungen als innerseelische<br />
Repräsentanzen entstehen. Schwere Charakterpathologien sind nach dieser<br />
Auffassung durch das Vorhandensein archaisch-destruktiver verinnerlichter<br />
Objektbeziehungen verursacht (Fairbairn, 1940/1953; Guntrip, 1969; Jacobson,<br />
1964; zitiert nach Wöller 2006).<br />
Mahler, Pine & Bergmann (1978) fassten in ihrem durch intensive Säuglings- und<br />
Kleinkindbeobachtungen entstandenem Entwicklungsmodell, das Phasen und<br />
Subphasen der Selbstentwicklung unterschied, Charakterstörungen als Defizite in der<br />
Bewältigung dieser einzelnen Phasen und Subphasen auf.<br />
Die Selbstpsychologie, im Wesentlichen durch Kohut (1976) geprägt, sieht<br />
Charakterpathologien als ein Ergebnis unzureichender Verinnerlichung spiegelnder<br />
Selbstobjekte. Durch diese unerfüllten Selbst-Objektbedürfnisse kommt es zu<br />
narzisstischen Kompensationsformen, um eine Fragmentierung des Selbst zu<br />
verhindern.<br />
Nach Balint (1987; zitiert nach Wöller, 2006) unterscheiden sich schwere<br />
Charakterpathologien von reiferen Neurosen durch die Präsens der „Grundstörung“,<br />
die durch ein unzureichendes basales Sicherheitsgefühl und fehlendes Urvertrauen<br />
gekennzeichnet ist.
II. Literaturübersicht 24<br />
Für Winnicot sind schwere Charakterpathologien das Ergebnis einer unzureichenden<br />
Verinnerlichung einer haltenden Umwelt und das Resultat ungenügender<br />
Übergangsobjekt-Erfahrungen (Winnicott, 1974b, 1953; zitiert nach Wöller 2006).<br />
Auf den Grundlagen der Ich-Psychologie und der Repräsentanzlehre von Jacobson<br />
(1964; zitiert nach Wöller, 2006) entwickelte Kernberg (1976/1981; zitiert nach<br />
Wöller, 2006) seine Theorie der Objektbeziehungen (vgl. Kap. 1.4.5). Kernberg sieht<br />
schwere Persönlichkeitsstörungen als einen Ausdruck einer verzerrten und in sich<br />
gespaltenen Welt verinnerlichter Objektbeziehungen.<br />
Bion (1962a/1990; zitiert nach Wöller, 2006) hat die Prozesse von Projektion,<br />
Introjektion und projektiver Identifizierung beschrieben, die die frühe Interaktionen<br />
zwischen der primären Bezugsperson und dem Säugling und Kleinkind bestimmen.<br />
Er konnte mit seinem Begriff des „Containing“ wesentliche Aspekte der<br />
affektregulatorischen Interaktion zwischen Bezugsperson und Kleinkind erfassen.<br />
Seiner in der neokleinianischen Tradition liegenden Auffassung nach sind<br />
Persönlichkeitsstörungen die Folge eines unzureichenden „Containments“ der<br />
kindlichen Projektion durch die frühe Bezugsperson.<br />
In jüngster Zeit entwickelten Fonagy und Target (1996, 2001; zitiert nach Wöller,<br />
2006) eine Theorie, die ausdrücklich die Erkenntnisse der Bindungsforschung und<br />
der Entwicklungspsychologie einfließen lassen. In ihrer Theorie sind viele<br />
Phänomene, die typischerweise bei schweren Persönlichkeitsstörungen vorkommen,<br />
Ausdruck einer durch ungünstige Bindungserfahrungen unzureichend ausgebildeten<br />
Fähigkeit zur reflektierenden Verarbeitung („Mentalisierung“) eigener und fremder<br />
psychischer Zustände<br />
Zusammenfassend sehen die älteren psychodynamischen Theorien<br />
Persönlichkeitsstörungen als eine Auswirkung intrapsychischer Strukturschwäche an.<br />
Neuere psychodynamische Ansätze verweisen auch auf die Bedeutung ungünstiger<br />
Interaktionsbedingungen.<br />
2.5.3 Interpersonelle Theorien<br />
In der interpersonellen Theorie, die von Sullivan (1953/1980; zitiert nach Wöller,<br />
2006) in Bezugnahme auf die psychoanalytische Theorie, aber auch in expliziter<br />
Alternative zu ihr, erstmalig formuliert und später von Kiesler (1982; zitiert nach<br />
Wöller, 2006) ausgebaut wurde, wird weniger die individuelle Entwicklung
II. Literaturübersicht 25<br />
betrachtet, sondern im Zentrum des Interesses stehen die zwischenmenschlichen<br />
Beziehungen, in denen sich eine Persönlichkeit ausbildet. Dieser Theorie zufolge<br />
wird die Persönlichkeit weniger durch intrapsychische Prozesse als vielmehr durch<br />
sich wiederholende interpersonelle Situationen des Lebens bestimmt.<br />
Die Individuen zeigen sich in den interpersonellen Situationen so, dass sie sich in<br />
den Interaktionen möglichst sicher und nicht bedroht fühlen. Dessen sind sich die<br />
Interaktionspartner allerdings zum überwiegenden Teil nicht bewusst.<br />
Bei den Interaktionspartnern löst die Art der Selbstpräsentation spezifische<br />
Reaktionen aus, die durch deren je eigene Situationsinterpretierungen beeinflusst<br />
werden. Dadurch werden die Verhaltensreaktionen der Interaktionspartner wiederum<br />
so ausfallen, dass auch diese sich nicht bedroht und sicher fühlen. Die<br />
interpersonellen Interaktionsprozesse sind also stark durch wechselseitige<br />
Erwartungen, Vorannahmen und Interpretation der Verhaltensweisen beeinflusst.<br />
Störungen im Kommunikationsgeschehen entstehen gerade durch Diskrepanzen von<br />
Selbst- und Fremdwahrnehmung. Somit kommt es zu sich wiederholenden,<br />
reziproken Interaktionsmustern, die sich auf den Dimensionen „Zuneigung“ und<br />
„Kontrolle“ in „interpersonellen Zirkeln“ um die Achsen „Liebe-Hass“ und<br />
„Dominanz-Submission“ abbilden lassen. Wöller (2006) führt Leary an, der<br />
detailliert beschreibt, wie Reaktionen eines Interaktionspartners durch die Art der<br />
Präsenz des anderen hervorgerufen werden, wie z.B. bei dem häufig zu<br />
beobachtenden Umstand, dass submissives Verhalten beim Interaktionspartner<br />
Dominanz und dominantes Verhalten Submissivität hervorzurufen pflegt (Leary,<br />
1957; zitiert nach Wöller 2006).<br />
- Zyklisch maladaptive Beziehungsmuster<br />
In ihrem Modell des „zyklisch maladaptiven Beziehungsmusters“ (Cyclic<br />
Maladaptive Pattern [CMP] ) haben Strupp und Binder (1991) vier strukturelle<br />
Elemente aufeinander bezogen:<br />
1. Der blockierte positive Beziehungswunsch gegenüber signifikanten<br />
Interaktionspartnern im Zusammenhang mit der erwarteten negativen Reaktion<br />
des Interaktionspartners.<br />
2. Das Verhalten der Person gegenüber dem Interaktionspartner: Z.B. meidet eine<br />
Person Kontakt als Schutz vor Zurückweisung.<br />
3. Das Verhalten der Interaktionspartner: Z.B. sie übersehen die Person.
II. Literaturübersicht 26<br />
4. Das Introjekt als Beschreibung des Umgangs des Individuums mit sich selbst.<br />
Die Person entwickelt z.B. das Selbstbild nicht wert zu sein, wahrgenommen<br />
und unterstützt zu werden.<br />
Das Konstrukt des Introjekts schlägt hierbei die Brücke zur intrapsychischen<br />
Entwicklung. Unter Bezug auf die psychoanalytische Theorie der Verinnerlichung<br />
früherer Beziehungserfahrungen können die Elemente zyklisch maladaptiver<br />
Beziehungsmuster mit den wichtigsten früheren Beziehungserfahrungen in<br />
Zusammenhang gebracht werden. Dabei lassen sich den drei Modi der<br />
Verinnerlichung früher Beziehungserfahrungen drei Elementen des CMP zuordnen<br />
(Tress, Henry, Junkert-Tress, Hildebrand, Hartkamp & Scheibe, 1996):<br />
• Die Identifikation mit wichtigen Bezugspersonen beeinflusst das Verhalten<br />
gegenüber anderen Personen. Personen verhalten sich z.B. anderen Menschen<br />
gegenüber so, wie eine wichtige Bezugsperson sich ihnen gegenüber verhalten<br />
hatte.<br />
• Die Internalisierungen prägen negative Erwartungen und Befürchtungen, z.B.<br />
ebenso aktuell abgelehnt zu werden, wie sie es von ihren früheren<br />
Bezugspersonen kennen.<br />
• Introjekte prägen das Selbstbild und den Umgang der Person mit seiner Umwelt.<br />
Zusammenfassend können Persönlichkeitsstörungen bei diesen Ansätzen als der<br />
Versuch angesehen werden, Stabilität in dem Wechselspiel von intrapsychischer und<br />
interpersoneller Dynamik zu bekommen, wodurch maladaptive Beziehungen<br />
wiederholt werden. Diese maladaptiven Beziehungen werden aufrechterhalten, da<br />
Handlungsalternativen nicht oder nur unzureichend erlernt wurden und somit eine<br />
Bedrohung des Selbstbildes darstellen.
II. Literaturübersicht 27<br />
2.5.4 Kognitiv-behaviorale Theorien<br />
Eine umfassende kognitionstheoretische Analyse der Persönlichkeitsstörungen haben<br />
Beck, Freeman und Kollegen (1990/1993) vorgelegt. Auch die Autorengruppe um<br />
Beck geht von einer genetischen, biologischen und erzieherisch prädisponierten<br />
Vulnerabilität der Betroffenen aus. Die Persönlichkeitsstörungen selbst entstehen in<br />
ihrer Konzeption jedoch durch die Art, wie Menschen ihre Vulnerabilität in<br />
zwischenmenschliche Erfahrungen einbeziehen und wie sie die dabei möglichen<br />
Erfahrungen kognitiv strukturieren und verarbeiten. Beck et al. stellen heraus, dass<br />
viele prädisponiert vulnerable Menschen dazu neigen, zwischenmenschliche<br />
Gefahren und Krisen als bedrohlich anzusehen und sich zunehmend scheuen – zum<br />
Schutz ihrer Vulnerabilität – Risiken einzugehen oder sich überhaupt neuen<br />
Erfahrungen zu stellen. Die Erfahrungen werden somit durch die bis dahin angelegte<br />
kognitive Struktur „geschützt“ wahrgenommen. Die Personen sind nunmehr<br />
voreingestellt und damit voreingenommen. Neue und alternative<br />
zwischenmenschliche Interaktionen werden vermieden, was im Folgenden einem<br />
Circulus vitiosus gleicht. Angemessene soziale und gesellschaftliche<br />
Umgangsformen können nicht oder nur verzögert mitgelernt werden.<br />
Persönlichkeitsstörungen sind im Sinne Becks immer auch Ausdruck eines<br />
persönlichen Entwicklungsrückstandes im Umgang mit sozial-gesellschaftlichen<br />
Anforderungen.<br />
Als Grundlage dieser fehleranfälligen Wirklichkeitsbewertungen sehen Beck et al.<br />
mehr oder weniger starr oder flexibel nutzbare kognitive Schemata, die die<br />
Erfahrungen selektiv oder synthetisierend strukturieren und – im Falle einer<br />
Persönlichkeitsstörung – verzerren.<br />
Grundsätzliche Persönlichkeitseigenarten („traits“) können in diesem Sinne als<br />
äußerlich sichtbare Anzeichen einer darunter liegenden kognitiv-schematischen<br />
Struktur angesehen werden, die die Person kennzeichnet.<br />
2.5.5 Die biosoziale Lerntheorie von Millon und Davis<br />
Nach Millon und Davis (1996; zitiert nach Trautmann, 2004) entwickelt sich die<br />
Persönlichkeit im Zusammenspiel aus biologischen Faktoren und Umweltfaktoren.<br />
So ist es möglich, dass Personen mit ähnlichen biologischen Anlagen<br />
unterschiedliche Persönlichkeitsstile entwickeln auf dem Hintergrund ihrer je<br />
eigenen Erfahrungen. Umgekehrt können ähnliche Lernerfahrungen unterschiedliche
II. Literaturübersicht 28<br />
Auswirkungen haben, je nachdem, über welche biologische „Grundausstattung“ eine<br />
Person verfügt.<br />
Jede Person besitzt bereits bei der Geburt ein biologisch bedingtes Muster von<br />
Sensitivitäten und Verhaltensdispositionen, die Einfluss darauf haben, wie die Person<br />
bestimmte Erfahrungen subjektiv erlebt. Die Zirkularität der Interaktion ist eine<br />
zentrale Behauptung in Millons Theorie und besagt, dass biologische Dispositionen<br />
bei Kindern bei ihren Interaktionspartnern Reaktionen hervorrufen, die wiederum<br />
ihre Dispositionen verstärken. Damit spielen Kinder eine aktive Rolle in der<br />
Gestaltung ihres Entwicklungsverlaufs. Sie schaffen letztlich die<br />
Umgebungsbedingungen, die ihre biologische Tendenz verstärken, somit formt das<br />
Kind nicht nur sein Verhalten, sondern auch das seiner Eltern (oder anderer<br />
Bezugspersonen).<br />
Millon (1983, zitiert nach Trautmann, 2004) postuliert in seiner biosozialen<br />
Lerntheorie drei Grunddimensionen, anhand derer man Persönlichkeiten<br />
charakterisieren kann.:<br />
1. aktiv vs. passiv (ist das Individuum initiativ oder reagiert es eher auf<br />
Umgebung und Ereignisse)<br />
2. Lust vs. Unlust (Was liegt der Person eher, positive Situationen aufzusuchen<br />
oder unangenehme zu vermeiden?)<br />
3. selbst vs. andere (sind andere verlässlich und bereiten angenehme Gefühle<br />
oder ist man auf sich selbst gestellt?)<br />
Diese Grunddimensionen haben Einfluss darauf, welche Ereignisse als Verstärker<br />
erlebt werden und auf welche Art und Weise Bewältigungsverhalten eingesetzt wird,<br />
wenn sich die Person in einer subjektiv unangenehmen Situation befindet. Diese<br />
Bewältigungsmuster (oder auch Persönlichkeitsstile) werden als komplexe Form<br />
instrumentellen Verhaltens aufgefasst, das darauf abzielt, Verstärkung zu erhalten<br />
und/oder negative Konsequenzen zu vermeiden.<br />
Millon trifft dabei aufgrund seiner dimensionalen Konzeption keine klare<br />
Unterscheidung von Persönlichkeitsstilen und -störungen.<br />
Aus der Kombination dieser drei Grunddimensionen ergeben sich acht grundlegende<br />
Bewältigungsmuster, die mit acht der in DSM-IV (Saß et al., 1996) beschriebenen<br />
Persönlichkeitsstörungen gut in Einklang stehen. Jedoch lassen sich drei der dort<br />
beschriebenen Störungen nicht ableiten: Die Borderline-Störung, die paranoide und<br />
die schizotype Störung.
II. Literaturübersicht 29<br />
Millon erweiterte 1990 sein biosoziales Modell durch evolutionäre Überlegungen<br />
Millon (1990; zitiert nach Trautmann, 2004). Demnach kann Persönlichkeit als<br />
spezifischer Stil adaptiven Funktionierens im Sinne der Evolution gesehen werden.<br />
Persönlichkeitsstörungen sind somit nach Millon (1996; zitiert nach Trautmann,<br />
2004) spezielle Stile von maladaptivem Funktionieren, die auf Mängel des<br />
Individuums zurückzuführen sind, sich auf spezifische Umgebungsbedingungen<br />
einzustellen, mit denen es konfrontiert ist.
II. Literaturübersicht 30<br />
3. Bindung<br />
Der Zusammenhang zwischen dem psychischen Zustand einer Person und ihren<br />
engen zwischenmenschlichen Beziehungen ist in der Psychologie allgemein<br />
anerkannt. Er wird in großem Maße davon mitbestimmt, ob die engen<br />
zwischenmenschlichen Beziehungen harmonisch und warmherzig sind oder ärgerlich<br />
bzw. ängstigend oder auch von emotionaler Unzulänglichkeit geprägt sind oder ob<br />
womöglich gar keine Beziehungen gegeben sind (Bowlby, 1989).<br />
„Die Fähigkeit, Bindungen zu anderen Personen aufzubauen (entweder in der Rolle<br />
der Person, die Unterstützung und Trost sucht, oder der Person, die beides gibt) [wird<br />
als] grundlegendes Merkmal einer effektiv funktionierenden Persönlichkeit und<br />
psychischer Gesundheit betrachtet“ (zitiert nach: Bowlby, 1989, in: Spangler &<br />
Zimmermann (Hrsg.), 2002, S. 21).<br />
Die Bindungstheorie kann somit als umfassende Konzeption der emotionalen<br />
Entwicklung des Menschen, als Kern seiner lebensnotwendigen sozialen<br />
Erfahrungen angesehen werden (Grossmann, Grossmann, Kindler, Scheurer-<br />
Englisch, Spangler, Stöcker, Suess & Zimmermann, 2003). Da die<br />
Bindungserfahrungen also eine grundlegende Auswirkung auf unsere psychische<br />
Entwicklung haben, könnten sie auch bei der Suchtentwicklung von Bedeutung sein.<br />
Im Folgenden wird zunächst definiert, was genau mit dem Konstrukt „Bindung“<br />
gemeint ist. Dann wird aufgezeigt, wie es im Laufe der Entwicklung zu<br />
unterschiedlichen Bindungsqualitäten kommt und wie verschiedene Autoren diese<br />
konzeptualisieren.<br />
3.1 Definition von Bindung<br />
„Bindung („attachment“) ist die besondere Beziehung eines Kindes zu seinen Eltern<br />
oder Personen, die es beständig betreuen. Sie ist im Gefühl verankert und verbindet<br />
das Individuum mit der anderen, besonderen Person über Raum und Zeit hinweg“<br />
(Ainsworth, 1973; zitiert nach Grossmann et al., 2003).<br />
3.2 Ätiologie<br />
Nach Bowlby (1973; zitiert nach Grossmann et al., 2003) sind Bindungsqualitäten<br />
emotionale Lebenserfahrung im Individuum und werden als Modellvorstellungen<br />
von Beziehungen verinnerlicht, den so genannten Arbeitsmodellen („internal<br />
working models“). Umstritten ist noch, wie möglicherweise verschiedene qualitative
II. Literaturübersicht 31<br />
Erfahrungen vom Individuum integriert werden (Bretherton, 1987; zitiert nach<br />
Grossmann et al., 2003). Das „innere Arbeitsmodell“ bildet sich entsprechend<br />
individueller Unterschiede der Persönlichkeitsentwicklung und Organisation des<br />
Verhaltens gerade und vor allem in engen persönlichen Beziehungen über den<br />
Lebenslauf hinweg.<br />
Die unterschiedlichen Bindungsqualitäten bilden sich während des ersten<br />
Lebensjahres des Kindes als Resultat der gemeinsamen, wie auch immer<br />
gekennzeichneten Interaktionsgeschichte mit der Bindungsperson. Bowlby<br />
(1973/1976) betont, dass die Erfahrungen des Kindes mit der primären Bezugsperson<br />
sein inneres Arbeitsmodell von Beziehungen prägen. Auf der Grundlage dieser<br />
Arbeitsmodelle versucht das Kind seine Entwicklungsaufgaben zu bewältigen. Dabei<br />
kommt der emotionalen Zugänglichkeit und der physiologischen Schutzfunktion der<br />
Bindungsperson eine besondere Bedeutung zu, da der Verlust dieses Schutzes mit<br />
Furcht und Unsicherheitsgefühlen einhergeht.<br />
Ein offenes Kommunizieren negativer Gefühle fördert in sicheren Beziehungen Nähe<br />
und Unterstützung und damit emotionale Sicherheit. Wird diese Offenheit<br />
vermieden, stellt sich nur eine relative Nähe zur Bindungsperson ein, die zwar<br />
Schutz vor Gefahren birgt, aber gleichzeitig nicht das Gefühl der Unsicherheit<br />
aufgrund der zu erwartenden Zurückweisung durch die Bindungsperson verringert<br />
(Grossmann et al., 2003).<br />
John Bowlby, der Pionier der Bindungsforschung, unterscheidet in seinem Entwurf<br />
verschiedene Arten von Arbeitsmodellen:<br />
„Ein Schlüsselmerkmal des Arbeitsmodells von der Welt, das sich jeder schafft, ist<br />
die Vorstellung von dem, wer seine Bindungspersonen sind, wo es sie finden kann,<br />
und wie sie wahrscheinlich reagieren. In ähnlicher Weise ist das Schlüsselmerkmal<br />
des Arbeitsmodells vom Selbst, das sich jeder schafft, die Vorstellung, wie<br />
akzeptabel oder inakzeptabel er in den Augen seiner Bindungspersonen ist“ (Bowlby,<br />
1973/1976, S. 247; zitiert nach Grossmann et al., 2003).<br />
Die Arbeitsmodelle stellen somit ein Resultat der Erfahrungen von Handlungen und<br />
Plänen, die bindungsrelevant sind dar (Main, 2002) und können als geistige<br />
Repräsentationen, die sowohl affektive als auch kognitive Komponenten beinhalten,<br />
angesehen werden. Sind diese Arbeitsmodelle erst einmal ausgebildet, existieren sie
II. Literaturübersicht 32<br />
(ähnlich wie „self-fulfilling prophecies“) zum Teil außerhalb des Bewusstseins und<br />
neigen, obwohl nicht unveränderbar, zu deutlicher Stabilität.<br />
Im Laufe der Entwicklung wirken die Arbeitsmodelle auch zunehmend in<br />
Abwesenheit der Bindungspersonen. Gemäß der Theorie bewirken natürliche<br />
Ängste, z.B. in Dunkelheit, plötzlicher Lärm, unerwarteter Angriff oder gelernte<br />
Ängste eine Aktivierung des Bindungssystems mit dem Ziel, Sicherheit zu erlangen.<br />
Ist das Bindungssystem einer Person aktiviert, beeinflussen seine unterschiedlich<br />
repräsentierten Erfahrungen individuelle Verhaltensorganisation und -strategien.<br />
Diese mehr oder weniger reflektierten Arbeitsmodelle wirken sich auch auf die<br />
Aufmerksamkeit gegenüber den eigenen Gefühlen und auf (selektive)<br />
Gedächtnisprozesse aus, die den Zugriff des Individuums zu bindungsrelevanten<br />
Formen des Wissens und Fühlens bezüglich des Selbst, der Bindungspersonen und<br />
der Beziehungen erweitern oder begrenzen (Grossmann et al., 2003).<br />
3.3 Die Bindungsqualitäten<br />
Im Folgenden werden die unterschiedlichen Konzeptualisierungen von Bindung<br />
dargestellt. Zunächst wird die sehr verbreitete Konzeptualisierung der<br />
Bindungsqualitäten nach Ainsworth (1978) dargestellt und dann die von<br />
Bartholomew (1990) und die von Asendorpf, Wilpers und Neyer (1997), die sich an<br />
Bartholomews Konzeption anlehnen.<br />
3.3.1 Die Bindungsqualitäten nach Ainsworth<br />
Mary Ainsworth und ihre Mitarbeiter entwickelten 1978 den Fremde-Situationstest,<br />
ein Verfahren, bei dem einige kurze Trennungen von Mutter und Kind stattfinden<br />
und die Art und Weise, wie das Kind nach der Rückkehr der Mutter mit ihr<br />
interagiert, analysiert wird.<br />
Die drei Grundmuster, die Ainsworth et al. (1978, zitiert nach Grossmann et al.,<br />
2003) identifizierten und die mehrfach repliziert wurden, sind: sicher, unsichervermeidend,<br />
und unsicher-ambivalent. Sie können nach Angaben der Autoren gegen<br />
Ende des ersten Lebensjahres beobachtet werden.
II. Literaturübersicht 33<br />
3.3.1.1 Die sichere Bindung (B)<br />
Die sichere Bindung ist das Bindungsmuster, das mit gesunder Entwicklung<br />
einhergeht. Das Kind besitzt die Zuversicht, dass seine Eltern oder Elternfiguren<br />
verfügbar, feinfühlig und hilfsbereit sein werden, wenn es in bedrohliche oder<br />
ängstigende Situationen kommt. Diese Sicherheit ist die Basis, auf der das Kind<br />
frohen Mutes seine Umwelt erkunden kann und sich deren Anforderungen<br />
gewachsen fühlt.<br />
Dieses Muster wird durch die Eltern gefördert, indem sie verfügbar sind, angemessen<br />
und prompt auf die Signale des Kindes reagieren und liebevoll und bereitwillig auf<br />
das Kind eingehen, sollte es Schutz, Trost oder Hilfe suchen (Bowlby, 1989).<br />
3.3.1.2 Die unsicher vermeidende Bindung (A)<br />
Der unsicher-vermeidende Bindungstyp ist dadurch gekennzeichnet, dass die Kinder,<br />
wenn sie Hilfe suchen, kein Vertrauen auf Unterstützung seitens der Eltern besitzen,<br />
sondern im Gegenteil Zurückweisung erwarten.<br />
Dieses Muster ist auf ständige Zurückweisung der Bezugsperson zurückzuführen,<br />
wenn das Kind Trost oder Schutz suchte. Die extremsten Fälle entstehen durch<br />
wiederholte Zurückweisung oder gar Misshandlung sowie lange Heimaufenthalte<br />
(Bowlby, 1989).<br />
3.3.1.3 Die unsicher ambivalente Bindung (C)<br />
Bei der unsicher-ambivalenten Bindung ist sich das Kind unsicher, ob die<br />
Bezugsperson verfügbar, responsiv oder hilfsbereit sein wird, wenn es Hilfe bedarf.<br />
Deshalb neigt das Kind zu Trennungsangst, ist anklammernd und ist ängstlich bei der<br />
Exploration der Umwelt.<br />
Dieses Muster ist das Ergebnis, wenn Eltern in bestimmten Situationen einmal<br />
zugänglich und hilfsbereit sind und in anderen aber nicht (Bowlby, 1989).<br />
3.3.1.4 Die desorganisierte Bindung (D)<br />
Mitte der 1980er Jahre entdeckten Main und Solomon, dass nicht alle Kinder einer<br />
der drei Bindungskategorien zuzuordnen sind (Main & Solomon, 1986). Bei einer<br />
Reanalyse von Kindern, die in der „Fremden Situation“ nicht oder nur schwer<br />
klassifizierbar waren, fanden Main und Salomon eine Reihe desorganisierter oder<br />
desorientierter Verhaltensweisen, die oft nur kurzzeitig sichtbar wurden, als
II. Literaturübersicht 34<br />
gemeinsames Merkmal dieser Kinder. Eine klare Verhaltensstrategie war nicht zu<br />
sehen. Main und Solomon (1986) stellten Merkmale von Desorganisation und<br />
Desorientierung zusammen. Sie führten z.B. das Suchen von Nähe zur Bezugsperson<br />
an, das kurz vor dem Körperkontakt abgebrochen wird, Verhaltensstereotypien,<br />
plötzliches Erstarren oder zielloses Herumwandeln bei gleichzeitigen Anzeichen von<br />
Angst. Diese Anzeichen der Desorganisation werden auf einer Skala von 1 bis 9<br />
gewichtet. Kinder, bei denen diese Anzeichen einen Wert über 5 zugewiesen<br />
bekommen, werden der D-Kategorie zugeordnet, wobei gleichzeitig das Kind einer<br />
der drei Ainsworth-Gruppen zugewiesen wird.<br />
3.3.2 Die Bindungsstile nach Bartholomew<br />
Bartholomew (1990, 1997) übernimmt in ihrem Ansatz den sicheren und den<br />
anklammernden (unsicher-vermeidenden) Bindungsstil, differenziert aber den<br />
vermeidenden in einen ängstlich-vermeidenden und einen abweisend-vermeidenden<br />
Bindungsstil.<br />
Sie beschreibt vier Prototypen für die Bindung Erwachsener, die definiert werden<br />
durch die zwei Dimensionen „Positivität des Selbstbildes einer Person“ und<br />
„Positivität des Images von anderen Bezugspersonen“. Anhand der zwei<br />
Dimensionen werden vier Bindungs-Prototypen abgeleitet, denen sich jedes<br />
Individuum mehr oder weniger ausgeprägt annähern kann:<br />
• sicher (secure): Selbstbild positiv/ Fremdbild positiv<br />
• ambivalent (preoccupied): Selbstbild negativ / Fremdbild positiv<br />
• vermeidend (dismissing): Selbstbild positiv / Fremdbild negativ<br />
• ängstlich (fearfull): Selbstbild negativ / Fremdbild negativ<br />
Somit bildet sich ein individuelles Profil von Skalenwerten aller vier Stile heraus.<br />
3.3.3 Beziehungsspezifische Bindungsskalen für Erwachsene<br />
Asendorpf, Wilpers und Neyer (1997) entwickelten Bartolomews Modell weiter,<br />
deren Dimension sicher-ängstlich empirisch gut bestätigt ist, nicht aber die<br />
Dimension besitzergreifend und abweisend. Demgegenüber suchten Asendorpf und<br />
Kollegen eine orthogonale Dimension zu sicher und ängstlich, um so eine gute<br />
Unterscheidung im Bereich unsicherer und sicherer Bindungen treffen zu können.
II. Literaturübersicht 35<br />
Sie finden als Kandidaten für den einen Pol für eine solche Dimension<br />
Bartholomews „abweisenden“ Stil, weil dessen Orthogonalität zu sicher und<br />
ängstlich gut gesichert scheint, nennen diesen Pol aber, der Augenscheinvalidität<br />
folgend, „unabhängig“. Den entgegengesetzten Pol dieser Dimension sieht das Team<br />
um Asendorpf naheliegenderweise mit „abhängig“ gegeben.<br />
Asendorpf et al. operationalisierten jeden Pol der zwei Dimensionen durch mehrere<br />
Items. Da eine sichere Bindung allerdings immer auch ein Mindestmaß an<br />
Abhängigkeit impliziert, betonen sie das Angewiesensein in den dazugehörigen<br />
Fragen stark, um eine positive Korrelation mit „sicher“ zu minimieren.<br />
Somit gehen Asendorpf et al. (1997) in ihrem Modell von zwei Dimensionen des<br />
Bindungsstils aus:<br />
• sicher - ängstlich<br />
• abhängig - unabhängig<br />
3.4 Epidemiologie<br />
Einer Untersuchung von van Ijzendoorn und Bakermans-Kranenburg (1996) zufolge,<br />
beträgt der Anteil sicher gebundener Erwachsener in klinisch unauffälligen<br />
Stichproben 58 %, in klinischen Stichproben hingegen lag der Anteil nur bei 14 % .<br />
3.5 Sind die Bindungsmuster über die Zeit und transsituational stabil?<br />
Schon Freud wies darauf hin, dass die frühe Eltern-Kind-Beziehung ein Prototyp<br />
aller späteren Liebesbeziehungen ist. John Bowlby modifizierte Freuds Einsichten<br />
und stellte heraus, dass reale Beziehungserfahrungen mit zentralen Bezugspersonen<br />
in der Kindheit besonders bedeutsam für die weitere Entwicklung sind, da sie die<br />
inneren Arbeitsmodelle prägen, die Individuen von Beziehungen haben. Diese<br />
Arbeitsmodelle wiederum beeinflussen lebenslang die Erwartungen und<br />
Verhaltensweisen gegenüber Beziehungspartnern.<br />
Jedoch gibt es bei allen Parallelen auch wesentliche Unterschiede zwischen der<br />
Beziehung zwischen Mutter (Vater) bzw. primärer Bezugsperson und Kind und den<br />
(Liebes)beziehungen zwischen Erwachsenen. Eltern-Kind-Beziehungen, die die<br />
Bindungsforschung als Prototyp ansieht, auf dem sich die inneren Arbeitsmodelle<br />
von Bindung entwickeln, sind wesentlich asymmetrisch, während zwei Erwachsene
II. Literaturübersicht 36<br />
im Prinzip gleichrangig interagieren. Ein zentrales Beziehungselement gegenüber<br />
Kleinkindern ist die Versorgung mit Wärme und emotionaler und materieller<br />
Sicherheit, wohingegen zwischen erwachsenen Partnern auch Sexualität und andere<br />
Motive und Interessen bedeutsam sind (Sydow, 1998), wobei auch in erwachsenen<br />
Partnerschaften Bindungsaspekte eine wesentliche Rolle spielen (Gloger-Tippelt &<br />
Ullmeyer, 2001). Diese Bindungsaspekte werden besonders deutlich in Zeiten von<br />
Krisen wie Krankheit, Angst, Trauer u.ä. Gerade in diesen Situationen zeigen auch<br />
Erwachsene typisches Bindungsverhalten wie Nähesuchen und Trennungsprotest.<br />
Charakteristische Merkmale, die darauf schließen lassen, dass stabile<br />
Paarbeziehungen als Bindungsbeziehungen zu sehen sind, ist der intime<br />
Körperkontakt, Gefühlsreaktionen bei Trennungen und die positive Auswirkungen<br />
zufriedener (sicherer) Paarbeziehungen auf die physische wie psychische<br />
Gesundheit. Demgegenüber können Trennungen/Scheidungen als Gesundheitsrisiko<br />
angesehen werden (Gloger-Tipelt & Ullmeyer, 2001).<br />
Die Forschung hat jedoch erst relativ spät begonnen, sich mit dem Thema<br />
Bindungshaltung und Partnerschaft zu beschäftigen. Cindy Hazan und Philipp<br />
Shaver (1987) eröffneten hiermit ein neues Forschungsfeld. Sie postulierten, dass<br />
romantische Beziehungen zwischen Erwachsenen in der Kindheit übernommene<br />
Bindungsstile widerspiegeln und dass die Beobachtungen von Kindern in der<br />
fremden Situation (Ainsworth, Blehar, Waters & Wall, 1978) und die aus dem Adult<br />
Attachment Interview abgeleiteten Bindungsstile (sicher, unsicher-vermeidend,<br />
unsicher-ambivalent) auch die Bindung Erwachsener in Hinblick auf<br />
Paarbeziehungen beschreiben können (Sydow, 2000).<br />
Asendorpf, Banse, Wilpers und Neyer (1997) hingegen geben zu bedenken, dass es<br />
unter entwicklungs- und persönlichkeitspsychologischen Gesichtspunkten völlig<br />
abwegig erscheint, von solch einer über die Jahre hinweg bestehenden Stabilität und<br />
Generalisierung des Bindungsstils auszugehen, wie es Bowlby (1980) und in<br />
Anlehnung an ihn viele andere tun. Asendorpf und Kollegen (1997) stellen heraus,<br />
dass Persönlichkeitsmerkmale im Erleben und Verhalten stark situationsspezifisch<br />
sind (vgl. auch Mischel & Peake, 1982) und von einer starken Konsistenz des<br />
Bindungsstils, z.B. zwischen Vater und Mutter, nicht auszugehen ist. Aus<br />
entwicklungspsychologischer Sicht sehen Asendorpf et al. ein einheitliches<br />
Arbeitsmodell als unplausibel an, da der Einfluss von Beziehungen zu Gleichaltrigen<br />
im späten Kindes- und Jugendalter auf die Persönlichkeitsentwicklung insgesamt viel
II. Literaturübersicht 37<br />
größer ist als lange angenommen (vgl. Harris, 1995). Ebenso findet Zimmermann<br />
(1995) für diese Annahme keine Bestätigung. Gleiches gilt für Partnerschaften. In<br />
einer Untersuchung zu Bindungsstilen ließen Baldwin, Keelan, Fehr, Enns und Koh-<br />
Rangarajoo (1996) Studierende ihre zehn wichtigsten Beziehungen und zudem<br />
immer die zu Mutter, Vater und evtl. vorhandenem Partner retrospektiv hinsichtlich<br />
der drei Bindungsstile von Hazan und Shaver (1987) beurteilen. In 88 % der Fälle<br />
wählten die Teilnehmer zur Beschreibung der zehn Beziehungen mindestens zwei<br />
und in 47 % der Fälle alle drei Bindungsstile. Auch bei Beschränkung auf<br />
romantische Beziehungen bestand eine große intraindividuelle Variabilität. Diese<br />
große Personenspezifität fand sich auch bei Asendorpf et al. (1997). So kann in<br />
Übereinstimmung mit Baldwin et al. (1996) von einer Vielzahl individuell<br />
koexistierender innerer Arbeitsmodelle für unterschiedliche aktuelle und vergangene<br />
Beziehungen ausgegangen werden, die untereinander nur eine mäßige Konsistenz<br />
aufweisen.<br />
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass es in der Annahme der<br />
Bindungsstile eine generelle Übereinstimmung gibt in den Typen von sicherer und<br />
unsicherer Bindung. Der unsichere Bindungstyp erfährt aber bei verschiedenen<br />
Autoren eine unterschiedliche Differenzierung, wobei es auch hinsichtlich der<br />
Konzeptualisierung der Bindungsstile Unterschiede gibt. Konzeptualisieren<br />
Ainsworth und Bartholomew ihre Bindungsqualitäten prototypisch, fassen Asendorpf<br />
und Kollegen (1997) diese eher dimensional auf. Wobei, wie Schindler (2001) zeigt,<br />
Bartholomews (1990) Typen auch dimensional betrachtet werden können.<br />
Bezüglich der zeitlichen und situationalen Stabilität der Bindungsstile gehen die<br />
Auffassungen in der Forschungsgemeinschaft auseinander. Doch gibt es gute<br />
Gründe, wie auch Befunde aus der Selbstkonzeptforschung (Hannover, 1997) und<br />
Psychotherapieforschung (z.B. Höger, 2005) nahe legen, diese mit Asendorpf et al.<br />
(1997) bindungsspezifisch und veränderbar zu fassen.
II. Literaturübersicht 38<br />
4. Psychotraumatisierung<br />
Ein weiterer Aspekt dieser vorliegenden Untersuchung ist der Zusammenhang von<br />
Psychotraumatisierung und Sucht. Im Folgenden wird zunächst eine Definition von<br />
Psychotraumatisierung gegeben, um dann auf die Klassifizierung einer<br />
Posttraumatischen Belastungsstörung nach ICD-10 und DSM-IV einzugehen.<br />
4.1 Definition von Psychotraumatisierung<br />
Bei der Definition eines Traumas kann entweder der Akzent auf das traumatische<br />
Ereignis gelegt werden oder aber auf den Zusammenhang von Ereignis und einem<br />
spezifisch subjektiven Erleben.<br />
Genau genommen kann ein Trauma immer erst retrospektiv von der<br />
Folgesymptomatik her definiert werden. Die Schwierigkeit einer Definition des<br />
psychischen Traumas liegt darin, dass ein Trauma niemals objektiv bewertet werden<br />
kann. Zu den objektiven Situationsfaktoren kommen untrennbar subjektive<br />
Bewertungsdimensionen. Das Konzept des psychischen Traumas ist somit ein<br />
relationaler Begriff.<br />
Bei einem Trauma handelt es sich somit um ein „vitales Diskrepanzerlebnis<br />
zwischen bedrohlichen Situationsfaktoren und den individuellen<br />
Bewältigungsmöglichkeiten, das mit den Gefühlen von Hilflosigkeit und schutzloser<br />
Preisgabe einhergeht und so eine dauerhafte Erschütterung von Selbst- und<br />
Weltverständnis bewirkt“ (Fischer & Riedesser, 1998, S. 79).<br />
Diese Definition verdeutlicht, dass traumatische Erlebnisse im Gegensatz zu weniger<br />
gravierenden Erfahrungen durch dauerhafte Folgen gekennzeichnet sind und dass<br />
ihre pathogene Auswirkung zumindest zeitweise von individuellen Ressourcen<br />
abhängig ist, auch wenn die Praxis zeigt, dass extrem schwerwiegende Erlebnisse bei<br />
nahezu jedem Betroffenen gravierende Folgen verursachen.<br />
Menschen mit Traumatisierungen haben eine Extremsituation erlebt, in der sie mit<br />
aversiven Reizen überflutet wurden. Huber (2003) betont, dass man solche<br />
Extremsituationen als Opfer bzw. Betroffener erleben kann, doch auch als Zeuge<br />
oder Täter.<br />
Breiter gefasst ist die Kategorie der „Life-Events“ (z.B. Dohrewend, 1998). Nicht<br />
jedes negative Life-Event stellt ein Trauma dar, aber jedes Trauma ein negatives<br />
Life-Event. Dabei ist die kategoriale Abgrenzung auch von sozialem Stress nicht
II. Literaturübersicht 39<br />
immer einfach. Mit einer genaueren Operationalisierung ist die Forschung nach wie<br />
vor beschäftigt.<br />
4.2 Eine Typologie von Traumatisierungen<br />
Psychische Traumen können nach zwei Dimensionen typisiert werden: personale und<br />
apersonale Traumatisierungen und nach Häufigkeit und Vorhersehbarkeit der<br />
Traumatisierung (ob es sich um einmalige und überraschende oder um<br />
langanhaltende und kumulative Traumatisierungen handelt).<br />
• Unter apersonalen Traumen werden Traumatisierungen verstanden, die nicht<br />
willentlich durch Menschen herbeigeführt werden, wie z.B. Naturkatastrophen<br />
oder Verkehrsunfälle.<br />
• Unter personalen Traumen werden hingegen Traumatisierungen verstanden, die<br />
willentlich durch Gewaltanwendung anderer Menschen dem Individuum<br />
zugefügt werden. Hier sind zu nennen: räuberische Überfälle, Vergewaltigungen,<br />
Kindesmisshandlung und -missbrauch, Folter, Geiselhaft und<br />
Kriegseinwirkungen.<br />
Die zweite Dimension betrifft die Häufigkeit und Vorhersehbarkeit des Ereignisses.<br />
Wöller (2006) unterscheidet in Anlehnung an Terr (1991) zwischen Typ I und Typ II<br />
wie folgt:<br />
• Typ-I-Traumen oder Schock-Traumen: plötzlich, unvorhergesehen, einmalig<br />
- apersonal: Naturkatastrophen, Verkehrsunfälle<br />
- personal: räuberische Überfälle, Vergewaltigung, plötzlicher Verlust einer<br />
Bezugsperson<br />
• Typ-II-Traumen: chronisch- kumulativ<br />
- politische Gewalt: Krieg, Folter, Geiselnahme, Konzentrationslager<br />
- personaler Nahbereich: Kindesmisshandlung und -vernachlässigung<br />
4.3 Klassifikation<br />
Im ICD-10 finden wir im Kapitel V unter F43 die Kategorie „Reaktionen auf<br />
schwere Belastungen und Anpassungsstörungen“
II. Literaturübersicht 40<br />
Hierunter werden die akute Belastungsreaktion (F43.0) als eine akute Reaktion auf<br />
eine Extremsituation aufgeführt, die aber innerhalb von Stunden oder Tagen wieder<br />
abklingt, die Posttraumatische Belastungsstörung (F43.1) als eine verzögerte oder<br />
protrahierte Reaktion auf Extremsituationen und die Anpassungsstörung (F43.2). Die<br />
Anpassungsstörung wird als Zustand subjektiven Leidens und emotionaler<br />
Beeinträchtigungen gefasst, „die soziale Funktionen und Leistungen behindern und<br />
während des Anpassungsprozesses nach einer entscheidenden Lebensveränderung,<br />
nach einem belastenden Lebensereignis oder auch nach schwerer körperlicher<br />
Krankheit auftreten“ (WHO, S.170) und im Allgemeinen nicht länger als 6 Monate<br />
bestehen sollten.<br />
Da in der Literatur ein enger Zusammenhang zwischen einer Alkohol- oder<br />
Drogenabhängigkeit und einer Posttraumatischen Belastungsstörung vermutet wird,<br />
soll im Folgenden auf die Posttraumatische Belastungsstörung näher eingegangen<br />
werden.<br />
4.3.1 Posttraumatische Belastungsstörung nach ICD-10-GM (2004/2005)<br />
Das ICD-10 stellt im Kapitel V unter der Codierung F43.1 Posttraumatische<br />
Belastungsstörung folgende diagnostische Leitlinien auf (zitiert nach Ehlers, 1999):<br />
Stressor:<br />
1. Ereignis oder Situation außergewöhnlicher Bedrohung oder<br />
katastrophenartigen Ausmaßes<br />
2. würde bei fast jedem eine tiefe Verstörung hervorrufen<br />
Notwendige Symptome:<br />
1. Wiederholte unausweichliche Erinnerung oder Wiederinszenierung des<br />
Ereignisses in Gedächtnis, Tagträumen oder Träumen<br />
Andere typische Symptome:<br />
2. Andauerndes Gefühl von Betäubtsein und emotionaler Stumpfheit,<br />
Gleichgültigkeit gegenüber anderen Menschen, Teilnahmslosigkeit<br />
gegenüber der Umgebung, Anhedonie
II. Literaturübersicht 41<br />
3. Vermeidung von Aktivitäten und Situationen, die Erinnerungen an das<br />
Trauma wachrufen könnten<br />
Gewöhnliche Symptome:<br />
4. Vegetative Übererregtheit mit Vigilanzsteigerung, übermäßiger<br />
Schreckhaftigkeit und Schlaflosigkeit<br />
5. Angst und Depression<br />
Seltene Symptome:<br />
6. Dramatische, akute Ausbrüche von Angst, Panik oder Aggression<br />
Zeitlicher Rahmen:<br />
Symptome treten üblicherweise innerhalb von 6 Monaten nach dem belastenden<br />
Ereignis auf<br />
4.3.2 Posttraumatische Belastungsstörung nach DSM-IV-TR (2003)<br />
Das DSM IV stellt folgende Kriterien auf, um eine posttraumatische<br />
Belastungsstörung codieren zu können:<br />
A. Traumaexposition (Kriterium 1 und 2 gefordert)<br />
1. Selbst erlebt oder Zeuge oder Konfrontation mit Ereignis:<br />
(drohender) Tod, ernsthafte Verletzung oder Gefahr für körperliche<br />
Unversehrtheit.<br />
2. Reaktion mit Furcht, Hilflosigkeit oder Entsetzen<br />
B. Wiedererleben (1 Kriterium gefordert)<br />
1. Belastende Erinnerungen<br />
2. Belastende Träume<br />
3. Illusionen, Halluzinationen, dissoziative Flashbacks<br />
4. Intensive psychische Belastung bei Konfrontation mit Hinweisreizen<br />
5. Körperliche Reaktionen bei Hinweisreizen
II. Literaturübersicht 42<br />
C. Vermeidung von Hinweisreizen oder Abflachung der allgemeinen<br />
Reagibilität (Numbing) (3 Kriterien gefordert)<br />
1. Vermeidung traumaassoziierter Gedanken, Gefühle, Gespräche<br />
2. von Aktivitäten, Orten, Menschen, die an das Trauma erinnern<br />
3. Amnesie wichtiger Traumaaspekte<br />
4. Vermindertes Interesse oder Teilnahme an wichtigen Aktivitäten<br />
5. Gefühl von Losgelöstheit/Entfremdung von anderen<br />
6. Reduzierte affektive Bandbreite<br />
7. Gefühl einer eingeschränkten Zukunft<br />
D. Erhöhtes Arousal (mindestens 2 Symptome)<br />
1. Ein- oder Durchschlafstörungen<br />
2. Reizbarkeit oder Wutausbrüche<br />
3. Konzentrationsschwierigkeiten<br />
4. Hypervigilanz<br />
5. Übertriebene Schreckreaktion<br />
E. Das Störungsbild dauert länger als einen Monat<br />
F. Die Störung verursacht klinisch bedeutsames Leiden oder Beeinträchtigungen<br />
Es wird also auch hier schon im Eingangskriterium zwischen dem äußeren Ereignis<br />
(A1) und der Reaktion des Betroffenen (A2) unterschieden und ein Trauma nur<br />
angenommen, wenn beide Beschreibungen zutreffen.<br />
4.3.3 Unterschiedliche Gewichtung der Kriterien in ICD-10 und DSM-IV<br />
Das ICD-10 und das DSM-IV stimmen hinsichtlich der Kernsymptomgruppen der<br />
Posttraumatischen Belastungsstörung überein: Wiedererleben, Vermeidung,<br />
emotionale Taubheit und Übererregung. Sie unterscheiden sich aber in der<br />
Gewichtung der Symptome. Das ICD-10 betont die Symptome des Wiedererlebens<br />
wobei das DSM-IV die Vermeidungs- und Taubheitssymptome priorisiert, da<br />
mindestens drei dieser Symptome für eine Diagnose vorliegen müssen.<br />
ICD-10 und DSM IV unterscheiden sich auch in den Zeitkriterien. Während im ICD-<br />
10 lediglich ein Auftreten der Symptome innerhalb der ersten 6 Monate nach dem
II. Literaturübersicht 43<br />
Ereignis gefordert wird und bei späterem Beginn nur eine „wahrscheinliche“<br />
posttraumatische Belastungsstörung diagnostiziert werden kann, differenziert das<br />
DSM IV hierin genauer. Die posttraumatische Belastungsstörung wird als akut<br />
bezeichnet, wenn sie erst kürzer als 3 Monate andauert, und als chronisch bei<br />
längerer als dreimonatiger Dauer.<br />
Insgesamt sind die Kriterien im DSM-IV strenger gefasst, was auch die Ergebnisse<br />
von Andrews, Slade & Peters (1999; zitiert nach Ehlers, 1999) belegen. Sie fanden in<br />
einer großen Stichprobe eine PTB-Prävalenz nach ICD-10 von 7 % und nach DSM-<br />
IV von 3 %. Dabei betrug die Übereinstimmung zwischen beiden diagnostischen<br />
Systemen nur 35 %.<br />
4.4 Epidemiologie<br />
Die Angaben zur Epidemiologie stammen nach Ehlers (1999).<br />
4.4.1 Häufigkeit traumatischer Ereignisse<br />
In einer großen repräsentativen US-amerikanischen Stichprobe fanden Kessler et al.<br />
(1995), dass 61 % der Männer und 51 % der Frauen mindestens ein traumatisches<br />
Erlebnis in ihrem Leben gehabt haben (nach DSM-III-R). Stein et al. (1997) fanden<br />
nach DSM-IV, dass 81 % der Männer und 74 % der Frauen mindestens einmal in<br />
ihrem Leben einem traumatischen Erlebnis ausgesetzt waren.<br />
4.4.2 Art des Traumas<br />
Die Häufigkeit der PTB ist abhängig von der Art des traumatischen Ereignisses.<br />
Mehrere Studien berichten die höchsten Prävalenzzahlen für die Posttraumatische<br />
Belastungsstörung nach Vergewaltigung. In der Studie von Kessler et al. (1995)<br />
erfüllten 65 % der Männer und 46 % der Frauen, die vergewaltigt worden waren, die<br />
Kriterien einer Posttraumatischen Belastungsstörung nach DSM-III-R. Des Weiteren<br />
wurden hohe Raten berichtet für: Kampfeinsatz im Krieg, Kindesmisshandlung und<br />
sexueller Missbrauch. Relativ niedrige Raten von weniger als 10 % wurden für<br />
Unfälle, Beobachten von Tod oder Verletzung sowie für Brände und<br />
Naturkatastrophen berichtet. Andere Forschergruppen berichten hohe Raten für<br />
Folteropfer (Maercker & Schützwohl, 1997), Überlebende des Holocaust (Kuch &<br />
Kox, 1992) und Kriegsgefangene (Engdahl, Dikel, Eberly & Blank, 1997).
II. Literaturübersicht 44<br />
4.4.3 Prävalenz der PTB nach einem traumatischen Erlebnis<br />
Das Risiko, eine Posttraumatische Belastungsstörung nach einem traumatischen<br />
Erlebnis zu entwickeln, liegt für Männer bei 8 % und für Frauen bei 20 % (Kessler et<br />
al., 1995). Andere berichteten ein höheres Risiko bei Stichproben junger<br />
Erwachsener: Breslau, Davis, Andreski und Peterson (1991) verzeichneten ein<br />
Gesamtrisiko von 24 % und Breslau, Davis, Andreski, Peterson und Schultz (1997)<br />
ein Risiko von 13 % für Männer und 30 % bei Frauen.<br />
4.5 Ausgewählte Ätiologiemodelle<br />
Im folgenden werden zwei aktuelle Ätiologiemodelle der Psychotraumatisierung<br />
vorgestellt.<br />
4.5.1 Das Verlaufsmodell psychischer Traumatisierung von Horowitz<br />
Horowitz (1986) beschreibt Phasen der Reaktion auf ein Stress-Ereignis. Die<br />
normale Reaktion wird als „Stress-Reaktion“ bezeichnet, die pathologische Form als<br />
„traumatische Reaktion“. Im Folgenden werde die Phasen kurz zusammengefasst.<br />
• Die erste Phase ist gewöhnlich durch Aufschrei, Angst, Wut und Trauer geprägt.<br />
Im pathologischen Fall kommt es zu einer überwältigenden Überflutung durch<br />
Emotionen bis zur Panik und völligen Erschöpfung.<br />
• Die zweite Phase ist gekennzeichnet durch Verleugnung. Im Normalfall wird das<br />
Opfer jede Erinnerung an das traumatische Geschehen vermeiden. Im<br />
pathologischen Falle setzt eine extreme Nichtanerkennung des Ereignisses ein,<br />
auf der Verhaltensebene wird ein ausgeprägtes Vermeidungsverhalten sichtbar,<br />
das auch Substanzkonsum einschließt, um die Erinnerung an das traumatische<br />
Geschehen zu dämpfen.<br />
• In der dritten Phase treten gehäuft die vermiedenen Bilder und Gedanken auf. Im<br />
pathologischen Falle der Posttraumatischen Belastungsstörung kommt es zu<br />
Intrusionen. Im Wechsel von Annäherung (Intrusion) und Verleugnung<br />
(Vermeidung) zeigt die traumatische Reaktion eine pendelnde Verlaufsform.<br />
• Im Rahmen der normalen Reaktion folgt nun eine Phase der Integration,<br />
während derer sich die betroffene Person eingehend mit dem Geschehen<br />
auseinandersetzt. Im pathologischen Fall ist dies nicht möglich, die Symptome<br />
der posttraumatischen Belastungsstörung verfestigen sich.
II. Literaturübersicht 45<br />
• Im normalem Verlauf kommt es letztlich zu einem Abschluss der<br />
Traumaverarbeitung. Die betroffenen Personen können sich an das traumatische<br />
Ereignis erinnern, ohne von Bildern und Gedanken überflutet zu werden. Diese<br />
Möglichkeit des Abschlusses ist den Traumatisierten nicht gegeben. Intrusionen,<br />
Übererregung, Vermeidungsverhalten und Betäubung bestehen fort und mindern<br />
dauerhaft die Lebensqualität.<br />
4.5.2 Das Modell der chronischen Posttraumatischen Belastungsstörung von<br />
Ehlers und Clark<br />
Ein Modell der Posttraumatischen Belastungsstörung sollte erklären können, warum<br />
die betroffenen Personen Angstsymptome erleben, obwohl sie sich aktuell nicht mehr<br />
in einer bedrohlichen Situation befinden. Angst bezieht sich üblicherweise auf die<br />
Wahrnehmung einer zukünftigen Bedrohung. Die Posttraumatische<br />
Belastungsstörung ist jedoch eine Störung aufgrund einer Erinnerung an ein<br />
vergangenes Ereignis. Ehlers und Clark (2000) lösen diesen vermeintlichen<br />
Widerspruch, indem sie die chronische Posttraumatische Belastungsstörung so<br />
konzeptualisieren, dass Betroffene das Ereignis und/oder seine Konsequenzen so<br />
verarbeiten, dass sie eine schwere gegenwärtige Bedrohung wahrnehmen.<br />
Zwei verschiedene Prozesse führen nach ihrem Modell zu dieser Wahrnehmung:<br />
Zum einen sind es individuelle Unterschiede in der Trauma-Interpretation und/oder<br />
in der Interpretation seiner Konsequenzen.<br />
Zum anderen sind es individuelle Unterschiede in der Art des Trauma-Gedächtnisses<br />
und der Verbindung zu anderen autobiographischen Erinnerungen.<br />
Wird die Wahrnehmung der gegenwärtigen Bedrohung aktiviert, kommt es zu<br />
intrusivem Wiedererleben, Symptomen der körperlichen Erregung und starken<br />
emotionalen Reaktionen wie Angst, Ärger, Scham oder Trauer. Dabei motiviert die<br />
wahrgenommene Bedrohung zu Verhaltensweisen und kognitiven Reaktionen, die<br />
die Belastung und wahrgenommene Bedrohung mindern sollen, die Störung letztlich<br />
aber aufrechterhalten, wie Abbildung 2 veranschaulicht.
II. Literaturübersicht 46<br />
Abbildung 2: Modell der chronischen Posttraumatischen Belastungsstörung von Ehlers<br />
und Clark (2000).<br />
Im Folgenden werde die einzelnen Elemente kurz erläutert:<br />
Interpretation des Traumas und/oder seiner Konsequenzen<br />
Ehlers und Clark (2000) gehen davon aus, dass Personen mit einer chronischen<br />
Posttraumatischen Belastungsstörung im Unterschied zu Personen, die sich von<br />
einem Trauma psychisch erholen, nicht in der Lage sind, das traumatisch Erlebte als<br />
ein zeitbegrenztes Ereignis zu sehen, das nicht notwendigerweise globale negative<br />
Auswirkungen auf ihr Leben hat. Dabei wird die Bedrohung häufig extern<br />
wahrgenommen (bedrohliche Umwelt), mehr jedoch noch intern als eine Bedrohung<br />
der Selbstwahrnehmung als fähige/akzeptable Person. Dabei ist nicht nur das<br />
Eintreten des traumatischen Ereignisses Gegenstand problematischer<br />
Interpretationen, sondern auch das eigene Verhalten in der Situation. Letztlich ist zu<br />
beachten, dass nicht nur das traumatische Ereignis als solches negativ interpretiert<br />
wird, sondern überdies auch seine Folgen wie die anfänglichen Symptome einer<br />
Posttraumatischen Belastungsstörung.<br />
Art des Trauma-Gedächtnisses
II. Literaturübersicht 47<br />
Die Erinnerung an das traumatische Ereignis ist bei den meisten Patienten mit einer<br />
Posttraumatischen Belastungsstörung nur bruchstückhaft und ungeordnet. Sie können<br />
das Ereignis willentlich nicht vollständig erinnern. Dazu steht das lebhafte<br />
ungewollte Wiedererleben von Aspekten des Erlebnisses im scheinbaren<br />
Widerspruch und muss durch Modelle der PTB erklärt werden. Ebenso muss eine<br />
Reihe von Eigenschaften des intrusiven Wiedererlebens wie z.B. die alle Modalitäten<br />
umfassenden sensorischen Eindrücke erklärt werden.<br />
Ehlers und Clark (2000) schlagen vor, dass dieses Muster der Erinnerungen mit<br />
erschwertem willentlichen Abruf und lebhaftes ungewolltes Wiedererleben mit Hierund-Jetzt-Qualität<br />
damit erklärt werden kann, wie das Trauma encodiert und im<br />
Gedächtnis abgespeichert wurde. Dazu treffen sie drei Annahmen:<br />
1. Das Ereignis wurde nur ungenügend elaboriert und in die Struktur des<br />
autobiographischen Gedächtnisses eingebettet. Dadurch ist der semantische<br />
Abrufpfad relativ schwach, die Erinnerung hat keinen zeitlichen Kontext und ist<br />
nicht mit späteren Informationen verbunden.<br />
2. Es bestehen für das traumatische Ereignis starke assoziative Gedächtnis-<br />
Verbindungen in Form von Reiz-Reiz (S-S) und Reiz-Reaktion (S-R)<br />
Assoziationen, die für das leicht auslösbare Wiedererleben mit verantwortlich<br />
sind.<br />
3. Traumatische Ereignisse unterliegen einem starken Priming. Schon einmal<br />
wahrgenommene Reizkonfigurationen haben eine niedrigere<br />
Wahrnehmungsschwelle als neue Reize. Deshalb werden Reize, die das Erlebte<br />
auslösen können, besonders schnell bemerkt. Zudem haben sie eine schlechte<br />
Reizdiskrimination, weshalb schon nur ähnliche Reize Erinnerungen an das<br />
Trauma auslösen können.<br />
Dysfunktionale Verhaltensweisen und kognitive Verarbeitungsstile<br />
Die Wahrnehmung der Bedrohung und der damit verbundenen Symptome bei einer<br />
Posttraumatischen Belastungsstörung werden von den betroffenen Personen mit einer<br />
ganzen Reihe unterschiedlicher Strategien versucht unter Kontrolle zu bringen.<br />
Jedoch sind diese Strategien dysfunktional, weil sie die Störung über mindestens<br />
einen von drei Strategien aufrechterhalten:<br />
- Sie fördern Symptome einer Posttraumatischen Belastungsstörung.
II. Literaturübersicht 48<br />
- Sie stehen einer Veränderung der negativen Interpretationen des Traumas<br />
und/oder seiner Folgen entgegen.<br />
- Sie unterdrücken die Elaboration des Trauma-Gedächtnisses.<br />
Als ein Beispiel einer dysfunktionalen Strategie sei die Gedankenunterdrückung<br />
genannt. Dieses hat den paradoxen Effekt, dass die Frequenz der ungewollten<br />
Erinnerung steigt (Shiperd & Beck, 1999; zitiert nach Ehlers, 1999).<br />
Als ein weiteres Beispiel einer dysfunktionalen Strategie zur Kontrolle der<br />
wahrgenommenen Bedrohung und/oder Symptome kann der Konsum psychotroper<br />
Substanzen angeführt werden.<br />
Kognitive Verarbeitung während des Traumas<br />
Die kognitive Verarbeitung während des traumatischen Geschehens beeinflusst die<br />
Interpretation und die Art des Trauma-Gedächtnisses. Ehlers und Clark (2000)<br />
fanden, dass Sich-Aufgeben (mental defeat) während einer sexuellen oder<br />
körperlichen Gewalttat oder politischer Inhaftierung eine chronische<br />
Posttraumatische Belastungsstörung und schlechtes Ansprechen auf<br />
Expositionstherapie (Ehlers, Mayou, & Bryant, 1998; zitiert nach Ehlers, 1999)<br />
prädiziert. Dabei lässt sich das Sich-Aufgeben als den wahrgenommenen Verlust<br />
jeglicher Autonomie, begleitet von dem Gefühl kein Mensch mehr zu sein, fassen.<br />
Betroffene, die sich während eines Traumas aufgeben, werden später mit größerer<br />
Wahrscheinlichkeit als andere Opfer das Trauma als einen Beleg ihrer negativen<br />
Selbstsicht interpretieren.<br />
Die Qualität der Informationsbearbeitung hat Auswirkungen auf die Encodierung.<br />
Relevante Größen sind hierbei die Tiefe und Organisation der Verarbeitung<br />
(datenorientierte vs. konzeptuelle Verarbeitung) und das Ausmaß der<br />
selbstbezogenen Verarbeitung und das Vermögen, Eindrücke auf ihren<br />
Wahrheitsgehalt zu überprüfen.<br />
Weitere Variablen, die die Entwicklung einer Posttraumatischen Belastungsstörung<br />
beeinflussen<br />
Wie die Abbildung 2 verdeutlicht, berücksichtigt das Modell zum einen die kognitive<br />
Verarbeitung und Interpretierung des Traumas und die Art, in der das traumatische<br />
Erlebnis im Gedächtnis gespeichert wird, und zum anderen die Strategiewahl, um die<br />
wahrgenommene Bedrohung oder die PTB-Symptome zu kontrollieren. Wichtige
II. Literaturübersicht 49<br />
Einflussgrößen zur Bedeutung psychischer Probleme und zum Auftreten ungewollter<br />
Gedanken sind dabei aber auch die Dauer und Vorhersehbarkeit des traumatischen<br />
Ereignisses, Reaktionen wichtiger Bezugspersonen nach dem Ereignis und der<br />
persönliche Zustand vor dem Trauma (z.B. Erschöpfung, Alkoholgenuss, Grad der<br />
Angst und physischer Erregung), Intelligenz und Persönlichkeitsfaktoren wie<br />
Neurotizismus, frühere traumatische Erfahrungen und Überzeugungen (Selbstwert,<br />
subjektive Einschätzung der Wahrscheinlichkeit selbst Opfer einer Gewalttat zu<br />
werden), sowie frühere Angststörungen oder Depressionen.<br />
Diese Hintergrundvariablen werden dabei von den Autoren weder als notwendige,<br />
noch als hinreichende Variablen in der Ätiologie der chronischen Posttraumatischen<br />
Belastungsstörung angesehen, sollten jedoch bei individueller Therapieplanung<br />
sinnvollerweise Berücksichtigung finden. Sie betonen jedoch ausdrücklich, dass sie<br />
die drei wesentlichen Mechanismen der PTB beeinflussen (Interpretation des<br />
Traumas und seiner Konsequenzen, Art des Traumagedächtnisses und Wahl der<br />
Strategie bezüglich des Umgangs mit der Bedrohung und der Symptome).<br />
4.6 Persönliche Reifung durch traumatische Ereignisse<br />
Die Erfahrung eines traumatischen Ereignisses muss jedoch nicht zwangsläufig die<br />
Person schwächen oder beeinträchtigen. Seit längerem haben unterschiedliche<br />
psychologische Vertreter auf das Phänomen hingewiesen, dass Personen, die eine<br />
Krise oder ein traumatisches Ereignis überstanden haben, von einem Zuwachs an<br />
innerer Reife, neu definiertem Lebenssinn und selbstwahrgenommenen positiven<br />
Veränderungen ihrer Person berichten (Frankl, 1973; Parkes & Weis, 1983; Taylor,<br />
Lichtman & Wood, 1984; Ulich, 1987; zitiert nach Maercker & Langner, 2001).<br />
Maercker und Langner (2001) beschreiben die persönliche Reifung von Personen<br />
nach erlebten Krisen „als die subjektive Erfahrung positiver Veränderungen, die das<br />
Ergebnis der kognitiven und emotionalen Verarbeitung von aversiven Ereignissen<br />
darstellt“ (S. 154). Es kommt hierbei also zur Veränderung und Differenzierung von<br />
Bedeutungen und Attribuierungen sowie zu neu geordneten Bedeutungen.<br />
Schaefer und Moos (1992; zitiert nach Maercker & Langner, 2001) sehen aus<br />
stresstheoretischer Perspektive die persönliche Reifung als ein<br />
Bewältigungsergebnis, das zudem einen Zuwachs an Bewältigungsressourcen für<br />
potenzielle neue Krisen und Traumata darstellt.
II. Literaturübersicht 50<br />
5. Bindung und Trauma<br />
In diesem Kapitel sollen Auswirkungen traumatischer zwischenmenschlicher<br />
Erfahrungen auf den Bindungsstil dargestellt werden.<br />
5.1 Bindung und Trauma in der Kindheit<br />
In bindungstheoretischer Konzeption beziehen sich traumatische Erfahrungen eines<br />
Kindes auf erwachsene Bindungspersonen, durch welche die Bindung erschüttert<br />
oder bedroht wird. Dies kann zum einen dadurch geschehen, dass die affektive<br />
Bindung durch längere oder wiederholte Trennungen oder durch Verluste<br />
unterbrochen wird, zum anderen „kann Traumatisierung durch eine Übergriffigkeit<br />
in der Bindung entstehen, wenn in einer forcierten, grenzüberschreitenden Nähe das<br />
Kind zum Opfer der sexuellen oder aggressiven Impulse der Bindungsfigur wird.<br />
Sexueller Missbrauch und körperliche Misshandlung sind die beiden anderen Formen<br />
von Bindungstraumata, bei denen das affektive Band vom Erwachsenen für andere<br />
Motive missbraucht wird und die Bindungsfigur dem Kind seine eigenen sexuellen<br />
oder aggressiven Bedürfnisse aufzwingt“ (Hauser, 2001, S. 227; zitiert nach Strauß,<br />
2005).<br />
Bevor in der entwicklungspsychologischen Bindungsforschung die Kategorie des<br />
desorganisierten Bindungsverhaltens eingeführt worden war, kamen mehrere Studien<br />
zu dem Schluss, dass misshandelte Kinder überwiegend eine unsichere<br />
Bindungsqualität entwickeln (z.B. mehr als zwei Drittel in den Studien von Egeland<br />
& Sroufe, 1981; Schneider-Rosen & Cicchetti, 1984; zitiert nach Strauß, 2005),<br />
trotzdem aber eine beträchtliche Zahl der sicheren Kategorie zugeordnet wurden.<br />
Nach der Einführung des desorganisierten Bindungsstils zeigten mehrere Studien<br />
(z.B. Carlson & Sroufe, 1995; Howe et al., 1999; zitiert nach Strauß, 2005), dass ein<br />
sehr hoher Anteil (bis über 80 %) betroffener Kinder eine desorganisierte<br />
Bindungsstrategie zeigt, während in nicht-klinischen Stichproben die Prävalenz<br />
desorganisierten Bindungsverhaltens zwischen 14 % (bei Kindern aus mittleren<br />
sozialen Schichten) und 24 % (bei Kindern aus unteren Schichten) anzugeben ist<br />
(van Ijzendoorn et al, 1999).
II. Literaturübersicht 51<br />
5.2 Bindungsrepräsentanzen traumatisierter und traumatisierender<br />
Erwachsener<br />
Eine traumatische Vorerfahrung bei mindestens einem Elternteil kann als<br />
wesentliche Determinante eines desorganisierten Bindungsstils angesehen werden.<br />
Diese Determinante umfasst den ungelösten traumatischen Verlust von<br />
Bindungsfiguren, traumatischen Misshandlungserfahrungen in Form physischer oder<br />
sexueller Gewalt oder auch erst kurz zurückliegende Traumatisierungen. Van<br />
Ijzendoorn et al. (1996) gehen davon aus, dass desorganisierte Bindung nicht auf<br />
konstitutionelle Faktoren zurückzuführen ist (Wöller, 2006). Darüber hinaus<br />
tendieren sie selbst aufgrund ihrer traumatischen Erfahrungen zur Fortführung von<br />
Misshandlung und Vernachlässigung in zwischenmenschlichen Beziehungen<br />
(Streeck-Fischer & van der Kolk, 2000).<br />
Es kann davon ausgegangen werden, dass aufgrund derartiger Erfahrungen die<br />
Fähigkeit, sich in den mentalen Zustand anderer einzufühlen, nachhaltig und<br />
dauerhaft gestört bleibt und die Wahrscheinlichkeit einer Transmission der<br />
traumatischen Erfahrung in der Interaktion mit den eigenen Kindern erhöht (vgl.<br />
Fonagy & Target, 1996; Hauser, 2001; zitiert nach Strauß, 2005). Zusammenhänge<br />
zwischen traumatischen Erfahrungen und Beeinträchtigungen von selbstreflexiven<br />
Funktionen wurden in mehreren empirischen Studien belegt (vgl. Fornagy, 2002;<br />
zitiert nach Strauß, 2005).<br />
Das Elternverhalten desorganisierter Kinder lässt sich beschreiben als ängstlicherschrockenes<br />
und gleichzeitig ängstigend-erschreckendes Verhalten. Dieses<br />
Verhalten bringt das Kind in den unlösbaren Konflikt, bei den Eltern Schutz zu<br />
suchen und sich gleichzeitig vor ihrem Verhalten schützen zu müssen (Main &<br />
Hesse, 1990; zitiert nach Wöller, 2006). Der so entstehende Annäherungs-<br />
Vermeidungskonflikt lässt dem Kind keine vorhersagbare Bewältigungsstrategie<br />
treffen, um mit den Eltern erfolgreich in Interaktion zu treten.<br />
Bei den Eltern handelt es sich bei diesen Reaktionen am ehesten um dissoziative<br />
Reaktionen, bei denen – ausgelöst durch kindliche Merkmale und<br />
Verhaltensweisen – eigene traumatische Erfahrungen, vor allem eigene Erfahrungen<br />
von traumatischem Verlust und sexuellem Missbrauch, hervorgerufen werden<br />
(Hesse, 1999; Liotti, 1995, 1999; Main & Morgan, 1996; Nijenhuis et al., 2003;<br />
zitiert nach Wöller 2006).
II. Literaturübersicht 52<br />
Henderson et al. (1997; zitiert nach Wöller, 2006) fanden eine erhöhte Tendenz der<br />
Reviktimisierung in der Gruppe der unsicher-ambivalent gebundenen und in der<br />
Gruppe der unsicher-desorientiert gebundenen Kinder, aber auch Erwachsenen. So<br />
waren die Bindungsstile von Frauen, die in der Ehe misshandelt wurden, kurz<br />
nachdem sie ihre misshandelnden Ehemänner verlassen hatten, überwiegend<br />
ängstlich anklammernd und mit negativen Selbstbildern verbunden. Fonagy (1998;<br />
zitiert nach Wöller, 2006) postuliert, dass bei unsicheren und vor allem<br />
desorganisierten Bindungen der Körper zum Vehikel für einen introjizierten<br />
„fremden“ Anderen wird, von dem sich die betreffende Person nicht trennen kann,<br />
mit dem sie aber auch nicht harmonisch koexistieren kann.<br />
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Missbrauchserfahrungen und<br />
Vernachlässigung potenziell die Entwicklung einer unsicheren und/oder<br />
desorganisierten Bindung zur Folge haben, die zwar nicht zwingend mit einer<br />
Psychopathologie einhergeht, aber einen erheblichen Risikofaktor für die<br />
Entwicklung psychopathologischer Zustände darstellt. Bindungsstörungen können<br />
die Folge von traumatischen Erfahrungen sein. Nach Brisch (1999) stellen<br />
Bindungsstörungen, die sich z.B. in einem extremen Rückzug und vermehrter<br />
Aggression bis zum völligen Fehlen von Bindungsverhalten äußern können, in der<br />
Regel die Folge von sequenziellen, permanenten Traumatisierungen dar, zu denen<br />
wiederholte (sexuelle) Gewalt und extreme Formen der Vernachlässigung zählen.
II. Literaturübersicht 53<br />
6. Bindung und Persönlichkeitsstörung<br />
In diesem Kapitel soll es um den Zusammenhang von Bindung und<br />
Persönlichkeitsstörungen gehen. Bislang gibt es noch keine konsistente Theorie, die<br />
Bindungsstörungen und die einzelnen Persönlichkeitsstörungen miteinander<br />
verbindet. Jedoch gibt es zahlreiche Ergebnisse, die auf einen Zusammenhang<br />
hinweisen.<br />
6.1 Unsichere Bindung, desorganisierte Bindung und Psychopathologien<br />
Es zeigen sich zahlreiche Zusammenhänge zwischen unsicheren Bindungsstilen und<br />
dem Auftreten klinischer Psychopathologien. Demgegenüber zeigen sicher<br />
gebundene Personen die geringste Anzahl von Symptomen und die meisten<br />
Indikatoren für psychische Gesundheit.<br />
In einer Studie von Alexander (1992; zitiert nach Wöller, 2006) fanden sich bei<br />
unsicher-ambivalent gebundenen Individuen am häufigsten abhängige<br />
Persönlichkeitsstörungen, ein selbstschädigendes Verhalten sowie Züge einer<br />
Borderline-Störung. Zusätzlich neigten sie signifikant häufiger zu Dissoziation<br />
(Alexander & Anderson, 1994; zitiert nach Wöller, 2006).<br />
Die meisten Studien zeigen einen Zusammenhang zwischen einem ängstlichambivalenten<br />
Bindungsstil und der Diagnose einer Borderline-<br />
Persönlichkeitsstörung.<br />
Personen mit desorganisiertem Bindungsmuster zeigen vermehrt eine geschwächte<br />
Kognitionsentwicklung, eine geringere soziale Kompetenz und aggressives<br />
Verhalten in den Vorschuljahren (van Ijzendoorn et al., 1999; zitiert nach Wöller,<br />
2006).<br />
6.2 Störungen der Selbstregulierung durch Beziehungstraumatisierungen<br />
Entwicklungspsychologische und neurobiologische Befunde der letzten Jahre legen<br />
überzeugend dar, dass chronische Bindungs- und Beziehungstraumatisierung im<br />
Zusammenwirken mit konstitutionellen Faktoren zu funktionellen Veränderungen<br />
der Hirnregionen führen, die an der Regulierung der Emotionalität und anderer<br />
wichtiger Steuerungsfunktionen maßgeblich beteiligt sind. Die nicht ausreichend<br />
sensiblen und passenden Abstimmungsprozesse zwischen dem sich entwickelnden
II. Literaturübersicht 54<br />
Kind und seiner primären Bezugsperson und das Ausbleiben eines Halt gebenden<br />
Containments seiner Affekte führen zu veränderten Stoffwechselvorgängen im<br />
Gehirn. Diese veränderten Stoffwechselvorgänge führen dazu, dass sich die für die<br />
Emotionsregulierung relevanten Hirnregionen nicht richtig entwickeln können (Perry<br />
et al., 1995; Schore, 1994; Siegel, 1999; Sroufe, 1996; zitiert nach Wöller, 2006).<br />
Besonders gravierend sind die traumatischen Einwirkungen in den ersten<br />
Lebensjahren, in der reifungssensiblen Phase. Sie münden in schweren Störungen der<br />
Selbstregulation, insbesondere der Emotionsregulierung, Selbstreflexion und<br />
Mentalisierung sowie Störungen der Ich-Integration.<br />
6.3 Modifikationen der Repräsentanzenwelt als intrapsychische Formen der<br />
Selbstregulierung<br />
Bei anhaltender Beziehungstraumatisierung erscheint es zunächst einmal adaptiv und<br />
notwendig, die Bindungsbeziehung zu schützen. Dies führt zu<br />
Persönlichkeitsveränderungen, einhergehend mit:<br />
• einer inkohärenten und verzerrten Wahrnehmung wichtiger<br />
Bindungsbeziehungen,<br />
• negativer Kognitionen über die eigene Person und<br />
• einer lebenslangen Aktivierung „traumatischer“ Beziehungsmuster, gespeichert<br />
in inneren Arbeitsmodellen von Bindung (Bowlby, 1969).<br />
Die bei komplex traumatisierten Patienten typischen chronischen<br />
Persönlichkeitsveränderungen können weitgehend als intrapsychische<br />
(autoregulative) Formen der Selbstregulierung verstanden werden (Herman, 1992;<br />
zitiert nach Wöller, 2006). In diesem Sinne sind auch die typischen Veränderungen<br />
in der Selbstwahrnehmung zu verstehen, einhergehend mit unangemessenen Schuldund<br />
Schamgefühlen, die oft verzerrte Wahrnehmung wichtiger Bezugspersonen und<br />
die Tendenz, misshandelnde frühe Bezugspersonen zu idealisieren. Alle diese<br />
Mechanismen haben eine Funktion: Die Bindungsbeziehung zur primären<br />
Bezugsperson zu erhalten und die betroffene Person vor überflutenden Affekten des<br />
Alleingelassenseins, der Verzweiflung und der Ohnmacht zu schützen.<br />
Die intrapsychische Modifikation der Repräsentanzenwelt erfordert einen nicht<br />
unerheblichen Einsatz von Abwehrmechanismen, dabei ist zu betonen, dass
II. Literaturübersicht 55<br />
projektive und dissoziative Mechanismen die psychosoziale Anpassung erheblich<br />
erschweren können. Traumatische Bindungsmuster stellen auch ein erhöhtes Risiko<br />
einer Reviktimisierung dar (Wöller, 2006).
II. Literaturübersicht 56<br />
7. Bindung und Substanzstörungen<br />
Flores (2004) sieht die Ursache der Suchtmittelabhängigkeit in einer<br />
Bindungsstörung des Patienten. Den Individuen ist es biologisch nicht möglich<br />
(aufgrund fehlender externaler Unterstützung in der frühen Kindheit), ihre eigenen<br />
Affekte zu regulieren. Aufgrund dieser Störung der Emotionsregulierung bzw.<br />
aufgrund eines auf langer Sicht dysfunktionalen Bindungsstils fällt es ihnen schwer,<br />
zwischenmenschliche Beziehungen zu knüpfen und zu unterhalten. Sie sind deshalb<br />
umso mehr gefährdet, aufgrund ihres Mangels an tiefen emotionalen Beziehungen<br />
Alkohol oder Drogen zu substituieren, mit denen zunächst leichter und<br />
unkomplizierter Emotionen reguliert und der Mangel an engen emotionalen<br />
Beziehungen ausgeglichen werden können.<br />
7.1 Unsichere Bindung als Risikofaktor für die Entwicklung einer<br />
Suchterkrankung<br />
Längsschnittstudien an Risikostichproben zeigen, dass eine unsichere Bindung in der<br />
frühen Kindheit ein Risikofaktor für spätere Fehlentwicklungen darstellt,<br />
wohingegen eine sichere Bindung protektiv wirkt (Egle, Hardt, Nickel, Kappis &<br />
Hoffmann, 2002). So findet sich ein deutlicher Zusammenhang zwischen unsicherer<br />
Bindung und psychischer Erkrankung. In klinisch unauffälligen Stichproben beträgt<br />
der Anteil sicher gebundener Erwachsener 58 %, in klinischen Stichproben hingegen<br />
lag der Anteil nur bei 14 % (van Ijzendoorn & Bakermans-Kranenburg, 1996). Für<br />
Abhängigkeitserkrankungen liegen diesbezüglich noch sehr wenige Daten vor, doch<br />
erscheint es plausibel anzunehmen, dass hier, ebenso wie bei anderen psychischen<br />
Störungen, überwiegend unsichere Bindungsmuster zu finden sind, wohingegen eine<br />
sichere Bindung eher vor einer Suchtentwicklung schützen dürfte. Diese Annahmen<br />
werden von Schindler (2001) gestützt, der einen überwiegenden Anteil von<br />
ängstlich-vermeidenden Bindungsstilen, gefolgt von den zweithöchsten<br />
Skalenwerten im anklammernden Bindungsstil (nach den prototypischen<br />
Beschreibungen von Bartholomew, 1990) feststellte. Zudem berichtet er, dass selbst<br />
innerhalb der klinischen Extremgruppe sowohl die Skalenwerte des ängstlichvermeidenden<br />
Stils als auch die des anklammernden Stils mit der Schwere der<br />
Abhängigkeit korrelieren. Die Schwere der Drogenabhängigkeit korreliert also in der<br />
Konzeption von Bartolomew (1990) mit dem negativen Selbstbild der
II. Literaturübersicht 57<br />
Drogenabhängigen. Dieses Ergebnis deckt sich wiederum mit den immer wieder<br />
replizierten Untersuchungen von Thomasius (2000), die einen negativen Selbstwert<br />
Drogenabhängiger konstatieren.<br />
Die unsicheren Bindungsstile zeugen von Angst vor erneuter Zurückweisung. Wenn<br />
keine anderen konstruktiven Bewältigungsmechanismen verfügbar sind, bieten sich<br />
Suchtstoffe als Bewältigungsversuch an. Im Sinne einer Selbstmedikation lassen sich<br />
mit bestimmten Substanzen unangenehme Gefühle zeitweise eindämmen und<br />
dämpfen. So gesehen lässt sich der Suchtmittelkonsum als Versuch begreifen, die in<br />
Bindungssituationen entstehenden negativen Affekte zu regulieren. Dabei ist eine<br />
Beobachtung aus der Kleinkindforschung nicht unerheblich, die besagt, dass sicher<br />
gebundene Kinder weder andere Kinder schikanieren noch selbst schikaniert werden<br />
(was negative Affekte nach sich zöge), da gleichaltrige Kinder sie als<br />
durchsetzungsfähig erleben (Troy & Sroufe, 1987; Weinfield u.a., 1999; zitiert nach:<br />
Brisch, K.E. Grossmann, E. Grossmann & Köhler, 2002).<br />
7.2 Suchtmittelkonsum als Beziehungsvermeidung<br />
Ein Suchtmittelkonsum wirkt sich in dem Maße, wie er in einen Missbrauch oder<br />
eine Abhängigkeit mündet, auch immer stärker auf enge Beziehungen und somit<br />
auch auf Bindungsbeziehungen aus. Werden Substanzen wie Alkohol oder auch<br />
Ecstasy anfangs noch als „Kontaktmittel“ genutzt, ist jemand im intoxikierten<br />
Zustand schlicht nicht beziehungsfähig. Der Suchtmittelkonsum kann und wird somit<br />
auch dazu benutzt, um sich – zumindest kurzfristig – aus unangenehm erlebten<br />
Beziehungen zu verabschieden. Suchtverhalten verhindert somit u. U.<br />
Bindungsbeziehungen, in denen neue, möglicherweise positive Bindungserfahrungen<br />
gemacht werden könnten. Somit verhindert Suchtverhalten eine konstruktive<br />
Weiterentwicklung der Bindung und verfestigt Unsicherheit.<br />
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Wissenschaft beim Thema Bindung<br />
und Sucht noch ganz am Anfang steht. Jedoch scheint das Thema Bindung für das<br />
Verständnis und Behandlung von Suchterkrankungen ein hoch relevantes Konzept zu<br />
sein, da die Bindungstheorie viel zum Verständnis von engen Beziehungen und von<br />
Affektregulation beiträgt. Beides, sowohl die Vermeidung enger Beziehungen und
II. Literaturübersicht 58<br />
die Affektregulation mittels psychotroper Substanzen sind wesentliche Elemente für<br />
das Verständnis von Suchtstörungen. Es liefert ein Modell, das erklärt, wie<br />
Suchtmittel gleichzeitig zur Beziehungsvermeidung und auch zur Angstbewältigung<br />
eingesetzt werden.
II. Literaturübersicht 59<br />
8. Trauma und Persönlichkeitsstörung<br />
In diesem Kapitel soll der Zusammenhang zwischen traumatischen Erfahrungen und<br />
Persönlichkeitsstörungen näher untersucht werden.<br />
8.1 Persönlichkeitsstörungen infolge Realtraumatisierungen<br />
Umfassende Störungen der Persönlichkeit zählen zu den gesicherten Langzeitfolgen<br />
gravierender und lang anhaltender Traumatisierungen durch körperliche oder<br />
sexuelle Gewalt. Eine Vielzahl empirischer Untersuchungen stützt die Hypothese,<br />
dass Traumatisierungen in der Kindheit und die Entstehung einer<br />
Persönlichkeitsstörung eng miteinander verbunden sind. In klinischen Stichproben<br />
finden sich bei Individuen mit der Diagnose einer Persönlichkeitsstörung zu einem<br />
hohen Prozentsatz Misshandlungs- und Missbrauchserfahrungen. Die<br />
Wahrscheinlichkeit, an einer Persönlichkeitsstörung zu erkranken, ist signifikant<br />
erhöht, wenn in der Vorgeschichte Gewalt oder sexuelle Übergriffe berichtet wurden<br />
(Johnson et al., 1999; Modestin et al. 1988; Southwick et al., 1993; zitiert nach<br />
Wöller, 2006).<br />
Allerdings ist zu beachten, dass Traumatisierungen in der Kindheit lediglich als ein<br />
wichtiger Risikofaktor neben anderen für die Entwicklung von<br />
Persönlichkeitsstörungen anzusehen sind. Die Diathese-Stress-Modelle betonen, dass<br />
hierbei genetische Faktoren, Belastungsfaktoren und protektive Faktoren in<br />
komplexer Interaktion stehen.<br />
8.2 Führen spezifische traumatische Erfahrungen zu spezifischen<br />
Persönlichkeitsstörungen?<br />
Einige Untersuchungen gehen der Frage nach, ob einzelne Persönlichkeitsstörungen<br />
stärker mit Realtraumatisierungen belastet sind als andere (Modestin, Ebner, Junghan<br />
& Erni, 1996; Zanarini & Frankenburg, 1997; zitiert nach Wöller & Kruse, 2003).<br />
Wöller (2006) referiert verschiedene Studien, die die stärksten Zusammenhänge<br />
zwischen Misshandlung in der Kindheit mit der paranoiden, der Borderline-, der<br />
dependenten und der sadistischen Persönlichkeitsstörung finden. Patienten mit der<br />
Diagnose einer Borderline-Persönlichkeitsstörung wiesen in zwei Drittel bis drei<br />
Viertel aller Fälle körperliche oder sexuelle Traumatisierungen auf (Modestin et al.,
II. Literaturübersicht 60<br />
1998; Zanarini et al., 1989, 2002; zitiert nach Wöller, 2006). Zarini et al. (2002;<br />
zitiert nach Wöller, 2006) erhob 290 Patienten mit einer Persönlichkeitsstörung.<br />
Davon gaben 62,4 % in der Vorgeschichte einen sexuellen Missbrauch, 86,2 %<br />
andere Formen der Kindesmisshandlungen und 92,1 % Vernachlässigung in der<br />
Kindheit an. Über 50 % gaben an, dass der sexuelle Missbrauch mit Penetration und<br />
dem Einsatz von Gewalt einherging. Dabei zeigte sich ein signifikanter<br />
Zusammenhang zwischen der Schwere des Missbrauchs mit der Schwere der<br />
Symptome sowie der Einschränkung der psychosozialen Anpassung, unabhängig von<br />
Alter, Geschlecht und Rasse.<br />
Ob es hingegen einen spezifischen Zusammenhang zwischen einer sexuellen<br />
Traumatisierung und der Entwicklung einer Borderline-Persönlichkeitsstörung gibt,<br />
ist noch immer nicht abschließend geklärt (Wöller & Kruse, 2003). Zanarini und<br />
Frankenburg (1997; zitiert nach Wöller, 2006) finden hierfür stützende Beweise in<br />
der Beobachtung, dass die Symptome einer Posttraumatischen Belastungsstörung<br />
überzufällig häufig gemeinsam mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung als mit<br />
einer anderen Persönlichkeitsstörung auftreten. Dagegen spricht die Tatsache, dass<br />
sich Misshandlungen, abrupte Trennungen und Vernachlässigungen zwar in hohem<br />
Maße bei Personen mit der Diagnose einer Borderline-Persönlichkeitsstörung finden,<br />
in gleichem Ausmaß jedoch auch bei verschiedenen anderen<br />
Persönlichkeitsstörungen (Johnson et al., 1999; Laporte & Guttman, 1996; zitiert<br />
nach Wöller, 2006). Eine Metaanalyse über die Literatur zur Beziehung zwischen<br />
sexuellem Kindesmissbrauch und dem Auftreten einer Borderline-<br />
Persönlichkeitsstörung, die 21 Studien aus den Jahren 1980-1985 umfasste, konnte<br />
die Hypothese einer spezifischen Korrelation nicht bestätigen (Fossati, Madeddu &<br />
Maffei, 1999; zitiert nach Wöller, 2006). Für einen solchen Zusammenhang sprechen<br />
hingegen die Ergebnisse von Yen, Shea, Battle, Johnson, Zlotnick, Dolan-Sewell,<br />
Skodol, Grilo, Gunderson, Sanislow, Zanarini, Bender, Rettew und McGlashan<br />
(2003, zitiert nach Wöller, 2006).<br />
Ebenso spielen bei den meisten anderen spezifischen Persönlichkeitsstörungen<br />
Traumatisierungen in der Kindheit und Jugend eine bedeutende Rolle, auch wenn,<br />
wie Modestin, Ebner, Junghan und Erni (1996, zitiert nach Wöller, 2006) berichten,<br />
in diesem Zusammenhang die Traumatisierungsraten durch physische oder sexuelle<br />
Gewalt niedriger liegen als bei der Borderline-Persönlichkeitsstörung. Lediglich bei<br />
der narzisstischen Persönlichkeitsstörung ist die empirische Befundlage dünn. Aus
II. Literaturübersicht 61<br />
mehreren kasuistischen Berichten kann jedoch abgeleitet werden, dass weniger die<br />
Erfahrung physischer oder sexueller Gewalt, als vielmehr beziehungstraumatische<br />
Erfahrungen für die Entwicklung dieser Persönlichkeitsstörung bedeutsam sind und<br />
dies besonders, wenn Kinder zur Emotionsregulierung der Eltern instrumentalisiert<br />
werden (Kernberg, 1976, 1988; Kohut, 1976; zitiert nach Wöller, 2006).<br />
Für die Entstehung der DSM-Cluster C-Persönlichkeitsstörungen, insbesondere für<br />
die ängstlich-vermeidende und die anankastische Persönlichkeitsstörung, werden<br />
demgegenüber weniger Realtraumatisierungen als vielmehr überprotektive elterliche<br />
Erziehungsstile als pathogenetisch bedeutsam angeführt (Arbel & Stravynski, 1991;<br />
Langenbach, Hartkamp, Ott, Wöller & Tress, 2001a, 2001b; zitiert nach Wöller,<br />
2006).<br />
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Persönlichkeitsstörungen zu einem<br />
beträchtlichen Teil mit Traumatisierungen im Zusammenhang stehen, dabei darf<br />
jedoch nicht übersehen werden, dass sie aufgrund ihrer multifaktoriellen Genese<br />
ätiologisch keinesfalls auf Realtraumatisierungen zu reduzieren sind. Genetischkonstitutionellen<br />
Faktoren (Paris, 1997; zitiert nach Wöller, 2006) sowie protektive<br />
Faktoren (Egele et al., 2005) sollten dabei nicht außer Acht gelassen werden. Es<br />
besteht ein bedeutsamer Überlappungsbereich zwischen der Diagnosekategorie<br />
„Persönlichkeitsstörungen“ und der auf eine Traumaätiologie hinweisenden<br />
Kategorie „Posttraumatische Belastungsstörung“.
II. Literaturübersicht 62<br />
9. Persönlichkeits- und Substanzstörungen<br />
In der Komorbiditätsforschung haben bislang maßgeblich zwei<br />
Persönlichkeitsstörungen im Zusammenhang mit einer Substanzstörung Beachtung<br />
gefunden: Die Antisoziale und die Borderline-Persönlichkeitsstörung.<br />
Es werden vier Ätiologiemodelle vorgeschlagen (van den Brink, 1995; zitiert nach<br />
Moggi, 2002):<br />
1. Modell der primären Persönlichkeitsstörungen und sekundären<br />
Substanzstörung,<br />
2. Modell der primären Substanzstörung und sekundären<br />
Persönlichkeitsstörung,<br />
3. Bidirektionale Modelle und<br />
4. Modelle des gemeinsamen Faktors bzw. einer Störung.<br />
Im Folgenden werden diese beiden zur Zeit am besten empirisch fundierten Modelle<br />
zur Ätiologie der Komorbidität von Antisozialer- bzw. Borderline-<br />
Persönlichkeitsstörung und Substanzmissbrauch bzw. -abhängigkeit vorgestellt.<br />
9.1 Die Antisoziale Persönlichkeitsstörung und Substanzstörung<br />
Nach einem kurzen Überblick zur Komorbidität von Antisozialer<br />
Persönlichkeitsstörung und Substanzabhängigkeit wird das Ätiologiemodell von<br />
Iacono, Carlson, Taylor, Elkins und McGue (1999) dargestellt.<br />
9.1.1 Epidemiologie Antisoziale Persönlichkeitsstörung und Substanzstörung<br />
Lieb und Isensee (2002) berichten von einem rund sechsfach erhöhten Risiko einer<br />
Komorbidität von Antisozialer Persönlichkeitsstörung bei Personen mit einer<br />
Lebenszeitdiagnose von Alkoholabhängigkeit (Prävalenzrate: 21,3 %) und von einem<br />
vierzehnfach erhöhtem Risiko bei Drogenabhängigkeit (Prävalenzrate: 30,3 %).<br />
Klinische Studien weisen Prävalenzraten von 1- 62 % (Median:22 %) auf, wobei die<br />
große Streubreite durch Setting (z.B. stationäre vs. ambulante Einrichtungen) und<br />
methodische (z.B. Fragebogen vs. Interview) Variablen zu erklären sind. In einer<br />
klinischen Stichprobe von 425 Patienten, die wegen Drogenabhängigkeit mit<br />
Komorbidität in Behandlung waren, fanden Compton, Cottler, Phelps, Abdallah und
II. Literaturübersicht 63<br />
Spitznagel (2000; zitiert nach Moggi, 2002), dass in 91 % der Fälle eine Antisoziale<br />
Persönlichkeitsstörung der Drogenabhängigkeit vorausgegangen war.<br />
9.1.2 Ätiologie Antisoziale Persönlichkeitsstörung und Substanzstörung<br />
Iacono et al. (1999; zitiert nach Moggi, 2002) gehen auf der Grundlage der<br />
empirischen Ergebnisse davon aus, dass ein Zusammentreffen von Antisozialer<br />
Persönlichkeitsstörung und Substanzstörung keine Komorbidität, sondern ein Subtyp<br />
der Substanzstörung ist. Das Ausbilden der Symptome (antisoziale<br />
Verhaltensweisen) wird mit einer genetischen Prädisposition zur<br />
Verhaltensenthemmung erklärt, die zu Verhaltensstörungen in der Kindheit und<br />
später zu antisozialem Verhalten und Substanzstörungen in der Adoleszenz bzw.<br />
Antisozialer Persönlichkeitsstörung im Erwachsenenalter führt.<br />
Bernstein et al. (1998; zitiert nach Moggi, 2002) berichten aufgrund von<br />
Forschungen zu erlebter Kindesmisshandlung und Antisozialer<br />
Persönlichkeitsstörung bei suchtmittelabhängigen Patienten eine signifikante<br />
Beziehung zwischen physischer Kindesmisshandlung und Antisozialer<br />
Persönlichkeitsstörung. Es konnte gezeigt werden, dass Kinder (v.a. Söhne) von<br />
ihren Vätern mit Antisozialer Persönlichkeitsstörung und Substanzstörung häufiger<br />
geschlagen werden und in der Folge Verhaltensstörungen entwickeln. Zudem<br />
fungiert der Vater auch als Lernmodell seines Kindes, das das Verhalten nachahmen<br />
wird. Das Zusammenspiel biologischer und psychologischer Faktoren kann das<br />
Ätiologiemodell zur Komorbidität von Antisozialer Persönlichkeitsstörung und<br />
Substanzstörung ergänzen (Moggi, 2002).
II. Literaturübersicht 64<br />
9.2 Die Borderline-Persönlichkeitsstörung und Substanzabhängigkeit<br />
9.2.1 Epidemiologie Borderline-Persönlichkeitsstörung und Substanzabhängigkeit<br />
In klinischen Studien findet man Prävalenzraten von 2-66 %, wobei die Merkmale<br />
des Settings (z.B. stationäre vs. ambulante Einrichtungen) und die Art des<br />
Suchtmittels (niedrigere Raten bei Substanzstörungen von Opiaten) die große<br />
Varianz der Prävalenz zumindest ansatzweise erklären (Verheul, van den Brink &<br />
Hartgers, 1995; zitiert nach Moggi, 2002). In Metaanalysen klinischer Studien<br />
fanden Trull, Sher, Minks-Brown, Durbin und Burr (2000; zitiert nach Moggi, 2002)<br />
bei Personen mit Borderline-Persönlichkeitsstörung und Alkoholstörungen eine<br />
Prävalenz von 48,8 % und bei Personen mit Borderline-Persönlichkeitsstörung und<br />
Drogenstörungen eine Prävalenzrate von 38 %. Umgekehrt konnte eine Komorbidität<br />
von Borderline-Persönlichkeitsstörung bei 14,3 % der Personen mit<br />
Alkoholstörungen, bei 16,8 % mit Kokainstörungen und bei 18,5 % mit<br />
Opiatstörungen gefunden werden (Trull et al., 2000; zitiert nach Moggi, 2002). Dabei<br />
gibt Moggi (2002) zu bedenken, dass dieser starke Zusammenhang von Borderline-<br />
Persönlichkeitsstörung und Substanzstörung auch artifiziell sein könnte, da die<br />
Substanzstörung eine Möglichkeit von Impulsivität, einem Kriterium der Borderline-<br />
Persönlichkeitsstörung ist. Jedoch bleibt nach Dulit, Fyer, Haas, Sullivan und<br />
Frances, (1990; zitiert nach Moggi, 2002) die Prävalenz auch erhöht, wenn die<br />
Substanzstörung als Kriterium nicht berücksichtigt wird oder wenn Personen mit<br />
aktiver Substanzstörung ausgeschlossen werden (Verheul et al., 1995; zitiert nach<br />
Moggi, 2002).<br />
9.2.2 Ätiologie von Borderline-Persönlichkeitsstörung und Substanzstörung<br />
In Familienstudien findet man bei Probanden mit einer Borderline-<br />
Persönlichkeitsstörung eine Häufung von Verwandten ersten Grades mit einer<br />
ebensolchen Störung, Depression und Substanzstörung. Trull et al. (2000; zitiert nach<br />
Moggi, 2002) schlagen daraufhin ein Ätiologiemodell vor, dessen Kernelemente in<br />
der Entwicklung dieser Komorbiditätsform im Sinne eines gemeinsamen Faktoren-<br />
Modells die beiden Persönlichkeitsmerkmale Impulsivität und emotionale Instabilität<br />
sind. Sher, Bartholow und Wood (2000; zitiert nach Moggi, 2002) zeigen, dass<br />
erhöhte Werte auf zwei Skalen zur Impulsivität zu Beginn der Untersuchung sieben<br />
Jahre später die Diagnose einer Substanzstörung vorhersagen lassen. Darüber hinaus
II. Literaturübersicht 65<br />
fanden sie signifikante Zusammenhänge zwischen dem Ausmaß an Impulsivität und<br />
negativer Emotionalität mit der Diagnose einer Substanzstörung. Bei hohen Werten<br />
wurde leider die Kontrolle einer Borderline-Persönlichkeitsstörung außer Acht<br />
gelassen.<br />
Im Vergleich zu Patienten ohne Borderline-Persönlichkeitsstörung mit<br />
Substanzstörung fand man bei klinischen Stichproben wiederholt eine erhöhte<br />
Impulsivität bei Patienten mit Borderline-Persönlichkeitsstörung und<br />
Substanzabhängigkeit (Kruedelbach, McCormick, Schulz & Gruenreich, 1993;<br />
Morgenstern, Langenbucher, Labouvie & Miller, 1997; zitiert nach Moggi, 2002).<br />
Nach Kruedelbach et al. (1993, zitiertnachMoggi, 2002) führt emotionale Instabilität<br />
häufig und rasch zu unvorhergesehenen negativen Gefühlszuständen, auf die die<br />
Patienten mit Borderline-Persönlichkeitsstörungen und Substanzstörungen deutlich<br />
stärker mit Verlangen nach Suchtmittel reagieren als Suchtpatienten ohne<br />
Borderline- Persönlichkeitsstörung. Nach Cooper, Frone, Russel und Mudar (1995;<br />
zitiert nach Moggi, 2002) korreliert emotionale Instabilität mit dem Trinkmotiv<br />
„Steigerung positiver Emotionen“ und emotionale Instabilität mit<br />
„Belastungsreduktion“.<br />
Somit kann gesagt werden, dass die bisher erwähnten Ergebnisse nicht nur das<br />
Modell der gemeinsamen Faktoren unterstützen, sondern auch das Modell der<br />
sekundären Substanzstörung.<br />
Links, Heslegrave, Mitton, Van Reekum und Patrick (1995; zitiert nach Moggi,<br />
2002) berichten dagegen in ihrer Katamnesestudie über sieben Jahre, dass die<br />
Schwere der Borderlinesymptomatik zu Beginn der Studie das Ausmaß des<br />
nachfolgenden Alkoholkonsums nicht vorhersagen sondern vielmehr hinge u.a. das<br />
Ausmaß einer Substanzstörung während des Katamnesezeitraums mit dem<br />
Persistieren einer bereits bestehenden Borderline-Persönlichkeitsstörung zusammen.<br />
Patienten, die nach sieben Jahren die Kriterien einer Borderline-<br />
Persönlichkeitsstörung nicht mehr erfüllten, wiesen in diesem Zeitraum deutlich<br />
weniger Trinkepisoden auf. Hinzu kommt, dass Moak und Anton (1999; zitiert nach<br />
Moggi, 2002) Impulsivität und emotionale Unausgeglichenheit als typische<br />
Merkmale von Patienten mit anhaltender Alkoholabhängigkeit beschreiben und die<br />
Abgrenzung zur Persönlichkeitsstörung schwierig werden kann. Diese Befunde<br />
lassen auf einen bidirektionalen Zusammenhang zwischen Borderline-
II. Literaturübersicht 66<br />
Persönlichkeitsstörung und Substanzstörung schließen, wenn sich diese Form der<br />
Komorbidität bereits entwickelt hat.<br />
Beide Persönlichkeitsmerkmale scheinen ihrerseits kausal direkt durch eine<br />
neurobiologische Vulnerabilität (v.a Störungen des serotonergen Systems) und<br />
bidirektional durch dysfunktionale Familiensysteme (z.B. chronische<br />
Familienkonflikte, unwirksame Erziehungsmethoden) und/oder durch in der Kindheit<br />
erlebte Traumata (z.B. Kindesmisshandlung) bedingt zu sein (Trull et al., 2000;<br />
zitiert nach Moggi, 2002). In klinischen Stichgruppen finden sich vermehrt<br />
Kindesmisshandlungen – insbesondere sexuelle Misshandlung, bei erwachsenen<br />
Patienten mit Borderline-Persönlichkeitsstörungen – kausale Zusammenhänge<br />
werden diskutiert (Paris, 1997; Sabo, 1997, zitiert nach Moggi, 2002). Bernstein,<br />
Stein und Handelsman (1998; zitiert nach Moggi, 2002) konnten allerdings in einer<br />
retrospektiven Untersuchung mit 378 Suchtpatienten pfadanalytisch lediglich eine<br />
signifikante Beziehung zwischen psychischer Kindesmisshandlung und Borderline-<br />
Persönlichkeitsstörung, nicht aber zwischen sexuellen oder anderen Formen der<br />
Kindesmisshandlung und Borderline-Persönlichkeitsstörung nachweisen. Perry und<br />
Hermann (1993; zitiert nach Moggi, 2006) verstehen die Entwicklung einer<br />
Borderline-Persönlichkeitsstörung auch als Anpassungsform an ein dysfunktionales<br />
Familiensystem, das gekennzeichnet ist durch Angst, Vertrauensbruch und<br />
unzuverlässige Betreuungspersonen.<br />
Der Modellvorschlag von Trull und Mitarbeitern (2000; zitiert nach Moggi, 2002) ist<br />
deshalb vielversprechend, da er Ergebnisse aus verschiedenen Forschungsrichtungen<br />
zusammenbringt. Genetische Prädispositionen (neurobiologische Vulnerabilität) und<br />
die Umweltfaktoren (Trauma, Familienprobleme) erhöhen dabei die<br />
Wahrscheinlichkeit von Impulsivität und emotionaler Instabilität, die als gemeinsame<br />
Faktoren eine Borderline-Persönlichkeitsstörung und eine Substanzstörung<br />
begünstigen können. Ist daraufhin diese Form der Komorbidität entwickelt, halten<br />
sich beide Störungen im Circulus Virtiosus gegenseitig aufrecht (vgl. Abbildung 3).
II. Literaturübersicht 67<br />
Genetische Faktoren<br />
(neurobiologische Vulnerabilität)<br />
Borderline Persönlichkeitsstörung<br />
Umweltfaktoren (z.B. Trauma<br />
Impulsivität<br />
und<br />
emotionale Instabilität<br />
Substanzstörung<br />
Abbildung 3: Komorbiditätsmodell von Borderline-Persönlichkeits- und Substanzstörungen<br />
(Trull et al., 2000)
II. Literaturübersicht 68<br />
10. Posttraumatische Belastungs- und Substanzstörungen<br />
Im Folgenden werden zunächst Ergebnisse neuerer Untersuchungen zu belastenden<br />
Faktoren in der Kindheit und späterer Suchtentwicklung dargestellt. Sodann wird in<br />
diesem Zusammenhang auf die Epidemiologie der Posttraumatischen<br />
Belastungsstörung und Substanzstörung eingegangen und drei aktuelle<br />
Ätiologiemodelle vorgestellt.<br />
10.1 Epidemiologie PTBS und Substanzstörung<br />
In angloamerikanischen Studien fand sich bei Personen in Suchtbehandlung eine<br />
Lebenszeitprävalenz der Posttraumatischen Belastungsstörung von bis zu 50 %. Der<br />
überwiegende Teil erfüllte auch die Kriterien einer akuten Posttraumatischen<br />
Belastungsstörung (Triffleman et al., 1995; Stewart et al., 1998; Najavits et al., 1998;<br />
zitiert nach Schäfer & Krausz, 2006). Im deutschsprachigen Raum kommen Teegen<br />
und Zumbeck (2000) bei einer klinischen Gruppe Drogenabhängiger auf eine<br />
Posttraumatische Belastungsstörungs-Rate von 26 %. Kutscher und Hayatghebi<br />
(2002) verzeichnen bei Patientinnen und Patienten im Alkoholentzug bei 8 % der<br />
männlichen und 22 % der weiblichen Klienten die Diagnose einer akuten<br />
Posttraumatischen Belastungsstörung.<br />
10.2 Belastende Faktoren in der Kindheit und spätere Suchterkrankungen<br />
Duncan, Saunders, Kilpatrik, Hanson und Resnick (1996; zitiert nach Schäfer &<br />
Krausz, 2006) fanden in einer repräsentativen Stichprobe, bestehend aus 4008 Frauen<br />
aus der Allgemeinbevölkerung, dass körperliche Misshandlung im Kindesalter mit<br />
erhöhten Raten von späterem Substanzmissbrauch einherging. In der Gruppe, die<br />
Misshandlungen erfahren hatten, zeigten 18 % einen aktuellen<br />
Medikamentenmissbrauch gegenüber 5 % der Kontrollgruppe. Auch Drogenkonsum<br />
und Anzeichen von Alkoholmissbrauch waren signifikant erhöht. Zudem waren sie<br />
beim Erstkonsum von Alkohol signifikant jünger und befanden sich häufiger wegen<br />
Substanzmissbrauch in Behandlung.<br />
In einer neueren Übersichtsarbeit bearbeiteten Simpson und Miller (2002)<br />
Untersuchungen, die kindlichen sexuellen Missbrauch und Misshandlung bei
II. Literaturübersicht 69<br />
klinischen Stichproben von Suchtpatienten erhoben. In 47 Studien zu kindlich<br />
sexuellem Missbrauch bei Patientinnen zeigte sich eine durchschnittliche<br />
Prävalenzrate von 45 %. Bei männlichen Patienten konnte in 20 Studien eine<br />
durchschnittliche Rate kindlichen sexuellen Missbrauchs von 16 % erhoben werden.<br />
Zu körperlicher Misshandlung im Kindesalter gingen in diese Metaanalyse 19<br />
Studien an weiblichen und 12 Studien an männlichen Patienten ein. Durchschnittlich<br />
39 % der weiblichen und 31 % der männlichen Patienten berichteten dabei von<br />
solchen Ereignissen.<br />
In Untersuchungen aus dem deutschsprachigen Raum berichteten bei Schmidt (2000)<br />
in einer Untersuchung an 215 substituierten Opiatabhängigen 60 % der Frauen und<br />
25 % der Männer signifikant schwerere, häufigere und frühere<br />
Missbrauchserlebnisse als die (studentische) Kontrollgruppe (11 % bzw. 6 %).<br />
Schäfer, Schnack und Soyka (2000) erhoben 100 Patientinnen und Patienten mit<br />
polyvalentem Substanzmissbrauch und sexuelle Missbrauchserlebnisse vor dem 16.<br />
Lebensjahr. Werden nur die Fälle berücksichtigt, bei denen es zu erzwungenem<br />
Geschlechtsverkehr gekommen war, so beträgt die Rate der Betroffenen 50 % der<br />
weiblichen und 40 % der männlichen Patienten.<br />
Untersuchungen konnten zeigen, dass Personen mit substanzbezogenen Störungen<br />
nicht nur hohe Raten von Traumatisierungen in der Kindheit aufweisen können,<br />
sondern dass sie auch in späteren Lebensabschnitten häufiger traumatischen<br />
Erlebnissen ausgesetzt sind (Breslau et al, 1991; Kessler et al, 1995; zitiert nach<br />
Schäfer, 2006).<br />
10.3 Ätiologie Posttraumatischer Belastungs- und Substanzstörung<br />
Im Folgenden werden die gebräuchlichsten Ätiologiemodelle im Zusammenhang von<br />
Posttraumatischer Belastungsstörung und Substanzstörung dargestellt.<br />
10.3.1 Die Selbstmedikationshypothese<br />
Die meisten Autoren ziehen zur Erklärung der Komorbidität von Posttraumatischer<br />
Belastungsstörung und Substanzabhängigkeit die fehlgeleitete<br />
Selbstmedikationshypothese von Khantzian (1997) heran (McFarlane, 1998; Stewart,<br />
1996; Stewart et al., 1998; zitiert nach Moggi 2002). Die Posttraumatische<br />
Belastungsstörung geht der Substanzstörung in diesem Erklärungsmodell zumeist
II. Literaturübersicht 70<br />
voraus, so dass die Selbstmedikation im Sinne einer Erleichterung von PTBS-<br />
Symptomen (v.a. erhöhtes Erregungsniveau und Wiedererleben) als initiale<br />
Motivation für den Suchtmittelkonsum oder dessen Steigerung am<br />
wahrscheinlichsten ist. Anhaltender Suchtmittelkonsum kann aber auch zu einer<br />
Verstärkung der PTBS-Symptome beitragen und negative emotionale Zustände<br />
fördern, in dessen Folge erneut (i.S. eines Circulus Virtiosus) vermehrt Suchtmittel<br />
konsumiert werden mit der Gefahr, eine Abhängigkeit auszubilden.<br />
10.3.2 Die Risikohypothese<br />
Die Risikohypothese (Chilcoat & Breslau, 1998) besagt, dass sich Personen mit<br />
Substanzstörungen eher in Situationen begeben, welche die Gefahr einer PTBS<br />
erhöhen.<br />
10.3.3 Die Vulnerabilitätshypothese<br />
Die Vulnerabilitätshypothese (Kushner, Sher & Beitman 1990) besagt, dass die<br />
Substanzabhängigkeit zur Entwicklung einer PTBS beitragen kann, indem der<br />
erhöhte Suchtmittelkonsum das Erregungs- und Angstniveau erhöht, so dass nach<br />
traumatischen Ereignissen oder Belastungen im Zusammenhang mit dem Konsum<br />
eher eine PTBS entwickelt wird. Suchtmittelkonsum kann somit sowohl eine<br />
bestehende PTBS aufrechterhalten oder verschlimmern, indem er die Personen an der<br />
kognitiv-emotionalen Verarbeitung hindert (Herman, 1992; zitiert nach Moggi,<br />
2002) als auch die Intensität der Intrusionen und Flashbacks kurz nach dem Trauma<br />
und vor einer PTBS verringert (McFarlane, 1998; zitiert nach Moggi, 2002).<br />
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass klinische Studien zum zeitlichen Muster<br />
von PTBS und Substanzstörung mehrheitlich davon ausgehen, dass die PTBS<br />
deutlich häufiger der Substanzabhängigkeit vorausgeht als umgekehrt. Die Befunde<br />
stützen stärker die Selbstmedikationshypothese, während die Risiko- und<br />
Vulnerabilitätshypothese weniger empirische Evidenz aufweisen können (Chilcoat &<br />
Breslau, 1998; Lieb & Isensee, 2002; Stewart, 1996; zitiert nach Moggi, 2002).
II. Literaturübersicht 71<br />
11. Resümee der dargelegten Befunde und Ableitung der Hypothesen<br />
Monokausale Zusammenhänge bei der Entwicklung von Suchtverhalten erscheinen<br />
abwegig. Über multikausale Zusammenhänge bei der Ausbildung von Suchtverhalten<br />
ist sich die Forschungsgemeinschaft einig.<br />
In der aktuellen Forschungsliteratur zum Thema wird dabei dem familiären Umfeld<br />
einer Person und den frühkindlichen Erfahrungen eine immense Bedeutung<br />
zugeschrieben. Dies gilt gerade für die Erfahrung mit den primären Bezugspersonen<br />
und den sich daraus bildenden Bindungsstilen, aber auch deren Einfluss auf<br />
Bewältigungskompetenzen und die Entwicklung des Persönlichkeitsstils werden<br />
diskutiert. In epidemiologischen Untersuchungen wird in klinischen Populationen<br />
allgemein ein erhöhtes Aufkommen eines unsicheren Bindungsstils berichtet. In<br />
Bezug auf süchtige Patienten gibt es hierzu noch sehr wenige Daten. Diese Arbeit<br />
kann einen Teil zur Aufklärung beitragen. Eine Bestätigung des allgemeinen Trends<br />
wird erwartet.<br />
In Suchtpopulationen wird allgemein ein gehäuftes Aufkommen der Antisozialen<br />
Persönlichkeitsstörung und der Borderline-Persönlichkeitsstörung berichtet. Ein<br />
Zusammenhang mit ungünstigen sozioökonomischen Faktoren ist wahrscheinlich.<br />
Ebenso zeigen sich positive Korrelationen zwischen problematischen<br />
Persönlichkeitsausprägungen, insbesondere der Borderline-Persönlichkeitsstörung<br />
und der Antisozialen Persönlichkeitsstörung, und traumatischen Erfahrungen sowie<br />
dem Ausbilden von Suchtverhalten. Laut epidemiolgischen Untersuchungen ist die<br />
Wahrscheinlichkeit für Substanzabhängige, an einer Posttraumatischen<br />
Belastungsstörung zu erkranken, erhöht. Es gibt in der Forschungsgemeinschaft<br />
jedoch keinen Konsens über die Wirkrichtung der einzelnen Faktoren (vgl.<br />
Risikohypothese, Selbstmedikationshypothese). Doch scheint es für die<br />
Selbstmedikationshypothese mehr empirische Grundlagen zu geben.<br />
Aufgrund der dargestellten, zum Teil kontroversen Ätiologiemodelle wurden die im<br />
Folgenden aufgelisteten Hypothesen getestet.
II. Literaturübersicht 72<br />
11.1 Auflistung der abgeleiteten Hypothesen<br />
Es wurden an einer Suchtgruppe in (teil-)stationärer Behandlung, die sich in<br />
ausschließlich Alkoholabhängige, Alkoholabhängige mit Beigebrauch und<br />
Polytoxikomane aufschlüsseln lässt, und einer nicht stationär aufgenommenen und<br />
nicht substanzabhängigen Kontrollgruppe folgende Hypothesen geprüft:<br />
1. In der Suchtgruppe finden sich im Vergleich zur Kontrollgruppe extremere<br />
Ausprägungen der Persönlichkeitsstile.<br />
2. Insbesondere beim „abenteuerlichen“ (Antisozialen) und „sprunghaften“<br />
(Borderliner-) Persönlichkeitsstil werden signifikante Unterschiede erwartet.<br />
3. In der Gruppe der Süchtigen befinden sich vermehrt unsicher Gebundene.<br />
4. Insbesondere bei den Menschen mit extremeren Ausprägungen im<br />
Persönlichkeitsprofil werden signifikante Unterschiede erwartet.<br />
5. In der Suchtgruppe gibt es vermehrt Traumaerfahrungen.<br />
6. Es sind spezifische Traumaerfahrungen in der Suchtgruppe erkennbar.<br />
7. In der Suchtgruppe werden höhere Werte von Intrusion, Vermeidung und<br />
Erregung als in der Kontrollgruppe erwartet.
III. Methoden 73<br />
III. METHODEN<br />
12. Rekrutierung der Versuchspersonen und Ablauf der Erhebung<br />
12.1 Rekrutierung der Versuchspersonen<br />
Die vorliegende Untersuchung wurde von Mitte Oktober bis Mitte Dezember 2006<br />
durchgeführt. Die Suchtstichprobe stellt sich zusammen aus männlichen Patienten<br />
der Westfälischen Klinik Münster, Fachklinik für Psychiatrie und Psychotherapie<br />
und des Niedersächsischen Landeskrankenhauses Osnabrück, Fachkrankenhaus für<br />
Psychiatrie und Psychotherapie.<br />
In der Westfälischen Klinik Münster erfolgte die Erhebung auf einer offen geführten<br />
Entzugs- und Motivationsstation für vornehmlich Alkohol-, Medikamenten- und<br />
Amphetaminabhängige, sowie auf einer geschlossen geführten Entzugs- und<br />
Motivationsstation für Abhängige illegaler Drogen. Zudem wurden Daten auf einer<br />
Langzeit-Rehabilitationsstation und in der Tagesklinik Sucht erhoben, die beide ihr<br />
Angebot vornehmlich an Alkohol-, Medikamenten- und Amphetaminabhängige<br />
richten.<br />
Im Niedersächsischen Landeskrankenhaus Osnabrück rekrutierten sich die Patienten<br />
aus zwei geschlossen geführten Entzugs- und Motivationsstationen für Patienten mit<br />
einer Abhängigkeitserkrankung von illegalen Drogen und einer offen geführten<br />
Entzugs- und Motivationsstationen für Patienten jeglicher stoffgebundener<br />
Suchtformen. Zudem wurden Daten in der Tagesklinik Sucht, einer teilstationären<br />
Langzeit-Rehabilitationseinrichtung für Patienten stoffgebundener Abhängigkeitserkrankungen<br />
erhoben.<br />
12.2 Einschlusskriterien<br />
Die Datenerhebung in den (teil-)stationären Einrichtungen richtete sich an<br />
ausschließlich männliche Patienten von mindestens 18 und nicht älter als 60 Jahren,<br />
die aufgrund einer primären Alkoholabhängigkeit und/oder Abhängigkeitserkrankung<br />
von illegalen Drogen (F 1x.2 nach ICD-10) behandelt wurden, zum<br />
Zeitpunkt der Erhebung keine Anzeichen eines akuten Entzuges boten und zum<br />
Erhebungszeitpunkt und in der Vorgeschichte frei von psychotischen Prozessen<br />
waren. Da die Fragebogenbatterie ausschließlich in deutscher Sprache vorlag,<br />
konnten nur solche Patienten teilnehmen, die über ausreichend gute
III. Methoden 74<br />
Sprachkenntnisse verfügten. Um die kognitiven Voraussetzungen für die<br />
Beantwortung der Fragebogenbatterie zu gewähren, mussten die Teilnehmer im<br />
Zahlen-Verbindungstest (ZVT) (Oswald & Roth, 1987; siehe Kap. 13.2) einen IQ-<br />
Wert über 80 erbringen.<br />
Die Teilnehmer der Kontrollgruppe sollten im Alter von 18-60 Jahren sein, im<br />
aktuellen Lebensabschnitt keine illegalen Drogen konsumieren und im CAGE<br />
Fragebogen (siehe Kap. 13.1) nur maximal eine Frage mit „Ja“ beantwortet haben.<br />
12.3 Ablauf der Erhebung<br />
Die Erhebung wurde in der Regel jeweils einmal wöchentlich zu festen Zeiten auf<br />
den einzelnen Stationen in Form einer Fragebogenerhebung durchgeführt und<br />
dauerte ca. eine bis zwei Stunden pro Patient. Im Niedersächsischen<br />
Landeskrankenhaus fanden sich die teilnehmenden Patienten verschiedener Stationen<br />
einmal wöchentlich auf einer Station zusammen, um den Fragebogen auszufüllen. In<br />
der Tagesklinik Sucht fanden lediglich zwei Erhebungen jeweils vormittags statt. Im<br />
Vorfeld wurden die in Frage kommenden Patienten von der Stationspsychologin/dem<br />
Stationspsychologen bzw. -pädagogen oder von dem Autor nach der Bereitschaft zur<br />
Teilnahme gefragt. Die Teilnahme für die Patienten war freiwillig und galt als<br />
Therapiezeit, sie wurden dafür ggf. von der Teilnahme an der Beschäftigungstherapie<br />
entbunden. Die Teilnehmer hatten das Recht, jederzeit die Erhebung abzubrechen.<br />
Die eigentliche Erhebung wurde in der Regel in Gruppen, zumeist bis zu 6 Personen<br />
durchgeführt. Zu Beginn gab der Autor einen groben Überblick über den Ablauf, die<br />
einzelnen Instrumente und kündigte den ZVT-Test an. Es wurde noch einmal<br />
deutlich auf die instruktionsgemäße Beantwortung der Fragen hingewiesen. Die<br />
Patienten verteilten sich dann so im Raum, dass sie ungestört und anonym den<br />
Fragebogen ausfüllen konnten. Während der Erhebung wurde im gleichen Raum der<br />
ZVT-Test als Einzelerhebung durchgeführt. Der Autor war die ganze Zeit anwesend<br />
und konnte ggf. bei auftretenden Fragen Hilfestellungen geben.<br />
Die Fragebögen der Kontrollgruppe wurden über den Bekannten- und<br />
Verwandtenkreis des Autors verteilt, mit der Bitte, diese an Dritte weiterzugeben.<br />
Die Fragebögen wurden zusammen mit einem frankierten und an den Fachbereich<br />
adressierten Rückumschlag ausgegeben, so dass eine völlige Anonymität gesichert
III. Methoden 75<br />
war. In den Fragebogen der Kontrollgruppe wurde neben den soziodemographischen<br />
Daten auch danach gefragt, ob die Person jemals in ihrem Leben illegale Drogen<br />
konsumiert hatte und ob sie im aktuellen Lebensabschnitt konsumiert. Um<br />
missbräuchlichen Alkoholkonsum auszuschließen, wurde zudem der CAGE-<br />
Fragebogen (Mayfield, McLeod & Hall, 1974) vorgelegt. In der Instruktion wurde<br />
um eine vollständige und instruktionsgemäße Beantwortung gebeten und auf die<br />
absolute Anonymität hingewiesen<br />
Alle Analysen wurden mit dem Programmpaket SPSS (Superior Performing<br />
Software Systems) Version 12.0. für Windows © durchgeführt.<br />
12.4 Ausschluss der Versuchspersonen<br />
Ausgeschlossen wurden alle Patienten, die nicht sämtliche Einschlusskriterien<br />
erfüllten, bzw. die Fragebögen, die nicht instruktionsgemäß ausgefüllt wurden.<br />
Insgesamt wurden im o.g. Zeitraum 172 Fragebögen erhoben. Die Suchtgruppe bildet<br />
120 Personen ab. Davon mussten 16 Patienten aufgrund eines zu niedrigen IQ-<br />
Wertes im ZVT ausgeschlossen werden und 14 Patienten, die die Erhebung vorzeitig<br />
abgebrochen haben oder einen unvollständigen Fragebogen abgegeben haben.<br />
Letztendlich sind 90 Fragebögen der Suchtgruppe in die Untersuchung eingegangen.<br />
Die Kontrollgruppe setzt sich aus 52 Fragebögen/Personen zusammen. Der Rücklauf<br />
von Fragebögen betrug bei 75 ausgegeben 69 %. Hiervon musste ein Fragebogen<br />
ausgeschlossen werden, der von einer Frau ausgefüllt wurde, einer aufgrund<br />
gelegentlichen Drogenkonsums und vier die im CAGE-Fragebogen eine<br />
Wahrscheinlichkeit eines missbräuchlichen Konsums von 68 % erzielten. Eine<br />
Person/ein Fragebogen wurde ausgeschlossen, der eine Wahrscheinlichkeit im<br />
CAGE-Test von 97 % erzielte. Es sind schließlich 45 Fragebögen der Kontrollgruppe<br />
in die Untersuchung einflossen. Das Gesamt-N der Untersuchung beträgt somit 135<br />
Personen.<br />
12.5 Soziodemographische Daten<br />
Die jüngste Person aus der Gesamtsuchtgruppe war zum Zeitpunkt der<br />
Datenerhebung 19 Jahre, der älteste Teilnehmer 60 Jahre alt. Die Teilnehmer der<br />
Kontrollgruppe waren zwischen 18 und 57 Jahren alt. Das Durchschnittsalter der
III. Methoden 76<br />
Suchtgruppe wie auch der Kontrollgruppe beträgt ungefähr 37 Jahre. Zwar<br />
unterscheiden sich die einzelnen Teilstichproben der Suchtgruppe im<br />
durchschnittlichen Alter, jedoch unterscheiden sich die Suchtgruppen<br />
zusammengefasst nicht in der Variable „Alter“ mit der Kontrollgruppe (t (133) = -.194,<br />
p n.s.) Weitere soziodemographische Merkmale können Tabelle 2 entnommen<br />
werden, bei deren Betrachtung auffällt, dass auf die Gesamtsuchtgruppe bezogen<br />
55,6 % der Befragten einen Hauptschulabschluss oder keinen Schulabschluss<br />
aufweisen und nur 17,8 % das Fachabitur oder höheren Bildungsabschluss.<br />
Demgegenüber verhält es sich in der Kontrollgruppe umgekehrt. Hier finden sich<br />
24,4 % mit einem Hauptschulabschluss und 49 % mit einem Fachabitur oder<br />
höherem Bildungsabschluss.<br />
Bei der Betrachtung der Variable „Berufstätigkeit“ fällt auf, dass in der Suchtgruppe<br />
46,1 % erwerbslos sind und 43,8 % in Arbeit. 4,5 % gaben an, Rentner oder<br />
Pensionär zu sein, 5,6 % gaben „sonstiges“ an. In der Kontrollgruppe ist eine Person<br />
erwerbslos (2,2 %) und 95,6 % sind in Arbeit. Eine Person (2,2 %) gab „sonstiges“<br />
an.<br />
Aus der Kontrollgruppe gaben neun Personen (20 %) an, schon einmal illegale<br />
Drogen konsumiert zu haben.<br />
Lediglich bei der Gruppe der stationär aufgenommenen Suchtpatienten wurde der<br />
ZVT erhoben. Das zulässige Minimum wurde bei einem Intelligenzquotienten von<br />
80 festgelegt. Der geringste in die Untersuchung eingeflossene Wert beträgt 82, der<br />
höchste 130. Der durchschnittliche Intelligenzquotient liegt für alle Untergruppen bei<br />
nahezu 97. Für die Gesamtgruppe beträgt der durchschnittliche Intelligenzquotient<br />
97,56 und liegt damit in etwa im Bereich des allgemein üblichen Mittelwertes.
III. Methoden 77<br />
Tabelle 2: Soziodemographische Daten der Stichprobe<br />
Alkohol<br />
n = 40<br />
Alter in Jahren, M (SD) 45,58<br />
(7,045)<br />
Nationalität, n<br />
deutsch<br />
39 (97,5%)<br />
Staaten der ehem. UdSSR<br />
polnisch<br />
1 (2,5%)<br />
andere<br />
Aufgewachsen in, n<br />
Deutschland<br />
Gebiet der ehem. UdSSR<br />
Polen<br />
Andere Staaten<br />
Familienstand, n<br />
ledig<br />
verheiratet<br />
eheähnl. Gemeinschaft<br />
geschieden<br />
verwitwet<br />
Zurzeit in fester Partnerschaft<br />
ja<br />
nein<br />
Höchster Schulabschluss, n<br />
ohne Abschluss<br />
Volks-/Hauptschule<br />
Realschulabschluss<br />
Fachabitur<br />
Abitur<br />
Hochschulabschluss<br />
Beruf, n<br />
in Ausbildung<br />
im Studium<br />
handwerklicher Beruf<br />
kaufmännischer Beruf<br />
sozialer Beruf<br />
Angestellter<br />
Beamter<br />
selbständig<br />
arbeitslos<br />
Rentner/Pensionär<br />
Sonstiges<br />
37 (92,5%)<br />
2 (5,0%)<br />
1 (2,5%)<br />
15 (37,5%)<br />
8 (20,0%)<br />
1 (2,5%)<br />
16 (40,0%)<br />
20 (50%)<br />
20 (50%)<br />
22 (55%)<br />
8 (20%)<br />
5 (12,5%)<br />
5 (12,5%)<br />
10 (25,6%)<br />
3 (7,7%)<br />
2 (5,1%)<br />
1 (2,6%)<br />
1 (2,6%)<br />
16 (41,0%)<br />
4 (10,3%)<br />
1 (2,2%)<br />
Alk mit<br />
Beigebrauch<br />
n = 10<br />
31,06<br />
(9,891)<br />
Polytoxikomane<br />
n = 40<br />
30,73<br />
(5,639)<br />
10 (100%) 35 (87,5%)<br />
1 (2,5%)<br />
4 (10%)<br />
10 (100%) 33 (82,5%)<br />
4 (10,0%)<br />
3 (7,5%)<br />
10 (100%) 32 (80,0%)<br />
5 (12,5%)<br />
2 (5,0%)<br />
1 (2,5%)<br />
2 (20%)<br />
8 (80%)<br />
3 (30%)<br />
3 (30%)<br />
3 (30%)<br />
1 (10%)<br />
2 (20,0%)<br />
1 (10,0%)<br />
1 (10,0%)<br />
5 (50,0%)<br />
1 (10,0%)<br />
21 (52,5%)<br />
19 (47,5%)<br />
3 (7,5%)<br />
19 (47,5%)<br />
13 (32,5%)<br />
2 (5,0%)<br />
2 (5,0%)<br />
1 (2,5%)<br />
17 (42,5%)<br />
1 (2,5%)<br />
20 (50,0%)<br />
2 (5,0%)<br />
KG<br />
n = 45<br />
37,07<br />
(10,186)<br />
Sucht<br />
gesamt<br />
n = 90<br />
37,42<br />
(9,971)<br />
45 (100%) 84 (93,3%)<br />
1 (1,1%)<br />
1 (1,1%)<br />
4 (3,0%)<br />
45 (100%) 80 (88,9%)<br />
4 (4,4%)<br />
2 (2,2%)<br />
4 (4,4%)<br />
15 (33,3%)<br />
24 (53,3%)<br />
5 (11,1%)<br />
1 (2,2%)<br />
38 (84,4%)<br />
7 (15,6%)<br />
11 (24,4%)<br />
12 (26,7%)<br />
7 (15,6%)<br />
7 (15,6%)<br />
8 (17,8%)<br />
2 (4,4%)<br />
6 (13,3%)<br />
9 (20,0%)<br />
10 (22,2%)<br />
3 (6,7%)<br />
10 (22,2%)<br />
1 (2,2%)<br />
2 (4,4%)<br />
1 (2,2%)<br />
1 (2,2%)<br />
57 (63,3%)<br />
13 (14,4%)<br />
3 (3,3%)<br />
18 (13,3%)<br />
43 (47,8%)<br />
47 (52,2%)<br />
6 (6,7%)<br />
44 (48,9%)<br />
24 (26,7%)<br />
2 (2,2%)<br />
7 (7,8%)<br />
7 (7,8%)<br />
29 (32,6%)<br />
4 (4,5%)<br />
3 (3,4%)<br />
1 (1,1%)<br />
2 (2,2%)<br />
41 (46,1%)<br />
4 (4,5%)<br />
5 (5,6%)
III. Methoden 78<br />
13. Die eingesetzten Erhebungsinstrumente<br />
Die in dieser Erhebung verwandten Instrumente wurden in Absprache mit Prof. Dr.<br />
Schöttke ausgewählt, um Persönlichkeitsstile (Fragebogen zum<br />
Persönlichkeitsportrait), Bindungsstile (Beziehungsspezifische Bindungsskalen für<br />
Erwachsene) und die Erfüllung der Kriterien einer Posttraumatischen<br />
Belastungsstörung nach DSM-IV erheben zu können (Posttraumatische Diagnoseskala).<br />
Darüber hinaus wurde noch der 12 Items umfassende „Fragebogen zum<br />
Persönlichkeitsportrait – Screening“ vorgelegt, der aber in dieser Arbeit keine<br />
weitere Berücksichtigung fand.<br />
Die kognitive Verarbeitungskapazität in der klinischen Stichprobe wurde anhand des<br />
Zahlen-Verbindungs-Tests ermittelt. Demographische Variablen wurden anhand<br />
eines selbst erstellten Fragebogens aufgenommen (siehe Anhang A und B).<br />
13.1 Der CAGE-Fragebogen<br />
Der CAGE-Fragebogen wurde Ende der 1960er Jahre von J. A. Ewing und B.A.<br />
Rouse entwickelt. Anhand vier kurzer Fragen (siehe Anhang A) wird die prozentuale<br />
Wahrscheinlichkeit für das Vorliegen eines missbräuchlichen Alkoholkonsums<br />
eingeschätzt. Nach John A. Ewing (1984) liegt die Wahrscheinlichkeit zum<br />
Vorliegen eines missbräuchlichen Konsums bei:<br />
- einer positiven Antwort bei 32 %<br />
- zwei positiven Antworten bei 59 %<br />
- drei positiven Antworten bei 81 %<br />
- vier positiven Antworten bei 97 %.<br />
Das Instrument hat breite Verwendung gefunden und gilt bei guter sensorischer und<br />
spezifischer Validität als zeitlich sehr ökonomisches Screening-Instrument für das<br />
Vorliegen eines missbräuchlichen Alkoholkonsums.<br />
13.2 Der Zahlen-Verbindungs-Test<br />
Der Zahlen-Verbindungs-Test (ZVT) wurde 1978 von Oswald und Roth in<br />
Anlehnung an den Trail-Making-Test (Reitan, 1956; zitiert nach Brähler, Holling,<br />
Leutner & Petermann, 2002) als einen Test zur Erfassung der kognitiven Leistungsund<br />
Verarbeitungsgeschwindigkeit entwickelt. Als spezifische Intelligenzdimension
III. Methoden 79<br />
soll mit dem ZVT die basale kognitive Verarbeitungsgeschwindigkeit erfasst werden.<br />
Es handelt sich hierbei um einen in der Testdurchführung zeitlich sehr ökonomischen<br />
und sprach- und milieuunabhängigen Intelligenztest in Form eines Speedtests. Die<br />
Bearbeitungszeit beträgt 5 bis 10 Minuten.<br />
Zur Anwendung kam die zweite überarbeitete und erweiterte Auflage von 1987.<br />
Es liegen Normstichproben für Personen zwischen 8 bis 16 Jahren als Gruppentest<br />
und 8 bis 60 Jahren als Einzeltest vor.<br />
Der ZVT besteht aus zwei Übungsmatrizen und vier unterschiedliche Testmatrizen,<br />
auf denen jeweils die Zahlenfelder mit Ziffern von 1 bis 90 in unterschiedlicher und<br />
ungeordneter Reihenfolge abgedruckt sind. Aufgabe der Probanden ist es, die Zahlen<br />
mit Hilfe eines Bleistiftes chronologisch durch eine geraden Linie so schnell wie<br />
möglich zu verbinden. Die Bearbeitungszeit der vier Matrizen wird einzeln in<br />
Sekunden gemessen.<br />
Die Objektivität im Hinblick auf Durchführung, Auswertung und Interpretation ist<br />
aufgrund vollständiger Standardisierung durch die Handanweisung gegeben.<br />
Der Test weist für die Erwachsenenstichprobe gute Reliabilitäten von r = .84 bis r =<br />
.90 auf. Die Konsistenzprüfung ergab Werte zwischen r = .89 bis r = .94.<br />
Die Validität wurde anhand korrelativer Untersuchungen mit verschiedenen anderen<br />
Intelligenztests überprüft (PSB, IST, HAWIE, RAVEN, etc.). Für verschiedene<br />
Stichproben ergaben sich insgesamt Korrelationen zwischen r = -.69 und r = -.80<br />
zum PSB und IST. Vernon (1993; zitiert nach Brähler et al., 2002) ermittelte einen<br />
Zusammenhang der ZVT-Leistung mit allgemeiner Intelligenz in Höhe von r = -.71<br />
(wobei negative Vorzeichen hier eine unterdurchschnittliche (schnelle)<br />
Bearbeitungszeit mit überdurchschnittlich (guten) Ergebnissen in anderen Tests<br />
bedeuten).<br />
13.3 Demographische Variablen<br />
Im Kapitel 12.5 sind sämtliche demographische Angaben der<br />
Untersuchungsteilnehmer aufgeführt, die anhand eines selbst erstellten Fragebogens<br />
(siehe Anhang A und B) erhoben wurden.
III. Methoden 80<br />
13.4 Der Fragebogen zum Persönlichkeits-Selbstportrait<br />
Der Fragebogen zum Persönlichkeitsportrait von Oldham und Morris (1988) ist von<br />
dem 1987 von der APA veröffentlichten Klassifikationssystem für<br />
Persönlichkeitsstörungen, dem Diagnostic and Statistical Manual of Mental<br />
Disorders (DSM III-R), abgeleitet. Dabei sind die 13 Persönlichkeitsstile die<br />
normalen, nicht pathologischen Versionen der 10 im DSM-III-R identifizierten<br />
extremen, gestörten Konstellationen, plus drei weitere zur Aufnahme<br />
vorgeschlagener (ins DSM-IV aber nicht aufgenommene) Persönlichkeitsstile (die<br />
passiv-agressive, die selbstschädigende und die sadistische Form), wobei auf die<br />
Erhebung der Skala „Sadistisch“ aufgrund von Testkonstruktionsmerkmalen in<br />
dieser Untersuchung verzichtet wurde. Persönlichkeitsstörungen fassen die Autoren<br />
als „extreme Ausprägungen normaler menschlicher Muster“ (Oldham & Morris,<br />
1992b, S. 20) auf. Die Unterschiede zwischen Stil und Störung sind graduell zu<br />
sehen und haben mit einem unterschiedlichen Ausmaß an Flexibilität, Vielfalt und<br />
Anpassungsfähigkeit vs. Unfähigkeit zur Stressbewältigung zu tun.<br />
Stil<br />
Gewissenhaft<br />
Selbstbewusst<br />
Dramatisch<br />
Wachsam<br />
Sprunghaft<br />
Anhänglich<br />
Ungesellig<br />
Lässig<br />
Sensibel<br />
Exzentrisch<br />
Abenteuerlich<br />
Aufopfernd<br />
Aggressiv<br />
Störung<br />
Zwanghaft<br />
Narzisstisch<br />
Histrionisch<br />
Paranoid<br />
Borderline<br />
Dependent<br />
Schizoid<br />
Passiv - aggressiv<br />
Selbstunsicher<br />
Schizotypisch<br />
Antisozial<br />
Selbstschädigend<br />
Sadistisch<br />
Abbildung 4: Das Kontinuum vom Persönlichkeitsstil<br />
zur Persönlichkeitsstörung (Oldham & Morris, 1992)
III. Methoden 81<br />
Die Beantwortung des Selbstbeschreibungsfragebogens, der in der hier verwendeten<br />
revidierten Form 82 von ursprünglich 104 Items umfasst, erfolgt auf einer<br />
dreistufigen Skala („Ja“, „Vielleicht“, „Nein“). Dabei soll dieser Test das jeweilige<br />
Persönlichkeitsprofil bestimmen, welches nach Auffassung der Autoren großen<br />
Einfluss auf sechs Schlüsselbereiche unseres Lebens hat, die sie unterteilen in:<br />
Arbeit, Selbst, Gefühle, Beziehungen, Selbstbeherrschung und reale Welt.<br />
In der Kombination aller dreizehn Stile liegt der individuelle Persönlichkeitsstil. Das<br />
Ziel dieses Tests besteht nach den Autoren darin, die Komponenten des<br />
Persönlichkeitsstils zu erkennen und nicht darin, eine Diagnose bzgl. einer<br />
Persönlichkeitsstörung zu stellen.<br />
Die Durchführungs- und Auswertungsobjektivität ist durch die detaillierte Anleitung<br />
zur Bearbeitung des Fragebogens gegeben. Es liegen jedoch keine offiziellen<br />
Reliabilitäts- und Normierungswerte vor. Die Daten der unveröffentlichten<br />
<strong>Diplomarbeit</strong>en von Glaesner (2005) und Nagel (2005) lassen aber bei eher mäßigen<br />
internen Konsistenzen der Skala auf sehr gute Test-Retest-Reliabilitäten schließen.<br />
Die inhaltliche Validität kann aufgrund der Verankerung mit dem<br />
Persönlichkeitskonzept des DSM-III-R als gegeben angesehen werden.<br />
Schöttke (2007; mündliche Mitteilung) entwickelte in einem laufenden<br />
Forschungsprojekt zu 10 der 13 Persönlichkeitsstile, die im FPP gemessen werden,<br />
Cut-off-Werte, die jeweils den Übergang vom Stil zur Störung markieren könnten.<br />
(Verdacht auf eine Persönlichkeitsstörung). Die Validierung dieser Cutt-off-Werte ist<br />
noch nicht abgeschlossen, eine Überprüfung dieser „Verdachtsdiagnose“ sollte z.B.<br />
mittels SKID II geschehen (siehe Anhang F).<br />
13.5 Die Beziehungsspezifischen Bindungsskalen für Erwachsene<br />
Die Beziehungsspezifischen Bindungsskalen für Erwachsene (BBE) von Asendorpf,<br />
Banse, Wilpers und Neyer (1997; siehe Anhang D) wurden zur differenziellen<br />
Einschätzung des Bindungsstils von Erwachsenen gegenüber wichtigen<br />
Bezugspersonen wie z.B. Partner, Mutter, Vater oder bester Freund als<br />
Selbstbeschreibungsfragebogen entwickelt. Dabei werden für jeden Beziehungstyp<br />
die Dimensionen „sicher-ängstlich" und „abhängig-unabhängig" durch kurze Skalen
III. Methoden 82<br />
erfasst und daraus ein individuelles Bindungsprofil in Bezug auf mehrere<br />
Bezugspersonen ökonomisch erstellt.<br />
Die aus 14 Items bestehenden BBE sind beziehungsspezifisch formuliert. Pro<br />
Beziehung werden zwei Skalenwerte berechnet. Der Wert für die Dimension „sicher<br />
– ängstlich“ bezieht sich auf einen sicheren (hohe Werte) vs. ängstlichen<br />
Bindungsstil (niedrige Werte), der Wert für die zweite Dimension „abhängig –<br />
unabhängig“ bezieht sich auf einen abhängigen (hohe Werte) vs. unabhängigen<br />
Bindungsstil (niedrige Werte). Die beiden Skalen korrelieren nach Angabe der<br />
Autoren je nach Beziehungstyp und Stichprobe zwischen 0 und +.50 miteinander.<br />
Die Antwortkategorien lauten:<br />
gar nicht = 1; wenig = 2; teils-teils = 3; ziemlich = 4; völlig = 5.<br />
Um die Skalenmittelwerte zu berechnen, werden die Antworten der Items pro Skala<br />
und Beziehungstyp gemittelt, wobei die Items, die sich auf „ängstlich“ bzw.<br />
„unabhängig“ beziehen, invertiert werden (Minimum 0, Maximum 5 Punkte).<br />
Durchführungs-, Auswertungs- und Interpretationsobjektivität sind gewährleistet. Es<br />
liegen jedoch in strengem Sinne nur für die Beziehung zum Partner bei jüngeren<br />
Erwachsenen offizielle Reliabilitäts- und Normierungswerte vor.<br />
Die interne Konsistenz liegt nach Angabe der Autoren für die Skala „sicher –<br />
ängstlich“ bei α = .74 bis α = .86 je nach Stichprobe und Beziehungstyp. Für die<br />
Skala „abhängig – unabhängig“ bei α = .71 bis α = .87 je nach Stichprobe und<br />
Beziehungstyp. Die Retestreliabilität (6 Monate) wird für die Skala „sicher –<br />
ängstlich“ mit α = .70 bis α = .86 je nach Stichprobe und Beziehungstyp angegeben<br />
und für die Skala „abhängig – unabhängig“ mit α = .75 bis α = .83 je nach<br />
Stichprobe und Beziehungstyp.<br />
Nach Angaben der Autoren wurden die BBE in mehreren Studien untersucht, wobei<br />
sie eine gute diskriminante Validität hinsichtlich des Bindungsstils gegenüber<br />
verschiedenen Bezugspersonen angeben. Die Skalen seien auch sensitiv gegenüber<br />
Veränderungen der Beziehungsqualität.
III. Methoden 83<br />
13.6 Die Posttraumatische Diagnoseskala<br />
Die Diagnoseskala der Posttraumatischen Belastungsstörung (PDS) (Ehlers, Steil,<br />
Winter & Foa, 1996; siehe Anhang E) ist die deutschsprachige Form der<br />
Posttraumatic Stress Diagnostic Scale von Foa (1995). Mit der PDS liegt ein<br />
deutschsprachiges Selbstbeurteilungsinstrument vor, welches auf ökonomische<br />
Weise a) das Vorhandensein einer Traumatisierung, b) das Vorliegen einer<br />
Posttraumatischen Belastungsstörung (PTB) oder Akuten Belastungsstörung (ABS),<br />
sowie c) die Auftretenshäufigkeit der Symptomcluster bzw. die Gesamtschwere einer<br />
PTB bei Erwachsenen erfasst. Es basiert dabei auf den diagnostischen Kriterien des<br />
DSM-IV (American Psychiatric Association, APA, 1994); Auswertungsmöglichkeiten<br />
für eine Diagnosestellung einer PTB nach ICD 10 liegen aber<br />
ebenfalls vor.<br />
Der vierteilige Aufbau der PDS lehnt sich an die sechs diagnostischen Kriterien des<br />
DSM-IV an.<br />
Im Teil 1 der PDS werden elf häufig auftretende belastende oder traumatische<br />
Ereignisse dargestellt, z.B. schwerer Unfall, sexueller Angriff oder<br />
Naturkatastrophen. Item 13 ermöglicht eine freie Beschreibung einer Situation. Der<br />
Proband wird gebeten, das Erleben jedes dieser Ereignisse (persönlich oder als<br />
Zeuge) auf einer dichotomen Skala („Ja-Nein“) zu beurteilen. Mehrfachnennungen<br />
sind zugelassen. Das am meisten belastende Ereignis wird benannt. Dieser Abschnitt<br />
entspricht einem Teil des A-Kriteriums der PTB (A1).<br />
Teil 2 enthält die Angabe zum Zeitpunkt des Ereignisses und eine subjektive<br />
Einschätzung des Erlebnisses hinsichtlich körperlicher Verletzung und Lebensgefahr<br />
(entspricht dem anderen Teil des Kriteriums A1 nach DSM-IV) sowie hinsichtlich<br />
währenddessen empfundener Hilflosigkeit und starker Angst oder Entsetzen,<br />
ebenfalls auf einer dichotomen Skala („Ja-Nein“). Dieser Teil entspricht dem<br />
Kriterium A2 nach DSM-IV. Die Teile 1 und 2 zusammen entsprechen dem A-<br />
Kriterium.<br />
In Teil 3 werden die Kriterien Intrusion (Kriterium B), Vermeidung und emotionale<br />
Taubheit (Kriterium C) und Übererregung (Kriterium D) entsprechend der Kriterien<br />
des DSM-IV anhand von 17 Symptombeschreibungen der PTB abgefragt, die vom<br />
Probanden hinsichtlich ihres Auftretens während des letzten Monats auf einer<br />
vierstufigen Likert-Skala von 0 (nicht vorhanden) bis 3 (fast immer vorhanden; 5-<br />
mal oder öfter pro Woche) beurteilt werden. Ein Item erhebt die zeitliche Dauer der
III. Methoden 84<br />
Symptomatik (E-Kriterium) und ermöglicht eine Klassifikation hinsichtlich akuter<br />
(bis 3 Monate) oder chronischer (über 3 Monate) PTB. Des Weiteren kann<br />
eingeschätzt werden, ob ein verzögerter Beginn vorliegt, d.h. ob die Symptome erst 6<br />
Monate nach dem Trauma einsetzten.<br />
In Teil 4 wird erfasst, inwieweit Beeinträchtigungen in neun Lebensbereichen<br />
vorliegen, eine Beantwortung erfolgt über eine Ja-Nein-Einschätzung durch den<br />
Probanden. Dieser Teil entspricht dem F-Kriterium der PTB.<br />
Über die Diagnose hinaus können Kennwerte des Schweregrades der generellen<br />
Symptombelastung sowie der einzelnen Symptombereiche Intrusionen, Vermeidung<br />
bzw. emotionale Taubheit, Übererregung bestimmt werden. Berechnet werden<br />
Mittelwerte über die Häufigkeit der Symptome. Für klinische und Forschungszwecke<br />
wird damit die posttraumatische Symptomatik zum einen als dichotomes Merkmal<br />
(Diagnose der PTB: ja/nein), zum anderen als kontinuierliche Variable<br />
(Schweregrad) erfasst. Dies ermöglicht eine differenziertere Betrachtungsweise des<br />
Problemfeldes.<br />
Die PDS verfügt mit Chronbachs α = .92 über eine exzellente interne Konsistenz und<br />
weist mit r = .83 eine ebenfalls sehr gute Retest-Reliabilität auf. Auch die<br />
konvergenten Validitäten, die durch Korrelationen mit verschiedenen anderen<br />
Messungen der Psychopathologie sowie mit dem strukturierten Interview nach DSM-<br />
IV berechnet wurden, werden mit befriedigend bis gut angegeben.<br />
Zusammengefasst sprechen die Befunde für eine gesicherte Reliabilität und Validität<br />
des Fragebogens.
IV. Ergebnisse 85<br />
IV. Ergebnisse<br />
14. Personengebundene Störvariablen<br />
Um eine gesicherte interne Validität der abhängigen Variablen zu gewährleisten,<br />
wurde überprüft, ob sich Konfundierungen der demographischen Variablen und der<br />
weiteren unabhängigen Variablen ergeben.<br />
Bei der Überprüfung der unabhängigen Variable „Alter“ wurde mit Hilfe einer<br />
einfaktoriellen Varianzanalyse überprüft, ob das Alter einen Effekt zwischen den vier<br />
Substichproben (Alkohol, Alkohol mit Beigebrauch, Polytoxikomane und nicht<br />
substanzabhängige Kontrollgruppe) liefert. Die einfaktorielle Varianzanalyse ergab<br />
einen höchstsignifikanten Effekt (F (3) = 24,291; p < .001). Werden die drei<br />
Suchtgruppen jedoch zusammengefasst und prüft man die Variable „Alter“ mit Hilfe<br />
eines zweiseitigen t-Testes gegenüber der Kontrollgruppe, so ergibt sich kein<br />
signifikanter Unterschied (t (133) = -.194; p n.s.). Aufgrund des nicht signifikanten<br />
Ergebnisses im Hinblick auf die Gesamtsuchtgruppe und der Kontrollgruppe muss<br />
das Alter im Vergleich dieser beiden Gruppen nicht als personengebundene<br />
Störvariable angesehen werden (vgl. Tabelle 2; S. 76).<br />
Um die Voraussetzungen zur Durchführung eines χ 2 - Tests zu erfüllen (vgl. Bortz,<br />
1999, S. 169f.), wurden die Kategorien des Familienstandes „ledig“ und<br />
„geschieden“ zu einer Kategorie zusammengefasst und die Subgruppen „eheähnliche<br />
Gemeinschaft“ und „verheiratet“ zu einer anderen. Im χ 2 -Test zeigten sich<br />
signifikante Unterschiede bzgl. des Familienstandes (χ 2 (1, N = 135) = 29.4; p < .001) im<br />
Hinblick auf die Gesamtsuchtgruppe und die Kontrollgruppe. Diese Unterschiede<br />
blieben auch bei der Testung der Variable „Z.Zt in Partnerschaft“ bestehen (χ 2 (1, N =<br />
135) = 16,806; p < .001).<br />
Ebenso wurden für die Gesamtsuchtgruppe und Kontrollgruppe bei der Variable<br />
„höchster Schulabschluss“ die Kategorien „ohne Schulabschluss“ und „Volks- und<br />
Hauptschule“ zu einer Gruppe „Untere Schulbildung“ zusammengefasst und die<br />
Kategorien „Realschulabschluss“, „Fachabitur“, „Abitur“ und „Hochschulabschluss“<br />
zu einer Kategorie „mittlere/höhere Schulbildung“. Der χ 2 - Test zeigt auch hier<br />
höchstsignifikante Gruppenunterschiede an (χ 2 (1, N = 135) = 11.724; p < .001).<br />
Der χ 2 - Test für die Variable „Beruf“ mit den Kategorien „erwerbslos“, „in Arbeit“,<br />
„Rentner“ und „sonstiges“ zwischen der Gesamtsuchtgruppe und der Kontrollgruppe<br />
ergab einen höchst signifikanten Unterschied (χ 2 (3, N = 134) = 34.196; p < .001), wobei
IV. Ergebnisse 86<br />
die Test-Voraussetzungen nicht komplett gegeben waren, da 4 Zellen (50 %) eine<br />
erwartete Häufigkeit kleiner 5 aufweisen. Insgesamt muss beachtet werden, dass sich<br />
mit Ausnahme der Variable „Alter“ die Gruppen in den soziodemographischen<br />
Daten „höchster Schulabschluss“, „Arbeit/Beruf“ und „Familienstand“ signifikant<br />
unterscheiden. Dies wird bei der Interpretation der Ergebnisse kritisch diskutiert<br />
werden.
IV. Ergebnisse 87<br />
15. Ergebnisse des Fragebogens zum Persönlichkeitsselbstportrait<br />
15.1 Mittelwertvergleiche und Gruppenunterschiede bei den<br />
Persönlichkeitsstilen des FPP<br />
Um der Frage nachzugehen, ob sich Männer mit einer Abhängigkeitsdiagnose<br />
(F.1x.2) in den Ausprägungen ihrer Persönlichkeitsstile von den Männern der<br />
Kontrollgruppe unterscheiden, wurden Mittelwertsvergleiche für alle Subskalen des<br />
Fragebogens zum Persönlichkeitsselbstportrait (FPP) zwischen den Substichproben<br />
(Alkohol, Alkohol mit Beigebrauch, Polytoxikomane, nicht konsumierende<br />
Kontrollgruppe) durchgeführt. Sämtliche Mittelwerte der FPP-Subskalen der<br />
Suchtgruppen sind, wenn auch zum Teil nur gering, höher ausgeprägt als die der<br />
Kontrollgruppe. Mit einer Ausnahme: Die Subskala „gewissenhaft“ unterscheidet<br />
sich nicht signifikant zwischen den Suchtgruppen und der Kontrollgruppe.<br />
14<br />
12<br />
10<br />
Mittelwerte<br />
8<br />
6<br />
4<br />
Suchtgruppe gesamt<br />
Kontrollgruppe<br />
Alkohol<br />
Alkohol mit Beigebrauch<br />
Polytoxikomane<br />
2<br />
0<br />
gewissenhaft<br />
selbstbewusst<br />
dramatisch<br />
wachsam<br />
sprunghaft<br />
anhänglich<br />
ungesellig<br />
lässig<br />
sensibel<br />
exzentrisch<br />
abenteuerlich<br />
aufopfernd<br />
Persönlichkeitsstile<br />
Abbildung 5: Mittelwerte der Persönlichkeitsstile des FFP aller Suchtgruppen<br />
und der Kontrollgruppe
IV. Ergebnisse 88<br />
Folgende Mittelwertsunterschiede wurden in der MANOVA bedeutsam:<br />
• Auf der Skala „wachsam“<br />
- jeweils zwischen der Kontrollgruppe und den Subgruppen Alkohol<br />
(p < .001), Alkohol mit Beigebrauch (p < .005) und der Gruppe der<br />
Polytoxikomanen (p < .001).<br />
• Auf der Skala „ungesellig“<br />
- zwischen der Kontrollgruppe und der Subgruppen Alkohol (p < .001).<br />
• Auf der Skala „exzentrisch“<br />
- jeweils zwischen der Kontrollgruppe und den Subgruppen Alkohol<br />
(p < .001), Alkohol mit Beigebrauch (p < .001) und der Gruppe der<br />
Polytoxikomanen (p < .001).<br />
• Auf der Skala „abenteuerlich“<br />
- jeweils zwischen der Kontrollgruppe und den Subgruppen Alkohol<br />
(p < .002), Alkohol mit Beigebrauch (p < .001) und der Gruppe der<br />
Polytoxikomanen (p < .001).<br />
- zwischen den Subgruppen Alkohol und Alkohol mit Beigebrauch (p < .005).<br />
• Auf der Skala „sprunghaft“<br />
- jeweils zwischen der Kontrollgruppe und den Subgruppen Alkohol<br />
(p < .001), Alkohol mit Beigebrauch (p < .001) und der Gruppe der<br />
Polytoxikomanen (p < .001).<br />
• Auf der Skala „dramatisch“<br />
- jeweils zwischen der Kontrollgruppe und den Subgruppen Alkohol mit<br />
Beigebrauch (p < .005) und der Gruppe der Polytoxikomanen (p < .040).<br />
• Auf der Skala „selbstbewusst“<br />
- jeweils zwischen der Kontrollgruppe und den Subgruppen Alkohol<br />
(p < .009), Alkohol mit Beigebrauch (p < .007) und der Gruppe der<br />
Polytoxikomanen (p < .001).
IV. Ergebnisse 89<br />
• Auf der Skala „sensibel“<br />
- zwischen der Kontrollgruppe und der Gruppe der Polytoxikomanen<br />
(p < .021).<br />
• Auf der Skala „anhänglich“<br />
- zwischen der Kontrollgruppe und der Gruppe der Polytoxikomanen<br />
(p < .012).<br />
• Auf der Skala „lässig“<br />
- jeweils zwischen der Kontrollgruppe und den Subgruppen Alkohol<br />
(p < .013), Alkohol mit Beigebrauch (p < .020) und der Gruppe der<br />
Polytoxikomanen (p < .001).<br />
• Auf der Skala „aufopfernd“<br />
- jeweils zwischen der Kontrollgruppe und den Subgruppen Alkohol<br />
(p < .001), Alkohol mit Beigebrauch (p < .001) und der Gruppe der<br />
Polytoxikomanen (p < .001).<br />
Um zu überprüfen, ob sich die Mittelwerte der dreizehn FPP-Subskalen nicht nur<br />
bzgl. der absoluten Mittelwerte unterscheiden und um Aussagen darüber treffen zu<br />
können, ob hierbei das Alter und die Berufstätigkeit als möglicher Einflussfaktor<br />
gelten können, wurde eine multivariate Varianzanalyse (MANOVA) mit dem festen<br />
Faktor „Gruppenzugehörigkeit“ (Gesamtsuchtgruppe, Kontrollgruppe), und den<br />
Kovariaten „Alter“ und „Berufstätigkeit“ für 12 Subskalen des FPP berechnet (siehe<br />
Tabelle 3). Um Aussagen über die unterschiedlich stark ausgeprägten<br />
Persönlichkeitsstile treffen zu können, wurden die Skalenmittelwerte t-transformiert.
IV. Ergebnisse 90<br />
Tabelle 3: Gruppenunterschiede für die abhängige Variable „FPP-Subskalen“:<br />
Mittelwerte, Standardabweichungen und signifikante Gruppenunterschiede<br />
Persönlichkeitsstil Gruppe N M SD p<br />
Skala wachsam<br />
Skala ungesellig<br />
Skala exzentrisch<br />
Skala abenteuerlich<br />
Skala sprunghaft<br />
Skala dramatisch<br />
Skala selbstbewusst<br />
Skala sensibel<br />
Skala anhänglich<br />
Skala gewissenhaft<br />
Skala lässig<br />
Skala aufopfernd<br />
Sucht 90 60,62 11,37<br />
Kontrolle 45 48,59 9,19<br />
Sucht 90 54,54 9,08<br />
Kontrolle 45 49,43 7,53<br />
Sucht 90 57,82 11,67<br />
Kontrolle 45 45,41 7,47<br />
Sucht 90 61,03 13,35<br />
Kontrolle 45 45,57 8,51<br />
Sucht 90 66,17 9,50<br />
Kontrolle 45 55,54 6,52<br />
Sucht 90 55,80 11,47<br />
Kontrolle 45 49,14 10,39<br />
Sucht 90 56,80 12,60<br />
Kontrolle 45 47,25 9,97<br />
Sucht 90 54,67 7,92<br />
Kontrolle 45 50,01 6,02<br />
Sucht 90 55,84 9,84<br />
Kontrolle 45 49,75 9,09<br />
Sucht 90 50,10 10,70<br />
Kontrolle 45 47,70 9,32<br />
Sucht 90 54,87 10,81<br />
Kontrolle 45 46,05 9,35<br />
Sucht 90 64,10 11,47<br />
Kontrolle 45 51,59 9,16<br />
.001***<br />
.002*<br />
.001***<br />
.001***<br />
.001***<br />
.005*<br />
.001***<br />
.004*<br />
.001***<br />
.212 n.s.<br />
.001***<br />
.001***<br />
Anmerkung: n.s. = nicht signifikant; p < .05*: p < .01**; p = .001*** - gilt für alle Signifikanzberechnungen bei<br />
einem Signifikanzniveau von 5 %<br />
Die multivariaten Testergebnisse zeigen einen höchst signifikanten Haupteffekt für<br />
die Variable „Gruppenzugehörigkeit“ (F (12,119) = .089; p < .001) und für die Variable<br />
„Alter“ (F (12,19) = .272; p < .001), aber keinen für die Variable „Arbeit“ (F (12,119) =<br />
.082; p < .569 n.s.).
IV. Ergebnisse 91<br />
Höchst signifikante Gruppenunterschiede finden sich bei den Subskalen „wachsam“<br />
(F (1) = 38,364; p < .001), „exzentrisch“ (F (1) = 42,632; p < .001), „abenteuerlich“<br />
(F (1) = 52,936; p < .001), „sprunghaft“ (F (1) = 33,933; p < .001), „selbstbewusst“ (F<br />
(1) = 18,429; p < .001), „anhänglich“ (F (1) = 11,240; p < .001), „lässig“ (F (1) =<br />
18,211; p < .001) und „aufopfernd“ (F (1) = 38,418; p < .001). Hoch signifikante<br />
Gruppenunterschiede finden sich bei den Subskalen „ungesellig“ (F (1) = 9,850;<br />
p < .002), „dramatisch“ (F (1) = 8,255; p < .005) und „sensibel“ (F (1) = 8,378;<br />
p < .004).<br />
Nicht signifikant wurde der Unterschied bei der Skala „gewissenhaft“ (F (1) = 1,576;<br />
p < .212 n.s.).<br />
Es finden sich also für alle Skalen mit Ausnahme der Subskala „gewissenhaft“<br />
signifikante Gruppenunterschiede. In der Suchtgruppe finden sich stets höhere<br />
Ausprägungen der Mittelwerte, mit Ausnahme der Skala „gewissenhaft“!<br />
15.2 Extremere Persönlichkeitsstilausprägungen, die eine Störung<br />
kennzeichnen<br />
Nachdem im Kap. 15.1 gezeigt werden konnte, dass sich die Mittelwertsunterschiede<br />
der Persönlichkeitsstile in nahezu allen Stilen signifikant unterscheiden, ist es nun<br />
von Interesse, ob und in wie viel Prozent der Fälle auch eine Persönlichkeitsstörung<br />
vorliegen. Nach Oldham und Morris (1992a) schafft nicht die Qualität jeden<br />
Persönlichkeitsstils Probleme, sondern die Quantität eines Persönlichkeitsstils im<br />
Kontinuum. Für die Grenze vom Persönlichkeitsstil zur Persönlichkeitsstörung wird<br />
das Überschreiten der von Schöttke (2007; persönl. Mitteilung) in laufender<br />
Forschung entwickelten Cut-off-Werte als Kriterium angelegt (siehe Anhang F).<br />
Tabelle 4 gibt einen Überblick über die Verteilung von solchen Störungen pro<br />
Gruppe (Mehrfachstörungen vorhanden).
IV. Ergebnisse 92<br />
Tabelle 4: Häufigkeiten, % der Persönlichkeitsstörungen nach Cut-off-Wert<br />
und Signifikanz der Unterschiede zwischen Suchtgesamt- und Kontrollgruppe<br />
Persönlichkeitsstörung<br />
paranoid<br />
schitzotypisch<br />
antisozial<br />
borderline<br />
histrionisch<br />
narzisstisch<br />
selbstunsicher<br />
abhängig<br />
zwanghaft<br />
passiv-aggressiv<br />
Alkohol<br />
n = 40<br />
10<br />
25 %<br />
Alk mit<br />
Beigeb.<br />
n = 10<br />
2<br />
20 %<br />
0 2<br />
20 %<br />
0 1<br />
10 %<br />
2<br />
5 %<br />
4<br />
10 %<br />
2<br />
20 %<br />
4<br />
40 %<br />
Polytoxikomane<br />
n = 40<br />
14<br />
35 %<br />
KG<br />
n = 45<br />
1<br />
2,2 %<br />
Sucht<br />
gesamt<br />
n = 90<br />
26<br />
28,9 %<br />
0 0 2<br />
2,2 %<br />
3<br />
7,5 %<br />
2<br />
5 %<br />
3<br />
7,5 %<br />
0 4<br />
4,4 %<br />
0 6<br />
6,7 %<br />
0 11<br />
12,2 %<br />
0 0 0 0 0<br />
3<br />
7,5 %<br />
3<br />
7,5 %<br />
4<br />
10 %<br />
2<br />
20 %<br />
2<br />
20 %<br />
1<br />
10 %<br />
2<br />
5 %<br />
0 7<br />
7,8 %<br />
0 0 5<br />
5,6 %<br />
0 0 5<br />
5,6 %<br />
0 0 0 0 0<br />
Signifikanz<br />
KG: Sucht<br />
gesamt<br />
.001***<br />
n.s.<br />
n.s.<br />
n.s.<br />
.016**<br />
.095*<br />
n.s.<br />
n.s.<br />
Nach Fishers exaktem Test (zweiseitig) wurden die Unterschiede der Häufigkeiten<br />
von Persönlichkeitsstörungen zwischen der Gesamtsuchtgruppe und der<br />
Kontrollgruppe für die paranoide Persönlichkeitsstörung höchst signifikant<br />
(p < .001), für die histrionische Persönlichkeitsstörung hoch signifikant (p < .016)<br />
und für die selbstunsichere Persönlichkeitsstörung signifikant (p < .095).<br />
Insgesamt gesehen leiden in der Gesamtsuchtgruppe 45 Personen (50 %) an einer<br />
Persönlichkeitsstörung, gemessen an dem Überschreiten der Cut-off-Werte im FPP.<br />
Im Gegensatz dazu findet sich in der Kontrollgruppe nur eine Person, die diese<br />
Kriterien erfüllt. Dieser Unterschied zeigte sich im χ 2 -Test höchst signifikant<br />
(χ 2 (1, N = 135) = 30,485; p < .001).
IV. Ergebnisse 93<br />
16. Ergebnisse der Bindungsspezifischen Bindungsskalen für Erwachsene<br />
16.1 Dauer der Partnerschaften<br />
Im Fragebogen Bindungsspezifische Bindungsskalen für Erwachsene wurde zunächst<br />
nach dem Bestehen und, wenn ja, nach der Dauer einer festen Partnerschaft gefragt.<br />
Für den Fall, dass die Person zurzeit. in keiner festen Partnerschaft lebt, wurde nach<br />
der Dauer der letzten festen Partnerschaft gefragt. Sollten die Probanden noch in<br />
keiner festen Partnerschaft gelebt haben, wurden sie gebeten, den Fragebogen der<br />
BBE hinsichtlich des Partners nicht auszufüllen.<br />
Die Tabelle 5 gibt einen Überblick über Dauer bei bestehender Partnerschaft pro<br />
Substichgruppe. Tabelle 6 gibt einen Überblick über die Dauer der letzten<br />
Partnerschaft derjenigen Probanden pro Substichgruppe, die zurzeit. in keiner festen<br />
Partnerschaft stehen.<br />
Tabelle 5: Dauer der bestehenden Partnerschaft in Monaten<br />
KG<br />
Sucht gesamt<br />
Alkohol<br />
Alkohol<br />
mit Beigebrauch<br />
Polytoxikomane<br />
N M Minimum Maximum<br />
38 157<br />
(13 J, 1 Mon)<br />
43 81<br />
(6 J, 9 Mon)<br />
20 127<br />
(10 J, 7 Mon)<br />
2 17<br />
(1 J, 5 Mon)<br />
21 43<br />
(3 J, 7 Mon)<br />
5 410<br />
(34 J, 2 Mon)<br />
5 444<br />
(37 J)<br />
6 444<br />
(37 J)<br />
11 23<br />
(1 J, 11 Mon)<br />
6 136<br />
(11 J, 4 Mon)
IV. Ergebnisse 94<br />
Tabelle 6: Bei keiner festen Partnerschaft: Dauer<br />
der letzten festen Partnerschaft in Monaten<br />
KG<br />
Sucht gesamt<br />
Alkohol<br />
Alkohol<br />
mit Beigebrauch<br />
Polytoxikomane<br />
N M Minimum Maximum<br />
5 52 3 182<br />
(4 J, 4 Mon)<br />
(15 J; 2 Mon)<br />
45 49 2 240<br />
(4 J, 1 Mon)<br />
(20 J)<br />
18 76 6 240<br />
(6 J, 4 Mon)<br />
(20 J)<br />
8 25 2 80<br />
(2 J, 1 Mon)<br />
(6 J, 8 Mon)<br />
19 33 2 120<br />
(2 J, 9 Mon)<br />
(10 J)<br />
Die Mittelwerte der Partnerschaftsdauer bei bestehender Partnerschaft wurden<br />
zwischen der Kontrollgruppe und der Gesamtsuchtgruppe anhand eines zweiseitigen<br />
t-Tests signifikant (t (79) = 3.301; p < .015). Die Mittelwertsunterschiede der letzten<br />
Partnerschaft unterschieden sich jedoch nicht signifikant zwischen der Kontroll- und<br />
Gesamtsuchtgruppe (t (4.415) = .087; p < .935).<br />
Desweiteren wurde eine einfaktorielle Varianzanalyse durchgeführt, um die<br />
Unterschiede zwischen allen Substichgruppen (Alkohol, Alkohol mit Beigebrauch,<br />
Polytoxikomane und Kontrollgruppe) hinsichtlich der Dauer einer bestehenden<br />
Partnerschaft zu prüfen. Die Unterschiede zwischen den Gruppen zeigten sich mit<br />
F (3) = 6,608; p < .001 höchst signifikant. Der sich anschließende Bonferoni-Test<br />
differenzierte lediglich einen signifikanten Unterschied zwischen der Kontrollgruppe<br />
und der Subsuchtgruppe der Polytoxikomanen (p < .001) und zwischen der<br />
Alkoholsubgruppe und der Subsuchtgruppe der Polytoxikomanen (p < .053).<br />
Die Personen, die zum Zeitpunkt der Datenerhebung in keiner festen Partnerschaft<br />
lebten, wurden gebeten, den Fragebogen im Hinblick auf ihre letzte feste<br />
Partnerschaft auszufüllen. Ein zweiseitiger t-Test zwischen der Gesamtsuchtgruppe<br />
und Kontrollgruppe zeigte keine signifikanten Unterschiede (t (48) = .119; p < .906) in<br />
Bezug auf die Dauer der letzten festen Partnerschaft an.
IV. Ergebnisse 95<br />
Eine einfaktorielle Varianzanalyse hinsichtlich der Mittelwertsunterschiede zwischen<br />
o.g. Gruppen in der Dauer der letzten festen Partnerschaft zeigte mit F (3) = 3.009;<br />
p < .040 zwar signifikante Unterschiede, der sich anschließende Bonferoni-Test<br />
differenzierte aber nur auf dem 10 % Niveau einen signifikanten Unterschied<br />
zwischen den Suchtsubgruppen Alkohol und Polytoxikomanen (p < .075). Alle<br />
anderen Mittelwertsunterschiede wurden nicht signifikant.<br />
16.2 Mittelwertvergleiche und Gruppenunterschiede bei den BBE<br />
Die Mittelwertvergleiche der Beziehungsspezifischen Bindungsskalen für<br />
Erwachsene (BBE) (Asendorpf et al., 1997) mittels einer multivariaten<br />
Varianzanalyse (MANOVA) ergaben ein heterogenes Bild.<br />
Tabelle 7 gibt zunächst einen Überblick über die Mittelwerte der beiden Skalen des<br />
BBE pro Subgruppen bezüglich erfragter Bindung zur Mutter und Bindung zum<br />
Partner.<br />
In einer MANOVA mit den abhängigen Variablen Skalen „sicher-ängstlich Mutter“<br />
und „abhängig-unabhängig Mutter“ sowie „sicher-ängstlich Partner“ und „abhängigunabhängig<br />
Partner“ mit der abhängigen Variable „Gruppenzugehörigkeit“ zeigte der<br />
Pillai-Spur-Test höchst signifikante Unterschiede zwischen den Gruppen mit F (6; 212)<br />
= 3,840; p < .001 an. Aufgrund der disproportionalen Zellenumfänge wurde als Post-<br />
Hoc-Test, wie von Diehl und Staufenbiel (2002) empfohlen, ein Bonferoni-Test<br />
durchgeführt, um Unterschiede zu differenzieren. Folgende signifikanten<br />
Unterschiede zeigte der Bonferoni-Test an:<br />
Auf der Skala „sicher-ängstlich“ in der Bindung zur Mutter:<br />
- zwischen der Kontrollgruppe und der Subsuchtgruppe der<br />
Alkoholabhängigen mit Beigebrauch (p < .009)<br />
- zwischen den Subsuchtgruppen Alkohol und Alkohol mit Beigebrauch<br />
(p < .013) und<br />
- zwischen der Polytoxikomanen und der Subsuchtgruppe Alkohol mit<br />
Beigebrauch (p < .045)<br />
Auf der Skala „abhängig-unabhängig“ in der Bindung zur Mutter:<br />
- zwischen der Kontrollgruppe und der Subsuchtgruppe der Polytoxikomanen<br />
(p < .018)
IV. Ergebnisse 96<br />
Auf den beiden Skalen hinsichtlich der Bindung zum Partner verzeichnete der Test<br />
keine signifikanten Unterschiede zwischen den Gruppen.<br />
Tabelle 7: N, Skalen-Mittelwerte, Standardabweichung der BBE pro Gruppe<br />
Gruppe M SD N<br />
KG 3,9259 1,036 36<br />
sicher-ängstlich Alkohol 3,8873 0,922 34<br />
(Mutter)<br />
Alkohol mit<br />
Beigebrauch<br />
2,8333 1,294 8<br />
Polytoxikomane 3,7083 1,004 32<br />
KG 1,5347 0,474 36<br />
abhängig-unabhängig Alkohol 1,6544 0,5888 34<br />
(Mutter)<br />
Alkohol mit<br />
Beigebrauch<br />
1,9063 0,6295 8<br />
Polytoxikomane 1,9766 0,7436 32<br />
KG 4,4960 0,5637 42<br />
sicher-ängstlich Alkohol 4,3333 1,5295 37<br />
(Partner)<br />
Alkohol mit<br />
Beigebrauch<br />
3,7222 0,8416 9<br />
Polytoxikomane 3,9099 0,7186 37<br />
KG 3,1250 0,7284 42<br />
abhängig-unabhängig Alkohol 2,9561 0,7029 37<br />
(Partner)<br />
Alkohol mit<br />
Beigebrauch<br />
2,9444 0,6558 9<br />
Polytoxikomane 2,9358 0,5725 37<br />
16.3 Bindung bei Extrempersönlichkeiten<br />
Um der Frage nachzugehen, ob sich die Personen mit einer stärkeren<br />
Persönlichkeitsstilausprägung hinsichtlich ihrer Bindung von den Personen mit<br />
unauffälliger Stilausprägung unterscheiden, wurden aus allen<br />
Untersuchungsteilnehmern zwei Gruppen gebildet. Die eine Gruppe der<br />
„Extrempersönlichkeiten“ setzte sich aus allen Personen zusammen, die in<br />
mindestens einem Persönlichkeitsstil die von Schöttke (2007; persönl. Mitteilung) in<br />
laufendem Forschungsprojekt entwickelten Cut-off-Werte (siehe Anhang F)<br />
überschritten haben (für den aufopfernden und den ungeselligen Stil wurde der Cut-
IV. Ergebnisse 97<br />
off-Wert 13 beibehalten). Die andere Gruppe bildeten die Personen, die in keinem<br />
Stil diese Werte überschritten (unauffällig ausgeprägter Persönlichkeitsstil). Mit<br />
einer MANOVA wurden Unterschiede auf den beiden Skalen („sicher-ängstlich“ und<br />
„abhängig-unabhängig“) der BBE in der Bindung zur Mutter und in der Bindung<br />
zum Partner zwischen der „Extremgruppe“ (n = 33) und der in den<br />
Persönlichkeitsstilen normal ausgeprägten Gruppe (n = 68) getestet. Tabelle 8 gibt<br />
einen Überblick über Mittelwerte, Standardabweichung und Gruppengröße, sowie<br />
dem Signifikanzniveau bezüglich beider Skalen in der Bindung zur Mutter und zum<br />
Partner.<br />
Tabelle 8: N, Skalen-Mittelwerte, Standardabweichung der BBE pro Gruppe und<br />
Signifikanzniveau<br />
Skala Gruppe M SD N p<br />
sicher-ängstlich<br />
extremer Persönlichkeitsstil 3,5 1,1134 33<br />
(Mutter) normal ausgeprägter Stil 3,8995 0,9976 68<br />
abhängig-unabhängig<br />
extremer Persönlichkeitsstil 1,8561 0,6982 33<br />
(Mutter) normal ausgeprägter Stil 1,6342 0,5844 68<br />
sicher-ängstlich<br />
extremer Persönlichkeitsstil 3,8838 0,7870 33<br />
(Partner) normal ausgeprägter Stil 4,4534 1,1532 68<br />
abhängig-unabhängig<br />
extremer Persönlichkeitsstil 2,8788 0,5724 33<br />
(Partner) normal ausgeprägter Stil 3,0018 0,7389 68<br />
.072<br />
.097<br />
.012<br />
.402<br />
Die MANOVA mit den abhängigen Variablen Skalen „sicher-ängstlich Mutter“ und<br />
„abhängig-unabhängig Mutter“ und „sicher-ängstlich Partner“ und „abhängigunabhängig<br />
Partner“ mit der unabhängigen Variable „Extrempersönlichkeit“ zeigte<br />
der Pillai-Spur-Test signifikante Unterschiede zwischen den Gruppen mit F (4; 96) =<br />
3,112; p < .019 an. Zwar sind die Personen mit normal ausgeprägten<br />
Persönlichkeitsstilen nominal jeweils sicherer gebunden hinsichtlich der Mutter und<br />
des Partners, beim Test der Zwischensubjekteffekte wurde jedoch nur der<br />
Unterschied auf der Skala „sicher-ängstlich“ in der Bindung zum Partner auf einem<br />
5 %-Signifikanzniveau dahingehend signifikant, dass erwartungsgemäß die Gruppe<br />
der normal ausgeprägten Persönlichkeitsstile sich sicherer erwies als die Gruppe der<br />
Extrempersönlichkeiten. Auf der Skala „abhängig-unabhängig“ in der Bindung zum<br />
Partner unterschieden sich die beiden Gruppen nicht.
IV. Ergebnisse 98<br />
16.4 Reliabilitätsberechnungen der BBE<br />
Da es sich bei den Beziehungsspezifischen Bindungsskalen für Erwachsene bisher<br />
noch um ein Forschungsinstrument handelt, wurden zur Prüfung des Instrumentes<br />
eigene Reliabilitätsberechnungen für die Skalen „sicher-ängstlich“ und „abhängigunabhängig“<br />
jeweils im Bezug zur Mutter und zum Partner durchgeführt, so wie<br />
Trennschärfeberechnungen pro Item.<br />
Die Berechnung der Reliabilität von Chronbachs Alpha für die einzelnen Skala im<br />
Bezug zur Mutter und zum Partner ergaben ein heterogenes Bild.<br />
Die Berechnungen ergaben für die Skala „sicher-ängstlich Mutter“, bestehend aus 6<br />
Items, ein α = ,827 und für die Skala „abhängig-unabhängig Mutter“, bestehend aus<br />
8 Items, ein α = ,754.<br />
Die folgende Tabelle 9 gibt einen Überblick über die korrigierte Trennschärfen pro<br />
Skala und Item in Bezug zur Mutter.<br />
Tabelle 9: Item-Trennschärfen pro Skala in der Bindung zur Mutter<br />
sicher-ängstlich (Mutter) abhängig-unabhängig (Mutter)<br />
Item 1 ,699 Item 3 ,500<br />
Item 2 ,410 Item 4 ,235<br />
Item 5 ,488 Item7 ,534<br />
Item 6 ,631 Item 8 ,358<br />
Item 9 ,640 Item 10 ,543<br />
Item12 ,739 Item 11 ,425<br />
Item 13 ,562<br />
Item 14 ,439<br />
Die Berechnungen ergaben für die Skala „sicher-ängstlich“-Partner, bestehend aus 6<br />
Items, jedoch nur ein α = ,262 und für die Skala „abhängig-unabhängig“- Partner,<br />
bestehend aus 8 Items, nur ein α = ,476.<br />
Tabelle 10 gibt eine Übersicht über die korrigierten Trennschärfen der Items beider<br />
Skalen in Bezug zum Partner.
IV. Ergebnisse 99<br />
Tabelle 10: Item-Trennschärfen pro Skala in der Bindung zum Partner<br />
sicher-ängstlich (Partner) Abhängig-unabhängig (Partner)<br />
Item 1 ,030 Item 3 -,488<br />
Item 2 ,143 Item 4 ,406<br />
Item 5 ,303 Item7 ,247<br />
Item 6 ,432 Item 8 ,218<br />
Item 9 -,102 Item 10 ,488<br />
Item12 ,463 Item 11 ,443<br />
Item 13 ,298<br />
Item 14 ,344<br />
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Reliabilitätsberechnungen der<br />
beiden Bindungsskalen des BBE im Bezug zur Mutter den von den Autoren<br />
berichteten Kennwerten entspricht. Im Hinblick auf den Bindungsstil zur Mutter<br />
kann von einer guten Internen Konsistenz und zufrieden stellenden Trennschärfen<br />
ausgegangen werden. Anders sieht es im Hinblick der Reliabilität zum Partner aus,<br />
hier kann der Reliabilitätskennwert und die Trennschärfekorrelationen nicht<br />
zufrieden stellen.
IV. Ergebnisse 100<br />
17. Ergebnisse der PDS<br />
17.1 Posttraumatische Belastungsstörung<br />
Die Kriterien einer PTBS nach DSM-IV wurden mittels dem PDS von Ehlers et al.<br />
(1996) abgefragt. Die folgende Tabelle 11 gibt eine Übersicht, wie viele Personen<br />
pro Subgruppe die Kriterien einer Posttraumatischen Belastungsstörung nach DSM-<br />
IV erfüllen:<br />
Tabelle 11: Anzahl und Prozentwerte der Teilnehmer, die die<br />
Kriterien einer PTBS nach DSM-IV erfüllen, pro Gruppe<br />
Gruppe PTBS Keine<br />
KG<br />
Alkohol<br />
Alkohol mit<br />
PTBS<br />
Gesamt<br />
1 44 45<br />
2,2 % 97,8 % 100 %<br />
6 34 40<br />
15 % 85 % 100 %<br />
4 6 10<br />
Beigebrauch 40 % 60 % 100 %<br />
Polytoxikomane<br />
Sucht gesamt<br />
11 29 40<br />
27,5 % 72,5 % 100 %<br />
21 69 90<br />
23,3 % 76,7 % 100 %<br />
Die Unterschiede zwischen der Gesamtsuchtgruppe und der Kontrollgruppe sind mit<br />
χ 2 (1, N = 135) = 9,802; p < .002 hoch signifikant.<br />
Die gezeigten Unterschiede zwischen den einzelnen Gruppen sind ebenfalls<br />
signifikant (χ 2 (3 N = 135) = 14,384; p < .002). Dabei fällt auf, dass die Gruppe der<br />
Alkoholabhängigen mit Beigebrauch prozentual die höchste Rate (40 %) (n = 4) der<br />
Personen aufweist, die die Kriterien einer PTBS nach DSM-IV erfüllen. Gefolgt von<br />
der Gruppe der Polytoxikomanen mit 27,5 % (n = 11) und der ausschließlich<br />
Alkoholabhängigen mit 15 %-Rate. Die Kontrollgruppe weist mit 2,2 % (n = 1)<br />
erwartungsgemäß die niedrigste Anzahl an Personen auf, die die Kriterien einer<br />
PTBS nach DSM-IV erfüllen.
IV. Ergebnisse 101<br />
17.2 Unterschiedliche traumatische Ereignisse<br />
Im PDS-Fragebogen sind 11 Kategorien von traumatischen Ereignissen vorgegeben<br />
und eine freie Beschreibung möglich. Die folgende Tabelle 12 gibt einen Überblick<br />
über Gruppengröße, Mittelwert und Standardabweichungen der Anzahl, der mit<br />
zutreffend bewerteten vorgegebenen „Trauma-Kategorien“ pro Gruppe.<br />
Tabelle 12: Gruppengröße, Mittelwert und Standartabweichungen der Anzahl,<br />
der mit zutreffend bewerteten „Trauma-Kategorien“ der PDS pro Gruppe<br />
N Mittelwert SD Minimum Maximum<br />
Kontrollgruppe 44 1,0 1,012 0 4<br />
Alkohol 40 2,4 2,146 0 11<br />
Alkohol mit<br />
Beigebrauch<br />
10 3,4 1,897 1 6<br />
Polytoxikomane 39 3,8 1,876 0 7<br />
Gesamtsuchtgruppe 89 3,1 2,095 0 11<br />
Die Personen der Kontrollgruppe gaben im Durchschnitt eine Kategorie als<br />
zutreffend an. Die Personen der Alkoholgruppe gaben im Mittel 2,4, die Personen<br />
der Alkoholgruppe mit Beigebrauch 3,4 und die Polytoxikomanen gaben<br />
durchschnittlich 3,8 Kategorien als zutreffend an. Die Suchtgruppe gesamt gesehen<br />
gab durchschnittlich 3,1 Kategorien als gegeben an.<br />
Bei der Durchführung der einfaktoriellen Varianzanalyse wurden die Unterschiede<br />
zwischen den Gruppen mit F (3) = 19,289; p = < .001 höchst signifikant. Der sich<br />
anschließende Bonferoni-Test ergab zwischen der Kontrollgruppe und allen anderen<br />
Subgruppen hoch signifikante Unterschiede (Alkohol p < .002; Alkohol mit<br />
Beigebrauch p < .001; Polytoxikomane p < .001). Die Alkoholsubgruppe<br />
unterscheidet sich zudem noch hoch signifikant von der Gruppe der<br />
Polytoxikomanen (p < .002).<br />
Ein t-Test ergab höchst signifikante Unterschiede zwischen der Kontrollgruppe und<br />
der Gesamtsuchtgruppe (t (131) = -7,924; p < .001).
IV. Ergebnisse 102<br />
17.3 Spezifische traumatische Erfahrungen<br />
Die folgende Tabelle 13 gibt einen Überblick über die prozentuale Verteilung der im<br />
PDS angegebenen erfahrenen traumatischen Ereignisse, die entweder selbst oder als<br />
Zeuge erlebt wurden.<br />
Tabelle 13: Verteilung der im PDS angegebenen erfahrenen<br />
traumatischen Ereignisse, n, %, pro Gruppe; Signifikanzniveau<br />
Ereigniskategorie<br />
Sucht<br />
KG<br />
Signifikanz<br />
n = 90<br />
n = 45<br />
Schwerer Unfall, Feuer oder Explosion<br />
(z.B. Arbeitsunfall, Unfall in der<br />
Landwirtschaft, Autounfall, Flugzeugoder<br />
Schiffsunglück)<br />
46<br />
51,1 %<br />
17<br />
37,8 %<br />
χ 2 (1, N = 135) =2,143; p < .143<br />
n.s.<br />
Naturkatastrophe (z.B. Wirbelsturm,<br />
Orkan, Flutkatastrophe, schweres<br />
Erdbeben)<br />
13<br />
14,4 %<br />
2<br />
4,4 %<br />
χ 2 (1, N = 135) = 3,038; p < .081<br />
Gewalttätiger Angriff durch jemanden aus<br />
dem Familien- oder Bekanntenkreis (z.B.<br />
körperlich angegriffen, ausgeraubt,<br />
angeschossen oder mit einer Schusswaffe<br />
bedroht werden, Stichverletzung zugefügt<br />
bekommen)<br />
10<br />
43,3 %<br />
4<br />
8,9 %<br />
χ 2 (1, N = 135) = 16,397; p < .001<br />
Gewalttätiger Angriff durch fremde Person<br />
(z.B. körperlich angegriffen, ausgeraubt,<br />
angeschossen oder mit einer Schusswaffe<br />
bedroht werden, Stichverletzung zugefügt<br />
bekommen)<br />
54<br />
60,0 %<br />
6<br />
13,3 %<br />
χ 2 (1, N = 135) = 26,460; p < .001<br />
Sexueller Angriff durch jemanden aus dem<br />
Familien- oder Bekanntenkreis (z.B.<br />
Vergewaltigung, versuchte<br />
Vergewaltigung)<br />
10<br />
11,1 %<br />
1<br />
2,2 %<br />
χ 2 (1, N = 135) =3,167; p < .075<br />
Sexueller Angriff durch fremde Person<br />
(z.B. Vergewaltigung, versuchte<br />
Vergewaltigung)<br />
Kampfeinsatz im Krieg oder Aufenthalt im<br />
Kriegsgebiet<br />
Sexueller Kontakt im Alter von unter 18<br />
Jahren mit einer Person, die mindestens 5<br />
Jahre älter war (z.B. Kontakt mit<br />
Genitalien oder Brüsten)<br />
Gefangenschaft (z.B. Strafgefangener,<br />
Kriegsgefangener, Geißel)<br />
9<br />
10,0 %<br />
3<br />
3,3 %<br />
23<br />
25,6 %<br />
33<br />
36,7 %<br />
0 χ 2 (1, N = 135) = 4,821; p < .028<br />
χ 2 (1, N = 135) = 1,534; p < .215<br />
0<br />
n.s.<br />
2<br />
χ 2 (1, N = 135) = 8,861; p < .003<br />
4,4 %<br />
0 χ 2 (1, N = 135) = 21,838; p < .001
IV. Ergebnisse 103<br />
Folter<br />
5<br />
5,6 %<br />
0<br />
χ 2 (1, N = 135) = 2,596; p < .107<br />
n.s<br />
Lebensbedrohliche Krankheit<br />
65<br />
72,2 %<br />
38<br />
84,4 %<br />
χ 2 (1, N = 135) = 2,478; p < .115<br />
n.s.<br />
Anderes traumatisches Ereignis<br />
20<br />
22,2 %<br />
5<br />
11,4 %<br />
χ 2 (1, N = 135) = 2,882; p < .237<br />
n.s.<br />
Kein traumatisches Ereignis angegeben<br />
9<br />
9,9 %<br />
17<br />
37,4 %<br />
Wie der Tabelle 13 zu entnehmen ist, zeigte sich in der Gegenüberstellung von der<br />
Gesamtsuchtgruppe und der Kontrollgruppe bzgl. der erfahrenen traumatischen<br />
Ereignisse folgende Kategorien anhand eines χ 2 - Tests signifikante Unterschiede:<br />
- Gewalttätiger Angriff durch jemanden aus dem Familien- oder<br />
Bekanntenkreis (z.B. körperlich angegriffen, ausgeraubt, angeschossen oder<br />
mit einer Schusswaffe bedroht werden, Stichverletzung zugefügt bekommen)<br />
(χ 2 (1, N = 135) = 16,397; p < .001)<br />
- Gewalttätiger Angriff durch fremde Person (z.B. körperlich angegriffen,<br />
ausgeraubt, angeschossen oder mit einer Schusswaffe bedroht werden,<br />
Stichverletzung zugefügt bekommen) (χ 2 (1, N = 135) = 26,460; p < .001)<br />
- Gefangenschaft (z.B. Strafgefangener, Kriegsgefangener, Geißel) (χ 2 (1, N = 135)<br />
= 21,838; p < .001)<br />
- Sexueller Kontakt im Alter von unter 18 Jahren mit einer Person, die<br />
mindestens 5 Jahre älter war (z.B. Kontakt mit Genitalien oder Brüsten) (χ 2 (1,<br />
N = 135) = 8,861; p < .003)<br />
- Sexueller Angriff durch fremde Person (z.B. Vergewaltigung, versuchte<br />
Vergewaltigung) (χ 2 (1, N = 135) = 4,821; p < .028)<br />
- Sexueller Angriff durch jemanden aus dem Familien- oder Bekanntenkreis<br />
(z.B. Vergewaltigung, versuchte Vergewaltigung) (χ 2 (1, N = 135) = 3,167;<br />
p < .075)<br />
- Naturkatastrophe (z.B. Wirbelsturm, Orkan, Flutkatastrophe, schweres<br />
Erdbeben) (χ 2 (1, N = 135) = 3,038; p < .081)
IV. Ergebnisse 104<br />
Nicht signifikant wurden die Unterschiede in folgenden Kategorien:<br />
- Schwerer Unfall, Feuer oder Explosion (z.B. Arbeitsunfall, Unfall in der<br />
Landwirtschaft, Autounfall, Flugzeug- oder Schiffsunglück)<br />
- Kampfeinsatz im Krieg oder Aufenthalt im Kriegsgebiet<br />
- Folter<br />
- Lebensbedrohliche Krankheit<br />
- Anderes traumatisches Ereignis<br />
17.4 Intrusionen, Vermeidung und Erregung<br />
Um zu überprüfen, ob sich die Subgruppen im Schweregrad der Symptombereiche<br />
Intrusionen, Vermeidung bzw. emotionale Taubheit und Übererregung unterscheiden<br />
wurden Mittelwertsanalysen mittels einer MANOVA durchgeführt. In diese Analyse<br />
sind nur Personen eingeflossen, die unabhängig von der Erfüllung der Kriterien einer<br />
PTBS ein belastendes Ereignis angegeben haben.<br />
Tabelle 15: Mittelwerte (und Standardabweichungen) der Intrusionen,<br />
Vermeidung und Erregung<br />
Alkohol<br />
n = 31<br />
Intrusionen 0,6968<br />
(0,8097)<br />
Vermeidung 0,5853<br />
(0,6220)<br />
Erregung 0,9097<br />
(0,7997)<br />
Alk mit<br />
Beigeb.<br />
n = 10<br />
0,9400<br />
(0,9143)<br />
0,9571<br />
(0,8833)<br />
1,5000<br />
(0,6128)<br />
Polytoxikomane<br />
n = 38<br />
0,7776<br />
(0,8270)<br />
0,7206<br />
(0,7314)<br />
1,1250<br />
(0,9670)<br />
KG<br />
n = 27<br />
0,1556<br />
(0,2242)<br />
0,2116<br />
(0,4310)<br />
0,2667<br />
(0,4311)<br />
Sucht<br />
gesamt<br />
n = 79<br />
0,7665<br />
(0,8241)<br />
0,6974<br />
(0,7117)<br />
1,0880<br />
(0,8763)<br />
In einer MANOVA mit den festen Faktoren „Gesamtsuchtgruppe“ und<br />
„Kontrollgruppe“ und den abhängigen Variablen „Intrusion“, „Vermeidung“ und<br />
„Erregung“ zeigte der Pillai-Spur Test höchst signifikante Unterschiede F (3, 102) =<br />
7,752; p < .001 Bei der Testung der Zwischensubjekteffekte erwiesen sich alle<br />
Mittelwerte der Suchtgruppe höchst signifikant höher als die der Kontrollgruppe, mit<br />
F (3) = 14,389; p < .001 für Intrusion, mit F (3) = 11,137; p < .001 für Vermeidung und<br />
mit F (3) = 21,525; p < .001 für Erregung.<br />
Bei genauerer Differenzierung der Suchtgruppe in die Unterteilung (feste Faktoren)<br />
„Alkohol“, „Alkohol mit Beigebrauch“ sowie „Polytoxikomane“ und der
IV. Ergebnisse 105<br />
Kontrollgruppe zeigte in der MANOVA zunächst der Pillai-Spur Test höchst<br />
signifikante Unterschiede mit F (9, 100) = 2,774; p < .001 an. Der sich anschließende<br />
Bonferoni-Test zeigte folgende bedeutsame Unterschiede an:<br />
• Auf der Skala Intrusion<br />
- jeweils zwischen der Kontrollgruppe und den Subgruppen Alkohol<br />
(p < .034), Alkohol mit Beigebrauch (p < .026) und der Gruppe der<br />
Polytoxikomanen (p < .006).<br />
• Auf der Skala Vermeidung<br />
- jeweils zwischen der Kontrollgruppe und den Subgruppen Alkohol mit<br />
Beigebrauch (p < .015) und der Gruppe der Polytoxikomanen (p < .015).<br />
• Auf der Skala Erregung<br />
- jeweils zwischen der Kontrollgruppe und den Subgruppen Alkohol<br />
(p < .014), Alkohol mit Beigebrauch (p < .001) und der Gruppe der<br />
Polytoxikomanen (p < .001).<br />
Rein deskriptiv zeigt die Gruppe der Alkoholabhängigen mit Beigebrauch in allen<br />
Symptomgruppen die höchsten Werte, gefolgt von der Gruppe der Polytoxikomane<br />
und der reinen Alkoholgruppe. Die Mittelwerte der drei Skalen zwischen den<br />
einzelnen Subsuchtgruppen erwiesen sich aber im Bonferoni-Test als nicht statistisch<br />
signifikant.
V. Diskussion 106<br />
V. Diskussion<br />
Im Folgenden sollen die Ergebnisse dieser Untersuchung kritisch diskutiert und in<br />
den aktuellen Forschungskontext eingeordnet werden. Die Gliederung des nun<br />
folgenden Diskussionskapitels ergibt sich analog zur Chronologie des Ergebnis-<br />
Kapitels (IV).<br />
18. Personengebundene Störvariable<br />
Um Aussagen über die Äquivalenz der soziodemographischen Merkmale zwischen<br />
der Suchtgruppe und der Kontrollgruppe machen zu können, wurden die Gruppen<br />
bezüglich der Variablen „Alter“, „Familienstand“, „z.Zt. in Partnerschaft“<br />
„Schulbildung“ und „Berufstätigkeit“ verglichen.<br />
Für alle genannten Variablen ergab sich ein signifikanter Gruppeneffekt, lediglich im<br />
Vergleich zwischen der Gesamtsuchtgruppe und der Kontrollgruppe gab es keinen<br />
signifikanten Unterschied im Hinblick auf das Alter, die Gruppen werden deshalb<br />
diesbezüglich als vergleichbar angesehen.<br />
Für die personengebundenen Variablen „Familienstand“, „Partnerschaft“,<br />
„Schulbildung“ und „Berufstätigkeit“ zeigten sich jedoch signifikante Unterschiede<br />
in der Zusammensetzung der Gruppen. Diese Unterschiede waren derart, dass die<br />
Personen der Kontrollgruppe mit rund 84 % in einer festen Partnerschaft leben, die<br />
Personen der Suchtgruppe jedoch nur zu rund 48 %, d.h. es leben mehr als die Hälfte<br />
aller Personen der Suchtgruppe in keiner festen Partnerschaft. In der Kontrollgruppe<br />
gaben annähernd zwei Drittel der Personen an, verheiratet zu sein oder in einer<br />
eheähnlichen Gemeinschaft zu leben, im Gegensatz zur Suchtgruppe, wo nicht<br />
einmal ein Viertel der Personen angaben, verheiratet zu sein oder in einer<br />
eheähnlichen Gemeinschaft zu leben. Zudem war in der Suchtgruppe im Hinblick auf<br />
Ehescheidungen das Verhältnis umgekehrt, hier gaben in der Suchtgruppe 13,3 % an<br />
geschieden zu sein und 2,2 % in der Kontrollgruppe.<br />
Auch bezüglich der Variable „Erwerbsarbeit“ unterscheiden sich die Gruppen. In der<br />
Suchtgruppe gaben rund 51 % an erwerbslos zu sein, in der Kontrollgruppe hingegen<br />
nur rund 2 %. Ebenso gibt es signifikante Effekte bezüglich der Variable „höchster<br />
Bildungsabschluss“.
V. Diskussion 107<br />
Es zeigt sich in dieser Studie die hinlänglich bekannte allgemeine Schwierigkeit, bei<br />
klinischen Studien hinsichtlich der soziodemographischer Merkmale äquivalente<br />
Kontrollgruppen zu finden. Auf dieses Problem wird in der Literatur immer wieder<br />
hingewiesen und es bestätigt sich auch in dieser Untersuchung, dass psychiatrische<br />
Stichgruppen vermehrt einen geringeren sozioökonomischen Status, hinsichtlich<br />
Bildung, Erwerbsarbeit/Einkommen und sozialer Eingebundenheit aufweisen als<br />
unselektierte Stichgruppen aus der Gesamtpopulation. Kritisch muss angemerkt<br />
werden, dass dieser geringere sozioökonomische Status schon für sich ein vermehrtes<br />
Risiko darstellt, eine psychische/psychiatrische Auffälligkeit zu entwickeln. Eine in<br />
allen demographischen Merkmalen der Suchtgruppe äquivalente Kontrollgruppe zu<br />
bilden, ohne den relativ großen Umfang der Subsuchtgruppen einzubüssen,<br />
überstiege jedoch den Rahmen dieser Arbeit.
V. Diskussion 108<br />
19. Interpretation und Diskussion der Ergebnisse des Fragebogens zum<br />
Persönlichkeitsselbstportraits<br />
In der aktuellen Literatur zu stoffgebundenen Abhängigkeitserkrankungen und<br />
Persönlichkeitsstörungen gibt es zahlreiche empirische Untersuchungen, die zeigen,<br />
dass psychische Störungen und Substanzabhängigkeit gehäuft komorbid auftreten.<br />
Die erste Hypothese dieser Untersuchung postulierte eine extremere Ausprägung auf<br />
den 12 erhobenen Persönlichkeitsskalen des FPPs in der Suchtgruppe als in der nicht<br />
abhängigen und nicht konsumierenden Kontrollgruppe. Oldham und Morris fassen<br />
eine höhere Stilausprägung als Tendenzen zu Persönlichkeitsstörungen auf, die sich<br />
in unflexiblerem Verhalten in den sechs Schlüsselbereichen des Lebens (Kap. 13.4)<br />
zeigen.<br />
Diese erste Hypothese konnte gemäß der Theorie bestätigt werden, die Auswertung<br />
des FPPs ergab eine höhere Ausprägung der Mittelwerte über alle einzelnen Stile in<br />
der Gesamtsuchtgruppe, mit Ausnahme der Skala „gewissenhaft“, auf der sich die<br />
Mittelwerte nicht signifikant unterschieden. Zu einem ähnlichen Ergebnis kam<br />
Reinert (2005). Warum sich die Gruppen gerade und nur in der Skala „gewissenhaft“<br />
nicht unterscheiden bedarf weiterer Forschung.<br />
Bei der Interpretation von Mittelwerten ist generell zu beachten, dass allein aufgrund<br />
der durchgeführten MANOVA noch keine Aussage darüber getroffen werden kann,<br />
ob bei einzelnen Personen Stile so stark ausgeprägt sind, dass von einer Störung<br />
gesprochen werden kann. Zu berücksichtigen ist ferner, dass der FPP im engeren<br />
Sinne nicht zur Diagnostik von Persönlichkeitsstörungen entwickelt wurde. Bei<br />
genauerer Analyse der Rohwerte zu der Skala „gewissenhaft“, die in extremerer<br />
Ausprägung eine Persönlichkeitstörung (Zwang) darstellt, fällt jedoch auf, dass der<br />
von Schöttke (2007; mündliche Mitteilung) für solch eine zwanghafte<br />
Persönlichkeitsstörung postulierte Cut-off-Wert von keiner Person der<br />
Kontrollgruppe, aber von 5 Personen der Suchtgruppe überschritten wurde.<br />
Nach Dilling et al. (2005) umfassen die spezifischen Persönlichkeitsstörungen „tief<br />
verwurzelte, anhaltende Verhaltensmuster, die sich in starren Reaktionen auf<br />
unterschiedliche persönliche und soziale Lebenslagen zeigen“ (S. 255). Auch<br />
Oldham und Morris (1992a) sehen eine höhere Stilausprägung einhergehend mit<br />
unflexibleres Verhalten in den sechs von ihnen postulierten Schlüsselbereichen des<br />
Lebens (vgl. Kap. 13.4). Solche starren Reaktionen und unflexibles Verhalten in<br />
persönlichen und sozialen Lebenslagen lassen sich auch mit einer Substanzstörung
V. Diskussion 109<br />
erklären, bei der zunehmend das Suchtmittel im Fokus der Aufmerksamkeit steht und<br />
als vornehmlicher Bewältigungsversuch fungiert (vgl. Kap. 1.4).<br />
Oldham und Morris (1992a) postulieren aufgrund klinischer Beobachtung, dass die<br />
Personen mit extremerer Ausprägung des „abenteuerlichen“, des „sprunghaften“ und<br />
des „lässigen“ Persönlichkeitsstils besonders gefährdet seien, eine Substanzstörung<br />
zu entwickeln. Auch in dieser Untersuchung zeigten sich hoch signifikant höhere<br />
mittlere Stilausprägungen dieser drei Stile in der Gesamtsuchtgruppe als in der<br />
Kontrollgruppe. Ebenso bestätigte sich auch die zweite Hypothese dieser<br />
Untersuchung, die insbesondere für den „abenteuerlichen“ (antisozialen) und<br />
„sprunghaften“ (Borderline-) Persönlichkeitsstil signifikante Unterschiede erwartete.<br />
Diese Untersuchung scheint somit, vorsichtig interpretiert, die Tendenz zu<br />
bestätigen, dass Personen, die die Kriterien einer Borderline-Persönlichkeitsstörung<br />
oder die einer antisozialen Persönlichkeitsstörung erfüllen, ein vermehrtes Risiko<br />
haben, eine Substanzabhängigkeit zu entwickeln (vgl. Kap. 9.1 und Kap. 9.2).<br />
Für die Ätiologie der Borderline-Persönlichkeitsstörung wird in der aktuellen<br />
Forschungsliteratur u.a. vermehrte traumatische Erfahrungen angeführt. Die<br />
Substanzabhängigkeit könnte in diesem Kontext als Affektabwehr (Wurmser, 1983)<br />
oder als Selbstmedikation (Khantzian 1997) angesehen werden (vgl. Kap. 1.4.5 und<br />
Kap. 10.3.1).<br />
Im Hinblick auf den abenteuerlichen (antisozialen) Stil und Substanzstörung bleibt<br />
festzuhalten, dass schon der Konsum illegaler Drogen ein deviantes Verhalten<br />
darstellt. Die Finanzierung und Beschaffung dieser illegalen Drogen erfolgt häufig<br />
durch kriminelles und schon per definitionem antisoziales Verhalten. Die große Zahl<br />
der Personen mit Gefängniserfahrung (siehe Tab. 13) in der Gruppe der<br />
Polytoxikomanen spiegelt diesen Sachverhalt wider.<br />
Personen, die die Kriterien einer antisozialen Persönlichkeitsstörung erfüllen,<br />
berichten gehäuft von (kindlichen) traumatischen Gewalterfahrungen in der Familie.<br />
So könnte auch hier der Substanzkonsum als ein Selbstmedikationsversuch<br />
verstanden werden.<br />
Die signifikanten Unterschiede zwischen der Gesamtsuchtgruppe und der<br />
Kontrollgruppe auf der Skala „wachsam“ (paranoid) können dahingehend erklärt<br />
werden, dass eine vermehrte Wachsamkeit und paranoide Gedanken mit einer<br />
erhöhten Ängstlichkeit und Unruhe einhergehen, die mit dem Suchtmittel<br />
eingedämmt werden sollen (vgl. Khantzian, 1997). Die höchst signifikanten
V. Diskussion 110<br />
Häufigkeitsunterschiede bezüglich eines Verdachts auf einer paranoiden<br />
Persönlichkeitsstörung (siehe Tabelle 4), gemessen am Überschreiten des Cut-off-<br />
Werts (Schöttke, 2007; persönl. Mitteilung) scheinen diese Erklärung zu belegen,<br />
wenngleich die Ergebnisse unter Vorbehalt stehen, da die Cut-off-Werte noch nicht<br />
abschließend validiert wurden.<br />
Für die höhere Ausprägung in der Suchtgruppe auf der Skala „ungesellig“ (schizoid)<br />
kann angenommen werden, dass das Suchtmittel die Funktion der<br />
Beziehungsvermeidung einnimmt (siehe Kap. 7.2).<br />
Die signifikanten Gruppenunterschiede im exzentrischen (schizotypischen),<br />
dramatischen (histrionischen), selbstbewussten (narzisstischen) Persönlichkeitsstils<br />
lassen sich mit kompensatorischem Suchtverhalten erklären. Die Person fühlt sich in<br />
ihrer Bedeutung von anderen verkannt. Der Konsum stellt somit auch ein<br />
Selbstheilungsversuch dar.<br />
Für die signifikant höheren Ausprägungen im sensiblen (selbstunsicheren) und<br />
abhängigen (dependenten) Persönlichkeitsstil der Suchtgruppe lässt sich zum einen<br />
die Selbstachtungstheorie von Kaplan (1983) heranziehen. Personen mit diesen<br />
extremen Ausprägungen brauchen andere (abhängiger Persönlichkeitsstil) um<br />
Verantwortung zu übernehmen oder sie vermeiden z.B. berufliche Aktivitäten<br />
(selbstunsicherer Stil) aus Angst vor Kritik. Sie verfügen über nur ein geringes<br />
Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen und sind vermehrt von Anerkennung anderer<br />
abhängig. Sie erfahren über den Konsum von Alkohol oder Drogen in<br />
konsumierenden Gruppen ein sicherheitsvermittelndes Zusammengehörigkeitsgefühl<br />
und können sich zugleich von diesen schlechter abgrenzen. Zum anderen kann auch<br />
hier die Selbstmedikationshypothese von Khantzian (1997) herangezogen werden.<br />
Fehlen solche Sicherheit vermittelnden Andere, können die unangenehmen Gefühle<br />
durch das Suchtmittel behoben werden.<br />
Millon und Davis (1996) sehen Interaktionsstörungen als einen grundlegenden<br />
Faktor einer Persönlichkeitsstörung an. Zahlreiche Autoren (vgl. Tretter & Müller,<br />
2001 und Kap. 1.4.5.1) konstatieren „Selbstwert-Regulationskrisen“ vor dem<br />
Hintergrund eines Abhängigkeits-Autonomiekonfliktes bei suchtkranken Menschen,<br />
die sich in Beziehungsstörungen ausdrücken. Auch vor diesem Hintergrund waren<br />
größere Ausprägungen über alle Stile zu erwarten.<br />
In dieser Erhebung zeigten sich nicht nur die Mittelwerte aller Persönlichkeitsstile<br />
der Gesamtsuchtgruppe gegenüber der Kontrollgruppe signifikant erhöht. Erste
V. Diskussion 111<br />
Ergebnisse mit den zu dem FPP noch in der Entwicklungsphase befindenden Cut-<br />
Off-Werten, die die Grenze vom Persönlichkeitsstil zur Persönlichkeitsstörung<br />
markieren (Schöttke, 2007; persönliche Mitteilung) weisen auf eine 50 %- Rate<br />
komorbider Persönlichkeitsstörungen in der Suchtpopulation hin. Dabei handelt es<br />
sich um „Verdachtsdiagnosen“, die z.B. mit dem SKID II zu überprüfen sind. In<br />
diesem Feld ist weitere Forschung notwendig.
V. Diskussion 112<br />
20. Interpretation und Diskussion der Ergebnisse zu den<br />
Bindungsspezifischen Bindungsskalen für Erwachsene<br />
20.1 Dauer der Partnerschaft<br />
Die mittlere Partnerschaftsdauer bei bestehenden Partnerschaften ist in der<br />
Gesamtsuchtgruppe mit einem Unterschied von mehr als 6 Jahren signifikant<br />
geringer als in der Kontrollgruppe (bei gleichem mittlerem Lebensalter). Dies könnte<br />
damit erklärt werden, dass die Partnerschaften der Suchtgruppe neben schlechteren<br />
sozioökonomischen Vorraussetzungen aufgrund der Sucht stärker belastet sind und<br />
aufgrund dessen nicht in dem Maße Bestand haben, wie die Partnerschaften der<br />
Kontrollgruppe. Auffällig ist auch, dass bei aufgeschlüsselter Betrachtung der<br />
einzelnen Suchtgruppen die Dauer der bestehenden Partnerschaften proportional zu<br />
der Schwere der Abhängigkeit, gemessen an dem Suchtpotential des Suchtmittels,<br />
abnimmt. Die im Mittel längsten Partnerschaften weisen die Personen der<br />
Kontrollgruppe auf, gefolgt von der Gruppe der Alkoholabhängigen und gefolgt von<br />
den Alkoholabhängigen mit Beigebrauch. Die im Mittel kürzeste Zeit bestehen die<br />
Partnerschaften in der Gruppe der Polytoxikomanen, die das größte Suchtpotential<br />
aufweist. Zu beachten ist, dass aufgrund unterschiedlicher Stichprobenumfänge<br />
statistisch hierbei nur die Unterschiede zwischen der Gesamtsuchtgruppe und der<br />
Kontrollgruppe, zwischen der Kontrollgruppe und der Gruppe der Polytoxikomanen<br />
und zwischen der Alkoholgruppe und der Gruppe der Polytoxikomanen signifikant<br />
wurden.<br />
Standen die Personen zum Zeitpunkt der Datenerhebung in keiner festen<br />
Partnerschaft, konnten bezüglich der Dauer der letzten bestehenden Partnerschaft<br />
zwischen der Gesamtsuchtgruppe und der Kontrollgruppe keine signifikanten<br />
Unterschiede ausgemacht werden. Das Fehlen einer festen Partnerschaft ließe sich<br />
unabhängig einer Substanzstörung mit Defiziten in der Beziehungsaufnahme<br />
erklären, die z.B. durch einen unsicheren Bindungsstil begünstigt werden.<br />
20.2 Mittelwertvergleiche und Gruppenunterschiede der Bindungsskalen<br />
In den letzten Jahren hat in der Forschungsliteratur die Bindungstheorie zunehmend<br />
Beachtung gefunden. Es werden Zusammenhänge zwischen stabilen und<br />
angemessenen (frühkindlichen) Beziehungserfahrungen und einer sicheren Bindung<br />
mit einer gefestigten Persönlichkeitsbildung und psychosozialer Gesundheit vermutet<br />
(siehe Kap.4).
V. Diskussion 113<br />
In dieser Untersuchung wurden vermehrt unsicher gebundene in der Suchtgruppe<br />
erwartet. Die Mittelwertsvergleiche der Beziehungsspezifischen Bindungsskalen<br />
erbrachten im Post-Hoc-Test in der Bindung zur Mutter zwischen der sicherer<br />
gebundenen Kontrollgruppe und der auf der Dimension „sicher-ängstlich“ geringer<br />
ausgeprägten sicheren Bindung der Subsuchtgruppe der Alkoholabhängigen mit<br />
Beigebrauch einen signifikanten Unterschied. Ebenfalls unterschieden sich<br />
signifikant die Subsuchtgruppe „Alkohol“, die sicherer gebunden war, und die<br />
Subsuchtgruppe „Alkohol mit Beigebrauch“. Ebenfalls gab es einen signifikanten<br />
Unterschied zwischen der Subsuchtgruppe der Polytoxikomanen, die sicherer<br />
gebunden war als die Subsuchtgruppe „Alkohol mit Beigebrauch“. Es ist auffällig,<br />
dass die Gruppe der Alkoholabhängigen mit Beigebrauch die auf der Dimension<br />
„sicher-ängstlich“ im Bezug zur Mutter geringsten Werte (2,8) aufweist und damit<br />
auf dieser Dimension eine mittlere Position einnimmt, im Unterschied zu allen<br />
anderen Subgruppen, die eher dem sicheren Pol dieser Dimension zuzuordnen sind.<br />
Auf der Dimension „abhängig-unabhängig“ in der Bindung zur Mutter zeigte sich<br />
nur ein signifikanter Unterschied zwischen der Kontrollgruppe und der<br />
Subsuchtgruppe der Polytoxikomanen. Die Kontrollgruppe ist somit bei einem Wert<br />
von rund 1,5 noch ein wenig unabhängiger von der Mutter ist als die Gruppe der<br />
Polytoxikomanen. Dies könnte darauf zurückzuführen sein, dass die Personen der<br />
Kontrollgruppe abgelöster von der Mutter sind – bedenkt man, dass mehr als 60 % in<br />
der Kontrollgruppe verheiratet oder in einer eheähnlichen Gemeinschaft leben. In der<br />
Gruppe der Polytoxikomanen finden sich hier lediglich rund 18 %.<br />
Die Erfassung der beiden Bindungsdimensionen im Bezug zum Partner ergab in der<br />
MANOVA keine signifikanten Unterschiede zwischen den Gruppen.<br />
Diese – wenn überhaupt – nur gering vorhandenen Unterschiede waren nicht<br />
vermutet worden und überraschen (siehe Kap. 7.1). Zwar zeigte nominal die nicht<br />
konsumierende Kontrollgruppe jeweils den höchsten Wert bezüglich einer sicheren<br />
Bindung sowohl im Bezug zur Mutter als auch zum Partner, doch sind die<br />
Unterschiede nicht bedeutsam. Auch die Suchtgruppen zeigen mit Ausnahme der<br />
Subsuchtgruppe „Alkohol mit Beigebrauch“ in der Bindung zur Mutter eine im<br />
Mittel sichere Bindung.<br />
Diese Ergebnisse decken sich nicht mit den in der Forschungsliteratur vorgefundenen<br />
Ergebnissen, die zumeist von einer deutlich höheren Zahl unsicher gebundener in<br />
klinischen Stichproben berichten. Die dritte Hypothese kann somit in dieser
V. Diskussion 114<br />
Untersuchung nicht bestätigt werden. Die Reliabilitätsberechnungen (siehe Kap.<br />
16.4) der Skala „sicher-ängstlich“ im Bezug zur Mutter ergaben mit α = ,827 und für<br />
die Skala „abhängig-unabhängig“ mit α = ,754 gute Reliabilitätsquotienten, die auch<br />
mit den von Asendorpf et al. (1997) berichteten übereinstimmen. Jedoch können die<br />
Reliabilitätsquotienten der beiden Dimensionen im Hinblick auf den Partner nicht<br />
überzeugen. Es ist kritisch zu hinterfragen, ob das Bindungsverhalten hier präzise<br />
mittels Fragebogenverfahren abgebildet werden konnte. Vielleicht aktiviert solches<br />
theoretische Abfragen in einer Situation, wie im Kapitel 12.3 beschrieben, das<br />
Bindungssystem zu wenig und die Fragen werden eher im Sinne einer sozialen<br />
Erwünschtheit beantwortet. Dann gäben sie eher das Selbstbild des Befragten denn<br />
sein tatsächliches Bindungsverhalten wieder.<br />
20.3 Bindung bei Extrempersönlichkeiten<br />
Um der Frage nachzugehen, ob sich die Personen mit einer stärkeren<br />
Persönlichkeitsstilausprägung hinsichtlich ihrer Bindung von den Personen mit<br />
unauffälliger Stilausprägung unterscheiden, wurden aus allen<br />
Untersuchungsteilnehmern zwei Gruppen gebildet. Die eine Gruppe der<br />
„Extrempersönlichkeiten“ setzte sich aus allen Personen zusammen, die in<br />
mindestens einem Persönlichkeitsstil die von Schöttke (2007; persönl. Mitteilung) in<br />
laufendem Forschungsprojekt entwickelten Cut-off-Werte überschritten haben (für<br />
den aufopfernden und den ungeselligen Stil wurde der Cut-off-Wert 13 beibehalten).<br />
Die andere Gruppe bildeten die Personen, die in keinem Stil diese Werte<br />
überschritten (unauffällig ausgeprägter Persönlichkeitsstil). In der Bindung zur<br />
Mutter zeigten sich die Extrempersönlichkeiten signifikant weniger sicher auf der<br />
Skala „sicher – ängstlich“ und signifikant abhängiger auf der Skala „abhängig -<br />
unabhängig“ als die Gruppe mit dem unauffällig ausgeprägten Persönlichkeitsstil.<br />
Auch in der Bindung zum Partner zeigte sich die Gruppe der unauffällig<br />
ausgeprägten signifikant sicherer als die der Extrempersönlichkeiten. Auf der Skala<br />
„abhängig-unabhängig“ unterschieden sich die Gruppen, allerdings nur nominal,<br />
nicht statistisch signifikant. Diese Ergebnisse decken sich mit dem in der Forschung<br />
gemeinhin berichteten Trend (siehe Kap. 7.1), die vierte Hypothese kann im<br />
Wesentlichen bestätigt werden.
V. Diskussion 115<br />
21. Interpretation und Diskussion der Ergebnisse der Posttraumatischen<br />
Diagnoseskala<br />
Umfassende Störungen der Persönlichkeit zählen zu den gesicherten Langzeitfolgen<br />
gravierender und lang anhaltender Traumatisierungen durch körperliche oder<br />
sexuelle Gewalt (siehe Kap. 8.1). Es wird ein bedeutsamer, aber bislang noch<br />
gemeinhin im Suchthilfesystem vernachlässigter Überlappungsbereich von<br />
Posttraumatischer Belastungsstörung und Substanzabhängigkeit vermutet (siehe<br />
Kap. 9).<br />
21.1 Posttraumatische Belastungsstörung<br />
So zeigten sich in dieser Untersuchung die Raten einer Posttraumatischen<br />
Belastungsstörung im Vergleich zur nicht konsumierenden und nicht an einer<br />
Substanzstörung erkrankten Kontrollgruppe signifikant erhöht. In der<br />
Gesamtsuchtgruppe erfüllten fast ein Viertel aller Personen die Kriterien einer<br />
Posttraumatischen Belastungsstörung nach DSM-IV, im Vergleich dazu waren es in<br />
der Kontrollgruppe lediglich rund 2 %. Es bestätigt sich somit auch die fünfte<br />
Hypothese, die ein signifikant erhöhtes Vorkommen in der Suchtstichprobe erwartet.<br />
Dies ist insofern ein bedeutsames Ergebnis, da bislang in den Suchthilfe-<br />
Einrichtungen diese Tatsache unterschätzt und insofern nicht systematisch erhoben<br />
wird. In Gesprächen mit Psychologen und Ärzten zeigte sich, dass vielerorts keine<br />
systematische Erhebung zum Vorliegen einer Posttraumatischen Belastungsstörung<br />
erfolgt. Das Ergebnis dieser Untersuchung bestätigt den hohen Anteil von Personen<br />
mit Posttraumatischer Belastungsstörungen in Populationen mit Substanzstörungen<br />
und unterstreicht die Notwendigkeit, dieses Faktum mit in die Therapie der<br />
Substanzstörungen einzubeziehen.<br />
Bei differenzierter Betrachtung fällt auf, dass in der Gruppe der Alkoholabhängigen<br />
mit Beigebrauch mit 40 % die höchsten Raten einer PTB aufzufinden sind, gefolgt<br />
von der Gruppe der Polytoxikomanen mit 27,5 % und der Gruppe der<br />
Alkoholabhängigen mit 15 %. Dieses Ergebnis steht im Einklang mit den von<br />
Teegen und Zumbeck (2000) erhobenen epidemiologischen Daten (siehe Kap. 10.1).<br />
Dieses Ergebnis bestätigt ebenso Befunde, die einen Zusammenhang zwischen einer<br />
Posttraumatischen Belastungsstörung und der Borderline-Persönlichkeitsstörung<br />
postulieren (siehe Kap. 8.1). Die Gruppe der Alkoholabhängigen mit Beigebrauch
V. Diskussion 116<br />
weisen auch auf der Skala „sprunghaft“ (Borderline Persönlichkeitsstörung) des<br />
FPPs die höchsten Absolutwerte über allen Stilen und Subgruppen auf (siehe<br />
Kap.15.1).<br />
21.2 Unterschiedliche traumatische Ereignisse<br />
In dem PDS-Fragebogen sind 11 Kategorien von traumatischen Ereignissen<br />
vorgegeben (siehe Anhang E). Auch hier gab es in der Anzahl der als zutreffend<br />
angekreuzten Kategorien einen signifikanten Unterschied zwischen der<br />
Gesamtsuchtgruppe, die im Mittelwert 3,1 Kategorien als zutreffend ankreuzten, und<br />
der Kontrollgruppe, die im Mittel eine Kategorie als zutreffend ankreuzte. Ebenso<br />
unterschieden sich alle Subgruppen in der mit zutreffend bewerteten Anzahl der<br />
einzelnen „Trauma-Kategorien“ des PDS von der Kontrollgruppe. Zudem zeigte sich<br />
auch ein signifikanter Unterschied zwischen der Alkohol-Gruppe (2,4 Kategorien)<br />
und der Gruppe der Polytoxikomanen (3,8 Kategorien). Wenn man die größere<br />
Anzahl der Kategorien dahingehend wertet, häufiger (unterschiedlichen) Gefahren<br />
ausgesetzt worden zu sein, sind die Personen der Suchtgruppen häufiger in<br />
gefährliche Situationen gekommen, als die Personen der Kontrollgruppe. Dabei ist zu<br />
beachten, dass die Häufigkeitsraten der Gruppe der Polytoxikomanen die der<br />
Alkoholabhängigen übertreffen. Diese Ergebnisse können vorsichtig als Bestätigung<br />
der Risikohypothese von Chilcoat und Breslau (1998) interpretiert werden, die<br />
besagt, dass sich Personen mit Substanzstörungen eher in Situationen begeben, die<br />
die Gefahr, eine traumatische Erfahrung zu machen, erhöhen (siehe Kap. 10.3.2).<br />
21.3 Spezifische traumatische Erfahrungen<br />
Es konnte gezeigt werden, dass in allen Kategorien, mit Ausnahme der Kategorie<br />
„Lebensbedrohliche Krankheit“, die Suchtgruppe zumeist deutlich höhere<br />
Prozentzahlen aufweist als die Kontrollgruppe (vgl. Tab. 13). Beide Gruppen weisen<br />
den höchsten Prozentsatz in der Kategorie „Lebensbedrohliche Krankheit“ auf<br />
(Sucht: 72,2 %; KG: 84,4 %) Dabei geht aus dem verwandten Fragebogen nicht<br />
hervorgeht, ob die Teilnehmer selbst erkrankt waren, oder eine Krankheit anderer<br />
gemeint ist, die sie tangiert hat. Der Fragebogen fragt nach selbst erfahrenen, oder als<br />
Zeuge erlebte Ereignisse. Beide Gruppen weisen ebenso hohe Prozentwerte in der
V. Diskussion 117<br />
Kategorie „schwerer Unfall etc.“ (Sucht: 51,1 %; KG: 37,8 %) auf. Diese<br />
Unterschiede sind jedoch nicht signifikant und scheinen keine gruppenspezifischen<br />
Erfahrungen zu sein. Hoch signifikante Unterschiede zeigten sich in den Kategorien<br />
„Gewalttätiger Angriff durch fremde Person“ (Sucht: 60 %; KG: 13,3 %),<br />
„Gewalttätiger Angriff durch jemanden aus dem Familien- oder Bekanntenkreis“<br />
(Sucht: 43,3 %; KG: 8,9 %) und „Gefangenschaft“ (Sucht: 36,7 %; KG: 0 %). Diese<br />
drei Kategorien scheinen gruppenspezifische traumatische Erfahrungen darzustellen.<br />
Diese Ergebnisse stehen im Einklang mit der Risikohypothese von Chilcoat und<br />
Breslau (1998). Es zeigt aber auch die Bedeutung des familiären Kontextes für die<br />
Entwicklung und Aufrechterhaltung psychologisch/psychiatrischer Störungen wie<br />
Substanzstörungen, Persönlichkeitsstörungen und Posttraumatischer Belastungsstörungen<br />
auf (siehe Kap. 1.4.4).Es kann somit die sechste Hypothese dieser<br />
Untersuchung als bestätigt angesehen werden, die postuliert, dass spezifische<br />
Traumaerfahrungen in der Suchtgruppe erkennbar sind.<br />
21.4 Intrusionen, Vermeidung und Erregung<br />
Die durchgeführten Analysen bezüglich der Intrusionen, Vermeidung und<br />
psychophysiologische Erregung zeigten höchst signifikant höhere Mittelwerte pro<br />
Symptomgruppe in der Suchtgruppe gegenüber der Kontrollgruppe. Somit konnte<br />
auch die siebte Hypothese bestätigt werden, die erhöhte Werte in der Suchtgruppe<br />
erwartete. Dieses Ergebnis kann mit der Vulnerabilitätshypothese erklärt werden, die<br />
besagt, dass der Substanzkonsum v.a. die Symptome Wiedererleben und erhöhtes<br />
Erregungsniveau verstärkt, indem er eine kognitiv-emotionale Verarbeitung des<br />
belastenden Ereignisses verhindert (siehe Kap. 10.3.3).
VI. Zusammenfassung 118<br />
VI. Zusammenfassung<br />
Es gibt eine Vielzahl unterschiedlicher, oft schulengebundener und unverbunden<br />
nebeneinander stehende Betrachtungsweisen des Suchtverhaltens. Eine einheitliche<br />
konzeptübergreifende Theorie gibt es bislang nicht. Allgemein anerkannt ist, dass die<br />
Substanzabhängigkeit ein nicht lineares multikausales Bedingungsgefüge darstellt.<br />
In dieser Arbeit wurde der Einfluss extremer Persönlichkeitsstile, des<br />
Bindungsverhaltens und traumatischer Erfahrungen, die das Bewältigungsvermögen<br />
einzelner übersteigen, auf die Manifestation einer Substanzabhängigkeit diskutiert.<br />
In biologischen Theorien sind Persönlichkeitsstörungen u.a. von genetischen<br />
Faktoren, insbesondere Temperamente (i.S. von Verhaltensdispositionen), aber auch<br />
Umweltfaktoren und sozialem Lernen beeinflusst. In neueren Theorien wird der<br />
biosoziale Aspekt i.S. eines Misfits von biologischer Ausstattung und<br />
Umweltbedingungen, der sich in interpersonellen Interaktionen manifestiert, betont.<br />
(Früh-)kindliche Interaktionserfahrungen determinieren auch im Wesentlichen die<br />
Bindung des Kindes zu seinen primären Bezugspersonen und haben einen starken<br />
Einfluss auf die Selbst- und Weltsicht. Eine sichere Bindung zeigt sich unspezifisch<br />
protektiv vor psychischen Krankheiten. In klinisch auffälligen Stichproben finden<br />
sich vermehrt unsicher Gebundene.<br />
Ebenso zählen umfassende Störungen der Persönlichkeit zu den gesicherten<br />
Langzeitfolgen gravierender und lang anhaltender Traumatisierungen durch<br />
körperliche oder sexuelle Gewalt. Die Wahrscheinlichkeit, an einer<br />
Persönlichkeitsstörung zu erkranken, ist signifikant erhöht, wenn in der<br />
Vorgeschichte Gewalt oder sexuelle Übergriffe berichtet wurden.<br />
Aufgrund hoher Komorbiditätsraten von Persönlichkeitsstörungen, Posttraumatischer<br />
Belastungsstörungen und unsicherer Bindung mit Substanzstörungen wird zwischen<br />
diesen Faktoren ein multikausaler Zusammenhang vermutet. Als die in diesem<br />
Zusammenhang meistgenannten Theorien sind neben dem Diathese-Stress-Modell<br />
die Selbstmedikationstheorie (Khantzian, 1997), die Selbstachtungstheorie von<br />
Kaplan (1983) und die Vulnerabilitätstheorie (Kushner et al., 1990) zu nennen.<br />
Gesicherte empirische Beweise der Kausalbeziehung stehen jedoch noch immer aus.<br />
Ungeachtet dessen sind diese Faktoren von immenser Bedeutung für das Verständnis<br />
und die Therapie von Substanzstörungen. Die Ergebnisse der vorliegenden
VI. Zusammenfassung 119<br />
Untersuchung, die die einzelnen Subgruppen bezüglich ihrer Persönlichkeitsstile,<br />
Bindung und traumatischer Erfahrungen verglich, unterstreichen ebenfalls die große<br />
Bedeutung der Persönlichkeitsstörungen und Posttraumatischer Belastungsstörungen<br />
in der Suchtpopulation.<br />
Die untersuchte Suchtgruppe teilte sich in ausschließlich Alkoholabhängige,<br />
Alkoholabhängige mit Beigebrauch und eine Gruppe mit polyvalentem<br />
Substanzkonsum und wurde einer nicht substanzabhängigen Kontrollgruppe<br />
gegenübergestellt.<br />
Es wurde angenommen, dass im Vergleich zur Kontrollgruppe in der<br />
Suchtpopulation extremere Persönlichkeitsstilausprägungen bestehen, sich die<br />
Suchtgruppe aufgrund unsicherer Bindung von der Kontrollgruppe unterscheidet und<br />
im Vergleich zur Kontrollgruppe höhere Raten von Posttraumatischen<br />
Belastungsstörungen und damit einhergehend höhere Werte von Intrusionen,<br />
Vermeidung und psychophysiologischer Erregung zu finden sind. Im wesentlichen<br />
konnten alle Hypothesen bestätigt werden, lediglich der vermutete<br />
Bindungsunterschied bestätigte sich in dieser Untersuchung nicht.<br />
Dabei unterschieden sich die Subsuchtgruppen teilweise im Ausmaß der<br />
Beeinträchtigungen, wobei die Gruppe der Alkoholabhängigen mit Beigebrauch zum<br />
Teil größere Beeinträchtigungen als die Gruppe der Polytoxikomanen zeigte. Da es<br />
insbesondere zu dieser Substanzgruppe der Alkoholabhängigen mit Beigebrauch<br />
bislang nur sehr wenige empirische Studien gibt, wären hier weitere Forschungen<br />
wünschenswert.<br />
Insgesamt unterstreichen die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung die<br />
Bedeutung von Persönlichkeits- und Posttraumatischer Belastungsstörungen für die<br />
Entstehung und Aufrechterhaltung der Substanzstörung. Das gewählte<br />
Untersuchungsdesign lässt jedoch keine Kausalaussagen zu.
VII. Literaturverzeichnis 120<br />
VII. Literaturverzeichnis<br />
Abraham, K. (1924/1969). Beiträge der Oralerotik zur Charakterbildung. In: K.<br />
Abraham (Hrsg.), Psychoanalytische Studien zur Charakterbildung und andere<br />
Schriften. Frankfurt/M.: Fischer. 205-217.<br />
Ainsworth, M.D.S. (1973). The development of infant-mother attachment. In: B.M.<br />
Caldwell & H.N. Ricutti (Hrsg.). Review of child development research, Vol.3.<br />
Chicago: University of Chicago Press.1-94.<br />
Ainsworth, M.D.S., Blehar, M.C., Waters, E. & Wall, S. (1978). Patterns of<br />
attachment. A psychological study of the strange situation. Hillsdale, NJ: Erlbaum.<br />
American Psychiatric Association (APA) (2003). Diagnostisches und Statistisches<br />
Manual Psychischer Störungen -Textrevision- DSM-IV-TR. Deutsche Bearbeitung<br />
und Einführung von Henning Saß, Hans-Ulrich Wittchen, Michael Zaudig und Isabel<br />
Houben. Göttingen: Hogrefe.<br />
Asendorpf, J.B., Banse, R., Wilpers, S. & Neyer, F.J. (1997). Beziehungsspezifische<br />
Bindungsskalen für Erwachsene und ihre Validierung durch Netzwerk- und<br />
Tagebuchverfahren. Diagnostica, 43, 289-313.<br />
Augustin, R. & Kraus, L. (2005). Alkoholkonsum, alkoholbezogene Probleme und<br />
Trends. Ergebnisse des Epidemiologischen Suchtsurvey 2003. Sucht, 51, 29-39.<br />
Bätzing, Sabine (Beauftragte der Bundesregierung, Hrsg.) (2007). Drogenbericht<br />
2006. Berlin: Publikationsversand der Bundesregierung.<br />
Baldwin, M.W, Keelan, J.P.R., Fehr, B., Enns, V. & Koh-Rangarajoo, E. (1996).<br />
Social-cognitive conzeptualization of attachment working models. Availability and<br />
accessibility effects. Journal of Personality and Social Psychology, 71, 94-109.<br />
Bandura, A. (1977). Social learning theory. Ingelwood Cliffs: Prentice Hall.
VII. Literaturverzeichnis 121<br />
Bartholomew, K. (1990). Avoidance of intimacy. An attachment perspective.<br />
Journal of Social and personal Relationships, 7, 147-178.<br />
Bartholomew, K. (1997). Adult attachment process. Individual and couple<br />
perspectives. British Journal of Medical Psychology, 70, 3, 249-263.<br />
Beck, A.T., Freeman, A. & Associates (1990). Cognitive therapy of personality<br />
disorders. New York: Guildfort Press. Dt.: (1993). Kognitive Therapie der<br />
Persönlichkeitsstörungen. Weinheim: Psychologie Verlags Union.<br />
Beck, A.T., Wright, F.D.; Newman, C.F. & Liese, B.S. (1997). Kognitive Therapie<br />
der Sucht. Weinheim: Beltz.<br />
Brähler, E., Holling, H. Leutner, D. & Petermann, F. (Hrsg.) (2002). Brickenkamp<br />
Handbuch psychologischer und pädagogischer Tests. Bd.1, Göttingen: Hogrefe.<br />
Brisch, K.H. (1999). Bindungsstörungen. Von der Bindungstheorie zur Therapie.<br />
Stuttgart: Klett-Cotta.<br />
Brisch, K.H., Grossmann, K.E, Grossmann, K. & Köhler, L. (Hrsg.) (2002).Bindung<br />
und seelische Entwicklungswege. Grundlagen, Prävention und klinische Praxis.<br />
Stuttgart: Klett-Cotta.<br />
Bortz, J. (1999). Statistik für Sozialwissenschaftler. Berlin: Springer.<br />
Bowlby, J. (1969). Attachment and loss. Vol.1: Attachment. New York: Basic Books.<br />
Bowlby, J. (1973). Attachment and loss. Vol. 2: Separation: Anxiety and Anger. New<br />
York: Basic Books (deutsch: 1976: Trennung. München: Kindler).<br />
Bowlby, J. (1989). Bindung: Historische Wurzeln, theoretische Konzepte und<br />
klinische Relevanz. In: G. Spangler & P. Zimmermann (Hrsg.) (2002). Die<br />
Bindungstheorie. Grundlagen, Forschung und Anwendung. Stuttgart: Klett-Cotta.
VII. Literaturverzeichnis 122<br />
Chilcoat, H.D. & Breslau, N. (1998). Posttraumatic Stress Disorder and Drug<br />
Disorders. Testing Causal Pathways, Archives of General Psychiatry, 55, 913-917.<br />
Diehl, J.M., Staufenbiel, T. (2002). Statistik mit SPSS, Version 10 + 11. Eschborn:<br />
Dietmar Klotz.<br />
Dilling, H., Mombour, W. & Schmidt, M.H. (2005). Internationale Klassifikation<br />
psychischer Störungen. ICD-10 Kapitel V (F). Klinisch-diagnostische Leitlinien. 5.<br />
durchgesehene und ergänzte Auflage unter Berücksichtigung der Änderungen<br />
entsprechend ICD-10-GM 2004/2005. Göttingen: Hans Huber.<br />
Egle, U.T., Hardt, J., Nickel, R., Kappis, B., Hoffmann, S.O. (2002). Früher Stress<br />
und Langzeitfolgen für die Gesundheit - Wissenschaftlicher Erkenntnisstand und<br />
Forschungsdesiderate. Zeitschrift für Psychosomatik und Medizinische<br />
Psychotherapie, 48, 441-434.<br />
Ehlers, A, Steil, R., Winter, H. & Foa E.B. (1996). Deutsche Übersetzung der<br />
Posttraumatic Stress Diagnostic Scale (PDS). Oxford: University, Warreford<br />
Hospital, Department of Psychiatry.<br />
Ehlers, A. (1999). Posttraumatische Belastungsstörung. Göttingen: Hogrefe.<br />
Ehlers, A. & Clark, D.M. (2000). A cognitive model of posttraumatic stress disorder.<br />
Behavior Research and Therapy, 38,4, 319-345.<br />
Ewing, J.A. (1984). Detectingalkoholism: The cage questionnaire. The Journal of the<br />
American Medical Association, 252, 1905-1907.<br />
Ferstl, F. (1991). Verhaltenstheoretische Modelle zu den Grundstörungen der Sucht.<br />
In: K. Wanke & G. Bühringer (Hrsg.), Grundstörungen der Sucht. Berlin: Springer.<br />
Feuerlein, W. (1989). Alkoholismus - Missbrauch und Abhängigkeit. Stuttgart:<br />
Thieme.
VII. Literaturverzeichnis 123<br />
Fiedler, P. (2001). Persönlichkeitsstörungen. Weinheim: Beltz, PVU.<br />
Fischer, G. & Riedesser, P. (1998). Lehrbuch der Psychotraumatologie. München:<br />
Reinhardt.<br />
Flores, P.F. (2004). Addiction as an Attachment Disorder. Lanham: Jason Aronson.<br />
Glaesener, K. (2005). Dimensionale Diagnostik von Persönlichkeitsstörungen: das<br />
Persönlichkeitsselbstportrait. Unveröffentlichte <strong>Diplomarbeit</strong>, Universität<br />
Osnabrück.<br />
Gloger-Tipelt, G. & Ullmeyer, M. (2001). Partnerschaft und Bindungsrepräsentation<br />
der Herkunftsfamilie. In: S. Walper & R. Pekrun (Hrsg.), Familie und Entwicklung.<br />
Perspektiven der Familienpsychologie. Göttingen: Hogrefe.<br />
Grossmann, K.E., Grossmann, K., Kindler, H., Scheurer-Englisch, H., Spangler, G.,<br />
Stöcker, K., Suess, G.J. & Zimmermann, P. (2003). Die Bindungstheorie: Modell:,<br />
entwicklungspsychologische Forschung und Ergebnisse. In: H. Keller (Hrsg.).<br />
Handbuch der Kleinkindforschung. Bern: Huber.<br />
Hannover, B. (1997). Das dynamische Selbst: die Kontextabhängigkeit selbstbezogenen<br />
Wissens. Bern: Huber.<br />
Harris, J.R. (1995). Where is the child´s enviroment? A group socialization theory of<br />
development. Psychological Review, 102, 458-489.<br />
Hazan, C. & Shaver, P. (1987). Conzeptualizing romantic love as an attachment<br />
process. Journal of Personality and Social Psycology, 52, 511-524.<br />
Herman, J.L. (1992). Complex PTSB. A syndrom of survivors of prolonged and<br />
repeated trauma. Journal of Traumatic Stress, 5, 377-391.
VII. Literaturverzeichnis 124<br />
Höger, D. (2005). Die psychotherapeutische Beziehung im Lichte der<br />
Bindungsforschung. In: M. Urban & H.-P. Hartmann (Hrsg.). Bindungstheorie.<br />
Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.<br />
Huber, M. (2003). Trauma und Traumabehandlung, Bd.1. Paderborn: Junfermann.<br />
Iacono,W.G., Carlson, S.R., Taylor, J., Elkins, I.J. & McGue, M. (1999). Behavioral<br />
disinhibition and the development of substance-use disorders. Findings from the<br />
Minnesota Twin Family Study. Development & Psychopathology, 11, 869-900.<br />
Jang, K.L., Livesley, W.J., Vernon, P.A. & Jackson, D.N. (1996). Heretability of<br />
personality disorder traits. a twin study. Acta Psychiatrica Scandinavica, 94, 438-<br />
444.<br />
Johann, M., Lange, K. & Wodarz, N. (2007). Psychiatrische Komorbiditäten bei<br />
Alkoholabhängigen. Psychiatrische Praxis, 34, 1, 47-48.<br />
Kanfer, F.H. & Saslow, G. (1965). Behavioral analysis: an alternative to diagnostic<br />
classification. Archives of General Psychiatry, 12, 529-538.<br />
Kaplan, H.B. (1983). Das Selbstachtungsmotiv als erklärungsvariable des<br />
Drogenkonsums. In: D.J. Lettieri & R. Welz (Hrsg.), Drogenabhängigkeit. Ursachen<br />
und Verlaufsformen. Ein Handbuch. Weinheim: Beltz. S.139-142.<br />
Kernberg, O. (1978). Borderline-Störungen und pathologischer Narzissmus.<br />
Frankfurt: Suhrkamp.<br />
Kernberg, O. (1996b). Ein psychoanalytisches Modell der Klassifizierung von<br />
Persönlichkeitsstörungen. Psychotherapeut, 41, 288-296.<br />
Kohut, H. (1973). Narzissmus. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.<br />
Kushner, M.G., Sher, K.J. & Beitman, B.D. (1990).The relation between alcohol<br />
problems and the anxiety disorders. American Journal of Psychiatry, 147, 685-695.
VII. Literaturverzeichnis 125<br />
Kutscher, S., Hayatghebi, S. et. al. (2002). Traumatische Lebensereignisse und<br />
Posttraumatische Belastungsstörungen bei alkoholabhängigen Patienten.<br />
Nervenarzt,1,200-201.<br />
Lieb, R. & Isensee, B. (2002). Häufigkeit und zeitliche Muster von Komorbidität. In:<br />
F. Moggi (Hrsg.). Doppeldiagnosen. Komorbidität psychischer Störungen und Sucht.<br />
Göttingen: Hans Huber.<br />
Maercker, A. & Langner, R. (2001). Persönliche Reifung (Personal Growth) durch<br />
Belastungen und Traumata. Diagnostica, 47, 3, 153–162.<br />
Mahler, M.S., Pine, F. & Bergmann, A. (1978). Die psychische Geburt des<br />
Menschen. Symbiose und Individuation. Frankfurt a. M.: Fischer.<br />
Main, M. & Solomon, J. (1986). Discovery of an insecure disorganized/disoriented<br />
attachment pattern: Procedures, findings and implications for the classification of<br />
behavior. In: T.B. Brazelton & M. Yogmann (Hrsg.), Affective development in<br />
infancy. Norwood, NJ: Ablex. 95-124.<br />
Main, M. (2002). Desorganisation im Bindungsverhalten. In: G. Spangler & P.<br />
Zimmermann (Hrsg.), Die Bindungstheorie. Grundlagen, Forschung und<br />
Anwendung. Stuttgart: Klett-Cotta. 120-139.<br />
Marlatt, G.A. & Gordon, J.R. (1985). Relapse prevention. New Yorg: Guilford Press.<br />
Mayfield, D., McLeod, G. & Hall, P. (1974). The CAGE questionnaire: Validation of<br />
a new alcoholism screening questionnaire. American Journal of Psychiatry, 131,<br />
1121-1123.<br />
Mischel, W. & Peake, P.K. (1982).Beyond déjà vu in the search for cross-situational<br />
consistency. Psychological Review, 89, 730-750.<br />
Moggi, F. (2002). Doppeldiagnosen. Komorbidität psychischer Störungen und Sucht.<br />
Göttingen: Hans Huber.
VII. Literaturverzeichnis 126<br />
Nagel, B. (2005). Psychometrische Untersuchung des Persönlichkeitsselbstportraits.<br />
Unveröffentlichte <strong>Diplomarbeit</strong>, Universität Osnabrück.<br />
Oldham, J.M. & Morris, L.B. (1992a). Ihr Persönlichkeits-Portrait. Warum Sie<br />
genau so denken, lieben und sich verhalten, wie Sie es tun. Hamburg: Kabel.<br />
Oswald, W.D. & Roth, E. (1987). Zahlen-Verbindungs-Test (ZVT). Göttingen:<br />
Hogrefe.<br />
Plomin, R., DeFries, J.C. & McClearn, G.E. (1990). Behavioral Genetics. A Primer.<br />
New York: WH Freeman.<br />
Reinert, C. (2005). Persönlichkeit, Belastungsereignisse und perzipierte Erziehungsstile<br />
bei Drogenabhängigen. Unveröffentlichte <strong>Diplomarbeit</strong>, Universität Osnabrück.<br />
Rost, W.D. (1986). Psychoanalyse des Alkoholismus. Stuttgart: Klett.<br />
Saß, H., Wittchen, H-U. Zaudig, M. und Houben, I. (2003). Diagnostisches und<br />
Statistisches Manual Psychischer Störungen -Textrevision- DSM-IV-TR. Deutsche<br />
Bearbeitung und Einführung. Göttingen: Hogrefe.<br />
Saß, H. & Jünemann, K. (2000). Klassifikation und Ätiopathogenese von<br />
Persönlichkeitsstörungen. In: G. Nissen (Hrsg.), Persönlichkeitsstörungen.<br />
Ursachen-Erkennung-Behandlung. Stuttgart: Kohlhammer.<br />
Schäfer, I. (2006). Die Bedeutung von Traumatisierungen für die Entwicklung und<br />
den Verlauf von Suchterkrankungen. In: I. Schäfer & M. Krausz (Hrsg.) (2006).<br />
Trauma und Sucht. Konzepte-Diagnostik-Behandlung. Stuttgart: Klett-Cotta.<br />
Schäfer, I. & Krausz, M. (Hrsg.) (2006). Trauma und Sucht. Konzepte-Diagnostik-<br />
Behandlung. Stuttgart: Klett-Cotta.<br />
Schäfer, M., Schnack, B. & Soyka, M. (2000). Sexueller und körperlicher<br />
Missbrauch während früher Kindheit oder Adoleszenz bei späterer
VII. Literaturverzeichnis 127<br />
Drogenabhängigkeit. Psychotherapie, Psychosomatik, Medizinische Psychologie,50,<br />
38-50.<br />
Schindler, A. (2001). Bindungsstile in den Familien Drogenabhängiger. Studien zur<br />
Familienforschung, Bd. 9, Hamburg: Dr. Kovac.<br />
Schmid, S.A. (2000). Prävalenz sexuellen Kindesmissbrauchs bei Opiatabhängigen.<br />
Themenbezogene Grundlagen, Konzept, Durchführung und Ergebnisse eines<br />
Kontrollgruppenvergleichs. Berlin: Verlag für Wissenschaft und Bildung.<br />
Schneider, R. (1985). Suchtverhalten aus lerntheoretischer und<br />
verhaltenstheoretischer Sicht. In: Deutsche Hauptstelle gegen die Suchtgefahren<br />
(Hrsg.).Süchtiges Verhalten. Hamm: Hoheneck.<br />
Simpson, T.L & Miller, W.R. (2002). Concomitance between childhood sexual and<br />
physical abuse and substance use problems. A Review. Clinical Psychology Review,<br />
22, 27-77.<br />
Soyka, M. (1998). Drogen- und Medikamentenabhängigkeit. Stuttgart:<br />
Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft<br />
Soyka, M. (1997). Alkoholismus - eine Krankheit und ihre Therapie. Stuttgart:<br />
Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft.<br />
Spangler, G. & Zimmermann, P. (Hrsg.) (2002). Die Bindungstheorie. Grundlagen,<br />
Forschung und Anwendung. Stuttgart: Klett-Cotta.<br />
Strauß, B. (2005) Vernachlässigung und Misshandlung aus Sicht der<br />
Bindungstheorie. In: U. Egle, S. Hoffmann & P. Joraschky (Hrsg). Sexueller<br />
Missbrauch, Misshandlung, Vernachlässigung. Erkennung Therapie und Prävention<br />
der Folgen früher Stresserfahrungen. Stuttgart: Schattauer.
VII. Literaturverzeichnis 128<br />
Streeck-Fischer, A. & Van der Kolk, B. (2000). Down will come baby, cradle and<br />
all: diagnostic and therapeutic implications of a chronic trauma on child<br />
developement. Australian-and-New-Zealand-Journal-of-Psychiatry, 34, 903-918.<br />
Strupp, H.H. & Binder, J.L. (1991). Kurzpsychotherapie. Stuttgart: Klett-Cotta.<br />
Sydow, K. v. (1998). Sexualität und/oder Bindung. Ein Forschungsüberblick zu<br />
sexuellen Beziehungen in langfristigen Partnerschaften. Familiendynamik, 23, 4,<br />
377-404.<br />
Sydow, K. v. (2000). Forschungsmethoden zur Erhebung von Partnerschaftsbindung.<br />
In: G. Gloger-Tippelt (Hrsg.), Bindung im Erwachsenenalter. Ein Handbuch für<br />
Forschung und Praxis. Göttingen: Huber. 275-294.<br />
Teegen, F. &Zumbeck, S. (2000). Prävalenz traumatischer Erfahrungen und<br />
Posttraumatischer Belastungsstörungen bei substanzabhängigen Personen: eine<br />
explorative Studie. Psychotherapeut, 45, 44-49.<br />
Terr, L. (1991). Childhood traumas. an outline and overview. American Journal of<br />
Psychiatry, 148, 10-20.<br />
Thomasius, R. (2000). Interpersonale Aspekte der Suchterkrankungen. In: R.<br />
Thomasius (Hrsg.). Psychotherapie der Suchterkrankungen. Stuttgart: Thieme.<br />
Torgersen, S, Lygren, S., Oien, P.A., Skre, I., Onstad, S., Edvardsen, J., Tambs, K. &<br />
Kringlen, E. (2000). A twin study of personality disorders. Comprehensive<br />
Psychiatry, 41, 416-425.<br />
Trautmann, R.D. (2004). Verhaltenstherapie bei Persönlichkeitsstörungen und<br />
problematischen Persönlichkeitsstilen. Stuttgart: Pfeiffer bei Klett-Cotta.<br />
Trautmann-Sponsel, R.D. & Zaudig, M. (1997). Diagnostik, Differentialdiagnostik<br />
und Komorbidität der Persönlichkeitsstörungen nach ICD-10 und DSM IV.<br />
Persönlichkeitsstörungen, 2, 51-62.
VII. Literaturverzeichnis 129<br />
Tress, W., Henry, W.P., Junkert-Tress, B., Hildenbrand, G., Hartkamp, N. &<br />
Scheibe, G. (1996). Das Modell des zyklisch maladaptiven Beziehungsmusters und<br />
der Strukturalen Analyse Sozialen Verhaltens (CMP/SASB). Psychotherapeut, 41,<br />
215-224.<br />
Tretter, F. (2000). Suchtmedizin. Der suchtkranke Patient in Klinik und Praxis.<br />
Stuttgart: Schattauer.<br />
Tretter, F. & Müller, A. (2001). Psychologische Therapie der Sucht. Göttingen:<br />
Hogrefe.<br />
Van Ijzendoorn, M.H., Bakermans-Kranenburg, M.J. (1996). Attachment<br />
Representations in Mothers, Fathers, Adolescents and Clinical Groups. A Meta-<br />
Analytic Search for Normative Data. Journal of Consultig and Clinical Psychology,<br />
64, 1, 8-21.<br />
World Health Organization [WHO] (1991). Internationale Klassifikation psychischer<br />
Störungen ICD 10. Deutsche Ausgabe: Dilling, Mombour, Schmidt & Schulte-<br />
Markwort, 2005, Göttingen: Hans Huber.<br />
Wöller, W. & Kruse, J. (2003). Persönlichkeitsstörungen und die Psychopathologie<br />
in der Folge von Traumen. Überlegungen zur diagnostischen Klassifikation.<br />
Nervenarzt, 74, 972-976.<br />
Wöller, W. (2006). Trauma und Persönlichkeitsstörungen. Psychodynamischintegrative<br />
Therapie. Stuttgart: Schattauer.<br />
Wurmser, L. (1983). Drogengebrauch als Abwehrmechanismus. In: D.J. Lettieri &<br />
R. Welz (Hrsg.), Drogenabhängigkeit, Ursachen und Verlaufsformen. Ein<br />
Handbuch. Weinheim: Beltz. 84 - 86.<br />
Wurmser, L. (1987). Flucht vor dem Gewissen. Berlin: Springer.
VII. Literaturverzeichnis 130<br />
Zimmermann, P. (1995). Bindungsentwicklung von der frühen Kindheit bis zum<br />
Jugendalter und ihre Bedeutung für den Umgang mit Freundschaftsbeziehungen. In:<br />
G. Spangler & P. Zimmermann (Hrsg.), Die Bindungstheorie. Grundlagen,<br />
Forschung und Anwendung. Stuttgart: Klett-Cotta. 203-231.
VIII. Anhang A 131<br />
Sehr geehrte Damen und Herren,<br />
im Rahmen meiner <strong>Diplomarbeit</strong>, im Fachbereich Psychologie der Uni<br />
Osnabrück, untersuche ich verschiedene Zusammenhänge bei schädlichem<br />
Alkohol- und Drogenkonsum. Dazu benötige ich eine nicht stationär<br />
aufgenommene und nicht drogenkonsumierende Vergleichsgruppe.<br />
Ich wäre Ihnen für Ihre Mithilfe sehr dankbar, die darin bestehen würde, die<br />
folgenden Fragebögen nach Ihren eigenen Erfahrungen und Erlebnissen<br />
auszufüllen. Hierfür benötigen Sie ca. 30 Min.<br />
Ihre Angaben werden ausschließlich für die wissenschaftliche Forschung<br />
verwendet und selbstverständlich streng vertraulich behandelt und anonym<br />
ausgewertet. Bitte schreiben Sie auf keinen Fragebogen Ihren Namen!<br />
Bitte kontrollieren Sie zum Schluss, ob Sie alle Fragen beantwortet haben!<br />
Vielen Dank für Ihre wertvolle Mithilfe!<br />
Axel <strong>Bensmann</strong><br />
Fragebogen zur Person<br />
Geschlecht: weiblich<br />
männlich<br />
Alter:_______Jahre<br />
Aufgewachsen in (Staat, z.B. Deutschland):____________________<br />
Nationalität:____________________________<br />
Familienstand:<br />
ledig<br />
verheiratet<br />
eheähnl. Gemeinschaft<br />
geschieden<br />
verwitwet
VIII. Anhang A 132<br />
Höchster Schulabschluss:<br />
ohne Abschluss<br />
Volks-/Hauptschulabschluss<br />
Realschulabschluss<br />
Fachabitur<br />
Abitur<br />
Hochschulabschluss<br />
Sonstiges<br />
Beruf: in Ausbildung Angestellter<br />
im Studium<br />
Beamter<br />
handwerklicher Beruf<br />
selbständig<br />
kaufmännischer Beruf<br />
arbeitslos<br />
sozialer Beruf<br />
Rentner / Pensionär<br />
medizinisch- /pflegerischer Beruf Sonstiges<br />
Substanzgebrauch:<br />
Haben Sie in Ihrem Leben jemals illegale Drogen konsumiert?<br />
Ja<br />
Nein<br />
Konsumieren Sie in Ihrem derzeitigen Lebensabschnitt illegale Drogen?<br />
Ja<br />
Nein<br />
Alkoholkonsum:<br />
Hatten Sie schon das Gefühl, dass Sie Ihren Alkoholkonsum reduzieren sollten?<br />
Ja<br />
Nein<br />
Hat es Sie auch schon aufgeregt, wenn andere Leute Ihr Trinkverhalten kritisieren?<br />
Ja<br />
Nein<br />
Hatten Sie wegen Ihres Alkoholkonsums auch schon Gewissensbisse?<br />
Ja<br />
Nein<br />
Haben Sie morgens nach dem Erwachen auch schon als erstes Alkohol getrunken, um Ihre<br />
Nerven zu beruhigen oder den Kater los zu werden?<br />
Ja<br />
Nein
VIII. Anhang B 133<br />
Sehr geehrte Damen und Herren,<br />
im Rahmen meiner <strong>Diplomarbeit</strong>, im Fachbereich Psychologie der Uni<br />
Osnabrück, untersuche ich verschiedene Zusammenhänge bei schädlichem<br />
Alkohol- und Drogenkonsum.<br />
Ich wäre Ihnen für Ihre Mithilfe sehr dankbar, die darin bestehen würde, die<br />
folgenden Fragebögen nach Ihren eigenen Erfahrungen und Erlebnissen<br />
auszufüllen. Für das Ausfüllen der Fragebögen benötigen Sie ca. 50 Min.<br />
Ihre Angaben werden ausschließlich für die wissenschaftliche Forschung<br />
verwendet und selbstverständlich streng vertraulich behandelt und anonym<br />
ausgewertet. Bitte schreiben Sie auf keinen Fragebogen Ihren Namen!<br />
Vielen Dank für Ihre wertvolle Mithilfe!<br />
Axel <strong>Bensmann</strong>
VIII. Anhang B 134<br />
Fragebogen zur Person<br />
Geschlecht: weiblich<br />
männlich<br />
Alter:_______Jahre<br />
Aufgewachsen in (Staat, z.B. Deutschland):____________________<br />
Nationalität:____________________________<br />
Familienstand:<br />
ledig<br />
verheiratet<br />
eheähnl. Gemeinschaft<br />
geschieden<br />
verwitwet<br />
Höchster Schulabschluss:<br />
ohne Abschluss<br />
Volks-/Hauptschule<br />
Realschulabschluss<br />
Fachabitur<br />
Abitur<br />
Hochschulabschluss<br />
Sonstiges<br />
Beruf: in Ausbildung Angestellter<br />
im Studium<br />
Beamter<br />
handwerklicher Beruf<br />
selbständig<br />
kaufmännischer Beruf<br />
arbeitslos<br />
sozialer Beruf<br />
Rentner / Pensionär<br />
medizinisch- /pflegerischer Beruf Sonstiges<br />
Entzugsbehandlung:<br />
Wegen folgender Substanzen bin ich in der Entzugsbehandlung:<br />
Alkohol<br />
Illegale Drogen Substanz:_______________________
VIII. Anhang C 135<br />
Der Fragebogen zum Persönlichkeitsporträt<br />
Bitte lese Sie jede Frage durch.<br />
Kreuzen Sie bitte das Antwortkästchen der Frage an, das am besten auf Sie zutrifft.<br />
Manche Fragen bestehen aus zwei Teilen. Wenn Sie nur mit einem Teil einverstanden sind,<br />
kreuzen Sie „Vielleicht“ an; wenn Sie mit beiden Teilen einverstanden sind, kreuzen Sie „Ja“<br />
an. Wenn Sie mit beiden teilen nicht einverstanden sind, kreuzen Sie „Nein“ an.<br />
Lassen Sie bitte keine Frage aus; auch wenn Sie meinen, eine Frage träfe auf Sie oder Ihre<br />
Lebensumstände nicht zu - antworten Sie so, als würde sie zutreffen.<br />
Ja<br />
Vielleicht<br />
Nein<br />
1 Ich neige dazu, mehr Zeit mit meiner Arbeit zu verbringen, als<br />
einige meiner Kollegen oder Mitarbeiter, denn ich bin ein<br />
Perfektionist und mag es, wenn die Dinge richtig gemacht werden.<br />
2 Bei mir ist alles durchorganisiert. Ich folge gern einem Plan und<br />
mache Listen von den Dingen, die ich zu tun habe. Manchmal habe<br />
ich so viele Listen, dass ich nicht mehr weiß, was ich mit ihnen<br />
machen soll!<br />
3 Ich bin manchmal als "Arbeitssüchtiger" bezeichnet worden. Es ist<br />
wahr, dass ich sehr hart arbeite, auch wenn wir genug Geld haben<br />
und alle Rechnungen bezahlt sind. Ich glaube, wenn ich wollte,<br />
könnte ich aufhören und entspannen, zumindest für kurze Zeit.<br />
4 Ich bin ein schrecklicher Verzögerer. Ich schiebe Dinge immer bis<br />
zur letzten Minute auf.<br />
5 Wenn ich etwas wirklich nicht tun möchte, und auch wenn mein<br />
Chef oder meine Familie mich bittet, lasse ich mir Zeit, bis ich es<br />
tue oder ich strenge mich nicht besonders an und mache meine<br />
Arbeit schlecht.<br />
6 Wenn Arbeiten zu erledigen sind und ich meine, dass eine bestimmte<br />
Arbeit nicht sinnvoll ist oder nicht in meine Verantwortung<br />
fällt, verweigere ich die Kooperation.<br />
7 Wenn ich bei etwas Erfolg habe, kann ich es entweder nicht richtig<br />
genießen, oder etwas anderes in meinem Leben läuft schief.<br />
8 Ich habe viele Fähigkeiten, die ich nicht zu nutzen scheine. Wenn<br />
ich in etwas gut bin, kann ich anderen Leuten damit helfen, aber<br />
ich kann meine Fähigkeit nicht für mich selbst einsetzen.<br />
9 Ich habe ein ziemlich gutes Gefühl für mich selbst. Ich weiß, welche<br />
Art Arbeit ich tun möchte, mit welchen Freunden ich Zusammensein<br />
möchte und was insgesamt für mich wichtig ist.<br />
10 Im Allgemeinen fühle ich mich nicht gelangweilt oder innerlich<br />
leer.
VIII. Anhang C 136<br />
Ja<br />
Vielleicht<br />
Nein<br />
11 Es bedeutet mir sehr viel, bestätigt oder gelobt zu werden. Ich mag<br />
es, wenn man mir Zuneigung immer wieder beteuert.<br />
12 Ich bin gern in meinen Träumereien. Ich stelle mir vor, ich wäre<br />
reich oder mächtig oder berühmt - vielleicht sogar der Gewinner<br />
eines Nobelpreises.<br />
13 Obwohl ich weiß, dass ich es nicht sein sollte, bin ich von Gewalt,<br />
Waffen und Kampfsportarten fasziniert. Ich mag Filme und Fernsehsendungen<br />
mit viel Action und Gewalt.<br />
14 Die Leute sagen, dass ich mich sonderbar ausdrücke - dass ich<br />
Dinge sage, die zu hoch für sie sind, oder dass ich nicht erkläre,<br />
was ich meine.<br />
15 Ich falle gerne auf, und ich habe die Gewohnheit, nach<br />
Komplimenten zu fischen, wenn ich ignoriert werde.<br />
16 Mein Äußeres ist mir sehr wichtig. Ich verbringe viel Zeit damit,<br />
sicherzustellen, dass ich attraktiv aussehe.<br />
17 Die Leute denken manchmal, dass ich exzentrisch bin, weil ich<br />
mich auf meine Weise kleide und ihnen ein bisschen ausgeflippt<br />
erscheine. Es stimmt, dass ich irgendwie in meiner eigenen kleinen<br />
Welt lebe.<br />
18 Wenn es "altmodisch" ist, sehr strenge Prinzipien zu haben und an<br />
ein sehr moralisches und ethisches Verhalten zu glauben, bin ich<br />
altmodisch.<br />
19 Ich denke lange nach, bevor ich Entscheidungen treffe. Während<br />
andere sich sehr viel schneller entscheiden, halte ich Vorsicht für<br />
wichtig.<br />
20 Ich neige dazu, alles aufzubewahren. Meine Schränke und Schubladen<br />
und der Speicher sind voll von Dingen, die ich einfach nicht<br />
wegwerfen kann oder will.<br />
21 Wenn Leute mir Vorschläge machen, wie ich produktiver sein<br />
könnte, ärgert mich das oft, weil sie ihre Nase in Angelegenheiten<br />
stecken, die sie nichts angehen, ohne meine Situation wirklich zu<br />
22 verstehen. Ich ertappe mich manchmal dabei, wie ich über die Missgeschicke<br />
anderer lache, obwohl ich auf diese Reaktion nicht besonders stolz<br />
bin.<br />
23 Obwohl ich nicht zögere, anderen von meinen Problemen zu erzählen,<br />
fühle ich mich sehr unwohl dabei, wenn ich zulasse, dass<br />
sie mir dabei helfen.<br />
24 Ich glaube, dass meine Probleme zu kompliziert und einmalig sind,<br />
als dass die meisten Menschen sie verstehen könnten.<br />
25 Es fällt mir nicht schwer, es mir gut gehen zu lassen. Wenn sich<br />
eine Gelegenheit bietet, mich zu amüsieren, versuche ich im allgemeinen,<br />
sie zu nutzen.
VIII. Anhang C 137<br />
26 In Bezug auf Beziehungen glaube ich manchmal, dass ich selbst<br />
mein ärgster Feind bin. Ich lasse mich immer wieder mit Leuten<br />
ein, die mich irgendwann einmal schlecht behandeln oder enttäuschen.<br />
Ich kann nicht glauben, dass ich so schlecht darin bin, andere<br />
einzuschätzen - ich muss naiv sein.<br />
27 Wenn jemand mich wirklich mag oder mich sehr freundlich oder<br />
zärtlich behandelt, bin ich oft nicht interessiert. Irgendwie erscheint<br />
es mir einfach langweilig, wenn es in der Beziehung keine<br />
wirkliche Herausforderung gibt.<br />
28 Der Umgang mit mir kann schwierig sein, und wenn ich darüber<br />
nachdenke, sind meine Erwartungen an andere ziemlich unvernünftig.<br />
Aber ich ärgere mich immer noch, wenn sie böse auf mich<br />
sind.<br />
29 Ich tue sehr viel für andere, oft unter großen Opfern für mich<br />
selbst, und ich warte nicht, bis ich gefragt werde.<br />
30 Die großen Entscheidungen überlasse ich im Allgemeinen den<br />
wichtigen Menschen in meinem Leben.<br />
31 Ich bin nicht das, was man einen Initiator nennen könnte. Ich bin<br />
als Gefolgsmann sehr viel besser denn als Anführer, aber ich kann<br />
ein sehr loyaler Mannschaftsspieler sein.<br />
32 Es macht mir nichts aus, mehr zu arbeiten als die anderen oder<br />
Dinge zu tun, die niemand sonst tun will, wenn das bedeutet, dass<br />
wir gut miteinander auskommen. Natürlich möchte ich dafür geschätzt<br />
werden.<br />
33 Ich verbringe nicht gern Zeit allein, und ich vermeide es, so sehr<br />
ich kann.<br />
34 Ich bin nicht übermäßig empfindlich für Ablehnung und Verlust.<br />
Wenn eine wichtige Beziehung zu Ende geht, komme ich damit<br />
ganz gut zurecht - es wirft mich im Allgemeinen nicht um.<br />
35 Ich mache mir sehr viele Sorgen, dass Menschen, an denen mir<br />
etwas liegt, mich verlassen, obwohl gewöhnlich kein Grund für<br />
diese Angst besteht.<br />
36 Manchmal ängstige ich mich so, dass Menschen mich verlassen,<br />
dass ich irgendwie außer mir bin und sie anrufe, damit sie mich<br />
beruhigen, was ziemlich lästig werden kann.<br />
37 Ich stehe gern im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit - es ist belebend.<br />
Ich fühle mich im Zentrum des Geschehens sehr viel wohler<br />
als am Rand.<br />
38 Ich bin ein Mensch, der sehr sexy ist. Ich flirte gern und kleide<br />
mich gern sexuell attraktiv.<br />
39 Die Leute beschreiben mich als sehr unterhaltsam. Ich kann Ereignisse<br />
sehr unterhaltsam und farbig erzählen, ohne ständig alle Fakten<br />
parat haben zu müssen.<br />
Ja<br />
Vielleicht<br />
Nein
VIII. Anhang C 138<br />
40 Im Allgemeinen habe ich sehr intensive Beziehungen, und gewöhnlich<br />
schwanken meine Gefühle für diesen Menschen von einem<br />
Extrem zum anderen. Manchmal bete ich ihn fast an, und dann<br />
wieder kann ich ihn nicht ausstehen.<br />
41 Ich bin oft neidisch auf andere.<br />
Ja<br />
Vielleicht<br />
Nein<br />
42 Ich habe nicht besonders viel Vertrauen, obwohl ich es gern hätte.<br />
Ich habe einfach Angst, dass Menschen mich ausnutzen könnten,<br />
wenn ich nicht vorsichtig bin.<br />
43 Manchmal denke ich, dass meine Freunde und Kollegen nicht so<br />
loyal sind, wie ich es gerne hätte.<br />
44 Ich bin ein ziemlich zurückgezogener Mensch und behalte Dinge<br />
im Allgemeinen für mich, denn man weiß nie, wer persönliche Informationen<br />
zu seinem eigenen Nutzen verwendet.<br />
45 Ich neige dazu, ein Einzelgänger zu sein, und für mich ist das in<br />
Ordnung. Es macht mir irgendwie keinen Spaß, viel mit anderen<br />
Leuten zusammen zu sein, auch wenn es meine Familie ist.<br />
46 Wenn ich die Wahl habe, tue ich Dinge lieber allein.<br />
47 Ich fühle mich im Allgemeinen in der Anwesenheit von Fremden<br />
ziemlich wohl, und ich bin gern bei gesellschaftlichen Zusammenkünften,<br />
bei denen ich einer Menge neuer Gesichter begegne.<br />
48 Ich bin sehr unsicher. Ich habe oft das Gefühl, dass Menschen<br />
mich ansehen und mich taxieren, nicht immer in schmeichelhafter<br />
Weise.<br />
49 Im Allgemeinen lasse ich mich erst dann mit Menschen ein, wenn<br />
ich sicher bin, dass sie mich mögen.<br />
50 Ich mag Menschen, aber ich fühle mich sehr viel wohler, wenn ich<br />
sozialen Aktivitäten und beruflichen Situationen aus dem Weg<br />
gehe, an denen viele Leute beteiligt sind.<br />
51 In Gesellschaft bin ich selbstbewusst. Ich rede ohne Schwierigkeiten<br />
und bin nicht schrecklich unsicher oder ängstlich, dass ich etwas<br />
Dummes sage oder uninformiert erscheine.<br />
52 Ich bin nicht gut darin, mich an Verpflichtungen zu erinnern, etwa<br />
Danksagungen zu schreiben. Meine Neigung, diese Dinge zu<br />
vergessen, kann peinlich sein.<br />
53 Ich habe den Eindruck, dass viele Menschen in meinem Leben<br />
unvernünftige Forderungen an mich stellen - obwohl ich das umgekehrt<br />
nicht tue.<br />
54 Ich kann an meinem Chef oder anderen Autoritätspersonen ziemlich<br />
viel auszusetzen haben. Vielleicht kann ich ihre Situation<br />
nicht ganz verstehen, aber ich glaube, dass ich oft bessere Arbeit<br />
leisten könnte.<br />
55 Wenn jemand mich bittet, etwas zu tun, was ich nicht tun will,<br />
kann ich ein richtiges Ekel sein - ich streite oder bin eingeschnappt<br />
oder bekomme sehr schlechte Laune.
VIII. Anhang C 139<br />
56 Manche Leute sagen, dass ich zu viel selbst mache, aber ich tue<br />
die Arbeit lieber selbst, als dass jemand anders sie falsch oder unvollständig<br />
macht. Ich riskiere es, als "stur" oder "herrschsüchtig"<br />
bezeichnet zu werden, wenn andere nur die Arbeit so machen, wie<br />
ich es für richtig halte.<br />
57 Ich glaube, dass strenge Disziplin extrem wichtig ist. Obwohl ich<br />
körperliche Bestrafungen nicht unbedingt für wirksam halte, glaube<br />
ich an das Prinzip hinter dem Sprichwort "Wer die Rute spart,<br />
verzieht das Kind".<br />
58 Die Mitglieder meiner Familie beklagen manchmal, dass ich ihnen<br />
nicht genug Unabhängigkeit und Freiheit erlaube. Ich glaube, ich<br />
führe ein ziemlich hartes Regiment.<br />
59 Leute haben mir gesagt, dass ich sie in Gegenwart anderer<br />
demütige. Sie sollten nicht so empfindlich sein - Worte verletzen<br />
doch niemanden. Und wenn sie wirklich meinen, ich würde sie zu<br />
sehr kritisieren, sollten sie mir Paroli bieten.<br />
60 Ich glaube, ich kann ziemlich einschüchternd sein. Manche Leute<br />
haben mir gesagt, dass sie tun, was ich will, weil sie Angst vor mir<br />
haben.<br />
61 Ich finde, dass bestimmte Leute kleine Dinge tun, die mich reizen,<br />
ärgern oder beleidigen, nur um mich auf die Palme zu bringen.<br />
Ja<br />
Vielleicht<br />
Nein<br />
62 Wenn jemand mich nicht richtig behandelt, werde ich es wahrscheinlich<br />
nicht vergessen.<br />
63 Ich habe ein starkes Bedürfnis nach neuen sexuellen Erfahrungen<br />
und Aufregung, deshalb bleibe ich nicht lange mit einem Menschen<br />
zusammen.<br />
64 Manchmal erfinde ich Geschichten oder ich verzerre die Wahrheit,<br />
nur um zu sehen, wie andere reagieren. Aber das ist nur Spaß und<br />
also kein Grund für irgend jemanden, sich zu ärgern<br />
65 Es fällt mir leicht, meine Gefühle zu zeigen.<br />
66 Ich kann manchmal ziemlich dumm handeln, was meine Freunde<br />
zuweilen stört; sie sagen, dass ich nicht weiß, wie man sich richtig<br />
benimmt, aber ich bin nicht ihrer Meinung.<br />
67 Ich bin sehr empfänglich für Stimmungen. Kleine Dinge können<br />
mich aus dem Gleichgewicht bringen. In ein paar Stunden kann<br />
ich eine breite Palette von Gefühlen empfinden. Glück, Trauer,<br />
Langeweile oder Angst. Aber die schlechten Stimmungen halten<br />
nie lange an.<br />
68 Es fällt mir schwer, Kritik anzunehmen, auch wenn ich weiß, dass<br />
sie konstruktiv ist. Obwohl ich es nicht unbedingt zeige, fühle ich<br />
mich innerlich erniedrigt, beschämt oder wütend.<br />
69 Ich neige dazu, meine Gefühle nicht zu zeigen, obwohl ich sie innerlich<br />
erlebe. Meistens erscheine ich ruhig und reserviert.
VIII. Anhang C 140<br />
70 Ich bleibe lieber bei meiner üblichen täglichen Routine, als mich<br />
in unbekannte Umgebungen und Situationen zu wagen.<br />
Ja<br />
Vielleicht<br />
Nein<br />
71 Man kann mich ein "Pokerface" nennen. Ich bin den Leuten irgendwie<br />
ein Geheimnis, weil ich im Allgemeinen wenig Gefühl<br />
zeige und nicht stark auf sie reagiere.<br />
72 Ich glaube, ich habe eine andere Wellenlänge als die meisten anderen<br />
Menschen. Manchmal kann ich Dinge spüren, die für mich<br />
sehr real sind, obwohl ich sie nicht beweisen kann, etwa dass der<br />
Geist eines verstorbenen Familienmitglieds im Raum ist, der versucht,<br />
mit mir zu kommunizieren.<br />
73 Ich bin fasziniert von Dingen wie Magie, außersinnlicher Wahrnehmung<br />
und dem Übernatürlichen. Ich habe eine Art "sechsten<br />
Sinn" und hatte manchmal unheimliche Erlebnisse, bei denen ich<br />
wusste, dass etwas geschehen würde, bevor es tatsächlich eintraf.<br />
74 Ich würde mein Geld eher sparen, als es für ein Geschenk auszugeben.<br />
Ich neige absolut nicht zu Extravaganzen, was eine gute<br />
Methode ist, sicherzustellen, dass immer Geld auf dem Konto ist.<br />
75 Ich kann ungeduldig sein; im Allgemeinen will ich das, was ich<br />
will, sofort.<br />
76 Ich handle gern spontan, wenn mir danach zumute ist. Zum Beispiel<br />
betrinke ich mich oder nehme Drogen, wenn ich in der<br />
Stimmung bin, oder ich esse viel, oder ich fahre zu schnell, oder<br />
ich genieße einen ausgiebigen Einkaufsbummel. Das macht das<br />
Leben sehr viel interessanter, obwohl es manchmal natürlich ins<br />
Auge geht.<br />
77 Ich kann sehr dramatisch sein, wenn ich mich ärgere. Ich habe<br />
schon gedroht, mich selbst zu verletzen, obwohl ich das natürlich<br />
nicht wirklich meine.<br />
78 Ich tue Dinge gern spontan, ohne vorauszuplanen, etwa den Koffer<br />
packen und reisen, solange es mir gefällt. Ich weiß, dass die meisten<br />
Probleme sich von selbst lösen.<br />
79 Ich habe einfach nicht die Geduld, mir über die Finanzen Gedanken<br />
zu machen oder meine Rechnungen zu bezahlen, und deshalb halten<br />
Leute mich für verantwortungslos.<br />
80 Ich bin nicht die Art Mensch, die immer den vorsichtigen Weg<br />
einschlägt. Ich gehe Risiken ein - etwa schneller fahren als erlaubt<br />
oder fahren, wenn ich etwas getrunken habe -, aber ich weiß, was<br />
ich tue, und ich komme dahin, wo ich hin will.<br />
81 Mich fasziniert eine Art Untergrundleben, in dem man die Regeln<br />
brechen kann und ungestraft davonkommt.<br />
82 Als Heranwachsender war ich ein Teufelskerl und immer in<br />
Schwierigkeiten. Einige der folgenden Dinge trafen auf mich zu:<br />
Ich habe die Schule geschwänzt; ich bin von zu Hause weggelaufen;<br />
ich bin in Schlägereien geraten; ich habe mich sexuell viel<br />
herumgetrieben; ich habe gelogen; ich habe gestohlen; ich habe<br />
Leute drangsaliert; ich habe das Eigentum anderer zerstört.
VIII. Anhang D 141<br />
Fragebogen zu Beziehungen<br />
Mit diesem Fragebogen sollen verschiedene Typen von engen, persönlichen Beziehungen<br />
erfasst werden. Im folgenden bitten wir Sie, den Charakter Ihrer Beziehung zu Ihrem Partner<br />
und zu Ihrer Mutter anhand der Fragen zu beschreiben.<br />
___________________________________________________________________________<br />
PERSÖNLICHE DATEN<br />
Geschlecht weiblich männlich<br />
Alter ............Jahre<br />
Hatten Sie schon einmal eine feste Beziehung zu einem Partner/ einer Partnerin?<br />
ja nein<br />
Sind Sie zur Zeit in einer festen Beziehung zu einem Partner/ einer Partnerin?<br />
ja nein<br />
Wenn ja, wie lange besteht diese Beziehung schon?<br />
...... Jahre und ...... Monate<br />
Wenn nein, wie lange bestand Ihre letzte feste Beziehung?<br />
...... Jahre und ...... Monate<br />
________________________________________________________<br />
Teil I<br />
Dieser Teil umfaßt 14 Aussagen, die sich zur Beschreibung Ihrer Beziehung zuIhrer Mutter<br />
eignen könnten. Sollte Ihre Mutter nicht mehr leben, überspringen Sie bitte diesen Teil. Lesen<br />
Sie bitte jede dieser Aussagen aufmerksam durch und überlegen Sie, ob diese Aussage Ihre<br />
Beziehung zu Ihrer Mutter in den letzten Monaten zutreffend beschreibt oder nicht. Zur<br />
Bewertung jeder der 14 Aussagen steht Ihnen eine fünffach abgestufte Skala zur Verfügung.
VIII. Anhang D 142<br />
Lassen Sie bitte keine Aussage aus; wenn Ihnen einmal die Entscheidung<br />
schwerfallen sollte, kreuzen Sie trotzdem immer eine Antwort an, und zwar die,<br />
welche noch am ehesten zutrifft.<br />
stimmt:<br />
1. Ich kann mich gut auf meine Mutter verlassen ................................ 1⎯2⎯3⎯4⎯5<br />
2. Ich mache mir Sorgen, von meiner Mutter nicht akzeptiert zu<br />
werden ..............................................................................................<br />
1⎯2⎯3⎯4⎯5<br />
3. Ich treffe wichtige Entscheidungen ohne meine Mutter ................. 1⎯2⎯3⎯4⎯5<br />
4. Um etwas richtig genießen zu können, muß meine Mutter immer<br />
dabei sein...........................................................................................<br />
5. Ich finde es einfach, meiner Mutter gefühlsmäßig nahe zu<br />
kommen..............................................................................................<br />
1⎯2⎯3⎯4⎯5<br />
1⎯2⎯3⎯4⎯5<br />
6. Ich habe Schwierigkeiten, mich auf meine Mutter ganz zu verlassen 1⎯2⎯3⎯4⎯5<br />
7. Ich vermeide es, von meiner Mutter abhängig zu sein ...................... 1⎯2⎯3⎯4⎯5<br />
8. Wenn ich Probleme habe, muß meine Mutter für mich da sein ....... 1⎯2⎯3⎯4⎯5<br />
9. Ich fühle mich unwohl, wenn ich meiner Mutter nahe komme ........ 1⎯2⎯3⎯4⎯5<br />
10. Wenn ich Probleme habe, kann ich sie sehr gut ohne meine Mutter<br />
lösen ................................................................................................<br />
1⎯2⎯3⎯4⎯5<br />
11. Ich kann meiner Mutter nie nahe genug sein ................................. 1⎯2⎯3⎯4⎯5<br />
12. Ich fühle mich von meiner Mutter akzeptiert ................................. 1⎯2⎯3⎯4⎯5<br />
13. Es ist wichtig für mich, unabhängig von meiner Mutter zu sein .... 1⎯2⎯3⎯4⎯5<br />
14. Ich kann Probleme nur mit meiner Mutter lösen ............................ 1⎯2⎯3⎯4⎯5
VIII. Anhang D 143<br />
Teil II<br />
Beschreiben Sie jetzt bitte ganz analog Ihre Beziehung zu Ihrem Partner in den letzten<br />
Monaten.<br />
Wenn Sie zur Zeit keine feste Beziehung haben, beschreiben Sie bitte Ihre letzte feste<br />
Partnerbeziehung. Um unnötigen Verbrauch von Papier zu vermeiden, haben wir nur eine<br />
geschlechtsneutrale Version des Fragebogens erstellt. Der allgemeine Begriff „Partner“<br />
bezeichnet daher entweder Ihren Partner oder Ihre Partnerin. Wenn Sie in noch keiner festen<br />
Beziehung standen, füllen Sie folgende zwei Seiten bitte nicht aus.<br />
stimmt:<br />
1. Ich kann mich gut auf meinen Partner verlassen ............................. 1⎯2⎯3⎯4⎯5<br />
2. Ich mache mir Sorgen, von meinem Partner nicht akzeptiert zu<br />
werden ..........................................................................................<br />
1⎯2⎯3⎯4⎯5<br />
3. Ich treffe wichtige Entscheidungen ohne meinen Partner ............... 1⎯2⎯3⎯4⎯5<br />
4. Um etwas richtig genießen zu können, muß mein Partner immer<br />
dabei sein .....................................................................................<br />
5. Ich finde es einfach, meinem Partner gefühlsmäßig nahe zu<br />
kommen..........................................................................................<br />
6. Ich habe Schwierigkeiten, mich auf meinen Partner ganz zu<br />
verlassen<br />
1⎯2⎯3⎯4⎯5<br />
1⎯2⎯3⎯4⎯5<br />
1⎯2⎯3⎯4⎯5<br />
7. Ich vermeide es, von meinem Partner abhängig zu sein .................... 1⎯2⎯3⎯4⎯5<br />
8. Wenn ich Probleme habe, muß mein Partner für mich da sein ....... 1⎯2⎯3⎯4⎯5<br />
9. Ich fühle mich unwohl, wenn ich meinem Partner nahe komme ...... 1⎯2⎯3⎯4⎯5<br />
10. Wenn ich Probleme habe, kann ich sie sehr gut ohne meinen<br />
Partner lösen ............................................................................<br />
1⎯2⎯3⎯4⎯5<br />
11. Ich kann meinem Partner nie nahe genug sein ................................ 1⎯2⎯3⎯4⎯5<br />
12. Ich fühle mich von meinem Partner akzeptiert ................................ 1⎯2⎯3⎯4⎯5<br />
13. Es ist wichtig für mich, unabhängig von meinem Partner zu sein ... 1⎯2⎯3⎯4⎯5<br />
14. Ich kann Probleme nur mit meinem Partner lösen ........................... 1⎯2⎯3⎯4⎯5
VIII. Anhang E 144<br />
TEIL 1<br />
PDS<br />
Viele Menschen haben irgendwann einmal in ihrem Leben ein sehr belastendes oder traumatisches<br />
Erlebnis oder werden Zeuge eines solches Ereignisses. Bitte geben Sie für jedes der folgenden<br />
Ereignisse an, ob Sie es erlebt haben, entweder persönlich oder als Zeuge. Bitte kreuzen Sie JA an,<br />
wenn dies der Fall war, und NEIN, wenn dies nicht der Fall war.<br />
1. JA NEIN Schwerer Unfall, Feuer oder Explosion (z.B. Arbeitsunfall, Unfall in der<br />
Landwirtschaft, Autounfall, Flugzeug- oder Schiffsunglück)<br />
2. JA NEIN Naturkatastrophe (z.B. Wirbelsturm, Orkan, Flutkatastrophe, schweres<br />
Erdbeben)<br />
3. JA NEIN Gewalttätiger Angriff durch jemanden aus dem Familien- oder Bekanntenkreis<br />
(z.B. körperlich angegriffen, ausgeraubt, angeschossen oder mit einer<br />
Schusswaffe bedroht werden, Stichverletzung zugefügt bekommen)<br />
4. JA NEIN Gewalttätiger Angriff durch fremde Person (z.B. körperlich angegriffen,<br />
ausgeraubt, angeschossen oder mit einer Schusswaffe bedroht werden,<br />
Stichverletzung zugefügt bekommen)<br />
5. JA NEIN Sexueller Angriff durch jemanden aus dem Familien- oder Bekanntenkreis (z.B.<br />
Vergewaltigung, versuchte Vergewaltigung)<br />
6. JA NEIN Sexueller Angriff durch fremde Person (z.B. Vergewaltigung, versuchte<br />
Vergewaltigung)<br />
7. JA NEIN Kampfeinsatz im Krieg oder Aufenthalt im Kriegsgebiet<br />
8. JA NEIN Sexueller Kontakt im Alter von unter 18 Jahren mit einer Person, die<br />
mindestens 5 Jahre älter war (z.B. Kontakt mit Genitalien oder Brüsten)<br />
9. JA NEIN Gefangenschaft (z.B. Strafgefangener, Kriegsgefangener, Geißel)<br />
10. JA NEIN Folter<br />
11. JA NEIN Lebensbedrohliche Krankheit<br />
12. JA NEIN Anderes traumatisches Ereignis<br />
Bitte beschreiben Sie dieses Ereignis:<br />
________________________________________________________<br />
Wenn Sie mehrmals JA angekreuzt haben, geben Sie bitte hier die Nummer desjenigen Erlebnisses<br />
an, das Sie am meisten belastet:<br />
Nr. ____________<br />
Bitte beantworten Sie die Fragen auf den folgenden Seiten FÜR DIESES SCHLIMMSTE<br />
ERLEBNIS (wenn Sie nur für eines der Ereignisse JA angekreuzt haben, ist mit „schlimmstes<br />
Erlebnis“ dieses Ereignis gemeint). Wenn Sie keines der Erlebnisse hatten, brauchen Sie keine<br />
weiteren Fragen dieses Bogens zu beantworten.
VIII. Anhang E 145<br />
TEIL 2<br />
PDS<br />
Wann hatten Sie dieses schlimmste Erlebnis?<br />
(Bitte kreuzen Sie eine der Antwortmöglichkeiten an)<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
vor weniger als einem Monat<br />
vor 1 bis 3 Monaten<br />
vor 3 bis 6 Monaten<br />
vor 6 Monaten bis 3 Jahren<br />
vor 3 bis 5 Jahren<br />
vor mehr als 5 Jahren<br />
Bitte kreuzen Sie für die folgenden Fragen JA oder NEIN an:<br />
Während des schlimmsten Ereignisses …<br />
JA NEIN … wurden Sie körperlich verletzt?<br />
JA NEIN … wurde jemand anders körperlich verletzt?<br />
JA NEIN … dachten Sie, dass Ihr Leben in Gefahr war?<br />
JA NEIN … dachten Sie, dass das Leben einer anderen Person in Gefahr war?<br />
JA NEIN … fühlten Sie sich hilflos?<br />
JA NEIN … hatten Sie starke Angst oder waren Sie voller Entsetzen?
VIII. Anhang E 146<br />
TEIL 3<br />
PDS<br />
Im Folgenden finden Sie eine Reihe von Problemen, die Menschen manchmal nach traumatischen<br />
Ereignissen haben. Bitte lesen Sie sich jedes der Probleme sorgfältig durch. Wählen Sie diejenige<br />
Antwortmöglichkeit (0 – 3) aus, die am besten beschreibt, wie häufig Sie IM LETZTEN MONAT (d.h. in<br />
den letzten vier Wochen bis einschließlich heute) von diesem Problem betroffen waren. Die Fragen sollten<br />
Sie dabei auf Ihr schlimmstes Erlebnis beziehen.<br />
Dabei bedeutet<br />
0 = überhaupt nicht oder nur einmal im letzten Monat<br />
1 = einmal pro Woche oder seltener/ manchmal<br />
2 = 2 bis 4 mal pro Woche/ die Hälfte der Zeit<br />
3 = 5 mal oder öfter pro Woche/ fast immer<br />
0 1 2 3 Hatten Sie belastende Gedanken oder Erinnerungen an das Erlebnis, die ungewollt<br />
auftraten und Ihnen durch den Kopf gingen, obwohl Sie nicht daran denken wollten?<br />
0 1 2 3 Hatten Sie schlechte Träume oder Alptraume über das Erlebnis?<br />
0 1 2 3 War es, als würden Sie das Ereignis plötzlich noch einmal durchleben, oder<br />
handelten oder fühlten Sie so, als würde es wieder passieren?<br />
0 1 2 3 Belastete es Sie, wenn Sie an das Erlebnis erinnert wurden (fühlten Sie sich z.B.<br />
ängstlich, ärgerlich, traurig, schuldig usw.)?<br />
0 1 2 3 Hatten Sie körperliche Reaktionen (z.B. Schweißausbruch oder Herzklopfen),<br />
wenn Sie an das Erlebnis erinnert wurden?<br />
0 1 2 3 Haben Sie sich bemüht, nicht an das Erlebnis zu denken, nicht darüber zu reden<br />
oder damit verbundene Gefühle zu unterdrücken?<br />
0 1 2 3 Haben Sie sich bemüht, Aktivitäten, Menschen oder Orte zu meiden, die Sie an das<br />
Erlebnis erinnern?<br />
0 1 2 3 Konnten / können Sie sich an einen wichtigen Bestandteil des Erlebnisses nicht<br />
erinnern?<br />
0 1 2 3 Hatten Sie deutlich weniger Interesse an Aktivitäten, die vor dem Erlebnis für Sie<br />
wichtig waren, oder haben Sie sie deutlich seltener unternommen?<br />
0 1 2 3 Fühlten Sie sich Menschen in Ihrer Umgebung gegenüber entfremdet oder isoliert?<br />
0 1 2 3 Fühlten Sie sich abgestumpft oder taub (z.B. nicht weinen zu können oder sich<br />
unfähig fühlen, liebevolle Gefühle zu erleben)?<br />
0 1 2 3 Hatten Sie das Gefühl, dass sich Ihre Zukunftspläne und Hoffnungen nicht erfüllen<br />
werden (z.B. dass Sie im Beruf keinen Erfolg haben, nie heiraten, keine Kinder<br />
haben oder kein langes Leben haben werden)?
VIII. Anhang E 147<br />
0 1 2 3 Hatten Sie Schwierigkeiten, ein- oder durchzuschlafen?<br />
0 1 2 3 Waren Sie reizbar oder hatten Sie Wutausbrüche?<br />
0 1 2 3 Hatten Sie Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren (z.B. während eines Gespräches<br />
in Gedanken abschweifen; beim Ansehen einer Fernsehsendung den Faden<br />
verlieren; vergessen, was Sie gerade gelesen haben)?<br />
0 1 2 3 Waren Sie übermäßig wachsam (z.B. nachprüfen, wer in Ihrer Nähe ist; sich<br />
unwohl fühlen, wenn Sie mit dem Rücken zur Tür sitzen; usw.)?<br />
0 1 2 3 Waren Sie nervös oder schreckhaft (z.B. wenn jemand hinter Ihnen geht)?<br />
PDS<br />
Wie lange haben Sie schon die Problem, die Sie in Teil 3 angegeben haben?<br />
(Bitte kreuzen Sie eine der Antwortmöglichkeiten an)<br />
<br />
<br />
<br />
weniger als einem Monat<br />
1 bis 3 Monate<br />
über 3 Monate<br />
Wann nach dem traumatischen Erlebnis traten diese Probleme auf?<br />
(Bitte kreuzen Sie eine der Antwortmöglichkeiten an)<br />
<br />
<br />
innerhalb der ersten 6 Monate<br />
nach 6 Monaten und später<br />
TEIL 4<br />
Bitte geben Sie an, ob die Probleme, die Sie in Teil 3 angegeben haben, Sie IM LETZTEN MONAT in<br />
den unten aufgeführten Bereichen Ihres Lebens beeinträchtigt haben. Bitte kreuzen Sie JA an, wenn<br />
eine Beeinträchtigung vorlag, und NEIN, wenn dies nicht der Fall war.<br />
JA NEIN Arbeit<br />
JA NEIN Hausarbeit und Haushaltspflichten<br />
JA NEIN Beziehungen zu Freunden<br />
JA NEIN Unterhaltung und Freizeitaktivitäten<br />
JA NEIN (Hoch-)Schule / Ausbildung<br />
JA NEIN Beziehungen zu Familienmitgliedern<br />
JA NEIN Erotik<br />
JA NEIN Allgemeine Lebenszufriedenheit<br />
JA NEIN Allgemeine Leistungsfähigkeit in allen Lebensbereichen
VIII. Anhang F 148<br />
Cut-Off-Werte (Schöttke, 2007, persönl. Mitteilung), die den Übergang vom Persönlichkeitsstil<br />
zur Persönlichkeitsstörung markieren für den Fragebogen zum Persönlichkeitsselbstportrait<br />
(Oldham & Morris, 1988).<br />
paranoid > 8<br />
schitzotypisch > 12<br />
borderline > 14<br />
histrionisch > 14<br />
narzisstisch > 12<br />
selbstunsicher > 8<br />
abhängig > 12<br />
zwanghaft > 14<br />
passiv-aggressiv > 16<br />
antisozial > 10<br />
Anmerkung:<br />
Die Cut-off-Werte befinden sich noch in der Entwicklung und sind noch nicht<br />
abschließend validiert. Sie können somit nur zur Diagnostik von „Verdachtsdiagnosen“<br />
verwandt werden und sollten zudem mittels SKID II überprüft werden.
Erklärung 149<br />
Hiermit versichere ich, die <strong>Diplomarbeit</strong>: „Persönlichkeit, Bindung und traumatische<br />
Erfahrungen bei alkohol- und/oder drogenabhängigen Männern“ selbständig verfasst<br />
und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt zu haben.<br />
Münster, 07.05.2007<br />
Axel <strong>Bensmann</strong>