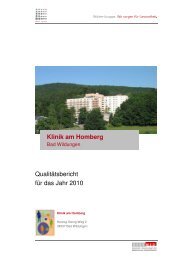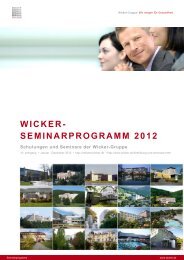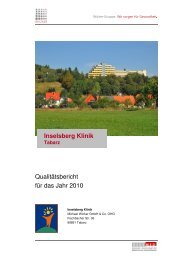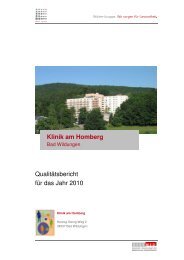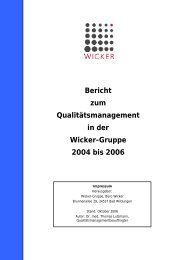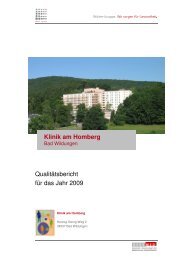Hardtwaldklinik II - Qualitätsmanagement und Evaluation der Wicker ...
Hardtwaldklinik II - Qualitätsmanagement und Evaluation der Wicker ...
Hardtwaldklinik II - Qualitätsmanagement und Evaluation der Wicker ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Bezug auf körperliche, seelische <strong>und</strong> soziale Fähigkeiten sowie auf Aktivität <strong>und</strong> Teilhabe<br />
im beruflichen <strong>und</strong> sozialen Bereich sind erheblich. Bei fehlen<strong>der</strong> o<strong>der</strong> zu später adäquater<br />
Behandlung sind lange Arbeitsunfähigkeitszeiten, Arbeitsplatzverlust, bleibende Behin<strong>der</strong>ungen<br />
<strong>und</strong> Min<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Erwerbsfähigkeit die Folgen.<br />
So wie die strukturbezogene Psychotherapie unterschiedliche therapeutische Vorgehensweisen<br />
bei konflikt-neurotischen <strong>und</strong> strukturellen Störungen vorsieht, bedürfen<br />
traumabedingte Störungen auch spezialisierte Behandlungsformen. In dem traumatherapeutischen<br />
Setting <strong>der</strong> Abteilung richten wir uns nach den Behandlungsleitlinien <strong>der</strong> Arbeitsgemeinschaft<br />
<strong>der</strong> wissenschaftlich medizinischen Fachgesellschaften (AWMF) <strong>und</strong><br />
den fortlaufend aktualisierten Empfehlungen <strong>der</strong> Deutschen Gesellschaft für Psychotraumatologie<br />
(DeGPT).<br />
Gr<strong>und</strong>sätzlich werden als wesentliche Behandlungsschwerpunkte bei posttraumatischen<br />
Belastungsstörungen die Bereiche Stabilisierung, Traumaexposition <strong>und</strong> Integration beschrieben.<br />
Wie die klinische Arbeit mit traumatisierten Menschen zeigt <strong>und</strong> die Forschung<br />
zu traumabedingten Folgestörungen zunehmend belegt, sind Therapieansätze mit einer<br />
strengen Abgrenzung dieser Bereiche <strong>und</strong> einem ausschließlich linearen Ablauf im Sinne<br />
einer Phasenbehandlung weniger effektiv <strong>und</strong> nachhaltig. Stattdessen ist erkennbar,<br />
dass ein integratives <strong>und</strong> prozessorientiertes Vorgehen zur nachhaltigen Gewährleistung<br />
von Aktivität <strong>und</strong> Teilhabe im sozialen <strong>und</strong> beruflichen Kontext bevorzugt werden sollte.<br />
In unserer Abteilung wird seit Jahren ein <strong>der</strong>artiger integrativer Behandlungsansatz mit<br />
gutem Erfolg umgesetzt. Dabei werden vor allem die ressourcenorientierten <strong>und</strong> selbstwertstärkenden<br />
Verfahren aus <strong>der</strong> Gestalttherapie genutzt. Das Wie<strong>der</strong>erlangen eines<br />
basalen Sicherheitsgefühls, die Selbstregulation überschießen<strong>der</strong> Affekte in sozialen<br />
Interaktionen <strong>und</strong> die Entwicklung funktionaler Bewältigungs-Strategien bei psychosozialer<br />
Belastung sind wesentliche Ziele <strong>der</strong> Behandlung. Bei ausreichen<strong>der</strong> Stabilisierung<br />
können zur weiteren Reduktion einer posttraumatischen Belastungssymptomatik zusätzlich<br />
auch klassische Traumaexpositionstechniken wie EMDR o<strong>der</strong> Screen-Technik angewandt<br />
werden.<br />
Traumaspezifische Rehabilitation bedeutet nach unserer Konzeption die För<strong>der</strong>ung aller<br />
verfügbarer Potentiale <strong>und</strong> ein gegenwarts-bezogenes, handlungs- <strong>und</strong> zielorientiertes<br />
Vorgehen mit <strong>der</strong> Absicht weitgehen<strong>der</strong> sozialer <strong>und</strong> beruflicher Integration.<br />
Geschlechtsspezifische Rehabilitation<br />
In den letzten Jahren wird zunehmend die Bedeutung geschlechts-spezifischer Aspekte<br />
bei <strong>der</strong> Entstehung <strong>und</strong> Behandlung psychogener <strong>und</strong> psychosomatischer Erkrankungen<br />
hervorgehoben. Dabei finden die unterschiedlichen Erlebens- <strong>und</strong> Bewältigungsformen<br />
von Frauen <strong>und</strong> Männern bei sozialem <strong>und</strong> beruflichem Stress <strong>und</strong> die divergenten sozialen<br />
Realitäten hinsichtlich Berufswahl <strong>und</strong> Mobilität beson<strong>der</strong>e Beachtung. Hinzu kommen<br />
die sich zunehmend verän<strong>der</strong>nden Rollenverständnisse <strong>der</strong> Geschlechter <strong>und</strong> sich<br />
daraus ergebenden Konfliktkonstellationen. Schließlich haben die unterschiedlichen Einstellungen<br />
zur eigenen Körperlichkeit erheblichen Einfluss auf das jeweilige Ges<strong>und</strong>heitsverhalten<br />
von Frauen <strong>und</strong> Männern.<br />
Aufgr<strong>und</strong> <strong>der</strong> genannten, nicht selten deutlichen Unterschiede liegt eine Integration geschlechtsspezifischer<br />
Behandlungsmodule in <strong>der</strong> medizinischen Rehabilitation nahe. In<br />
<strong>der</strong> Abteilung wird dieser Ansatz bereits seit über zehn Jahren mit guten Erfahrungen<br />
umgesetzt. Dabei zeigt sich, dass im Rahmen einer geschlechtshomogenen Gruppenzusammensetzung<br />
geschlechtspezifische Themen mit hoher Intensität <strong>und</strong> Vertrautheit<br />
behandelt werden können.<br />
Konflikte <strong>und</strong> Kränkungen am Arbeitsplatz sowie offene o<strong>der</strong> latente partnerschaftliche<br />
Konfliktkonstellationen stehen dabei oft im Vor<strong>der</strong>gr<strong>und</strong>. Hiervon ausgehend werden<br />
Seite 16