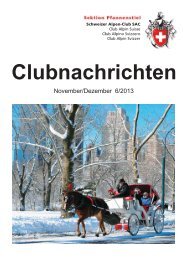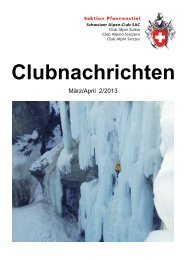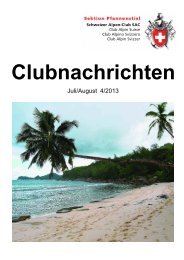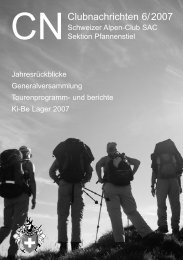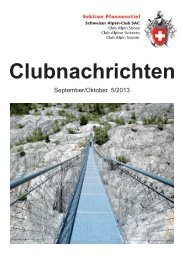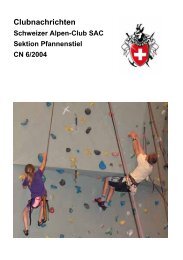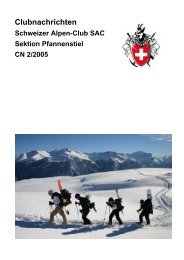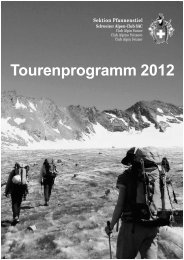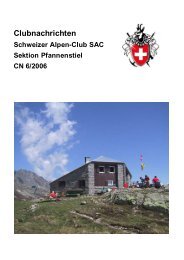CN3 2002 - SAC Sektion Pfannenstiel
CN3 2002 - SAC Sektion Pfannenstiel
CN3 2002 - SAC Sektion Pfannenstiel
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Wenn das Alpenwetter im Computer stattfindet<br />
Eugen Müller, Meteorologe und Prognostiker bei MeteoSchweiz, Zürich<br />
Heutige Wetterprognosen beruhen zu einem<br />
grossen Teil auf den Berechnungen<br />
numerischer Modelle, d.h. leistungsstarke<br />
Supercomputer berechnen mit Hilfe von<br />
mathematisch-physikalischen Gleichungen<br />
die atmosphärischen Prozesse voraus.<br />
Als Faustregel gilt: Je weiter voraus ein<br />
Meteorologe das Wetter prognostizieren<br />
will, desto mehr muss er sich auf Computermodelle<br />
abstützen. Um das Wetter für<br />
die nächsten paar Stunden oder je nach<br />
Wetterlage sogar für einen Tag vorauszusagen,<br />
sind das dichte Wetterbeobachtungsnetz<br />
sowie Radar- und Satelliteninformationen<br />
meist ausreichend (Kürzest- und<br />
Kurzfristprognose). Will man aber eine<br />
Prognose für mehrere Tage wagen (Mittelfristprognose),<br />
so bilden die Ergebnisse<br />
von Computersimulationen und zunehmend<br />
auch deren statistisch bearbeiteten<br />
Werte die Hauptbasis dazu.<br />
Die Anfänge<br />
Die ersten Ueberlegungen zur numerischen<br />
Wettervorhersage gehen bis in die<br />
1920er Jahre zurück. Aber erst mit der Entwicklung<br />
vom Computer und dem stark<br />
wachsenden Beobachtungsnetz nach dem<br />
Zweiten Weltkrieg waren die Voraussetzungen<br />
gegeben, und 1950 konnte die erste<br />
numerische Wettervorhersage gemacht<br />
werden. Die weitere Entwicklung bis zu<br />
den heutigen hochaufgelösten Modellen<br />
kam Schritt um Schritt mit der rasanten<br />
Steigerung der Rechenkapazität von Supercomputern<br />
voran.<br />
Aufbau eines Modells<br />
Ein Wettervorhersagemodell ist ein sehr<br />
komplexes System. Dabei wird um die<br />
Erdkugel herum ein Gitternetz gelegt. Je<br />
engmaschiger das Gitter ist, desto realer<br />
wird die Erdoberfläche abgebildet. Je nach<br />
Modellauflösung bewegt sich der Abstand<br />
von Gitterpunkt zu Gitterpunkt zwischen 7<br />
und 60 km, so dass z.B. auch die Alpen<br />
unterschiedlich genau wiedergegeben werden.<br />
In einem grob aufgelösten Modell weisen<br />
die Alpen stark geglättete Strukturen<br />
ohne einzelne Täler und Berge sowie eine<br />
maximale Höhe von nur 2300m auf. Ein<br />
solches Modell kann daher spezifische<br />
Phänomene vor allem im inneralpinen<br />
Raum, wie zum Beispiel Föhn im Haslital,<br />
gar nicht simulieren, weil allein schon das<br />
Tal im Modell nicht vorhanden ist. Etwas<br />
anders sieht es bei Modellen mit einer höher<br />
aufgelösten Topografie aus. Im Alpen-<br />
Modell (aLMo) von MeteoSchweiz mit<br />
einem Gitterpunktabstand von 7 km sind<br />
die Alpen deutlich feiner strukturiert dargestellt<br />
und die maximale Höhe beträgt<br />
immerhin rund 3400 m. Grössere Alpentäler<br />
wie etwa das Rheintal oder das Zentralwallis<br />
sind in der Modelltopografie enthalten<br />
(Abb.1). So kommt zum Beispiel<br />
auch die räumliche Verteilung des Niederschlags<br />
schon etwas näher an die Realität<br />
heran. In der Vertikalen wird die Modellatmosphäre<br />
in 30 bis 60 Schichten unter-<br />
Abb.1 Ausschnitt der Topografie des bei Meteo-<br />
Schweiz operationell betriebenen Modells aLMo mit<br />
Gitterpunktabstand von 7 km. Grob aber gut erkennbar<br />
das Zentralwallis und das Rheintal.<br />
CN <strong>Pfannenstiel</strong> 3/<strong>2002</strong> 31