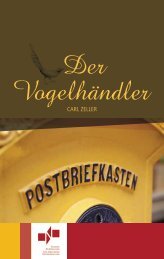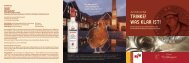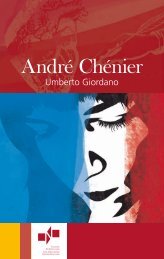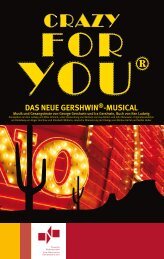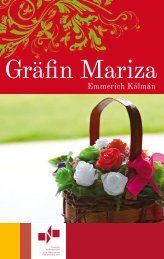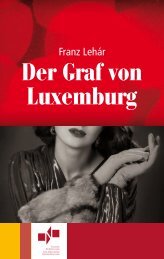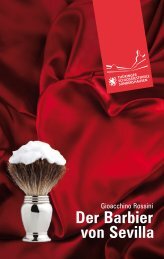Programmheft - 4. Sinfoniekonzert - Theater Nordhausen
Programmheft - 4. Sinfoniekonzert - Theater Nordhausen
Programmheft - 4. Sinfoniekonzert - Theater Nordhausen
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
ment des Sängers. „Die ersten Tacte, Mephisto betritt mit Faust ein Wirtshaus,<br />
1848 und schloss ihn 1864 in seiner Zeit dem am Ende, nach dem unerbittlichen<br />
6 in dem eine bäuerliche Hochzeit<br />
im italienischen Kloster Madonna del Cantus firmus der Posaunen der Absturz<br />
feierliche Harfen-Arpeggios, lassen<br />
uns den königlichen Sänger inmitten mit Gesang und Tanz gefeiert wird. Me-<br />
Rosario schließlich ab.<br />
folgt“ (Barbara Meier). Liszt schuf mit<br />
7<br />
der Natur und ihrer Bewohner erschauen<br />
und die Kraft des Tones suchen“<br />
schrieb Felix Draeseke 1858 in seiner<br />
Abhandlung über Liszts „Orpheus“. „Er<br />
hat gesiegt der göttliche Klang, gerührt<br />
und erweicht horchen Steine, Pflanzen<br />
und Thiere dem Verkünder der heiligen<br />
Kunst, der mit milder Hoheit jetzt einherschreitet,<br />
seine Bahn zu erweitern.“<br />
In den Celli und Hörnern ist das lyrische<br />
Hauptthema zu vernehmen. Den Mittelteil<br />
beherrschen Soli in den Streichern<br />
mit einer klagenden, zwischen Dur und<br />
Moll wechselnden Melodie. Ob Orpheus<br />
hier, wie Draeseke vermutet, den Verlust<br />
seiner Eurydike beweint? Das Werk<br />
schließt völlig entrückt immer leiser<br />
werdend in chromatisch aufsteigenden<br />
Akkorden bis zum reinen C-Dur. Hier<br />
mag Orpheus’ Entschwinden zum Ausdruck<br />
gebracht sein, der es fortan den<br />
Menschen überlässt, seine Lehren ohne<br />
ihn zu verbreiten. Ganz im Sinne des<br />
Philosophen und Schriftstellers Pierre-<br />
Simon Ballanche, von dessen „Orpheé“<br />
(1829) sich Liszts Orpheus-Bild ableitete.<br />
In eine gänzlich andere Welt, ins Diabolische,<br />
Wilde und Ungebändigte, führen<br />
der Mephisto-Walzer Nr. 1 und der „Totentanz“.<br />
In Weimar schrieb Liszt neben<br />
seinen Symphonischen Dichtungen zwei<br />
Sinfonien und kleinere Orchesterwerke,<br />
darunter 1857–1861 „Zwei Episoden aus<br />
Lenaus Faust“. Daraus bearbeitete er<br />
den „Tanz in der Dorfschenke“ für Klavier<br />
(Mephisto-Walzer Nr. 1). Faust faszinierte<br />
Liszt, in seiner „Faust-Sinfonie“<br />
war es der Faust Goethes. Nikolaus<br />
Lenau (1802–1850) griff Aspekte der<br />
phisto nimmt dem Geiger sein Instrument<br />
aus der Hand, um eine Musik „voll<br />
Blut und Brand“ anzustimmen, wie es<br />
in Lenaus Faust-Dichtung heißt, diabolisch<br />
und zügellos. Chromatische Vorschlagsnoten<br />
nehmen das Diabolische<br />
vorweg, in den leeren Quinten des Klaviers<br />
tönen die leeren Saiten der Geige.<br />
Weicher klingt das Thema Fausts. „In<br />
atemberaubendem Tempo wirbelt das<br />
Thema durch alle Lagen (…). Aus dem<br />
‚bacchantischen Kreisen‘ entfernt sich<br />
Faust mit seiner Tänzerin, wie die intime<br />
Themenvariante mit den verführerischen<br />
Trillern der Nachtigall zeigt – eine<br />
trügerische Szene, der ein wilder Presto-<br />
Schluss ein Ende setzt.“ (Barbara Meier)<br />
Den „Totentanz. Paraphrase über Dies<br />
irae“ für Klavier und Orchester komponierte<br />
Liszt in mehreren Phasen, immer<br />
wieder etwas daran verändernd seit<br />
Liszt griff hier ein altes Thema auf, das<br />
zunächst über viele Jahrhunderte hinweg<br />
diverse bildliche Darstellungen erfuhr:<br />
die Gewalt des Todes über das<br />
Menschenleben. Berühmt wurde der<br />
Holzschnitt von Hans Holbein dem Jüngeren;<br />
auf über 30 Bildern zeigte der<br />
Künstler in seinem „Totentanz“ nicht<br />
nur, dass der Tod kein Alter und Stand<br />
verschont, sondern völlig unerwartet<br />
mitten hinein ins Leben treten kann.<br />
Holbeins Holzschnitt inspirierte Liszt<br />
ebenso wie ein Fresko aus Pisa „Trionfo<br />
della Morte“ (13. Jahrhundert). Die Sequenz<br />
„Dies irae“ („Tag des Zorns“) aus<br />
der Totenmesse kehrt in Variationen immer<br />
wieder und ist musikalische Grundlage<br />
für eine aufreibende Musik, die<br />
einen düsteren Blick auf die Menschheit<br />
und deren Schicksal wirft.<br />
Unheilvoll ist der Anfang. Dissonante<br />
und hart stampfende Akkorde aus Sekunden<br />
und dem Teufelsintervall Tritonus<br />
(„Diabolus in musicae“) im Klavier<br />
leiten das Werk ein. Dazu entfaltet sich<br />
das Dies-irae-Thema in ruhiger Bewegung<br />
in den tiefen Streichern, Blechund<br />
Holzbläsern. Kühne harmonische<br />
Verbindungen, peitschende Klavierklänge<br />
und wie Hohngelächter anmutende<br />
hohe Triller und Glissandi beherrschen<br />
das Klangbild im weiteren Verlauf. Nur<br />
an wenigen Stellen kehrt etwa Ruhe ein.<br />
Marschartig erscheinen Variation eins<br />
und zwei. Im „Fugato“ (Variation V) löst<br />
sich die zunächst streng anmutende<br />
Schreibweise nach und nach auf in<br />
wilde Akkordjagd und tosende Läufe.<br />
Im gesamten Klavierpart „von geradezu<br />
expressiver Virtuosität ist die diabolische<br />
dem „Totentanz“ ein klanglich weit in<br />
das 20. Jahrhundert vorausweisendes<br />
Werk.<br />
„DIE EINE WEINT, DIE ANDRE LACHT“ –<br />
BRAHMS’ OUVERTÜREN<br />
von Harald Hodeige<br />
Dass in der Brahms-Literatur die „Akademische<br />
Festouvertüre“ c-Moll op. 80<br />
und die „Tragische Ouvertüre“ d-Moll<br />
op. 81 als zwei zusammengehörige Werke<br />
behandelt werden, hat mehrere gute<br />
Gründe: Beide Stücke entstanden in enger<br />
zeitlicher Abfolge im Sommer 1880<br />
in Bad Ischl, erschienen zusammen im<br />
Druck und wurden von Brahms selbst in<br />
Konzerten gemeinsam aufgeführt.<br />
Die „Akademische Festouvertüre“<br />
schrieb Brahms für die Promotionsfeier<br />
anlässlich der Verleihung der Ehrendoktorwürde<br />
durch die Universität Breslau.<br />
Inwieweit die „Tragische Ouvertüre“ im<br />
Zusammenhang mit einer geplanten<br />
Aufführung von Goethes „Faust“ am<br />
Wiener Burgtheater entstanden ist, wie<br />
der Brahms-Biograf Max Kalbeck vermutete,<br />
lässt sich heute nicht mehr<br />
klären. Neben diesen eher äußerlichen<br />
Bezugspunkten stehen die Stücke in<br />
einem engen inhaltlichen Zusammenhang,<br />
da sie ein für Brahms’ Schaffen<br />
typisches komplementäres Werkpaar<br />
bilden: „Die eine weint, die andre<br />
lacht“, schrieb der Komponist lapidar<br />
an den Komponisten, Pianisten<br />
und Dirigenten Carl Reinecke. Am 6.<br />
September 1880 schrieb der Komponist<br />
mit der ihm eigenen Ironie an seinen<br />
Lust zu spüren, mit welcher der Verleger Simrock: „Ich habe nicht umhin<br />
Faust-Sage auf, die Goethe nicht berücksichtigt<br />
hatte.<br />
„Totentanz“ (um 1525)<br />
Tanz über dem Abgrund vorgeführt wird, können, eine sehr lustige<br />
Ausschnitt aus Hans Holbeins Holzschnitt<br />
Akademische