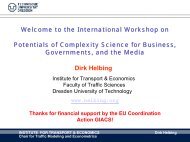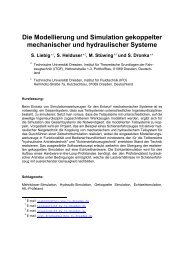Privatisierung und Re-Regulierung der deutschen Flughäfen unter ...
Privatisierung und Re-Regulierung der deutschen Flughäfen unter ...
Privatisierung und Re-Regulierung der deutschen Flughäfen unter ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Privatisierung</strong> <strong>und</strong> <strong>Re</strong>-<strong>Re</strong>gulierung <strong>der</strong><br />
<strong>deutschen</strong> Flughäfen<br />
<strong>unter</strong> Berücksichtigung internationaler<br />
Erfahrungen 1<br />
T. Beckers a,1 , J.-S. Fritz a,2 , C. v. Hirschhausen a,3 <strong>und</strong> S. Müller a,4<br />
a TU Berlin, Fachgebiet Wirtschafts- <strong>und</strong> Infrastrukturpolitik (WIP),<br />
Sekretariat H 33 (Raum H 3150), Straße des 17. Juni 135, 10623 Berlin<br />
Kurzfassung: In diesem Beitrag werden Optionen für eine <strong>Privatisierung</strong> <strong>und</strong> <strong>Re</strong>-<br />
<strong>Re</strong>gulierung <strong>der</strong> Verkehrsflughäfen in Deutschland <strong>unter</strong>sucht. Dabei werden die jüngsten<br />
internationalen Erfahrungen mit <strong>der</strong> <strong>Privatisierung</strong> <strong>und</strong> <strong>Re</strong>gulierung von Flughäfen<br />
berücksichtigt. In Großbritannien, Neuseeland <strong>und</strong> Australien wurden unlängst die dort in<br />
den vergangenen Jahren implementierten <strong>Re</strong>gulierungskonzepte modifiziert, wobei<br />
tendenziell eine <strong>Re</strong>duktion <strong>der</strong> <strong>Re</strong>gulierungsintensität zu beobachten war. Aufbauend auf<br />
einer Analyse <strong>der</strong> Marktmacht <strong>der</strong> drei Flughafentypen in Deutschland (Primär-, Sek<strong>und</strong>är<br />
<strong>und</strong> Tertiärflughäfen) werden jeweils verschiedene <strong>Re</strong>gulierungsverfahren <strong>unter</strong>sucht.<br />
Es wird vorgeschlagen, die bisherige ineffiziente <strong>Re</strong>gulierung nach dem Kostenzuschlagsprinzip<br />
durch ein neues <strong>Re</strong>gulierungssystem zu ersetzen <strong>und</strong> dann die <strong>deutschen</strong><br />
Flughäfen zu privatisieren. Eine b<strong>und</strong>esweite <strong>Re</strong>gulierungsinstitution sollte ein<br />
<strong>Re</strong>gulierungssystem nach dem Price-Cap-Verfahren <strong>und</strong> dem Dual-Till-Konzept für Primär<strong>und</strong><br />
Sek<strong>und</strong>ärflughäfen ausarbeiten. Dieses Konzept sollte den Marktteilnehmern als<br />
Ausgangspunkt für eine korporatistische Verhandlungslösung vorgelegt werden <strong>und</strong> als<br />
<strong>Re</strong>gulierungsandrohung für einzelne Flughäfen dienen. Aufgr<strong>und</strong> <strong>der</strong> begrenzten<br />
Marktmacht, verschiedener Interessenkongruenzen <strong>der</strong> Beteiligten <strong>und</strong> sektoraler<br />
Beson<strong>der</strong>heiten kann durch eine <strong>der</strong>artige korporatistische <strong>Re</strong>gulierung – im Gegensatz z.B.<br />
zum Energiesektor – eine gesamtwirtschaftlich sinnvolle Lösung erreicht werden. Für<br />
Tertiärflughäfen wird als <strong>Re</strong>gulierung ein Monitoring nach australischem Vorbild empfohlen.<br />
Schlagworte: Flughafen; Marktmacht; <strong>Privatisierung</strong>; <strong>Re</strong>gulierung; Deutschland;<br />
Großbritannien; Neuseeland; Australien; Korporatistische <strong>Re</strong>gulierung<br />
1 Dieser Beitrag basiert auf Vorarbeiten eines studentischen Projektes, das im Sommersemester 2002 am<br />
Fachgebiet Wirtschafts- <strong>und</strong> Infrastrukturpolitik (WIP) <strong>der</strong> TU Berlin durchgeführt wurde. An dem Projekt<br />
haben die Studierenden Jörg-Stefan Fritz (Koordination), Gregor Farchmin, Axel Garbrecht, Martin<br />
Herrmann, Stephan Kuhn, Stefan Müller, Gregor Rasch <strong>und</strong> Wojtek Slimok teilgenommen. Die<br />
wissenschaftliche Leitung erfolgte durch PD Dr. Christian von Hirschhausen, die Betreuung <strong>und</strong> Koordination<br />
des Projektes wurde durch Dipl.-Ing. Thorsten Beckers wahrgenommen.<br />
1 Korrespondieren<strong>der</strong> Autor. E-mail: tb@wip.tu-berlin.de, URL: wip.tu-berlin.de<br />
2 E-mail: jsf@wip.tu-berlin.de, URL: wip.tu-berlin.de<br />
3 E-mail: cvh@wip.tu-berlin.de, URL: wip.tu-berlin.de<br />
4 E-mail: smueller@araneus.de
Inhaltsverzeichnis<br />
1 Einleitung ........................................................................................................................... 4<br />
2 Gr<strong>und</strong>lagen <strong>der</strong> Analyse <strong>und</strong> Ausgangslage ...................................................................... 6<br />
2.1 Technische <strong>und</strong> ökonomische Charakteristika eines Flughafens............................... 6<br />
2.2 Tendenzen im Luftverkehr <strong>und</strong> <strong>der</strong>en Auswirkungen auf die Flughäfen .................. 8<br />
2.3 Ausgangslage im <strong>deutschen</strong> Flughafenmarkt........................................................... 10<br />
3 <strong>Privatisierung</strong> ................................................................................................................... 16<br />
3.1 Theoretische Überlegungen...................................................................................... 16<br />
3.2 Schlussfolgerungen aus den Erfahrungen in Großbritannien, Neuseeland <strong>und</strong><br />
Australien ................................................................................................................. 19<br />
3.3 Empfehlungen für die <strong>Privatisierung</strong> <strong>der</strong> Flughäfen in Deutschland....................... 20<br />
4 Abschätzung <strong>der</strong> Marktmacht <strong>der</strong> <strong>deutschen</strong> Flughäfen .................................................. 21<br />
4.1 Theoretische Gr<strong>und</strong>lagen ......................................................................................... 21<br />
4.1.1 Marktmacht im Aviation-Bereich .................................................................... 22<br />
4.1.2 Marktmacht im Non-Aviation-Bereich ............................................................ 27<br />
4.1.3 Exkurs: Möglichkeiten zur Abschöpfung <strong>der</strong> Zahlungsbereitschaft <strong>der</strong><br />
Nachfrager durch einen Flughafen mit Marktmacht ........................................ 28<br />
4.1.4 Zwischenfazit ................................................................................................... 29<br />
4.2 Schlussfolgerungen aus den Erfahrungen in Großbritannien, Neuseeland <strong>und</strong><br />
Australien ................................................................................................................. 30<br />
4.3 Abschätzung <strong>der</strong> Marktmacht <strong>der</strong> <strong>deutschen</strong> Flughäfen .......................................... 30<br />
4.3.1 Marktmacht im Aviation-Bereich .................................................................... 30<br />
4.3.2 Marktmacht im Non-Aviation-Bereich ............................................................ 36<br />
4.3.3 <strong>Re</strong>sümee <strong>der</strong> Marktmachtabschätzung für die <strong>deutschen</strong> Verkehrsflughäfen . 36<br />
5 Exkurs: Interdependenzen zwischen Marktmacht, <strong>Re</strong>gulierung <strong>und</strong> Slotallokation ....... 39<br />
5.1 Theoretische Gr<strong>und</strong>lagen ......................................................................................... 39<br />
5.2 Wirtschaftspolitische Handlungsempfehlungen....................................................... 41<br />
6 <strong>Re</strong>gulierungssystem ......................................................................................................... 42<br />
6.1 Theoretische Gr<strong>und</strong>lagen ......................................................................................... 42<br />
6.1.1 <strong>Re</strong>gulierungsbasis: Single-Till vs. Dual-Till.................................................... 42<br />
6.1.2 Klassische <strong>Re</strong>gulierungsverfahren ................................................................... 44<br />
2
6.1.3 Korporatistische <strong>Re</strong>gulierung........................................................................... 49<br />
6.1.4 Ansiedlung <strong>und</strong> Kompetenzbereich einer <strong>Re</strong>gulierungsinstitution.................. 54<br />
6.2 Schlussfolgerungen aus den Erfahrungen in Großbritannien, Neuseeland <strong>und</strong><br />
Australien ................................................................................................................. 55<br />
6.2.1 <strong>Re</strong>gulierungsverfahren <strong>und</strong> -basis.................................................................... 55<br />
6.2.2 <strong>Re</strong>gulierungsinstitutionen................................................................................. 56<br />
6.2.3 <strong>Re</strong>sümee <strong>der</strong> internationalen <strong>Re</strong>gulierungserfahrungen .................................. 57<br />
6.3 Empfehlung für Deutschland ................................................................................... 57<br />
6.3.1 <strong>Re</strong>gulierungsverfahren <strong>und</strong> -basis sowie Beteiligung <strong>der</strong> Marktteilnehmer.... 57<br />
6.3.2 <strong>Re</strong>gulierungsinstitution .................................................................................... 61<br />
6.3.3 Konkretisierung des wirtschaftspolitischen Handlungsbedarfs ....................... 62<br />
7 Wettbewerbspolitik – Horizontale Integration................................................................. 63<br />
7.1 Theoretische Gr<strong>und</strong>lagen ......................................................................................... 63<br />
7.2 Schlussfolgerungen aus den Erfahrungen in Großbritannien, Neuseeland <strong>und</strong><br />
Australien ................................................................................................................. 64<br />
7.3 Empfehlungen für Deutschland................................................................................ 64<br />
8 Zusammenfassung <strong>und</strong> Schlussfolgerungen .................................................................... 66<br />
8.1 Zusammenfassung <strong>der</strong> Ergebnisse ........................................................................... 66<br />
8.2 Schlussfolgerungen <strong>und</strong> Ausblick............................................................................ 68<br />
Tabellen-, Abbildungs- <strong>und</strong> Literaturverzeichnis .................................................................... 70<br />
Tabellenverzeichnis.............................................................................................................. 70<br />
Abbildungsverzeichnis ......................................................................................................... 70<br />
Literaturverzeichnis.............................................................................................................. 71<br />
Anhang: Internationale Erfahrungen mit <strong>der</strong> <strong>Privatisierung</strong> <strong>und</strong> <strong>Re</strong>gulierung von Flughäfen 77<br />
A.1) Großbritannien ................................................................................................................. 77<br />
A.2) Neuseeland....................................................................................................................... 80<br />
A.3) Australien ......................................................................................................................... 83<br />
A.4) <strong>Re</strong>sümee........................................................................................................................... 86<br />
3
1 Einleitung<br />
Defizite bei <strong>der</strong> <strong>Privatisierung</strong> <strong>und</strong> <strong>Re</strong>gulierung von Flughäfen in Deutschland<br />
In Deutschland ist die öffentliche Hand nach wie vor alleiniger bzw. Mehrheits-Eigentümer<br />
<strong>der</strong> 18 internationalen Verkehrsflughäfen. Die <strong>Re</strong>gulierung <strong>der</strong> traditionell als Monopole<br />
angesehenen Flughäfen erfolgt nach dem Kostenzuschlagsprinzip durch Behörden auf<br />
Landesebene, die i.d.R. für die komplexe Aufgabe <strong>der</strong> Flughafenregulierung nicht<br />
ausreichend ausgestattet sind. Bei den größeren <strong>deutschen</strong> Flughäfen (z.B. Düsseldorf,<br />
Hamburg <strong>und</strong> Frankfurt) wurden in den letzten Jahren Teilprivatisierungen durchgeführt.<br />
Bisher gibt es jedoch in Deutschland keine ernsthaften Ansätze <strong>der</strong> Politik, eine <strong>Re</strong>-<br />
<strong>Re</strong>gulierung <strong>und</strong> <strong>Privatisierung</strong> <strong>der</strong> Flughäfen mit dem Ziel <strong>der</strong> Wohlfahrtssteigerung<br />
durchzuführen. Insbeson<strong>der</strong>e aufgr<strong>und</strong> des – im Vergleich zu an<strong>der</strong>en Verkehrsinfrastrukturen<br />
wie z.B. Straßen – sehr großen Innovationspotenzials bei Flughäfen <strong>und</strong> des zunehmenden<br />
Kapitalbedarfs wird eine <strong>Privatisierung</strong> von <strong>der</strong> Literatur einhellig gefor<strong>der</strong>t (Wolf 1997;<br />
Forsyth 2001). Vor dem Hintergr<strong>und</strong> <strong>der</strong> international gesammelten Erfahrungen ist darüber<br />
hinaus die deutsche <strong>Re</strong>gulierungspraxis als ineffizient anzusehen (Niemeier 2002).<br />
Neue internationale Entwicklungen zur <strong>Re</strong>gulierung von Flughäfen<br />
Im Gegensatz zu Deutschland wird in verschiedenen Län<strong>der</strong>n von <strong>der</strong> Politik explizit<br />
angestrebt, mit <strong>der</strong> <strong>Privatisierung</strong> <strong>und</strong> <strong>Re</strong>gulierung von Flughäfen <strong>der</strong>en allokative <strong>und</strong><br />
produktive Effizienz – <strong>und</strong> somit die Wohlfahrt in den jeweiligen Län<strong>der</strong>n – zu erhöhen<br />
(Wolf 1997, S. 140,217). Beispielsweise wurden in Großbritannien, Neuseeland <strong>und</strong><br />
Australien in den 1990er Jahren umfangreiche Untersuchungen durchgeführt, wie die<br />
staatlichen Flughäfen privatisiert <strong>und</strong> reguliert werden sollten, um diese Ziele zu erreichen.<br />
Die daraufhin implementierten Konzepte wurden in diesen Län<strong>der</strong>n in den vergangenen zwei<br />
bis drei Jahren von fachk<strong>und</strong>igen <strong>Re</strong>gulierungsbehörden modifiziert. In Australien wurde an<br />
einigen größeren Flughäfen die ex-ante <strong>Re</strong>gulierung durch ein Monitoring-System (ex-post<br />
<strong>Re</strong>gulierung) abgelöst. In Großbritannien wird bei den vier größeren Flughäfen weiterhin die<br />
Price-Cap-<strong>Re</strong>gulierung beibehalten.<br />
Ziel <strong>und</strong> Struktur dieses Beitrages<br />
Ziel dieses Beitrages ist es,<br />
• Kurz die Vor- <strong>und</strong> Nachteile <strong>der</strong> verschiedenen <strong>Privatisierung</strong>smodelle aufzuzeigen,<br />
• das Ausmaß <strong>der</strong> Marktmacht bei den einzelnen Flughafentypen in Deutschland<br />
(Primär-, Sek<strong>und</strong>är- <strong>und</strong> Tertiärflughäfen) abzuschätzen <strong>und</strong><br />
• für die einzelnen Flughafentypen auf ihre Charakteristika <strong>und</strong> das Ausmaß <strong>der</strong><br />
Marktmacht abgestimmte <strong>Re</strong>gulierungskonzepte zu entwickeln. 2<br />
2 In Berlin ist geplant, den existierenden Flughafen Berlin-Schönefeld zu einem internationalen Großflughafen<br />
„Berlin Brandenburg International (BBI)“ auszubauen <strong>und</strong> die existierenden Flughäfen Berlin-Tempelhof <strong>und</strong><br />
Berlin-Tegel zu schließen; ein erster <strong>Privatisierung</strong>sversuch für den geplanten Großflughafen ist allerdings<br />
Anfang 2003 gescheitert. Diese Berliner „Son<strong>der</strong>situation“ wird in diesem Beitrag jedoch nicht weiter betrachtet.<br />
4
In Abschnitt 2 werden zunächst die Rahmenbedingungen für den <strong>deutschen</strong> Flughafenmarkt<br />
<strong>und</strong> dessen <strong>Re</strong>form dargestellt. In Abschnitt 3 erfolgt eine Diskussion über Umfang <strong>und</strong> Form<br />
<strong>der</strong> <strong>Privatisierung</strong> <strong>der</strong> <strong>deutschen</strong> Flughäfen. Abschnitt 4 ermittelt den <strong>Re</strong>gulierungsbedarf<br />
durch Abschätzung <strong>der</strong> Marktmacht, wobei für die verschiedenen Flughafentypen<br />
Marktmacht verstärkende <strong>und</strong> abschwächende Faktoren analysiert werden. Die<br />
Interdependenzen zwischen Marktmacht, Slotallokation <strong>und</strong> <strong>Re</strong>gulierung werden in Abschnitt<br />
5 thematisiert. In Abschnitt 6 wird ein Vorschlag für ein <strong>Re</strong>gulierungssystem in Deutschland<br />
entwickelt, Im Anschluss wird in Abschnitt 7 die wettbewerbspolitische Fragestellung <strong>der</strong><br />
horizontalen Integration von Flughäfen erörtert. In den einzelnen Abschnitten wird jeweils<br />
aufbauend auf theoretischen Gr<strong>und</strong>lagen sowie internationalen Erfahrungen die Anwendung<br />
<strong>der</strong> Konzepte auf Deutschland diskutiert. Eine ausführliche Darstellung <strong>der</strong> <strong>Privatisierung</strong>s<strong>und</strong><br />
<strong>Re</strong>gulierungserfahrungen in Großbritannien, Neuseeland <strong>und</strong> Australien erfolgt im<br />
Anhang. Abschnitt 8 schließt mit <strong>der</strong> Zusammenfassung <strong>der</strong> wesentlichen Ergebnisse <strong>und</strong><br />
einem Ausblick.<br />
5
2 Gr<strong>und</strong>lagen <strong>der</strong> Analyse <strong>und</strong> Ausgangslage<br />
2.1 Technische <strong>und</strong> ökonomische Charakteristika eines Flughafens<br />
Leistungsbereiche <strong>und</strong> Komplementaritäten<br />
Flughäfen stellen die bodenseitige Infrastruktur des Luftverkehrsystems dar <strong>und</strong> fungieren<br />
damit als Schnittstelle zwischen land- <strong>und</strong> luftseitigen Komponenten des Luftverkehrs. Sie<br />
übernehmen dabei verschiedene Funktionen, um als Mittler zwischen Nutzern <strong>und</strong> Betreibern<br />
von Luftverkehrsgesellschaften den Umschlag (Ankunft, Umstieg, Abflug) von<br />
Transportobjekten (Passagiere, Fracht, Post) zu ermöglichen. Hierfür nutzen die<br />
Fluggesellschaften <strong>und</strong> / bzw. die Passagiere verschiedene in Abbildung 1 dargestellte<br />
Leistungsbereiche des Flughafens (Wolf 1997, S.32ff.): 3<br />
• Über die Verkehrsinfrastrukturanbindung erreichen <strong>und</strong> verlassen die Passagiere den<br />
Flughafen. Hierzu gehören die Anbindung an den Individual- <strong>und</strong> öffentlichen<br />
Verkehr, wie Straßen- <strong>und</strong> Schienenwege sowie Parkflächen <strong>und</strong> Taxistellplätze.<br />
• Start- <strong>und</strong> Landebahnsystem. Unter diesem Oberbegriff werden neben den Start- <strong>und</strong><br />
Landebahnen alle Transportwege <strong>und</strong> -flächen zusammengefasst, die von den<br />
Flugzeugen im luftseitigen Bereich des Flughafens genutzt werden (wie<br />
Abstellflächen, Roll- <strong>und</strong> Vorfeld).<br />
• Terminals: Diese Gebäude halten Andockstationen für Flugzeuge (Gates) vor <strong>und</strong><br />
stellen Flächen für Zoll-, Einreise-, Ges<strong>und</strong>heits- <strong>und</strong> Sicherheitsdienste sowie für<br />
Lounges in unmittelbarer Nähe zu diesen Stationen bereit. Hier erfolgt traditionell<br />
auch <strong>der</strong> Check-In <strong>der</strong> Passagiere.<br />
• Bodenverkehrsdienste umfassen so genannte land- <strong>und</strong> luftseitige<br />
Abfertigungsdienstleistungen. Zu den landseitigen Bodenverkehrsdiensten gehören<br />
insbeson<strong>der</strong>e Aufgaben im Bereich <strong>der</strong> Terminals wie z.B. Gepäcktransport <strong>und</strong> die<br />
Durchführung des Check-In; zu den luftseitigen Bodenverkehrsdiensten – i.d.R. auf<br />
dem Vorfeld – gehören Wartungs-, Flugbetriebs- <strong>und</strong> Sicherheitsaufgaben.<br />
• Die Bodenverkehrsdienstleister müssen auf Bestandteile <strong>der</strong> zentralen<br />
Betriebsinfrastruktur zurückgreifen, z.B. Betankungsanlagen <strong>und</strong><br />
Gepäckbeför<strong>der</strong>ungssysteme.<br />
Die Bestandteile Start- <strong>und</strong> Landebahnsystem, Terminals, Bodenverkehrsdienste sowie<br />
Zentrale Betriebsinfrastruktur werden als Aviation-Bereich des Flughafens bezeichnet, <strong>der</strong><br />
alle Aktivitäten <strong>und</strong> Dienstleistungen umfasst, die unmittelbar für die Abwicklung des<br />
eigentlichen Flugverkehrs notwendig sind o<strong>der</strong> sie begleitend <strong>unter</strong>stützen. Diese<br />
Leistungsbereiche sind vollständig komplementär, da die Nutzung eines Bereiches nur in<br />
Verbindung mit <strong>der</strong> Nutzung <strong>der</strong> an<strong>der</strong>en Bereiche sinnvoll ist (Starkie 2001, S. 124 ff). Für<br />
3 In diesem Beitrag wird in erster Linie auf den Personentransport explizit Bezug genommen; die Überlegungen<br />
gelten i.d.R. analog für den Transport von Gütern durch Transport<strong>unter</strong>nehmen bzw. die Fluggesellschaften<br />
selber.<br />
6
Fluggäste, die ihre <strong>Re</strong>ise an dem jeweiligen Flughafen beginnen o<strong>der</strong> beenden, ist auch die<br />
Nutzung <strong>der</strong> Verkehrsinfrastrukturanbindung unumgänglich. Der Aviation-Bereich seinerseits<br />
wird in den so genannten Verkehrsbereich – bestehend aus Start- <strong>und</strong> Landebahnsystem,<br />
Terminals <strong>und</strong> Zentraler Betriebsinfrastruktur – sowie die Bodenverkehrsdienste <strong>unter</strong>teilt.<br />
Weiterhin gibt es auf Flughäfen den so genannten Non-Aviation-Bereich, <strong>der</strong> ein Angebot<br />
verschiedener Güter <strong>und</strong> Dienstleistungen für die Passagiere umfasst, welches nicht für <strong>der</strong>en<br />
Lufttransport erfor<strong>der</strong>lich ist. Hierzu gehören z.B. Einzelhandelsgeschäfte, Hotels,<br />
Autovermietungen, etc. Da hauptsächlich Fluggäste Güter <strong>und</strong> Dienstleistungen im Non-<br />
Aviation-Bereich einkaufen, sind beide – Aviation- <strong>und</strong> Non-Aviation-Bereich – als<br />
komplementäre Güter anzusehen, wobei die Stärke <strong>der</strong> Komplementarität an einem<br />
bestimmten Flughafen von <strong>der</strong> jeweiligen Nutzerstruktur abhängt (Brunekreeft / Neuscheler<br />
2003, S. 269ff.). Die Einnahmen in diesem Bereich nehmen deshalb mit steigendem<br />
Verkehrsaufkommen zu.<br />
Abbildung 1: System Flughafen: Leistungsbereiche <strong>und</strong> Vertragsbeziehungen (Quelle: eigene Darstellung)<br />
Bedeutung <strong>der</strong> Flughafengesellschaft <strong>und</strong> Vertragsbeziehungen<br />
In einer „unregulierten Welt“ hat zunächst <strong>der</strong> Flughafenbetreiber als Eigentümer des<br />
Flughafengeländes das <strong>Re</strong>cht, als Anbieter für die verschiedenen genannten<br />
7
Leistungsbereiche tätig zu sein. 4 Er schließt in <strong>der</strong> Praxis mit einer Vielzahl von Unternehmen<br />
Verträge ab, die diesen die Aktivität auf dem Flughafengelände in den <strong>unter</strong>schiedlichen<br />
Leistungsbereichen zu bestimmten Konditionen erlauben. 5 In Abbildung 2 ist dargestellt, über<br />
welche Vertragsbeziehungen <strong>der</strong> Flughafenbetreiber direkt von den Fluggesellschaften<br />
<strong>und</strong>/o<strong>der</strong> indirekt über verschiedene Unternehmen in den einzelnen Leistungsbereichen seinen<br />
Anteil an den Ticketpreisen <strong>der</strong> Passagiere bzw. <strong>der</strong>en Ausgaben im Non-Aviation-Bereich<br />
erhält. Darüber hinaus ist <strong>der</strong> Fall dargestellt, dass <strong>der</strong> Flughafen über eine Bepreisung <strong>der</strong><br />
Verkehrsanbindung direkt Einnahmen bei den Passagieren erhebt. 6<br />
Abbildung 2: Vertragsbeziehungen <strong>der</strong> Beteiligten des Systems Flughafen nach Leistungsbereichen<br />
(Quelle: eigene Darstellung)<br />
2.2 Tendenzen im Luftverkehr <strong>und</strong> <strong>der</strong>en Auswirkungen auf die Flughäfen<br />
Wachstum, Allianzen, Wettbewerb <strong>und</strong> <strong>Privatisierung</strong> im Luftverkehrsmarkt<br />
Der Luftverkehrsmarkt vollzieht in Deutschland <strong>und</strong> Europa seit einigen Jahren einen<br />
gr<strong>und</strong>legenden Wandel. Nach einer stufenweisen Liberalisierung innerhalb <strong>der</strong> EU ist dieser<br />
Markt seit dem 1. April 1997 mit <strong>der</strong> Kabotagefreigabe als weitgehend <strong>der</strong>eguliert anzusehen.<br />
Auch auf Seiten <strong>der</strong> Luftkontroll- <strong>und</strong> Flugsicherungssysteme sind Bestrebungen zu einer<br />
<strong>Privatisierung</strong> <strong>und</strong> einer parallelen europaweiten Harmonisierung zu erkennen. Prognosen<br />
4 Bei einer <strong>Re</strong>gulierung werden diese Eigentumsrechte des Flughafens durch staatliche Vorgaben eingeschränkt,<br />
z.B. verpflichtet eine Marktzugangsregulierung den Flughafenbetreiber, an<strong>der</strong>e Unternehmen in bestimmten<br />
Leistungsbereichen tätig werden zu lassen.<br />
5 Beispielsweise vermietet die Flughafengesellschaft Gebäudeflächen in den Terminals an Geschäftsbetreiber<br />
<strong>und</strong> <strong>Re</strong>staurants, verpachtet Gr<strong>und</strong>stücksflächen an Hotelketten, die dort Gebäude errichten, o<strong>der</strong> schließt<br />
Verträge mit Mineralöl<strong>unter</strong>nehmen ab, die Tanklager <strong>und</strong> -anlagen für Flugzeuge betreiben.<br />
6 Analog könnte ein unregulierter Flughafenbetreiber natürlich auch die Terminalbenutzung etc. für Passagiere<br />
bepreisen.<br />
8
gehen davon aus, dass <strong>der</strong> Luftverkehr durch die Marktöffnung in den kommenden 20 Jahren<br />
um durchschnittlich 4,7% bis 5,1% pro Jahr wachsen wird. (Airbus 2002, S. 19ff., Boeing<br />
2003, S. 7f.). Die gleichzeitig zunehmende Wettbewerbsintensität zwischen den<br />
Fluggesellschaften führt zur Konsolidierung des Marktes <strong>und</strong> zur Bildung von strategischen<br />
Allianzen, die ein globales Netzwerk an Flugverbindungen aufgebaut haben. Diese<br />
Zusammenschlüsse dominieren den Markt <strong>und</strong> transportieren zwei Drittel des weltweiten<br />
Verkehrs (IATA 2000). Außenstehende Fluglinien nähern sich über Code-Sharing,<br />
Franchising o<strong>der</strong> Absprachen an diese Gruppierungen an. An<strong>der</strong>erseits führt auch <strong>der</strong> Eintritt<br />
von Low-Cost-Fluggesellschaften in zum Teil erst neu durch sie geschaffene Marktsegmente<br />
zu massiven Marktanteilsverschiebungen. Schätzungen gehen davon aus, dass sich bis zum<br />
Jahr 2030 ihr Anteil bei 30% stabilisieren wird. 7<br />
Gr<strong>und</strong>sätzliche Entwicklungen im weltweiten Flughafenmarkt<br />
Auch im Flughafensektor haben verän<strong>der</strong>te Rahmenbedingungen neue Entwicklungen<br />
ausgelöst. Graham (2001, S. 7) verweist auf folgende Schlüsselentwicklungen, die den<br />
Wandel im Flughafensektor charakterisieren:<br />
• Die erste Entwicklung ist die Flughafenkommerzialisierung. Flughäfen entwickeln<br />
sich zu Unternehmen mit kommerziellen Zielen <strong>und</strong> übernehmen zunehmend<br />
Managementphilosophien aus an<strong>der</strong>en Industriezweigen. Eine zunehmende Bedeutung<br />
gewinnt – gemessen am Umsatz – <strong>der</strong> Non-Aviation-Bereich.<br />
• Weiterhin ist weltweit eine Tendenz zur Flughafenprivatisierung zu beobachten. Das<br />
Management <strong>und</strong> Eigentum von Flughäfen wird an den Privatsektor übertragen.<br />
• Das Entstehen von global agierenden Flughafengesellschaften, welche eine steigende<br />
Zahl an Flughäfen weltweit betreiben, wird als Flughafenglobalisierung bezeichnet.<br />
Dies ist die dritte Entwicklungsstufe im Flughafensektor. Einige dieser „Global<br />
Player“ sind traditionelle Flughafenbetreiber wie die British Airport Authority (BAA)<br />
aus London; an<strong>der</strong>e – wie z. B. Investmentbanken – sind neu im<br />
Flughafenmanagement.<br />
Eine weitere wichtige Tendenz ist die Ausbildung von Flughäfen, die sich speziell an<br />
bestimmten Anfor<strong>der</strong>ungen <strong>der</strong> Fluggesellschaften orientieren. Hierbei sind zwei<br />
Entwicklungen hervorzuheben:<br />
• Große Fluggesellschaften entwickeln Hub-and-Spoke-Netzwerke 8 , die in Konkurrenz<br />
zueinan<strong>der</strong> stehen. Drehkreuzflughäfen spielen dabei zunehmend eine wichtige Rolle.<br />
<strong>Re</strong>levante Merkmale sind neben einem attraktiven Einzugsgebiet die geographische<br />
Lage entlang <strong>der</strong> Hauptflugrouten <strong>der</strong> Fluggesellschaft, ausreichend große<br />
7 Quelle: Vortrag „Low Cost Carrier“ von Dr. jur. Raphael Freiherr v. Heereman (Lufthansa Consulting GmbH)<br />
am 27.05.2003 am Institut für Luft- <strong>und</strong> Raumfahrt <strong>der</strong> Technischen Universität Berlin.<br />
8<br />
Hub-and-Spoke bezeichnet ein Nabe-Speiche-System von Streckenverbindungen um einen<br />
Drehkreuzflughafen mit sternförmig angeb<strong>und</strong>en Zubringerflughäfen.<br />
9
Kapazitätsreserven, sowie die Sicherstellung möglichst kurzer Umsteigezeiten (Bunse<br />
2003).<br />
• Die neu in den Markt eingetretenen Low-Cost-Fluggesellschaften, die ein<br />
gr<strong>und</strong>sätzlich an<strong>der</strong>es Geschäftsmodell als die etablierten Fluggesellschaften haben,<br />
führen zu einer neuartigen Nachfrage nach Flughäfen mit deutlich niedrigeren Preisen<br />
im Aviation-Bereich <strong>und</strong> akzeptieren hierfür auch einen geringeren Service. Diese<br />
Nachfrage wird hauptsächlich durch ehemalige Militärflughäfen o<strong>der</strong><br />
<strong>Re</strong>gionalflughäfen bedient. 9 Insgesamt ist ein als „Matching“ bezeichnetes Phänomen<br />
zu beobachten, das mit einem Abgleich <strong>der</strong> strategischen Ausrichtung zwischen Low-<br />
Cost-Fluggesellschaft <strong>und</strong> Flughafen einhergeht. 10<br />
2.3 Ausgangslage im <strong>deutschen</strong> Flughafenmarkt<br />
2.3.1 Größe <strong>und</strong> Eigentümerstruktur <strong>der</strong> <strong>deutschen</strong> Verkehrsflughäfen<br />
Laut dem Flughafenkonzept <strong>der</strong> B<strong>und</strong>esregierung vom August 2000 gibt es in Deutschland 17<br />
internationale Verkehrsflughäfen, 21 <strong>Re</strong>gionalflughäfen, von denen 14 im regelmäßigen, auch<br />
internationalen Luftverkehrsdienst angeflogen werden, sowie 350 Verkehrslande- <strong>und</strong><br />
Son<strong>der</strong>landeplätze (BMVBW 2000, S. 12). Inzwischen ist mit Dortm<strong>und</strong> ein weiterer<br />
Flughafen durch das BMVBW als internationaler Verkehrsflughafen kategorisiert worden<br />
(ADV 2003). Für diese Flughäfen ist das Bedürfnis nach Flugsicherung anerkannt, <strong>und</strong> <strong>der</strong><br />
B<strong>und</strong> übernimmt die Kosten hierfür (Budau 2002).<br />
In diesem Beitrag sollen vornehmlich die internationalen Verkehrsflughäfen betrachtet<br />
werden. Diese befinden sich noch immer fast ausschließlich im öffentlichen Eigentum, wobei<br />
häufig sowohl <strong>der</strong> B<strong>und</strong> als Län<strong>der</strong> <strong>und</strong> Kommunen Anteile besitzen. Auch bei den ersten<br />
teilprivatisierten Flughäfen Hamburg, Hannover, Saarbrücken, Düsseldorf <strong>und</strong> Frankfurt am<br />
Main halten öffentliche Eigentümer nach wie vor die Mehrheit <strong>der</strong> Anteile.<br />
In Tabelle 1 sind die Eigentümerstrukturen <strong>und</strong> die Passagierzahlen <strong>der</strong> internationalen<br />
Verkehrsflughäfen dargestellt, die in diesem Beitrag in folgende Kategorien eingeordnet<br />
werden:<br />
• Primärflughäfen: Flughäfen mit Drehkreuzfunktion.<br />
• Sek<strong>und</strong>ärflughäfen: Weitere, bedeutende Flughäfen, die ein attraktives Einzugsgebiet<br />
aufweisen <strong>und</strong> daher von mehreren Netzwerkfluggesellschaften an ihr Drehkreuz<br />
angeb<strong>und</strong>en werden.<br />
• Tertiärflughäfen: Alle weiteren internationalen Verkehrsflughäfen.<br />
9 Aber auch einige internationale Verkehrsflughäfen reagieren auf die neuen Nachfrager <strong>und</strong> werden von diesen<br />
angeflogen, wie z.B. <strong>der</strong> Flughafen Köln/Bonn.<br />
10 Diese Tendenz wurde auf <strong>der</strong> Hamburg Aviation Conference 2003 von mehreren Branchenexperten, wie z.B.<br />
Scott Butler (Westjet Airlines) <strong>und</strong> Peter Poungias (Hochtief Airport), dargestellt.<br />
10
<strong>Re</strong>gional- <strong>und</strong> ehemalige Militärflughäfen, die bislang nicht zu den internationalen<br />
Verkehrsflughäfen zählen <strong>und</strong> in diesem Beitrag nur vereinzelt in die Betrachtungen<br />
einbezogen werden, bilden eine weitere im Folgenden als Quartiärflughäfen bezeichnete<br />
Kategorie. 11 Diese Flughäfen gewinnen aber zunehmend an Bedeutung, da sie verstärkt von<br />
Low-Cost-Carriern angeflogen werden, wie z.B. die Flughäfen in Hahn/Hunsrück, Lübeck,<br />
Mönchengladbach o<strong>der</strong> Altenburg-Nobitz.<br />
Tabelle 1: Eigentümerstruktur <strong>der</strong> <strong>deutschen</strong> internationalen Verkehrsflughäfen<br />
(Quelle: in Anlehnung an Hirschhausen, Beckers, Tegner 2002, S. 53)<br />
Flughafen Eigentümer Anteil (%) Passagiere 2001 (Mio.)<br />
Primärflughäfen<br />
Frankfurt<br />
(FRAPORT)<br />
48,3<br />
Land Hessen<br />
Streubesitz<br />
Gemeinden<br />
B<strong>und</strong><br />
München<br />
Freistaat Bayern<br />
B<strong>und</strong><br />
Stadt München<br />
Sek<strong>und</strong>ärflughäfen<br />
Düsseldorf<br />
Stadt Düsseldorf<br />
Hochtief Airport GmbH<br />
Aer Rianta International<br />
Berlin 12<br />
Land Berlin<br />
Land Brandenburg<br />
B<strong>und</strong><br />
Hamburg<br />
Stadt Hamburg<br />
Hochtief Airport GmbH / Aer Rianta International<br />
Stuttgart<br />
Land Baden-Württemberg<br />
Stadt Stuttgart<br />
Köln/Bonn<br />
Tertiärflughäfen<br />
Hannover<br />
Nürnberg<br />
Leipzig/Halle<br />
Stadt Köln<br />
B<strong>und</strong><br />
Land Nordrhein-Westfalen<br />
Gemeinden<br />
Land Nie<strong>der</strong>sachsen<br />
Stadt Hannover<br />
Fraport AG / Norddeutsche Landesbank<br />
Freistaat Bayern<br />
Stadt Nürnberg<br />
Land Sachsen<br />
Land Sachsen-Anhalt<br />
Stadt Leipzig<br />
Gemeinden<br />
32,13%<br />
28,97%<br />
20,52%<br />
18,38%<br />
51,00%<br />
26,00%<br />
23,00%<br />
50,00%<br />
30,00%<br />
20,00%<br />
37,00%<br />
37,00%<br />
26,00%<br />
60,00%<br />
40,00%<br />
50,00%<br />
50,00%<br />
31,12%<br />
30,94%<br />
30,94%<br />
7,00%<br />
35,00%<br />
35,00%<br />
30,00%<br />
50,00%<br />
50,00%<br />
60,50%<br />
17,80%<br />
11,00%<br />
10,70%<br />
Bremen Stadt Bremen 100,00% 1,8<br />
Dresden<br />
Land Sachsen<br />
74,90%<br />
1,6<br />
Stadt Dresden<br />
20,90%<br />
23,5<br />
15,3<br />
12,5<br />
9,4<br />
7,6<br />
5,7<br />
5,1<br />
3,1<br />
2,1<br />
11 Viele <strong>der</strong> geführten Überlegungen <strong>und</strong> abgeleiteten Handlungsempfehlungen für Tertiärflughäfen lassen sich<br />
auch auf Quartiärflughäfen übertragen.<br />
12 Aufgr<strong>und</strong> <strong>der</strong> Tatsache, dass die drei Berliner Flughäfen rechtlich <strong>und</strong> organisatorisch ein Flughafensystem<br />
bilden, werden Tegel, Tempelhof <strong>und</strong> Schönefeld hier nicht getrennt betrachtet.<br />
11
Münster/<br />
Osnabrück<br />
Dortm<strong>und</strong><br />
Erfurt<br />
Saarbrücken<br />
Gemeinden 4,20%<br />
Gemeinden 100,00% 1,6<br />
Stadt Dortm<strong>und</strong><br />
Dortm<strong>und</strong>er Stadtwerke<br />
Land Thüringen<br />
Stadt Erfurt<br />
Fraport AG<br />
Saarland<br />
Stadt Saarbrücken<br />
26,00%<br />
74,00%<br />
95,00%<br />
5,00%<br />
51,00%<br />
48,00%<br />
1,00%<br />
1,0<br />
0,5<br />
0,4<br />
2.3.2 Gesetzliche Rahmenbedingungen <strong>und</strong> traditionelle <strong>Re</strong>gulierung<br />
Der rechtliche Rahmen für Flughäfen in Deutschland wird durch das Luftverkehrsgesetz<br />
(LuftVG) <strong>und</strong> die Luftverkehrszulassungsordnung (LuftVZO) beschrieben.<br />
<strong>Re</strong>gulierungskompetenz <strong>und</strong> –institution<br />
Die Preisregulierung <strong>der</strong> <strong>deutschen</strong> Flughäfen wird in § 43 LuftVZO geregelt, <strong>der</strong> vorgibt,<br />
dass <strong>der</strong> Flughafenbetreiber seine Entgelte bezüglich dem Starten, Landen <strong>und</strong> Abstellen von<br />
Luftfahrzeugen sowie für die Benutzung von Fluggasteinrichtungen einer Behörde zur<br />
Genehmigung vorzulegen hat. Die Verordnung regelt nur den Umfang <strong>der</strong> zu regulierenden<br />
Preise, klärt aber nicht eindeutig, in welcher Höhe die Tarife festgesetzt werden sollen.<br />
Hervorzuheben ist, dass <strong>der</strong> § 43 LuftVZO die <strong>Re</strong>gulierungskompetenz an die Län<strong>der</strong> abgibt,<br />
wobei das B<strong>und</strong>esverkehrsministerium ein Einspruchsrecht besitzt. B<strong>und</strong> <strong>und</strong> Län<strong>der</strong> sind<br />
somit Eigentümer, aber gleichzeitig auch <strong>Re</strong>gulierer <strong>der</strong> Flughäfen, was einen<br />
Interessenkonflikt darstellt. Neben den einzelnen Landesluftfahrtbehörden existiert keine<br />
b<strong>und</strong>esweite <strong>Re</strong>gulierungsbehörde. In <strong>der</strong> Praxis kommt dem Flughafen die aktive Seite zu.<br />
Er versucht, neue Tarife billigen zu lassen, wobei die Landesluftfahrtbehörde als <strong>Re</strong>gulierer<br />
gem. § 42 LuftVZO, die Entgelte nicht einfach verän<strong>der</strong>n, son<strong>der</strong>n als passiver Part quasi nur<br />
ein Veto einlegen darf. Die Landesluftfahrtbehörden sind verpflichtet, bei <strong>der</strong> Beurteilung <strong>der</strong><br />
Entgelthöhe die Gewährleistung <strong>der</strong> Kostendeckung, die öffentliche Verkehrspolitik <strong>und</strong> die<br />
Angemessenheit <strong>der</strong> Tarife zu berücksichtigen (Niemeier 2002, S. 40f.).<br />
Preis- <strong>und</strong> Marktzugangsregulierung nach deutschem <strong>und</strong> europäischem <strong>Re</strong>cht<br />
Derzeit sind die <strong>deutschen</strong> Verkehrsflughäfen, mit Ausnahme von Frankfurt am Main <strong>und</strong><br />
Hamburg, einer Kostenzuschlagsregulierung <strong>unter</strong>worfen. Die Tarifregulierung in<br />
Deutschland bezieht sich dabei ausschließlich auf den Endproduktpreis. Zugangsentgelte<br />
beispielsweise für die zentrale Infrastruktur sind nicht in einer <strong>Re</strong>gulierung inbegriffen. Das<br />
Luftverkehrsgesetz gibt im §19c lediglich eine abschließende Definition <strong>der</strong><br />
Bodenabfertigungsdienste <strong>und</strong> regelt weiterhin <strong>der</strong>en Zulassung zu den Flughäfen. So haben<br />
die Flughafenbetreiber, Luftfahrt<strong>unter</strong>nehmen o<strong>der</strong> sonstigen Anbieter die Erbringung von<br />
Bodenabfertigungsdiensten zu ermöglichen. 13 Damit ist allerdings nur eine Verhaltensauflage<br />
13 Diese Fassung des LuftVG vom 23.03.1999 ist als Umsetzung <strong>der</strong> EU-Richtlinie 96/67/EG von 1996 zu<br />
sehen, welche die Mitgliedsstaaten zu einer Liberalisierung <strong>der</strong> Bodenverkehrsdienste verpflichtet hat.<br />
12
für die Flughafenbetreiber zur Marktöffnung verb<strong>und</strong>en gewesen <strong>und</strong> keine Vorgabe für den<br />
<strong>deutschen</strong> Gesetzgeber zu einer Zugangsentgeltregulierung erteilt worden (Kunz, 1999).<br />
2.3.3 Erste Erfahrungen mit Teilprivatisierungen <strong>und</strong> <strong>der</strong> Anwendung<br />
neuer <strong>Re</strong>gulierungsvarianten in Deutschland<br />
Die Veräußerungen von Anteilen <strong>der</strong> öffentlichen Hand an Flughafengesellschaften waren<br />
durch <strong>unter</strong>schiedliche Gründe <strong>und</strong> Zielstellungen motiviert <strong>und</strong> erfolgten auf verschiedene<br />
Art <strong>und</strong> Weise. Im Folgenden werden kurz die wichtigsten Teilprivatisierungen in<br />
Deutschland dargestellt.<br />
2.3.3.1 Teilprivatisierung des Düsseldorfer Flughafens<br />
Beim Düsseldorfer Flughafen gab <strong>der</strong> durch den Brand 1996 entstandene, hohe<br />
Investitionsbedarf den Ausschlag für die Landesregierung in Nordrhein-Westfalen, sich im<br />
Dezember 1997 von ihrem 50%-igen Anteil an <strong>der</strong> Flughafengesellschaft zu trennen <strong>und</strong><br />
damit die erste Teilprivatisierung eines <strong>deutschen</strong> Verkehrsflughafens einzuleiten. Die Anteile<br />
kaufte für 180 Mio. € ein Konsortium, Airport Partners GmbH, das aus <strong>der</strong> Hochtief Airport<br />
GmbH <strong>und</strong> <strong>der</strong> irischen Aer Rianta International bestand. Mit dem Kauf war für den<br />
strategischen Investor die Auflage verb<strong>und</strong>en, in kurzer Zeit die volle Betriebsfähigkeit des<br />
Flughafens wie<strong>der</strong>herzustellen <strong>und</strong> anschließend eine wachstumsorientierte Strategie zu<br />
verfolgen. Die Airport Partners GmbH investierte dann auch 389 Mio. € in eine erste<br />
Ausbaustufe des Neubaus des Terminals B <strong>und</strong> stellte diesen nach nur zweieinhalbjähriger<br />
Bauzeit fertig (Flughafen Düsseldorf 2001).<br />
Die <strong>Re</strong>gulierung des Düsseldorfer Flughafens erfolgt noch immer nach dem<br />
Kostenzuschlagsprinzip. Nach Genehmigung durch das Landesverkehrsministerium gelten<br />
seit dem 1. April 2000 um 7,1% höhere Lande- <strong>und</strong> Passagierentgelte. Die Klage von<br />
Fluggesellschaften gegen diese Preiserhöhung wies ein Gericht mit <strong>der</strong> Begründung zurück,<br />
dass die Entgelte denen an vergleichbaren Flughäfen entsprechen würden. Es kann jedoch<br />
davon ausgegangen werden, dass eher <strong>der</strong> hohe Investitionsbedarf dazu geführt hat, dass im<br />
Rahmen <strong>der</strong> traditionellen Kostenzuschlagsregulierung dem neuen Betreiber eine<br />
dementsprechend hohe Entgelterhöhung ermöglicht wurde (BARIG 2000).<br />
2.3.3.2 Teilprivatisierung <strong>und</strong> <strong>Re</strong>-<strong>Re</strong>gulierung des Hamburger Flughafens<br />
Bis Mitte 2000 war <strong>der</strong> Hamburg Airport zu 100% in öffentlicher Hand; 74% <strong>der</strong> Anteile<br />
gehörten <strong>der</strong> Freien <strong>und</strong> Hansestadt Hamburg, die übrigen 26% dem B<strong>und</strong>. Nachdem die<br />
<strong>Privatisierung</strong> des Hamburger Flughafens schon seit 1982 geplant war, gab die sich<br />
verschärfende Finanzmittelknappheit Mitte <strong>der</strong> 90er Jahre den Ausschlag für <strong>der</strong>en<br />
Umsetzung. Im Oktober 2000 wurden dann 36% <strong>der</strong> Anteile, dar<strong>unter</strong> alle Anteile des<br />
B<strong>und</strong>es, für ca. 270 Mio. € an ein privatwirtschaftliches Konsortium <strong>unter</strong> Beteiligung <strong>der</strong><br />
Hochtief Airport GmbH <strong>und</strong> Aer Rianta International verkauft. Nach einem zweiten (Teil-)<br />
<strong>Privatisierung</strong>sschritt reduzierte sich <strong>der</strong> Anteil <strong>der</strong> Hansestadt auf mittlerweile 60%. Darüber<br />
hinaus hält das Konsortium die Option für den weiteren Kauf von bis zu 9% <strong>der</strong> Anteile bis<br />
zum Jahr 2007 (Flughafen Hamburg 2001; Stadt Hamburg 2000).<br />
13
In Hamburg wurde zuvor im Mai 2000 nach mehrjährigen Überlegungen die traditionelle<br />
Kostenzuschlagsregulierung durch eine Price-Cap-<strong>Re</strong>gulierung nach dem Dual-Till-Prinzip<br />
mit <strong>Re</strong>venue-Yield-Ansatz <strong>und</strong> asymmetrischer Sliding-Scale ersetzt. 14 Dies wurde zwischen<br />
dem Flughafen <strong>und</strong> <strong>der</strong> Stadt in einem öffentlich-rechtlichen Vertrag vereinbart, <strong>der</strong> mit einer<br />
Laufzeit von fünf Jahren (bis Ende 2004) die Basis für die <strong>Re</strong>gulierung bildet. 15 Die<br />
Lufthansa als am Flughafen dominierende Fluggesellschaft forcierte trotz einiger<br />
Kritikpunkte diese neue Art <strong>der</strong> <strong>Re</strong>gulierung, da sie sich eine Effizienzerhöhung <strong>und</strong><br />
Ausstrahlungswirkung auf an<strong>der</strong>e Flughäfen erhoffte (Niemeier 2002, S. 43).<br />
Bei <strong>der</strong> Konzipierung des <strong>Re</strong>gulierungsverfahrens wurde die Möglichkeit starker<br />
Nachfrageschwankungen jedoch nicht bzw. nicht ausreichend berücksichtigt. Es wurde ein<br />
asymmetrisches Sliding-Scale-Verfahren vereinbart; dieses führte dazu, dass <strong>der</strong> Flughafen<br />
seine Preise im Zeitablauf stärker senken musste als angedacht. Schließlich wurde <strong>der</strong> Vertrag<br />
auf Druck <strong>der</strong> Flughafengesellschaft deshalb noch einmal nachverhandelt (Schernus 2002).<br />
2.3.3.3 Teilprivatisierung <strong>und</strong> <strong>Re</strong>-<strong>Re</strong>gulierung des Frankfurter Flughafens<br />
Nach einer rechtlichen <strong>Privatisierung</strong> mit Gründung <strong>der</strong> Fraport AG erfolgte 2001 die<br />
Teilprivatisierung des Frankfurter Flughafens. In einer Börsenplatzierung wurden im Rahmen<br />
einer Kapitalerhöhung ca. 29% <strong>der</strong> Anteile breit gestreut in private Hand übergeben. 2002<br />
wurde <strong>der</strong> <strong>Re</strong>gulierungsrahmen für den Frankfurter Flughafen in Anlehnung an das<br />
Hamburger Modell abgeän<strong>der</strong>t. Am 30. April wurde eine dem Price-Cap-Verfahren ähnelnde<br />
Entgeltrahmenvereinbarung zwischen den in Frankfurt operierenden Fluggesellschaften <strong>und</strong><br />
dem Flughafen abgeschlossen (BARIG 2002; Fraport 2003). Diese Übereinkunft wurde<br />
ebenfalls in einem öffentlich-rechtlichen Vertrag fixiert <strong>und</strong> beinhaltet u.a. eine<br />
Festschreibung <strong>der</strong> Entwicklung <strong>der</strong> Flughafenentgelte für fünf Jahre (2002-2006). 16<br />
Zukünftig wird die Höhe <strong>der</strong> Entgelte demnach an das Passagierwachstum über den Sliding-<br />
Scale-Ansatz gekoppelt, wobei die Erfahrungen aus Hamburg berücksichtigt wurden <strong>und</strong> von<br />
vornherein eine symmetrische Anpassung vereinbart wurde (Rolshausen 2002).<br />
2.3.3.4 Erste <strong>Privatisierung</strong>sschritte bei Quartiärflughäfen<br />
Auch kleinere als die hier betrachteten, internationalen Flughäfen wurden in den letzten<br />
Jahren in Deutschland teilprivatisiert. Die Anteile <strong>der</strong> öffentlichen Gebietskörperschaften<br />
wurden dabei oftmals an Flughafengesellschaften verkauft, die selbst schon Anteilseigner<br />
größerer Flughäfen im B<strong>und</strong>esgebiet waren. So erwarb das Konsortium um die Hochtief<br />
Airport GmbH bei Vertragsschluss zum Kauf des 50%-Anteils am Düsseldorfer Flughafen<br />
von <strong>der</strong> nordrheinwestfälischen Landesregierung auch eine Mehrheitsbeteiligung am<br />
14 Die Price-Cap-<strong>Re</strong>gulierung sowie das Dual-Till-Prinzip, <strong>der</strong> <strong>Re</strong>venue-Yield-Ansatz <strong>und</strong> das Sliding-Scale-<br />
Verfahren werden in Abschnitt 6.1 erläutert.<br />
15<br />
NfL I 293/00 Öffentlich-rechtlicher Vertrag über die Festsetzung <strong>und</strong> Anpassung regulierter<br />
Flughafenentgelte zwischen <strong>der</strong> Freien <strong>und</strong> Hansestadt Hamburg (Wirtschaftsbehörde) <strong>und</strong> <strong>der</strong> Flughafen<br />
Hamburg GmbH (FHG) vom 16.11.2000.<br />
16 NfL I 328/02 Öffentlich-rechtlicher Vertrag vom 29.10.2002.<br />
14
Flughafen in Mönchengladbach (Flughafen Düsseldorf 2003). Das Land Rheinland-Pfalz<br />
verkaufte 74,9% <strong>der</strong> Anteile am ehemaligen Militärflughafen Hahn/Hunsrück an die Fraport<br />
AG (Hirschhausen, Beckers, Tegner 2002, S. 53).<br />
2.3.3.5 <strong>Re</strong>sümee <strong>der</strong> bisherigen <strong>Privatisierung</strong>s- <strong>und</strong> <strong>Re</strong>-<strong>Re</strong>gulierungserfahrungen in<br />
Deutschland<br />
Die aufgezeigten Erfahrungen geben Hinweise bezüglich <strong>der</strong> Ausgestaltung einer <strong>Re</strong>-<br />
<strong>Re</strong>gulierung <strong>und</strong> einer weiteren <strong>Privatisierung</strong> von Flughäfen in Deutschland. Die wenigen<br />
Beispiele <strong>unter</strong>streichen die Wichtigkeit einer geeigneten <strong>Re</strong>gulierung. Eine reine<br />
<strong>Privatisierung</strong>, ohne Anpassung des <strong>Re</strong>gulierungsrahmens wie in Düsseldorf führt zu<br />
Problemen. Wie das Beispiel Hamburg verdeutlicht, kann eine zuvor mit den Beteiligten<br />
diskutierte <strong>Re</strong>-<strong>Re</strong>gulierung, die eine <strong>Privatisierung</strong> begleitet, zu einer für alle Beteiligten<br />
vorteilhaften Lösung führen. Die Erfahrungen aus den vorhergehenden Vereinbarungen am<br />
Hamburger Flughafen wurden im Fall Frankfurt adäquat berücksichtigt <strong>und</strong> flossen in die<br />
Verhandlungslösung <strong>der</strong> Marktteilnehmer ein.<br />
15
3 <strong>Privatisierung</strong><br />
3.1 Theoretische Überlegungen<br />
In diesem Abschnitt soll zunächst erläutert werden, warum eine <strong>Privatisierung</strong> von Flughäfen<br />
gr<strong>und</strong>sätzlich vorteilhaft sein kann. Anschließend werden die einzubeziehenden<br />
Wertschöpfungsstufen, die Dauer, <strong>der</strong> Umfang <strong>und</strong> die Form bzw. <strong>der</strong> Prozess bei einer<br />
<strong>Privatisierung</strong> von Flughäfen diskutiert.<br />
3.1.1 Gründe <strong>und</strong> Erfolgsfaktoren für eine <strong>Privatisierung</strong><br />
In diesem Beitrag ist es nicht möglich, sämtliche Vor- <strong>und</strong> Nachteile einer <strong>Privatisierung</strong> von<br />
Flughäfen zu diskutieren. Zur Begründung <strong>der</strong> Überlegenheit einer stärkeren<br />
Privatsektorbeteiligung wird deshalb insbeson<strong>der</strong>e auf folgende Argumente verwiesen:<br />
• Die Anreizsysteme im privaten Sektor sind geeigneter, eine effiziente<br />
Leistungserbringung des bzw. im Unternehmen zu erreichen.<br />
• In privatisierten Unternehmen ist politische Einflussnahme nur in einem geringeren<br />
Maße möglich, so dass <strong>der</strong> wirtschaftliche Erfolg – im Gegensatz zu öffentlichen<br />
Unternehmen – Hauptziel ist (López-Calva 1998, S.3).<br />
Empirische Untersuchungen zeigen, dass in „normalen“ Wirtschaftssektoren durch eine<br />
<strong>Privatisierung</strong> Effizienzgewinne erzielt werden. Bei Vorliegen eines natürlichen Monopols,<br />
das Marktmacht besitzt, führt eine <strong>Privatisierung</strong> nur dann zu Effizienzgewinnen, wenn ein<br />
geeignetes <strong>Re</strong>gulierungssystem implementiert ist (Vickers / Yarrow 1991). Dies bedeutet<br />
insbeson<strong>der</strong>e die Schaffung einer glaubwürdigen <strong>Re</strong>gulierungsinstanz (Levy / Spiller 1998).<br />
Ohne das Bestehen von Marktmacht <strong>und</strong> die Notwendigkeit einer <strong>Re</strong>gulierung beurteilen zu<br />
können, kann folglich eine <strong>Privatisierung</strong> von Flughäfen empfohlen werden – sofern bei<br />
entsprechen<strong>der</strong> Notwendigkeit ein geeignetes <strong>Re</strong>gulierungssystem implementiert ist o<strong>der</strong> vor<br />
bzw. parallel zur <strong>Privatisierung</strong> implementiert wird.<br />
3.1.2 Umfang <strong>und</strong> Form <strong>der</strong> <strong>Privatisierung</strong><br />
Einbezogene Wertschöpfungsstufen <strong>und</strong> Dauer <strong>der</strong> <strong>Privatisierung</strong><br />
Bei <strong>der</strong> <strong>Privatisierung</strong> eines Flughafens ist zunächst zu entscheiden,<br />
• ob sämtliche Wertschöpfungsstufen (bzw. Leistungsbereiche, siehe Unterabschnitt<br />
2.1) privatisiert bzw. gemeinsam verkauft werden sollen <strong>und</strong><br />
• ob die <strong>Privatisierung</strong> von begrenzter o<strong>der</strong> unbegrenzter Dauer sein soll.<br />
Anstelle einer <strong>Privatisierung</strong> des Gesamtsystems Flughafen wäre auch eine <strong>Privatisierung</strong> nur<br />
einzelner Leitungsbereiche – z.B. über Konzessionssysteme – bzw. <strong>der</strong> Verkauf verschiedener<br />
Leistungsbereiche an <strong>unter</strong>schiedliche Investoren möglich. Aufgr<strong>und</strong> <strong>der</strong> Dynamik des<br />
Flughafensektors (siehe hierzu Unterabschnitt 2.2) kann eine „Aufspaltung“ des Flughafens<br />
jedoch einen erheblichen Koordinationsaufwand bei <strong>der</strong> Instanz verursachen, die die<br />
einzelnen Konzessionen vergibt. Durch die Anpassung <strong>der</strong> einzelnen Konzessionsverträge,<br />
zwischen denen verschiedene Interdependenzen bestehen, würden hohe Transaktionskosten<br />
16
entstehen, <strong>und</strong> die <strong>Re</strong>aktionsfähigkeit auf sich wandelnde Umweltbedingungen wäre<br />
eingeschränkt. Aus diesem Gr<strong>und</strong> ist es empfehlenswert, Flughäfen „en bloc“ zu<br />
17, 18<br />
privatisieren.<br />
Bei einer zeitlich begrenzten <strong>Privatisierung</strong> mit kurzer Vertragslaufzeit sinken die Anreize,<br />
größere Investitionen durchzuführen. Da dies auf Flughäfen jedoch regelmäßig erfor<strong>der</strong>lich<br />
ist, sollten Flughäfen entwe<strong>der</strong> dauerhaft o<strong>der</strong> über lang laufende (Konzessions- bzw.<br />
Leasing-) Verträge privatisiert werden. Bei einem zeitlich begrenzten, aber für sehr lange Zeit<br />
abgeschlossenen (<strong>Privatisierung</strong>s-) Vertrag bestehen – abgesehen vom Ende <strong>der</strong><br />
entsprechenden Zeitperiode – ähnliche Rahmenbedingungen <strong>und</strong> Probleme wie bei einer<br />
dauerhaften <strong>Privatisierung</strong>. Deshalb wird im Folgenden nur <strong>der</strong> Fall einer dauerhaften<br />
<strong>Privatisierung</strong> betrachtet, die Überlegungen sind jedoch im Wesentlichen auch auf<br />
Konzessionsverträge mit langer Laufzeit übertragbar.<br />
Vor- <strong>und</strong> Nachteile einer Voll- bzw. Teilprivatisierung<br />
Beim Umfang einer <strong>Privatisierung</strong> ist zu entscheiden, ob sämtliche Anteile<br />
(Vollprivatisierung) o<strong>der</strong> nur Anteile (Teilprivatisierung) an einem Flughafen bzw. einer<br />
Flughafengesellschaft verkauft werden. Die empirische Evidenz deutet auf höhere<br />
Effizienzsteigerung bei einer Vollprivatisierung hin (López-Calva 1998, S.4). Dies lässt sich<br />
durch folgende theoretische Überlegungen erklären:<br />
• Bessere Disziplinierung des Managements durch die Kapitalmärkte,<br />
• Geringere Interessenskonflikte des Staates (als bei einer Teilprivatisierung, bei <strong>der</strong> <strong>der</strong><br />
Staat dann i.d.R. eine Doppelrolle als Eigentümer <strong>und</strong> <strong>Re</strong>gulierer innehat) <strong>und</strong><br />
• Erhöhte Glaubwürdigkeit <strong>und</strong> somit erhöhte Investitionssicherheit für private<br />
Investoren aufgr<strong>und</strong> <strong>der</strong> durch eine Vollprivatisierung stärker steigenden Kosten<br />
zukünftiger <strong>Re</strong>gierungseingriffe (Shleifer / Vishny 1996)<br />
Für eine Teilprivatisierung sprechen <strong>unter</strong> Umständen geringere Hold-up-Probleme durch<br />
Einbeziehung <strong>der</strong> an den relevanten Planungsprozessen beteiligten öffentlichen<br />
Miteigentümer. Um diesen Effekt zu erzielen, reicht jedoch eine Min<strong>der</strong>heitsbeteiligung <strong>der</strong><br />
öffentlichen Hand an dem Flughafen aus. Bei einer Teilprivatisierung bleibt für die<br />
öffentliche Hand darüber hinaus die Möglichkeit bestehen, über ihre Flughafenbeteiligung<br />
Einfluss auf die regionalwirtschaftliche Entwicklung auszuüben; dieses Ziel ist jedoch oft<br />
nicht kompatibel mit dem Leitbild einer am Ziel <strong>der</strong> Wohlfahrtssteigerung orientierten<br />
Flughafenpolitik.<br />
17 Diese Aussage bezieht sich insbeson<strong>der</strong>e auf Flughäfen in Industrielän<strong>der</strong>n. In Schwellen- <strong>und</strong><br />
Entwicklungslän<strong>der</strong>n hingegen kann auch die <strong>Privatisierung</strong> einzelner Leistungsbereiche vorteilhaft sein.<br />
18 Lediglich die Eigentumsrechte an den Slots werden an dieser Stelle nicht in die Betrachtungen mit<br />
einbezogen; siehe hierzu Abschnitt 5.<br />
17
<strong>Privatisierung</strong>sprozess: (Wettbewerblicher) Verkauf an strategischen Investor vs.<br />
Börsenplatzierung<br />
Der Prozess einer <strong>Privatisierung</strong> kann über die Platzierung von Unternehmensanteilen an <strong>der</strong><br />
Börse – im englischen Sprachgebrauch als „Initial Public Offering“ (IPO) bezeichnet – o<strong>der</strong><br />
die gezielte Einbeziehung strategischer Investoren erfolgen. Letzteres bedeutet eine<br />
wettbewerbliche Vergabe an einzelne Unternehmen o<strong>der</strong> an Konsortien, die häufig aus<br />
Unternehmen mit Erfahrung im Flughafenbetrieb <strong>und</strong> –management sowie reinen<br />
Kapitalgebern bzw. –investoren bestehen. Bei <strong>der</strong> Entscheidung zwischen diesen Alternativen<br />
sind folgende Aspekte zu berücksichtigen:<br />
• Transparenz: Vorteil eines IPO ist die große Transparenz beim Verkauf.<br />
• (Transaktions-)Kosten: Aufgr<strong>und</strong> <strong>der</strong> relativ hohen administrativen Kosten eines<br />
Börsengangs eignet sich ein IPO nur für größere Flughäfen.<br />
• Vorgabe einer klaren Unternehmensstrategie: Nach <strong>der</strong> Theorie effizienter<br />
Kapitalmärkte besteht kein Unterschied <strong>der</strong> beiden Alternativen bezüglich <strong>der</strong><br />
zukünftigen Vorgabe einer klaren Unternehmensstrategie; weicht man jedoch von <strong>der</strong><br />
uneingeschränkten Gültigkeit dieser Theorie ab, so ist ein IPO insbeson<strong>der</strong>e bei<br />
Flughäfen mit Managementdefiziten aufgr<strong>und</strong> eines nicht absehbaren Ausgangs <strong>der</strong><br />
sich ergebenden Eigentümerstruktur problematisch.<br />
• Einbringung von Management-Know-how: Das Gleiche gilt bezüglich <strong>der</strong><br />
Einbringung bzw. des Aufbaus von Management-Know-how, so dass dann <strong>der</strong><br />
Verkauf an strategische Investoren tendenziell Vorteile gegenüber einem IPO bietet.<br />
Insbeson<strong>der</strong>e große öffentliche Flughäfen können aber auch bereits über ausreichendes<br />
Management-Know-how verfügen, so dass die genannten Vorteile strategischer<br />
Investoren vor allem für kleinere Flughäfen relevant sein dürften.<br />
• Kapitalkraft <strong>der</strong> neuen Anteilseigner: Dem Argument, dass strategische Investoren<br />
<strong>unter</strong> Umständen nicht über das erfor<strong>der</strong>liche Kapital verfügen, kann durch den<br />
Verweis auf die Möglichkeit <strong>der</strong> Einbindung von institutionellen Anlegern bzw.<br />
Kreditinstituten begegnet werden.<br />
Es zeigt sich also auch hier keine Überlegenheit einer <strong>der</strong> Alternativen. Es besteht auch die<br />
Möglichkeit, beide Formen zur Gestaltung des <strong>Privatisierung</strong>sprozesses zu kombinieren.<br />
Dabei wird in einem ersten Schritt durch den Verkauf eines wesentlichen Anteils des<br />
Flughafens an einen strategischen Investor ein effizientes Management mit einer klaren<br />
Unternehmensstrategie geschaffen. In einem zweiten Schritt kann <strong>der</strong> öffentliche Eigentümer<br />
später die restlichen Anteile an <strong>der</strong> Börse platzieren.<br />
Exkurs: Getrennte Privatsierung einzelner Flughäfen vs. <strong>Privatisierung</strong> von<br />
Flughafensystemen<br />
Bei einer <strong>Privatisierung</strong> <strong>der</strong> Flughäfen eines Landes ist weiterhin zu entscheiden, ob einzelne<br />
Flughäfen o<strong>der</strong> ganze Flughafensysteme veräußert werden sollten. Letzteres reduziert die<br />
Transaktionskosten beim Verkauf. Kontrovers wird diskutiert, ob durch das gemeinsame<br />
Eigentum mehrerer Flughäfen Synergieeffekte von Flughafensystemen entstehen. Niemeier<br />
18
<strong>und</strong> Wolf (2002) kommen zu dem Schluss, dass diese sehr stark begrenzt sind <strong>und</strong> sich im<br />
Wesentlichen auf den Transfer von Management-Know-how beschränken. Der Eigentümer<br />
<strong>der</strong> drei wichtigsten Londoner Flughäfen führt dagegen an, dass Synergieeffekte in einem<br />
relevanten Ausmaß bestehen <strong>und</strong> Transaktionskosten durch eine verbesserte Koordination<br />
reduziert werden (Toms 2003, S. 3ff.). 19 Trotz wettbewerbspolitischer Bedenken folgt die<br />
britische <strong>Re</strong>gulierungsbehörde <strong>der</strong> Argumentation.<br />
Zwischenfazit: Keine allgemeingültigen Schlussfolgerungen zur Ausgestaltung<br />
einer <strong>Privatisierung</strong> möglich<br />
Insgesamt lassen sich keine allgemeingültigen Schlussfolgerungen bezüglich <strong>der</strong><br />
Ausgestaltung einer <strong>Privatisierung</strong> im Hinblick auf <strong>der</strong>en Umfang <strong>und</strong> Prozess ziehen. Da<br />
diese jedoch von großer Bedeutung für das Erreichen <strong>der</strong> <strong>Privatisierung</strong>sziele ist (López-<br />
Calva 1998, S.5), sollte bei je<strong>der</strong> <strong>Privatisierung</strong> <strong>unter</strong> Berücksichtigung <strong>der</strong> konkreten Ziele<br />
<strong>und</strong> <strong>der</strong> konkret existierenden Beschränkungen sowohl im politischen als auch institutionellen<br />
Bereich eine Einzelfallentscheidung in Bezug auf Privatiserungsumfang <strong>und</strong> -prozess<br />
durchgeführt werden.<br />
3.2 Schlussfolgerungen aus den Erfahrungen in Großbritannien, Neuseeland <strong>und</strong><br />
Australien<br />
Großbritannien, Neuseeland <strong>und</strong> Australien waren bzw. sind Vorreiter bei <strong>der</strong> <strong>Privatisierung</strong><br />
von Flughäfen. Dabei wurden jedoch sehr <strong>unter</strong>schiedliche Wege in den einzelnen Län<strong>der</strong>n<br />
eingeschlagen. 20 Großbritannien begann bereits 1987 mit <strong>der</strong> Vollprivatisierung <strong>der</strong> drei<br />
großen Londoner Flughäfen Heathrow, Gatwick <strong>und</strong> Stansted als Flughafensystem über einen<br />
Börsengang. Die weiteren größeren Flughäfen wurden inzwischen mit Ausnahme des<br />
Flughafens Manchester häufig vollständig an strategische Investoren verkauft. Bei kleineren<br />
Flughäfen blieb die öffentliche Hand – meist regionale Körperschaften – weiterhin alleiniger<br />
Eigentümer o<strong>der</strong> zumindest Teilhaber.<br />
In Neuseeland wurden die großen Flughäfen Auckland <strong>und</strong> Wellington teilprivatisiert. Auch<br />
hier gab es keine einheitliche <strong>Privatisierung</strong>sstrategie. Der Mehrheitsanteil am Flughafen<br />
Auckland wurde an <strong>der</strong> Börse platziert, <strong>der</strong> Mehrheitsanteil am Flughafen Wellington<br />
hingegen wurde an strategische Investoren verkauft.<br />
In Australien wurden die großen Flughäfen des nationalen Flughafensystems über sehr<br />
langfristige Konzession privatisiert <strong>und</strong> jeweils einzeln, i.d.R. vollständig, an strategische<br />
Investoren verkauft. Hervorzuheben ist, dass die <strong>Privatisierung</strong> <strong>der</strong> Flughäfen in Sydney<br />
aufgr<strong>und</strong> beson<strong>der</strong>er Umstände wie einer zunächst ungeklärten Kapazitätserweiterungsfrage,<br />
den olympischen Spielen 2000 <strong>und</strong> dem Konkurs <strong>der</strong> zweitgrößten Fluggesellschaft Ansett<br />
zeitlich hinausgezögert wurde. Dieses erscheint äußerst plausibel, da bei einer <strong>Privatisierung</strong><br />
19 Zur Diskussion <strong>der</strong> wettbewerbspolitischen Aspekte einer horizontalen Integration von Flughäfen siehe<br />
Abschnitt 7.<br />
20 Für eine detaillierte Beschreibung <strong>der</strong> Erfahrungen in Großbritannien, Neuseeland <strong>und</strong> Australien siehe<br />
Anhang.<br />
19
vor dem Hintergr<strong>und</strong> großer, insbeson<strong>der</strong>e politischer Risiken die Investoren hohe<br />
Risikozuschläge gefor<strong>der</strong>t hätten.<br />
Bei Betrachtung <strong>der</strong> internationalen Erfahrungen in Großbritannien, Neuseeland <strong>und</strong><br />
Australien wird deutlich, dass Flughäfen privatisiert werden, wobei festzustellen ist, dass bei<br />
kleineren Flughäfen eine geringere Tendenz zur <strong>Privatisierung</strong> besteht. Umfang <strong>und</strong> Form <strong>der</strong><br />
<strong>Privatisierung</strong> <strong>unter</strong>schieden sich von Land zu Land.<br />
3.3 Empfehlungen für die <strong>Privatisierung</strong> <strong>der</strong> Flughäfen in Deutschland<br />
Auf <strong>der</strong> Gr<strong>und</strong>lage <strong>der</strong> theoretischen Überlegungen <strong>und</strong> <strong>unter</strong> Einbeziehung internationaler<br />
Erfahrungen können folgende Handlungsempfehlungen in Bezug auf die <strong>Privatisierung</strong> <strong>der</strong><br />
<strong>deutschen</strong> Flughäfen gegeben werden:<br />
• Die <strong>deutschen</strong> Flughäfen sollten privatisiert werden.<br />
• Während für kleinere Flughäfen eine Ausschreibung von Unternehmensanteilen an<br />
strategische Investoren sinnvoll erscheint, kann für größere Flughäfen (Primär- <strong>und</strong><br />
einige Sek<strong>und</strong>ärflughäfen) keine allgemeingültige Empfehlung abgegeben werden.<br />
Lediglich bei offensichtlich unzureichen<strong>der</strong> Managementkompetenz ist die<br />
Einbeziehung eines strategischen Investors durch Ausschreibung einem Börsengang<br />
vorzuziehen. Ggf. ist in einigen Fällen eine Mischform geeignet, bei <strong>der</strong> erst über eine<br />
Ausschreibung Know-how in das Unternehmen transferiert wird <strong>und</strong> in einem zweiten<br />
Schritt bei ausreichen<strong>der</strong> Größe des Unternehmens weitere Anteile an <strong>der</strong> Börse<br />
platziert werden.<br />
• In welchen Fällen eine vollständige <strong>Privatisierung</strong> einer mehrheitlichen<br />
Teilprivatisierung vorzuziehen ist, hängt von den konkreten Rahmenbedingungen ab.<br />
20
4 Abschätzung <strong>der</strong> Marktmacht <strong>der</strong> <strong>deutschen</strong> Flughäfen<br />
4.1 Theoretische Gr<strong>und</strong>lagen<br />
Traditionell wird angenommen, dass Flughäfen Monopole darstellen, in einem unregulierten<br />
Umfeld ihre Marktmacht ausnutzen <strong>und</strong> gewinnmaximierende Preise nach <strong>der</strong> Cournot-<strong>Re</strong>gel<br />
setzen. Ob diese Annahme Gültigkeit besitzt, wird inzwischen von Teilen <strong>der</strong> Wissenschaft<br />
bezweifelt (Starkie 2001, S. 124-127; Forsyth 2001, S. 8f.).<br />
Ein Unternehmen besitzt Marktmacht, wenn es über längere Zeit den Marktpreis autonom<br />
beeinflussen kann. Wenn <strong>der</strong> vom Unternehmen gesetzte Preis über den langfristigen<br />
marginalen Kosten liegt, ist dies mit Wohlfahrtsverlusten verb<strong>und</strong>en. Diese Möglichkeit tritt<br />
in ausgeprägter Form insbeson<strong>der</strong>e im Falle von Marktversagen aufgr<strong>und</strong> eines natürlichen<br />
Monopols auf, das einerseits vor potenzieller Konkurrenz geschützt <strong>und</strong> an<strong>der</strong>erseits keiner<br />
Substitutionskonkurrenz ausgesetzt ist. Dann kann das Unternehmen eine Preissetzung nach<br />
<strong>der</strong> Cournot-<strong>Re</strong>gel durchführen. 21<br />
Im Falle <strong>der</strong> Flughäfen bedeutet Marktmacht, dass <strong>der</strong> Betreiber für die Nutzung <strong>der</strong><br />
Leistungsbereiche des Flughafens Preise verlangen kann, die über den langfristigen<br />
Bereitstellungskosten eines effizienten Unternehmens liegen, ohne dass es auf absehbare Zeit<br />
K<strong>und</strong>en an Konkurrenten verliert (King 2001, S.10). Für die Beurteilung <strong>der</strong> Notwendigkeit<br />
einer <strong>Re</strong>gulierung ist es darüber hinaus entscheidend, ob das Unternehmen diesen<br />
Preissetzungsspielraum auch ausnutzen würde.<br />
Bei <strong>der</strong> Analyse ist zu berücksichtigen, ob die Marktmacht des gesamten Flughafens o<strong>der</strong> nur<br />
im Aviation-Bereich betrachtet wird bzw. betrachtet werden soll:<br />
• Für die Betrachtung <strong>der</strong> Marktmacht im Aviation-Bereich ist aufgr<strong>und</strong> <strong>der</strong><br />
vollständigen Komplementarität <strong>der</strong> Leistungsbereiche die Summe <strong>der</strong> einzelnen<br />
Preise in das Verhältnis zur Summe <strong>der</strong> langfristigen Durchschnittskosten zu setzen,<br />
um Marktmacht bzw. das Ausnutzen von Marktmacht für diese Bereiche zu<br />
identifizieren. 22<br />
• Für die Betrachtung <strong>der</strong> Marktmacht des gesamten Flughafens sind zusätzlich die<br />
Preise im Non-Aviation-Bereich zu berücksichtigen.<br />
Im Folgenden wird zunächst in Unterabschnitt 4.1.1 die Marktmacht von Flughäfen diskutiert<br />
<strong>und</strong> dabei <strong>der</strong> Non-Aviation-Bereich ausgeklammert bzw. nur indirekt über bestehende<br />
Komplementaritätsbeziehungen berücksichtigt. Anschließend erfolgt in Unterabschnitt 4.1.2<br />
eine geson<strong>der</strong>te Diskussion über Martkmacht im Non-Aviation-Bereich. Nach einer<br />
21 Es ist natürlich zu berücksichtigen, dass im Falle des natürlichen Monopols bei Preissetzung nach <strong>der</strong><br />
wohlfahrtsmaximierenden Preis-gleich-Grenzkosten-<strong>Re</strong>gel das Defizitproblem auftritt. Unter <strong>der</strong> – mit<br />
verschiedenen Argumenten (insbeson<strong>der</strong>e fiskalische Äquivalenz) zu rechtfertigenden – Nebenbedingung <strong>der</strong><br />
Kostendeckung kann die Preissetzung nach dem Durchschnittskostenprinzip o<strong>der</strong> gemäß <strong>der</strong> Ramsey-Preisregel<br />
erfolgen.<br />
22<br />
Bei Bepreisung des Zugangs zum Flughafen sind auch die Preise im Leistungsbereich<br />
Verkehrsinfrastrukturanbindung in die Betrachtungen mit einzubeziehen.<br />
21
Untersuchung <strong>und</strong> Bewertung <strong>der</strong> Möglichkeiten zur Preisdifferenzierung im System<br />
Flughafen in Unterabschnitt 4.1.3 wird ein Zwischenfazit zur Marktmacht in Unterabschnitt<br />
4.1.4 gezogen.<br />
4.1.1 Marktmacht im Aviation-Bereich<br />
Zunächst werden drei Einflussfaktoren vorgestellt, die Marktmacht von Flughäfen<br />
hervorrufen o<strong>der</strong> verstärken; anschließend werden vier Einflussfaktoren entgegengestellt, die<br />
Marktmacht selbst o<strong>der</strong> Anreize zum Ausnutzen von Marktmacht im Aviation-Bereich<br />
reduzieren.<br />
4.1.1.1 Marktmacht verstärkende Faktoren: Subadditivitäten <strong>und</strong><br />
Markteintrittsbarrieren sowie Abschöpfung von Quasirenten bei<br />
Netzwerkfluggesellschaften<br />
Subadditivitäten<br />
Im Falle eines natürlichen Monopols liegt eine subadditive Kostenfunktion vor, so dass die<br />
Gesamtnachfrage am kostengünstigsten durch ein Unternehmen befriedigt werden kann.<br />
Größenvorteile resultieren bei Flughäfen aus Unteilbarkeiten bei <strong>der</strong> Erstellung des Angebots.<br />
Um zu einem aussagekräftigen Ergebnis bei <strong>der</strong> Betrachtung <strong>der</strong> Subadditivitäten zu<br />
kommen, sollte man zwischen kurz- <strong>und</strong> langfristigen Größenvorteilen <strong>unter</strong>scheiden (Wolf<br />
1997, S. 40). Kurzfristige Auslastungsvorteile sind dann vorhanden, wenn bei gegebenen<br />
Kapazitäten des Flughafens eine intensivere Nutzung dieser Kapazitäten zu sinkenden<br />
Durchschnittskosten führt. Langfristige Größenvorteile werden dagegen dadurch bestimmt,<br />
dass eine Kapazitätserweiterung zu sinkenden Durchschnittskosten führt.<br />
22
Langfristige<br />
Durchschnittskosten<br />
Durchschnittskosten<br />
Kurzfristige<br />
Durchschnittskosten<br />
1 Terminal,1 S/L-Bahn Kurzfristige<br />
Durchschnittskosten<br />
2 Terminal;1 S/L-Bahn<br />
Kurzfristige<br />
Durchschnittskosten<br />
2 Terminal; 2 S/L-Bahnen<br />
C 2<br />
C 1<br />
Q 1 Q 2<br />
Ausbringungsmenge<br />
(WLU)<br />
Abbildung 3: Durchschnittskosten von Flughäfen,<br />
(Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Doganis 1992, S. 52)<br />
Empirische Untersuchungen zu langfristigen Größenvorteilen auf europäischen Flughäfen<br />
kommen zu keinem eindeutigem Ergebnis (Doganis, Graham <strong>und</strong> Lobbenberg 1995, S. 47;<br />
Pels 2000, S.46f.). Es kann aber davon ausgegangen werden, dass die Durchschnittskosten<br />
nur bis zu einer bestimmten Ausbringungsmenge sinken <strong>und</strong> danach annähernd konstant<br />
verlaufen o<strong>der</strong> sogar ansteigen (siehe Abbildung 3) 23 . Pels (2000, 44ff.) stellt fest, dass in<br />
Europa einige Flughäfen im Bereich ansteigen<strong>der</strong> Durchschnittskosten operieren; Niemeier<br />
(2002, S.39) verweist auf Beispiele für kapazitätsbeschränkte Hubflughäfen, bei denen – ohne<br />
Betrachtung <strong>der</strong> externen Kosten – steigende Durchschnittskosten zu beobachten sind. 24<br />
23 Die Angaben zur Ausbringungsmenge, ab <strong>der</strong> langfristige Durchschnittskosten nicht mehr signifikant sinken,<br />
schwanken in <strong>der</strong> Literatur zwischen 5 Mio. WLU (Doganis et. al. 1995) <strong>und</strong> 12,5 Mio. WLU (Niemeier 2002,<br />
beruft sich auf Pels 2000 <strong>und</strong> ergänzende Angaben dieses Autors).WLU (Work Load Unit) ist eine<br />
Vergleichseinheit für die Ausbringungsmenge von Flughäfen. 1 WLU = 1 Passagier o<strong>der</strong> 100kg Fracht<br />
24 Aus den bisherigen Darstellungen könnte gefolgert werden, dass die Nachfrage nach Flughafenleistungen in<br />
einer <strong>Re</strong>gion ab einer gewissen Größe des relevanten Marktes aufgr<strong>und</strong> <strong>der</strong> dann fehlenden Größenvorteile<br />
durch zwei Flughäfen stets günstiger als durch einen Flughafen erfolgen könnte (WOLF 1997, S.40ff.). Dieses<br />
Ergebnis ist jedoch nicht zwangsläufig gültig, wenn ein Großteil dieser Nachfrage auf Passagiere einer (bzw.<br />
mehrerer) so genannten/r Netzwerkfluggesellschaft(en) entfällt, die an diesem Flughafen einen „Hub“ betreibt<br />
(bzw. betreiben).<br />
23
Es bleibt festzuhalten, dass Kostenfunktionen von Flughäfen in Folge ihrer komplexen<br />
Strukturen schwierig zu vergleichen sind. Obwohl die genannten Studien auf einer hohen<br />
Aggregationsstufe durchgeführt wurden, deuten die Ergebnisse darauf hin, dass bei größeren<br />
Flughäfen kein natürliches Monopol vorliegen muss.<br />
Markteintrittsbarrieren<br />
Für die Bewertung von Wettbewerbspotenzialen bei Flughäfen sind Marktzutrittsschranken<br />
von beson<strong>der</strong>er Bedeutung. Wenn keine Markteintrittsbarrieren bestehen, sind selbst bei<br />
Vorliegen von Subadditivität die Möglichkeiten des Anbieters – unabhängig von <strong>der</strong><br />
Ausprägung <strong>der</strong> Nachfragecharakteristika (wie <strong>der</strong> Existenz von Substitutionskonkurrenz) –<br />
begrenzt, durch entsprechende Preissetzung Überrenditen zu erzielen, denn potenzielle<br />
Konkurrenz schränkt den Preissetzungsspielraum ein. 25 Bei Flughäfen bestehen zwei Formen<br />
von Markteintrittsbarrieren, die Marktmacht verstärken:<br />
- Versunkene Kosten: Sie ergeben sich durch hohe irreversible Kosten, die beim Neuo<strong>der</strong><br />
Ausbau von Flughäfen anfallen.<br />
- Institutionelle Markteintrittsbarrieren in Form planungs- <strong>und</strong> umweltrechtlicher<br />
Einschränkungen bei <strong>der</strong> Standortwahl verhin<strong>der</strong>n bzw. erschweren den Ausbau<br />
vorhandener bzw. den Bau neuer Flughäfen (Starkie 2002, S. 63).<br />
Abschöpfung von Quasirenten bei Netzwerkfluggesellschaften<br />
Durch den Aufbau ihrer Flugverbindungen nach dem Prinzip eines Hub-and-Spoke-<br />
Netzwerks können Fluggesellschaften im Bereich einer gewissen Nachfragehöhe<br />
Kostenvorteile gegenüber einem ausschließlichen Angebot von Direktflügen realisieren. Zur<br />
Erzielung von Netzwerkeffekten in diesem Hub-and-Spoke-System ist es erfor<strong>der</strong>lich, eine<br />
ausreichend hohe Anzahl an Passagieren am Drehkreuzflughafen zu konzentrieren. In<br />
Abhängigkeit <strong>der</strong> Nachfrage ergibt sich daher eine Höchstzahl an Luftverkehrsdrehkreuzen,<br />
die nebeneinan<strong>der</strong> in einem Gebiet wirtschaftlich betrieben werden können. Die daraus<br />
resultierende, oligopolistische o<strong>der</strong> sogar monopolistische Struktur in diesem Marktsegment<br />
kann es den Fluggesellschaften erlauben, Überrenditen zu erzielen.<br />
Für einen Hub-Flughafen ist es <strong>unter</strong> Umständen möglich, diese Überrenditen ganz o<strong>der</strong><br />
teilweise von einer Fluglinie abzuschöpfen, wenn<br />
- für die das Hub-and-Spoke-Netzwerk betreibende Luftverkehrsgesellschaft – z.B.<br />
aufgr<strong>und</strong> ihrer K<strong>und</strong>enstruktur o<strong>der</strong> von Bindungen an ihr „Heimatland“ – nur dieser<br />
eine Flughafen als Hub geeignet ist o<strong>der</strong><br />
- wenn die Luftverkehrsgesellschaft aufgr<strong>und</strong> getätigter spezifischer Investitionen, die<br />
nicht ausreichend durch langfristige Verträge geschützt sind, nicht glaubhaft mit <strong>der</strong><br />
Verlegung des Hubs zu einem an<strong>der</strong>en geeigneten Flughafen drohen kann. 26<br />
25 Zur Theorie <strong>der</strong> bestreitbaren Märkte siehe Baumol / Panzar / Willig (1988).<br />
26 Allerdings werden auch vom Flughafen spezifische Investitionen im Hinblick auf die Zusammenarbeit mit<br />
einer bestimmten Fluggesellschaft getätigt. Dieser Aspekt wird u.a. in Unterabschnitt 6.1.3 beleuchtet.<br />
24
4.1.1.2 Marktmacht abschwächende Faktoren: Substitutionskonkurrenz,<br />
Marktmachtgegengewicht <strong>und</strong> Komplementaritäten<br />
Die Marktmacht von Flughäfen kann durch intramodale <strong>und</strong> intermodale<br />
Substitutionskonkurrenz, ein Marktmachtgegengewicht <strong>der</strong> Fluggesellschaften sowie<br />
aufgr<strong>und</strong> <strong>der</strong> Komplementaritäten zwischen dem Aviation- <strong>und</strong> dem Non-Aviation-Bereich<br />
eingeschränkt sein.<br />
Intramodale Substitutionskonkurrenz durch an<strong>der</strong>e Flughäfen<br />
Wettbewerb bzw. potenzieller Wettbewerb zwischen Flughäfen wird wesentlich durch die im<br />
Folgenden aufgeführten Aspekte beeinflusst:<br />
o Wettbewerb zwischen Hub-Flughäfen um Transferpassagiere: Die Existenz mehrerer,<br />
konkurrieren<strong>der</strong> Netzwerkfluggesellschaften mit einem Hub-and-Spoke-System führt<br />
indirekt auch zu einem Wettbewerb <strong>der</strong> jeweiligen Drehkreuzflughäfen um Umsteiger<br />
(Starkie 2002, S. 66). Die Anzahl <strong>der</strong> konkurrierenden Fluggesellschaft-Flughafen-<br />
Paare ist dabei entscheidend für das Ausmaß des Wettbewerbs (Wolf 1997, S. 41-46).<br />
o Größe <strong>und</strong> Überlappung von Einzugsgebieten: Aber auch benachbarte Flughäfen ohne<br />
Drehkreuzfunktion können im Wettbewerb stehen. Die Marktmacht eines Flughafens<br />
wird umso größer ausfallen, je größer das natürliche Einzugsgebiet ist. In<br />
Ballungsräumen kann es aber zu sich überlappenden Einzugsgebieten kommen. Hier<br />
entsteht Konkurrenz zwischen zwei o<strong>der</strong> mehreren Flughäfen um das dortige<br />
potenzielle Passagieraufkommen. Da Passagiere nicht nach ihrer geographischen<br />
Herkunft preislich differenziert werden können, überträgt sich dieser Wettbewerb auf<br />
alle Passagiere <strong>der</strong> konkurrierenden Flughäfen (Starkie 2002, S. 68). Verfügen diese<br />
Flughäfen über freie Kapazitäten, kann von einem Wettbewerb ausgegangen werden.<br />
Die geographische Nähe, die Dichte <strong>und</strong> das Angebot von Flughäfen in einem Gebiet<br />
sind entscheidend für die Konkurrenz zwischen Flughäfen (Wolf 1997, S. 41-46).<br />
Holzschnei<strong>der</strong> (2003) weist darüber hinaus auf die Abhängigkeit des Einzugsgebietes<br />
von den am jeweiligen Flughafen angebotenen Flugfrequenzen <strong>und</strong> –preisen hin.<br />
o Wirtschaftsstruktur: Das Verkehrspotenzial einer <strong>Re</strong>gion wird nicht nur durch <strong>der</strong>en<br />
Ausdehnung <strong>und</strong> Bevölkerungszahl, son<strong>der</strong>n auch maßgeblich durch <strong>der</strong>en<br />
Wirtschaftsstruktur geprägt, die Einfluss auf den Anteil <strong>der</strong> Geschäfts- <strong>und</strong><br />
Privatreisenden an den jeweiligen Flughäfen hat. Bei Geschäftsreisenden sind die<br />
Opportunitätskosten <strong>der</strong> Zeitverwendung hoch <strong>und</strong> somit die Preiselastizität <strong>der</strong><br />
Nachfrage geringer. Sie werden deshalb meist den am nächsten gelegenen Flughafen<br />
auswählen, so dass ein Flughafen in <strong>Re</strong>gionen mit großer Wirtschaftskraft <strong>und</strong> hohem<br />
Geschäftsreiseverkehr tendenziell einen größeren Preissetzungsspielraum besitzt. Der<br />
intramodale Wettbewerb ist somit umso stärker, je geringer das lokale<br />
Passagieraufkommen im Geschäftsreiseverkehr <strong>und</strong> je geringer die Entfernung zum<br />
nächstgelegenen Flughafen ist, <strong>der</strong> im gleichen Marktsegment tätig ist (Wolf 1997, S.<br />
45).<br />
o Erreichbarkeit an<strong>der</strong>er Flughäfen: Die räumliche Abgrenzung anhand des natürlichen<br />
Einzugsgebietes muss um die Erreichbarkeitskomponente erweitert werden. Eine gute<br />
25
Verkehrsinfrastrukturanbindung kann für manche Flughäfen <strong>der</strong>en Einzugsgebiet<br />
erhöhen <strong>und</strong> die Konkurrenz zwischen Flughäfen för<strong>der</strong>n. Für die Flughafenwahl ist<br />
die Anreisezeit ein entscheidendes Kriterium. Die relative Bedeutung von<br />
Anreisezeiten nimmt aber mit zunehmen<strong>der</strong> <strong>Re</strong>iseentfernung ab (Wolf 1997, S. 42).<br />
Auch bei Privatreisenden ist die Zeit weniger bedeutend. Sie reagieren elastischer auf<br />
Preis<strong>unter</strong>schiede. So besteht bei entsprechen<strong>der</strong> Verkehrsanbindung auch die<br />
Bereitschaft, einen entfernter liegenden Flughafen zu benutzen. Folglich bestehen bei<br />
Flughäfen mit einem hohen Pauschalreiseverkehr tendenziell geringere Möglichkeiten<br />
zur Ausnutzung von Marktmacht.<br />
Insgesamt besitzen Fluggesellschaften bzw. Passagiere eine <strong>Re</strong>ihe von Möglichkeiten zur<br />
Substitution von Flughäfen mit <strong>der</strong> Folge, dass <strong>der</strong> Preissetzungsspielraum <strong>der</strong> Flughäfen<br />
begrenzt sein kann.<br />
Intermodale Substitutionskonkurrenz<br />
Die Existenz gut ausgebauter Autobahnen o<strong>der</strong> Hochgeschwindigkeitszugverbindungen kann<br />
intermodalen Wettbewerb für den Flugverkehr <strong>und</strong> die betroffenen Flughäfen bedeuten. Bei<br />
zu hohen Flugpreisen könnte eine entsprechend wettbewerbsfähige Bahnanbindung eine<br />
Substitution ermöglichen <strong>und</strong> disziplinierend wirken. Allerdings ist diese Konkurrenz nur bei<br />
Kurzstreckenflügen entlang <strong>der</strong> Verkehrskorridore <strong>der</strong> an<strong>der</strong>en Verkehrsträger tatsächlich<br />
relevant. Außerdem nimmt sie bei zunehmen<strong>der</strong> Bedeutung des zeitsensitiven<br />
Geschäftsreiseverkehrs ab. Wettbewerbspotenziale für Geschäftsreisen sind auf<br />
<strong>Re</strong>isedistanzen von etwa 300 bis 500 km beschränkt. Bei mehrtägigen Geschäftsreisen ist <strong>der</strong><br />
relevante Entfernungsbereich größer (Wolf 1997, S. 46-52; Starkie 2002, S. 69).<br />
Marktmachtgegengewicht aufgr<strong>und</strong> unvollständigen Wettbewerbs<br />
Ein so genanntes Marktmachtgegengewicht („co<strong>unter</strong>vailing power“) in einem nicht<br />
wettbewerbsfähigen Markt kann entstehen, wenn Nutzer glaubhaft androhen können, die<br />
Leistung nicht mehr in Anspruch zu nehmen bzw. an<strong>der</strong>e Alternativen, die nicht in einer<br />
konventionellen Marktanalyse erfasst sind, zu wählen (King, S. 12). Eine solche glaubhafte<br />
Androhung beschränkt ein marktmächtiges Unternehmen in seinem Preissetzungsspielraum.<br />
Bei Flughäfen kann ein Marktmachtgegengewicht von einer Fluggesellschaft aufgebaut<br />
werden, wenn<br />
1. sie glaubhaft mit einem vollständigen Abzug von dem Flughafen o<strong>der</strong> <strong>der</strong><br />
<strong>Re</strong>duzierung von Streckenverbindungen zu diesem Flughafen drohen kann,<br />
2. es wegen unvollständigen Wettbewerbs kein Luftverkehrs<strong>unter</strong>nehmen gibt, das das<br />
wegfallende Angebot ersetzen könnte <strong>und</strong><br />
3. <strong>der</strong> Flughafen dadurch einen bedeutenden Umsatzverlust erleiden würde.<br />
In diesen Fällen ist <strong>der</strong> Preissetzungsspielraum des Flughafens eingeschränkt. Bei kleineren<br />
<strong>und</strong> mittleren Flughäfen kann beispielsweise die dominierende Fluggesellschaft glaubhaft mit<br />
dem Wechsel zu einem benachbarten Flughafen o<strong>der</strong> sogar einem vollständigen Rückzug aus<br />
<strong>der</strong> <strong>Re</strong>gion drohen. Denn es wäre denkbar, dass sie in einem unvollständig funktionierenden<br />
Wettbewerb die einzige Fluglinie darstellt, die diesen Flughafen in ein Hub-and-Spoke-Netz<br />
26
integrieren würde. Durch ihren Abzug würde <strong>der</strong> Flughafen einen beträchtlichen Teil seiner<br />
Einnahmen einbüßen, wohingegen angenommen werden kann, dass die Fluggesellschaft zur<br />
Not bei einer nur geringen Nachfrage aus dieser <strong>Re</strong>gion auf die einzelne Streckenverbindung<br />
verzichten könnte. 27<br />
Im Falle eines Hubflughafens kann eine Fluglinie, die hier ein Drehkreuz ihres Streckennetzes<br />
aufgebaut hat, gr<strong>und</strong>sätzlich nicht glaubhaft mit einem Rückzug von diesem Flughafen<br />
drohen. Dagegen sprechen hohe, i.d.R. vertraglich nicht weiter geschützte, faktorspezifische<br />
Investitionen <strong>der</strong> Fluggesellschaft zum Aufbau <strong>der</strong> Drehkreuzfunktion. Es beleibt ihr jedoch<br />
die Möglichkeit, mit dem Verzicht auf einen weiteren Ausbau bzw. mit dem Rückbau des<br />
eigenen Hub-and-Spoke-Netzes zu drohen. Selbst diese Entscheidung kann für einen<br />
Hubflughafen mit einem bedeutenden Rückgang <strong>der</strong> Erlöse verb<strong>und</strong>en sein <strong>und</strong> somit<br />
zumindest ein begrenztes Drohpotenzial darstellen, den eventuell vorhandenen<br />
Preissetzungsspielraum nicht bzw. nicht übermäßig auszunutzen.<br />
Komplementaritäten zwischen Aviation- <strong>und</strong> Non-Aviation-Bereich<br />
Für eine Einschätzung, ob Marktmacht im Aviation-Bereich auch ausgenutzt wird, spielt <strong>der</strong><br />
schon dargestellte Komplementärcharakter <strong>der</strong> angebotenen Güter auf einem Flughafen eine<br />
entscheidende Rolle (vgl. Starkie 2001, S. 124ff.; Starkie 2002, S. 70; Forsyth 2001, S. 8ff.).<br />
Die Abhängigkeit <strong>der</strong> kommerziellen Aktivitäten von <strong>der</strong> realisierten Nachfrage im<br />
Luftverkehrsbereich kann selbst ohne eine Preisregulierung bei einem profitmaximierenden<br />
Flughafen<strong>unter</strong>nehmen mit Marktmacht im Aviation-Bereich zu Anreizen führen, die<br />
luftseitigen Preise (bzw. ggf. auch für die Verkehrsinfrastrukturanbindung) niedrig zu halten,<br />
um so durch ein möglichst großes Passagieraufkommen höhere Erträge im kommerziellen<br />
Bereich zu erzielen. Das genaue Gewinnoptimum <strong>und</strong> die optimale Bepreisung von Aviation<strong>und</strong><br />
Non-Aviation-Bereich hängt aber von <strong>der</strong> Stärke <strong>der</strong> Komplementarität ab (Zhang /<br />
Zhang 1997). Diese ist abhängig von <strong>der</strong> Nutzerstruktur, insbeson<strong>der</strong>e <strong>der</strong> Zusammensetzung<br />
des Passagieraufkommens. Aussagen dazu sind allerdings nicht eindeutig. So wird zum Teil<br />
angeführt, dass internationale Transferpassagiere, insbeson<strong>der</strong>e Langstreckenpassagiere, für<br />
den größten Anteil am Umsatz im Non-Aviation-Bereich verantwortlich seien (Starkie 2002,<br />
S. 71). An<strong>der</strong>erseits wird auch behauptet, dass gerade Umsteiger weniger <strong>und</strong> stattdessen das<br />
originäre Passagieraufkommen stärker zum Umsatz in diesem Bereich beitragen würden<br />
(Wolf 1997, S. 40ff.).<br />
4.1.2 Marktmacht im Non-Aviation-Bereich<br />
Flughafengesellschaften verfügen im Non-Aviation-Bereich teilweise über<br />
Angebotsspielräume, durch die sie Überrenditen erzielen können. Diese Freiheit bei <strong>der</strong><br />
Preissetzung resultiert v.a. aus den ausschließlichen Entscheidungsrechten eines<br />
Flughafenbetreibers über die Flächen- <strong>und</strong> Terminalnutzung am jeweiligen Standort (Wolf<br />
1997, S. 54f.). Bei <strong>der</strong> Bewertung dieser hohen Erträge gibt es zwei <strong>unter</strong>schiedliche<br />
27 Forsyth (2001, S. 11) bestreitet jedoch die Existenz eines Marktmachtgegengewichts <strong>der</strong> Fluggesellschaften<br />
für den australischen Markt, da er von vollständigem Wettbewerb ausgeht, bei dem ein Mitbewerber den Platz<br />
sofort übernehmen würde.<br />
27
Ansichten. Zum Teil wird argumentiert, dass es sich dabei lediglich um Lagerenten handelt,<br />
die die Opportunitätskosten <strong>der</strong> Infrastrukturanlagennutzung an einem bevorzugten Ort mit<br />
Flächenknappheit wi<strong>der</strong>spiegeln. Die Mehrheitsmeinung sieht darin jedoch eine weitere Form<br />
des Missbrauchs von Marktmacht, die zu Wohlfahrtsverlusten führt (Forsyth 2001, S. 28f.).<br />
Da aber ein Großteil <strong>der</strong> Angebote im Non-Aviation-Bereich einer Konkurrenz außerhalb des<br />
Flughafengeländes <strong>unter</strong>liegt, sind Preissetzungsspielräume begrenzt <strong>und</strong> mögliche<br />
Effizienzverluste eher als gering einzuschätzen. Deshalb ist es fraglich, ob eine <strong>Re</strong>gulierung<br />
des Non-Aviation-Bereiches notwendig bzw. vorteilhaft ist.<br />
Darüber hinaus gibt es weitere Gründe, die eine <strong>Re</strong>gulierung des Non-Aviation-Bereiches<br />
fraglich erscheinen lassen:<br />
• Da die angebotenen Dienstleistungen von Passagieren nicht zwingend in Anspruch<br />
genommen werden müssen 28 , stellen hohe Preise im Non-Aviation-Bereich auch eine<br />
an den Zahlungsbereitschaften orientierte Preisdifferenzierung für die Nutzung des<br />
Flughafens dar.<br />
• Aufgr<strong>und</strong> des Komplementärcharakters führt die uneingeschränkte Möglichkeit <strong>der</strong><br />
Preissetzung im Non-Aviation-Bereich zudem beim Flughafenbetreiber zu einer<br />
<strong>Re</strong>duzierung <strong>der</strong> Anreize, seine bestehende Marktmacht im Aviation-Bereich<br />
auszunutzen (Starkie 2001, S. 124 ff). Ein möglicher Missbrauch des<br />
Preissetzungsspielraums im Non-Aviation-Bereich ist deshalb als weniger<br />
problematisch zu bewerten.<br />
4.1.3 Exkurs: Möglichkeiten zur Abschöpfung <strong>der</strong> Zahlungsbereitschaft <strong>der</strong><br />
Nachfrager durch einen Flughafen mit Marktmacht<br />
Die Folgen unregulierter Marktmacht sind nicht per se wohlfahrtsschädigend. Denn ein<br />
Flughafen mit Marktmacht kann – alternativ zur Preissetzung nach <strong>der</strong> Cournot-<strong>Re</strong>gel –<br />
versuchen, Preisdifferenzierung zu betreiben <strong>und</strong> von jedem einzelnen Nachfrager einen<br />
spezifischen Preis zu verlangen, <strong>der</strong> im Idealfall <strong>der</strong> jeweiligen, individuellen<br />
Zahlungsbereitschaft entspricht. Die Folge wäre eine höchst effiziente Allokation <strong>der</strong><br />
bestehenden Kapazität. Einige Ökonomen vertreten daher die Ansicht, dass – wenn eine<br />
Effizienzsteigerung das einzige Ziel <strong>der</strong> Flughafenpolitik darstellt – <strong>der</strong> Verzicht auf die<br />
<strong>Re</strong>gulierung eines marktmächtigen Flughafens sinnvoll wäre (Forsyth 2001, S. 8). Allerdings<br />
kann kritisch bemerkt werden, dass eine präzise Preisdifferenzierung oft an ihrer<br />
Durchsetzbarkeit scheitert. Zudem würde <strong>der</strong> Flughafenbetreiber durch die Abschöpfung <strong>der</strong><br />
gesamten bzw. eines Großteils <strong>der</strong> Konsumentenrente erhebliche Überrenditen erwirtschaften.<br />
Dies stellt eine problematische Distributionswirkung dar.<br />
Preisdifferenzierung bietet zudem eine Möglichkeit, im Falle des natürlichen Monopolisten<br />
den klassischen Zielkonflikt zwischen allokativer Ineffizienz <strong>und</strong> <strong>der</strong> möglichen<br />
unzureichenden Kostendeckung bei Vorgabe von einheitlichen Preisen nahe den Grenzkosten<br />
zu reduzieren. Auch bei einem regulierten Flughafen kann es daher durchaus sinnvoll sein,<br />
28 Umsteiger, die während <strong>der</strong> Wartezeit auf ihre Anschlussverbindungen kaum über Ausweichmöglichkeiten<br />
verfügen, haben nur einen geringen Anteil am Umsatz im Non-Aviation-Bereich (Wolf 1997, S. 11).<br />
28
dem Betreiber einen Spielraum zur Preisdifferenzierung <strong>unter</strong> Berücksichtigung <strong>der</strong> Ramsey-<br />
<strong>Re</strong>gel einzuräumen (CAA 2001c, S.53ff.), sei es allgemein zur effizienteren Allokation <strong>der</strong><br />
vorhandenen Kapazitäten o<strong>der</strong> im Falle von nahe an <strong>der</strong> <strong>Re</strong>ntabilitätsgrenze agierenden<br />
Flughäfen zur Erleichterung <strong>der</strong> Kostendeckung.<br />
Die folgende Tabelle 2 soll aufzeigen, inwieweit Preisdifferenzierung im Flughafenmarkt<br />
möglich ist. Dazu wird für jedes Marktsegment eine qualitative Bewertung <strong>der</strong> Preiselastizität<br />
<strong>der</strong> Nachfrage vorgenommen, um daran anschließend abzuschätzen, bei welchen<br />
Nachfragegruppen ein Flughafen eine Preisdifferenzierung durchsetzen könnte. Gemäß <strong>der</strong><br />
Preissetzungsregel nach Ramsey sollten höhere Aufschläge auf die Grenzkosten insbeson<strong>der</strong>e<br />
für Produkte erfolgen, <strong>der</strong>en Nachfrage eine niedrige Preiselastizität aufweist, da dann nur<br />
begrenzte Wohlfahrtsverluste auftreten. Die Durchsetzbarkeit <strong>der</strong> Preisdifferenzierung ist<br />
wie<strong>der</strong>um v.a. davon abhängig, inwieweit es dem Flughafen gelingt, durch eine begleitende<br />
Produktdifferenzierung eine <strong>unter</strong>schiedlich hohe Zahlungsbereitschaft für die verschiedenen<br />
Qualitätsstufen seines Angebots bei den Nachfragern zu etablieren o<strong>der</strong> bei homogener<br />
Produktstruktur <strong>der</strong>en Möglichkeit zum Arbitragegeschäft zu <strong>unter</strong>binden.<br />
Tabelle 2: Möglichkeiten zur Preisdifferenzierung auf Flughäfen (Quelle: eigene Darstellung)<br />
4.1.4 Zwischenfazit<br />
Die Analyse <strong>der</strong> Determinanten <strong>der</strong> Marktmacht zeigt, dass nicht pauschal beurteilt werden<br />
kann, ob Flughäfen Marktmacht besitzen. Die Abschätzung <strong>der</strong> Marktmacht eines Flughafens<br />
<strong>und</strong> daraus abgeleitet <strong>der</strong> Vorteilhaftigkeit einer <strong>Re</strong>gulierung sollte bzw. kann deshalb nur<br />
<strong>unter</strong> Berücksichtigung <strong>der</strong> Ausprägung dieser Determinanten in Bezug auf den jeweiligen<br />
Flughafen bzw. Flughafentyp erfolgen.<br />
29
4.2 Schlussfolgerungen aus den Erfahrungen in Großbritannien, Neuseeland <strong>und</strong><br />
Australien<br />
In Großbritannien, Neuseeland <strong>und</strong> Australien werden – wie weltweit in <strong>der</strong> großen Mehrzahl<br />
<strong>der</strong> Län<strong>der</strong> – zumindest die größeren Flughäfen reguliert. 29 Kleinere Flughäfen sind teilweise<br />
unreguliert bzw. einer <strong>Re</strong>gulierungsvariante mit geringerer Eingriffsintensität ausgesetzt.<br />
Hieraus kann im Umkehrschluss nicht pauschal gefolgert werden, dass diese Flughäfen keine<br />
Marktmacht besitzen. Vielmehr können drei Gründe angeführt werden, die eine solche<br />
Beobachtung rechtfertigen würden.<br />
• Der Preissetzungsspielraum eines Flughafens ist tatsächlich so gering, dass keine<br />
Marktmacht identifiziert werden kann.<br />
• Der entsprechende Flughafen operiert an seiner <strong>Re</strong>ntabilitätsgrenze. Daher wird bei<br />
<strong>der</strong> Entscheidung zur Vorteilhaftigkeit einer <strong>Re</strong>gulierung dem Kostendeckungsaspekt<br />
eine höhere Bedeutung beigemessen als einer Preissetzung nahe den Grenzkosten.<br />
• Der Flughafen besitzt Marktmacht, nutzt diesen Angebotsspielraum auch aus <strong>und</strong><br />
erwirtschaftet dadurch Überrenditen. Die durch eine <strong>Re</strong>gulierung vermiedenen<br />
Wohlfahrtsverluste fallen jedoch niedriger aus als <strong>der</strong>en Kosten. Folglich wird keine<br />
<strong>Re</strong>gulierung durchgeführt.<br />
4.3 Abschätzung <strong>der</strong> Marktmacht <strong>der</strong> <strong>deutschen</strong> Flughäfen<br />
Im Folgenden sollen zunächst in Unterabschnitt 4.3.1 die zuvor beschriebenen Faktoren, die<br />
entwe<strong>der</strong> Marktmacht verstärken o<strong>der</strong> die Marktmacht selbst bzw. Anreize zum Ausnutzen<br />
von Marktmacht im Aviation-Bereich reduzieren, in Anwendung auf die <strong>deutschen</strong><br />
Verkehrsflughäfen analysiert werden. Die Bewertung erfolgt dabei differenziert nach Primär-,<br />
Sek<strong>und</strong>är- <strong>und</strong> Tertiärflughäfen. Anschließend wird kurz in Unterabschnitt 4.3.2 die<br />
Bedeutung möglicher Marktmacht im Non-Aviation-Bereich diskutiert. In Unterabschnitt<br />
4.3.3 wird ein <strong>Re</strong>sümee gezogen.<br />
4.3.1 Marktmacht im Aviation-Bereich<br />
4.3.1.1 Marktmacht verstärkende Faktoren: Subadditivitäten <strong>und</strong><br />
Markteintrittsbarrieren sowie Abschöpfung von Quasirenten bei Hub-Airlines<br />
Subadditivitäten <strong>und</strong> Größenvorteile<br />
Die pauschale Einstufung, dass Flughäfen natürliche Monopole seien <strong>und</strong> somit<br />
Subadditivitäten vorliegen, ist in Deutschland nicht aufrechtzuerhalten. Es kann davon<br />
ausgegangen werden, dass bei den Primärflughäfen Frankfurt <strong>und</strong> München, aber auch für die<br />
Sek<strong>und</strong>ärflughäfen in Düsseldorf, Hamburg, Berlin-Tegel, Stuttgart <strong>und</strong> Köln/Bonn<br />
Größenvorteile nur noch einen geringen bis gar keinen Einfluss auf das Ausmaß von<br />
29 Für eine ausführliche Darstellung <strong>der</strong> Erfahrungen mit <strong>der</strong> <strong>Privatisierung</strong> <strong>und</strong> <strong>Re</strong>gulierung <strong>der</strong> Flughäfen in<br />
Großbritannien, Neuseeland <strong>und</strong> Australien siehe Anhang.<br />
30
Marktmacht besitzen. So stellt z.B. Pels (2000, S. 44f.) auch fest, dass Frankfurt <strong>und</strong><br />
München im Bereich steigen<strong>der</strong> Grenzkosten operieren.<br />
Folglich kann für die einzelnen Flughafentypen folgendes Ergebnis festgehalten werden:<br />
• Primärflughäfen: Marktmacht aufgr<strong>und</strong> von Subadditivitäten besteht nicht.<br />
• Sek<strong>und</strong>ärflughäfen: Subadditivitäten sind bei einer zunehmenden Zahl <strong>der</strong> Flughäfen<br />
fraglich. Signifikante Marktmacht kann daraus nicht abgeleitet werden.<br />
• Tertiärflughäfen: Subadditivitäten sind empirisch nachgewiesen.<br />
Markteintrittsbarrieren<br />
Zum einen ist die Höhe <strong>der</strong> irreversiblen Kosten zu berücksichtigen, die bei einem<br />
Marktzutritt von einem neuen Konkurrenten aufzuwenden sind. So werden insbeson<strong>der</strong>e<br />
Neubauprojekte von größeren Flughäfen in Deutschland schwierig sein, wenn schon ein<br />
etablierter Flughafen in <strong>der</strong> <strong>Re</strong>gion tätig ist. Bei Tertiär- bzw. Quartiärflughäfen ist diese<br />
Aussage allerdings nicht in jedem Fall begründet (Barrett 2000, S. 15). So kann auch <strong>der</strong><br />
Ausbau bereits vorhandener Infrastruktur versunkene Kosten verringern <strong>und</strong> einen<br />
Markteintritt erleichtern, wie die Beispiele ehemaliger Militärflughäfen (wie z.B. Hahn <strong>und</strong><br />
Altenburg-Nobitz) zeigen, die inzwischen von Low-Cost-Fluggesellschaften angeflogen<br />
werden.<br />
Von Bedeutung sind in Deutschland rechtliche <strong>und</strong> institutionelle Markteintrittsbarrieren<br />
(Wolf 1997, S. 55ff.). Der Bau <strong>und</strong> Betrieb eines Flughafens bedarf einer behördlichen<br />
Genehmigung (vgl. § 8 Abs. 1 LuftVG). Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens wird<br />
geprüft, ob die geplante Maßnahme den Erfor<strong>der</strong>nissen <strong>der</strong> Raum- <strong>und</strong> Landesplanung<br />
entspricht sowie öffentliche <strong>und</strong> private Belange einschließlich <strong>der</strong> Umweltverträglichkeit<br />
abgewogen worden sind. Vor allem schärfere Umweltauflagen können die Suche nach<br />
geeigneten Standorten für Flughafenneubauten in Deutschland erschweren. Des Weiteren<br />
verhin<strong>der</strong>t die erhebliche Dauer <strong>der</strong> Prüfungs- <strong>und</strong> Genehmigungsverfahren einen<br />
unmittelbaren Markteintritt eines potenziellen Wettbewerbers. Negativbeispiele stellen in<br />
diesem Zusammenhang <strong>der</strong> Neubau des Flughafens München II dar, für den vom<br />
Genehmigungsantrag bis zur Eröffnung 23 Jahre vergingen, sowie <strong>der</strong> Ausbau des Flughafens<br />
Stuttgart, <strong>der</strong> noch 19 Jahre beanspruchte (ADV 1997, S. 123). Da bei internationalen<br />
Verkehrsflughäfen irreversible Kosten weiterhin hoch sind <strong>und</strong> erhebliche institutionelle<br />
Barrieren existieren, ist eine Bestreitbarkeit des <strong>deutschen</strong> Flughafenmarktes nicht gegeben.<br />
Folglich kann für die einzelnen Flughafentypen folgendes Ergebnis festgehalten werden:<br />
• Primärflughäfen: Es bestehen sehr hohe Markteintrittsbarrieren, insbeson<strong>der</strong>e<br />
rechtlicher <strong>und</strong> institutioneller Natur, die potenziellen Wettbewerb beschränken.<br />
• Sek<strong>und</strong>ärflughäfen: Auch für diese Flughäfen bestehen sehr hohe<br />
Markteintrittsbarrieren, insbeson<strong>der</strong>e rechtlicher <strong>und</strong> institutioneller Natur, die<br />
potenziellen Wettbewerb beschränken.<br />
• Tertiärflughäfen: Die große Dichte teilweise immer noch nicht o<strong>der</strong> kaum genutzter<br />
Flughafeninfrastruktur in Deutschland bedeutet, dass für diese Flughäfen die<br />
31
Markteintrittsbarrieren deutlich geringer sind. <strong>Re</strong>chtliche <strong>und</strong> institutionelle Barrieren<br />
reduzieren jedoch auch hier potenziellen Wettbewerb.<br />
Abschöpfung von Quasirenten bei Netzwerkfluggesellschaften<br />
Diese Marktmacht verstärkende Determinante könnte wegen des notwendigen Hub-Status’<br />
gr<strong>und</strong>sätzlich nur bei Primärflughäfen auftreten, d.h. Frankfurt <strong>und</strong> München. Seit <strong>der</strong><br />
Liberalisierung des europäischen Luftverkehrsmarktes ist es auch ausländischen<br />
Netzwerkfluggesellschaften möglich, Zubringerverkehr aus Deutschland ihren jeweiligen<br />
Drehkreuzen zuzuführen. Dieser Wettbewerb zwischen Netzwerkfluggesellschaften ist auch<br />
an Sek<strong>und</strong>är-, weniger jedoch an Tertiäflughäfen zu beobachten. Daher ist es insgesamt<br />
fraglich, inwieweit die Lufthansa in Deutschland noch in <strong>der</strong> Lage ist, einen Preisaufschlag<br />
für die Anbindung an das Hub-and-Spoke-Netzwerk durchzusetzen. Dementsprechend gibt es<br />
auch keine bzw. kaum Überrenditen, die die Flughafengesellschaften in Frankfurt <strong>und</strong><br />
München mittels höherer Preise von <strong>der</strong> Lufthansa als Quasirente abschöpfen könnten.<br />
Folglich kann für die einzelnen Flughafentypen folgendes Ergebnis festgehalten werden:<br />
• Primärflughäfen: Aufgr<strong>und</strong> dieses Kriteriums wird keine Marktmacht begründet bzw.<br />
verstärkt.<br />
• Sek<strong>und</strong>ärflughäfen: Das Kriterium ist für diese Flughäfen nicht relevant.<br />
• Tertiärflughäfen: Das Kriterium ist für diese Flughäfen nicht relevant.<br />
4.3.1.2 Marktmacht abschwächende Faktoren: Substitutionskonkurrenz,<br />
Marktmachtgegengewicht <strong>und</strong> Komplementaritäten<br />
Intramodaler Wettbewerb zwischen Flughäfen<br />
Das Ausmaß intramodalen Wettbewerbs, dem die <strong>deutschen</strong> Flughäfen ausgesetzt sind, kann<br />
anhand <strong>der</strong> abgeleiteten Faktoren wie folgt beurteilt werden:<br />
• Wettbewerb zwischen Hub-Flughäfen um Transferpassagiere: Der Wettbewerb um<br />
Umsteiger wird auf europäischer Ebene geführt. 30 Seit <strong>der</strong> Liberalisierung des<br />
europäischen Luftverkehrs stehen die Flughäfen in Frankfurt <strong>und</strong> München in<br />
Kombination mit <strong>der</strong> Lufthansa in Konkurrenz zu Flughäfen wie Amsterdam, London-<br />
Heathrow <strong>und</strong> Paris CDG <strong>und</strong> <strong>der</strong>en jeweiligen Netzwerkfluggesellschaften, die<br />
wie<strong>der</strong>um alle auf beson<strong>der</strong>s attraktiven <strong>Re</strong>lationen auch <strong>der</strong> Konkurrenz von Punktzu-Punkt-Verbindungen<br />
an<strong>der</strong>er Fluggesellschaften ausgesetzt sind (Niemeier / Wolf<br />
2002, S. 196). Die Anzahl <strong>der</strong> Wettbewerber ist somit in Deutschland hoch. Dennis<br />
(1998 S. 240) zählt z.B. acht verschiedene Drehkreuze, die für einen <strong>Re</strong>isenden von<br />
Berlin nach Los Angeles mit verschiedenen Fluggesellschaften zur Auswahl stehen.<br />
Somit ist die Marktmacht in Frankfurt <strong>und</strong> München reduziert. Das<br />
30 Das Entstehen weiterer Drehkreuzflughäfen in Deutschland, neben Frankfurt <strong>und</strong> München, ist auf absehbare<br />
Zeit nicht zu erwarten, es sei denn, Kapazitätsprobleme, verb<strong>und</strong>en mit Ausbaurestriktionen an einem<br />
bestehendem Drehkreuz, machen dies – wie zuvor in München – notwendig.<br />
32
Umsteigerpassagieraufkommen ist aufgr<strong>und</strong> seiner geringen Bedeutung bei Sek<strong>und</strong>är<strong>und</strong><br />
Tertiärflughäfen nicht relevant.<br />
• Größe <strong>und</strong> Überlappung von Einzugsgebieten sowie Wirtschaftsstruktur: Hier ist vor<br />
allem das Originärpassagieraufkommen in <strong>der</strong> räumlichen Umgebung des Flughafens<br />
zu betrachten. Das Originäraufkommen <strong>und</strong> insbeson<strong>der</strong>e <strong>der</strong> Anteil des<br />
Geschäftsreiseverkehraufkommens ist bei den Primär- <strong>und</strong> Sek<strong>und</strong>ärflughäfen<br />
aufgr<strong>und</strong> ihrer geographischen Lage in wirtschaftlich starken <strong>Re</strong>gionen<br />
(Rhein/Main/Neckar-Gebiet, Ruhrgebiet, Hamburg, München o<strong>der</strong> Stuttgart) deutlich<br />
höher als bei den Tertiärflughäfen. Demnach verfügen Sek<strong>und</strong>ärflughäfen über ein<br />
gewisses Maß an Marktmacht. Tertiärflughäfen, die häufig eine große Abhängigkeit<br />
vom Pauschalreiseverkehr aufweisen, stehen <strong>unter</strong> deutlich höherem<br />
Wettbewerbsdruck. Dieser kann aber auch bei Sek<strong>und</strong>ärflughäfen mit stark<br />
überlappenden Einzugsgebieten vorliegen. Holzschnei<strong>der</strong> (2003, S. 332f.)<br />
beispielsweise errechnet mit Hilfe eines umfassenden Flughafenwahlmodels einen<br />
maximalen Potenzialverlust des Flughafens Düsseldorf bei Geschäftsreisenden von<br />
15%, falls <strong>der</strong> nah gelegene Flughafen Köln/Bonn ein gleichwertiges Angebotsbild<br />
erreicht.<br />
• Erreichbarkeit an<strong>der</strong>er Flughäfen: Der insgesamt gute Zustand <strong>und</strong> Ausbaugrad <strong>der</strong><br />
landseitigen Verkehrsinfrastruktur in Deutschland hat eine gute Erreichbarkeit vieler<br />
deutscher Verkehrsflughäfen zur Folge. Als Beispiel kann die kürzlich neu eröffnete<br />
Bahn-Neubaustrecke Köln-Frankfurt genannt werden, die in Kombination mit den<br />
direkten Bahnanbindungen <strong>der</strong> jeweiligen Flughäfen die relevanten Einzugsgebiete<br />
sowohl des Flughafens Frankfurt als auch des Flughafens Düsseldorf nachhaltig<br />
erweitern.<br />
Zusammengefasst lässt sich in Bezug auf die einzelnen Flughafentypen folgendes Ergebnis<br />
festhalten:<br />
• Primärflughäfen: Wettbewerb mit an<strong>der</strong>en Drehkreuzflughäfen reduziert Marktmacht.<br />
• Sek<strong>und</strong>ärflughäfen: Intramodale Substitution ist kaum möglich <strong>und</strong> reduziert<br />
Marktmacht folglich nicht.<br />
• Tertiärflughäfen: Intramodale Substitution ist bedingt für einzelne Marktsegmente<br />
möglich. Entsprechend reduziert sich die Marktmacht.<br />
Intermodaler Wettbewerb zwischen verschiedenen Verkehrsträgern<br />
Intermodaler Wettbewerb betrifft vor allem Tertiärflughäfen, da <strong>der</strong> Anteil von<br />
Kurzstreckenverbindungen an ihrem Passagierlinienverkehr hoch ist. Beispiele für<br />
wettbewerbsfähige Bahnstrecken sind Hannover-Köln, Hannover-Frankfurt, Hamburg-<br />
Frankfurt. Eine noch stärkere Rolle könnte die intermodale Konkurrenz in Zukunft spielen.<br />
Mit neuen Hochgeschwindigkeitszügen können die <strong>Re</strong>isezeiten auf den Schienenwegen<br />
verkürzt werden. Insgesamt nimmt die intermodale Angreifbarkeit <strong>der</strong> <strong>Re</strong>isemärkte mit<br />
zunehmen<strong>der</strong> Bedeutung des Geschäftsreiseverkehrs ab (Wolf 1997, S. 52).<br />
33
Folglich kann für die einzelnen Flughafentypen folgendes Ergebnis festgehalten werden:<br />
• Primärflughäfen: Intermodaler Wettbewerb ist nur für einen relativ geringen Anteil<br />
des Verkehrsaufkommens relevant <strong>und</strong> reduziert somit nicht die Marktmacht.<br />
• Sek<strong>und</strong>ärflughäfen: Auch hier ist intermodaler Wettbewerb auf wenige Kurzstrecken<br />
reduziert. Der Anteil des entsprechenden Verkehrs ist jedoch höher als bei<br />
Primärflughäfen. Insgesamt wird die Marktmacht nur geringfügig reduziert.<br />
• Tertiärflughäfen: Für diese Flughäfen ist die Marktmacht reduzierende Wirkung<br />
intermodalen Wettbewerbs noch am größten, jedoch insgesamt als eher gering<br />
einzuschätzen.<br />
Marktmachtgegengewicht aufgr<strong>und</strong> unvollständigen Wettbewerbs<br />
An den Primärflughäfen in Frankfurt <strong>und</strong> München ist mit <strong>der</strong> Deutschen Lufthansa AG eine<br />
Netzwerkfluggesellschaft aktiv, die nicht glaubwürdig die Inanspruchnahme <strong>der</strong> Leistung<br />
aufkündigen könnte. Die Verhandlungsposition, bei einer Preiserhöhung mit Rückzug aus<br />
dem Geschäft zu drohen, ist äußerst eingeschränkt, da die Fluggesellschaft, verb<strong>und</strong>en mit<br />
ihrer Netzwerkbereitstellung, hohe irreversible Kosten aufgewendet hat, die einen sofortigen<br />
Marktaustritt unmöglich machen. 31 Mit an<strong>der</strong>en Worten: die Wahl <strong>der</strong> Lufthansa für einen<br />
Flughafen als Hub-Standort begründet ein Abhängigkeitsverhältnis für eine längere Zeitdauer.<br />
Insofern existiert ein Marktmachtgegengewicht in Frankfurt <strong>und</strong> München nur durch die<br />
Drohung, einen Teil <strong>der</strong> Streckenverbindungen abzuziehen <strong>und</strong> an einen an<strong>der</strong>en Flughafen<br />
zu transferieren; durch den Aufbau des Münchner Flughafens als zweitem Hub hat die<br />
Lufthansa ein entsprechendes Drohpotenzial gegenüber beiden Flughäfen aufgebaut.<br />
Sek<strong>und</strong>ärflughäfen mit einem attraktiven Einzugsgebiet wie Hamburg, Düsseldorf o<strong>der</strong><br />
Stuttgart besitzen eine große Bedeutung für den Linienverkehr <strong>und</strong> werden daher von den<br />
meisten europäischen Netzwerkfluggesellschaften angeflogen. Folglich sind<br />
Sek<strong>und</strong>ärflughäfen kaum einem Marktmachtgegengewicht <strong>der</strong> dominanten Fluggesellschaft –<br />
<strong>der</strong> Lufthansa- ausgesetzt. 32 Diese Argumentation trifft auch für die Primärflughäfen zu, die<br />
ebenfalls ein attraktives Einzugsgebiet besitzen <strong>und</strong> von den großen<br />
Netzwerkfluggesellschaften angeflogen werden.<br />
Bei kleineren Tertiärflughäfen ist jedoch anzunehmen, dass die Lufthansa in einigen<br />
<strong>Re</strong>gionen die einzige Netwerkfluggesellschaft darstellt, die den Standort in ein weltweites<br />
Hub-and-Spoke-Streckennetz integrieren würde. Sie besitzt daher mit dem Umsatz<br />
31 Es ist zu vermuten, dass die Lufthansa diese spezifischen Investitionen nur ungenügend in langfristigen<br />
Vereinbarungen mit den jeweiligen Flughäfen hat absichern können.<br />
32 Als Beispiel sei kurz <strong>der</strong> Flughafen Stuttgart erwähnt. Die Lufthansa ist mit einem gesamten Anteil von 26%<br />
am gesamten Passagierverkehr (Linie <strong>und</strong> Touristik) die dominante Fluggesellschaft. Der Verkehr nach<br />
Frankfurt (wovon ein guter Teil Zubringerverkehr sein dürfte) macht jedoch nur 5,1% des gesamten<br />
Aufkommens in Stuttgart aus. Zum Vergleich: 3,9% fliegen mit Air France nach Paris CDG, 2,9% mit British<br />
Airways nach London Heathrow <strong>und</strong> 2,5% mit KLM nach Amsterdam (Flughafen Stuttgart 2003). Sollte die<br />
Lufthansa ihr Angebot Stuttgart-Frankfurt reduzieren, kann davon ausgegangen werden, dass die an<strong>der</strong>en<br />
Netzwerkfluggesellschaften ihr Angebot zu den jeweiligen Drehkreuzen entsprechend aufstocken würden.<br />
34
eduzierenden Abzug ein relativ großes Drohpotenzial gegenüber dem Flughafenbetreiber.<br />
Bei unvollständigem Wettbewerb zwischen den Fluggesellschaften an einem Standort wie<br />
z.B. Nürnberg sind die Einstellung einer Flugstrecke o<strong>der</strong> ein Ausweichen auf einen in <strong>der</strong><br />
Nähe gelegenen, günstigeren Flughafen für sie nicht mit hohen Marktaustrittskosten<br />
verb<strong>und</strong>en <strong>und</strong> daher kurzfristig realisierbar.<br />
Bedeutende Fluggesellschaften mit Punkt-zu-Punkt-Verbindungen wie HapagLloyd Express<br />
o<strong>der</strong> Germanwings besitzen am Köln-Bonner Flughafen aufgr<strong>und</strong> ihrer höheren Flexibilität<br />
ebenfalls ein Marktmachtgegengewicht, da auch ihr Rückzug mit einem empfindlichen<br />
Umsatzrückgang für den Flughafen verb<strong>und</strong>en wäre. Da Tertiärflughäfen einen relativ großen<br />
Umsatzanteil im Pauschal- <strong>und</strong> Charterreiseverkehr realisieren <strong>und</strong> es in diesem Segment<br />
nötig ist, vor allem Leistungen zu niedrigen Preisen anzubieten, werden die entsprechenden<br />
Flughäfen zudem indirekt einem ähnlichen Wettbewerbsdruck ausgesetzt, wie er zwischen<br />
den Fluggesellschaften herrscht. Verstärkt wird dies durch einen Markteintritt von<br />
Quartiärflughäfen in diesem Segment, die immer mehr in Konkurrenz zu den Tertiärflughäfen<br />
treten. Diese Tendenz wird durch neue Spielregeln im Luftverkehrsmarkt bewirkt, in dem<br />
Low-Cost-Fluggesellschaften wie RyanAir erhöhte Nachfrage für Flüge schaffen (Barrett<br />
2000, S. 20ff.). Ein Marktmachtgegengewicht von Fluggesellschaften kann also insbeson<strong>der</strong>e<br />
gegenüber Tertiärflughäfen vorliegen.<br />
Zusammenfassend kann folgendes Ergebnis festgehalten werden:<br />
• Primärflughäfen: Die Lufthansa als Netzwerkfluggesellschaft besitzt nur ein<br />
begrenztes Marktmachtgegengewicht.<br />
• Sek<strong>und</strong>ärflughäfen: Fluggesellschaften besitzen kein Marktmachtgegengewicht.<br />
• Tertiärflughäfen: Insbeson<strong>der</strong>e die Lufthansa als i.d.R. einzige Airline, die den<br />
Flughafen an ein Hub-and-Spoke-Netzwerk anschließt, besitzt ein<br />
Marktgegengewicht.<br />
Komplementaritäten<br />
Um die Auswirkungen <strong>der</strong> Komplementaritäsbeziehungen zwischen Aviation- <strong>und</strong> Non-<br />
Aviation-Bereich auf den <strong>deutschen</strong> Flughäfen beurteilen zu können, wird an dieser Stelle<br />
<strong>unter</strong>stellt, dass <strong>der</strong> Non-Aviation-Bereich nicht reguliert wird; diese Annahme wird in<br />
Unterabschnittt 4.1.2 sowie 6.1.1 <strong>und</strong> 6.3.1 diskutiert. Unabhängig vom Anteil <strong>der</strong><br />
Transferpassagiere generieren in Deutschland größere Flughäfen einen höheren Anteil ihrer<br />
Einnahmen aus dem Non-Aviation-Bereich (ADV 2001), so dass für Primär- <strong>und</strong><br />
Sek<strong>und</strong>ärflughäfen wie z.B. Frankfurt, München, Düsseldorf, Hamburg <strong>und</strong> Berlin<br />
angenommen werden kann, dass diese Nachfragebeziehung das Entscheidungskalkül des<br />
Flughafenbetreibers relativ stark beeinflusst. Die Primärflughäfen Frankfurt <strong>und</strong> München<br />
profitieren darüber hinaus von einem höheren Anteil an Langstreckenpassagieren <strong>und</strong> u.U.<br />
den oft längeren Aufenthaltsdauern von Umsteigepassagieren. Tertiärflughäfen, bei denen <strong>der</strong><br />
kommerzielle Bereich eine eher <strong>unter</strong>geordnete Rolle spielt <strong>und</strong> somit nicht über das gleiche<br />
Potenzial verfügt, sind von diesem Effekt weniger stark betroffen.<br />
35
Es bleibt festzuhalten:<br />
- Primärflughäfen: Ein hoher Umsatzanteil im Non-Aviation-Bereich <strong>und</strong> insbeson<strong>der</strong>e ein<br />
hoher Anteil an Langstreckenpassagieren lassen Anreize vermuten, Marktmacht im<br />
Aviation-Bereich nicht vollständig auszunutzen.<br />
- Sek<strong>und</strong>ärflughäfen: Ein hoher Umsatzanteil im Non-Aviation-Bereich lässt Anreize<br />
vermuten, Marktmacht im Aviation-Bereich nicht vollständig auszunutzen.<br />
- Tertiärflughäfen: Anreize, Marktmacht im Aviation-Bereich aufgr<strong>und</strong> von<br />
Komplementarität nicht vollständig auszunutzen, bestehen ebenfalls, sind aber nicht so<br />
stark ausgeprägt.<br />
4.3.2 Marktmacht im Non-Aviation-Bereich<br />
Aus den theoretischen Überlegungen kann abgeleitet werden, dass an <strong>deutschen</strong> Flughäfen im<br />
Non-Aviation-Bereich Preissetzungsspielräume existieren werden. Da diese jedoch begrenzt<br />
sind, erscheint es fraglich, ob eine <strong>Re</strong>gulierung dieses Bereichs zu relevanten<br />
Effizienzgewinnen führen würde. Im Rahmen <strong>der</strong> Analyse <strong>der</strong> verschiedenen<br />
<strong>Re</strong>gulierungssysteme gilt es, im Hinblick auf den Non-Aviation-Bereich zu prüfen, welche<br />
Nutzen <strong>und</strong> Kosten bei seiner <strong>Re</strong>gulierung bzw. bei einer Ausklammerung dieses Bereiches<br />
aus einer <strong>Re</strong>gulierung vorliegen würden.<br />
4.3.3 <strong>Re</strong>sümee <strong>der</strong> Marktmachtabschätzung für die <strong>deutschen</strong> Verkehrsflughäfen<br />
Es bleibt festzustellen, dass für eine Entscheidung über die <strong>Re</strong>gulierung <strong>der</strong> <strong>deutschen</strong><br />
Flughhäfen die Marktmacht im Aviation-Bereich entscheidend ist. Der Grad <strong>der</strong> Marktmacht<br />
im Aviation-Bereich kann bei den <strong>deutschen</strong> Verkehrsflughäfen nicht pauschal bewertet<br />
werden <strong>und</strong> ist <strong>unter</strong>schiedlich ausgeprägt. Die Abbildung 4 fasst die Bewertung <strong>der</strong><br />
einzelnen Faktoren, die Marktmacht von Flughäfen im Aviation-Bereich verstärken o<strong>der</strong><br />
Marktmacht selbst bzw. Anreize zum Ausnutzen von Marktmacht reduzieren, nach<br />
Flughafentyp geordnet zusammen. Hieraus können für die einzelnen Flughafentypen folgende<br />
Schlussfolgerungen gezogen werden.<br />
• Die Primärflughafen Frankfurt <strong>und</strong> München besitzen nicht aufgr<strong>und</strong> von<br />
Subadditivitäten Marktmacht, son<strong>der</strong>n vor allem bedingt durch institutionelle<br />
Markteintrittsbarrieren. Darüber hinaus ist Marktmacht insbeson<strong>der</strong>e gegenüber <strong>der</strong><br />
Deutschen Lufthansa vorhanden, die in beiden Fällen aufgr<strong>und</strong> vertraglich nicht<br />
geschützter, faktorspezifischer Investitionen für den Aufbau einer<br />
Drehscheibenfunktion in einem Abhängigkeitsverhältnis zum jeweiligen Flughafen<br />
steht <strong>und</strong> nur über ein eingeschränktes Marktmachtgegengewicht verfügt. Dennoch ist<br />
ein extensives Ausnutzen dieser Marktmacht aus verschiedenen Gründen fraglich. Der<br />
Flughafenbetreiber hat regelmäßig ein Interesse an einer langfristig gefestigten<br />
Wettbewerbsposition als Hub-Flughafen. Durch Wettbewerb vor allem mit an<strong>der</strong>en<br />
europäischen Drehkreuzflughäfen um Transferpassagiere werden Möglichkeiten zum<br />
Ausnutzen von Marktmacht etwas begrenzt. Die zunehmende Bedeutung des<br />
kommerziellen Bereiches schafft darüber hinaus starke Anreize, den<br />
Preissetzungsspielraum im Aviation-Bereich nicht übermäßig auszunutzen. Dennoch<br />
36
ist ein möglicher Wohlfahrtsverlust bei Ausnutzung <strong>der</strong> Marktmacht in diesem<br />
Segment als so groß einzuschätzen, dass eine <strong>Re</strong>gulierung des Angebotsverhaltens in<br />
Betracht gezogen werden sollte.<br />
• Sek<strong>und</strong>ärflughäfen wie Düsseldorf, Hamburg, Berlin <strong>und</strong> Stuttgart entwickeln<br />
aufgr<strong>und</strong> <strong>der</strong> hohen Attraktivität ihrer Einzugsgebiete insbeson<strong>der</strong>e im Bereich des<br />
europäischen Geschäftsreiseverkehrs bedeutende Marktmacht. Markteintrittsbarrieren<br />
sind vor allem auf institutioneller Ebene vorhanden. Es bestehen jedoch Anreize, den<br />
Preissetzungsspielraum im Aviation-Bereich nicht übermäßig auszunutzen. Des<br />
Weiteren stehen einige Flughäfen wie Düsseldorf <strong>und</strong> Köln/Bonn aufgr<strong>und</strong> ihrer<br />
geographischen Nähe im intramodalen Wettbewerb. Insgesamt sind signifikante<br />
Wohlfahrtsverluste möglich, so dass bis auf Einzelfälle, eine <strong>Re</strong>gulierung des<br />
Angebotsverhaltens in Betracht gezogen werden sollte.<br />
• Tertiärflughäfen (Hannover, Dresden, Leipzig, Nürnberg, etc.) beziehen ihre<br />
Marktmacht vornehmlich aus noch nicht ausgeschöpften Skalenerträgen. Auf<br />
bestimmten Strecken bis zu einer Distanz von 500 km wird ihr Preissetzungsspielraum<br />
jedoch durch intermodale Substitutionskonkurrenz eingeschränkt. Der internationale<br />
Luftverkehr ist vor allem durch den wenig zeitsensitiven Freizeitreiseverkehr<br />
gekennzeichnet, so dass durch die höhere Preiselastizität dieser Passagiergruppe bei<br />
entsprechen<strong>der</strong> Verkehrsanbindung auch intramodale Konkurrenz die Marktmacht<br />
reduziert. Durch den möglichen Eintritt von Quartiärflughäfen in den Markt werden<br />
diese Flughäfen in Zukunft zusätzlich diszipliniert. Unter Berücksichtigung des relativ<br />
starken Marktmachtgegengewichts <strong>der</strong> dominanten Charter- <strong>und</strong> Low-Cost-<br />
Fluggesellschaften bzw. <strong>der</strong> Lufthansa als oft einziger Netzwerkfluggesellschaft ist ein<br />
Ausnutzen von Marktmacht nur eingeschränkt zu erwarten. Eine <strong>Re</strong>gulierung ist daher<br />
nur in seltenen Fällen erfor<strong>der</strong>lich.<br />
37
Abbildung 4: Marktmacht deutscher Verkehrsflughäfen (Quelle: eigene Darstellung)<br />
38
5 Exkurs: Interdependenzen zwischen Marktmacht,<br />
<strong>Re</strong>gulierung <strong>und</strong> Slotallokation<br />
5.1 Theoretische Gr<strong>und</strong>lagen<br />
Slothandel <strong>und</strong> Spitzenlastbepreisung als geeignete Instrumente zur Slotallokation<br />
Bei kapazitätsbeschränkten Flughäfen ist die Nachfrage <strong>der</strong> Fluggesellschaften nach Slots, die<br />
das <strong>Re</strong>cht zur Nutzung <strong>der</strong> Start- <strong>und</strong> Landebahn in einem bestimmten Zeitfenster gewähren,<br />
zeitweise größer als die Kapazität des Flughafens. Die Engpassfaktoren an europäischen<br />
Flughäfen sind häufig – insbeson<strong>der</strong>e an Hub-Flughäfen – die Kapazitäten <strong>der</strong> Start- <strong>und</strong><br />
Landebahnen. 33 Aufgr<strong>und</strong> institutioneller Hemmnisse sind diese Engpässe nicht o<strong>der</strong><br />
zumindest nicht kurzfristig durch Erweiterungsinvestitionen behebbar. 34 Zur Allokation <strong>der</strong><br />
begrenzten Kapazität bestehen gr<strong>und</strong>sätzlich zwei ökonomisch akzeptable Lösungen:<br />
• Handelbare Zertifikate für das <strong>Re</strong>cht, Starts <strong>und</strong> Landungen durchzuführen.<br />
• Spitzenlastbepreisung.<br />
In Europa werden – orientiert an <strong>der</strong> Zertifikatslösung – durch so genannte Slots die <strong>Re</strong>chte<br />
für Starts <strong>und</strong> Landungen begrenzt. Allerdings dürfen diese Slots nicht gehandelt werden,<br />
son<strong>der</strong>n werden nach dem Großvaterprinzip auf die Fluggesellschaften verteilt, was aus<br />
ökonomischer Sicht nicht sinnvoll ist <strong>und</strong> zu keiner effizienten Allokation führt.<br />
Bei <strong>der</strong> Begrenzung <strong>der</strong> Starts <strong>und</strong> Landungen über Slots sowie bei <strong>der</strong> Spitzenlastbepreisung<br />
bestehen nun erhebliche Interdependenzen mit <strong>der</strong> <strong>Re</strong>gulierung eines Flughafens.<br />
• Interdependenzen zwischen Spitzenlastbepreisung <strong>und</strong> <strong>Re</strong>gulierung: Durch<br />
Spitzenlastbepreisung kann <strong>der</strong> Flughafen ggf. (<strong>und</strong> möglicherweise trotz<br />
Landegebühren in Höhe <strong>der</strong> Grenzkosten zu Zeiten geringer Nachfrage) hohe<br />
Überrenditen erzielen. Dieses kann durch die <strong>Re</strong>gulierung auch angestrebte<br />
distributive Ziele konterkarieren.<br />
• Interdependenzen zwischen Slothandel <strong>und</strong> <strong>Re</strong>gulierung: Der Wert von Slots wird<br />
beeinflusst durch die Höhe <strong>der</strong> Preise im Aviation-Bereich; wenn diese steigen, dann<br />
sinkt entsprechend <strong>der</strong> Wert <strong>der</strong> Slots <strong>und</strong> vice versa.<br />
Bewertung verschiedener Verfahren zur Slotallokation<br />
Für die Allokation von <strong>Re</strong>chten zur Benutzung <strong>der</strong> Start- <strong>und</strong> Landebahnen existieren<br />
folgende Möglichkeiten:<br />
• Das bestehende System <strong>der</strong> Zuteilung von Slots nach dem Großvaterprinzip.<br />
• Kapazitätszuteilung nach dem First-Come-First-Serve-Prinzip.<br />
33 Weitere Engpassfaktoren sind auch <strong>Re</strong>striktionen aufgr<strong>und</strong> von Umweltauflagen, Terminalkapazitäten <strong>und</strong> die<br />
Luftraumüberwachung.<br />
34 Siehe hierzu Unterabschnitt 4.3.1.2.<br />
39
• Ein System handelbarer Slots.<br />
• Spitzenlastbepreisung.<br />
• Versteigerung von Slots als <strong>der</strong> Spitzenlastbepreisung ähnliche Lösung.<br />
Bei <strong>der</strong> Spitzenlastbepreisung <strong>und</strong> <strong>der</strong> Auktion von Slots können die über das im Rahmen<br />
einer <strong>Re</strong>gulierung erlaubte Maß hinausgehenden Einnahmen z.B. an den Staat o<strong>der</strong> einen<br />
Kapazitätserweiterungsfond fließen.<br />
Tabelle 3: Alternativen zur Allokation von Slots in Verbindung mit einer <strong>Re</strong>gulierung sowie bei einem<br />
Verzicht auf eine <strong>Re</strong>gulierung (Quelle: eigene Darstellung)<br />
In Tabelle 3 wird eine Bewertung <strong>der</strong> verschiedenen Alternativen zur Allokation von <strong>Re</strong>chten<br />
zur Benutzung <strong>der</strong> Start- <strong>und</strong> Landebahnen in Verbindung mit <strong>der</strong> <strong>Re</strong>gulierung sowie bei<br />
einem Verzicht auf eine <strong>Re</strong>gulierung anhand folgen<strong>der</strong> Kriterien vorgenommen:<br />
• Kapazitätsauslastung: Diese entspricht bei allen Verfahren außer <strong>der</strong> First-Come-<br />
First-Serve-<strong>Re</strong>gel <strong>und</strong> <strong>der</strong> Preissetzung nach <strong>der</strong> Cournot-<strong>Re</strong>gel stets <strong>der</strong> als optimal<br />
angesehenen Kapazität des Flughafens. Bei einer Preissetzung nach <strong>der</strong> Cournot-<strong>Re</strong>gel<br />
kommt es einerseits während Schwachlastzeiten zu einer ineffizienten<br />
Nachfrageverdrängung; an<strong>der</strong>erseits kann auch während Spitzenlastzeiten bei<br />
40
Anwendung <strong>der</strong> Cournot-<strong>Re</strong>gel die umgesetzte Menge <strong>unter</strong>halb <strong>der</strong> maximalen<br />
Kapazität des Flughafens sinken. 35<br />
• Slotallokation: Diese ist optimal, wenn die Starts <strong>und</strong> Landungen von den<br />
Fluggesellschaften durchgeführt werden, die hierfür die höchste Zahlungsbereitschaft<br />
besitzen.<br />
• Investitionsanreize: Diese werden an einem regulierten Flughafen stark durch die<br />
Auswahl des <strong>Re</strong>gulierungssystems beeinflusst. 36<br />
• Überrenditen: Diese werden durch eine <strong>Re</strong>gulierung begrenzt.<br />
• Implementierung: Hier<strong>unter</strong> werden die Wi<strong>der</strong>stände gegen die jeweiligen Lösungen<br />
<strong>und</strong> die Schwierigkeiten bei <strong>der</strong>en politischer Durchsetzung zusammengefasst.<br />
Sofern die Marktmacht eines Flughafens durch eine <strong>Re</strong>gulierung begrenzt werden soll, ist<br />
nach dieser Bewertung die Kombination <strong>der</strong> <strong>Re</strong>gulierung mit einem Slothandelsystem eine<br />
<strong>der</strong> vorteilhaftesten Lösungen.<br />
5.2 Wirtschaftspolitische Handlungsempfehlungen<br />
Die kurzfristige Implementierung eines Slothandelsystems ist für europaweit zu empfehlen; in<br />
Kombination mit einer <strong>Re</strong>gulierung werden vorhandene Kapazitäten effizient ausgelastet <strong>und</strong><br />
alloziiert sowie die Erzielung von Überrenditen des Flughafens aufgr<strong>und</strong> von Marktmacht<br />
verhin<strong>der</strong>t. 37 Bei <strong>der</strong> Notwendigkeit bzw. Durchführung von Kapazitätserweiterungen an den<br />
Start- <strong>und</strong> Landebahnen ist allerdings zu diskutieren, ob ein Verkauf bzw. eine Versteigerung<br />
<strong>der</strong> neu geschaffenen Slots durch den Flughafen ohne <strong>Re</strong>nditebegrenzung gestattet werden<br />
sollte, damit hohe Investitionsanreize bestehen. 38<br />
Die Problembereiche <strong>der</strong> Begrenzung von Marktmacht bzw. <strong>der</strong> <strong>Re</strong>gulierung <strong>und</strong> <strong>der</strong><br />
Allokation <strong>der</strong> Slots können bei <strong>der</strong> vorgeschlagenen Lösung gr<strong>und</strong>sätzlich getrennt<br />
angegangen werden, d.h. ein neues <strong>Re</strong>gulierungssystem kann implementiert werden, auch<br />
wenn ein Slothandelsystem noch nicht eingeführt ist. 39 Eine zeitliche Differenzierung von<br />
Start- <strong>und</strong> Landegebühren ist (innerhalb eines vom <strong>Re</strong>gulierungssystem vorgegebenen<br />
Rahmens) zu empfehlen, da dann eine Preissetzung <strong>unter</strong> Berücksichtigung <strong>der</strong> Ramsey-<br />
<strong>Re</strong>gel erfolgt <strong>und</strong> in Zeiten geringer Nachfrage sich die Preise den Grenzkosten annähern<br />
können.<br />
35 Die Frage, ob <strong>und</strong> wie eine optimale Auslastung <strong>der</strong> Start- <strong>und</strong> Landebahn (<strong>und</strong> somit die Anzahl <strong>der</strong> Slots)<br />
erzeugt werden kann, wird von Brenck / Czerny (2001) diskutiert.<br />
36 Siehe hierzu Unterabschnitt 6.1.2.<br />
37 Eine ähnliche Empfehlung wird von Feess (2002) ausgesprochen.<br />
38 Dieser Vorschlag orientiert sich an den Ergebnissen von Ewers et al (2001), dem für den Fall von<br />
Kapazitätserweiterungen auch Feess (2002) zustimmt.<br />
39 Solange ein Slothandelsystem noch nicht eingeführt ist, werden die genannten Ineffizienzen bei <strong>der</strong><br />
Allokation <strong>der</strong> Slots zwischen den Airlines zwangsläufig zunächst bestehen bleiben.<br />
41
6 <strong>Re</strong>gulierungssystem<br />
6.1 Theoretische Gr<strong>und</strong>lagen<br />
Ziel <strong>der</strong> <strong>Re</strong>gulierung eines marktmächtigen Unternehmens ist insbeson<strong>der</strong>e die Verhin<strong>der</strong>ung<br />
<strong>der</strong> wohlfahrtsmin<strong>der</strong>nden Preissetzung nach <strong>der</strong> Cournot-<strong>Re</strong>gel, die zur ineffizienten<br />
Nachfrageverdrängung führt. In allen <strong>Re</strong>gulierungssystemen führt <strong>der</strong> Eingriff in die freie<br />
Preissetzung des entsprechenden Unternehmens zu verschiedenen (<strong>und</strong> interdependenten)<br />
Wirkungen auf die weiteren Bereitstellungsentscheidungen zu Investitionen, zur<br />
Qualitätswahl sowie auf die Anreize zu produktiver Effizienz. 40 Deshalb werden im Rahmen<br />
<strong>der</strong> <strong>Re</strong>gulierung häufig auch die Investitions- <strong>und</strong> Qualitätswahlentscheidungen des<br />
Unternehmens <strong>Re</strong>geln <strong>unter</strong>worfen. Bei <strong>der</strong> Beurteilung <strong>der</strong> Vorteilhaftigkeit einer<br />
<strong>Re</strong>gulierung <strong>und</strong> bei <strong>der</strong> Auswahl zwischen verschiedenen <strong>Re</strong>gulierungssystemen ist<br />
gr<strong>und</strong>sätzlich zu überprüfen, ob <strong>der</strong> intendierte Nutzen <strong>der</strong> <strong>Re</strong>gulierung die Kosten aufgr<strong>und</strong><br />
nicht intendierter, aber zwangsläufig auftreten<strong>der</strong> Effekte übersteigt.<br />
Bei <strong>der</strong> Entscheidung über die konkrete Ausgestaltung eines <strong>Re</strong>gulierungssystems für einen<br />
Flughafen werden die folgenden Fragen beantwortet:<br />
• Welche Leistungsbereiche eines Flughafens sollen in eine <strong>Re</strong>gulierung einbezogen<br />
werden?<br />
• Welche Verfahren sind für einen staatlichen Eingriff zur Preis- bzw<br />
Gewinnregulierung geeignet?<br />
• Ist die Alternative einer so genannten korporatistischen <strong>Re</strong>gulierung, d.h. einer<br />
Verhandlungslösung <strong>der</strong> Marktteilnehmer bei gleichzeitiger, wirksamer Androhung<br />
einer externen <strong>Re</strong>gulierung, möglich <strong>und</strong> sinnvoll?<br />
• Wo sollte ggf. eine <strong>Re</strong>gulierungsinstitution angesiedelt werden <strong>und</strong> mit welchen<br />
Kompetenzen sollte diese ausgestattet werden?<br />
Hierzu werden im Folgenden allgemeine Erkenntnisse <strong>der</strong> <strong>Re</strong>gulierungstheorie aufgegriffen<br />
<strong>und</strong> die Bedeutung <strong>der</strong> einzelnen Fragestellungen für die <strong>Re</strong>gulierung von Flughäfen<br />
diskutiert.<br />
6.1.1 <strong>Re</strong>gulierungsbasis: Single-Till vs. Dual-Till<br />
Die beiden Ansätze im Überblick: Single Till vs. Dual-Till<br />
Bei <strong>der</strong> <strong>Re</strong>gulierung von Flughäfen stellt sich (insbeson<strong>der</strong>e bei einer ex-ante <strong>Re</strong>gulierung)<br />
die Frage, welche Leistungsbereiche des Gesamtsystems Flughafen in eine <strong>Re</strong>gulierung mit<br />
einbezogen werden sollen. Dabei sind zwei gr<strong>und</strong>legend verschiedene Ansätze zu<br />
<strong>unter</strong>scheiden. Zum einen können sämtliche Bereiche des Flughafens einschließlich des Non-<br />
Aviation-Bereiches im Rahmen des so genannten „Single-Till“-Ansatzes reguliert werden.<br />
Zum an<strong>der</strong>en kann eine <strong>Re</strong>gulierung – entsprechend <strong>der</strong> Theorie <strong>der</strong> wesentlichen Einrichtung<br />
40 Unter dem Begriff „<strong>Re</strong>gulierungssystem“ werden im Folgenden sämtliche Institutionen <strong>und</strong> <strong>Re</strong>geln einer<br />
<strong>Re</strong>gulierung zusammengefasst.<br />
42
– auf die Bereiche eines Flughafens beschränkt werden, die für die eigentliche<br />
Leistungserstellung des Luftverkehrstransports notwendig sind <strong>und</strong> nicht wirtschaftlich<br />
dupliziert werden können (Niemeier 2002, S. 13). Demnach werden hierbei nur die Entgelte<br />
des Aviation-Bereichs sowie gegebenenfalls <strong>der</strong> Verkehrsinfrastrukturanbindung reguliert.<br />
Die Einnahmen aus den kommerziellen Aktivitäten im Non-Aviation-Bereich werden<br />
hingegen nicht berücksichtigt. Dieser Ansatz einer Trennung des Leistungsspektrums in zwei<br />
Bereiche ist als Dual-Till bekannt. Beide Verfahren weisen in Bezug auf eine<br />
Wohlfahrtsbeurteilung spezifische Vor- <strong>und</strong> Nachteile auf.<br />
Vor- <strong>und</strong> Nachteile beim Single-Till-Ansatz<br />
Der Hauptvorteil ist die relativ unkomplizierte Handhabung, denn <strong>der</strong> Single-Till-Ansatz<br />
erfor<strong>der</strong>t we<strong>der</strong> eine problematische Abgrenzung <strong>der</strong> regulierten Bereiche auf <strong>der</strong><br />
Einnahmenseite noch eine detaillierte Kostenzurechnung wie sie beim Dual-Till-Ansatz<br />
notwendig werden (Forsyth 2001, S. 27). Eine Kostendiversifizierung über mehrere Bereiche<br />
erlaubt zudem bei Flughäfen mit ausreichen<strong>der</strong> Kapazität eine Preissenkung im Aviation-<br />
Bereich auf ein Niveau nahe den Grenzkosten, indem die Deckung <strong>der</strong> gesamten Fixkosten<br />
des Flughafens über entsprechend hohe Erlöse aus den kommerziellen Aktivitäten erfolgt.<br />
Diese Quersubventionierung des Verkehrsbereiches kann im Rahmen des <strong>der</strong>zeitigen<br />
ineffizienten Systems <strong>der</strong> Slotallokation 41 aber dazu führen, dass an kapazitätsbeschränkten<br />
Flughäfen <strong>der</strong> Nachfrageüberhang <strong>und</strong> die damit einhergehenden Ineffizienzen verstärkt<br />
werden. (Starkie / Yarrow 2000, S. 5ff.; Starkie 2001, S. 127f.; Wolf 1997, S. 121ff.). Der<br />
bedeutendste Kritikpunkt am Single-Till-Ansatz ist die Ausweitung <strong>der</strong> <strong>Re</strong>gulierungsbasis auf<br />
wettbewerbsfähige Bereiche. 42 Darüber hinaus bleiben die entsprechend <strong>der</strong> Risikobewertung<br />
<strong>unter</strong>schiedlichen Kapitalkosten bei<strong>der</strong> Bereiche beim Single-Till weitestgehend<br />
unberücksichtigt. Insgesamt weist <strong>der</strong> Single-Till-Ansatz eine höhere Konsistenz mit<br />
kostenbasierten <strong>Re</strong>gulierungsverfahren auf (Forsyth 2001, S. 28).<br />
Vor- <strong>und</strong> Nachteile beim Dual-Till-Ansatz<br />
Für einen Dual-Till-Ansatz spricht zum einen die Beschränkung <strong>der</strong> <strong>Re</strong>gulierung auf nicht<br />
wettbewerbsfähige Bereiche. Weiterhin besitzt <strong>der</strong> Flughafen unabhängig von seiner<br />
Kapazitätsauslastung stärkere Anreize als beim Single-Till-Ansatz, viele Passagiere<br />
anzuziehen, da er bei höheren Passagierzahlen aufgr<strong>und</strong> <strong>der</strong> Komplementarität <strong>der</strong> Nachfrage<br />
zwischen Aviation- <strong>und</strong> Non-Aviation-Bereich im kommerziellen Geschäft Gewinne erzielen<br />
kann, die nicht durch eine <strong>Re</strong>gulierung begrenzt werden. Der Betreiber hat daher beim Dual-<br />
Till-Ansatz ein Interesse, im Aviation-Bereich nicht zu hohe Preise von den Nutzern zu<br />
verlangen. Dieser Effekt tritt beson<strong>der</strong>s dann auf, wenn für die Zukunft erwartet werden kann,<br />
dass <strong>der</strong> Grenzertrag <strong>der</strong> zusätzlichen Nachfrage im Non-Aviation-Bereich steigt (Starkie<br />
2001, S. 128f.).<br />
41 Siehe hierzu Abschnitt 5.<br />
42 Vgl. Abschnitt 4.<br />
43
Gegen eine Anwendung des Dual-Till-Ansatzes spricht die höhere Komplexität <strong>und</strong> damit <strong>der</strong><br />
höhere administrative Aufwand dieser Methode speziell bei <strong>der</strong> Kontrolle <strong>der</strong><br />
Gemeinkostenzurechnung <strong>und</strong> – im Rahmen einer Price-Cap-<strong>Re</strong>gulierung 43 – <strong>der</strong> Definition<br />
<strong>der</strong> Preiskörbe. Forsyth (2001, S. 28) weist auf die größere Konsistenz dieses Konzepts mit<br />
anreizorientierten <strong>Re</strong>gulierungsverfahren hin, da nur Bewertungskriterien für den<br />
Verkehrsbereich Berücksichtigung zu finden brauchen.<br />
<strong>Re</strong>sümee zur <strong>Re</strong>gulierungsbasis<br />
Insgesamt bleibt festzuhalten, dass <strong>der</strong> Dual-Till-Ansatz gegenüber dem Single-Till in Bezug<br />
auf eine Steigerung <strong>der</strong> produktiven <strong>und</strong> allokativen Effizienz überlegen ist. Die Vorteile<br />
eines Dual-Till sind dabei umso größer, je stärker die Komplementaritätsbeziehung zwischen<br />
Verkehrsbereich <strong>und</strong> kommerziellen Aktivitäten ausgeprägt ist <strong>und</strong> je gravieren<strong>der</strong> die<br />
Kapazitätsengpässe am jeweiligen Flughafen sind. Jedoch können bei einer Kosten-Nutzen-<br />
Betrachtung die erhöhten Anfor<strong>der</strong>ungen an ein <strong>Re</strong>gulierungssystem im konkreten Einzelfall<br />
gegen die Anwendung dieser Fokussierung <strong>der</strong> <strong>Re</strong>gulierungsbasis sprechen.<br />
6.1.2 Klassische <strong>Re</strong>gulierungsverfahren<br />
Für eine ex-ante <strong>Re</strong>gulierung von Flughäfen durch eine staatliche <strong>Re</strong>gulierungsbehörde<br />
können – wie auch in an<strong>der</strong>en Sektoren – das Kostenzuschlags- (bzw. Rate-of-<strong>Re</strong>turn) sowie<br />
das anreizorientierte Price-Cap-Verfahren angewandt werden. Bei Flughäfen findet darüber<br />
hinaus vereinzelt eine ex-post <strong>Re</strong>gulierung Anwendung.<br />
6.1.2.1 Ex-ante <strong>Re</strong>gulierung<br />
Kostenzuschlags-<strong>Re</strong>gulierung<br />
Bei einer Kostenzuschlags-<strong>Re</strong>gulierung wird dem Flughafen erlaubt, Preise zu setzen, die den<br />
Durchschnittskosten plus einem (Gewinn-) Zuschlag entsprechen. Neben <strong>der</strong> Preishöhe ist<br />
dabei auch die gewünschte Preisstruktur genehmigungspflichtig. Bei <strong>der</strong> (traditionell in den<br />
USA weiter verbreiteten) Rate-of-<strong>Re</strong>turn-<strong>Re</strong>gulierung dürfen Preise im Unterscheid dazu so<br />
festgelegt werden, dass eine vorgegebene <strong>Re</strong>ndite nicht auf die gesamten Kosten, son<strong>der</strong>n nur<br />
auf das eingesetzte Kapital erzielt werden kann. Da Anreiz- <strong>und</strong> sonstige Wirkungen dieser<br />
beiden Verfahren ansonsten ähnlich sind, wird im Folgenden nur die<br />
Kostenzuschlagsregulierung berücksichtigt.<br />
Bei dem Kostenzuschlagsverfahren sind Risiken tendenziell den Nachfragern zugeordnet.<br />
Dieses führt einerseits zu geringeren Kapitalkosten bei dem regulierten Unternehmen,<br />
an<strong>der</strong>erseits sind jedoch die Anreize zu Kostensenkungen bei dem Unternehmen begrenzt. Bei<br />
einer Kostenzuschlagsregulierung bestehen weiterhin tendenziell – ohne dieses hier im Detail<br />
zu vertiefen – die in Tabelle 4 dargestellten Wirkungen.<br />
43 Siehe hierzu Abschnitt 6.1.2.1.<br />
44
Tabelle 4: Wirkungsvergleich Price-Cap-<strong>Re</strong>gulierung <strong>und</strong> Kostenzuschlagsregulierung<br />
(Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an Fritsch / Wein / Ewers 2003, S. 222ff.)<br />
Price-Cap-<strong>Re</strong>gulierung<br />
Kostenzuschlags-regulierung<br />
Produktive Effizienz<br />
(+) hohe Anreize, Kosten<br />
einzusparen<br />
(-) Anreize, Kosten zu erhöhen<br />
(-) höhere Kapitalkosten (+) niedrigere Kapitalkosten<br />
Schaffung von<br />
Investitionsanreizen<br />
Allokative Effizienz:<br />
Verbesserung <strong>der</strong><br />
Preisstruktur<br />
Anreize<br />
zur Qualitätssicherung<br />
(-) Wenig Anreize zu<br />
Kapazitätserweiterungen<br />
(+) Anreize zur Implementierung<br />
einer effizienten<br />
Preisstruktur kann in<br />
<strong>Re</strong>gulierung integriert<br />
werden<br />
(-) Anreize zur Kostensenkung<br />
durch Qualitätsreduzierung<br />
(o) Gefahr des Averch-Johnson-<br />
Effektes (bei Rate-of-<br />
<strong>Re</strong>turn-<strong>Re</strong>gulierung)<br />
(-) wenig Anreize zur<br />
Implementierung einer<br />
effizienten Preisstruktur<br />
(o) Gefahr des Gold-Plating<br />
Price-Cap-<strong>Re</strong>gulierung<br />
Bei <strong>der</strong> stärker anreizorientierten Price-Cap-<strong>Re</strong>gulierung wird dem Unternehmen eine zeitlich<br />
befristete Obergrenze für sein Preisniveau vorgegeben, die schrittweise angepasst wird. Die<br />
bei einer Price-Cap-<strong>Re</strong>gulierung tendenziell bestehenden Wirkungen sind in Tabelle 4<br />
dargestellt.<br />
Nach einem häufig verwendeten Ansatz, <strong>der</strong> so genannten „RPI-X“-<strong>Re</strong>gel, darf sich das<br />
Preisniveau des Unternehmens jährlich um die Differenz aus Inflationsrate (RPI) <strong>und</strong> einem<br />
Faktor (X), <strong>der</strong> sich an <strong>der</strong> erwarteten Produktivitätssteigerung orientieren soll, än<strong>der</strong>n. Die<br />
Bestandteile <strong>der</strong> <strong>Re</strong>gel, insbeson<strong>der</strong>e <strong>der</strong> X-Faktor, werden in Zeitabständen – üblicherweise<br />
alle 4-6 Jahre – modifiziert. Die zentrale Idee ist, die Preisentwicklung von <strong>der</strong> tatsächlichen<br />
Kostenentwicklung abzukoppeln; so kann das regulierte Unternehmen Kostensenkungen als<br />
Gewinnerhöhung einbehalten, anstatt sie über Preissenkungen an die Nachfrager weitergeben<br />
zu müssen, was starke Anreize zu produktiver Effizienz etabliert. Dieses ist jedoch mit dem<br />
Nachteil verb<strong>und</strong>en, dass die Kapitalkosten des Unternehmens tendenziell höher sind, da<br />
Risiken gr<strong>und</strong>sätzlich dem Unternehmen zugeordnet sind.<br />
Das Price-Cap-Verfahren wirkt nicht nur auf das Preisniveau <strong>und</strong> <strong>der</strong>en Anpassung im<br />
Zeitverlauf, son<strong>der</strong>n erlaubt auch Variationen <strong>der</strong> Preisstruktur, um diese (<strong>und</strong> damit die<br />
allokative Effizienz) zu verbessern. Hierfür werden <strong>Re</strong>geln vorgegeben, die für das regulierte<br />
Unternehmen Anreize schaffen, eine möglichst effiziente Preisstruktur zu etablieren. Bei<br />
kapazitätsbeschränkten Flughäfen können z.B. Anreize gesetzt werden, die Landegebühren<br />
während <strong>der</strong> Spitzenzeiten zu erhöhen. Ist ein Slothandelssystem eingeführt, ist diese<br />
Spitzenlastbepreisung bei Start- <strong>und</strong> Landegebühren nicht notwendig, um eine effiziente<br />
45
Allokation <strong>der</strong> Slots zwischen den Airlines zu erreichen (Wolf 1997, S. 122). 44 Allerdings<br />
können so ggf. die Gebühren während <strong>der</strong> Schwachlastzeiten gesenkt <strong>und</strong> an die Grenzkosten<br />
angenähert werden, was einer Preisdifferenzierung nach <strong>der</strong> Ramsey-<strong>Re</strong>gel entspricht.<br />
Nachteile des Verfahrens können bei <strong>der</strong> Qualitätswahl <strong>und</strong> Investitionsentscheidungen durch<br />
das regulierte Unternehmen auftreten. Es ist tendenziell bestrebt, durch eine <strong>Re</strong>duzierung <strong>der</strong><br />
angebotenen Qualität o<strong>der</strong> durch Zurückhaltung von Erweiterungsinvestitionen seine Kosten<br />
zu senken. Es existieren verschiedene Möglichkeiten dieses Problem zu verringern. Zur<br />
Qualitätssicherung können beispielsweise „Quality <strong>Re</strong>view Boards“ <strong>der</strong> Nutzer, Bonus-<br />
Malus-Systeme <strong>und</strong> an<strong>der</strong>e Qualitätsvereinbarungen neben einer Preisobergrenzenregulierung<br />
implementiert o<strong>der</strong> in eine solche integriert werden (Wolf 1997, S. 108; Niemeier 2002, S. 14;<br />
Productivity Commission 2002, S. 265ff. insbeson<strong>der</strong>e S.271). Um dem Problem <strong>der</strong><br />
unzureichenden Investitionen in Kapazitätserweiterungen adäquat zu begegnen, können<br />
Investitionsvereinbarungen für die Zukunft getroffen werden, die es dem Unternehmen<br />
gestatten, seine erhöhten Kosten auf die Nutzer umzulegen, ohne dadurch das vorgegebene<br />
Preislevel zu durchbrechen (Wolf 1997, S. 153ff.; Niemeier 2002, S.15f.). Eine weitere<br />
Möglichkeit ist für kapazitätsbeschränkte Flughäfen denkbar. Bei Erweiterungsinvestitionen<br />
in die Start- <strong>und</strong> Landebahnen könnten Eigentumsrechte an neu geschaffenen Slots dem<br />
Flughafen übertragen werden (vgl. Abschnitt 5).<br />
Ein Price-Cap bietet sich v.a. für Flughafen<strong>unter</strong>nehmen an, bei denen angenommen wird,<br />
dass sie noch über erhebliche, unausgeschöpfte <strong>Re</strong>serven zur Produktivitätssteigerung<br />
verfügen <strong>und</strong> spezifische Investitionen eher von geringer Bedeutung sind (Wolf 1997, S. 77).<br />
Spezielle Fragen <strong>der</strong> Ausgestaltung einer Price-Cap-<strong>Re</strong>gulierung<br />
Allgemein sind bei einer Price-Cap-<strong>Re</strong>gulierung zwei Möglichkeiten gegeben, das zu<br />
kappende Preisniveau konkret zu definieren. Einerseits existiert <strong>der</strong> so genannte <strong>Re</strong>venue-<br />
Yield-Ansatz, <strong>der</strong> den Umsatz des regulierten Unternehmensbereichs ins Verhältnis zur<br />
produzierten Menge stellt. Die Definition einer geeigneten Zielgröße ist bei einer Vielzahl<br />
bereitgestellter Leistungen problematisch. Bei <strong>der</strong> <strong>Re</strong>gulierung eines Flughafens wird i.d.R.<br />
ein <strong>Re</strong>ferenzquotient aus Umsatz <strong>und</strong> abgefertigter Passagierzahl gebildet. Leistungen, wie<br />
z.B. reine Frachtflüge bleiben dabei unberücksichtigt (CAA 2001c, S. 4f.). Alternativ kann<br />
<strong>der</strong> Tariff-Basket-Ansatz angewendet werden, bei dem <strong>der</strong> Preis eines gewichteten<br />
Leistungskorbs als Basis für das Price-Cap dient. Die Gewichtung <strong>der</strong> einzelnen Preise, die<br />
<strong>der</strong> Flughafen für seine verschiedenen Leistungen setzt, geht dabei i.d.R. auf die<br />
Umsatzverteilung <strong>der</strong> Leistungen in <strong>der</strong> Vorperiode zurück (CAA 2001c, S.3). Dieser Ansatz<br />
wurde im Flughafensektor bisher jedoch noch nicht angewandt.<br />
Aus theoretischer Sicht ist <strong>der</strong> Tariff-Basket-Ansatz zu bevorzugen, da dieser im Gegensatz<br />
zum <strong>Re</strong>venue-Yield-Ansatz keine Motivation zu exzessiver Preisdifferenzierung bietet<br />
(Bradley & Price, 1988, S. 99ff.; CAA, 2001c, S.3ff. ; Laffont & Tirole, 2000, S.154). Der<br />
Tariff-Basket-Ansatz bietet Anreize für eine effiziente Preisstruktur entsprechend <strong>der</strong><br />
44 Siehe hierzu unsere Empfehlung zur Einführung eines Slothandels in Kapital 5.<br />
46
Zahlungsbereitschaften <strong>der</strong> Nutzer <strong>und</strong> eröffnet die Möglichkeit, ohne die Preisobergrenze zu<br />
durchbrechen, eine adäquate Spitzenlastbepreisung umzusetzen 45<br />
Ein weiterer wichtiger Aspekt einer Price-Cap–<strong>Re</strong>gulierung ist <strong>der</strong> Umgang mit externen<br />
Risiken. Es ist von Vorteil, wenn diese Risiken, die außerhalb des Einflussbereichs <strong>der</strong><br />
Unternehmen liegen, zwischen Flughafen <strong>und</strong> Fluggesellschaften aufgeteilt werden <strong>und</strong><br />
dieses ex-ante explizit vereinbart wird. 46 Solche Risiken sind z.B. unerwartet auftretende,<br />
dramatische Nachfrageschwankungen o<strong>der</strong> eine verän<strong>der</strong>te Sicherheitslage, die erhöhte<br />
Aufwendungen nötig machen. Dies kann z.B. durch einen Sliding-Scale-Mechanismus<br />
umgesetzt werden. Dabei wird <strong>der</strong> X-Faktor in Abhängigkeit von zu definierenden externen<br />
Faktoren variiert (Wolf 1997, S. 77).<br />
Konvergenz von Kostenzuschlags- <strong>und</strong> Price-Cap-<strong>Re</strong>gulierung<br />
Die Unterschiede zwischen den Wirkungen <strong>der</strong> Price-Cap- <strong>und</strong> <strong>der</strong><br />
Kostenzuschlagsregulierungen nehmen stark ab, wenn beim Kostenzuschlagsverfahren die<br />
(<strong>Re</strong>gulierungs-) Periode, für die die Preise festgelegt werden, ausgedehnt wird. Dann kann<br />
das Unternehmen – aufgr<strong>und</strong> des so genannten „<strong>Re</strong>gulierungs-Lags“ – ebenfalls von<br />
Kostensenkungen profitieren <strong>und</strong> besitzt Anreize zu produktiver Effizienz; allerdings treten<br />
dann auch zunehmend die bei <strong>der</strong> Price-Cap-<strong>Re</strong>gulierung genannten Nachteile auf.<br />
6.1.2.2 Ex-Post-<strong>Re</strong>gulierung: Missbrauchsaufsicht <strong>und</strong> Monitoring<br />
Im Unterschied zu den ex-ante <strong>Re</strong>gulierungsverfahren gibt die ex-post-<strong>Re</strong>gulierung einem<br />
marktmächtigen Unternehmen für die Zukunft keine expliziten Parameter zur Preissetzung<br />
vor, son<strong>der</strong>n greift ggf. nachträglich bei einem Abweichen von vorgegebenen <strong>Re</strong>geln bzw.<br />
einem begründetem Verdacht auf einen Missbrauch von Marktmacht ein. Unter dem Begriff<br />
<strong>der</strong> ex-post <strong>Re</strong>gulierung werden <strong>unter</strong>schiedliche regulative Konzepte zusammengefasst,<br />
<strong>der</strong>en Wirkung auf das Verhalten eines marktbeherrschenden Flughafen<strong>unter</strong>nehmens von <strong>der</strong><br />
Ausgestaltung ihrer Vorgaben, Kontroll- <strong>und</strong> Sanktionsinstrumente abhängt, so dass auch hier<br />
eine pauschale Beurteilung dieser <strong>Re</strong>gulierungsform nicht möglich ist. Im Folgenden wird<br />
zunächst das System des Monitoring vorgestellt, das <strong>der</strong>zeit bei Flughäfen in Australien <strong>und</strong><br />
Neuseeland zur Anwendung kommt, <strong>und</strong> anschließend wird die wettbewerbsrechtliche<br />
Missbrauchsaufsicht nach aktuellem, <strong>deutschen</strong> Muster dargestellt, die als eine beson<strong>der</strong>e<br />
Form <strong>der</strong> ex-post-<strong>Re</strong>gulierung angesehen werden kann.<br />
Monitoring<br />
Im Rahmen des so genannten „Monitoring“ wird in Australien <strong>und</strong> Neuseeland eine<br />
weitreichende, durch eine externe Institution ex-post durchgeführte Verhaltensüberwachung<br />
45 Da die im Rahmen einer Price-Cap-<strong>Re</strong>gulierung mögliche Tarifspreizung nicht ausreicht, um einen<br />
Nachfrageüberhang zu beseitigen, ist die Einführung eines Verfahrens zur effizienten Slotallokation<br />
unverzichtbar.<br />
46 Unter Berücksichtigung <strong>der</strong> Determinanten zur gesamtwirtschaftlich sinnvollen Risikoallokation kann so eine<br />
vorteilhaftere Lösung erzielt werden; vgl. Beckers / Miksch (2002, S. 10-14) <strong>und</strong> Beckers / Hirschhausen (2003,<br />
S. 31).<br />
47
<strong>der</strong> regulierten Flughäfen durchgeführt (Forsyth 2003b, S. 13ff.; Productivity Commission<br />
2002, S. 261ff.). Neben dem Preis werden hierbei auch an<strong>der</strong>e Parameter, insbeson<strong>der</strong>e die<br />
Qualität, in eine Angebotsüberwachung mit einbezogen. Die <strong>Re</strong>gulierungsbehörde nutzt bei<br />
diesem Verfahren Kosten-, Preis- <strong>und</strong> Leistungsdaten aus <strong>der</strong> Vergangenheit, um ein<br />
missbräuchliches Verhalten zu identifizieren <strong>und</strong> durch Sanktionen die Erzielung von<br />
Überrenditen für die Zukunft zu <strong>unter</strong>binden; die Unternehmen haben hierfür regelmäßig<br />
Kosten- <strong>und</strong> Leistungsnachweise ihrer Aktivitäten vorzulegen, die in einem System von<br />
unangemeldeten Audits von <strong>der</strong> Aufsichtsbehörde überprüft werden können. Form <strong>und</strong><br />
Umfang dieser Angaben <strong>unter</strong>liegen zuvor festgelegten Standards, um eine Vergleichbarkeit<br />
<strong>unter</strong> den Unternehmen sicherzustellen; anhand dieser Informationen kann dann ein<br />
branchenweiter Benchmarking-Vergleich generiert werden. Darüber hinaus kann ein<br />
Beschwerde- <strong>und</strong> Vorschlagssystem für die Nutzer dazu beitragen, missbräuchliches<br />
Verhalten schnellstmöglich aufzudecken <strong>und</strong> eine präventive Rückwirkung auf die<br />
Unternehmen zu ermöglichen. Dieses Vorgehen reduziert insgesamt die Gefahr, dass die<br />
regulierten Unternehmen wirksam Informationen zurückhalten (Productivity Commission<br />
2002, S. 323ff.).<br />
Der große Vorteil des Monitoring ist es, in höchstem Maße flexibel auf sich än<strong>der</strong>nde<br />
Rahmenbedingungen reagieren zu können, da die Bewertung von potenziell<br />
missbräuchlichem Verhalten im Nachhinein die Möglichkeit bietet, die jeweils aktuelle<br />
Sachlage mit in die Entscheidung einbeziehen zu können (Forsyth 2003b, S. 16).<br />
Je nach Art <strong>der</strong> Anwendung dieser Analysen ist mit zunehmen<strong>der</strong> Kostenorientierung bei <strong>der</strong><br />
Preisüberwachung eine Annäherung an eine implizite Kostenzuschlagsregulierung möglich,<br />
mit den gleichen möglichen Anreizverzerrungen im Hinblick auf die produktive Effizienz.<br />
Ex-post <strong>Re</strong>gulierung nach dem Konzept <strong>der</strong> Missbrauchsaufsicht in Deutschland<br />
Im Rahmen <strong>der</strong> vom Kartellamt in Deutschland durchgeführten „Missbrauchsaufsicht“ wird<br />
versucht, wettbewerbsschädigendes Verhalten von marktbeherrschenden Unternehmen<br />
aufzudecken <strong>und</strong> zu <strong>unter</strong>binden. Bei <strong>der</strong> gegenwärtigen Praxis des Kartellamtes steht v.a. die<br />
Verfolgung von wettbewerbsbeeinträchtigenden Behin<strong>der</strong>ungstatbeständen im Vor<strong>der</strong>gr<strong>und</strong>.<br />
Diese Zielstellung impliziert von vornherein die Annahme, dass in dem entsprechenden Markt<br />
Konkurrenz zwischen den Anbietern herrscht o<strong>der</strong> zumindest Wettbewerbspotenziale<br />
existieren, die es zu schützen gilt. Liegt jedoch eine monopolistische Marktstruktur (wie z.B.<br />
im Falle des nicht durch Substitutionskonkurrenz bedrohten <strong>und</strong> vor potenzieller Konkurrenz<br />
geschützten natürlichen Monopols) vor, so ist gr<strong>und</strong>sätzlich zweifelhaft, dass eine erst bei<br />
begründetem Verdacht eingreifende <strong>Re</strong>gulierung zweckmäßig ist, um das Ausnutzen von<br />
Marktmacht zu verhin<strong>der</strong>n bzw. einzuschränken. Bei <strong>der</strong> gegenwärtigen <strong>Re</strong>gulierungspraxis<br />
des Kartellamtes im Rahmen <strong>der</strong> Missbrauchsaufsicht steht zwar v.a. die Verfolgung von<br />
wettbewerbsbeeinträchtigenden Behin<strong>der</strong>ungstatbeständen im Vor<strong>der</strong>gr<strong>und</strong>. Allerdings gehört<br />
dazu beispielsweise auch die Unterbindung überhöhter Zugangsentgelte zu essentiellen<br />
Einrichtungen in Netzsektoren, so dass sich aus den bisherigen Erfahrungen beim Aufspüren<br />
eines missbräuchlichen Verhaltens auch Schlussfolgerungen für eine mögliche Anwendung<br />
als ex-post <strong>Re</strong>gulierung im Flughafenmarkt ziehen lassen.<br />
48
Die für die Missbrauchsaufsicht notwendigen Verhaltenskontrollen basieren auf ex-post<br />
durchgeführten Kosten-, Preis- <strong>und</strong> Leistungsanalysen. Eine gegenwärtig oft angewandte<br />
Methode zur Überprüfung eines Marktmachtmissbrauchs ist das Vergleichsmarktkonzept.<br />
Dieses Verfahren stößt allerdings an Grenzen, wenn auch auf den Vergleichsmärkten keine<br />
Wettbewerbspreise, son<strong>der</strong>n nur regulierte Preise existieren. Es ist daher höchstens als<br />
Ausgangspunkt für die Feststellung missbräuchlich überhöhter Netznutzungsentgelte<br />
geeignet. Zur Verbesserung <strong>der</strong> Vergleichbarkeit könnte es durch ein begleitendes,<br />
kostenorientiertes Benchmarking-Modell ergänzt werden, um so zumindest die relative<br />
(Kosten-) Effizienz <strong>der</strong> Netzbetreiber ermitteln zu können (Monopolkommission 2000/2001,<br />
S. 24). 47<br />
Insgesamt weist die Missbrauchsaufsicht des <strong>deutschen</strong> Kartellamtes gegenüber dem<br />
Monitoring einen schwerwiegenden Nachteil auf. Notwendige Kostenstudien sind ex-post<br />
wesentlich schwieriger durchzuführen, da die Kartell- bzw. <strong>Re</strong>gulierungsbehörden<br />
hinsichtlich ihrer Entscheidungen darlegungs- <strong>und</strong> beweispflichtig sind. Im Gegensatz dazu<br />
muss <strong>der</strong> Betreiber im Rahmen des Monitoring dem <strong>Re</strong>gulierer selbst Kostennachweise<br />
vorlegen. Somit ist <strong>der</strong> <strong>Re</strong>gulierungsaufwand beim Monitoring geringer als bei <strong>der</strong><br />
Missbrauchsaufsicht, da eine aufwändige eigene Informationsrecherche durch die Behörde<br />
entfallen kann. Vorteile <strong>der</strong> Missbrauchsaufsicht gegenüber dem Monitoring sind nicht<br />
erkennbar.<br />
6.1.3 Korporatistische <strong>Re</strong>gulierung<br />
Charakteristika <strong>und</strong> Funktionsweise einer korporatistischen <strong>Re</strong>gulierung<br />
Eine weitere Möglichkeit zur Ausgestaltung eines <strong>Re</strong>gulierungssystems stellt <strong>der</strong><br />
korporatistische Ansatz dar. Eine solche korporatistische <strong>Re</strong>gulierung (bzw.<br />
korporaratistisches <strong>Re</strong>gulierungssystem) ist folgen<strong>der</strong>maßen gekennzeichnet.<br />
• Der Staat gibt einen Rahmen vor, innerhalb dessen die Marktteilnehmer selbst eine<br />
korporatistische Lösung aushandeln. Diese wird weiterhin auch als marktinterne<br />
Verhandlungslösung o<strong>der</strong> korporatistisches Arrangement bezeichnet. Der vorgegebene<br />
Rahmen kann dabei Vorgaben für die Organisation <strong>und</strong> das Verfahren <strong>der</strong><br />
<strong>Re</strong>gelbildung festlegen, den Lösungsraum einschränken <strong>und</strong> Anreizkorrekturen zur<br />
Überwindung von Informationsasymmetrien schaffen (Engel 2002, S. 57).<br />
• Damit die Marktteilnehmer eine interne Verhandlungslösung auch wirklich anstreben,<br />
ist ein wirksames Drohpotenzial aufzubauen (Engel, S. 59). Sinnvollerweise geschieht<br />
dies durch Androhung einer alternativen Lösung in Form einer subsidiären, einseitigen<br />
staatlichen Entscheidung, im Folgenden auch <strong>Re</strong>gulierungsandrohung genannt.<br />
47 Wolf (1997, S. 210ff.) zweifelt die Vergleichbarkeit <strong>der</strong> Effizienz einzelner Flughäfen angesichts recht<br />
<strong>unter</strong>schiedlicher Ausgangsbedingungen an den einzelnen Standorten an. Es besteht jedoch die Möglichkeit,<br />
mo<strong>der</strong>ne Schätzverfahren, z.B. DEA o<strong>der</strong> „stochastic production frontier“, einzusetzen. Siehe hierzu Pels (2000,<br />
29ff.).<br />
49
• Dafür muss ein geeigneter Rahmen geschaffen werden, <strong>der</strong> eine Durchsetzung<br />
glaubhaft macht. Die Wahrscheinlichkeit <strong>der</strong> Notwendigkeit, diese <strong>Re</strong>geln<br />
durchsetzen bzw. die Androhung selbst umsetzen zu müssen, kann so wirksam<br />
reduziert werden. Die korporatistische <strong>Re</strong>gulierung setzt also auf die Vorwirkung <strong>der</strong><br />
Androhung <strong>und</strong> mo<strong>der</strong>ierte Verhandlungen (Engel, S. 65).<br />
In Anwendung auf den Flughafensektor ergibt sich folgendes Modell.<br />
• Die Marktteilnehmer, die eine korporatistische Lösung aushandeln, sind ein einzelner<br />
Flughafen sowie dessen direkten Nutzer, also v.a. die dort ansässigen<br />
Fluggesellschaften. Dementsprechend können diese Verhandlungen prinzipiell für alle<br />
Flughäfen getrennt, aber auch für mehrere gebündelt, stattfinden.<br />
• Das staatliche Drohpotenzial wird durch die Androhung <strong>der</strong> Umsetzung eines <strong>der</strong><br />
vorher vorgestellten externen <strong>Re</strong>gulierungsverfahren für den (die) behandelten<br />
Flughafen (Flughäfen) etabliert.<br />
• Die Rolle des Staates, einen Verhandlungsrahmen vorzugeben <strong>und</strong> ein Drohpotenzial<br />
aufzubauen, wird durch eine staatliche <strong>Re</strong>gulierungsinstanz wahrgenommen. Dazu<br />
entwickelt sie vor den Verhandlungen <strong>der</strong> Marktteilnehmer ein geeignetes<br />
<strong>Re</strong>gulierungssystem, das als Ausgangsbasis für die Verhandlungen betrachtet werden<br />
kann. Zu den weiteren Aufgaben gehört, eine vorhandene Tendenz zur Einigung ggf.<br />
durch Mo<strong>der</strong>ation zu verstärken. Im Falle von Vertragsverletzungen <strong>und</strong> Disputen<br />
zwischen den Parteien während <strong>der</strong> Laufzeit einer Vereinbarung kann diese<br />
<strong>Re</strong>gulierungsinstitution schlichtend eingreifen o<strong>der</strong> die <strong>Re</strong>gulierungsandrohung wahr<br />
machen.<br />
Die Verhandlungslösung <strong>der</strong> Marktteilnehmer wie auch <strong>der</strong> angedrohte, staatliche<br />
<strong>Re</strong>gulierungseingriff kann auf die zuvor geschil<strong>der</strong>ten Konzepte einer ex-ante o<strong>der</strong> ex-post<br />
<strong>Re</strong>gulierung zurückgreifen. I.d.R. werden ex-ante Vereinbarungen über die Preishöhe, -<br />
struktur <strong>und</strong> -niveauentwicklung sowie Qualität <strong>und</strong> Investitionen getroffen. Die<br />
<strong>Re</strong>gulierungsandrohung kann bzw. wird Gedanken <strong>der</strong> anreizorientierten <strong>Re</strong>gulierung (also<br />
<strong>der</strong> Price-Cap-<strong>Re</strong>gulierung) o<strong>der</strong> <strong>der</strong> kostenbasierten <strong>Re</strong>gulierung aufgreifen. Prinzipiell folgt<br />
die Diskussion dann den gleichen Aspekten zum Für <strong>und</strong> Wi<strong>der</strong> <strong>der</strong> einzelnen Verfahren <strong>und</strong><br />
zum Umfang einer <strong>Re</strong>gulierung. 48 Daher beschränkt sich die Argumentation an dieser Stelle<br />
auf die Beson<strong>der</strong>heiten <strong>der</strong> korporatistischen <strong>Re</strong>gulierung.<br />
Erste Ansätze einer praktischen Anwendung korporatistischer Lösungen im Flughafensektor<br />
existieren bereits. Die <strong>Re</strong>gulierung von Flughäfen in Australien wie auch die<br />
Preisvereinbarungen <strong>der</strong> Marktteilnehmer in Hamburg <strong>und</strong> Frankfurt seit 2000 bzw. 2002<br />
berücksichtigen Elemente des vorgestellten Konzepts.<br />
48 Siehe Abschnitt 6.1.1 <strong>und</strong> Abschnitt 6.1.2.<br />
50
Vorteile einer korporatistischen <strong>Re</strong>gulierung<br />
In Anlehnung an Engel (S. 60ff.) ergeben sich drei wesentliche Vorteile, wenn marktinterne<br />
Verhandlungslösungen reinen externen <strong>Re</strong>gulierungseingriffen bevorzugt werden:<br />
• Große Sachnähe <strong>der</strong> Marktteilnehmer: Flughafen <strong>und</strong> Fluggesellschaften verfügen<br />
gegenüber einer staatlichen <strong>Re</strong>gulierungsinstanz über einen bedeutenden<br />
Informationsvorsprung.<br />
• Angemessener <strong>Re</strong>gelumfang: Diese Chance besteht insbeson<strong>der</strong>e bei typisierten<br />
Leistungen zwischen Infrastrukturanbieter <strong>und</strong> Nutzer, wie sie gerade bei Flughäfen<br />
allgemein vorliegen. Die Beteiligten an den Verhandlungen können oft besser als ein<br />
staatlicher <strong>Re</strong>gulierer beurteilen, welche Details in eine Vertragsvereinbarung<br />
aufgenommen werden müssen <strong>und</strong> welche zur Verringerung <strong>der</strong> Transaktionskosten<br />
zunächst ausgespart bleiben können.<br />
• Offen für Verän<strong>der</strong>ungen: Der Informationsvorsprung <strong>der</strong> Marktteilnehmer kann für<br />
eine flexible <strong>und</strong> dynamische Anpassung <strong>und</strong> Verbesserung des <strong>Re</strong>gulierungsrahmens<br />
genutzt werden.<br />
Ggf. sinken auch die bürokratischen Anfor<strong>der</strong>ungen an die <strong>Re</strong>gulierungsinstitution.<br />
Allerdings ist zu vermuten, dass die Größe <strong>der</strong> Behörde auch die Glaubwürdigkeit einer<br />
<strong>Re</strong>gulierungsandrohung beeinflussen wird, so dass – wenn eine glaubhafte<br />
<strong>Re</strong>gulierungsdrohung bestehen soll – das Einsparpotenzial nicht überbewertet werden sollte.<br />
Voraussetzungen zum Abschluss einer Vereinbarung<br />
Die Implementierung <strong>der</strong> korporatistischen <strong>Re</strong>gulierung bietet sich v.a. dann an, wenn<br />
Marktmacht nur beschränkt existiert – es also nicht nur um reine Aufteilung bestehen<strong>der</strong><br />
<strong>Re</strong>nten geht, son<strong>der</strong>n auch positive Wohlfahrtseffekte generiert werden – <strong>und</strong> eine Tendenz<br />
zur Einigung zwischen den Beteiligten besteht bzw. vermutet werden kann. Für die<br />
Bereitschaft <strong>der</strong> Marktteilnehmer, miteinan<strong>der</strong> entsprechende Vereinbarungen abzuschließen,<br />
lassen sich folgende, allgemein gültige Gründe anführen:<br />
• Die Verhandlungspartner erhalten die Möglichkeit, ein – je nach Ausführlichkeit <strong>der</strong><br />
durch die externe Institution vorgegebenen <strong>Re</strong>gulierungsandrohung – ihnen nur<br />
unvollständig bekanntes <strong>Re</strong>gulierungsverfahren gegen ein bekanntes – da selber<br />
ausgehandeltes – System zu tauschen.<br />
• Wenn das bestehende <strong>Re</strong>gulierungssystem für die Beteiligten nachteilig ist, können<br />
beide Vorteile aus einer Verhandlungslösung ziehen. Es ist davon auszugehen, dass<br />
sich diese Vorteile nicht so sehr auf einer Umverteilung von <strong>Re</strong>nten <strong>der</strong><br />
nachgelagerten Nutzer, d.h. <strong>der</strong> Passagiere, basieren, son<strong>der</strong>n überwiegend aus <strong>Re</strong>nten<br />
bestehen, die eine effizientere Angebotsregelung schafft. Gr<strong>und</strong> zur dieser Annahme<br />
ist, dass solche Vereinbarungen immer für einen bestimmten Flughafen gelten <strong>und</strong> die<br />
Kombination aus Flughafen <strong>und</strong> beteiligten Fluggesellschaften – insbeson<strong>der</strong>e an<br />
Drehkreuzflughäfen – teilweise einer Substitutionskonkurrenz ausgesetzt sind.<br />
51
Weiterhin können speziell zwischen Fluggesellschaften <strong>und</strong> Flughäfen gewisse<br />
Interessenkongruenzen bzw. Anreize zu langfristigen Kooperationen bestehen, die wie folgt<br />
begründet sind<br />
• An Hub-Flughäfen tätigen Flughafen <strong>und</strong> Fluggesellschaft gleichermaßen spezifische<br />
Investitionen; gemäß <strong>der</strong> Transaktionskostentheorie kann eine langfristige<br />
Zusammenarbeit dann eine vorteilhafte Lösung sein. Die Fluggesellschaften haben<br />
langfristig gesehen ein Interesse daran, dass <strong>der</strong> Flughafen bestimmte Investitionen<br />
(re-) finanzieren kann <strong>und</strong> werden entsprechenden Preiserhöhungen zustimmen.<br />
• Bei Aufnahme des Dual-Till-Ansatzes in eine <strong>Re</strong>gulierungsandrohung besitzt <strong>der</strong><br />
Flughafen tendenziell auch Anreize, niedrige Preise im Aviation-Bereich zu setzen,<br />
wodurch Interessenskonflikte verringert werden.<br />
Begrenzte Übertragbarkeit <strong>der</strong> Erfahrungen aus dem <strong>deutschen</strong> Energiesektor<br />
Eine Umsetzung einer korporatistischen Lösung existiert auch im <strong>deutschen</strong> Energiesektor, in<br />
dem seit 1998 verschiedene, so genannte „Verbändevereinbarungen“ eine externe<br />
<strong>Re</strong>gulierung des Netzzugangs ersetzen. Die Monopolkommission übt umfangreiche Kritik an<br />
einer korporatistischen Lösung im <strong>deutschen</strong> Energiesektor in Form <strong>der</strong><br />
Verbändevereinbarungen (Monopolkommission 2000/2001, S. 48). 49 Die<br />
Monopolkommission beobachtete, dass die an den Verhandlungen beteiligten Verbände einen<br />
Anreiz haben, sich zu Lasten Dritter, d.h. nicht verbandszugehöriger Unternehmen, speziell<br />
aus dem Ausland, <strong>und</strong> <strong>der</strong> (Klein-)K<strong>und</strong>en zu einigen. Außerdem wurde trotz staatlicher<br />
Mo<strong>der</strong>ation ein Trend zur Unvollständigkeit solcher Vereinbarungen registriert. Weiterer<br />
schwerwiegen<strong>der</strong> Kritikpunkt sind die sehr hohen Transaktionskosten in <strong>der</strong> Umsetzung, die<br />
aus <strong>der</strong> großen Zahl von Beteiligten an solchen Verhandlungen resultieren <strong>und</strong> <strong>der</strong> Tatsache,<br />
dass auf einer Verhandlungsseite oft verschiedene Teilnehmer mit <strong>unter</strong>schiedlichen<br />
Interessen vertreten sind.<br />
Der Flughafenmarkt weist im Vergleich zum Energiesektor jedoch bedeutende Unterschiede<br />
auf, die eine Übertragung <strong>der</strong> berechtigten Kritik <strong>der</strong> Monopolkommission an den<br />
Verbändevereinbarungen im Energiesektor auf korporatistische Lösungen im Flughafensektor<br />
nur in Einzelfällen zulässt.<br />
• Im Energiemarkt versorgen wenige große Stromerzeuger <strong>und</strong> H<strong>und</strong>erte von kleinen<br />
Stadtwerken, die bei den Verhandlungen durch insgesamt vier Industrieverbände<br />
repräsentiert werden, Millionen von Endk<strong>und</strong>en. Diese Vielzahl <strong>der</strong> Marktteilnehmer<br />
ist im Flughafenmarkt indes nicht vorhanden, da die Verhandlungen jeweils auf einen<br />
Standort beschränkt sind <strong>und</strong> so nur eine überschaubare Zahl an Akteuren an den<br />
Gesprächen zu beteiligen ist.<br />
49 Auf Druck <strong>der</strong> Europäischen Union plant inzwischen auch die B<strong>und</strong>esregierung, die Verbändevereinbarungen<br />
durch eine externe <strong>Re</strong>gulierung des Netzzuganges im Energiesektor zu ersetzen (FAZ 2003; Artikel 23 (1) <strong>der</strong><br />
Richtlinie 2003/54/EG des Europäischen Parlamentes <strong>und</strong> Rates vom 26.06.2003 über gemeinsame Vorschriften<br />
für den Elektrizitätsbinnenmarkt)<br />
52
• Für die Durchleitung von Energie sind zum Teil Verträge mit einer Vielzahl von<br />
Netzbetreibern in Deutschland abzuschließen, die teilweise selbst als Anbieter von<br />
Energie auftreten <strong>und</strong> daher ggf. nicht an einem Vertragsabschluss interessiert sind.<br />
Start- <strong>und</strong> Zielflughafen stellen indes im Rahmen einer korporatistischen <strong>Re</strong>gulierung<br />
für die ansässigen Fluggesellschaften die einzigen Vertragspartner dar, so dass<br />
Interessenkonflikte weniger stark ausgeprägt sein dürften 50 . Wie zuvor gezeigt,<br />
existieren zudem teilweise Übereinstimmungen in <strong>der</strong> Interessenlage zwischen<br />
Flughafen <strong>und</strong> Fluggesellschaften.<br />
• Durch die Vorgabe eines <strong>Re</strong>ferenzsystems als Ausgangsbasis für die Verhandlungen<br />
können die Transaktionskosten <strong>der</strong> Umsetzung für die Beteiligten reduziert werden.<br />
• <strong>Re</strong>gelungen zu Lasten Dritter bzw. Kleink<strong>und</strong>en können im Flughafenbereich<br />
vermieden werden, indem das <strong>Re</strong>gulierungssystem so ausgestaltet wird, dass die<br />
Verhandlungsposition von Min<strong>der</strong>heiten gestärkt wird. 51 Dies kann durch die<br />
Festlegung entsprechen<strong>der</strong> <strong>Re</strong>geln – z.B. bestimmte Mindestanfor<strong>der</strong>ungen für einen<br />
wirksamen Abschluss einer marktinternen Vereinbarung – sichergestellt werden.<br />
Weiterhin sollte eine praktikable Möglichkeit für Dritte bestehen, durch Beschwerde<br />
bei <strong>der</strong> <strong>Re</strong>gulierungsinstanz eine Überprüfung <strong>der</strong> geschlossenen Vereinbarung auf<br />
Diskriminierung zu erwirken. Wie bereits erwähnt, sind Interessenkonflikte zwischen<br />
verschiedenen Fluggesellschaften deutlich unwahrscheinlicher.<br />
Eine wichtige Voraussetzung für den Erfolg einer korporatistischen Lösung ist die<br />
Wirksamkeit <strong>der</strong> ex-ante Androhung eines subsidiären <strong>Re</strong>gulierungseingriffs durch den Staat.<br />
Diese hängt vor allem von <strong>der</strong> Glaubwürdigkeit ihrer Umsetzung ab. Im Vergleich zu <strong>der</strong><br />
notwendigerweise branchenweiten Durchsetzung im Netzzugang von Energieversorgern<br />
besteht im Flughafensektor die Möglichkeit, sofern erfor<strong>der</strong>lich, die <strong>Re</strong>gulierungsandrohung<br />
bei einzelnen Flughäfen durchzusetzen. Dieses erhöht die Glaubwürdigkeit <strong>der</strong> Drohung für<br />
die verbleibenden Flughäfen.<br />
Zwischenfazit: Eine korporatistische <strong>Re</strong>gulierung ist vorteilhaft<br />
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die korporatistische <strong>Re</strong>gulierung im Vergleich<br />
zum alleinigen einseitigen, staatlichen <strong>Re</strong>gulierungseingriff bedeutende Vorteile aufweisen<br />
kann. So kann sie dazu beitragen, die Angebotskontrolle eines marktmächtigen Unternehmens<br />
flexibler an die Erfor<strong>der</strong>nisse des Einzelfalls anzupassen, ohne mit einer nur angedrohten<br />
<strong>Re</strong>gulierung bedeutende Einbußen in <strong>der</strong> Disziplinierungswirkung hinnehmen zu müssen.<br />
Durch die aktive Einbindung <strong>der</strong> Marktteilnehmer bei <strong>der</strong> Entwicklung eines<br />
<strong>Re</strong>gulierungsrahmens für den jeweiligen Flughafen haben die Beteiligten darüber hinaus die<br />
Möglichkeit, Informationsvorsprünge zur Verbesserung des <strong>Re</strong>gulierungssystems<br />
einzusetzen. Das vorgestellte Verfahren bietet sich insbeson<strong>der</strong>e dann an, wenn die<br />
Marktteilnehmer nur über begrenzte Marktmacht verfügen <strong>und</strong> Interessenkongruenzen<br />
50 Interessenkonflikte ergeben sich z.B. zwischen Netzwerk- <strong>und</strong> Low-Cost-Fluggesellschaften.<br />
51 Mit Kleink<strong>und</strong>en eines konkreten Flughafens sind direkte Nutzer – also Fluggesellschaften – gemeint, die an<br />
diesem Flughafen nur einen kleinen Anteil <strong>der</strong> Flugbewegungen bzw. des Passagierverkehrs haben.<br />
53
zwischen Flughafen <strong>und</strong> Fluggesellschaften existieren <strong>und</strong> somit eine potenzielle Tendenz zur<br />
Einigung besteht.<br />
6.1.4 Ansiedlung <strong>und</strong> Kompetenzbereich einer <strong>Re</strong>gulierungsinstitution<br />
In <strong>der</strong> Praxis lässt sich eine Vielzahl institutioneller Formen beobachten, <strong>unter</strong> denen sich<br />
anhand von drei Dimensionen<br />
• Agentur- o<strong>der</strong> Ministeriumsmodell,<br />
• sektor-spezifische o<strong>der</strong> sektorübergreifende Institution <strong>und</strong><br />
• <strong>der</strong> hierarchische Ansiedlung auf Län<strong>der</strong>-, B<strong>und</strong>es- o<strong>der</strong> EU-Ebene<br />
mehrere Gr<strong>und</strong>typen <strong>unter</strong>scheiden lassen (Grande / Eberlein 1999, S. 646).<br />
Die Organisation einer <strong>Re</strong>gulierungsinstitution nach dem Ministeriumsmodell ist mit einer<br />
<strong>Re</strong>ihe von Problemen verb<strong>und</strong>en. Das wohl schwerwiegendste Problem ist <strong>der</strong><br />
Interessenkonflikt, <strong>der</strong> entsteht, wenn die öffentliche Hand gleichzeitig als Eigentümer <strong>und</strong><br />
<strong>Re</strong>gulierer auftritt. Da in diesem Fall <strong>der</strong> öffentliche Eigentümer auch ein Interesse an<br />
möglichst hohen Gewinnen des Flughafens o<strong>der</strong> <strong>der</strong> Verfolgung an<strong>der</strong>er regionalpolitischer<br />
Ziele haben kann, besteht die Gefahr, dass Wohlfahrtsaspekte vernachlässigt werden. Aus<br />
diesem Gr<strong>und</strong> ist einer unabhängigen Agentur <strong>der</strong> Vorzug zu geben.<br />
Eine sektorübergreifende <strong>Re</strong>gulierungsinstitution hat im Vergleich zu einer sektorbezogenen<br />
Lösung insbeson<strong>der</strong>e die folgenden Vorteile:<br />
• <strong>Re</strong>gulierungskosten können durch Skaleneffekte reduziert <strong>und</strong> vorhandenes,<br />
regulatorisches Fachwissen übertragen werden.<br />
• Eine sektorübergreifende steht Instanz weniger in Gefahr, in gedankliche<br />
Abhängigkeit von <strong>der</strong> regulierten Branche zu geraten. 52<br />
• In Zeiten sinkenden <strong>Re</strong>gulierungsbedarfs in einzelnen Industrien kann ein „phasing<br />
out“ von <strong>Re</strong>gulierung <strong>und</strong> Personal bzw. eine Umorientierung einfacher betrieben<br />
werden.<br />
Allerdings existieren auch Vorteile durch den Aufbau einer spezifisch für Flughäfen<br />
zuständigen <strong>Re</strong>gulierungsinstanz. So wird sektorbezogenes, insbeson<strong>der</strong>e technisches<br />
Fachwissen angesammelt, welches gerade in <strong>der</strong> Anfangsphase eines neuen<br />
<strong>Re</strong>gulierungssystems beson<strong>der</strong>s wichtig ist.<br />
Mit Blick auf die hierarchische Kompetenzverteilung ist einerseits das Subsidiaritätsprinzip<br />
zu beachten. Entscheidungsbefugnisse sollten demnach nur vom übergeordneten<br />
Territorialrechtsträger an sich gezogen werden, wenn übergreifende Gemeinschaftsinteressen<br />
wie die Vereinheitlichung <strong>der</strong> Marktbedingungen dies rechtfertigen. Ansonsten gilt es, eine<br />
größtmögliche Nähe zum Entscheidungsobjekt zu wahren. Gegen regionale Institutionen<br />
spricht indes die mit <strong>der</strong> ineffizienten Duplizierung des Verwaltungsaufbaus verb<strong>und</strong>ene<br />
52 Dieses Problem wird als „regulatory capture“ bezeichnet.<br />
54
Erhöhung <strong>der</strong> <strong>Re</strong>gulierungskosten. Mit nur einer <strong>Re</strong>gulierungsinstanz auf B<strong>und</strong>esebene<br />
können Skaleneffekte generiert <strong>und</strong> <strong>der</strong> Organisations- <strong>und</strong> Koordinationsaufwand reduziert<br />
werden. Eine Harmonisierung <strong>und</strong> Vereinheitlichung des <strong>Re</strong>gelwerks trägt zudem zur<br />
Erhöhung <strong>der</strong> <strong>Re</strong>chtssicherheit bei <strong>und</strong> verringert die Transaktionskosten des Marktes.<br />
6.2 Schlussfolgerungen aus den Erfahrungen in Großbritannien, Neuseeland <strong>und</strong><br />
Australien<br />
Die Erfahrungen aus Großbritannien, Neuseeland <strong>und</strong> Australien geben Hinweise in Bezug<br />
auf eine Ausgestaltung einer Flughafenregulierung. 53<br />
6.2.1 <strong>Re</strong>gulierungsverfahren <strong>und</strong> -basis<br />
Großbritannien<br />
In Großbritannien werden die vier größten Flughäfen seit 1987 nach dem Price-Cap-<br />
Verfahren reguliert. Weitere Flughäfen mit einem Umsatz größer als 1 Mio. £ <strong>unter</strong>liegen<br />
lediglich einer ex-post Angebotskontrolle <strong>und</strong> einer angedrohten Preisregulierung. Alle<br />
Flughäfen <strong>unter</strong>halb dieser Umsatzschwelle werden nicht reguliert. Die <strong>Re</strong>gulierungsbehörde<br />
CAA identifizierte Probleme mit einem Single-Till- <strong>und</strong> <strong>Re</strong>venue-Yield-Ansatz in <strong>der</strong><br />
bisherigen <strong>Re</strong>gulierungspraxis <strong>und</strong> wies auf die theoretische Überlegenheit <strong>der</strong> Ansätze nach<br />
dem Dual-Till-Prinzip <strong>und</strong> Tariff-Basket-Konzept hin (CAA 2001c, S. 3ff.). Die Kritik <strong>der</strong><br />
CAA betraf v.a. die kontraproduktive Anreizwirkung des Single-Tills, Preise im<br />
Avaitionbereich exzessiv zu senken, um mehr Passagiere für den Non-Aviation-Bereich<br />
anzuziehen, was insbeson<strong>der</strong>e an den kapazitätsbeschränkten Flughäfen im Großraum London<br />
zu einer ineffizienten Ausweitung <strong>der</strong> kommerziellen Aktivitäten (Warenhauseffekt) sowie<br />
paradoxerweise zu einer weiteren Absenkung <strong>der</strong> Preise zu Spitzenlastzeiten führte (Starkie<br />
2001, S. 127ff.). Die CAA konnte sich jedoch mit ihrer Meinung nicht gegen die<br />
Wettbewerbsbehörde (Competition Commission) als zweiter, quasi-übergeordneter<br />
<strong>Re</strong>gulierungsinstanz im Vereinigten Königreich durchsetzen. Für die kommende<br />
<strong>Re</strong>gulierungsperiode 2003-2008 wurden daher keine Verän<strong>der</strong>ungen am <strong>Re</strong>gulierungsrahmen<br />
in Bezug auf das von <strong>der</strong> CAA favorisierte Konzept eines Dual-Tills vorgenommen (CAA<br />
2003a, S. 22f.). Das Price-Cap-Verfahren in Großbritannien wird ergänzt durch eine, als „sfactor“<br />
bezeichnete, ex-ante <strong>Re</strong>gelung zur anteiligen Durchreichung <strong>der</strong> Sicherheitskosten, die<br />
außerhalb des Einflussbereichs <strong>der</strong> Unternehmen liegen. Somit wird im Vorfeld die<br />
Risikoaufteilung bzgl. dieser Kosten zwischen Flughafen <strong>und</strong> Fluggesellschaften explizit<br />
vereinbart (CAA 2003, S.5).<br />
Neuseeland<br />
In Neuseeland <strong>unter</strong>liegen die drei größten Flughäfen einer ex-post Angebotskontrolle.<br />
Entgegen einer Empfehlung <strong>der</strong> mit <strong>der</strong> Überwachung betrauten Wettbewerbsbehörde zur<br />
Einführung einer Price-Cap-<strong>Re</strong>gulierung für die beiden privatisierten Flughäfen Auckland<br />
53 Für eine Ausführliche Darstellung <strong>der</strong> Erfahrungen mit <strong>der</strong> <strong>Privatisierung</strong> <strong>und</strong> <strong>Re</strong>gulierung <strong>der</strong> Flughäfen in<br />
Großbritannien, Neuseeland <strong>und</strong> Australien siehe Anhang.<br />
55
<strong>und</strong> Wellington, entschied sich das Wirtschaftsministerium nach Durchführung einer Kosten-<br />
Nutzen-Analyse für die Beibehaltung des bestehenden Modells einer „light-handed“<br />
<strong>Re</strong>gulierung. In <strong>der</strong> Pressemitteilung dazu hieß es, dass die relativ geringen Nutzengewinne<br />
auf Seiten <strong>der</strong> Fluglinien nicht durch die bei Einführung einer Preiskontrolle entstehenden<br />
Kostennachteile aufgr<strong>und</strong> <strong>der</strong> relativ großen Eingriffsintensität einer ex-ante <strong>Re</strong>gulierung zu<br />
rechtfertigen seien. So würde eine Umlage des geschätzten Nettonutzens auf alle Passagiere<br />
nur zu einer Absenkung des durchschnittlichen Ticketpreises um 0,35 NZD 54 führen.<br />
(Ministry of Commerce 2003).<br />
Australien<br />
In Australien wurde nach einer umfangreichen Bewertung <strong>der</strong> bisherigen <strong>Re</strong>gulierungspraxis<br />
für die größeren Flughäfen durch die Productivity Commission, einer staatlichen<br />
Wirtschaftsforschungsinstitution, <strong>und</strong> nach den Ereignissen des 11. September 2001 die bis<br />
dahin bestehende Price-Cap-<strong>Re</strong>gulierung mit einem Dual-Till-Ansatz ausgesetzt. Mitte 2002<br />
wurde sie gegen ein ex-post Monitoring-System ersetzt, das allerdings bei Identifizierung<br />
eines missbräuchlichem Angebotsverhaltens die Implementierung einer angedrohten ex-ante<br />
Preisregulierung nach dem bisherigem Muster nach sich zieht. Zur Erhöhung <strong>der</strong><br />
Vergleichbarkeit <strong>der</strong> Flughäfen <strong>unter</strong>einan<strong>der</strong> bestehen seitdem für das externe<br />
<strong>Re</strong>chnungswesen <strong>der</strong> regulierten Unternehmen strenge Vorgaben zur Kontoführung <strong>und</strong> zur<br />
Offenlegung von Leistungsdaten, so dass die Disziplinierungswirkungen dieser<br />
<strong>Re</strong>gulierungsvariante verstärkt werden. Für die kleineren Flughäfen wurde selbst diese bis<br />
dahin existierende ex-post Überwachung aufgehoben; sie sind seither vollständig <strong>der</strong>eguliert.<br />
Darüber hinaus besteht für unabhängige Dienstleister weiterhin die Möglichkeit, nach<br />
gescheiterten Marktzutrittsverhandlungen die Wettbewerbsbehörde um eine Entscheidung<br />
über den Zugang zu wesentlichen Einrichtungen auf Flughäfen anzurufen (Forsyth 2003b, S.<br />
4ff.).<br />
6.2.2 <strong>Re</strong>gulierungsinstitutionen<br />
In allen drei betrachteten Län<strong>der</strong>n ist die Aufgabe <strong>der</strong> Flughafenregulierung einer landesweit<br />
zuständigen Behörde übertragen worden. Die ex-post <strong>Re</strong>gulierung wird in Neuseeland <strong>und</strong><br />
Australien allein von den jeweiligen sektorübergreifenden Wettbewerbsbehörden (New<br />
Zealand Competition Commission, NZ-CC sowie Australian Competition and Consumer<br />
Commission, ACCC) übernommen, die jedoch nicht vergleichbar mit dem <strong>deutschen</strong><br />
Kartellamt sind, da sie mit weit umfangreicheren Kompetenzen ausgestattet wurden. In<br />
Großbritannien hingegen existiert mit <strong>der</strong> Civil Aviation Authority, CAA, eine für die<br />
gesamte Luftverkehrsbranche zuständige, sektorspezifische Behörde. Sie hat die Aufgabe,<br />
nach Ablauf einer <strong>Re</strong>gulierungsperiode die für die ex-ante <strong>Re</strong>gulierung notwendigen<br />
konkreten Bestimmungen wie z.B. den X-Faktor beim Price-Cap festzusetzen <strong>und</strong> Flughäfen<br />
für eine Monopolregulierung dem Verkehrsminister vorzuschlagen. Um die Gefahr eines<br />
„regulatory capture“ zu minimieren, fungiert eine zweite Institution als Kontrollinstanz. Die<br />
Wettbewerbsbehörde (Competition Commission) besitzt in diesem System <strong>der</strong> „checks and<br />
54 Dies entspricht ca. 0,18 €.<br />
56
alances“ die Aufgabe, die <strong>Re</strong>gulierungsergebnisse zu kontrollieren <strong>und</strong> die Entscheidungen<br />
<strong>der</strong> CAA zu bewerten sowie ggf. als Schlichter zwischen <strong>der</strong> CAA <strong>und</strong> den Flughäfen<br />
aufzutreten (Wolf 1997, S. 141ff.),<br />
6.2.3 <strong>Re</strong>sümee <strong>der</strong> internationalen <strong>Re</strong>gulierungserfahrungen<br />
Die Flughafenregulierung in Australien, Großbritannien <strong>und</strong> Neuseeland folgt nicht einem<br />
einheitlichen Muster, lässt aber doch eine Tendenz zum Abbau <strong>der</strong> <strong>Re</strong>gulierungsintensität<br />
erkennen. Bezüglich <strong>der</strong> <strong>Re</strong>gulierungsinstitution wird ein Agenturmodell auf nationaler Ebene<br />
(analog zur B<strong>und</strong>esebene) angewandt. Keine eindeutige Tendenz ist jedoch bei <strong>der</strong><br />
Ausgestaltung als sektorspezifische bzw. sektorübergreifende Institution zu erkennen.<br />
6.3 Empfehlung für Deutschland<br />
Die Marktmachtabschätzung für deutsche Flughäfen in Abschnitt 4 hat ergeben, dass<br />
bedeutende Wohlfahrtsverluste durch Ausnutzen von Marktmacht bei Primär- <strong>und</strong><br />
Sek<strong>und</strong>ärflughäfen möglich sind, die eventuell ein regulatorisches Eingreifen notwendig<br />
machen. Für Tertiärflughäfen gilt dies nur in seltenen Fällen. Die Vorteilhaftigkeit einer<br />
<strong>Re</strong>gulierung ergibt sich aber nur dann, wenn <strong>der</strong> Nutzen <strong>der</strong> <strong>Re</strong>gulierung potenzielle<br />
Wohlfahrtsverluste aufgr<strong>und</strong> des Markteingriffs (<strong>Re</strong>gulierungskosten) übertrifft. Das Ergebnis<br />
dieser Kosten-Nutzen-Abwägung hängt von <strong>der</strong> konkreten Ausgestaltung des<br />
<strong>Re</strong>gulierungssystems ab.<br />
Unter dieser Prämisse soll zunächst für Primär- <strong>und</strong> Sek<strong>und</strong>ärflughäfen eine Empfehlung für<br />
ein geeignetes <strong>Re</strong>gulierungsverfahren <strong>und</strong> die in die <strong>Re</strong>gulierungsbasis einzuschließenden<br />
Leistungsbereiche gegeben werden. Im Anschluss werden Tertiärflughäfen betrachtet <strong>und</strong><br />
schließlich Ansiedlung <strong>und</strong> Kompetenzen einer <strong>Re</strong>gulierungsinstitution in Deutschland<br />
diskutiert.<br />
6.3.1 <strong>Re</strong>gulierungsverfahren <strong>und</strong> -basis sowie Beteiligung <strong>der</strong> Marktteilnehmer<br />
6.3.1.1 <strong>Re</strong>gulierungsverfahren für Primär- <strong>und</strong> Sek<strong>und</strong>ärflughäfen<br />
Empfehlung für Dual-Till<br />
Der Fokus einer <strong>Re</strong>gulierung sollte auf einer Begrenzung <strong>der</strong> Marktmacht im Aviation-<br />
Bereich liegen. Das Ausnutzen von Marktmacht im Non-Aviation-Bereich kann in<br />
Deutschland als nicht regulierungsbedürftig angesehen werden, da aufgr<strong>und</strong> zahlreicher<br />
begrenzen<strong>der</strong> Faktoren die Wohlfahrtsverluste insgesamt gering sein dürften. Außerdem<br />
besteht allgemein Konsens, dass potenzielle Wohlfahrtsverluste in vergleichbaren Situationen,<br />
wie z.B. mögliche Überrenditen beim innerstädtischen Einzelhandel aufgr<strong>und</strong> exponierter<br />
Lage, ebenfalls keinen <strong>Re</strong>gulierungsbedarf begründen. Ein Vorteil auf eine <strong>Re</strong>gulierung des<br />
kommerziellen Bereichs zu verzichten, besteht darin, dass die Anreize zur<br />
Marktmachtausnutzung im Aviation-Bereich aufgr<strong>und</strong> <strong>der</strong> Komplementaritäten sinken.<br />
Daher sollte für Deutschland ein <strong>Re</strong>gulierungskonzept ausgewählt werden, dass diesen Effekt<br />
positiv beeinflussen kann. Eine Fokussierung <strong>der</strong> <strong>Re</strong>gulierungsbasis auf den Aviation-Bereich<br />
durch Anwendung eines Dual-Tills stellt ein mögliches Instrument dafür dar. Die für eine<br />
57
Umsetzung eines Dual-Tills vorteilhafte Komplementaritätsbeziehung ist in Deutschland<br />
insbeson<strong>der</strong>e bei Primär- <strong>und</strong> Sek<strong>und</strong>ärflughäfen stark ausgeprägt.<br />
• Primärflughäfen wie Frankfurt <strong>und</strong> München ziehen einen Großteil des<br />
Langstreckenflugverkehrs auf sich <strong>und</strong> sind bestrebt, diese Marktstellung in Europa<br />
weiter auszubauen, da die Passagiere dieses Marktsegments für einen<br />
überproportionalen Anteil an den Einnahmen im Non-Aviation-Bereich verantwortlich<br />
sind (Starkie 2002, S. 71f.).<br />
• Sek<strong>und</strong>ärflughäfen wie Hamburg, Düsseldorf o<strong>der</strong> Stuttgart besitzen aufgr<strong>und</strong> <strong>der</strong><br />
attraktiven Einzugsgebiete ebenfalls starke Anreize, die Komplementarität durch eine<br />
Ausdehnung ihres Non-Aviation-Angebots auszubauen. Ein Dual-Till liefert dafür<br />
effizientere Investitionsanreize als ein Single-Till.<br />
Die negativen Erfahrungen mit <strong>der</strong> Anwendung eines Single-Tills v.a. bei<br />
kapazitätsbeschränkten Flughäfen in Großbritannien sprechen ebenfalls für ein Dual-Till am<br />
Primärflughafen Frankfurt, da hier zu Spitzenzeiten ähnlich wie am Drehkreuzflughafen in<br />
London Heathrow bedeutende Kapazitätsengpässe auftreten. Die Vorteilhaftigkeit eines Dual-<br />
Tills erhöht sich zudem mit <strong>der</strong> Größe des Flughafens, da die wohlfahrtsteigernden<br />
Effizienzzuwächse dann zunehmend den Mehraufwand aufgr<strong>und</strong> des komplizierteren<br />
Verfahrens übersteigen, so dass auch dieser Aspekt dessen Anwendung für die Flughäfen <strong>der</strong><br />
ersten <strong>und</strong> zweiten Kategorie in Deutschland geeignet erscheinen lässt.<br />
Aus diesen Gründen sollte in Deutschland die <strong>Re</strong>gulierungsbasis für Primär- als auch<br />
Sek<strong>und</strong>ärflughäfen auf den Aviation-Bereich beschränkt <strong>und</strong> im Rahmen <strong>der</strong> <strong>Re</strong>-<strong>Re</strong>gulierung<br />
ein Dual-Till-Ansatz angewandt werden. Die gesetzlichen Rahmenbedingungen des § 43<br />
LuftVZO geben bereits heute eine rechtliche Basis, um Preise für ausgewählte<br />
Leistungsbereiche aus dem Aviation-Bereich zu regulieren. Dies könnte als Gr<strong>und</strong>lage für<br />
einen Dual-Till interpretiert werden. Wesentliche Leistungsbereiche wie die Zugangsentgelte<br />
für die Zentrale Betriebsinfrastruktur bleiben jedoch unberücksichtigt. Da die <strong>Re</strong>gelung nicht<br />
den vollständigen Aviation-Bereich abdeckt, ist eine Än<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> gesetzlichen<br />
<strong>Re</strong>gulierungsgr<strong>und</strong>lagen bezüglich <strong>der</strong> <strong>Re</strong>gulierungsbasis notwendig. Nach Möglichkeit sollte<br />
in Zukunft <strong>der</strong> Umfang <strong>der</strong> <strong>Re</strong>gulierungsbasis gesetzlich nur grob festgelegt sein <strong>und</strong> die<br />
konkrete Interpretation <strong>der</strong> <strong>Re</strong>gulierungsinstitution überlassen werden.<br />
Price-Cap-Verfahren als geeignetes <strong>Re</strong>gulierungsverfahren …<br />
Die Flughäfen in Deutschland befinden sich noch mehrheitlich in öffentlichem Eigentum. Es<br />
kann daher angenommen werden, dass sie tendenziell über ungenutzte Produktivitätsreserven<br />
verfügen. Eine Price-Cap-<strong>Re</strong>gulierung bietet im Vergleich zur bestehenden<br />
Kostenzuschlagsregulierung größere Anreize dafür, die produktive Effizienz zu steigern. Eine<br />
Anwendung <strong>der</strong> Price-Cap-<strong>Re</strong>gulierung in Deutschland sollte nach Möglichkeit die folgenden<br />
Aspekte beinhalten:<br />
• Qualitätskontrolle: Der Gefahr einer kostensenkenden, jedoch nicht<br />
nachfragegerechten Absenkung <strong>der</strong> Angebotsqualität durch den Flughafenbetreiber<br />
kann durch eine regelmäßige, mit den Nutzern abgestimmte Qualitätskotrolle begegnet<br />
werden.<br />
58
• Investitionsvereinbarungen: Das Bestreben des Flughafens, durch einen Aufschub<br />
von nachfragegerechten, aber nicht unmittelbar erfor<strong>der</strong>lichen<br />
Erweiterungsinvestitionen Kosten einzusparen, kann durch Investitionsvereinbarungen<br />
deutlich reduziert werden. Allerdings ist dabei zu beachten, dass dieses Problem sich<br />
mit zunehmen<strong>der</strong> Komplementarität <strong>der</strong> Nachfrage verringert.<br />
• Tariff-Basket: Die Anwendung dieses Verfahren bietet theoretisch Vorteile gegenüber<br />
dem <strong>Re</strong>venue-Yield-Ansatz. Dies gilt insbeson<strong>der</strong>e für den Flughafen Frankfurt mit<br />
seinen Kapazitätsbeschränkungen, bei dem durch diese Methode die Anreize für eine<br />
effiziente Preisstruktur gestärkt werden. Die Anwendbarkeit in <strong>der</strong> Praxis <strong>der</strong><br />
Flughäfen muss noch weiter <strong>unter</strong>sucht werden.<br />
• Sliding-Scale: Dieses Verfahren ermöglicht eine effiziente Risikoaufteilung zwischen<br />
Fluggesellschaften <strong>und</strong> Flughafenbetreiber. Um die negativen Erfahrungen mit einer<br />
asymmetrischen Sliding-Scale am Hamburger Flughafen zu vermeiden, sollte diese<br />
wie in Frankfurt symmetrisch ausgestaltet sein.<br />
… für eine <strong>Re</strong>gulierungsandrohung als Teil einer korporatistischen <strong>Re</strong>gulierung<br />
Eine flexiblere Anpassung des <strong>Re</strong>gulierungssystems an die individuelle Situation des<br />
Flughafens kann eine korporatistische <strong>Re</strong>gulierung erlauben, da die Marktteilnehmer zur<br />
Verbesserung <strong>der</strong> <strong>Re</strong>gulierungsregeln am jeweiligen Flughafen ihnen zugängliche<br />
Informationen einbringen können. Diese Art <strong>der</strong> marktinternen Angebotskontrolle bietet sich<br />
v.a. bei einer gewissen Tendenz zur Einigung zwischen Fluggesellschaften <strong>und</strong><br />
Flughafenbetreiber an, die durch die Entscheidung zugunsten eines Dual-Tills zusätzlich<br />
<strong>unter</strong>stützt wird.<br />
Die Bereitschaft zur Einigung kann darüber hinaus durch eine wirksam angedrohte ex-ante<br />
<strong>Re</strong>gulierung erhöht werden, die den Marktteilnehmern zu Beginn <strong>der</strong> Verhandlungen als<br />
schon ausgearbeitetes <strong>Re</strong>ferenzsystem zur <strong>Re</strong>duzierung <strong>der</strong> Transaktionskosten vorgelegt<br />
wird. Für die Primär- <strong>und</strong> Sek<strong>und</strong>ärflughäfen in Deutschland bietet sich dafür in erster Linie<br />
eine Price-Cap-<strong>Re</strong>gulierung <strong>unter</strong> Einbeziehung sämtlicher zuvor dargestellter Bestandteile<br />
an.<br />
Spezielle Fragen zur Ausgestaltung <strong>der</strong> korporatistischen <strong>Re</strong>gulierung<br />
Die Wirksamkeit einer korporatistischen <strong>Re</strong>gulierung wird ähnlich wie das Price-Cap-<br />
Verfahren von <strong>der</strong> konkreten Ausgestaltung <strong>der</strong> Details beeinflusst. Folgende Aspekte sind<br />
dabei im Zusammenhang mit <strong>der</strong> korporatistischen <strong>Re</strong>gulierung von Bedeutung:<br />
• Wer führt die Verhandlungen? Dem Betreiber des Primär- bzw. Sek<strong>und</strong>ärflughafens<br />
stehen in den Verhandlungen die hier ansässigen Fluggesellschaften gegenüber. Es ist<br />
zu erwarten, dass sich die Luftverkehrs<strong>unter</strong>nehmen in lokalen <strong>und</strong> regionalen<br />
Nutzervereinigungen zusammenschließen werden, um ihre Transaktionskosten zu<br />
minimieren. Eventuell übernehmen auch überregionale, nationale o<strong>der</strong> sogar<br />
internationale Branchenverbände wie die BARIG diese Aufgabe, wie bei den<br />
Vereinbarungen in Hamburg <strong>und</strong> Frankfurt zu beobachten war. Dabei ist anzunehmen,<br />
dass die Lufthansa als dominante Netzwerkfluggesellschaft in Deutschland in den<br />
59
meisten Fällen eine herausgehobene Stellung einnehmen wird, da für sie <strong>der</strong> Nutzen<br />
eines verstärkten Engagements bei den Verhandlungen größer als die damit<br />
verb<strong>und</strong>enen Kosten sein dürfte. 55 Der <strong>Re</strong>gulierungsinstitution könnte in den<br />
Gesprächen die Rolle des Mo<strong>der</strong>ators zukommen. 56<br />
• Die Verhandlungsposition von Min<strong>der</strong>heiten sollte durch geeignete <strong>Re</strong>geln gestärkt<br />
werden. Beispielsweise könnte die Gültigkeit von Vereinbarungen zwischen einem<br />
Flughafen <strong>und</strong> den ansässigen Fluggesellschaften an eine qualifizierte Mehrheit<br />
geknüpft werden, die sowohl die Anzahl <strong>der</strong> Fluggesellschaften als auch die durch die<br />
einzelnen Gesellschaften abgewickelten Verkehrsmengen berücksichtigt.<br />
• Der Detaillierungsgrad <strong>der</strong> Androhung beeinflusst neben den allgemeinen<br />
Rahmenbedingungen u.U. ebenfalls den möglichen Ausgang einer korporatistischen<br />
Lösung zwischen den Marktbeteiligten. Es stellt sich daher eventuell die Frage, wie<br />
konkret das kommunizierte <strong>Re</strong>ferenzsystem ausgestaltet sein sollte.<br />
• Um die Transparenz des <strong>Re</strong>gulierungssystems <strong>und</strong> die Vergleichbarkeit zwischen den<br />
Flughäfen insgesamt zu erhöhen, sollten die Betreiber dazu verpflichtet werden, die<br />
von <strong>der</strong> b<strong>und</strong>esweiten <strong>Re</strong>gulierungsinstitution auszuarbeitenden <strong>und</strong> vorzugebenden<br />
Standards zur Kontoführung <strong>und</strong> regelmäßigen Veröffentlichung von<br />
Unternehmensdaten einzuhalten. Damit ließe sich relativ unkompliziert ein<br />
Benchmarking-System implementieren, womit auch die Effekte einer <strong>Re</strong>-<strong>Re</strong>gulierung<br />
im Zeitverlauf besser dokumentiert <strong>und</strong> bewertet werden können.<br />
Implementierung <strong>der</strong> korporatistischen <strong>Re</strong>gulierung ist kurzfristig möglich<br />
Die korporatistische <strong>Re</strong>gulierung besitzt für eine Anwendung in Deutschland den großen<br />
Vorteil, dass sie schon relativ kurzfristig umgesetzt werden kann. So zeigen die Beispiele<br />
Hamburg <strong>und</strong> Frankfurt, dass <strong>der</strong> gegenwärtige rechtliche <strong>und</strong> institutionelle Rahmen bereits<br />
die Möglichkeit bietet, ähnliche marktinterne Lösungen zu vereinbaren. Bis zur vollständigen<br />
Umsetzung aller notwendigen rechtlichen <strong>und</strong> institutionellen Rahmenbedingungen kann eine<br />
schnell zu bildende Task-Force als Vorstufe <strong>der</strong> zu schaffenden <strong>Re</strong>gulierungsinstitution<br />
bereits mit <strong>der</strong> Ausarbeitung <strong>der</strong> Details einer anzudrohenden <strong>Re</strong>gulierung, <strong>der</strong> Beratung <strong>der</strong><br />
noch zuständigen Län<strong>der</strong>behörden <strong>und</strong> <strong>der</strong> Mo<strong>der</strong>ierung weiterer korporatistischer Lösungen<br />
beginnen. Das bestehende Kostenzuschlagsystem kann dabei als faktische<br />
<strong>Re</strong>gulierungsandrohung dienen. Beispielsweise stimmten im Falle von Hamburg <strong>und</strong><br />
Frankfurt alle Beteiligten darin überein, dass das ausgehandelte Price-Cap eine Verbesserung<br />
zum ineffizienten Status-Quo darstellt (Niemeier 2002, S. 43f.).<br />
Um die Glaubwürdigkeit <strong>der</strong> <strong>Re</strong>gulierungsandrohung <strong>und</strong> damit die Effizienz des gesamten<br />
<strong>Re</strong>gulierungssystems zu erhöhen, sollte in Deutschland langfristig eine permanent aktive<br />
<strong>Re</strong>gulierungsinstitution eingerichtet werden, <strong>der</strong>en Ansiedlung <strong>und</strong> Kompetenzen im<br />
folgenden Unterabschnitt 6.3.2 diskutiert werden.<br />
55 Branchenexperten deuten intern diese Möglichkeit analog zu den Erfahrungen in Hamburg <strong>und</strong> Frankfurt an.<br />
56 Bei größeren Flughäfen könnten auf <strong>der</strong> Nutzerseite neben den Fluggesellschaften gegebenenfalls auch die<br />
unabhängigen Bodenverkehrsdienstleister an den Verhandlungen beteiligt werden.<br />
60
6.3.1.2 <strong>Re</strong>gulierungsverfahren für Tertiärflughäfen<br />
Der Preissetzungsspielraum von Tertiärflughäfen wird in Deutschland durch inter- <strong>und</strong><br />
intramodale Substitutionskonkurrenz sowie das relativ große Marktmachtgegengewicht <strong>der</strong><br />
dominanten Fluggesellschaften, insbeson<strong>der</strong>e <strong>der</strong> Lufthansa, stark eingeschränkt. Eine<br />
<strong>Re</strong>gulierung ist daher nur in seltenen Fällen erfor<strong>der</strong>lich. Entscheidend ist aber letztendlich<br />
eine Abwägung <strong>der</strong> Kosten zum Nutzen einer <strong>Re</strong>gulierung für den jeweiligen Standort.<br />
Ein Monitoring-Modell nach dem Vorbild Australiens stellt eine für den Großteil <strong>der</strong><br />
<strong>deutschen</strong> Tertiärflughäfen geeignete Methode dar, ein missbräuchliches Verhalten zu<br />
identifizieren <strong>und</strong> gegebenenfalls durch Sanktionen die zukünftige Erzielung von<br />
Überrenditen zu <strong>unter</strong>binden. Die ex-post Angebotskontrolle ist auch hierbei auf den<br />
Aviation-Bereich zu beschränken.<br />
Um die Arbeit <strong>der</strong> Kontrollinstanz zu vereinfachen <strong>und</strong> um eine Vergleichbarkeit zwischen<br />
den Flughafengesellschaften sicherzustellen, sollten den Unternehmen im Vorfeld ähnliche<br />
<strong>Re</strong>geln zur Kontoführung <strong>und</strong> Verpflichtungen zur Veröffentlichung von Unternehmensdaten<br />
auferlegt werden, wie bei <strong>der</strong> korporatistischen <strong>Re</strong>gulierung, Darüber hinaus kann ein<br />
Beschwerde- <strong>und</strong> Vorschlagssystem für die Nutzer dazu beitragen, missbräuchliches<br />
Verhalten schnellstmöglich aufzudecken <strong>und</strong> eine präventive Rückwirkung auf die<br />
Unternehmen zu ermöglichen.<br />
Sollten diese Maßnahmen insgesamt nicht ausreichen, die Marktmacht eines Tertiärflughafens<br />
auf ein akzeptables Maß zu beschränken, so kann durch die <strong>Re</strong>gulierungsinstitution in<br />
Einzelfällen entschieden werden, den Flughafen in eine korporatistische <strong>Re</strong>gulierung mit<br />
einzubeziehen.<br />
6.3.2 <strong>Re</strong>gulierungsinstitution<br />
Die <strong>Re</strong>gulierungsinstitution sollte zukünftig nach dem Agenturmodell aufgebaut werden. In<br />
Bezug auf die Frage <strong>der</strong> hierarchischen Ansiedlung <strong>der</strong> Verwaltungsinstanz wird ein Wechsel<br />
hin zu einer einzigen, b<strong>und</strong>esweiten Institution empfohlen. Mit <strong>der</strong> Konzentration <strong>der</strong><br />
Fachkompetenz auf eine einzige <strong>Re</strong>gulierungsinstanz wird die <strong>der</strong>zeitige ineffiziente<br />
Duplizierung des Verwaltungsaufbaus abgeschafft, <strong>der</strong> Gesamtpersonalbedarf einer<br />
<strong>Re</strong>gulierungsbehörde auf B<strong>und</strong>esebene dürfte deutlich geringer ausfallen.<br />
Um weitere Skaleneffekte zu nutzen <strong>und</strong> die Gefahr einer Vereinnahmung <strong>der</strong> Verwaltung<br />
durch die regulierten Flughafen<strong>unter</strong>nehmen zu reduzieren, ist es sinnvoll, die Kompetenz bei<br />
einer unabhängigen, sektorübergreifenden <strong>Re</strong>gulierungsinstitution zu bündeln. Eine<br />
Netzsektorenbehörde, wie sie von <strong>der</strong> Monopolkommission vorgeschlagen wird<br />
(Monopolkommission 2000/2001, S.376ff.), stellt die favorisierte <strong>und</strong> langfristig<br />
anzustrebende Lösung dar. Solange diese noch nicht existiert, ist eine eigenständige,<br />
sektorspezifische <strong>Re</strong>gulierungsbehörde für den Flughafenmarkt (<strong>Re</strong>gFH) <strong>unter</strong> Rückgriff auf<br />
<strong>Re</strong>ssourcen <strong>der</strong> <strong>Re</strong>gTP, wie Immobilien, Personal etc, eine geeignete Lösung. 57 Um eine<br />
kurzfristige Umsetzung <strong>der</strong> <strong>Re</strong>-<strong>Re</strong>gulierung zu ermöglichen, sollte frühzeitig eine Task Force<br />
57 Laut Pressemitteilung soll die <strong>Re</strong>gTP auch die Funktion <strong>der</strong> <strong>Re</strong>gulierung des Strom- <strong>und</strong> Gasmarktes<br />
übernehmen (FTD 2003).<br />
61
aus Branchenexperten gebildet werden, die in <strong>der</strong> Übergangsphase die <strong>der</strong>zeitigen<br />
Verantwortlichen <strong>der</strong> Län<strong>der</strong> bei <strong>der</strong> Implementierung <strong>der</strong> korporatistischen <strong>Re</strong>gulierung<br />
berät <strong>und</strong> die Tätigkeit <strong>der</strong> <strong>Re</strong>gFH vorbereitet, wie z.B. die Ausarbeitung eines<br />
<strong>Re</strong>ferenzsystems zur <strong>Re</strong>gulierungsandrohung.<br />
6.3.3 Konkretisierung des wirtschaftspolitischen Handlungsbedarfs<br />
Die notwendigen Schritte für eine Umsetzung <strong>der</strong> korporatistischen <strong>Re</strong>gulierung sind:<br />
• Task Force: Als organisatorischer Vorläufer <strong>und</strong> späterer Kern einer b<strong>und</strong>esweiten<br />
<strong>Re</strong>gulierungsinstitution (<strong>Re</strong>gFH) sollte eine Task Force aus geeigneten Fachleuten<br />
gebildet werden. Dazu gehören die Ausarbeitung <strong>der</strong> Details einer anzudrohenden<br />
<strong>Re</strong>gulierung, <strong>der</strong> Beratung <strong>der</strong> noch zuständigen Län<strong>der</strong>behörden <strong>und</strong> <strong>der</strong><br />
Mo<strong>der</strong>ierung weiterer korporatistischer Lösungen, um den ineffizienten Status-Quo zu<br />
verbessern.<br />
• Än<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> gesetzlichen Rahmenbedingungen: Die für eine <strong>Re</strong>-<strong>Re</strong>gulierung<br />
erfor<strong>der</strong>lichen Än<strong>der</strong>ungen <strong>der</strong> rechtlichen Rahmenbedingungen sollten daraufhin<br />
<strong>unter</strong> Einbeziehung <strong>der</strong> Task Force ausgearbeitet <strong>und</strong> auf den Weg gebracht werden.<br />
Wichtigste Punkte sind dabei die Schaffung <strong>der</strong> b<strong>und</strong>esweiten <strong>Re</strong>gulierungsbehörde<br />
<strong>Re</strong>gFH <strong>und</strong> die Definition ihrer Kompetenzen <strong>und</strong> Zielsetzungen. Zu den Befugnissen,<br />
die <strong>der</strong> Institution übertragen werden, gehört die Entscheidungsfreiheit zur Auswahl,<br />
getrennt nach Flughafentypen <strong>und</strong> gegebenenfalls einzelnen Flughäfen, eines<br />
geeigneten Verfahrens für einen staatlichen <strong>Re</strong>gulierungseingriff <strong>und</strong> zur Festlegung<br />
<strong>der</strong> entsprechenden <strong>Re</strong>gulierungsbasis.<br />
• <strong>Privatisierung</strong>: Der <strong>Privatisierung</strong>sprozess ist erst fortzusetzen, wenn am jeweiligen<br />
Primär- <strong>und</strong> Sek<strong>und</strong>ärflughafen eine marktinterne Vertragsvereinbarung geschlossen<br />
wurde bzw. das angedrohte <strong>Re</strong>gulierungsverfahren in Kraft getreten ist. Durch den<br />
somit erzielten Abbau an <strong>Re</strong>gulierungsunsicherheit fallen die vom Flughafen in die<br />
Endpreise einkalkulierten Risikozuschläge geringer aus, was im Endeffekt zu einer<br />
Vermeidung bzw. <strong>Re</strong>duzierung von Wohlfahrtsverlusten führt.<br />
• Überprüfung: Die <strong>Re</strong>gulierungspraxis <strong>der</strong> korporatistischen <strong>Re</strong>gulierung <strong>und</strong> des<br />
Monitoring sind in regelmäßigen Abschnitten kritisch auf ihre Zielerreichung hin zu<br />
überprüfen. Im Idealfall führt – ähnlich wie in Australien –eine von <strong>der</strong> <strong>Re</strong>gFH<br />
unabhängige Instanz diese Überprüfung durch bzw. kontrolliert sie zumindest (Wolf<br />
2003).<br />
62
7 Wettbewerbspolitik – Horizontale Integration<br />
Als Wettbewerbspolitik wird hier die Beurteilung <strong>und</strong> Entscheidung über Fragen <strong>der</strong><br />
horizontalen Integration angesehen; es ist zu beurteilen <strong>und</strong> zu entscheiden, ob Flughäfen<br />
einen gemeinsamen (Teil-) Eigentümer haben bzw. durch Überkreuzbeteiligungen<br />
miteinan<strong>der</strong> verb<strong>und</strong>en sein dürfen. Fragen <strong>der</strong> vertikalen Integration zwischen Flughäfen <strong>und</strong><br />
z.B. Fluggesellschaften werden hier nicht betrachtet.<br />
7.1 Theoretische Gr<strong>und</strong>lagen<br />
Aus Sicht <strong>der</strong> Wettbewerbspolitik lautet die zentrale Frage, ob bei gemeinsamen (Teil-)<br />
Eigentümern o<strong>der</strong> durch Überkreuzbeteiligungen von Flughäfen die Vorteile aufgr<strong>und</strong> von<br />
Synergieffekten die Nachteile aufgr<strong>und</strong> <strong>der</strong> wettbewerbsmin<strong>der</strong>nden Wirkung überwiegen.<br />
Aus gesamtwirtschaftlicher Sicht würde das Vorhandensein signifikanter Synergieeffekte ein<br />
Argument für einen gemeinsamen Betrieb von Flughäfen sein. Vom<br />
Rationalisierungspotenzial zentraler Verwaltungsfunktionen <strong>und</strong> eventuell vorhandener<br />
Netzwerkeffekte durch eine abgestimmte Preis- <strong>und</strong> Investitionspolitik abgesehen besteht<br />
jedoch kein Kostensenkungspotenzial (Niemeier / Wolf 2002, S. 192 u. 198). Niemeier <strong>und</strong><br />
Wolf (2002, S. 193) sehen darüber hinaus Vorteile lediglich im Know-how-Transfer, wobei<br />
<strong>der</strong> Schwerpunkt dabei im Non-Aviation-Bereich liegt.<br />
Gegen die Zulassung horizontal integrierter Flughäfen sprechen die Auswirkungen eines<br />
möglicherweise reduzierten Wettbewerbs zwischen den Flughäfen. Diese dürften regelmäßig<br />
dann groß sein, wenn es sich um Flughäfen im selben Marktsegment <strong>und</strong> mit stark<br />
überlappenden Einzugsgebieten handelt. Die Segmentierung des Marktes erfolgt dabei<br />
entlang <strong>der</strong> in diesem Beitrag verwendeten Einteilung <strong>der</strong> Flughäfen, die unmittelbar auf die<br />
Attraktivität des Flughafens für die Fluggesellschaften <strong>unter</strong> Berücksichtigung verschiedener<br />
Geschäfts-modelle zurückgeht. 58<br />
Bei <strong>der</strong> Beurteilung oben genannter Fragestellung ist weiterhin die Unterscheidung <strong>der</strong><br />
verschiedenen Marktbeziehungen, die zwischen Flughäfen vorliegen können, von Bedeutung.<br />
Flughäfen stehen in vertikaler Beziehung zu einan<strong>der</strong>, wenn sie durch Flugverbindungen<br />
direkt verb<strong>und</strong>en sind. In diesem Fall komplementärer Flughäfen ergibt sich ein weiterer<br />
Vorteil durch eine Integration <strong>der</strong> Flughafenbetreiber, da ein abgestimmtes Angebotsverhalten<br />
zur Beseitigung von Marktunvollkommenheiten beitragen kann (Niemeier / Wolf 2002, S.<br />
198). In diesem Fall kann das Problem des doppelten Gewinnaufschlages vertikal verknüpfter<br />
Unternehmen mit Marktmacht reduziert werden. 59<br />
58 Während <strong>der</strong> Flughafen Köln/Bonn als Sek<strong>und</strong>ärflughafen je nach Bepreisung sowohl für Netzwerk- als auch<br />
Low-Cost-Fluggesellschaften attraktiv sein kann, ist <strong>der</strong> Flughafen Hahn/Hunsrück aufgr<strong>und</strong> seiner<br />
geographischen Lage – ähnlich den Tertiärflughäfen – lediglich für Low-Cost- o<strong>der</strong> Touristik-Fluggesellschaften<br />
interessant.<br />
59 Wolf / Niemeier (2001, S. 211ff.) geben eine detaillierte Darstellung des Problems des doppelten<br />
Gewinnaufschlags.<br />
63
Folglich lassen sich folgende Ergebnisse festhalten:<br />
• Verflechtungen von Flughäfen im selben Marktsegment <strong>und</strong> mit stark überlappenden<br />
Einzugsgebieten sind tendenziell problematisch, da sie vorhandene<br />
Wettbewerbstendenzen benachbarter Flughäfen verhin<strong>der</strong>n.<br />
• Das Ausmaß <strong>der</strong> Synergieeffekte durch den gemeinsamen Betrieb von Flughäfen ist<br />
unklar.<br />
• Verflechtungen zwischen komplementären Flughäfen sind als unproblematisch<br />
einzustufen, da diese keine bzw. kaum sich überschneidende Einzugsgebiete haben.<br />
Weiterhin hilft eine Angebotskoordinierung, Marktunvollkommenheiten zu beseitigen.<br />
7.2 Schlussfolgerungen aus den Erfahrungen in Großbritannien, Neuseeland <strong>und</strong><br />
Australien<br />
Die Erfahrungen aus Großbritannien, Neuseeland <strong>und</strong> Australien sind in Bezug auf<br />
Flughafenintegration uneindeutig. 60 Die zwei großen privatisierten Flughäfen in Neuseeland<br />
gehören <strong>unter</strong>schiedlichen Eigentümern; ein ausdrückliches Verbot einer Kapitalverflechtung<br />
o<strong>der</strong> sonstige Einschränkungen sind auch nicht vorhanden.<br />
Bei <strong>der</strong> <strong>Privatisierung</strong> in Großbritannien wurden die vier großen Londoner Flughäfen als<br />
Flughafensystem gemeinsam verkauft. Gegen jede Kritik <strong>und</strong> alle For<strong>der</strong>ungen zur<br />
Aufspaltung <strong>der</strong> BAA hat sich die britische <strong>Re</strong>gulierungsbehörde CAA bisher für die<br />
Beibehaltung <strong>der</strong> <strong>der</strong>zeitigen Eigentümerstruktur ausgesprochen (Starkie 1987). Sie folgt<br />
dabei <strong>der</strong> Argumentation <strong>der</strong> BAA, dass <strong>der</strong> potenzielle Effizienzzuwachs aufgr<strong>und</strong><br />
freigesetzter Wettbewerbspotenziale zwischen den Londoner Flughäfen den Verlust von<br />
Synergieeffekten <strong>und</strong> den Anstieg von Transaktionskosten nicht kompensieren würde (Toms<br />
2003, S. 3ff.).<br />
In Australien sind im Rahmen des Airport Acts von 1996 die gemeinsame Teilhaberschaft an<br />
den vier Einreise-Flughäfen („Ports of Entry“) Sydney, Melbourne, Brisbane <strong>und</strong> Perth<br />
verboten, die <strong>unter</strong>einan<strong>der</strong> in einem gewissen Wettbewerb stehen. Ebenso ist die<br />
Teilhaberschaft von Fluggesellschaften an Flughäfen limitiert (Wolf 1997, S. 160).<br />
7.3 Empfehlungen für Deutschland<br />
Die theoretischen Überlegungen <strong>und</strong> internationalen Erfahrungen lassen erkennen, dass keine<br />
allgemeingültigen Empfehlungen zum Umgang mit horizontaler Integration von Flughäfen<br />
abgeleitet werden können. Bei <strong>der</strong> Entwicklung einer Handlungsempfehlung für eine<br />
effiziente <strong>Re</strong>gulierung wird in dieser Arbeit von begrenzt vorhandener Marktmacht <strong>der</strong><br />
<strong>deutschen</strong> Flughäfen <strong>und</strong> Interessenkongruenzen zwischen Flughäfen <strong>und</strong> Fluggesellschaften<br />
ausgegangen. Diese beiden Annahmen sind wichtige Bedingungen für die Vorteilhaftigkeit<br />
einer korporatistischen <strong>Re</strong>gulierung. Zur Aufrechterhaltung dieser Vorteile ist jede Form von<br />
Wettbewerbsdruck von Bedeutung. Unter dieser Voraussetzung sind Kapitalverflechtungen<br />
60 Für eine ausführliche Darstellung <strong>der</strong> Erfahrungen mit <strong>der</strong> <strong>Privatisierung</strong> <strong>und</strong> <strong>Re</strong>gulierung <strong>der</strong> Flughäfen in<br />
Großbritannien, Neuseeland <strong>und</strong> Australien siehe Anhang.<br />
64
von Flughäfen im selben Marktsegment mit stark überlappenden Einzugsgebieten, wie z.B.<br />
die Flughäfen in Düsseldorf, Köln/Bonn <strong>und</strong> Dortm<strong>und</strong>, als kritisch zu bewerten <strong>und</strong> sollten<br />
daher starken Einschränkungen <strong>unter</strong>liegen <strong>und</strong> eher nicht genehmigt werden. Im Rahmen <strong>der</strong><br />
vorgeschlagenen korporatistischen <strong>Re</strong>gulierung könnten <strong>der</strong>artige Beteiligungen aber auch<br />
von <strong>der</strong> Zustimmung <strong>der</strong> betroffenen Fluggesellschaften abhängig gemacht werden.<br />
Ein schlüssiges „ex-ante“-Konzept zur Wettbewerbspolitik bzgl. <strong>der</strong> möglichen Integration<br />
von Flughafenbetreibern sollte vor einer <strong>Privatisierung</strong> von <strong>der</strong> neu zu schaffenden<br />
<strong>Re</strong>gulierungsinstanz in Abstimmung mit dem Kartellamt entwickelt werden. Dieses Konzept<br />
sollte daraufhin dem Markt deutlich kommuniziert werden, um unnötige<br />
<strong>Re</strong>gulierungsunsicherheit <strong>und</strong> somit auch Risikoaufschläge <strong>der</strong> privaten Investoren zu<br />
verringern.<br />
65
8 Zusammenfassung <strong>und</strong> Schlussfolgerungen<br />
8.1 Zusammenfassung <strong>der</strong> Ergebnisse<br />
Ziel dieses Beitrages ist es, geeignete Konzepte für eine <strong>Privatisierung</strong> <strong>und</strong> insbeson<strong>der</strong>e <strong>Re</strong>-<br />
<strong>Re</strong>gulierung <strong>der</strong> <strong>deutschen</strong> Flughäfen zu entwickeln. Dies geschieht vor dem Hintergr<strong>und</strong>,<br />
dass die bisherige Form <strong>der</strong> Bereitstellung <strong>der</strong> noch überwiegend öffentlichen Flughäfen als<br />
ineffizient eingeschätzt wird <strong>und</strong> insgesamt nicht o<strong>der</strong> nur unzureichend den Anfor<strong>der</strong>ungen<br />
des dynamischen Luftverkehrssektors, beson<strong>der</strong>s mit Blick auf den zukünftigen<br />
Investitionsbedarf, entspricht. Die Analyse <strong>der</strong> verschiedenen Handlungsoptionen erfolgt<br />
<strong>unter</strong> <strong>der</strong> Zielsetzung, eine gesamtwirtschaftlich sinnvolle Lösung zur Überwindung dieser<br />
Defizite zu finden. Die wesentlichen Ergebnisse sollen hier zusammengefasst werden.<br />
<strong>Privatisierung</strong> <strong>der</strong> <strong>deutschen</strong> Flughäfen<br />
Die Betrachtung des <strong>deutschen</strong> Flughafensektors lässt keine Gründe erkennen, Flughäfen<br />
nicht zu privatisieren. Nach Vickers / Yarrow (1991) sind Effizienzgewinne in Sektoren mit<br />
monopolistischem Charakter aber von einer geeigneten <strong>Re</strong>gulierung abhängig. Daher ist vor<br />
einer <strong>Privatisierung</strong> von Flughäfen eine <strong>Re</strong>-<strong>Re</strong>gulierung notwendig.<br />
Die <strong>deutschen</strong> Flughäfen sollten im <strong>Re</strong>gelfall vollständig privatisiert werden, in Einzelfällen<br />
kann demgegenüber eine Teilprivatisierung mit privater Mehrheitsbeteiligung sinnvoll sein.<br />
Während für Tertiärflughäfen eine Ausschreibung von Unternehmensanteilen an strategische<br />
Investoren sinnvoll erscheint, ist bei Primär- <strong>und</strong> einigen Sek<strong>und</strong>ärflughäfen i.d.R. ein<br />
Börsengang zum Verkauf <strong>der</strong> Unternehmensanteile an private Investoren besser geeignet.<br />
Flughäfen besitzen eingeschränkte Marktmacht, die zudem nicht zwingend ausgenutzt wird<br />
Im Non-Aviation-Bereich ist Marktmacht vorhanden, die aber nicht als problematisch<br />
angesehen wird. Der Grad <strong>der</strong> Marktmacht im Aviation-Bereich ist für die einzelne<br />
Flughafentypen sehr <strong>unter</strong>schiedlich ausgeprägt.<br />
• Die Primärflughafen Frankfurt <strong>und</strong> München besitzen bedingt durch institutionelle<br />
Markteintrittsbarrieren <strong>und</strong> nicht geschützter, faktorspezifischer Investitionen <strong>der</strong><br />
Lufthansa Marktmacht, die durch Wettbewerb mit an<strong>der</strong>en europäischen<br />
Drehkreuzflughäfen um Transferpassagiere eingeschränkt ist. Das Interesse an einer<br />
langfristig gefestigten Wettbewerbsposition als Hub-Flughafen sowie die zunehmende<br />
Bedeutung des kommerziellen Bereiches schaffen darüber hinaus starke Anreize, den<br />
Preissetzungsspielraum im Aviation-Bereich nicht übermäßig auszunutzen. Dennoch<br />
ist ein möglicher Wohlfahrtsverlust bei Ausnutzung <strong>der</strong> Marktmacht in diesem<br />
Segment als so groß einzuschätzen, dass eine <strong>Re</strong>gulierung des Angebotsverhaltens in<br />
Betracht gezogen werden sollte.<br />
• Sek<strong>und</strong>ärflughäfen wie Düsseldorf, Hamburg <strong>und</strong> Stuttgart besitzen insbeson<strong>der</strong>e im<br />
Bereich des europäischen Geschäftsreiseverkehrs bedeutende Marktmacht. Einige<br />
Flughäfen wie Düsseldorf <strong>und</strong> Köln/Bonn stehen aufgr<strong>und</strong> ihrer geographischen Nähe<br />
im intramodalen Wettbewerb. Die Komplementarität mit dem kommerziellen Bereich<br />
reduziert zwar mögliche Wohlfahrtsverluste, insgesamt können diese aber doch so<br />
66
groß sein, dass eine <strong>Re</strong>gulierung des Angebotsverhaltens dennoch in Betracht gezogen<br />
werden sollte.<br />
• Tertiärflughäfen, <strong>der</strong>en Marktmacht vornehmlich auf noch nicht ausgeschöpften<br />
Skalenerträgen beruht, sind inter- <strong>und</strong> verstärkt intramodaler Substitutionskonkurrenz<br />
ausgesetzt. Durch den möglichen Eintritt von Quartiärflughäfen in den Markt werden<br />
diese Flughäfen in Zukunft zusätzlich diszipliniert. Unter Berücksichtigung des relativ<br />
starken Marktmachtgegengewichts <strong>der</strong> dominanten Charter- <strong>und</strong> Low-Cost-<br />
Fluggesellschaften bzw. <strong>der</strong> Lufthansa als oft einziger Netzwerkfluggesellschaft ist ein<br />
Ausnutzen von Marktmacht nur eingeschränkt zu erwarten. Eine <strong>Re</strong>gulierung ist daher<br />
nur in seltenen Fällen erfor<strong>der</strong>lich.<br />
Korporatistische <strong>Re</strong>gulierung für Primär- <strong>und</strong> Sek<strong>und</strong>ärflughäfen<br />
Primär- als auch Sek<strong>und</strong>ärflughäfen sollten einem <strong>Re</strong>gulierungssystem <strong>unter</strong>worfen werden,<br />
das korporatistische Ansätze integriert. Eine neu zu schaffende, zunächst sektorspezifische<br />
<strong>und</strong> unabhängige <strong>Re</strong>gulierungsbehörde <strong>Re</strong>gFH auf B<strong>und</strong>esebene entwickelt dafür einen<br />
Rahmen, innerhalb dessen einzelne Flughäfen <strong>und</strong> dort ansässige Fluggesellschaften<br />
marktinterne Lösungen vereinbaren. Diese <strong>Re</strong>gFH würde größeres Fachwissen als die bisher<br />
zuständigen Landesbehörden vereinen <strong>und</strong> insgesamt einen geringeren Personalbestand<br />
erfor<strong>der</strong>n. Bei Ausbau <strong>der</strong> <strong>Re</strong>gTP zu einer <strong>Re</strong>gulierungsbehörde für Netzsektoren sollte die<br />
<strong>Re</strong>gFH in diese integriert werden.<br />
Als <strong>Re</strong>gulierungsandrohung <strong>und</strong> gleichzeitig Ausgangsbasis für Verhandlungen <strong>der</strong><br />
Marktteilnehmer dient ein subsidiärer, staatlicher <strong>Re</strong>gulierungseingriff. Dieser sollte<br />
entsprechend einer Price-Cap-<strong>Re</strong>gulierung mit Dual-Till-Ansatz entwickelt werden, die eine<br />
Qualitätskontrolle, die Möglichkeit separater Investitionsvereinbarungen, die Anwendung<br />
eines Tariff-Baskets sowie eine gerechte Risikoaufteilung externer Einflüsse, z.B. mittels<br />
einer symmetrischen Sliding-Scale, implementiert.<br />
Um die Transparenz des <strong>Re</strong>gulierungssystems <strong>und</strong> die Vergleichbarkeit zwischen den<br />
Flughäfen insgesamt zu erhöhen, sollten die Betreiber dazu verpflichtet werden, bestimmte<br />
Standards zur Kontoführung <strong>und</strong> regelmäßigen Veröffentlichung von Unternehmensdaten<br />
einzuhalten. Damit ließe sich relativ unkompliziert ein Benchmarking-System<br />
implementieren, womit auch die Effekte einer <strong>Re</strong>-<strong>Re</strong>gulierung im Zeitverlauf besser<br />
dokumentiert <strong>und</strong> bewertet werden können.<br />
Ex-Post <strong>Re</strong>gulierung für Tertiärflughäfen<br />
Für den Großteil <strong>der</strong> <strong>deutschen</strong> Tertiärflughäfen stellt ein Monitoring-Modell nach dem<br />
Vorbild Australiens ein geeignetes <strong>Re</strong>gulierungssystem dar, wobei die ex-post<br />
Angebotskontrolle auf den Aviation-Bereich beschränkt bleibt. <strong>Re</strong>geln zur Kontoführung <strong>und</strong><br />
Verpflichtungen zur Veröffentlichung von Unternehmensdaten wie bei den Primär- <strong>und</strong><br />
Sek<strong>und</strong>ärflughäfen vereinfachen die Arbeit <strong>der</strong> <strong>Re</strong>gulierungsbehörde. Bei Bedarf können<br />
einzelne Flughäfen in eine korporatistische <strong>Re</strong>gulierung einbezogen werden.<br />
67
Weitere Fragen <strong>der</strong> <strong>Re</strong>gulierung <strong>und</strong> Slotallokation<br />
Die <strong>Re</strong>gulierungspraxis <strong>der</strong> korporatistischen <strong>Re</strong>gulierung <strong>und</strong> des Monitoring sind in<br />
regelmäßigen Abschnitten kritisch auf ihre Zielerreichung hin zu überprüfen..<br />
Die Problembereiche <strong>der</strong> Flughafenregulierung <strong>und</strong> <strong>der</strong> Allokation <strong>der</strong> Slots werden bei <strong>der</strong><br />
vorgeschlagenen Lösung gr<strong>und</strong>sätzlich getrennt angegangen. Es ist allerdings dringend<br />
erfor<strong>der</strong>lich, ein Slothandelsystem einzuführen.<br />
Horizontale Integration<br />
Begrenzt vorhandene Marktmacht <strong>und</strong> Interessenkongruenzen zwischen Flughäfen <strong>und</strong><br />
Fluggesellschaften sind wichtige Bedingungen für die Vorteilhaftigkeit einer<br />
korporatistischen <strong>Re</strong>gulierung. Unter dieser Voraussetzung sind Kapitalverflechtungen von<br />
Flughäfen im selben Marktsegment mit stark überlappenden Einzugsgebieten, wie z.B. die<br />
Flughäfen in Düsseldorf, Köln/Bonn <strong>und</strong> Dortm<strong>und</strong>, als kritisch zu bewerten <strong>und</strong> sollten<br />
daher starken Einschränkungen <strong>unter</strong>liegen <strong>und</strong> i.d.R. nicht genehmigt werden.<br />
8.2 Schlussfolgerungen <strong>und</strong> Ausblick<br />
In Deutschland besteht die Notwendigkeit einer Neuausrichtung <strong>der</strong> Flughafenpolitik <strong>und</strong><br />
einer <strong>Privatisierung</strong> <strong>und</strong> <strong>Re</strong>-<strong>Re</strong>gulierung <strong>der</strong> Flughäfen, um Effizienzsteigerungen zu<br />
bewirken. Erfahrungen mit <strong>der</strong> <strong>Privatisierung</strong> <strong>und</strong> <strong>Re</strong>gulierung in an<strong>der</strong>en Sektoren (wie z.B.<br />
im Energiesektor o<strong>der</strong> im privaten Fernstraßenbau) weisen darauf hin, dass dem Problem <strong>der</strong><br />
<strong>Re</strong>gulierung in Deutschland verstärkt Beachtung geschenkt werden sollte. Hier können die<br />
<strong>Re</strong>gulierungskonzepte Großbritanniens, Neuseelands <strong>und</strong> Australiens als Vorbild dienen.<br />
Die in diesem Beitrag erzielten Ergebnisse sind als Ausgangspunkt für eine Neuorientierung<br />
<strong>der</strong> Flughafenpolitik in Deutschland gedacht. Die Vorschläge bedürfen noch weiterer<br />
vertiefter Überlegungen; insbeson<strong>der</strong>e müssen noch juristische Aspekte verstärkt<br />
berücksichtigt <strong>und</strong> Detailfragen des <strong>Re</strong>gulierungssystems geklärt werden. Ein wichtiges<br />
Ergebnis <strong>der</strong> Untersuchung ist, dass aufgr<strong>und</strong> <strong>der</strong> begrenzten Marktmacht <strong>der</strong> Flughäfen,<br />
verschiedener Interessenkongruenzen <strong>der</strong> Beteiligten <strong>und</strong> sektoraler Beson<strong>der</strong>heiten durch<br />
eine korporatistische <strong>Re</strong>gulierung – im Gegensatz zum Energiesektor – eine<br />
gesamtwirtschaftlich vorteilhafte Lösung erreicht werden kann.<br />
68
Danksagungen<br />
Wir danken Achim I. Czerny für wichtige inhaltlich Hinweise sowie Claudia Eich <strong>und</strong> Berit<br />
Meinhart für die Hilfe bei <strong>der</strong> redaktionellen Bearbeitung des Textes. Weiterhin danken wir<br />
unseren Gesprächspartnern aus <strong>der</strong> „Praxis“, die uns viele nützliche Informationen <strong>und</strong><br />
Anregungen gegeben haben.<br />
69
Tabellen-, Abbildungs- <strong>und</strong> Literaturverzeichnis<br />
Tabellenverzeichnis<br />
Tabelle 1: Eigentümerstruktur <strong>der</strong> <strong>deutschen</strong> internationalen Verkehrsflughäfen................... 11<br />
Tabelle 2: Möglichkeiten zur Preisdifferenzierung auf Flughäfen .......................................... 29<br />
Tabelle 3: Alternativen zur Allokation von Slots in Verbindung mit einer <strong>Re</strong>gulierung sowie<br />
bei einem Verzicht auf eine <strong>Re</strong>gulierung......................................................................... 40<br />
Tabelle 4: Wirkungsvergleich Price-Cap-<strong>Re</strong>gulierung <strong>und</strong> Kostenzuschlagsregulierung....... 45<br />
Abbildungsverzeichnis<br />
Abbildung 1: System Flughafen: Leistungsbereiche <strong>und</strong> Vertragsbeziehungen ....................... 7<br />
Abbildung 2: Vertragsbeziehungen <strong>der</strong> Beteiligten des Systems Flughafen nach<br />
Leistungsbereichen............................................................................................................. 8<br />
Abbildung 3: Durchschnittskosten von Flughäfen................................................................... 23<br />
Abbildung 4: Marktmacht deutscher Verkehrsflughäfen......................................................... 38<br />
Abbildung 5: <strong>Re</strong>gulierungstendenzen in Großbritannien, Neuseeland <strong>und</strong> Australien ........... 87
Literaturverzeichnis<br />
[1] ACCC, 2001a, Access to Airport Services – Supplementary Submission to the Productivity<br />
Commission`s Inquiry into Price <strong>Re</strong>gulation of Airport Services (abgerufen<br />
am 12.05.2003 <strong>unter</strong> URL: www.pc.gov.au/inquiry/airports).<br />
[2] ACCC, 2001b, Price <strong>Re</strong>gulation of Airport Services– Supplementary Submission to<br />
the Productivity Commission`s Inquiry into Price <strong>Re</strong>gulation of Airport Services (abgerufen<br />
am 12.05.2003 <strong>unter</strong> URL: www.pc.gov.au/inquiry/airports).<br />
[3] ADV – Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen, 1997: Sicherung <strong>und</strong><br />
Optimierung des Luftverkehrsstandortes Deutschland.<br />
[4] ADV – Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen, 2001: Sicherung <strong>und</strong><br />
Optimierung des Luftverkehrsstandortes Deutschland.<br />
[5] ADV – Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen, 2003: Pressemitteilung<br />
Nr. 7 / 2003 (abgerufen am 03.08.2003 <strong>unter</strong> URL:<br />
www.adv-net.org/de/gfx/presse/pm_07_2003.php).<br />
[6] Airbus, 2002, Global Market Forecast 2001-2020 (abgerufen am 20.05.2003 <strong>unter</strong><br />
URL:<br />
ww.airbus.com/pdf/media/gmf2001.pdf).<br />
[7] BARIG – Board Of Airline <strong>Re</strong>presentatives In Germany, 2000, Pressemitteilung<br />
vom 30.03.2000 (abgerufen am .25.05.2003 <strong>unter</strong> URL:<br />
www.barig.org/Pressemitteilungen/dp000330.htm).<br />
[8] BARIG – Board Of Airline <strong>Re</strong>presentatives In Germany, 2002, Pressemitteilung<br />
vom 30.04.2002 (abgerufen am 25.05.2003 <strong>unter</strong> URL:<br />
www.barig.org/Pressemitteilungen/dp020430.htm).<br />
[9] Barrett, S. D., 2000, Airport competition in the <strong>der</strong>egulated European aviation market,<br />
Journal of Air Transport Management. 6 (1), S. 13-27.<br />
[10] Beckers, T. & Hirschhausen, Chr. von, 2003, <strong>Privatisierung</strong> <strong>der</strong> B<strong>und</strong>esautobahnen<br />
über Konzessionsmodelle – Alternative Konzepte, offene Fragen <strong>und</strong><br />
wirtschaftspolitische Schlussfolgerungen, Arbeitspapier zu einem Vortrag auf den<br />
19. Verkehrswissenschaftlichen tagen am 22.09.2003 an <strong>der</strong> Technischen Universität<br />
Dresden.<br />
[11] Beckers, T. & Miksch, J, 2002, Die Allokation des Verkehrsmengenrisikos beim A-<br />
Modell, in: Festschrift - 75 Jahre Baubetrieb an <strong>der</strong> TU Berlin, herausgegeben von<br />
Kochendörfer, B., S. 23-38.<br />
[12] BMVBW, 2002, Flughafenkonzept <strong>der</strong> B<strong>und</strong>esregierung, August 2002, Digitalen<br />
Bibliothek <strong>der</strong> Friedrich Ebert Stiftung (abgerufen am 25.05.2003 <strong>unter</strong><br />
URL: library.fes.de/fulltext/fo-wirtschaft/01138002.htm).<br />
71
[13] Boeing, 2003, Current Market Outlook 2003 (abgerufen am 20.05.2003 <strong>unter</strong> URL:<br />
www.boeing.com/commercial/cmo/pdf/CMO2003.pdf).<br />
[14] Bradley, I. & C. Price, 1988, The economic regulation of private industries by price<br />
constraints, Journal of Industrial Economics, 37 (1), S. 99-106.<br />
[15] Baumol, W., J.C. Panzar, R.D. Willig, 1988, Contestable Markets and the Theory of<br />
Industry Strucrure (Hartcourt Brace Jovanovich, San Diego).<br />
[16] Brenck, A., 2001b, <strong>Re</strong>gulierungsverfahren (Skript zur Lehrveranstaltung „Staatliche<br />
<strong>Re</strong>gulierung“ im Sommersemester 2001 an <strong>der</strong> TU Berlin).<br />
[17] Brenck, A.& A. I. Czerny, 2001, Allokation von Slots bei unvollständiger<br />
Information, Arbeitspapier zu einem Vortrag auf den 19. Verkehrswissenschaftlichen<br />
Tagen am 17./18.09.2001 an <strong>der</strong> Technischen Universität Dresden.<br />
[18] Brunekreeft, G. & Neuscheler, T., 2003, Preisregulierung von Flughäfen, in:<br />
Zwischen <strong>Re</strong>gulierung <strong>und</strong> Wettbewerb – Netzsektoren in Deutschland,<br />
herausgegeben von Knieps, G. & Brunekreeft, G. (Physica-Verlag, Heidelberg), S.<br />
251-280.<br />
[19] Budau, E.-M., Institut für Städtebau <strong>und</strong> Landesplanung, Flughafensystem <strong>der</strong><br />
B<strong>und</strong>esrepublik Deutschland, 2002 (abgerufen am 20.05.2003 <strong>unter</strong> URL:<br />
www.isl.unikarlsruhe.de/module/flugverkehr/flughafensystem/flughafensystem.html).<br />
[20] Bunse, T., 2003, Deutsche Lufthansa AG, Luftverkehrsstandort Berlin – Strategische<br />
<strong>und</strong> regulatorische Aspekte, Vortrag am 24.06.2003 in Berlin.<br />
[21] CAA, 2001a, Competitive Provision of Infrastructure and Services Within Airports<br />
(abgerufen am 12.06.2003 <strong>unter</strong> URL: www.caa.co.uk/publications).<br />
[22] CAA, 2001b, Direct Contracting Between Airports and Users: A Default Price Cap<br />
(abgerufen am 12.06.2003 <strong>unter</strong> URL: www.caa.co.uk/publications).<br />
[23] CAA, 2001c, Pricing Structures and Economic <strong>Re</strong>gulation (abgerufen am 12.06.2003<br />
<strong>unter</strong> URL: www.caa.co.uk/publications).<br />
[24] CAA, 2003a, Economic <strong>Re</strong>gulation of BAA London Airports (Heathrow, Gatwick<br />
and Stansted) 2003 – 2008 CAA Decision February 2003 (abgerufen am 12.06.2003<br />
<strong>unter</strong> URL: www.caa.co.uk/publications).<br />
[25] CAA, 2003b, UK Airport Statistics 2002 – Annual (abgerufen am 12.06.2003 <strong>unter</strong><br />
URL: www.caa.co.uk/erg/erg_stats).<br />
[26] Dennis, Nigel, 1998, Competition between Hub Airports In Europe and A Methodology<br />
for Forecasting Connecting Traffic, 8 th WCTR Proceedings, Volume 1, S.239–<br />
252.<br />
[27] Doganis, R. S., 1992, The Airport Business, (Routledge, London).<br />
72
[28] Doganis, R.S., A. Graham <strong>und</strong> A. Lobbenberg, 1995, The Economic Performance of<br />
European Airports, <strong>Re</strong>search <strong>Re</strong>port 3, Department of Air Transport, Cranfield University,<br />
Bedford, England.<br />
[29] Engel, C., 2002, Verhandelter Netzzugang, Max-Planck-Projektgruppe, <strong>Re</strong>cht <strong>der</strong><br />
Gemeinschaftsgüter, Bonn. (e-print: www.mpp-rdg.mpg.de/pdf_dat-2002_4.pdf).<br />
[30] Ewers, H.-J., Brenck, A., Czerny, A. et al., 2001, Möglichkeiten <strong>der</strong> besseren<br />
Nutzung von Zeitnischen auf Flughäfen (Slots) in Deutschland <strong>und</strong> <strong>der</strong> EU,<br />
Technische Universität Berlin, Fachgebiet für Wirtschafts- <strong>und</strong> Infrastrukturpolitik.<br />
[31] FAZ – Frankfurter Allgemeine Zeitung, 2003, In <strong>der</strong> EU beginnt <strong>der</strong> Abschied von<br />
den Energiemonopolen, 05.06.2003, Nr. 129 / S. 13.<br />
[32] Feess, E., 2002, Ökonomische Analyse <strong>unter</strong>schiedlicher Verfahren <strong>der</strong> Vergabe von<br />
Zeitnischen auf Flughäfen, Gutachten vom 19. Februar 2002, RWTH Aachen.<br />
[33] Flughafen Düsseldorf, 2001, Geschäftsbericht 2000, Flughafen Düsseldorf GmbH.<br />
[34] Flughafen Düsseldorf, 2003, Beteiligungen des Unternehmens (abgerufen am<br />
20.05.2003 <strong>unter</strong> URL: www.duesseldorf-international.de).<br />
[35] Flughafen Hamburg 2002, Geschäftsbericht 2001, Flughafen Hamburg GmbH 2001.<br />
[36] Flughafen Stuttgart, 2003, Statistischer Jahresbericht 2002, Flughafen Stuttgart<br />
GmbH.<br />
[37] Forsyth, P., 1999, <strong>Re</strong>gulating Access to Airport Facilities, (Air Transport <strong>Re</strong>search<br />
Group Conference, City University Hong Kong, 6. Juni 1999).<br />
[38] Forsyth, P., 2001 Airport Price <strong>Re</strong>gulation: Rationales, Issues and Directions for <strong>Re</strong>form<br />
– Submission to the Productivity Commission’s Inquiry into Price <strong>Re</strong>gulation<br />
of Airport Services (abrufbar <strong>unter</strong> URL: http://www.pc.gov.au/inquiry/airports).<br />
[39] Forsyth, P., 2002, Privatization and regulation of Australian and New Zealand airports,<br />
Journal of Air Transport Management. 8 (1), S. 19-28.<br />
[40] Forsyth, P., 2003a, <strong>Re</strong>gulation <strong>und</strong>er Stress: Developments in Australian Airport Policy,<br />
Journal of Air Transport Management. 9 (1), S. 25-35.<br />
[41] Forsyth, P., 2003b (forthcoming), <strong>Re</strong>placing <strong>Re</strong>gulation: Airport Price Monitoring in<br />
Australia in: The Economic <strong>Re</strong>gulation of Airports, herausgegeben von Gillen, D.<br />
W., Forsyth, P., Knorr, A., Mayer, O. G., Niemeier, H.-M. & Starkie, D. (Ashgate,<br />
Al<strong>der</strong>shot, Hampshire).<br />
[42] Fraport AG 2003, Flughafenentgelte 2003 (abgerufen am 20.05.2003 <strong>unter</strong> URL:<br />
http://www.fraport.de/online/bereiche/de/jsp/vtm_flughafenentgelte.jsp).<br />
[43] Fritsch, M., T. Wein, H.-J. Ewers, 2003, Marktversagen <strong>und</strong> Wirtschaftspolitik:<br />
Mikroökonomische Gr<strong>und</strong>lagen staatlichen Handelns (Vahlen, München, 5.<br />
Auflage).<br />
73
[44] FTD – Financial Times Deutschland, 2003, Matthias Kurth: Marktkontrolleur mit<br />
Scheu vor Konflikten, 11.08.2003.<br />
[45] Graham, A., 2001, Managing Airports – An International Perspective (Butterworth-<br />
Heinemann, Oxford).<br />
[46] Grande, E. & B. Eberlein, 1999, Der Aufstieg des <strong>Re</strong>gulierungsstaates im<br />
Infrastrukturbereich – Zur Transformation <strong>der</strong> politischen Ökonomie <strong>der</strong><br />
B<strong>und</strong>esrepublik Deutschland, in Von <strong>der</strong> Bonner zur Berliner <strong>Re</strong>publik. 10 Jahre<br />
deutsche Einheit, Leviathan-Son<strong>der</strong>heft 19, herausgegeben von R. Czada & H.<br />
Wollmann (Westdeutscher Verlag, Wiesbaden), S. 631–650.<br />
[47] Hirschhausen, Chr. von, T. Beckers, H. Tegner, 2002, PPI in Germany – The Gradual<br />
Awakening; Infrastructure Journal, June 2002, S. 48-55.<br />
[48] Holzschnei<strong>der</strong>, M., 2003, Flughäfen im Wettbewerb, Internationales Verkehrswesen<br />
(55) 7+8/2003, 329-333.<br />
[49] IATA – International Air Transport Association. 2000. World Air Transport Statistics,<br />
Edition 45.<br />
[50] King, S. P., 2001, Market Power and Airports – Supplementary Submission to the<br />
Productivity Commission`s Inquiry into Price <strong>Re</strong>gulation of Airport Services.<br />
[51] Kunz, M., 1999, Entbündelter Zugang zu Flughäfen: Zur Liberalisierung <strong>der</strong> Bodenverkehrsdienste<br />
auf europäischen Flughäfen, in: Zeitschrift für Verkehrswissenschaft,<br />
70, 1999, Heft 3, S. 206-232.<br />
[52] Laffont, J.-J. & J. Tirole., 2000, Competition in Telecommunications (MIT Press<br />
Cambridge, Massachusetts).<br />
[53] Levy, B. & P. Spiller, 1998, <strong>Re</strong>gulation, Institutions and Commitment in Telecommunications:<br />
A Comparative Study of Five Country Studies (Cambridge University<br />
Press, Cambridge, Massachusetts).<br />
[54] Lopez-Calva, Luis Felipe, 1998, On Privatization Methods (Devlopment Discussion<br />
Paper No. 665, Harvard Institute for International Development, Cambridge, Massachusetts).<br />
[55] Ministry of Commerce, 2003, Pressemitteilung vom 23. Mai 2003 (abgerufen am<br />
12.06.2003 <strong>unter</strong> URL: www.med.govt.nz/buslt/bus_pol/airports/index.html).<br />
[56] Monopolkommission, 2000/2001, Netzwettbewerb durch <strong>Re</strong>gulierung – Vierzehntes<br />
Hauptgutachten <strong>der</strong> Monopolkommission, Kurzfassung (abgerufen am 20.05.2003<br />
<strong>unter</strong> URL: www.monopolkommission.de/haupt_14/sum_h14.pdf).<br />
[57] Niemeier, H.-M. & H. Wolf, 2002, Strategische Allianzen zwischen Flughäfen –<br />
notwendiges Gegengewicht zur Blockbildung <strong>der</strong> Fluggesellschaften?, Schriftenreihe<br />
<strong>der</strong> DVWG, B246. S. 187-215.<br />
74
[58] Niemeier, H.-M., 2002, <strong>Re</strong>gulation of airports: the case of Hamburg airport – a view<br />
from the perspective of regional policy, Journal of Air Transport Management. 8 (1),<br />
S. 37-48.<br />
[59] Pels, E., 2000, Airport Economics and Policy Efficiency, Competition and Interaction<br />
with Airlines (Tinbergen <strong>Re</strong>search Series 222, Vrije Universiteit Amsterdam,<br />
Nie<strong>der</strong>lande).<br />
[60] Productivity Commission, 2002, Price <strong>Re</strong>gulation of Airport Services (<strong>Re</strong>port no. 19,<br />
Aisinfo, Canberra, (abgerufen am 12.05.2003 <strong>unter</strong> URL: http://<br />
www.pc.gov.au/inquiry/airports).<br />
[61] Rolshausen, R.-D., 2002, Fraport AG, Neue Wege <strong>und</strong> Erfahrungen – Das Beispiel<br />
Frankfurt, Zur Entgeltregulierung von Flughäfen in Deutschland – Erfahrungen,<br />
Optionen – <strong>Re</strong>formnotwendigkeiten?, Unterlagen zu einem Vortrag auf Tagung des<br />
DLR <strong>und</strong> des Deutschen Verkehrsforum vom 8./9.10.2002 im BMVBW in Berlin.<br />
[62] Schernus, M., 2002, Flughafen Hamburg GmbH, Neue Wege <strong>und</strong> Erfahrungen – Das<br />
Beispiel Hamburg, Zur Entgeltregulierung von Flughäfen in Deutschland –<br />
Erfahrungen, Optionen – <strong>Re</strong>formnotwendigkeiten?, Unterlagen zu einem Vortrag auf<br />
Tagung des DLR <strong>und</strong> des Deutschen Verkehrsforum vom 8./9.10.2002 im BMVBW<br />
in Berlin.<br />
[63] Shleifer, A. & R. Vishny, 1996, A Theory of Privatization, Economic Journal.<br />
[64] (Stadt Hamburg 2000, Pressemitteilung vom 18.07.2000, Staatliche Pressestelle <strong>der</strong><br />
Stadt Hamburg, abgerufen am 12.06.2003 <strong>unter</strong> URL:<br />
www.hamburg.de/Behoerden/Pressestelle/Meldungen/tagesmeldungen/2000/juli/w29<br />
/di/news.htm).<br />
[65] Starkie, D., 2001, <strong>Re</strong>forming UK Airports, Journal of Transport Economics, 35 (1),<br />
S. 119-135.<br />
[66] Starkie, D., 2002, Airport regulation and competition, Journal of Air transport Management,<br />
8 (1), S. 63-72.<br />
[67] Toms, M., 2003 (forthcoming), UK – <strong>Re</strong>gulating from the Perspective of British<br />
Airport Authority, in: The Economic <strong>Re</strong>gulation of Airports, herausgegeben von Gillen,<br />
D. W., Forsyth, P., Knorr, A., Mayer, O. G., Niemeier, H.-M. & Starkie, D.<br />
(Ashgate, Al<strong>der</strong>shot, Hampshire).<br />
[68] Vickers, J., Yarrow, G., 1991, Economic perspectives on privatization, Journal of<br />
Economic Perspectives, 5 (2), S. 111-132.<br />
[69] Wolf, H., 1997, Gr<strong>und</strong>satzfragen einer Flughafenprivatisierung, in Deutschland –<br />
Gutachten im Auftrag des B<strong>und</strong>esministeriums für Finanzen (Institut für<br />
Weltwirtschaft an <strong>der</strong> Universität Kiel – Abteilung Raumwirtschaft <strong>und</strong><br />
Infrastruktur, Kiel).<br />
75
[70] Wolf, H., 2003 (forthcoming), Airport privatisation and <strong>Re</strong>gulation, in: The Economic<br />
<strong>Re</strong>gulation of Airports, herausgegeben von Gillen, D. W., Forsyth, P., Knorr,<br />
A., Mayer, O. G., Niemeier, H.-M. & Starkie, D. (Ashgate, Al<strong>der</strong>shot, Hampshire).<br />
[71] Zhang, A., Zhang, Y., 1997, Concession <strong>Re</strong>venue and Optimal Airport Pricing,<br />
Transportation <strong>Re</strong>search, 33 (4), S. 287-296.<br />
76
Anhang: Internationale Erfahrungen mit <strong>der</strong> <strong>Privatisierung</strong> <strong>und</strong><br />
<strong>Re</strong>gulierung von Flughäfen<br />
A.1) Großbritannien<br />
A.1.1) Der Flughafenmarkt im Überblick<br />
Zwei wirtschaftsgeographisch bedingte Beson<strong>der</strong>heiten prägen die Strukturen des britischen<br />
Flughafenmarktes. Zum einen besitzt <strong>der</strong> Flugverkehr aufgr<strong>und</strong> <strong>der</strong> Insellage Großbritanniens<br />
seit jeher eine hohe Bedeutung für die nationale Verkehrsanbindung, was zur Entwicklung<br />
eines dichten, landesweit verteilten Flughafennetzes führte. Zum an<strong>der</strong>en ist die<br />
Wirtschaftsstruktur des Landes durch eine starke Konzentration auf den Großraum London<br />
gekennzeichnet. Trotz einiger Tendenzen zur Dezentralisierung erbringen die drei Londoner<br />
Flughäfen Heathrow, Gatwick <strong>und</strong> Stansted noch heute 65% des internationalen<br />
Luftverkehrsaufkommens von <strong>und</strong> nach Großbritannien (CAA 2003b). Die Konzentration<br />
setzt sich in den Eigentumsstrukturen <strong>der</strong> Flughafen<strong>unter</strong>nehmen fort. So wurde die British<br />
Airport Authority (BAA) 1966 als unabhängiges, öffentliches aber gewinnorientiertes<br />
Unternehmen gegründet, um die drei zuvor genannten Londoner sowie einen Flughäfen in<br />
Schottland (Prestwick) zu betreiben. In <strong>der</strong> Zeit von 1966 bis 1987 erwarb die<br />
Flughafenholding zusätzlich noch drei weitere schottische Flughäfen (Edinburgh 1971,<br />
Aberdeen <strong>und</strong> Glasgow 1975) <strong>und</strong> besaß in Schottland damit einen Marktanteil von nahezu<br />
90%. Insgesamt stellte die BAA bereits zu Beginn <strong>der</strong> 80er Jahre das dominierende<br />
Flughafen<strong>unter</strong>nehmen im Vereinigten Königreich dar (Productivity Commission, S. 411).<br />
A.1.2) <strong>Privatisierung</strong><br />
Vollprivatisierung <strong>der</strong> BAA über ein IPO<br />
Nachdem die konservative <strong>Re</strong>gierung <strong>unter</strong> Margaret Thatcher 1982 einen Politikwechsel in<br />
Großbritannien einleitete <strong>und</strong> sich für eine gr<strong>und</strong>legende Liberalisierung <strong>der</strong> Wirtschaft<br />
aussprach, folgte mit <strong>der</strong> Verabschiedung des „Airports Act“ 1986 <strong>der</strong> erste Schritt in<br />
Richtung einer <strong>Privatisierung</strong> <strong>der</strong> britischen Flughäfen. Daraufhin wurde die BAA noch im<br />
selben Jahr in eine private Aktiengesellschaft (BAA plc.) umgewandelt <strong>und</strong> 1987 durch einen<br />
Börsengang (IPO) materiell privatisiert. Damit war sie das erste börsennotierte<br />
Flughafen<strong>unter</strong>nehmen <strong>der</strong> Welt. Durch die Ausgabe von 500 Millionen Aktien erzielte die<br />
britische <strong>Re</strong>gierung einen <strong>Privatisierung</strong>serlös von 1,2 Mrd. £, behielt aber zunächst eine mit<br />
beson<strong>der</strong>en Stimmrechten ausgestattete Aktie („Golden Share“), die v.a. eine feindliche<br />
Übernahme verhin<strong>der</strong>n sollte. Die BAA stellt inzwischen aufgr<strong>und</strong> ihres Fachwissens <strong>und</strong> <strong>der</strong><br />
finanziellen Stärke selbst einen bedeutenden strategischen Investor dar <strong>und</strong> hat selber<br />
Beteiligungen an internationalen Flughäfen erworben.<br />
(Teil-) <strong>Privatisierung</strong> <strong>der</strong> an<strong>der</strong>en <strong>und</strong> kleineren Flughäfen<br />
Der „Airports Act“ verpflichtete darüber hinaus die regionalen Gebietskörperschaften, ihre<br />
Anteile an den Flughäfen mit einem Umsatz von mehr als 1 Mio. £ pro Jahr entwe<strong>der</strong> an<br />
private Investoren zu verkaufen o<strong>der</strong> zumindest formell zu privatisieren. Da dies jedoch nicht<br />
zur erhofften <strong>Privatisierung</strong>swelle führte, erhöhte die <strong>Re</strong>gierung Anfang <strong>der</strong> 90er Jahre ihren<br />
Druck auf die öffentlichen Eigentümer, indem sie die Subventionen drastisch zurückfuhr <strong>und</strong><br />
gleichzeitig die Möglichkeit zur <strong>Re</strong>finanzierung am privaten Kapitalmarkt auf die<br />
Flughafen<strong>unter</strong>nehmen beschränkte, die einen Mindestanteil privater Eigentümer von 50%<br />
nachweisen konnten (Wolf, 1997, S. 137). Zwei Drittel <strong>der</strong> regulierten Flughäfen (s.u.) sind
seither nicht selten erst aufgr<strong>und</strong> dieser finanziellen Zwangslage materiell privatisiert worden.<br />
Im April 1999 erfolgte nach dem <strong>Re</strong>gierungswechsel eine Rücknahme <strong>der</strong> bisherigen<br />
<strong>Re</strong>gelung. Den größeren profitablen Flughäfen, die sich nach wie vor in staatlichem Besitz<br />
befanden, wie Manchester, Newcastle, Leeds-Bradford <strong>und</strong> Norwich war es wie<strong>der</strong> gestattet,<br />
zur Kapitalaufnahme den offenen Kapitalmarkt zu nutzen. Dies ermöglichte z.B. Manchester,<br />
83% <strong>der</strong> Anteile am nahe gelegenen Humberside International Airport zu erwerben. Während<br />
viele <strong>der</strong> großen regionalen Flughäfen mit einem Umsatz über 1 Mio. £ mittlerweile private<br />
Eigentümer haben, blieben die meisten <strong>der</strong> kleineren Flughäfen auf regionaler Ebene in<br />
öffentlicher Hand (Graham 2001, S. 31).<br />
A.1.3) <strong>Re</strong>gulierung<br />
Berichtspflicht gegenüber <strong>der</strong> sektorbezogenen, landesweit tätigen CAA<br />
Mit <strong>der</strong> forcierten materiellen <strong>Privatisierung</strong> verlor <strong>der</strong> Staat seine bisherigen<br />
Einflussmöglichkeiten, das Angebotsverhalten <strong>der</strong> Flughäfen direkt zu steuern. Daher wurde<br />
mit Verabschiedung des Airports Acts 1986 gleichzeitig auch ein neuer <strong>Re</strong>gulierungsrahmen<br />
festgelegt. Der sektor-spezifischen <strong>Re</strong>gulierungsinstanz Civil Aviation Authority (CAA)<br />
wurde darin die Aufgabe übertragen, die Interessen <strong>der</strong> Flughafennutzer zu <strong>unter</strong>stützen,<br />
einen effizienten, wirtschaftlichen <strong>und</strong> profitablen Betrieb <strong>der</strong> Flughäfen zu gewährleisten <strong>und</strong><br />
Investitionsanreize für neue Kapazitäten zu geben, wenn die Nachfrage dies erfor<strong>der</strong>t. Alle<br />
Flughafen<strong>unter</strong>nehmen mit einem Umsatz von mehr als 1 Mio. £ pro Jahr <strong>unter</strong>liegen dem<br />
Gesetz nach einer <strong>Re</strong>gulierung durch die CAA (Wolf, 1997, S. 140ff.). Sie vergibt auf Antrag<br />
eine Angebotslizenz für den kommerziellen Flughafenbetrieb, <strong>der</strong>en Erteilung sie an<br />
bestimmte Auflagen wie <strong>der</strong> Einhaltung technischer Standards knüpfen kann. Darüber hinaus<br />
müssen die Unternehmen einer beson<strong>der</strong>en Berichtspflicht nachkommen, die neben <strong>der</strong><br />
Angabe wichtiger Geschäftsdaten wie Bilanzen <strong>und</strong> geplanter Preisverän<strong>der</strong>ungen vorsieht,<br />
die Gesamtkosten nach verkehrsbezogenen <strong>und</strong> kommerziellen Aktivitäten aufzuschlüsseln.<br />
Derzeit besitzen 47 Flughäfen in Großbritannien eine solche Lizenz (Productivity<br />
Commission 2002, S. 412).<br />
Ex-ante Preisregulierung für ausgewählte Flughäfen<br />
Neben dieser light-handed <strong>Re</strong>gulierung können Flughafengesellschaften bei Verdacht auf<br />
ausgeprägte Marktmacht von <strong>der</strong> CAA ausgewählt (so genannte „Designierung“) <strong>und</strong> nach<br />
Zustimmung des Verkehrsministers einer speziellen ex-ante Preisregulierung <strong>unter</strong>worfen<br />
werden. Die Wettbewerbsbehörde (Competition Commission) <strong>unter</strong>sucht daraufhin<br />
fortwährend das Angebotsverhalten <strong>der</strong> für die Monopolkontrolle designierten Flughäfen <strong>und</strong><br />
kann von <strong>der</strong> CAA verlangen, auf ihre Vorschläge hin Maßnahmen zu ergreifen, die ein<br />
missbräuchliches Verhalten für die Zukunft verhin<strong>der</strong>n. Gleichzeitig besitzt sie die Aufgabe,<br />
regelmäßig die Ergebnisse <strong>der</strong> <strong>Re</strong>gulierung zu <strong>unter</strong>suchen, Entscheidungen <strong>der</strong> CAA zu<br />
bewerten <strong>und</strong> bei Streitigkeiten zwischen Flughafen <strong>und</strong> <strong>der</strong> <strong>Re</strong>gulierungsbehörde als<br />
Schlichter einzugreifen (Wolf, 1997, S. 141ff.). Für kleinere <strong>Re</strong>gionalflughäfen wird<br />
angenommen, dass ihre Marktmacht nicht ausreicht, um eine Preisregulierung zu<br />
rechtfertigen. Außerdem wird vermutet, dass bereits die drohende Designierung genügt, um<br />
die Betreiber zu disziplinieren. Ziel dieses <strong>Re</strong>gulierungssystems bei Einführung war es, die<br />
78
Anreizstrukturen des Marktes auf Seiten <strong>der</strong> privaten Eigentümer <strong>und</strong> Betreiber<br />
weitestgehend zu erhalten, während gleichzeitig ein Missbrauch ihrer Marktmacht möglichst<br />
<strong>unter</strong>b<strong>und</strong>en werden sollte. Daher wurde eine <strong>Re</strong>gulierungsmethode benötigt, die die aus<br />
allokativer Sicht ineffiziente Preisbildung nach <strong>der</strong> Cournot-<strong>Re</strong>gel verhin<strong>der</strong>t, aber parallel<br />
dazu den Flughafen<strong>unter</strong>nehmen genügend Anreize bieten würde, langfristig ihre produktive<br />
Effizienz zu steigern <strong>und</strong> innovativ tätig zu werden. Der von <strong>der</strong> CAA für die designierten<br />
Flughäfen Heathrow, Gatwick, Stansted <strong>und</strong> Manchester implementierte <strong>Re</strong>gulierungsrahmen<br />
orientierte sich an den Strukturen, die von Prof. Stephen Littlechild für die <strong>Re</strong>gulierung <strong>der</strong><br />
zwei großen, zuvor privatisierten Unternehmen im Telekommunikations- <strong>und</strong> Gassektor<br />
entwickelt worden war (British Telecoms – BT, British Gas – BG). In allen drei Fällen lag <strong>der</strong><br />
Schwerpunkt auf <strong>der</strong> Umsetzung einer „light-touch regulation“, die das regulierte<br />
Unternehmen nach <strong>der</strong> Festsetzung eines Preispfades gemäß <strong>der</strong> RPI-X <strong>Re</strong>gel alle fünf Jahre<br />
bis zum Ablauf <strong>der</strong> <strong>Re</strong>gulierungsperiode nahezu unbehelligt agieren lässt (Toms 2003, S. 1).<br />
Da die <strong>Re</strong>gierung sich im bilateralen Luftverkehrsabkommen mit den USA (Bermuda II) bis<br />
1991 zum Single-Till-Prinzip verpflichtet hatte, wurde im Gegensatz zu den beiden an<strong>der</strong>en<br />
Sektoren das Price-Cap bei Flughäfen zunächst als Single-Till eingeführt, das nach dem<br />
<strong>Re</strong>venue-Yield-Konzept ermittelt wird. Ein weiterer Bestandteil des Ordnungsrahmens neben<br />
<strong>der</strong> ex-ante <strong>Re</strong>gulierung kam durch die Errichtung eines Beschwerdesystems über<br />
wettbewerbswidriges Verhalten hinzu, das mit verbindlichen <strong>Re</strong>chtsfolgen für den<br />
betroffenen Flughafen verknüpft wurde. Die Wettbewerbsbehörde <strong>unter</strong>sucht regelmäßig das<br />
Angebotsverhalten. Jedoch besteht keine spezielle Marktzugangsregulierung für wesentliche<br />
Einrichtungen (Productivity Commission 2002, S. 415).<br />
Probleme bei <strong>der</strong> Price-Cap-<strong>Re</strong>gulierung, insbeson<strong>der</strong>e mit dem Single-Till-System<br />
Im Laufe von 15 Jahren seit Einführung des Price-Cap-Systems 1987 hat die CAA mehrfach<br />
die Effektivität ihrer praktizierten <strong>Re</strong>gulierung in Bezug auf ihre Zielvorgaben einer<br />
kritischen Überprüfung <strong>unter</strong>zogen. Dabei wurde festgestellt, dass die <strong>Re</strong>gulierung einige<br />
schwerwiegende Schwachstellen aufwies (CAA 2000):<br />
• Das <strong>Re</strong>gulierungssystem bot unzureichende Anreize für einen effizienten Ausbau <strong>der</strong><br />
Flughäfen (Unterinvestitionsproblem).<br />
• Das Single-Till-Prinzip führte zu ineffizient niedrigen Start- <strong>und</strong> Landegebühren an<br />
den kapazitätsbeschränkten Flughäfen Heathrow <strong>und</strong> Gatwick. Dieses ist durch<br />
falsche Anreizwirkungen von Detailregelungen des <strong>Re</strong>gulierungssystems bedingt.<br />
• Der <strong>Re</strong>venue–Yield-Ansatz schuf inadäquate Anreize, verstärkt in outputabhängige<br />
Aktivitäten zu investieren (Erhöhung <strong>der</strong> Passagierzahlen zur Verringerung des<br />
Durchschnittspreises).<br />
• Die Price-Cap-<strong>Re</strong>gulierung liefert Anreize zu ineffizienter Qualitätsreduzierung.<br />
Daraufhin wurden zum Teil bedeutende Anpassungen diskutiert <strong>und</strong> vorgeschlagen (CAA<br />
2001a, CAA 2001b):<br />
• Beschränkung <strong>der</strong> <strong>Re</strong>gulierungsbasis für das Price-Cap auf eindeutig monopolistische<br />
Flughafenaktivitäten durch Einführung des <strong>Re</strong>vised <strong>Re</strong>gulatory Cost Base (RRCB).<br />
79
• För<strong>der</strong>ung von Investitionsvereinbarungen für Kapazitätserweiterungen verb<strong>und</strong>en mit<br />
einer abgestimmten Lockerung des Price-Caps.<br />
• Ausweitung <strong>der</strong> <strong>Re</strong>gulierungsperiode in London auf künftig sechs Jahre zur<br />
Verstärkung <strong>der</strong> Investitionsanreize <strong>und</strong> <strong>der</strong> Anreize zur produktiven Effizienz.<br />
• För<strong>der</strong>ung von Preisdifferenzierungen durch marktinterne Verhandlungen (Default<br />
Price-Cap) <strong>und</strong> Übergang zum Tariff-Basket-Modell anstelle des <strong>Re</strong>venue-Yield.<br />
• Konzept zur Qualitätsüberwachung mit jährlichen K<strong>und</strong>enbefragungen durch<br />
unabhängige Marktforschungsinstitute.<br />
• Einbeziehung <strong>der</strong> Preise für Gepäcktransportinfrastruktur bei Transferpassagieren.<br />
Zu Beginn dieses Jahres flossen jedoch nur ein Teil dieser Än<strong>der</strong>ungsvorschläge in die neuen<br />
Price-Cap-Vorgaben für die vier designierten Flughäfen mit ein. Da sich die CAA mit ihren<br />
Vorstellungen zum Dual Till <strong>und</strong> Tariff Basket nicht gegen die Wettbewerbsbehörde <strong>und</strong> die<br />
Kritik <strong>der</strong> Nutzer durchsetzen konnte, entschied sie sich dafür, das bisherige Price-Cap-<br />
System mit Single-Till <strong>und</strong> <strong>Re</strong>venue-Yield-Ansatz für die preisregulierten Flughäfen bis<br />
voraussichtlich zum Ende <strong>der</strong> laufenden <strong>Re</strong>gulierungsperiode im März 2008 beizubehalten<br />
(CAA 2003a, S. 22f.). Die restlichen Flughäfen <strong>unter</strong>liegen auch in Zukunft nur einer lighthanded<br />
<strong>Re</strong>gulierung.<br />
A.1.4) Wettbewerbspolitik<br />
Ein neben <strong>der</strong> Preisregulierung immer wie<strong>der</strong> in die Diskussion gelangendes Thema ist die<br />
Aufspaltung <strong>der</strong> BAA. Bislang hat die CAA sich jedoch mehrfach gegen jede Kritik (Starkie<br />
1987) für die Beibehaltung <strong>der</strong> <strong>der</strong>zeitigen Eigentümerstruktur ausgesprochen mit <strong>der</strong><br />
Begründung, dass <strong>der</strong> Verlust von Synergieeffekten <strong>und</strong> <strong>der</strong> Anstieg <strong>der</strong> Transaktionskosten<br />
nicht durch den potenziellen Effizienzzuwachs aufgr<strong>und</strong> <strong>der</strong> freigesetzten<br />
Wettbewerbspotenziale zwischen den Londoner Flughäfen kompensiert werden würde (Toms<br />
2003, S. 3ff.).<br />
A.2) Neuseeland<br />
A.2.1) <strong>Privatisierung</strong><br />
Im Flughafensektor Neuseelands wurden die ersten Schritte in Richtung einer <strong>Privatisierung</strong><br />
bereits Ende <strong>der</strong> 1980er Jahre <strong>unter</strong>nommen, als die drei großen internationalen Flughäfen in<br />
Auckland, Wellington <strong>und</strong> Christchurch in eine privatrechtliche Unternehmensform überführt<br />
wurden <strong>und</strong> dem Management stärker gewinnorientierte Unternehmensziele gesetzt wurden<br />
(McKenzie-Williams 2003). Im Juli 1998 entschied sich <strong>der</strong> Staat, durch einen Börsengang<br />
seine Mehrheitsanteile am Flughafen Auckland zu veräußern <strong>und</strong> sie in Streubesitz übergehen<br />
zu lassen. R<strong>und</strong> 42% <strong>der</strong> ausgegebenen Aktien verblieben allerdings im Besitz <strong>der</strong> Stadt<br />
Auckland <strong>und</strong> einiger Nachbargemeinden. Kurz darauf erwarb ein vom ansässigen<br />
Bau<strong>unter</strong>nehmen Infrastructure & Utilities NZ Ltd. (Infratil NZ) angeführtes<br />
Bieterkonsortium die 2/3 Beteiligung <strong>der</strong> neuseeländischen <strong>Re</strong>gierung am Wellingtoner<br />
Flughafen. Die restlichen Anteile verblieben auch hier bei <strong>der</strong> Stadt. Im Gegensatz dazu blieb<br />
80
<strong>der</strong> Flughafen in Christchurch vollständig in öffentlichem Eigentum, wobei 75% <strong>der</strong> Anteile<br />
von <strong>der</strong> Stadt <strong>und</strong> <strong>der</strong> <strong>Re</strong>st vom Staat gehalten wurden.<br />
A.2.2) <strong>Re</strong>gulierung: Kein Abrücken von <strong>der</strong> Light-Handed <strong>Re</strong>gulation<br />
Das neuseeländische Modell <strong>der</strong> „Light-Handed <strong>Re</strong>gulation“<br />
Seit Mitte <strong>der</strong> 80er Jahre betreibt Neuseeland eine radikale Liberalisierung seiner Wirtschaft;<br />
gleichzeitig setzte man auf eine weitgehende Deregulierung <strong>der</strong> privatisierten Unternehmen.<br />
Das dabei angewandte Konzept <strong>der</strong> Beschränkung auf eine ex-post <strong>Re</strong>gulierung durch die<br />
Wettbewerbskommission wurde <strong>unter</strong> dem Begriff „light-handed regulation“ bekannt<br />
(Productivity Commission 2002, S. 423ff.). So war sich die <strong>Re</strong>gierung zu <strong>der</strong> Zeit als die<br />
Teilprivatisierungen in Auckland <strong>und</strong> Wellington vollzogen wurden, noch nicht über das Ob<br />
<strong>und</strong> Wie einer Preisregulierung für diese Flughäfen im Klaren. Im Mai 1998 beauftragte daher<br />
<strong>der</strong> damalige Wirtschaftsminister, John Luxton, die Wettbewerbsbehörde (Commerce<br />
Commission) mit <strong>der</strong> Aufgabe, eine detaillierte Kosten-Nutzen-Analyse über die<br />
Auswirkungen einer ex-ante Preisregulierung <strong>der</strong> Flughafenpreise zu erstellen, um eine<br />
abschließende Entscheidung zu diesem Thema treffen zu können. Der Bericht <strong>der</strong> Behörde<br />
wurde allerdings erst am 1. August 2002 veröffentlicht, um, wie es hieß, neueste<br />
Informationen mit in eine Beurteilung einfließen zu lassen. In <strong>der</strong> Zwischenzeit beschränkte<br />
man sich auch für die beiden privatisierten Flughäfen auf eine erst ex-post durchgeführte<br />
Qualitäts- <strong>und</strong> Preisüberwachung.<br />
Vorschlag zur Einführung einer Price-Cap-<strong>Re</strong>gulierung…<br />
Um zu entscheiden, ob die Einführung einer ex-ante <strong>Re</strong>gulierung notwendig o<strong>der</strong><br />
wünschenswert sei, <strong>unter</strong>suchte die Kommission das Preissetzungsverhalten <strong>der</strong> einzelnen<br />
Flughäfen im internationalen Vergleich <strong>unter</strong> Berücksichtigung neuester Maßstäbe zur<br />
Vermögensbewertung <strong>und</strong> Kapitalkostenabschätzung. Die Untersuchung ergab u.a., dass die<br />
Preise neuseeländischer Flughäfen im Vergleich zum Weltdurchschnitt zwar mo<strong>der</strong>at<br />
ausfielen, jedoch die höchsten im asiatisch-pazifischen Raum darstellten. Des Weiteren wurde<br />
ein Missverhältnis in <strong>der</strong> Profitabilität <strong>der</strong> Flughäfen, verglichen zu <strong>der</strong> Gewinnsituation <strong>der</strong><br />
auf ihnen operierenden Fluggesellschaften, festgestellt. Im internationalen Kontext fiel dieser<br />
<strong>Re</strong>ntabilitätsvergleich meist zugunsten <strong>der</strong> Luftverkehrsgesellschaften aus, was zum Teil auf<br />
eine strikte Preisregulierung bei den betrachteten Flughäfen zurückgeführt werden konnte.<br />
Dennoch nahm man an, dass <strong>der</strong> Konkurs von Air New Zealand Ende 2001 <strong>und</strong> die<br />
anschließende Übernahme durch den australischen Konkurrenten Quantas zumindest teilweise<br />
auf das hohe Preisniveau in Auckland <strong>und</strong> auf den beiden an<strong>der</strong>en Heimatflughäfen <strong>der</strong><br />
nationalen Fluggesellschaft zurückzuführen war (McKenzie-Williams 2003). Diese<br />
ermittelten Indizien legten insgesamt die Vermutung nahe, dass die Flughäfen in Neuseeland<br />
aufgr<strong>und</strong> des eingeschränkten Wettbewerbs auf dem Inselstaat über die Jahre hinweg<br />
Überrenditen erwirtschafteten.<br />
Die Untersuchungskommission empfahl daher, für den bedeutendsten Flughafen Auckland<br />
eine Price-Cap-<strong>Re</strong>gulierung mit einem Dual-Till-Ansatz zu implementieren. Für Wellington<br />
sollte keine ex-ante <strong>Re</strong>gulierung eingeführt werden – vorausgesetzt, dass die zu diesem<br />
Zeitpunkt noch nicht abgeschlossenen Verhandlungen mit den wichtigsten Fluggesellschaften<br />
81
nicht zu einem signifikanten Anstieg <strong>der</strong> Preise führen würden. Der Flughafen Christchurch<br />
sollte ebenfalls weiterhin nicht ex-ante reguliert werden.<br />
… wurde nach Durchführung einer Nutzen-Kosten-Analyse verworfen<br />
Aufgr<strong>und</strong> von Neuwahlen wurde eine endgültige Entscheidung durch das<br />
Wirtschaftsministerium auf die Zeit danach vertagt <strong>und</strong> den beteiligten Parteien erneut die<br />
Möglichkeit gegeben, sich zu dem Bericht zu äußern. Indes vollzog <strong>der</strong> Wellingtoner<br />
Flughafen eine 27,6 %ige Preiserhöhung Trotzdem <strong>und</strong> entgegen <strong>der</strong> Empfehlung <strong>der</strong><br />
Wettbewerbsbehörde verkündete die neu ins Amt gewählte Wirtschaftsministerin Lianne<br />
Dalziel am 23. Mai 2003 (Ministry of Commerce 2003), we<strong>der</strong> für die Flughäfen in<br />
Christchurch <strong>und</strong> Wellington noch für den Aucklan<strong>der</strong> Flughafen eine ex-ante<br />
Preisregulierung in Kraft zu setzen. Sie begründete ihre Entscheidung insbeson<strong>der</strong>e damit,<br />
dass die bei Einführung einer Preiskontrolle entstehenden Kostennachteile nicht durch die<br />
relativ geringen Nutzengewinne auf Seiten <strong>der</strong> Fluglinien <strong>und</strong> indirekt bei den Passagieren zu<br />
rechtfertigen seien. Für den Fall des Flughafens in Auckland ergäbe sich durch eine ex-ante<br />
Preisregulierung ein negativer Nettonutzen von -0,7 Mio. NZD, während <strong>der</strong> Nutzen für die<br />
Fluggesellschaften mit 1,7 Mio. NZD beziffert werden könnte, bedingt durch eine<br />
prognostizierte Preissenkung von 3,1 %. Vorausgesetzt, die Fluglinien würden diese<br />
<strong>Re</strong>duktion komplett auf die Passagiere umlegen, so würde das nur zu einer geschätzten<br />
Absenkung des durchschnittlichen Ticketpreises um 0,35 NZD führen. Angesichts eines so<br />
geringen Nutzengewinns für die Allgemeinheit <strong>und</strong> <strong>der</strong> relativ großen Eingriffsintensität einer<br />
ex-ante <strong>Re</strong>gulierung lehne sie <strong>der</strong>en Einführung ab. Stattdessen gäbe sie – wie ihre Vorgänger<br />
– <strong>der</strong> light-handed <strong>Re</strong>gulierung den Vorzug <strong>und</strong> setze weiterhin auf die disziplinierende<br />
Wirkung eines transparenten Preis-Monitoring. Bei ihrer Verkündung gab die<br />
Wirtschaftsministerin allerdings auch zu bedenken, dass mit dieser Entscheidung die<br />
Überarbeitung des <strong>der</strong>zeitigen Systems bei Weitem noch nicht abgeschlossen sei. Denn<br />
obwohl eine Preisregulierung für nicht gerechtfertigt bef<strong>und</strong>en wurde, sind sich die<br />
Verantwortlichen <strong>der</strong> Tatsache bewusst, dass internationale Flughäfen in Neuseeland in einem<br />
Marktumfeld mit nur begrenztem Wettbewerb agieren <strong>und</strong> daher <strong>der</strong> Weiterentwicklung von<br />
Schutzmechanismen gegen Marktmachtmissbrauch eine erhöhte Priorität zukommt. So wurde<br />
in <strong>der</strong> Entscheidungsbegründung u.a. auch <strong>der</strong> Vorschlag <strong>unter</strong>breitet, das <strong>der</strong>zeitige System<br />
dahingehend abzuän<strong>der</strong>n, einige obligatorische Bestandteile noch weiter zu verschärfen.<br />
Momentan ist <strong>der</strong> Flughafenbetreiber verpflichtet, wichtige Unternehmensdaten zu<br />
veröffentlichen <strong>und</strong> vor Preiserhöhungen die wichtigsten Airlines zu konsultieren. Das<br />
Transportministerium soll nun überprüfen, ob <strong>der</strong> Flughafen nicht nur zu Konsultationen,<br />
son<strong>der</strong>n auch zur Aufnahme von Vertragsverhandlungen mit ihnen verpflichtet werden sollte;<br />
dieser Ansatz folgt dem Gedanken <strong>der</strong> korporatistischen <strong>Re</strong>gulierung.<br />
82
A.3) Australien<br />
A.3.1) <strong>Privatisierung</strong><br />
Vollprivatisierung über langfristige Leasing-Verträge<br />
Bis 1996 befanden sich alle großen internationalen Flughäfen in Australien im Eigentum <strong>der</strong><br />
B<strong>und</strong>esregierung <strong>und</strong> wurden von <strong>der</strong> nationalen, staatlichen Flughafenholding Fe<strong>der</strong>al<br />
Airports Corporation (FAC) betrieben. Dem gegenüber standen die zwei nationalen<br />
Fluggesellschaften Quantas <strong>und</strong> Ansett. Die <strong>Privatisierung</strong> <strong>der</strong> Flughäfen vollzog sich dann in<br />
mehreren Phasen. Den Gr<strong>und</strong>stein dafür bildete ein im Jahr 1996 verabschiedetes Gesetz<br />
(Airports Act), das den Weg für eine materielle <strong>Privatisierung</strong> <strong>der</strong> 22 größten Flughäfen in<br />
Australien ebnete. Der nächste Schritt war die eigentumsrechtliche Entflechtung <strong>der</strong> bis dahin<br />
mit dem Betrieb beauftragten FAC. Daraufhin konnten im Sommer 1997 zunächst die nach<br />
Sydney-Kingsfort zweit- <strong>und</strong> drittgrößten Flughäfen Melbourne <strong>und</strong> Brisbane sowie Perth für<br />
50 Jahre <strong>und</strong> einer Verlängerungsoption für weitere 49 Jahre an private Investoren verpachtet<br />
werden. Für den Großteil <strong>der</strong> restlichen Flughafen<strong>unter</strong>nehmen fanden sich im Jahr darauf<br />
trotz ihres zum Teil desolaten technischen <strong>und</strong> finanziellen Zustandes genügend<br />
Interessenten, so dass die <strong>Re</strong>gierung im Mai 1998 auch für sie Leasingverträge mit ähnlichen<br />
Konditionen abschließen konnte (Graham 2001, S. 33).<br />
Nur die vier Flughäfen im Umkreis von Sydney wurden bei <strong>der</strong> zweiten <strong>Privatisierung</strong>sphase<br />
bewusst ausgeschlossen. Deren Betrieb wurde stattdessen <strong>der</strong> 1998 gegründeten staatlichen<br />
Sydney Airport Corporation übertragen. Dies geschah v.a. mit Bedacht auf die noch<br />
ungeklärten Fragen zum Thema Neubau eines zweiten Großflughafens neben Sydney-<br />
Kingsfort <strong>und</strong> <strong>der</strong> damit zusammenhängenden anwachsenden Lärmbelästigung, sowie um vor<br />
den anstehenden Olympischen Spielen im Jahr 2000 keine Umstrukturierungen einleiten zu<br />
müssen. 61 Obwohl die <strong>Privatisierung</strong> dann für 2001 angesetzt war, wurde <strong>der</strong> Sydney<br />
International Airport erst im Juni 2002 an ein Konsortium <strong>unter</strong> Beteiligung <strong>der</strong> Hochtief<br />
Airport GmbH verkauft, nachdem die Frist für die Angebotsabgabe aufgr<strong>und</strong> <strong>der</strong> Ereignisse<br />
des 11. September 2001 <strong>und</strong> dem damit zusammennhängenden Konkurs <strong>der</strong> zweitgrößten<br />
Airline Ansett kurz darauf um gut ein halbes Jahr verschoben worden war. Mit diesem<br />
Verkauf sind somit sämtliche 22 Flughäfen in Australien letztendlich in die Hände<br />
strategischer Investoren übergeben worden; <strong>unter</strong> den Investoren befinden sich u.a. die<br />
weltweit operierenden Flughafen<strong>unter</strong>nehmen BAA <strong>und</strong> die Schiphol-Group, die Anteile an<br />
den Flughäfen Melbourne bzw. Brisbane erwarben (Forsyth 2003b, S. 3f.).<br />
Leasing-Verträge bzw. Konzessionen als <strong>Privatisierung</strong>smodell<br />
Durch die Ausgestaltung <strong>der</strong> meisten Verträge als Leasinggeschäft behält die <strong>Re</strong>gierung zwar<br />
das Eigentumsrecht, aber sie gibt ansonsten die Verantwortung <strong>der</strong> Unternehmensführung<br />
komplett in die Hände <strong>der</strong> Leasingnehmer ab, einschließlich <strong>der</strong> Entscheidungen für<br />
Kapazitätserweiterungen; <strong>der</strong>artige Leasingverträge werden in <strong>der</strong> Literatur häufig auch als<br />
Konzessionsmodelle bezeichnet. Angesichts <strong>der</strong> langen Laufzeit <strong>der</strong> Konzessionen bestehen<br />
61 Gespräch mit Michael Holzschnei<strong>der</strong> – Hochtief Airport GmbH, Februar 2003<br />
83
für die privaten Flughafenbetreiber in den ersten Jahren bzw. Jahrzehnten ähnliche Anreize<br />
wie bei einem zeitlich unbegrenzten Erwerb des Flughafens. Es ist anzunehmen, dass die<br />
Investitionsanreize jedoch zum Ende <strong>der</strong> Pachtzeit hin geringer sein dürften als bei einem<br />
zeitlich unbegrenzten Verkauf an einen strategischen Investor.<br />
A.3.2) <strong>Re</strong>gulierung: Monitoring enthält auch Gr<strong>und</strong>gedanken <strong>der</strong> korporatistischen<br />
<strong>Re</strong>gulierung<br />
Begrenzte Substitionskonkurrenz in Australien<br />
Für die Beurteilung <strong>der</strong> Marktmacht <strong>und</strong> des <strong>Re</strong>gulierungsbedarfes in Australien ist es<br />
wichtig, auf die regionalen Beson<strong>der</strong>heiten des Luftverkehrsmarktes hinzuweisen. Die<br />
Flughäfen liegen sehr weit auseinan<strong>der</strong> <strong>und</strong> <strong>unter</strong>liegen daher nur begrenzt einer<br />
Substitutionskonkurrenz durch intra- <strong>und</strong> intermodalen Wettbewerb. Dennoch sehen sich die<br />
privatisierten Flughäfen nach dem Zusammenbruch <strong>der</strong> zweiten australischen<br />
Fluggesellschaft Ansett faktisch nur <strong>der</strong> Fluggesellschaft Quantas als Nachfrager gegenüber,<br />
so dass das Missbrauchspotenzial für Marktmacht durch das Gegengewicht <strong>der</strong> Airline stark<br />
eingeschränkt wird (King 2001, S. 17ff.).<br />
Ab 1996 zunächst Pric-Cap-<strong>Re</strong>gulierung <strong>der</strong> größeren Flughäfen durch<br />
sektorübergreifend tätige ACCC<br />
Im Airports Act 1996 legte <strong>der</strong> Gesetzgeber daher zur Erhöhung <strong>der</strong> Planungssicherheit für<br />
potenzielle Investoren gleichzeitig auch einen neuen sektor-spezifischen <strong>Re</strong>gulierungsrahmen<br />
fest. So wurde gemäß dem zuvor erlassenen Price Surveillance Act 1983 für zwölf<br />
Flughafengesellschaften exklusive Sydney International zum Zeitpunkt <strong>der</strong> <strong>Privatisierung</strong><br />
eine Price-Cap-<strong>Re</strong>gulierung nach dem Dual-Till Ansatz implementiert <strong>und</strong> die<br />
Monopolkontrolle <strong>der</strong> Australian Competition and Consumer Commission (ACCC)<br />
übertragen (Forsyth 2002, S. 19ff.). Die restlichen Flughäfen waren nur einer ex-post<br />
Überwachung ihres Angebotsverhaltens <strong>unter</strong>worfen. Des Weiteren regelte das Gesetz einige,<br />
durch die <strong>Re</strong>gulierungsinstanz nicht abän<strong>der</strong>bare Bestimmungen (Airports Act 1996, S. 2,<br />
Wolf 1997, S. 160), wie z.B. eine Genehmigungspflicht für Bau, Betrieb aber auch<br />
Schließung von Flughäfen, beson<strong>der</strong>e Auskunftspflichten <strong>der</strong> Flughafen<strong>unter</strong>nehmen sowie<br />
Anteilsbeschränkungen für ausländische Investoren (max. 49%), Luftverkehrs<strong>unter</strong>nehmen<br />
(5%) <strong>und</strong> in Konkurrenz zueinan<strong>der</strong> stehende Flughäfen.<br />
Die Entwicklung <strong>der</strong> Preisobergrenzen wurde durch die ACCC nach <strong>der</strong> CPI-X <strong>Re</strong>gel auf<br />
fünf Jahre individuell für jeden Flughafen festgelegt. Zur Bestimmung des X-Wertes zog man<br />
u.a. das prognostizierte Wachstum des Verkehrsaufkommens zu Rate; so wurde<br />
beispielsweise für Brisbane aufgr<strong>und</strong> <strong>der</strong> Annahme dynamischerer Verkehrsentwicklung <strong>der</strong><br />
Wert höher angesetzt als für Melbourne. Da eine Preisregulierung dieser Art in Australien<br />
schon für eine ganze <strong>Re</strong>ihe an<strong>der</strong>er Sektoren erprobt war, versuchte man, bei <strong>der</strong>en<br />
Neuauflage für die Flughäfen auf die bekannt gewordenen Nachteile angemessen zu<br />
reagieren. Z.B. wurde dem Risiko <strong>der</strong> Qualitätsabsenkung mit <strong>der</strong> Einführung einer<br />
entsprechenden Angebotskontrolle begegnet. Anreize zur Unterinvestition versuchte man zu<br />
reduzieren, indem den Unternehmen für genehmigte Investitionen eine Lockerung des Price-<br />
Caps in Aussicht gestellt wurde. Der ACCC obliegt auch die Durchsetzung einer<br />
84
Marktzugangsregulierung für wettbewerbsfähige Bereiche auf Flughäfen, insbeson<strong>der</strong>e <strong>der</strong><br />
Bodenverkehrsdienste, nachdem marktinterne Verhandlungen bereits gescheitert sind <strong>und</strong> auf<br />
Antrag eines Benachteiligten tatsächlich ein wettbewerbswidriges Verhalten Seitens des<br />
Flughafens festgestellt werden konnte (ACCC 2001a, S. 3ff.; Forsyth 1999, S. 6ff.).<br />
Überprüfung des <strong>Re</strong>gulierungssystems in 2001 durch die Productivity Commission<br />
Die Übertragung <strong>der</strong> <strong>Re</strong>gulierungsaufgabe an die nationale Wettbewerbsbehörde erfolgte vor<br />
dem Hintergr<strong>und</strong>, dass die Price-Cap-<strong>Re</strong>gulierung von vornherein nur als Übergangsregime<br />
angelegt war. Es war geplant, die ex-ante <strong>Re</strong>gulierung noch vor Ablauf <strong>der</strong> ersten<br />
<strong>Re</strong>gulierungsperiode von fünf Jahren nach einer kritischen Überprüfung bei Bedarf auslaufen<br />
zu lassen. Auf lange Sicht sollten die Marktergebnisse allein von den Verhandlungen <strong>der</strong><br />
Flughäfen <strong>und</strong> <strong>der</strong> Fluggesellschaften bestimmt werden. Daher hatte die ACCC in dieser<br />
Phase auch die Aufgabe, neben <strong>der</strong> Durchsetzung <strong>der</strong> Preis- <strong>und</strong> Marktzugangsregulierung<br />
sowie <strong>der</strong> Überwachung <strong>und</strong> Bewertung <strong>der</strong> Angebotsqualität, detaillierte Informationen über<br />
die Geschäftstätigkeit <strong>der</strong> Flughäfen zu sammeln, um vor Ablauf <strong>der</strong> 5-Jahresfrist dem<br />
Verkehrsminister eine Empfehlung bezüglich <strong>der</strong> Aufhebung, Fortdauer o<strong>der</strong> Abän<strong>der</strong>ung <strong>der</strong><br />
ex-ante <strong>Re</strong>gulierung für bestimmte Flughäfen abgeben zu können (Forsyth 2003a, S. 26ff.).<br />
Die Überprüfung des <strong>Re</strong>gulierungsrahmens wurde schließlich durch die Productivity<br />
Commission (PC) vorgenommen, um den Effekt des „regulatory capture“ auf Seiten <strong>der</strong><br />
ACCC zu vermeiden. Sie begann ihre Arbeit Ende 2000 <strong>und</strong> legte einen ersten Bericht im<br />
August 2001 vor. Darin wurden zwei Möglichkeiten erörtert, zum einen die vollkommene<br />
Abschaffung einer ex-ante Preisregulierung <strong>unter</strong> Beibehaltung einer ex-post<br />
Angebotskontrolle, zum an<strong>der</strong>en die Option, eine Price-Cap <strong>Re</strong>gulierung nur für die größten<br />
Flughäfen in den Ballungszentren aufrecht zu erhalten, verb<strong>und</strong>en mit <strong>der</strong> Beibehaltung des<br />
Price Monitoring bzw. <strong>der</strong> gänzliche Aussetzung einer <strong>Re</strong>gulierung für die kleineren<br />
Flughäfen. Die Flughäfen ihrerseits favorisierten die erste Möglichkeit, da sie eine ex-ante<br />
<strong>Re</strong>gulierung als zu eingriffsintensiv betrachteten <strong>und</strong> die meisten von ihnen in den Jahren<br />
zuvor Verluste erwirtschafteten. Diese Situation verschärfte sich durch die Ereignisse im<br />
September 2001. Einige Flughäfen verloren nahezu die Hälfte ihres Verkehrsaufkommens,<br />
<strong>und</strong> <strong>der</strong> Ruf nach Abschaffung einer <strong>Re</strong>gulierung wurde lauter.<br />
Abbau <strong>der</strong> <strong>Re</strong>gulierungsintensität seit 2001: Monitoring plus<br />
<strong>Re</strong>gulierungsandrohung bei größeren Flughäfen<br />
Im Oktober setzte die <strong>Re</strong>gierung dann auch für den Großteil <strong>der</strong> Flughäfen die<br />
Preisregulierung aus. Der noch nicht privatisierte Flughafen in Sydney fiel <strong>unter</strong> eine ex-post<br />
Preisüberwachung. Für die Flughäfen in Melbourne, Brisbane <strong>und</strong> Perth wurde das Price-Cap<br />
beibehalten, ihnen wurde allerdings eine einmalige Anhebung <strong>der</strong> Entgelte um 6-7 %<br />
gestattet. Die neu gewonnenen Preissetzungsspielräume nutzten die Flughäfen exzessiv <strong>und</strong><br />
erhöhten ihre Preise zum Teil um 100%. Den endgültigen Bericht präsentierte die PC <strong>der</strong><br />
<strong>Re</strong>gierung Anfang 2002, die ihn dann im Mai veröffentlichte (Productivity Commission<br />
2002). Die Kommission empfahl, die direkte Preisregulierung abzuschaffen <strong>und</strong> für die<br />
bedeutendsten Flughäfen stattdessen ein Price-Monitoring-System zu errichten, das wie<strong>der</strong>um<br />
in fünf Jahren einer kritischen Überprüfung <strong>unter</strong>zogen werden sollte. Eine ex-ante<br />
85
<strong>Re</strong>gulierung könnte bei Anzeichen eines Missbrauchs dieser Preissetzungsfreiheit dann sofort<br />
wie<strong>der</strong> eingeführt werden.<br />
Die <strong>Re</strong>gierung entschloss sich, den Empfehlungen <strong>der</strong> Kommission in allen Punkten zu<br />
folgen <strong>und</strong> setzte mit Wirkung vom Juni 2002 an die Preisregulierung komplett aus. Die<br />
größeren Flughäfen einschließlich Sydney <strong>unter</strong>liegen jetzt einem System <strong>der</strong><br />
Preisüberwachung, das bei missbräuchlichem Angebotsverhalten die Implementierung einer<br />
ex-ante Preisregulierung nach dem bisherigem Muster nach sich zieht. Die kleineren<br />
Flughäfen hingegen sind seitdem vollständig <strong>der</strong>eguliert. Allerdings besteht weiterhin für<br />
unabhängige Dienstleister die Möglichkeit, nach gescheiterten Marktzutrittsverhandlungen<br />
die Wettbewerbsbehörde um eine Entscheidung über den Zugang zu wesentlichen<br />
Einrichtungen anzurufen (Forsyth 2003b, S. 4ff.).<br />
Das <strong>der</strong>zeit in Australien praktizierte Konzept eines Price-Monitoring beinhaltet auch<br />
Gr<strong>und</strong>gedanken <strong>der</strong> korporatistischen <strong>Re</strong>gulierung, denn es wird Verhandlungen zwischen<br />
dem Flughafen <strong>und</strong> den dort aktiven Unternehmen gr<strong>und</strong>sätzlich <strong>der</strong> Vorzug gegeben<br />
gegenüber einer ex-ante Preisregulierung, die jedoch als Androhung „indirekt“ in das<br />
<strong>Re</strong>gulierungssystem eingeb<strong>und</strong>en ist.<br />
A.4) <strong>Re</strong>sümee<br />
Zusammenfassend bleibt festzustellen, dass in den drei vorgestellten Län<strong>der</strong>n Großbritannien,<br />
Neuseeland <strong>und</strong> Australien, in denen die Flughafenpolitik dem Ziel <strong>der</strong> Wohlfahrtssteigerung<br />
folgt,<br />
• die größeren Flughäfen privatisiert wurden, wobei ein <strong>unter</strong>schiedlicher Umfang <strong>und</strong><br />
<strong>unter</strong>schiedliche Formen für die <strong>Privatisierung</strong> angewandt wurden,<br />
• die größeren Flughäfen stets einer <strong>Re</strong>gulierung <strong>unter</strong>liegen, um den Missbrauch von<br />
Marktmacht zu verhin<strong>der</strong>n bzw. einzuschränken <strong>und</strong><br />
• auch kleinere Flughäfen zum Teil einer <strong>Re</strong>gulierung <strong>unter</strong>liegen, die jedoch i.d.R. mit<br />
einer geringeren <strong>Re</strong>gulierungsintensität als bei den großen Flughäfen einhergeht.<br />
Wie die Abbildung 5 verdeutlicht, kann eine Tendenz zum Abbau <strong>der</strong> <strong>Re</strong>gulierungsintensität<br />
beobachtet werden. In Großbritannien wird den Flughäfen in Zukunft die Möglichkeit<br />
eröffnet, für Kapazitätserweiterungen Investitionsvereinbarungen abzuschließen. Zur<br />
<strong>Re</strong>finanzierung können im Gegenzug die Preisobergrenzen gelockert werden. In Neuseeland<br />
wird auch in Zukunft einem weniger eingriffsintensiven, ex-post Price-Monitoring-System<br />
<strong>der</strong> Vorzug gegeben gegenüber einer strikten ex-ante Preisregulierung. Auch die <strong>Re</strong>gierung in<br />
Australien hat sich für den Wechsel zu einer solchen „light-handed“ Variante einer ex-post<br />
<strong>Re</strong>gulierung entschieden. Allerdings verknüpft sie dieses Konzept zusätzlich mit <strong>der</strong><br />
disziplinierenden Wirkung einer angedrohten ex-ante <strong>Re</strong>gulierung, die im Falle <strong>der</strong><br />
Aufdeckung eines Marktmachtmissbrauchs eingreifen würde.<br />
Die negativen Erfahrungen in Großbritannien mit dem Single-Till-Konzept deuten daraufhin,<br />
dass bei Anwendung einer ex-ante <strong>Re</strong>gulierung nach dem Price-Cap-Verfahren das Dual-Till-<br />
Konzept mit Tariff-Basket <strong>und</strong> Sliding-Scale-Ansatz am Besten für Flughäfen geeignet ist.<br />
86
Abbildung 5: <strong>Re</strong>gulierungstendenzen in Großbritannien, Neuseeland <strong>und</strong> Australien<br />
(Quelle: eigene Darstellung)<br />
87