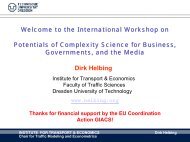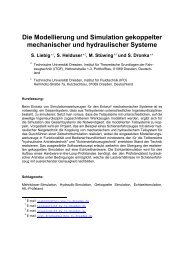Neue mobile Echtzeit-Informationsdienste für die Fahrgäste der ...
Neue mobile Echtzeit-Informationsdienste für die Fahrgäste der ...
Neue mobile Echtzeit-Informationsdienste für die Fahrgäste der ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Neue</strong> <strong>mobile</strong> <strong>Echtzeit</strong>-<strong>Informations<strong>die</strong>nste</strong> für<br />
<strong>die</strong> Fahrgäste <strong>der</strong> Dresdner Verkehrsbetriebe<br />
Dipl.-Ing. F. Müller-Eberstein 1 , Prof. Dr. J. Schütte, 2 Hr. Küster 3<br />
1<br />
Dresdner Verkehrsbetriebe AG<br />
Trachenberge ...<br />
e-mail: mueller-eberstein@dvbag.de<br />
URL: www.dvbag.de<br />
2<br />
3<br />
Fraunhofer-IVI<br />
Zeunerstraße 38 01069 Dresden<br />
e-mail: schuette@ivi.fhg.de<br />
URL: www.ivi.fhg.de<br />
Fraunhofer-IVI<br />
Zeunerstraße 38 01069 Dresden<br />
e-mail: kuester@ivi.fhg.de<br />
URL: www.ivi.fhg.de<br />
Kurzfassung:<br />
In dem folgenden Vortrag werden <strong>mobile</strong> <strong>Echtzeit</strong>-<strong>Informations<strong>die</strong>nste</strong> vorgestellt und insbeson<strong>der</strong>e<br />
das seit Anfang des Jahres 2001 im Probebetrieb befindliche <strong>mobile</strong> <strong>Echtzeit</strong>informationssystem<br />
<strong>der</strong> Dresdner Verkehrsbetriebe beschrieben, daß den Fahrgästen in Dresden<br />
zur Verfügung steht.<br />
Es werden <strong>die</strong> Anfor<strong>der</strong>ungen, <strong>die</strong> an ein solches System in <strong>der</strong> heutigen Zeit gestellt werden<br />
analysiert und <strong>der</strong> Integrationsprozeß mit dem Rechnergestützten Betriebsleitsystem <strong>der</strong><br />
DVB AG sowie <strong>die</strong> technische Realisierung am konkreten Beispiel beschrieben. Da ein beson<strong>der</strong>er<br />
Augenmerk auf eine einfache Be<strong>die</strong>nbarkeit, sowie <strong>die</strong> hohe Verfügbarkeit des<br />
Systems gelegt wurden, beschäftigt sich <strong>der</strong> Vortrag auch mit den konkret verwendeten<br />
Technologien und <strong>der</strong>en Ausfallsicherheit, sowie mit <strong>der</strong> Darstellung <strong>der</strong> entwickelten Kundenschnittstelle,<br />
und den Erfahrungen, <strong>die</strong> in den ersten 6 Monaten des Betriebes gesammelt<br />
wurden. Abschließend wird <strong>die</strong> offene Systemarchitektur aufgezeigt, welche sowohl <strong>die</strong><br />
Integration in bereits bestehende o<strong>der</strong> in Entwicklung befindliche Produkte ermöglicht, als<br />
auch offen für zukünftige Erweiterungen <strong>der</strong> <strong>mobile</strong>n <strong>Echtzeit</strong>informations<strong>die</strong>nste ist.<br />
Schlagworte: SMS; WAP; DVB AG; RBL; FhG IVI; intermobil; Leitprojekt; MIV; ÖPNV; modal-split;<br />
DFI; internet; EPON;
1 Einleitung<br />
Innerhalb des Leitprojektes „intermobil“ bei dem sowohl <strong>die</strong> Dresdner Verkehrsbetriebe AG,<br />
als auch das Fraunhofer Institut für Verkehrs- und Infrastruktursysteme als Konsortialpartner<br />
mitwirken, beschäftigen sich mehrere Arbeitspakete mit <strong>der</strong> Distribution <strong>der</strong> Ergebnisse des<br />
Leitprojekts auf <strong>mobile</strong> Endgeräte. Dies betrifft unter an<strong>der</strong>em Informationen aus dem Bereich<br />
des öffentlichen Verkehrs. Da <strong>die</strong> DVB AG auch eigenständig Aktivitäten auf dem Gebiet<br />
<strong>der</strong> Informationsdistribution durchgeführt hat, sowie mit <strong>der</strong> Inbetriebnahme des Rechnergestützten<br />
Betriebsleitsystems eine Grundvoraussetzung geschaffen hat, <strong>Echtzeit</strong>fahrplaninformationen<br />
überhaupt zu generieren, können Synergieeffekte genutzt werden, und <strong>die</strong> Anstrengungen<br />
bei<strong>der</strong> Institutionen gebündelt zu neuen Ergebnissen geführt werden.<br />
Ziel <strong>der</strong> Arbeiten war <strong>die</strong> einfache, schnelle und umfassende Information <strong>der</strong> Fahrgäste <strong>der</strong><br />
Dresdner Verkehrsbetriebe rund um <strong>die</strong> Uhr auf einem allgemein verfügbaren Kommunikationsweg<br />
zu vertretbaren Kosten. Eine kontinuierliche Beauskunftung durch Personal <strong>der</strong> Verkehrsbetriebe<br />
via Telefon schied von Anfang an als Kommunikationsweg aus Kosten und<br />
Verfügbarkeitsgründen aus. Damit kam nur eine vollautomatische Lösung in Betracht, welche<br />
alle genannten Anfor<strong>der</strong>ungen erfüllt. Eine in <strong>der</strong> Evaluierungsphase durchgeführte Stu<strong>die</strong><br />
ergab, daß zum Zeitpunkt des Projektstarts kein System in Deutschland existierte, welches <strong>die</strong><br />
gefor<strong>der</strong>ten Funktionalitäten sicherstellt. Insbeson<strong>der</strong>e auf dem Weg <strong>der</strong> Istdatenbeauskunftung<br />
auf <strong>mobile</strong> Endgeräte beschritten <strong>die</strong> Dresdner Verkehrsbetriebe AG in Kooperation mit<br />
dem Fraunhoferinstitut IVI Neuland. Erfahrungen aus bereits in Betrieb befindlichen Systemen<br />
auf Sollplanbasis, wie zum Beispiel im Bereich des MVV in München, wurden bei <strong>der</strong><br />
Umsetzung ebenso beachtet, wie <strong>die</strong> reichhaltigen Erfahrungen <strong>die</strong> während <strong>der</strong> ersten Funktionalitätstest<br />
in <strong>der</strong> Aufbauphase des Systems gesammelt werden konnten.<br />
In den folgenden Abschnitten wird zuerst <strong>die</strong> technische und betriebliche Ausgangslage bei<br />
den Dresdner Verkehrsbetrieben näher beschrieben und <strong>die</strong> Motivation für ein <strong>mobile</strong>s <strong>Echtzeit</strong>informationssystem<br />
für eine breite Benutzerbasis erläutert.<br />
Daraufhin wird auf <strong>die</strong> Realisierung und <strong>die</strong> dabei gewonnenen Erfahrungen in einem getrennten<br />
Abschnitt eingegangen, sowie <strong>der</strong>zeit bestehende Grenzen und Möglichkeiten des im<br />
Betrieb befindlichen Systems dargestellt.<br />
Abschließend werden <strong>die</strong> Assimilationsmöglichkeiten <strong>der</strong> <strong>mobile</strong>n <strong>Echtzeit</strong>-Auskunft an<br />
Hand <strong>der</strong> Integration in das „intermobil“ Informationssystem aufgezeigt und somit <strong>die</strong> offene<br />
Architektur des Systems herausgestellt, sowie Ausblicke auf geplante Erweiterungen und<br />
Ausbaumöglichkeiten <strong>der</strong> <strong>mobile</strong>n <strong>Echtzeit</strong>auskunft aufgezeigt.<br />
2
2 Ausgangslage bei <strong>der</strong> Dresdner Verkehrsbetriebe AG (DVB)<br />
In <strong>die</strong>sem Abschnitt werden <strong>die</strong> technischen und betrieblichen Motivationen und Voraussetzungen<br />
seitens <strong>der</strong> DVB dargestellt, welche zu dem grundsätzlichen Bekenntnis geführt haben<br />
ein deutschlandweit neuartiges <strong>mobile</strong>s <strong>Echtzeit</strong>informationssystem in Kooperation mit dem<br />
Fraunhoferinstitut IVI (FhG IVI) zu entwickeln.<br />
2.1 betriebliche Motivation und Ausgangslage bei <strong>der</strong> DVB AG<br />
[%]<br />
100<br />
90<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
Verkehrsmittelanteile von MIV und ÖPNV<br />
{MIV und ÖPNV = 100%}<br />
MIV<br />
37% 32% 42% 45% 62%<br />
67% 71%<br />
63% 68% 58% 55%<br />
ÖPNV<br />
38%<br />
33%<br />
29%<br />
Steigendes Mobilitätsbedürfnis ist ein allgegenwärtiges Phänomen, sowohl im privaten als<br />
auch beruflichen Umfeld. Dabei verursacht gerade <strong>die</strong> wachsende Anzahl von Nutzern des<br />
motorisierten Individualverkehrs (MIV) eine überproportionale Belastung des Straßennetzes<br />
beson<strong>der</strong>s in urbanen Ballungsräumen, wie <strong>der</strong> Region Dresden und belastet negativ den Lebens-<br />
und Arbeitsraum Stadt. Um <strong>die</strong>sem allgemeinen negativen Trend im modal-split, dem<br />
Verhältnis von öffentlichen zu privatem Verkehr (Abbildung 1), nachhaltig entgegenzuwirken<br />
ist <strong>die</strong> Einführung attraktiver Dienste im öffentlichen Verkehr unumgänglich. Da in<br />
Dresden in den vergangenen Jahren bereits eine Stagnation und sogar eine Trendwende im<br />
Verlauf des modal-Split erkennbar ist (Abbildung 2) wird bei <strong>der</strong> DVB AG ein Hauptaugenmerk<br />
darauf gerichtet, Zugangshemmnisse zum ÖPNV ohne großen Kostenaufwand aus dem<br />
Weg zu räumen um das Vertrauen <strong>der</strong> Kunden zum Verkehrs<strong>die</strong>nstleister positiv zu beeinflussen<br />
und damit <strong>die</strong> Kundenbindung zu festigen. Diese Motivation haben <strong>die</strong> DVB zum<br />
Anlaß genommen sich des Zugangshemmnisses „Fahrplankenntnis“ zuzuwenden und ein<br />
Fahrgastinformationssysteme auf einer breiten Systembasis mit hochwertigen Daten zu publizieren.<br />
In zunehmendem Maße wird<br />
<strong>der</strong> traditionelle gedruckte Fahrplan,<br />
welcher systembedingt nur eine begrenzte<br />
Aktualität aufweisen kann<br />
durch elektronische Me<strong>die</strong>n ersetzt.<br />
Dabei wird durch <strong>die</strong> DVB auf ein<br />
vielgleisiges Konzept gesetzt um verschiedene<br />
Personengruppen an verschiedenen<br />
Orten zu erreichen. Neben<br />
den dynamischen Fahrgastinformationstafeln<br />
(DFI), welche direkt mit dem<br />
RBL verbunden sind spielt das Internet<br />
eine zunehmend wichtige Rolle.<br />
1972 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 2000 J<br />
Abbildung1: Entwicklung <strong>der</strong> Verkehrsmittelwahl in Dresden 1972 bis 1992 und Trend 2000<br />
Quelle: SOCIALDATA: Mobilität in Dresden, Band 1 und 3, München, Oktober 1993<br />
3
Abbildung2: Entwicklung <strong>der</strong> Fahrgastentwicklung bei <strong>der</strong> Dresdner Verkehrsbetriebe AG<br />
Quelle: DVB AG<br />
Wie Tabelle 1 entnommen werden kann, bestand im Bereich beson<strong>der</strong>s <strong>der</strong> „on trip“ Planung<br />
<strong>der</strong> Bedarf ein System anzubieten, welches möglichst je<strong>der</strong> je<strong>der</strong>zeit auch während betrieblichen<br />
Störungssituationen zuverlässige Istdaten unabhängig von einem Dispatcher liefert. Gerade<br />
während betrieblicher Störungen durch unvorhersehbare Ereignisse ist <strong>der</strong> Bedarf <strong>der</strong><br />
Fahrgäste nach Informationen beson<strong>der</strong>s hoch. Aus all <strong>die</strong>sen Überlegungen reifte <strong>der</strong> Entschluß<br />
<strong>die</strong>se Lücke zu schließen und auf Grundlage vorhandener Infrastruktur eine Lösung zu<br />
finden.<br />
Tabelle1: Auskunftssysteme <strong>der</strong> DVB zu Projektbeginn im Vergleich<br />
System Auskunftszeit Benutzerkreis Aktualität<br />
Fahrplanheft pre trip Je<strong>der</strong> gering<br />
internet pre trip Internetnutzer hoch<br />
Haltestellenfahrplantafeln on trip Je<strong>der</strong> mittel<br />
<strong>Neue</strong> Lösung on trip / pre trip Je<strong>der</strong> hoch<br />
2.2 Technische Motivation und Ausgangslage bei <strong>der</strong> DVB AG<br />
Nachdem bei <strong>der</strong> DVB <strong>der</strong><br />
Entschluß gefallen war, ein<br />
<strong>mobile</strong>s <strong>Echtzeit</strong>informationssystem<br />
zu etablieren, wurde<br />
sowohl nach geeigneten bereits<br />
bestehenden Systemen gesucht,<br />
welche Informationen des vor-<br />
4<br />
Abbildung 3: Entwicklung des Mobiltelefonmarktes in<br />
Deutschland
handenen RBL verarbeiten können, als auch nach Partnern, <strong>die</strong> alternativ ein entsprechendes<br />
System implementieren o<strong>der</strong> erweitern können. Da es deutschlandweit bisher kein entsprechendes<br />
System gab bzw. Systeme für <strong>mobile</strong> Sollfahrplanauskünfte als proprietiäre Lösungen<br />
existieren ergab sich <strong>die</strong> Notwendigkeit einer <strong>Neue</strong>ntwicklung.<br />
Als <strong>mobile</strong> Endgeräte wurden durch <strong>die</strong> DVB verschiedene Möglichkeiten diskutiert. Auf<br />
Grund <strong>der</strong> breiten vorhandenen Massenbasis von Mobiltelefonen nach dem GSM-Standard<br />
und <strong>der</strong> Entwicklungstendenzen (Abbildung 3) auf <strong>die</strong>sem Markt wurden mobiltelefonbasierende<br />
Dienste, konkret WAP und SMS ausgewählt. So wurden im Jahr 2000 in Deutschland<br />
pro Monat ca. 1.8 Milliarden SMS versendet. 1999 betrug <strong>der</strong> Umsatz z.B. beim Netzbetreiber<br />
D2 Vodaphone alleine 1 Milliarde DM. Diese Erfolgszahlen dürften <strong>die</strong> Mobilfunkbetreiber<br />
motivieren, auch längerfristig solche o<strong>der</strong> ähnliche Dienste anzubieten, so daß nicht mit<br />
einem Aussterben, wie etwa bei Pager<strong>die</strong>nsten, zu rechnen ist. Damit ist eine hinreichende<br />
Investitionssicherheit gegeben.<br />
Kommunikation DVB AG RBL - INTERMOBIL<br />
Arbeitsplatz<br />
Funk-Gateway<br />
Arbeitsplatz<br />
WAP/SMS<br />
RBL<br />
Funk-Gateway<br />
Firewall<br />
Gateway<br />
Firewall<br />
Export RBL<br />
DVB-NETZ<br />
Fahrplan-Server<br />
INTERMOBIL-Netz<br />
Abbildung 4: Struktureller Gesamtaufbau <strong>der</strong> <strong>mobile</strong>n <strong>Echtzeit</strong>auskunft bei DVB und FhG IVI<br />
Da <strong>der</strong> im RBL implementierte, von <strong>der</strong> FhG IVI entwickelte Fahrplanauskunfts-Algorithmus<br />
echtzeitfähig konzipiert wurde und somit <strong>die</strong> technischen Voraussetzungen geschaffen waren,<br />
hatten sich <strong>die</strong> beiden Leitprojekt-Konsortialpartner DVB und FhG IVI entschlossen, das geplante<br />
System vorzeitig zu realisieren.<br />
Als Datengrundlage für <strong>die</strong> <strong>mobile</strong> <strong>Echtzeit</strong>auskunft wurde von Anfang an das bei <strong>der</strong> DVB<br />
in Betrieb befindliche Rechnerbetriebsleitsystem favorisiert, da nur auf <strong>die</strong>sem Weg <strong>die</strong> notwendige<br />
kontinuierliche Ist-Datenbereitstellung möglich ist. Das RBL (Abbildung 4 rechts)<br />
besitzt unter an<strong>der</strong>em drei zeitlich voneinan<strong>der</strong> unabhängige Fahrplan Datenbasen (Tabelle 2).<br />
Als einfachste Ebene werden aus dem Fahrplanungssystem EPON Sollfahrpläne mit einer<br />
Gültigkeit von wenigen Tagen vorgehalten, <strong>die</strong> unter an<strong>der</strong>em auch als Datengrundlage für<br />
5
85<br />
75<br />
Fahrplanauskünfte innerhalb des RBL <strong>die</strong>nen. Eine zweite Ebene <strong>der</strong> Datenversorgung stellen<br />
sogenannte Disponentenfahrpläne dar, welche immer dann aktualisiert werden, wenn ein<br />
Dispatcher in <strong>der</strong> 24h besetzten Dispatcherzentrale auf Grund temporärer Ereignisse Modifikationen<br />
am Liniennetz vornimmt. Diese Fahrpläne wurden zu Projektbeginn außerhalb des<br />
RBL allerdings nicht ausgewertet. Als dritte und aktuellste Ebene wird das RBL alle 15 Sekunden<br />
mit den Fahrzeugpositionen aller Fahrzeuge <strong>der</strong> DVB beschickt, welche gerade eine<br />
Fahrt durchführen. Diese Ebene ist für eine <strong>Echtzeit</strong>auskunft natürlich am Interessantesten, da<br />
nur mit Hilfe <strong>die</strong>ser Daten eine Prognose über Ankünfte und Abfahrten an Haltestellen möglich<br />
ist. In den Räumlichkeiten <strong>der</strong> DVB ist des weiteren eine mo<strong>der</strong>ne Computerinfrastruktur<br />
installiert, so daß einer zügigen Netzwerkkommunikation nichts im Weg steht. Die Daten des<br />
RBL standen ursprünglich im Intranet, den Call- und Servicecentren, an den DFI, sowie den<br />
Dispatchern <strong>der</strong> DVB AG zur Verfügung (Abbildung 5). Die Einführung <strong>der</strong> <strong>mobile</strong>n Dienste<br />
bringen einen echten Mehrwert, da <strong>die</strong> Daten des RBL den Kunden unabhängig von kostenintensiv<br />
zu plazierenden DFI-Anzeigen, aber denoch mit <strong>der</strong>en Qualität zur Verfügung stehen<br />
(siehe auch Tabelle 3). Die funktechnischen Voraussetzungen für <strong>die</strong> in Kapitel drei diskutierte<br />
drahtlose Kommunikationsverbindung zur FhG IVI sind an den Gebäuden <strong>der</strong> DVB AG<br />
voll gegeben.<br />
Tabelle 2: Verfügbare Datenarten im RBL <strong>der</strong> DVB AG<br />
Datenart Datenumfang Datenaktualität<br />
EPON-Daten gering gering<br />
Dispositive Daten mittel mittel<br />
Ist-Daten hoch hoch<br />
76<br />
Mockritz<br />
2593<br />
Abbildung 5: Schematischer Aufbau des RBL <strong>der</strong> DVB AG<br />
6
3 Technische und betriebliche Realisierung <strong>der</strong> bürgernahen<br />
neuen Dienste<br />
Um Daten des RBL automatisch und kontinuierlich in ein angeschlossenes System exportieren<br />
zu können wurde durch den Hersteller des RBL eine in Zusammenarbeit mit <strong>der</strong> DVB AG<br />
und FhG IVI definierte Exportschnittstelle realisiert, welche neben den für <strong>die</strong> Istauskunft<br />
notwendigen Daten auch für betriebliche Zwecke innerhalb <strong>der</strong> DVB genutzt werden kann.<br />
Die exportierten Daten werden durch einen Kommunikationsrechner seitens <strong>der</strong> DVB gesammelt<br />
und stehen durch Firewalltechnologien geschützt für externe Benutzung zur Verfügung.<br />
Da auf Grund des sehr großen Datenumfangs von mehreren tausend Dateien pro Tag<br />
eine breitbandige Schnittstelle geschaffen werden mußte, wurde eine Funkverbindung im 2.4<br />
GHz ISM-Band zwischen DVB AG und FhG IVI etabliert, welche eine kostengünstige Alternative<br />
zu einer breitbandigen Standleitung darstellt. Diese Lösung bringt den weiteren Vorteil<br />
<strong>der</strong> kostengünstigen Transportabilität nach Abschluß <strong>der</strong> Entwicklung, falls Komponenten<br />
<strong>der</strong> <strong>Echtzeit</strong>auskunft den physikalischen Standort wechseln. Seitens <strong>der</strong> FhG IVI werden <strong>die</strong><br />
hier importierten Daten, nachdem sie einen auch hier installierten Firewall passiert haben in<br />
eine hochperformante Datenbank geschrieben, <strong>die</strong> neben den dynamischen Istdaten auch alle<br />
notwendigen Infrastrukturdaten aufnimmt. Ferner werden in <strong>die</strong>ser Datenbank geschützte<br />
Nutzerdaten für <strong>die</strong> im folgenden kurz beschriebene „Profilierung“ gesichert.<br />
Diese Profilierung gestattet Nutzern eine Hinterlegung von oft angefragten Verbindungs- und<br />
Haltestellenrelationen und ermöglicht insbeson<strong>der</strong>e für <strong>die</strong> SMS-Lösung eine zeitsparende<br />
und verständliche Nutzerschnittstelle. Für eine Anfrage ist lediglich ein selbst definiertes<br />
Kürzel anzufragen, was auch eine Individualisierung <strong>der</strong> Anfragen durch Benutzer ermöglicht.<br />
(z.B. „nach hause“ für eine Auskunft vom Arbeitsplatz zum Wohnort).<br />
Da Mobiltelefone als <strong>mobile</strong> Endgeräte ausgewählt wurden unterstützt <strong>die</strong> istdatengestütze<br />
Auskunft <strong>die</strong> beiden zur Zeit populären Informationskanäle WAP und SMS auf <strong>die</strong>sem Medium.<br />
In Tabelle 3 sind <strong>die</strong> Möglichkeiten <strong>der</strong> bei <strong>der</strong> DVB AG verfügbaren Dienste gegenübergestellt.<br />
Tabelle 3: Auskunfts<strong>die</strong>nste im Systemvergleich<br />
Eigenschaft WAP SMS DFI Callcenter Servicecenter<br />
Verbreitung mittel sehr hoch gering sehr gering gering<br />
Popularität gering sehr hoch hoch mittel hoch<br />
Erreichbarkeit sehr hoch sehr hoch sehr hoch mittel mittel<br />
Preis variabel fest kostenfrei Telefonat kostenfrei<br />
Anfragevoloumen sehr hoch sehr hoch hoch mittel mittel<br />
Handhabung interaktiv aufwendig einfach interaktiv interaktiv<br />
Reaktionsgeschwindigkeit hoch mittel sehr hoch mittel gering<br />
Betriebskosten gering mittel mittel hoch hoch<br />
Da es schwer war, ein System auf Grund <strong>der</strong> gezeigten Möglichkeiten auszuschließen, sind<br />
für WAP und SMS getrennte Lösungen entwickelt worden. Zur Realisierung des Projektes<br />
wurde ein mehrstufiger Algorithmus entwickelt, welcher analog zu den RBL-Datenbasen <strong>die</strong><br />
<strong>mobile</strong>n <strong>Echtzeit</strong>informationen beauskunftet (Tabelle 4 und Abbildung 8). Bis Ende des Jahres<br />
2000 wurden <strong>die</strong> ersten 2 Stufen in Betrieb genommen und Anfang 2001 eine voll datenbankbasierte<br />
Lösung, welche <strong>die</strong> Istdaten <strong>der</strong> Stufe 3 verwendet (Stufe 3 /DB). Die Daten-<br />
7
anklösung ist in <strong>der</strong> Lage ohne Zuhilfenahme des FhG – Auskunftsalgorithmus istdatenbasierte<br />
Auskünfte zu erstellen, was jedoch eine erhebliche Belastung und damit auch entsprechende<br />
Ausstattung <strong>der</strong> verwendeten Datenbank voraussetzt. Diese Lösung ist auf ein beliebiges<br />
System portierbar, wenn dort <strong>die</strong> entsprechenden Tabellen in <strong>der</strong> Datenbank zur Verfügung<br />
gestellt werden.<br />
Der dreistufige Aufbau des Algorithmus hat den weiteren Vorteil bei Bedarf zwei Rückfallebenen<br />
zu bieten. Diese werden automatisch aktiviert, wenn Teile des Auskunftssystems, wie<br />
<strong>der</strong> Datenverbindung zwischen DVB und FhG IVI o<strong>der</strong> das RBL selber temporär nicht verfügbar<br />
sind und garantiert so eine hohe Ausfallsicherheit.<br />
Tabelle 4: Stufenplan bei <strong>der</strong> Entwicklung <strong>der</strong> <strong>mobile</strong>n <strong>Echtzeit</strong>auskunft<br />
Stufe<br />
Merkmale<br />
1 Solldatenauskunft laut „EPON- Fahrplanungssystem mit einer aktualität von wenigen Tagen<br />
geringe Aktualität (---)/ geringes Datenvoloumen(++)/<br />
2 dispositive Auskunf mit einer Aktualität von einer Stunde o<strong>der</strong> besser<br />
gute Aktualität (+)/ mittleres Datenvoloumen(0)<br />
3 echtzeitdatenbasierte, algorithmische Prognoseauskunft mit einer Aktualität unter einer Minute<br />
höchste Aktualität (+++)/hohes Datenvoloumen(-)<br />
3/DB echtzeitdatenbasierte, datenbankbasierte Prognoseauskunft mit einer Aktualität unter einer Minute<br />
höchste Aktualität (+++)/höchstes Datenvoloumen(--)/hoher Rechenaufwand(-)<br />
Unter WAP und SMS wurden systembedingt getrennte Nutzerschnittstellen entwickelt, welche<br />
<strong>die</strong> Möglichkeiten jeweils möglichst gut unterstützen und folgende Dienste bieten:<br />
• SMS<br />
- direkt Beauskunftung beliebiger Verbindungen und Haltestellen<br />
- Möglichkeit <strong>der</strong> Vorabspezifizierung im WWW und Info-Säulen (Profilierung)<br />
- Direkte Angabe von Startpunkt und Zeithorizont am Mobiltelefon<br />
- geringer Eingabeaufwand durch Nutzung von Abkürzungen<br />
- Benachrichtigung durch Disponenten bei Verkehrsstörungen und Fahrplanabweichungen<br />
(Pushtechnologie)<br />
- Benutzerschnittstelle muß erlernt werden<br />
- hohe Verbreitung durch breite Handybasis mit SMS-Fähigkeit<br />
• WAP<br />
- interaktive Beauskunftung beliebiger Verbindungen und Haltestellen<br />
- hoher Be<strong>die</strong>nkomfort durch Benutzung von Auswahllisten (Benutzbarkeit für Ortsunkundige)<br />
- Benutzerschnittstelle intuitiv be<strong>die</strong>nbar<br />
8
Abbildung 6: Startbildschirm <strong>der</strong> <strong>mobile</strong>n <strong>Echtzeit</strong>auskunft unter WAP<br />
Unter WAP präsentiert sich das System wie in Abbildung 6. dargestellt. Er wird durch einen<br />
bereits vorhandenen und um WAP-Funktionalitäten erweiterten WWW Server be<strong>die</strong>nt. Dieser<br />
reicht <strong>die</strong> Anfragen an <strong>die</strong> Istauskunft weiter, welche abhängig von <strong>der</strong> notwendigen Datenbasis<br />
aus dem Drei-Ebenen Modell eine Auskunft <strong>der</strong> entsprechenden Ebene erstellt.<br />
Für eine SMS-Anfrage, wie in Abbildung 7 muß für <strong>die</strong> Beauskunftung ein erhöhter Aufwand<br />
Abbildung 7: Zugang zur <strong>mobile</strong>n Auskunft via SMS<br />
betrieben werden.<br />
Da keine interaktive Kommunikation zwischen System und Mobiltelefon mit SMS möglich<br />
ist, wird <strong>der</strong> Weg des „best match“ verfolgt. Weiterhin ist es für den Benutzer notwendig, eine<br />
definierte Syntax einzuhalten, <strong>die</strong> bewußt einfach gehalten wurde. Nach Eingang <strong>der</strong> SMS in<br />
einer <strong>mobile</strong>n Empfangseinheit, wird <strong>die</strong> Anfrage, bei Bedarf unter Zuhilfenahme <strong>der</strong> Profilierungsparameter<br />
<strong>der</strong> Anfrage analysiert, und je nach Bedarf eine Haltestellen- o<strong>der</strong> Verbindungsauskunft<br />
mit <strong>der</strong> entsprechenden Datenbasis initiiert. Abhängig vom Auskunftsvolumen<br />
9
werden daraufhin eine o<strong>der</strong> mehrere SMS-Nachrichten generiert und über einen „large message<br />
account“ eines globalen SMS- Provi<strong>der</strong>s versendet. Dieser übergibt <strong>die</strong> Nachrichten<br />
dann direkt in <strong>die</strong> anfragenden Mobilfunknetze, welche dann direkt <strong>die</strong> Benutzer kontaktieren.<br />
Trotz des erheblich aufwendigeren Kommunikationsweges werden typische Antwortzeiten<br />
von deutlich unter einer Minute erreicht.<br />
Epon-Fahrpläne<br />
Fahrplan 1<br />
Fahrplan 2 Fahrplan 3<br />
Zeitplan RBL-Haltestellenauskunft<br />
ab eingetretenem Ereignis<br />
12h gültig<br />
Disponentenfahrplan<br />
15sek<br />
Istdaten<br />
Position +<br />
Fahrplanlage<br />
minütlicher Export<br />
Fahrplan 4<br />
geringes<br />
Datenvolumen<br />
mittleres<br />
Datenvolumen<br />
großes<br />
Datenvolumen<br />
riesiges<br />
Datenvolumen<br />
voll datenbankbasierte Phase<br />
Phase 1<br />
Phase 2<br />
Phase 3<br />
wissensbasierter Haltestellenserver<br />
WAP / SMS - Dienst<br />
Abbildung 8: Struktur des mehrstufigen Auskunftsalgorithmus<br />
4 Erfahrungen im bisherigen Betrieb <strong>der</strong> <strong>mobile</strong>n<br />
<strong>Echtzeit</strong>information<br />
Nach einer Probelaufzeit von ca. einem halben Jahr kann ein insgesamt positives Resümee<br />
gezogen werden. So fanden nach kurzzeitigen Anlaufschwierigkeiten praktisch keine Systembedingten<br />
Totalausfälle <strong>der</strong> Auskunftsgenerierung statt. Hier hat sich das mehrstufige Konzept<br />
voll bewährt, welches in <strong>der</strong> Tat temporäre Nichtverfügbarkeiten von Teilkomponenten<br />
neutralisierte. Durchgeführte Tests haben ferner eine hohe Qualität <strong>der</strong> Auskünfte, vergleichbar<br />
mit den installierten dynamischen Fahrgastinformatinsanzeigen ergeben.<br />
Probleme traten zeitweise lediglich mit den <strong>mobile</strong>n Komponenten des Systems auf. So<br />
kommt es in einigen Fällen zu Verzögerung bei <strong>der</strong> SMS-Zustellung. Dies ist ein systembedingter<br />
Effekt <strong>der</strong> Mobilfunkbetreiber und läßt sich nur schwer durch <strong>die</strong> DVB beeinflussen.<br />
Ein Konzept wird im Kapitel 5 angesprochen. Weiterhin ist im Gegensatz zu den SMS-<br />
Auskünften, wo ein kontinuierlich hohes Anfragevolumen erreicht wurde im WAP-Bereich<br />
nur ein mäßiges Interesse zu verzeichnen. Analysen haben hier als Ursache vor allem <strong>die</strong><br />
WAP-bedingten variablen Kosten ergeben. Wenn sich volumenbasierte <strong>mobile</strong> Systeme in<br />
naher Zukunft etablieren, wird hier mit einem Anstieg des Nachfrageverhaltens gerechnet, da<br />
WAP durch <strong>die</strong> mögliche Visualisierungs- und Interaktionsmöglichkeiten ein höheres technisches<br />
Potential als SMS aufweist.<br />
Insgesamt kann konstatiert werden, dass mit dem deutschlandweit erstmaligen Einsatz von<br />
<strong>mobile</strong>n <strong>Echtzeit</strong>informations<strong>die</strong>nsten neben dem wissenschaftlichen Erfolg auch ein konkre-<br />
10
ter Nutzen für <strong>die</strong> Fahrgäste <strong>der</strong> Dresdner Verkehrsbetriebe erzielt wurde und auch nach dem<br />
Probebetrieb ein Weiterbetrieb und weiterer Ausbau <strong>der</strong> Auskunft vorangetrieben wird.<br />
5 Einbettung in übergeordnete Informationsstrategien und Ausblick<br />
Das <strong>mobile</strong> <strong>Echtzeit</strong>informationssystem <strong>der</strong> DVB wurde in Verbindung mit Aktivitäten, welche<br />
im Rahmen des Leitprojektes „intermobil“ stattfanden entwickelt. Deswegen ergibt sich<br />
<strong>die</strong> logische Konsequenz, <strong>die</strong> hier angebotenen Dienste auch in dem Informationssystem „doris“,<br />
welches innerhalb von „intermobil“ kreiert wird einzubetten. Das System „doris“ realisiert<br />
bereits <strong>die</strong> Profilierungsmöglichkeiten, welche den <strong>mobile</strong>n Komponenten zur Verfügung<br />
stehen. Weiterhin wird in „doris“ auch ein ausführliches Hilfesystem für <strong>die</strong> <strong>mobile</strong><br />
Auskunft angeboten. Dies ist auch sinnvoll, da <strong>die</strong> für und mit <strong>der</strong> DVB entwickelte Lösung,<br />
wie bereits erwähnt, im Rahmen <strong>der</strong> in „intermobil“ geplanten Gesamtlösung erstellt wurde.<br />
So werden <strong>die</strong> folgenden Weiterentwicklungen auch den Fahrgästen <strong>der</strong> DVB im vollem Umfang<br />
zur Verfügung stehen. Beispielsweise wird <strong>der</strong> Auskunftsraum über <strong>die</strong> Grenzen <strong>der</strong><br />
DVB in Zukunft <strong>die</strong> Region Dresden – Oberes Elbtal umfassen und auch weitere Zugangsme<strong>die</strong>n,<br />
wie Spracherkennungsysteme einschließen. Gerade solche natürlichsprachlichen<br />
Komponenten könnten durch Ihre noch einfachere Be<strong>die</strong>nung weitere Nutzergruppen erschließen,<br />
<strong>die</strong> bisher <strong>die</strong> elektronischen Me<strong>die</strong>n gemieden haben. Um ferner kürzere Reaktionszeiten<br />
im SMS-Segment zu erreichen, sowie <strong>die</strong> Kosten für <strong>die</strong> Benutzer zu reduzieren ist<br />
mittelfristig mit einem Ausbau des Systems und damit mit Zugangsnummern direkt in allen<br />
deutschen Mobilfunknetzen zu rechnen. Weiterhin wird <strong>der</strong> Auskunftsalgorithmus in <strong>der</strong> Stufe<br />
3 realisiert, was <strong>die</strong> Anfor<strong>der</strong>ungen an <strong>die</strong> Hardware und damit <strong>die</strong> Betriebskosten reduziert,<br />
allerdings eine proprietiäre Lösung basierend auf dem Auskunftsalgorithmus <strong>der</strong> FhG<br />
IVI mit sich bringt.<br />
Da <strong>die</strong> <strong>mobile</strong> <strong>Echtzeit</strong>auskunft als offenes System gestaltet wurde steht auch <strong>der</strong> Implementierung<br />
von zukünftigen Diensten <strong>der</strong> 3. Mobilfunkgeneration nichts im Wege. Damit ist eine<br />
Zukunftssicherheit <strong>der</strong> getätigten Aufwände sichergestellt und <strong>die</strong> Fahrgäste <strong>der</strong> Dresdner<br />
Verkehrsbetriebe können sich auf <strong>die</strong>, mit jeweils mo<strong>der</strong>nsten Telematik<strong>die</strong>nsten erstellten<br />
Auskünfte verlassen.<br />
11