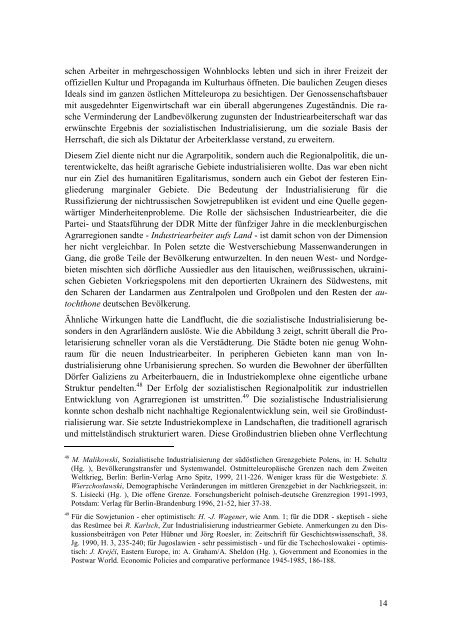Die sozialistische Industrialisierung – toter Hund ... - von Helga Schultz
Die sozialistische Industrialisierung – toter Hund ... - von Helga Schultz
Die sozialistische Industrialisierung – toter Hund ... - von Helga Schultz
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
schen Arbeiter in mehrgeschossigen Wohnblocks lebten und sich in ihrer Freizeit der<br />
offiziellen Kultur und Propaganda im Kulturhaus öffneten. <strong>Die</strong> baulichen Zeugen dieses<br />
Ideals sind im ganzen östlichen Mitteleuropa zu besichtigen. Der Genossenschaftsbauer<br />
mit ausgedehnter Eigenwirtschaft war ein überall abgerungenes Zugeständnis. <strong>Die</strong> rasche<br />
Verminderung der Landbevölkerung zugunsten der Industriearbeiterschaft war das<br />
erwünschte Ergebnis der <strong>sozialistische</strong>n <strong>Industrialisierung</strong>, um die soziale Basis der<br />
Herrschaft, die sich als Diktatur der Arbeiterklasse verstand, zu erweitern.<br />
<strong>Die</strong>sem Ziel diente nicht nur die Agrarpolitik, sondern auch die Regionalpolitik, die unterentwickelte,<br />
das heißt agrarische Gebiete industrialisieren wollte. Das war eben nicht<br />
nur ein Ziel des humanitären Egalitarismus, sondern auch ein Gebot der festeren Eingliederung<br />
marginaler Gebiete. <strong>Die</strong> Bedeutung der <strong>Industrialisierung</strong> für die<br />
Russifizierung der nichtrussischen Sowjetrepubliken ist evident und eine Quelle gegenwärtiger<br />
Minderheitenprobleme. <strong>Die</strong> Rolle der sächsischen Industriearbeiter, die die<br />
Partei- und Staatsführung der DDR Mitte der fünfziger Jahre in die mecklenburgischen<br />
Agrarregionen sandte - Industriearbeiter aufs Land - ist damit schon <strong>von</strong> der Dimension<br />
her nicht vergleichbar. In Polen setzte die Westverschiebung Massenwanderungen in<br />
Gang, die große Teile der Bevölkerung entwurzelten. In den neuen West- und Nordgebieten<br />
mischten sich dörfliche Aussiedler aus den litauischen, weißrussischen, ukrainischen<br />
Gebieten Vorkriegspolens mit den deportierten Ukrainern des Südwestens, mit<br />
den Scharen der Landarmen aus Zentralpolen und Großpolen und den Resten der autochthone<br />
deutschen Bevölkerung.<br />
Ähnliche Wirkungen hatte die Landflucht, die die <strong>sozialistische</strong> <strong>Industrialisierung</strong> besonders<br />
in den Agrarländern auslöste. Wie die Abbildung 3 zeigt, schritt überall die Proletarisierung<br />
schneller voran als die Verstädterung. <strong>Die</strong> Städte boten nie genug Wohnraum<br />
für die neuen Industriearbeiter. In peripheren Gebieten kann man <strong>von</strong> <strong>Industrialisierung</strong><br />
ohne Urbanisierung sprechen. So wurden die Bewohner der überfüllten<br />
Dörfer Galiziens zu Arbeiterbauern, die in Industriekomplexe ohne eigentliche urbane<br />
Struktur pendelten. 48 Der Erfolg der <strong>sozialistische</strong>n Regionalpolitik zur industriellen<br />
Entwicklung <strong>von</strong> Agrarregionen ist umstritten. 49 <strong>Die</strong> <strong>sozialistische</strong> <strong>Industrialisierung</strong><br />
konnte schon deshalb nicht nachhaltige Regionalentwicklung sein, weil sie Großindustrialisierung<br />
war. Sie setzte Industriekomplexe in Landschaften, die traditionell agrarisch<br />
und mittelständisch strukturiert waren. <strong>Die</strong>se Großindustrien blieben ohne Verflechtung<br />
48 M. Malikowski, Sozialistische <strong>Industrialisierung</strong> der südöstlichen Grenzgebiete Polens, in: H. <strong>Schultz</strong><br />
(Hg. ), Bevölkerungstransfer und Systemwandel. Ostmitteleuropäische Grenzen nach dem Zweiten<br />
Weltkrieg, Berlin: Berlin-Verlag Arno Spitz, 1999, 211-226. Weniger krass für die Westgebiete: S.<br />
Wierzchosławski, Demographische Veränderungen im mittleren Grenzgebiet in der Nachkriegszeit, in:<br />
S. Lisiecki (Hg. ), <strong>Die</strong> offene Grenze. Forschungsbericht polnisch-deutsche Grenzregion 1991-1993,<br />
Potsdam: Verlag für Berlin-Brandenburg 1996, 21-52, hier 37-38.<br />
49 Für die Sowjetunion - eher optimistisch: H. -J. Wagener, wie Anm. 1; für die DDR - skeptisch - siehe<br />
das Resümee bei R. Karlsch, Zur <strong>Industrialisierung</strong> industriearmer Gebiete. Anmerkungen zu den Diskussionsbeiträgen<br />
<strong>von</strong> Peter Hübner und Jörg Roesler, in: Zeitschrift für Geschichtswissenschaft, 38.<br />
Jg. 1990, H. 3, 235-240; für Jugoslawien - sehr pessimistisch - und für die Tschechoslowakei - optimistisch:<br />
J. Krejči, Eastern Europe, in: A. Graham/A. Sheldon (Hg. ), Government and Economies in the<br />
Postwar World. Economic Policies and comparative performance 1945-1985, 186-188.<br />
14