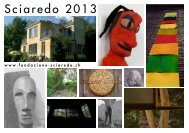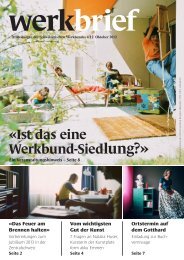Untitled - Schweizerischer Werkbund
Untitled - Schweizerischer Werkbund
Untitled - Schweizerischer Werkbund
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Abb. S. XX: Die gute Form – Sonderausstellung des<br />
Schweizerischen <strong>Werkbund</strong>es, 1949<br />
Gestaltung: Max Bill<br />
Abb. (rechts): Die gute Form – Sonderausstellung des<br />
Schweizerischen <strong>Werkbund</strong>es, 1949; Gestaltung: Max Bill<br />
Foto: Ernst Scheidegger<br />
der Zwanzigerjahre dem kunstgewerblichen Nachwuchs in<br />
relativer Reinheit übermittelt hat.“ 6<br />
Vorbild Schweiz nach 1945<br />
Offensichtlich war sich der Schweizerische <strong>Werkbund</strong> seiner<br />
Verantwortung bewusst: Im kleinen, von totalitären Verhältnissen<br />
und vom Krieg verschonten Land hatte sich die Moderne,<br />
wenn auch verlangsamt, aber doch kontinuierlich weiter entwickeln<br />
können. Daran hatte der mehrheitlich standfest gebliebene<br />
<strong>Werkbund</strong> gewiss seine Verdienste. – Übrigens trifft<br />
Vergleichbares für das ebenfalls kriegsverschonte Schweden<br />
zu, wo die Moderne eine ähnliche Entwicklung durchlief.<br />
Diese Tatsache verschaffte dem schweizerischen wie dem<br />
schwedischen Kulturschaffen zum Kriegsende 1945 einen<br />
beträchtlichen Vorsprung.<br />
Bis Anfang der 1930er Jahre hatte die Moderne-Bewegung in<br />
der Schweiz einigermaßen Schritt gehalten mit der internationalen<br />
Entwicklung. Zu nennen wäre einerseits die 1924 bis<br />
1928 von Hans Schmidt (SWB) und Mart Stam herausgegebene<br />
Zeitschrift ABC - Beiträge zum Bauen 7 . ABC trat für die<br />
Grundsätze eines radikalen Funktionalismus ein und verkündete<br />
die Doktrin einer Schönheit, die dem reinen (primären)<br />
Zweck entspringt: „Komposition von Kuben, von Farben, von<br />
Materialien bleibt ein Hülfsmittel und eine Schwäche. Wichtig<br />
sind die Funktionen, und diese werden die Form bestimmen.“<br />
8<br />
Der zweite bedeutende Beitrag zur Moderne – und wohl radikalster<br />
Bauzeuge des Neuen Bauens in der Schweiz – ist<br />
die <strong>Werkbund</strong>siedlung Neubühl (1928-32). Die an der Projektierung<br />
beteiligten <strong>Werkbund</strong>mitglieder zählten zu den Protagonisten<br />
der Schweizer Moderne. Sie und ihre Mitstreiter<br />
waren es, die damals die Ziele und die Auswirkungen des<br />
<strong>Werkbund</strong>es bestimmten. Umgekehrt verschaffte der <strong>Werkbund</strong><br />
als angesehene Vereinigung ihren Anliegen das nötige<br />
Gewicht und die gesellschaftliche Resonanz.<br />
Anders als in Deutschland, wo die Bewegung der Moderne<br />
nach 1932 abrupt unterbunden wurde, setzte in der Schweiz<br />
eine Differenzierung des Funktionalismusverständnisses ein;<br />
die Fixierung auf die primäre Funktion wurde schrittweise<br />
überwunden. 9 Neu erkannte die Avantgarde auch die komplexen,<br />
über die nackte Zweckmäßigkeit hinaus greifenden, sozialen<br />
und kulturellen Zusammenhänge einer Gestaltungsaufgabe<br />
als zusätzliche Funktionen, für die es eine synthetische<br />
Lösung zu finden galt, an. Auch Schönheit wurde als Funktion<br />
akzeptiert. Dadurch wurden die Gestaltungsprozesse subjektiver;<br />
den Entwerfenden und den Benutzern wurde eine aktive<br />
Rolle zugestanden. 10<br />
So erstaunt es nicht, dass ein erneutes Interesse an formalen<br />
Fragen erwachte. Dies führte zu einer Vielfalt, die bei aller<br />
Modernität auch Platz für Farbigkeit, Stimmung und Materialwirkungen<br />
einräumte. Die radikale Stereometrie der frühen<br />
Moderne wurde modifiziert: gegliedert, verfeinert, überformt.<br />
In der Architektur beispielsweise kamen Vordächer, grobe<br />
Verputze, Schattenfugen und ähnliche Gestaltungsmittel<br />
zum Einsatz. Der Begriff „menschlicher Maßstab“ wurde<br />
zu einem zentralen Kriterium. Auch bei dieser Entwicklung<br />
zählten SWB-Mitglieder zu den Protagonisten. Die Radikalität<br />
der Schweizer Avantgarde wurde, wie der Architekturhistoriker<br />
Martin Steinmann feststellt, im Laufe der dreißiger Jahre<br />
von einer Entwicklung eingeholt, die sich „in allen Ländern,<br />
in denen das Neue Bauen nach und nach zum Teil der allgemeinen<br />
Kultur wurde“, beobachten lässt. Eine Entwicklung,<br />
die auch „eine Kritik am Neuen Bauen“ bedeutete, das man<br />
als unmenschlich, in zu hohem Maß vom Verstand beherrscht<br />
und zu wenig vom Gefühl durchdrungen, beurteilte. 11 So hatte<br />
sich das Neue Bauen in den 1930er und 1940er Jahren<br />
sukzessive von seiner Radikalität losgelöst und nahm dabei<br />
„fremde Werte auf, die es immer schwieriger machten, die<br />
Entscheidungen auf eine einheitliche Theorie zu beziehen. An<br />
ihrer Stelle beriefen sich die Architekten auf ‚das Leben’ oder<br />
‚die Freiheit’.“ 12<br />
Demgegenüber war die Entwicklung der avantgardistischen<br />
Moderne in den kriegsbetroffenen Ländern weitgehend abgebrochen.<br />
Die Gestalter – durch eine kaum überbrückbare<br />
Kluft von den radikalen 1920er Jahren getrennt – mussten sich<br />
1945 völlig neu situieren. Angesichts der immensen Aufgaben<br />
des Wiederaufbaus wandten sie sich mit größtem Interesse<br />
den Entwicklungen der Moderne in den kriegsverschonten<br />
Ländern zu. Diese bekamen in der Folge während der ersten<br />
Nachkriegsjahre wichtige Vorbildfunktion. 13 Den Schweizer<br />
Fachzeitschriften Werk und Bauen + Wohnen sowie dem<br />
schwedischen Byggmästaren 14 kam jetzt eine bedeutende Vermittlerrolle<br />
zu. Ebenso unschätzbar war die Anknüpfung an alte<br />
Bande und den internationalen „geistigen Austausch“ innerhalb<br />
der Werkbünde und andere gleichgesinnte Bewegungen.