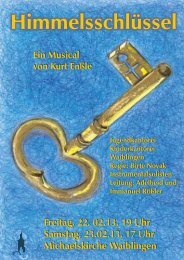Jenseits der Wachstumsillusion Nachhaltige Entwicklung braucht ...
Jenseits der Wachstumsillusion Nachhaltige Entwicklung braucht ...
Jenseits der Wachstumsillusion Nachhaltige Entwicklung braucht ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Jenseits</strong> <strong>der</strong> <strong>Wachstumsillusion</strong><br />
<strong>Nachhaltige</strong> <strong>Entwicklung</strong> <strong>braucht</strong> vor allem soziale Innovationen<br />
Von Reinhard Loske<br />
Es gehört zu den großen Irrtümern <strong>der</strong> Vergangenheit, dass <strong>der</strong> Schutz unserer natürlichen<br />
Lebensgrundlagen und die Verbesserung <strong>der</strong> Umweltqualität quasi „Luxusgüter“ seien, die<br />
man sich nur leisten könne, wenn die Wirtschaft brumme und dringlichere Probleme wie<br />
Armut o<strong>der</strong> Ungerechtigkeit bewältigt seien. Obwohl es noch immer den einen o<strong>der</strong> an<strong>der</strong>en<br />
Protagonisten dieser überkommenen Sichtweise gibt, kann man doch heute mit gewissem<br />
Recht sagen, dass die bundesdeutsche Gesellschaft die Herausfor<strong>der</strong>ungen des notwendigen<br />
ökologischen Strukturwandels im Großen und Ganzen erkannt und bis zu einem gewissen<br />
Grad auch angenommen hat.<br />
Heute wissen wir, dass die Gratisleistungen <strong>der</strong> Natur wie produktive Böden, saubere Luft,<br />
gutes Wasser, biologische Vielfalt o<strong>der</strong> Klimastabilität keine Selbstverständlichkeiten sind,<br />
son<strong>der</strong>n dass wir das „Naturkapital“ ebenso pflegen müssen wie das „menschgemachte<br />
Kapital“, also unsere Gebäude, öffentlichen Infrastrukturen für Energie, Verkehr, Wasser,<br />
Stoffströme und Kommunikation, Bildungs-, Sozial- und Gesundheitseinrichtungen. Wenn<br />
wir nicht angemessen in diese beiden Formen von „Kapital“ investieren, drohen Einbußen an<br />
Wohlstand und Lebensqualität.<br />
Wir wissen auch, dass unsere Kulturlandschaften und Naturräume mit ihren Siedlungen und<br />
ihrer vielfältigen Tier- und Pflanzenwelt Identifikationsorte sind, an denen die Menschen<br />
hängen, in denen sie wirtschaften, sich erholen und zur Ruhe kommen wollen. Aus diesem<br />
Grund hat <strong>der</strong> Naturschutz in <strong>der</strong> Bevölkerung einen wachsenden Stellenwert, auch wenn ihm<br />
in <strong>der</strong> Praxis noch immer ökonomische Interessen, schlechte Planung und schlechte<br />
Gewohnheiten im Wege stehen. Ob <strong>der</strong> Naturschutz mit „Eigenrechten <strong>der</strong> Natur“ begründet<br />
wird, mit seiner Rolle als „weicher Standortfaktor“, als „touristisches Asset“ o<strong>der</strong> als<br />
„wissenschaftliche Notwendigkeit“, er gehört heute aller Verbesserungsnotwendigkeit zum<br />
Trotz zum gesellschaftlichen Wertekanon.<br />
Am schwersten tun wir uns als Gesellschaft damit, das gewachsene Umweltbewusstsein<br />
tatsächlich in eine konsequente Strategie zur Erneuerung und zum Umbau unserer Wirtschaft<br />
und unserer Infrastrukturen umzusetzen. Sicher, das Bekenntnis, Ökologie und Ökonomie<br />
seien keine Gegensätze, son<strong>der</strong>n zu versöhnen, geht allen leicht über die Lippen, von<br />
1
Industrie- und Handelskammern bis zu den Gewerkschaften, von Umweltverbänden bis zu<br />
den Kirchen. Aber darüber, was das für Infrastrukturen, Produktionsweisen und Lebensstile<br />
bedeutet, gehen die Meinungen doch nach wie vor recht weit auseinan<strong>der</strong>.<br />
Ein gewisser Konsens scheint sich darin abzuzeichnen, dass nach <strong>der</strong> Phase des „end-ofpipe“-Umweltschutzes<br />
<strong>der</strong> Filter, Katalysatoren, Klärtechniken und Mülltrennung nun das<br />
forciert werden muss, was gemeinhin als integrierter Umweltschutz bezeichnet wird und im<br />
politischen Raum wahlweise als ökologische Industriepolitik, ökologische Mo<strong>der</strong>nisierung<br />
o<strong>der</strong> „Green New Deal“ gepriesen wird, gern auch unter <strong>der</strong> Überschrift „Grünes Wachstum“.<br />
Im Zentrum dieses Ansatzes stehen die Verbesserung <strong>der</strong> Ressourcen- und Energieeffizienz,<br />
die Abfallvermeidung, das Stoffstrommanagement, die Einführung geschlossener<br />
Wasserkreisläufe und schadstoffarmer Produkte und Verfahren, vor allem aber <strong>der</strong> Ersatz<br />
fossiler (Kohle, Öl, Gas) und nuklearer Brennstoffe durch erneuerbare Energie- und<br />
Rohstoffquellen (Wind, Sonne, Wasser, Biomasse, Erdwärme). Und in <strong>der</strong> Tat lässt sich<br />
sagen, dass sich hier ein weites Feld <strong>der</strong> Möglichkeiten auftut, auf dem nicht nur<br />
Umweltverbesserungen zu erreichen sind, son<strong>der</strong>n auch neue Arbeitsplätze winken. Für ein<br />
Industrieland wie Deutschland ist das konsequente Verfolgen einer solchen grünen<br />
Mo<strong>der</strong>nisierungsstrategie von hoher wirtschaftlicher Attraktivität: Die Wertschöpfung bleibt<br />
im Lande, die Innovationskraft wird ebenso gestärkt wie die Wettbewerbsfähigkeit auf<br />
globalen Zukunftsmärkten, und nicht zuletzt lassen sich durch diese Techniken zumindest<br />
mittelfristig Kosten sparen – spätestens dann, wenn „Peak Oil“, „Peak Gas“, „Peak<br />
Everything“ und die entsprechenden Verknappungen mit ihren Preiseffekten voll zuschlagen..<br />
Beispiel Energie: Durch Energieeinsparung, verbesserte Energieeffizienz und den Ausbau<br />
erneuerbarer Energien wird makroökonomisch nichts an<strong>der</strong>es getan, als (teure)<br />
Energieimporte und (umweltschädliche) inländische Kohleför<strong>der</strong>ung durch inländischen<br />
Ingenieursverstand, inländische Handwerksleistungen und inländische Technologie zu<br />
ersetzen. Kurzum: An die Stelle von Importen und Umweltschäden tritt„grüne“<br />
Wertschöpfung, die sich über alle Sektoren <strong>der</strong> Volkswirtschaft erstreckt: von <strong>der</strong><br />
Landwirtschaft über Handwerk und Industrie bis zum Dienstleistungs- und Wissenssektor.<br />
Eine solche Strategie ist allerdings kurzfristig durchaus mit Kosten verbunden, weil in die<br />
neuen Strukturen ja zunächst investiert werden muss. Es ist deshalb auch nicht<br />
auszuschließen, dass es vorübergehend zu Anpassungsproblemen kommt. Als Stichwort seien<br />
hier die notwendigerweise steigenden Energiepreise genannt, die sich vor allem für<br />
2
einkommensschwache Haushalte und im internationalen Wettbewerb stehende<br />
energieintensive Industrien als schwierig erweisen können. Hier sind intelligente und faire<br />
Lösungen durch die Politik erfor<strong>der</strong>lich, vor allem, um die dringend notwendige Akzeptanz<br />
<strong>der</strong> Bevölkerung für die Energiewende aufrechtzuerhalten und zu för<strong>der</strong>n.<br />
Politik muss aktiv kommunizieren und darf sich nicht wegducken, wenn es schwierig wird.<br />
Die Botschaft muss lauten: Ja, es gibt heute und morgen Kosten des Handelns, und die<br />
müssen gerecht verteilt werden, aber es würde morgen und übermorgen ungleich höhere<br />
Kosten für die Gesellschaft geben, wenn wir nicht handelten! Unsere Aufgabe ist es, dafür zu<br />
sorgen, dass die anfallenden Kosten in Grenzen gehalten, gerecht aufgeteilt und nicht einseitig<br />
bestimmten Bevölkerungsgruppen aufgebürdet werden.<br />
Klar sollte sein: Im Zentrum aller energiepolitischen Bemühungen muss die<br />
Energieeinsparung stehen. Die beste Energie, ob Strom, Wärme o<strong>der</strong> Kraftstoff, ist die, die<br />
erst gar nicht produziert werden muss, weil sie nicht ge<strong>braucht</strong> wird. Instrumente aus dem<br />
Baukasten <strong>der</strong> ökologischen Finanzpolitik, die entsprechende Anreize geben, sind hier die<br />
Mittel <strong>der</strong> Wahl. Dazu gehören <strong>der</strong> Abbau umweltschädlicher Subventionen,<br />
För<strong>der</strong>programme für Effizienztechnik, steuerliche Anreize zur Energieeinsparung und eine<br />
intelligente Weiterentwicklung <strong>der</strong> ökologischen Steuerreform. Sie hat eine „zweite Chance“<br />
verdient.<br />
Richtig ist zwar, dass wir uns bis Mitte des Jahrhun<strong>der</strong>ts eine weitgehende Vollversorgung<br />
mit erneuerbaren Energien vornehmen. Aber auch an diese flächenintensive<br />
Energieerzeugungsform müssen über die reine CO2-Bilanz hinausgehende ökologische<br />
Anfor<strong>der</strong>ungen gestellt werden. Große Staudämme etwa mögen CO2-freie Wasserkraft<br />
erzeugen, aber sie sind gewaltige Eingriffe in Natur- und Kulturräume.Auch für<br />
siedlungsnahe Windrä<strong>der</strong> gibt es Grenzen <strong>der</strong> Akzeptanz. Vor allem <strong>der</strong> Irrweg des Biosprits,<br />
des massiven Energiepflanzenanbaus und des Ertränkens auch noch <strong>der</strong> letzten<br />
nährstoffarmen Wiese im Mittelgebirge durch die Güllefluten <strong>der</strong> Massentierhaltung muss<br />
beendet werden. Bioenergie kann einen Beitrag zur Energiewende leisten, aber nur dann,<br />
wenn sie nicht zu Lasten von Ernährungssicherheit, landschaftlicher Vielfalt und<br />
Bodenfruchtbarkeit geht. Auch erneuerbare Energie ist eben nicht zum ökologischen Nulltarif<br />
zu haben. Auch sie brauchen viele Rohstoffe und viel Fläche. Soviel Wahrheit muss sein.<br />
Letztgenanntes Beispiel verweist auf zwei Problemkreise, die bei einer rein<br />
technologieorientierten Strategie des „grünen Wachstums“ oft nicht berücksichtigt werden.<br />
3
Zum einen: In einer auf permanentes Wachsen von Produktion und Konsum orientierten<br />
Wirtschaft werden die technisch realisierten Einspareffekte bei Ressourcen- und<br />
Energieverbrauchdurch Mengeneffekte wie<strong>der</strong> aufgefressen: Ja, wir haben sparsamere Autos,<br />
aber immer mehr davon, sparsamere Elektrogeräte, aber immer mehr elektrische<br />
Anwendungen, besser gedämmte Häuser, aber immer größere Wohnungen, mehr erneuerbare<br />
Energie, aber anhaltend hohe fossile Stromerzeugungskapazität … Im Ergebnis bleibt <strong>der</strong><br />
Ressourcenverbrauch trotz technischen Fortschritts konstant o<strong>der</strong> steigt sogar. Wir müssen<br />
uns also mit <strong>der</strong> „Wachstumsfrage“ beschäftigen, auch wenn das politisch nach wie vor heikel<br />
ist.<br />
Zum an<strong>der</strong>en: Neben <strong>der</strong> Technologie bestimmen auch unsere Lebensstile und sozialen<br />
Praktiken den Umwelt- und Ressourcenverbrauch: unser Fleischkonsum, unser<br />
Mobilitätsverhalten, unsere Art zu wohnen, zu arbeiten, zu kommunizieren, zu reisen und<br />
einzukaufen. Gerade hierlassen sich gewaltige Umweltentlastungspotenziale erschließen:<br />
Wenn wir die notwendige Erwerbsarbeitszeit zwischen allen besser aufteilen und reduzieren,<br />
weniger Fleisch essen, weniger Unnützes kaufen, weniger wegwerfen, mehr reparieren und<br />
wie<strong>der</strong>verwerten, mehr gemeinschaftlich nutzen, mehr Nützliches an an<strong>der</strong>e weitergeben,<br />
mehr Verantwortung übernehmen undunser Geld sinnvoll anlegen, dann ist das im Regelfall<br />
gut für die Natur, gut für den sozialen Zusammenhaltund gut für die individuelle<br />
Zufriedenheit.<br />
Erzeuger-Verbraucher-Gemeinschaften, Energiegenossenschaften, Car Sharing,<br />
Fahrradleihsysteme, Mitfahr- o<strong>der</strong> Mitwohnzentralen, öffentliche Transportsysteme,<br />
Recyclingbörsen, Tauschringe, gemeinschaftliche Stadtgärten o<strong>der</strong> Wohnprojekte,<br />
Übergangsnutzungen leerstehen<strong>der</strong> Immobilien, all das hat ein ebenso großes<br />
Umweltverbesserungspotenzial wie es Windrä<strong>der</strong> und Solaranlagen haben. Die Wahrheit ist,<br />
dass sich soziale und technische Innovationen oft her hervorragend ergänzen.<br />
Der Abbau von Wachstumszwängen, ob auf dem Arbeitsmarkt o<strong>der</strong> im<br />
Rentenversicherungssystem, in den öffentlichen Haushalten o<strong>der</strong> in <strong>der</strong> Verteilungspolitik,<br />
wird für die gesättigten Industriegesellschaften zur politischen Aufgabe erster Ordnung. Vor<br />
allem die Finanzmärkte als rabiatester aller Wachstumstreiber müssen domestiziert werden.<br />
Letzten Endes geht es um eine Erhöhung <strong>der</strong> Resilienz von Gesellschaften, also das<br />
Unabhängig werden vom Vorhandensein permanenten Wirtschaftswachstums. Ein System,<br />
das nur funktioniert, wenn es dauernd wächst, und kollabiert, sobald Wachstum ausbleibt, ist<br />
definitiv we<strong>der</strong> sozial noch ökonomisch durchhaltbar.<br />
4
Momentan gibt es eine Tendenz, ökologische Politik auf Technologie und „grünes<br />
Wachstum“ zu reduzieren. Das ist vielleicht nachvollziehbar, aber dennoch falsch, vor allem<br />
ist es zu bequem. Was wir ebenso sehr brauchen wie Technologiesprünge sind soziale<br />
Innovationen und ein Kulturwandel, <strong>der</strong> den Zwang zum ewigen Mehr überwindet und<br />
immaterielle Werte (re-)kultiviert: von einer umfassenden Bildung über bürgerschaftliches<br />
Engagement bis zu neuen Formen <strong>der</strong> Tauschbeziehungen jenseits <strong>der</strong> Geldwirtschaft.<br />
Das kann Politik sicher nicht verordnen, wohl aber auf vielerlei Weise unterstützen. Vor allem<br />
die städtische Kommunalpolitik kann viele <strong>der</strong> genannten sozialen Innovationen beför<strong>der</strong>n.<br />
Weltweit sind heute die urbanen Ballungsräume die bevorzugten Experimentierfel<strong>der</strong> und<br />
sozialen Labore für kulturelle Neuerungen. Die Politik sollte das, was sich heute unter<br />
Überschriften wie „Transition Towns“ (Städte im Wandel), „Commoning“ (Gemeinsame<br />
Nutzung, Pflege und <strong>Entwicklung</strong> öffentlicher Güter) o<strong>der</strong> „Social Banking“<br />
(Wie<strong>der</strong>indienstnahme des Finanzsektor für eine nachhaltige <strong>Entwicklung</strong> von Gesellschaft<br />
und Realwirtschaft) entwickelt, genau beobachten und zu verstehen versuchen. Sonst verpasst<br />
sie den Anschluss und wird weiter de-legitimiert.<br />
Fazit: Ökologische Politik muss heute beides sein, För<strong>der</strong>in technischer Innovationen, die den<br />
Stoffwechsel zwischen Mensch und Natur auf eine neue, eine nachhaltige Basis stellen, und<br />
zugleich För<strong>der</strong>in eines Kulturwandels, <strong>der</strong> sich vom Zwang zum ewigen Mehr befreit und<br />
Wachstumsdruck von <strong>der</strong> Gesellschaft nimmt. Ob das alles reicht, um die großen<br />
Verän<strong>der</strong>ungen wie den Klimawandel o<strong>der</strong> den Schwund <strong>der</strong> biologischen Vielfalt<br />
aufzuhalten o<strong>der</strong> mindestens zu begrenzen, können wir heute nicht mit letzter Sicherheit<br />
sagen. Aber handeln können wir!<br />
Dr. Reinhard Loske ist promovierter Volkswirt und habilitierter Politikwissenschaftler. Er war<br />
bremischer Senator für Umwelt, Bau, Verkehr und Europa (2007 bis 2011), Mitglied des<br />
Deutschen Bundestages und stellvertreten<strong>der</strong> Vorsitzen<strong>der</strong> <strong>der</strong> Fraktion„Bündnis90/Die<br />
Grünen“ (1998 bis 2007) und Wissenschaftler am Wuppertal Institut für Klima, Umwelt und<br />
Energie, wo er u.a. die Forschungsgruppe „Zukunftsfähiges Deutschland“ und das Projektfeld<br />
„Klimapolitik“ leitete (1992 bis 1998). Heute arbeitet er freiberuflich in <strong>der</strong> internationalen<br />
<strong>Entwicklung</strong>szusammenarbeit, insbeson<strong>der</strong>e in Südafrika. Zu seinen bekanntesten Büchern<br />
(z.T. mit an<strong>der</strong>en) gehören „Wie weiter mit <strong>der</strong> Wachstumsfrage?“ (2012), „Abschied vom<br />
Wachstumszwang“ (2010), „Die Zukunft <strong>der</strong> Infrastrukturen“ (2005), „Klimapolitik“ (1997),<br />
„Greeningthe North. A Post-Industrial Blueprintfor Ecology and Equity“ (1998) und<br />
„Zukunftsfähiges Deutschland“ (1996).<br />
5