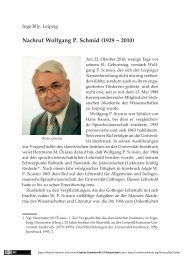413 Rezensionen und Neuerscheinungen talia Filatkina (Trier ...
413 Rezensionen und Neuerscheinungen talia Filatkina (Trier ...
413 Rezensionen und Neuerscheinungen talia Filatkina (Trier ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Rezensionen</strong> <strong>und</strong> <strong>Neuerscheinungen</strong><br />
<strong>413</strong><br />
<strong>talia</strong> <strong>Filatkina</strong> (<strong>Trier</strong>), Variation im<br />
Bereich der formelhaften Wendungen<br />
am Beispiel der Luxemburger Rechnungsbücher<br />
(1388–1500) (S. 79 – 95);<br />
Doris Tophinke / Nadine Wallmeier<br />
(Paderborn), Textverdichtungsprozesse<br />
im Spätmittelalter: Syntaktischer Wandel<br />
in mittelniederdeutschen Rechtstexten<br />
des 13.–16. Jahrh<strong>und</strong>erts (S. 97–116);<br />
Konrad SchrÖder / Judith Walter<br />
(Augsburg), Die Stadt als Ort europäi<br />
scher Mehrsprachigkeit: Erwerb <strong>und</strong><br />
Vermittlung moderner Fremdsprachen<br />
in Augsburg im Zeitalter der Frühen<br />
Neuzeit (S. 117–162); Manuela BÖhm<br />
(Kassel), Sprachwechsel in der Stadt<br />
<strong>und</strong> auf dem Land – Struktur <strong>und</strong> Dynamik<br />
des Sprachkontakts bei Brandenburger<br />
Hugenotten vom 17. bis 19.<br />
Jahrh<strong>und</strong>ert (S. 163 –187) [mit Hinweis<br />
auf u. a. Namenseindeutschungen als<br />
Zeichen rascher Akkulturation]; Marija<br />
Lazar (Hamburg), Über deutschen<br />
Einfluss <strong>und</strong> Eigendynamik in russischen<br />
Geschäftsbriefen der Petrinischen<br />
Epoche (S. 189 –199); Catherine Squires<br />
(Moskau), Hoch- <strong>und</strong> Niederdeutsch<br />
im mittelalterlichen Halberstadt. Probleme<br />
einer Erforschung der Sprachverhältnisse<br />
in der historischen Stadt (S.<br />
201–220); Sarah Horstkamp (Münster),<br />
„von der Pbstischen Finsternß zum<br />
hellscheinenden Evangelischen Liechte“<br />
– Konfessionalisierung der Sprache in<br />
Konversionsschriften des konfessionellen<br />
Zeitalters? (S. 221–238; Anna-Maria<br />
Balbach (Münster), „Hier ruhen wir<br />
in dieser Grufft, biß Unser Herr uns zu<br />
sich rufft.“ – Grabinschriften der Frühen<br />
Neuzeit als Spiegel sprachlicher Konfessionalisierung?<br />
Das Beispiel der Stadt<br />
Augsburg (S. 239 –251). – Alle Beiträge<br />
schließen mit ausführlichen Literaturverzeichnissen<br />
ab.<br />
Volkmar Hellfritzsch, Stollberg<br />
Antroponimia Polski od XVI do<br />
końca XVIII wieku. Wybór artykułów<br />
hasłowych oraz wykazy nazwisk wraz<br />
z chronologią i geografią [Die Anthroponymie<br />
Polens vom 16. bis zum Ende<br />
des 18. Jahrh<strong>und</strong>erts. Eine Auswahl von<br />
Wörterbuchartikeln sowie Verzeichnisse<br />
der Familiennamen zusammen mit<br />
ihrer Chronologie <strong>und</strong> Geographie],<br />
pod redakcą Aleksandry CieŚlikowej<br />
przy współpracy Katarzyny Skowronek<br />
[unter der Redaktion von Aleksandra<br />
CieŚlikowa, unter Mitarbeit<br />
von Katarzyna Skowronek]. Tom II:<br />
H-Mą, opracował zespół [bearbeitet<br />
von]: Halszka GÓrny, Zygmunt Klimek,<br />
Małgorzata Magda-Czekaj, Maria Malec,<br />
Elena Palinciuc, Elżbieta Supranowicz,<br />
Agnieszka Wieczorek-Ostrowska.<br />
Kraków: Wydawnictwo LEXIS 2009.<br />
436 S.<br />
Mit dem zweiten Band setzen die Mitarbeiter<br />
der anthroponomastischen<br />
Ar beitsstelle im Institut für polnische<br />
Sprache an der Polnischen Akademie<br />
der Wissenschaften in Krakau die Publikation<br />
ihrer Arbeitsergebnisse zu den<br />
Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons-BY 3.0 Deutschland Lizenz. http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/
414 <strong>Rezensionen</strong> <strong>und</strong> <strong>Neuerscheinungen</strong><br />
Familiennamen Polens vom 16. bis zum<br />
Ende des 18. Jahrh<strong>und</strong>erts fort.<br />
Da Walter Wenzel 1 in seiner ausführlichen<br />
Besprechung zu Band 1 eine<br />
umfassende Würdigung mit einer Einordnung<br />
des Werkes in die Forschungslandschaft<br />
vorgenommen hat, sind die<br />
nachfolgenden Ausführungen bewußt<br />
kurz gefaßt.<br />
Auf die Einleitung der Herausgeberin<br />
Aleksandra CieŚlikowa (5– 6) folgen<br />
Ergänzungen zu den Quellen (7– 9), zur<br />
Literatur (10–14) <strong>und</strong> zu den Abkürzungen<br />
(15). Den Hauptteil des Bandes<br />
macht erwartungsgemäß <strong>und</strong> dem Konzept<br />
des Werkes folgend das umfangreiche<br />
Namenbuch (17– 415) aus. Es ist<br />
in zwei Strängen angelegt, von denen<br />
jeweils der erste die detaillierte Behandlung<br />
einer Auswahl von Familiennamen<br />
bildet, der 2. aus Registern zur Chronologie<br />
<strong>und</strong> Geographie der Familiennnamen<br />
Polens besteht. Konkret heißt dies,<br />
daß unter einem bestimmten Buchstaben,<br />
z. B. dem K, jeweils eine Anzahl<br />
von Familiennamen ausführlich behandelt<br />
wird. Der Stichwortaufbau einer<br />
solchen Namenbehandlung folgt den<br />
aus Band 1 bekannten Kriterien. Neben<br />
dem Wörterbuch der altpolnischen Personennamen<br />
<strong>und</strong> seiner auswertenden<br />
Bände 2 wurden u.a. eine ganze Reihe<br />
regionaler Monographien herangezogen.<br />
Enthalten sind in der Stichwortbearbeitung<br />
auch Angaben zur Wortbildungsstruktur<br />
sowie zur Verbreitung<br />
eines Namens in Polen. Nebenformen<br />
werden durch Verweise auf das jeweilige<br />
Hauptstichwort angeschlossen.<br />
An diesen 1. Teil, d.h. die detaillierte<br />
Behandlung einer Auswahl von Familiennamen,<br />
schließt sich dann zu demselben<br />
Buchstaben ein Register von Familiennamen<br />
mit ihrer Chronologie <strong>und</strong><br />
Geographie an. Soweit vorhanden, wird<br />
der Erstbeleg des Namens genannt. Auf<br />
Namen, die zuvor als ausführliches<br />
Stichwort behandelt wurden, wird lediglich<br />
verwiesen. Weibliche Familiennamen<br />
sind im Register am Zusatz fem.<br />
gut zu erkennen. Auch die Verbreitung<br />
des jeweiligen Familiennamens in Polen<br />
erfährt der Nutzer.<br />
Die Hälfte des Alphabets ist mit den<br />
Bänden I <strong>und</strong> II bereits annähernd geschafft.<br />
Die Gratulation an die Arbeitsgruppe<br />
zu diesem großartigen Ergebnis<br />
verbindet sich mit dem Wunsch nach<br />
weiteren Bänden, denn vom beneidenswert<br />
guten Bearbeitungsstand der Personennamen<br />
Polens profitiert nicht nur<br />
die polnische <strong>und</strong> die gesamtslawische<br />
anthroponomastische Forschungs- <strong>und</strong><br />
Lexikonarbeit, sondern u.a. auch die<br />
Untersuchung der Personennamen in<br />
1 Vgl. Walter Wenzel, in: NI 93/94 (2008), 301–<br />
303.<br />
2 Słownik staropolskich nazw osobowych. Pod<br />
red. i ze wstępem W. Taszyckiego. Bd. 1– 6;<br />
pod kierunkiem M. Malec. Bd. 7. Wrocław,<br />
Warszawa, Kraków, Gdańsk 1965 –1987 <strong>und</strong><br />
Indeks a tergo do Słownika staropolskich<br />
nazw osobowych. Pod red. A. CieŚlikowej i<br />
M. Malec. Kraków 1993 sowie Słownik etymologiczno-motywacyjny<br />
staropolskich nazw<br />
osobowych, cz. 1–7. Kraków 1995 –2002.
<strong>Rezensionen</strong> <strong>und</strong> <strong>Neuerscheinungen</strong><br />
415<br />
Deutschland, unter denen bekanntlich<br />
eine beträchtliche Anzahl ursprünglich<br />
polnischer Familiennamen nachgewiesen<br />
ist.<br />
Inge Bily, Leipzig<br />
Der Südwesten im Spiegel der Namen.<br />
Gedenkschrift für Lutz Reichardt. Hg.<br />
von Albrecht Greule <strong>und</strong> Stefan Hackl.<br />
Stuttgart: W. Kohlhammer 2011 (Veröffentlichungen<br />
der Kommission für<br />
geschichtliche Landesk<strong>und</strong>e in Baden-<br />
Württemberg. Reihe B: Forschungen.<br />
Bd. 184), VIII + 263 S.<br />
Nachdem die baden-württembergische<br />
Namenforschung am 29. April 2009<br />
mit Lutz Reichardt einen ihrer Protagonisten<br />
verloren hat, widmen seine<br />
Fre<strong>und</strong>e, Kollegen <strong>und</strong> Schüler ihm nun<br />
eine Gedenkschrift: „Auf diese Weise<br />
sollten sowohl Werk <strong>und</strong> Verdienst des<br />
Verstorbenen gewürdigt werden als<br />
auch durch die Aufnahme von Beiträgen<br />
zu Forschungsperspektiven, die direkt<br />
oder indirekt durch Lutz Reichardt angeregt<br />
wurden, dokumentiert werden,<br />
dass seine Leistungen vorbildlich waren.“<br />
(VII) Die Reihe „Veröffentlichungen<br />
der Kommission für geschichtliche<br />
Landesk<strong>und</strong>e in Baden-Württemberg“<br />
ist sicher der richtige Ort für diese Würdigung<br />
von Lutz Reichardts Werk. Im<br />
Vorwort (VI-VII) skizzieren die Herausgeber<br />
kurz die wichtigsten Forschungsbeiträge<br />
des Verstorbenen <strong>und</strong> schaffen<br />
so einen gelungenen Einstieg in den<br />
vorliegenden Sammelband.<br />
Mit dem ersten Beitrag bietet Martina<br />
Winner einen einleitenden Forschungsüberblick<br />
über „Baden-Württemberg in<br />
Ortsnamenbüchern“ (1– 9). Zuerst werden<br />
die bisherigen Forschungsarbeiten<br />
beschrieben (inklusive einer Auflistung<br />
von Reichardts Ortsnamenbüchern);<br />
wo ältere Forschungsansätze kritisiert<br />
werden, finden sich allerdings keine<br />
neuen Vorschläge zur Etymologie<br />
des jeweiligen Siedlungsnamens. Die<br />
folgenden Punkte stellen aktuelle Forschungsprojekte<br />
<strong>und</strong> zukunftsweisende<br />
Projektplanungen vor, die sich mit dem<br />
Raum Baden-Württemberg befassen.<br />
Einen richtungsweisenden Beitrag<br />
liefern Anja Makrutzki <strong>und</strong> Jörg Riecke<br />
mit den Ausführungen „‚Südwestdeutscher<br />
Ortsnamenatlas‘ – eine Projektskizze“<br />
(11–23). Nach der Anerkennung<br />
des Beitrags von Lutz Reichardt zur<br />
baden-württembergischen Ortsnamenforschung,<br />
präsentieren sie eine sehr<br />
genaue Projektbeschreibung, die eine<br />
Möglichkeit aufzeigt, bereits verfügbares<br />
Datenmaterial vergleichend auszuwerten,<br />
<strong>und</strong> über Baden-Württemberg<br />
hinaus den gesamten südwestdeutschen<br />
Sprachraum mit einbezieht. Als Vorbild<br />
für den geplanten Atlas dient der Deutsche<br />
Familiennamenatlas (dfa): Angepasst<br />
an die Bedürfnisse der Ortsnamenforschung<br />
soll der Atlas zunächst einen<br />
grammatischen (Graphematik <strong>und</strong> Phonematik,<br />
Morphematik <strong>und</strong> Derivation,<br />
Syntagmatik sowie Translation) <strong>und</strong>