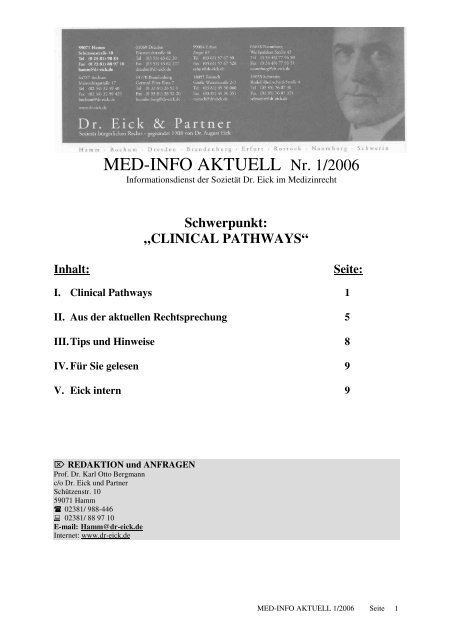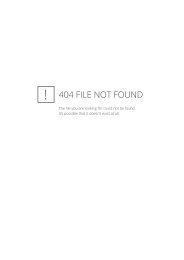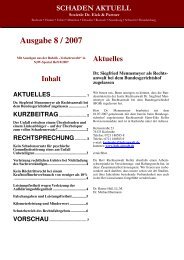MED-INFO AKTUELL Nr. 1/2006 - Dr. Eick & Partner
MED-INFO AKTUELL Nr. 1/2006 - Dr. Eick & Partner
MED-INFO AKTUELL Nr. 1/2006 - Dr. Eick & Partner
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
¡<br />
<strong>MED</strong>-<strong>INFO</strong> <strong>AKTUELL</strong> <strong>Nr</strong>. 1/<strong>2006</strong><br />
Informationsdienst der Sozietät <strong>Dr</strong>. <strong>Eick</strong> im Medizinrecht<br />
Schwerpunkt:<br />
„CLINICAL PATHWAYS“<br />
Inhalt:<br />
Seite:<br />
I. Clinical Pathways 1<br />
II. Aus der aktuellen Rechtsprechung 5<br />
III. Tips und Hinweise 8<br />
IV. Für Sie gelesen 9<br />
V. <strong>Eick</strong> intern 9<br />
⌦ REDAKTION und ANFRAGEN<br />
Prof. <strong>Dr</strong>. Karl Otto Bergmann<br />
c/o <strong>Dr</strong>. <strong>Eick</strong> und <strong>Partner</strong><br />
Schützenstr. 10<br />
59071 Hamm<br />
02381/ 988-446<br />
02381/ 88 97 10<br />
E-mail: Hamm@dr-eick.de<br />
Internet: www.dr-eick.de<br />
<strong>MED</strong>-<strong>INFO</strong> <strong>AKTUELL</strong> 1/<strong>2006</strong> Seite 1
<strong>MED</strong>-<strong>INFO</strong> <strong>AKTUELL</strong> <strong>Nr</strong>. 1/<strong>2006</strong><br />
Informationsdienst der Sozietät <strong>Dr</strong>. <strong>Eick</strong> im Medizinrecht<br />
I. „Clinical Pathways“<br />
Im Krankenhausmanagement wird immer<br />
mehr von klinischen Behandlungspfaden<br />
oder „clinical pathways“ als Instrument<br />
guter und gleichzeitig wirtschaftlich tragbarer<br />
Krankenhausleistung gesprochen.<br />
Was sind clinical pathways Wie sind sie<br />
aus rechtlicher Sicht einzuordnen<br />
Mit der Einführung der Fallpauschalenhonorierung<br />
nach den DRG-System sind die<br />
Klinikträger aufgefordert, Diagnostik und<br />
Therapie bei Patienten mit spezifischen<br />
Symptomen, Diagnosen oder Therapien zu<br />
standardisieren. Denn bei gleicher Vergütung<br />
pro Fall müssen sich Krankenhäuser<br />
über Kosten und Qualität messen lassen<br />
können. Wie schwierig dies ist, kann nur<br />
ermessen, wer den Klinikalltag kennt. Das<br />
Instrument der klinischen Behandlungspfade<br />
gibt es in den englischsprachigen<br />
Ländern seit über 30 Jahren, die medizinrechtliche<br />
Literatur in Deutschland beschäftigt<br />
sich erst jüngst mit diesem Phänomen<br />
(vgl. Oberender (Hrsg.) Clinical<br />
Pathways, Stuttgart 2005; Kahla-Witzsch,<br />
Geisinger, Clinical Pathways in der Krankenhauspraxis,<br />
Stuttgart, 2004. Bereits<br />
vorher Dykes, Wheeler (Hrsg.), Critical<br />
Pathways - Interdisziplinäre Versorgungspfade,<br />
DRG-Management-Instrumente,<br />
Bern 2002).<br />
Entscheidungen über den Ressourceneinsatz,<br />
also die Effizienz der ärztlichen Leistung<br />
bestimmen den Leistungsprozess und<br />
damit das qualitative Ergebnis. Klinische<br />
Behandlungspfade sind also in erster Linie<br />
ein betriebswirtschaftliches Instrument<br />
eines einzelnen Krankenhausträgers auf<br />
freiwilliger Basis, im Wege der Prozessstandardisierung<br />
eine bessere Grundlage<br />
für die zeitliche Koordination der Prozesse<br />
und der Resourcen in der Klinik zu haben.<br />
Insofern unterscheiden sich die klinischen<br />
Behandlungspfade als in erster Linie betriebswirtschaftliches<br />
Instrument auf freiwilliger<br />
Basis von den Richtlinien und<br />
Leitlinien in der Medizin. Deshalb sei ein<br />
kurzer Überblick zur rechtlichen Einordnung<br />
von Clinical Pathways gestattet.<br />
Auch wenn in der medizinischen Literatur<br />
die folgenden Begriffe vielfach synonym<br />
verwendet werden, bemühen sich insbesondere<br />
die ärztliche Zentralstelle für Qualitätssicherung,<br />
die Leitlinien-Konferenz<br />
der AWMF und das Deutsche Leitlinien<br />
Clearing-Verfahren, die Begriffe zu trennen,<br />
da die Unterschiede nicht nur schematischer<br />
Natur sind.<br />
1.)<br />
Richtlinien sind Regelungen des Handelns<br />
oder Unterlassens, die von einer rechtlich<br />
legitimierten Institution konsentiert,<br />
schriftlich fixiert und veröffentlicht werden,<br />
für den Rechtsraum dieser Institution<br />
<strong>MED</strong>-<strong>INFO</strong> <strong>AKTUELL</strong> 1/<strong>2006</strong> Seite 2
<strong>MED</strong>-<strong>INFO</strong> <strong>AKTUELL</strong> <strong>Nr</strong>. 1/<strong>2006</strong><br />
Informationsdienst der Sozietät <strong>Dr</strong>. <strong>Eick</strong> im Medizinrecht<br />
verbindlich sind und deren Nichtbeachtung<br />
definierte Sanktionen nach sich zieht.<br />
Richtlinien räumen dem einzelnen Arzt nur<br />
einen geringen Ermessensspielraum ein.<br />
2.)<br />
Leitlinien sind systematisch entwickelte<br />
Entscheidungshilfen über angemessene<br />
Vorgehensweisen bei speziellen diagnostischen<br />
und therapeutischen Problemstellungen.<br />
Sie stellen den in einem definierten<br />
transparent gemachten Vorgehen erzielten<br />
Konsens mehrerer Experten aus unterschiedlichen<br />
Fachbereichen und Arbeitsgruppen<br />
zu bestimmten ärztlichen Vorgehensweisen<br />
dar und werden regelmäßig<br />
aktualisiert. Sie lassen dem Arzt einen Entscheidungsspielraum<br />
und beschreiben<br />
Handlungskorridore, von denen in begründeten<br />
Einzelfällen auch abgewichen werden<br />
kann.<br />
3.)<br />
Versorgungspfade (Clinical/Critical Pathways,<br />
Patientenpfade, Behandlungspfade)<br />
sind Versorgungspläne, welche die optimale<br />
Abfolge der wichtigsten Interventionen<br />
bei der Versorgung eines Patienten mit<br />
einer bestimmten Diagnose oder einer Behandlung<br />
als dokumentierte Pläne des klinischen<br />
Managements festlegen, in denen<br />
die entscheidenden Behandlungsschritte<br />
identifiziert und entlang einer Zeitachse<br />
sequentiert werden. Sie werden meist im<br />
interdisziplinären Team entwickelt. Versorgungspfade<br />
setzen also da an, wo Leitlinien<br />
aufhören.<br />
vgl. zu allem: Standards und Richtlinien in<br />
Behandlungspfaden: Standardisierbarkeit<br />
ärztlicher Leistungen, Ollenschläger/<br />
Kirchner, in Oberender, Clinical Pathways,<br />
Stuttgart 2005, S. 118 ff.<br />
Haben wir so den Versorgungspfad/Behandlungspfad<br />
(„Clinical Pathways“)<br />
eingeordnet – zu Leitlinien und<br />
Richtlinien wäre noch viel zu sagen –, ergeben<br />
sich gleichzeitig viele Fragen nach<br />
den Vorteilen und Nachteilen einer solchen<br />
Umsetzungslösung von Leitlinien für das<br />
einzelne Krankenhaus unter Berücksichtigung<br />
der betriebswirtschaftlichen Aspekte<br />
speziell dieses Krankenhauses. Steigern<br />
Clinical Pathways die Transparenz im<br />
Krankenhaus durch Beschreibung von Leistungen,<br />
Qualität und Kosten Bilden sie<br />
eine Informationsbasis für die Prozessoptimierung<br />
im Krankenhaus Können sie<br />
Vorbildfunktion für unerfahrene Ärzte und<br />
Pflegekräfte entwickeln, können sie unter<br />
Umständen sogar eine Nachweisfunktion<br />
bei Arzthaftungsfragen entwickeln (Oberender,<br />
S. 23). Können bestehende Behandlungspfade<br />
die ärztliche Therapiefreiheit<br />
einschränken Können sie die Weiterentwicklung<br />
des ärztlichen Standards gefährden<br />
Leisten sie einer Defensivmedizin<br />
Vorschub Können sie unter Umständen<br />
sogar zu einer negativen Risikoselektion<br />
<strong>MED</strong>-<strong>INFO</strong> <strong>AKTUELL</strong> 1/<strong>2006</strong> Seite 3
<strong>MED</strong>-<strong>INFO</strong> <strong>AKTUELL</strong> <strong>Nr</strong>. 1/<strong>2006</strong><br />
Informationsdienst der Sozietät <strong>Dr</strong>. <strong>Eick</strong> im Medizinrecht<br />
und einem Abschieben des Patienten in<br />
Krankenhäuser höherer Versorgungsstufe<br />
führen Alle diese Fragen zu beantworten,<br />
würde den Rahmen dieses Beitrages<br />
sprengen und von den rechtlichen Überlegungen<br />
ablenken. Alle bisherigen auch in<br />
der Praxis konzeptionellen Instrumente<br />
sind nach den Worten ihrer Verfasser Instrumente<br />
zur Qualitätssicherung (Tiemann,<br />
Clinical Pathways, Instrumente zur<br />
Qualitätssicherung, in Führen und Wirtschaften<br />
1996, 454 ff.; Schmidt/Heuser,<br />
Weiterentwicklung der Fallpauschalen zu<br />
Patientenbehandlungsleitlinien, Führen<br />
und Wirtschaften 1994, 173 ff.). Sie verfolgen<br />
gemeinsam das Ziel, die optimale<br />
Behandlung von Patienten transparent zu<br />
machen und die Zufälligkeit medizinischer<br />
Leistungserbringung so weit wie möglich<br />
in planbare und koordinierte Behandlungsabläufe<br />
zu überführen (vgl. auch Bräu,<br />
fallorientiertes Prozessmanagement im<br />
Krankenhaus, Bayreuth 2001).<br />
Einigkeit besteht aber darüber, dass Qualitätsschwankungen<br />
hinsichtlich Prozessdurchführung,<br />
Leistungsergebnis und Patientenzufriedenheit<br />
auch bei größtmöglicher<br />
Standardisierung nie zu vermeiden<br />
sind. Einigkeit besteht auch darüber, dass<br />
Umfang und Ablauf der Leistungsprozesse<br />
Patienten individuell variieren. Die größten<br />
und gewichtigsten Gefahren werden aber<br />
in der Einschränkung der Therapiefreiheit<br />
gesehen (eingehend Loß/Nagel, Ärztliches<br />
Handeln im Spannungsfeld zwischen Leitlinien<br />
und Therapiefreiheit, in Oberender<br />
S. 158 ff.). Gleich ob angestellter oder niedergelassener<br />
Arzt, der Arztberuf ist seinem<br />
inneren Wesen nach ein freier Beruf<br />
(§ 1 Abs. 2 DÄO). Einschränkungen der<br />
Therapiefreiheit bestehen nur insoweit, als<br />
die Therapiewahl in der gesetzlichen<br />
Krankenversicherung das Wirtschaftlichkeitsgebot<br />
zu berücksichtigen hat, da der<br />
Versicherte lediglich Anspruch auf ausreichende,<br />
zweckmäßige und das Maß des<br />
Notwendigen nicht überschreitende Leistungen<br />
hat. Es darf nicht verkannt werden,<br />
dass klinische Behandlungspfade den Freiraum<br />
ärztlichen Ermessens in einem weiteren<br />
Umfange einschränken, ohne die Besonderheit<br />
des jeweiligen Krankheitsfalles,<br />
insbesondere auch die Eigenheiten und den<br />
Willen des Patienten berücksichtigen zu<br />
können. Es darf auch nicht verkannt werden,<br />
dass gerade in Fächern mit rapiden<br />
wissenschaftlichen Fortschritten entwickelte<br />
Behandlungspfade veraltet und standardwidrig<br />
sein können, somit eine weitere<br />
Haftungsgefahr heraufbeschwören können.<br />
Schließlich besteht die Gefahr, dass es in<br />
klinischen Behandlungspfaden zu einer<br />
Vermischung des ärztlichen Standards,<br />
also des Medical Practice mit gesundheitsökonomischen<br />
Zielen kommt.<br />
Die Thematik der „Behandlungspfade“<br />
wird also möglicherweise zukünftig von<br />
haftungsrechtlicher Relevanz sein.<br />
<strong>MED</strong>-<strong>INFO</strong> <strong>AKTUELL</strong> 1/<strong>2006</strong> Seite 4
<strong>MED</strong>-<strong>INFO</strong> <strong>AKTUELL</strong> <strong>Nr</strong>. 1/<strong>2006</strong><br />
Informationsdienst der Sozietät <strong>Dr</strong>. <strong>Eick</strong> im Medizinrecht<br />
II.<br />
Aus der aktuellen Rechtsprechung<br />
Wird zum Transport eines infolge ärztlichen<br />
Fehlverhaltens schwerstbehinderten<br />
Kindes von den Eltern ein Fahrzeug<br />
angeschafft, sind die Anschaffungskosten<br />
als Mehrbedarf gemäß § 843 Abs. 1<br />
BGB grundsätzlich erstattungsfähig.<br />
LG Trier, Urteil vom 15.6.2005 – 4 O<br />
421/03 -<br />
Die Entscheidung beschäftigt sich mit der<br />
Erstattungsfähigkeit von Anschaffungskosten<br />
für ein behindertengerechtes<br />
Kraftfahrzeug, und zwar durch den<br />
schädigenden Arzt.<br />
Der Kläger ist durch ärztliches Fehlverhalten<br />
des Beklagten körperlich und geistig<br />
schwerstbehindert. Infolge einer schweren<br />
Hirnschädigung leidet er unter einer ausgeprägten<br />
Zerebral-Parese und ist bei allen<br />
Verrichtungen des täglichen Lebens auf<br />
fremde Hilfe angewiesen.<br />
In einem im Jahre 2000 abgeschlossenen<br />
Teilvergleich verpflichtete sich der hinter<br />
dem Beklagten stehende Haftpflichtversicherer,<br />
sich an den Anschaffungskosten<br />
eines behindertengerechten Kraftfahrzeuges<br />
mit 15.000,00 DM zu beteiligen. Die<br />
Eltern des Klägers hatten zunächst einen<br />
gebrauchten Pkw erworben, veräußerten<br />
den Pkw jedoch im April 2003 und erwarben<br />
anstelle dieses Fahrzeugs einen Kleinbus<br />
zum Kaufpreis von 36.000,00 €. An<br />
diesem Fahrzeuge beteiligte sich die Haftpflichtversicherung<br />
des Beklagten mit<br />
10.000,00 € und begründete die Teilzahlung<br />
damit, dass der Kauf eines derartigen<br />
Fahrzeugs behindertenbedingt nicht erforderlich<br />
gewesen sei. Klageweise machte<br />
der Kläger nun den Restkaufpreis gegenüber<br />
dem beklagten Arzt selbst geltend.<br />
Das LG Trier nahm eine Zahlungsverpflichtung<br />
des schädigenden Arztes an. Die<br />
Ersatzpflicht ergebe sich aus dem Gesichtspunkt<br />
der vermehrten Bedürfnisse<br />
gemäß § 843 Abs. 1 BGB. Die Kosten für<br />
ein Fahrzeug, mit dem die aufgrund der<br />
Schwerstbehinderung des Klägers erforderlichen<br />
Transporte zu Ärzten, Ergotherapeuten,<br />
Krankengymnasten usw. durchgeführt<br />
werden, sei Vermögensschaden<br />
gemäß § 843 Abs. 1 2. Alt. BGB. Der Begriff<br />
der „Vermehrung der Bedürfnisse“<br />
erfasse die verletzungsbedingten Mehraufwendungen,<br />
die den Zweck haben,<br />
Nachteile auszugleichen oder zu vermeiden,<br />
die dem Verletzten infolge der dauernden<br />
Beeinträchtigung seines körperlichen<br />
und geistigen Wohlbefindens entstehen.<br />
Es müsse sich dabei um Mehraufwendungen<br />
handeln, die dauernd und regelmäßig<br />
erforderlich sind und nicht der Herstel-<br />
<strong>MED</strong>-<strong>INFO</strong> <strong>AKTUELL</strong> 1/<strong>2006</strong> Seite 5
<strong>MED</strong>-<strong>INFO</strong> <strong>AKTUELL</strong> <strong>Nr</strong>. 1/<strong>2006</strong><br />
Informationsdienst der Sozietät <strong>Dr</strong>. <strong>Eick</strong> im Medizinrecht<br />
lung der Gesundheit dienen, wie dies z.B:<br />
bei Heilungskosten der Fall sei.<br />
Die Entscheidung befindet sich im Einklang<br />
mit der bisherigen Rechtsprechung<br />
zu verletzungsbedingten Mehraufwendungen<br />
im Sinne des § 843 Abs. 1 BGB, wonach<br />
beispielsweise auch die Anschaffung<br />
eines Rollstuhls (BGH NJW 182, 757), der<br />
Ausbau eines der Behinderung angepassten<br />
Eigenheimes (OLG Stuttgart, VersR 1998,<br />
366) und die Anschaffungskosten eines<br />
Kraftfahrzeugs, wenn dadurch der Verletzte<br />
in die Lage versetzt wird, seinen Arbeitsplatz<br />
aufzusuchen (OLG München,<br />
VersR 1984, 245), erstattungsfähig sind.<br />
Bemerkenswert ist, dass das LG Trier einen<br />
über den geschlossenen Teilvergleich<br />
mit der Versicherung hinausgehenden Ersatzanspruch<br />
des geschädigten Kindes gegen<br />
den Arzt postuliert hat.<br />
Zu den Grenzen der Durchführung des<br />
selbständigen Beweisverfahrens im<br />
Arzthaftungsprozess<br />
Thür. OLG, Beschl. v. 19.12.2005<br />
– 4 W 503/05 -<br />
Nach der Rechtsprechung des BGH ist<br />
anerkannt, dass in Arzthaftungssachen das<br />
selbständige Beweisverfahren gemäß § 485<br />
Abs. 2 ZPO grundsätzlich statthaft ist<br />
(BGHZ 153, 302). In der Rechtsprechung<br />
der Obergerichte besteht jedoch Einigkeit<br />
(OLG Nürnberg, OLGR Nürnberg 2001,<br />
273; OLG Köln, OLGR Köln 2002, 264,<br />
OLGR Köln 2000, 234; KG, NJW-RR<br />
1999, 1369), dass ein selbständiges Beweisverfahren<br />
unzulässig ist, wenn es allein<br />
der Ausforschung dient, um damit erst<br />
die Voraussetzungen für eine Klage zu<br />
schaffen und die Grundlagen für einen<br />
beweiserheblichen Tatsachenvortrag zu<br />
gewinnen. Auch in dem zugrunde liegenden<br />
Fall hat das Thüringer Oberlandesgericht<br />
die sofortige Beschwerde gegen den<br />
die Durchführung des selbständigen Beweisverfahrens<br />
versagenden Beschluss des<br />
LG Erfurt als unbegründet zurückgewiesen.<br />
Zulässigkeitsvoraussetzung für einen<br />
Antrag auf Durchführung des selbständigen<br />
Beweisverfahrens sei, dass der Antragsteller<br />
eine bestimmte Tatsachenbehauptung<br />
aufstelle oder einen festzustellenden<br />
Zustand bezeichne. Das bedeute für<br />
das Arzthaftungsverfahren, dass der Antragsteller<br />
unter Bezeichnung gewisser<br />
Anhaltspunkte die Behauptung eines ärztlichen<br />
Behandlungsfehlers aufstellen müsse<br />
und das selbständige Beweisverfahren<br />
der Klärung dieses behaupteten Behandlungsfehlers<br />
diene. Da sich der umfangreiche<br />
Fragenkatalog der Antragstellerin jedoch<br />
auf die gesamte Behandlung ihres<br />
verstorbenen Ehemannes, namentlich auf<br />
die Dokumentation, die Medikation, die<br />
sonstige ärztliche Betreuung und die Nahrungsgabe<br />
beziehe, sei eine Ausforschung<br />
eines möglichen Behandlungsfehlers anzunehmen.<br />
Ohne die nähere Eingrenzung<br />
eines angenommenen Behandlungsfehlers,<br />
der für den Tod des Ehemannes kausal<br />
geworden sein könnte, sei der Antrag unzulässig.<br />
<strong>MED</strong>-<strong>INFO</strong> <strong>AKTUELL</strong> 1/<strong>2006</strong> Seite 6
<strong>MED</strong>-<strong>INFO</strong> <strong>AKTUELL</strong> <strong>Nr</strong>. 1/<strong>2006</strong><br />
Informationsdienst der Sozietät <strong>Dr</strong>. <strong>Eick</strong> im Medizinrecht<br />
bei dem Arzt entwickelt hat. Der Senat<br />
führt wörtlich aus:<br />
1. Ein niedergelassener Gynäkologe,<br />
der bei einer 57-jährigen Patientin<br />
ohne besondere Risikofaktoren im Jahre<br />
2000 keine Mammographie zur Krebsvorsorge<br />
im zweijährigen Intervall veranlasst,<br />
handelt (noch) nicht fehlerhaft.<br />
2. Ein (unterstellt) fehlerhaftes Unterlassen<br />
einer Mammographie zur<br />
Krebsvorsorge führt nicht zu einer Beweislastumkehr<br />
nach den Grundsätzen<br />
der Verletzung der Befunderhebungsund<br />
–sicherungspflicht, wenn keine<br />
Symptome für eine Erkrankung vorliegen.<br />
OLG Hamm, Urt. v. 31.08.2005 – 3 U<br />
277/04<br />
Das Urteil beschäftigt sich mit der interessanten<br />
Frage, wann eine Standardmethode<br />
den Charakter als Standard verliert und zu<br />
einem Behandlungsfehler wird. Beispielhaft<br />
wird in diesem Urteil die Mammographie<br />
vorgestellt. Der Sachverständige hat<br />
das Unterlassen einer Mammographie bei<br />
einer 57-jährigen Patientin ohne besondere<br />
Risikofaktoren im Jahre 2000 als Behandlungsfehler<br />
bewertet. Hier hat der Senat<br />
die Auffassung des Sachverständigen nicht<br />
geteilt und weist darauf hin, dass der Sachverständige<br />
bei seiner Beurteilung den<br />
Maßstab zugrundegelegt hat, der sich erst<br />
später nach der Vorstellung der Klägerin<br />
„Ein Behandlungsfehler setzt voraus, dass<br />
der Arzt in der Behandlungssituation nicht<br />
das Verhalten zeigte, welches nach dem<br />
anerkannten und gesicherten Stand der<br />
medizinischen Wissenschaft von ihm erwartet<br />
werden musste. Dies ist dann nicht<br />
mehr der Fall, wenn sich die vorgenommeine<br />
Behandlung angesichts des Wissensstandes<br />
in Praxis, Forschung und Lehre<br />
als nicht mehr vertretbar darstellt. Allein<br />
das Vorhandensein neuerer wissenschaftlicher<br />
Erkenntnisse führt hingegen noch<br />
nicht zwangsläufig dazu, eine bestimmte<br />
Behandlungsmethode als überholt und<br />
nicht mehr vertretbar anzusehen. Vielmehr<br />
ist eine Unterschreitung des zu fordernden<br />
Qualitätsstandards erst dann gegeben,<br />
wenn die Vorzugswürdigkeit der neuen<br />
Methode im wesentlichen unumstritten<br />
ist“. Der Senat stellt im konkreten Fall<br />
darauf ab, dass aus dem Positionspapier<br />
des Bundesamtes für Strahlenschutz aus<br />
dem Jahre 2002 noch hervorgeht, dass<br />
selbst zu diesem Zeitpunkt noch eine Diskussion<br />
über den Nutzen der Mammographie<br />
im Hinblick auf das damit verbundene<br />
Strahlenrisiko stattfand und die Aussagekraft<br />
der Studien, die den Nutzen der<br />
Mammographie belegt hat, von verschiedenen<br />
Wissenschaftlern in Zweifel gezogen<br />
wurde. Die Kassenärztliche Vereinigung<br />
Westfalen-Lippe teilte in einem<br />
Rundschreiben aus Oktober 2002 noch mit,<br />
dass nach einer Auskunft des Bundesministeriums<br />
für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit<br />
allein das Alter der Frau<br />
nicht ausreiche, um eine Mammographie<br />
<strong>MED</strong>-<strong>INFO</strong> <strong>AKTUELL</strong> 1/<strong>2006</strong> Seite 7
<strong>MED</strong>-<strong>INFO</strong> <strong>AKTUELL</strong> <strong>Nr</strong>. 1/<strong>2006</strong><br />
Informationsdienst der Sozietät <strong>Dr</strong>. <strong>Eick</strong> im Medizinrecht<br />
zu rechtfertigen. Der Senat weist ferner<br />
darauf hin, dass das Unterbleiben einer<br />
Mammographie ohne Vorliegen von Auffälligkeiten<br />
bisher nicht als Behandlungsfehler<br />
gewertet worden war (OLG Stuttgart,<br />
VersR 1994, 1306; OLG Hamburg,<br />
328, für das Jahr 1999). Die Ausführungen<br />
des Sachverständigen ergeben nach Auffassung<br />
des Senats keinen Anhaltspunkt,<br />
warum für das Jahr 2000 bereits eine andere<br />
Bewertung gerechtfertigt sein sollte.<br />
Die Entscheidung ist immerhin bemerkenswert,<br />
da das Gericht einem, wie es<br />
selbst formuliert, renommierten Sachverständigen<br />
nicht folgt und eigene rechtliche<br />
Erwägungen zum Zeitpunkt einer Standardänderung<br />
macht.<br />
III. Tips und Hinweise:<br />
1. Das Gesundheitsmodernisierungsgesetz<br />
(GMG) besteht mehr als 1 Jahr.<br />
Wenn man eine Bilanz der Wirkung dieses<br />
Gesetzes ziehen will, lässt sich erkennen,<br />
dass die angestrebte finanzielle Konsolidierung<br />
der gesetzlichen Krankenversicherung<br />
vorzeitig und vorerst eingetreten ist.<br />
Von den neuen Möglichkeiten im Leistungs-Beitrags-<br />
und Vertragsrecht machen<br />
viele Anbieter im Gesundheitswesen Gebrauch.<br />
Eine Reihe medizinischer Versorgungszentren<br />
ist gegründet, integrierte<br />
Versorgungsverträge sind geschlossen<br />
worden. Der Arzneimittelbereich ist noch<br />
nicht konsolidiert. Daher sind weitere Reformen<br />
im Gesundheitswesen unausweichlich.<br />
Die große Reform steht noch aus.<br />
2. Am 10. Mai <strong>2006</strong> findet in Berlin<br />
das Frühjahrsforum <strong>2006</strong> der Gesellschaft<br />
Deutscher Krankenhaustag (GDK) zum<br />
Thema „Krankenhaus und Wettbewerb“<br />
statt. Einzelheiten können erfragt werden<br />
unter info@deutscher-krankenhaustag.de.<br />
3. Die Entwicklung der Krankenhauslandschaft<br />
und Investitionsfinanzierung in<br />
den Bundesländern ist in einem instruktiven<br />
Beitrag von Mörsch, in Arzt und Krankenhaus<br />
<strong>2006</strong>, 85 ff., mit verschiedenen<br />
Grafiken plastisch geschildert. Danach ist<br />
die Anzahl der Krankenhäuser zwischen<br />
den Jahren 1991 und 2004 von 2.411 auf<br />
2.166 und damit um rd. 10 % gesunken.<br />
Die Anzahl der aufgestellten Betten fiel im<br />
gleichen Zeitraum von 665.565 auf<br />
531.333 und damit sogar um 20 %. Die<br />
Bettendichte sank sogar um 23 %. Die<br />
Zahl der Behandlungsfälle stieg demgegenüber<br />
im betrachteten Zeitraum um 15<br />
%.<br />
Die Zahl der Krankenhäuser in öffentlicher<br />
Trägerschaft ging deutlich zurück. Betrug<br />
der Anteil 1991 noch 46 %, waren es im<br />
Jahre 2004 nur noch 36 %. Der Anteil der<br />
privaten Krankenhäuser stieg in demselben<br />
Zeitraum von 15 auf 26 %. Der Anteil der<br />
frei gemeinnützigen Krankenhäuser blieb<br />
weitgehend konstant.<br />
Der deutliche Rückgang der KHG-<br />
Fördermittel schlägt sich in der Krankenhausinvestitionsquote<br />
nieder. Die Investitionsquote<br />
sank von 11,1 auf 5,1 %.<br />
<strong>MED</strong>-<strong>INFO</strong> <strong>AKTUELL</strong> 1/<strong>2006</strong> Seite 8
<strong>MED</strong>-<strong>INFO</strong> <strong>AKTUELL</strong> <strong>Nr</strong>. 1/<strong>2006</strong><br />
Informationsdienst der Sozietät <strong>Dr</strong>. <strong>Eick</strong> im Medizinrecht<br />
IV. Für Sie gelesen<br />
1. Wever, Fahrlässigkeit und Vertrauen<br />
im Rahmen der arbeitsteiligen<br />
Medizin, Hamburg 2005<br />
ISSN 1861-1508<br />
Die Dissertation unserer neuen in Hamm<br />
tätigen Kollegin untersucht die Voraussetzungen<br />
der ärztlichen fahrlässigen Strafbarkeit<br />
im deutschen Recht und im angloamerischen<br />
Rechtskreis und erörtert Möglichkeiten<br />
einer Haftungsbegrenzung. Kern<br />
der Arbeit ist die Frage, ob die Haftung für<br />
ärztliche Fahrlässigkeit in sinnvoller Art<br />
und Weise begrenzt werden kann. Mit eingehender<br />
Darstellung der Probleme der<br />
arbeitsteiligen Medizin und des Vertrauensgrundsatzes<br />
in der arbeitsteiligen Medizin<br />
kommt die Verfasserin zu einem interessanten<br />
Vorschlag zur Umsetzung der<br />
Entkriminalisierung leichter ärztlicher<br />
Fahrlässigkeit durch Empfehlung einer<br />
Richtlinie im Strafverfahren.<br />
2. Steffen, Formen der Arzthaftung<br />
in interdisziplinär tätigen Gesundheitseinrichtungen,<br />
Medizinrecht <strong>2006</strong>, S. 75 ff.<br />
Der ehemalige Vorsitzende des Arzthaftungssenates<br />
des Bundesgerichtshofes beschäftigt<br />
sich in einem instruktiven Aufsatz<br />
mit den Formen der Arzthaftung in<br />
interdisziplinär tätigen Gesundheitseinrichtungen,<br />
insbesondere also der Haftung bei<br />
interdisziplinärer Zusammenarbeit von<br />
Ärzten mit anderen Heilberufen unter dem<br />
Dach von Gesundheitseinrichtungen oder<br />
unter dem Dach einer juristischen Person.<br />
Er kommt zu dem Ergebnis, gleichgültig in<br />
welcher Rechtsform die interdisziplinäre<br />
Zusammenarbeit von Ärzten mit Nichtärzten<br />
erfolgt, für den Patienten wir die<br />
Haftungslage bei einer Schädigung durch<br />
eine fehlerhafte Behandlung nicht verkürzt,<br />
sondern die Haftung wir verstärkt, je<br />
enger die Tätigkeitsfelder rechtlich zusammengebunden<br />
sind.<br />
3. Zeitschrift für ärztliche Fortbildung<br />
und Qualität im Gesundheitswesen<br />
100. Jahrgang <strong>2006</strong>, Heft 1<br />
In ihrem 100. Jahrgang beschäftigt sich die<br />
renommierte Zeitschrift in ihrem ersten<br />
Heft speziell mit den Auswirkungen des<br />
GMG auf ambulante Versorgungsformen,<br />
auf die Qualität in der Medizin aus der<br />
Sicht der Institutionen und mit dem Problem<br />
der Gefährdung des Facharztes in<br />
freier Praxis. Beiträge von namhaften Medizinrechtlern<br />
wie Jansen, Dierks, Köhler<br />
und Luxenburger beleuchten verschiedene<br />
Facetten der neuen Versorgungsformen in<br />
der vertragsärztlichen Versorgung.<br />
V. <strong>Eick</strong> intern<br />
Unser Seniorpartner Prof. <strong>Dr</strong>. Bergmann<br />
referierte beim 52. Zahnärztetag Westfalen-Lippe,<br />
der unter dem Motto „Ästhetik<br />
und Implantologie – Therapie oder Luxus“<br />
stand, in einem Gutachterseminar<br />
<strong>MED</strong>-<strong>INFO</strong> <strong>AKTUELL</strong> 1/<strong>2006</strong> Seite 9
<strong>MED</strong>-<strong>INFO</strong> <strong>AKTUELL</strong> <strong>Nr</strong>. 1/<strong>2006</strong><br />
Informationsdienst der Sozietät <strong>Dr</strong>. <strong>Eick</strong> im Medizinrecht<br />
zum Thema Richtlinien und Leitlinien im<br />
Zahnarzthaftungsprozess.<br />
Am 06. Mai <strong>2006</strong> wird Prof. <strong>Dr</strong>. Bergmann<br />
im Rahmen der Weiterbildung zum Transfusionsmediziner<br />
bei der Ärztekammer<br />
Westfalen-Lippe die rechtlichen Aspekte<br />
der klinischen Transfusionsmedizin vortragen.<br />
Herr Rechtsanwalt <strong>Dr</strong>. Alberts wird am<br />
13. Mai <strong>2006</strong> beim Frühjahrskongress der<br />
niedergelassenen Orthopäden in Hamm<br />
über medizinrechtliche Fragen „Rund ums<br />
Knie“ sprechen.<br />
Aufgrund zahlreicher Bitten unserer<br />
Mandantschaft sind wir dazu übergegangen,<br />
Med-Info aktuell als E-Mail zu<br />
verschicken. Mit der <strong>Nr</strong>. 1/<strong>2006</strong> stellen<br />
wir Ihnen erstmals ausschließlich per<br />
E-Mail unsere vierteljährliche Information<br />
zur Verfügung. Wir bitten nochmals<br />
um Übersendung Ihrer E-Mail-<br />
Adressen.<br />
Wir weisen darauf hin, dass jedes bis<br />
jetzt erschienene „Med-Info aktuell“ wie<br />
auch alle zukünftigen bei uns auf der<br />
Homepage unter „Aktuelles“, dort unter<br />
„Infodienst“, zum Ausdruck jederzeit<br />
bereitstehen.<br />
Vorschau auf<br />
<strong>MED</strong>-<strong>INFO</strong> <strong>AKTUELL</strong> 2/<strong>2006</strong><br />
„Risikomanagement und<br />
Qualitätssicherung in der<br />
Orthopädie durch die<br />
Rechtsprechung“<br />
<strong>MED</strong>-<strong>INFO</strong> <strong>AKTUELL</strong> 1/<strong>2006</strong> Seite 10