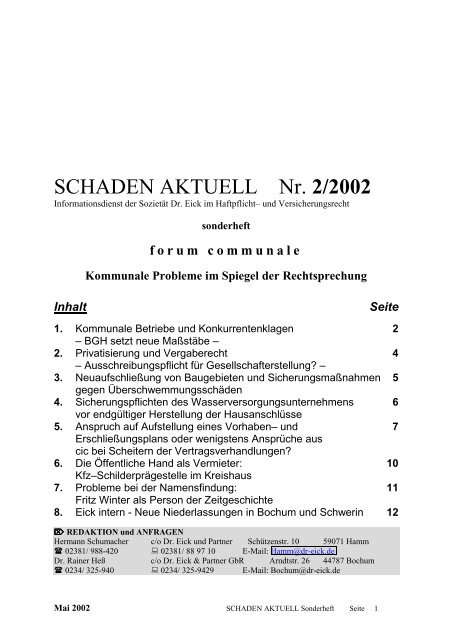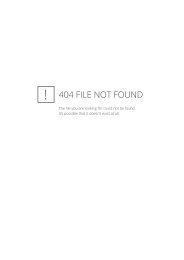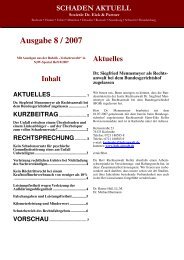Inhalt Seite - Dr. Eick & Partner
Inhalt Seite - Dr. Eick & Partner
Inhalt Seite - Dr. Eick & Partner
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
SCHADEN AKTUELL Nr. 2/2002<br />
Informationsdienst der Sozietät <strong>Dr</strong>. <strong>Eick</strong> im Haftpflicht– und Versicherungsrecht<br />
sonderheft<br />
forum communale<br />
Kommunale Probleme im Spiegel der Rechtsprechung<br />
<strong>Inhalt</strong> <strong>Seite</strong><br />
1. Kommunale Betriebe und Konkurrentenklagen 2<br />
– BGH setzt neue Maßstäbe –<br />
2. Privatisierung und Vergaberecht 4<br />
– Ausschreibungspflicht für Gesellschafterstellung? –<br />
3. Neuaufschließung von Baugebieten und Sicherungsmaßnahmen 5<br />
gegen Überschwemmungsschäden<br />
4. Sicherungspflichten des Wasserversorgungsunternehmens 6<br />
vor endgültiger Herstellung der Hausanschlüsse<br />
5. Anspruch auf Aufstellung eines Vorhaben– und 7<br />
Erschließungsplans oder wenigstens Ansprüche aus<br />
cic bei Scheitern der Vertragsverhandlungen?<br />
6. Die Öffentliche Hand als Vermieter: 10<br />
Kfz–Schilderprägestelle im Kreishaus<br />
7. Probleme bei der Namensfindung: 11<br />
Fritz Winter als Person der Zeitgeschichte<br />
8. <strong>Eick</strong> intern - Neue Niederlassungen in Bochum und Schwerin 12<br />
���� REDAKTION und ANFRAGEN<br />
Hermann Schumacher c/o <strong>Dr</strong>. <strong>Eick</strong> und <strong>Partner</strong> Schützenstr. 10 59071 Hamm<br />
� 02381/ 988-420 � 02381/ 88 97 10 E-Mail: Hamm@dr-eick.de<br />
<strong>Dr</strong>. Rainer Heß c/o <strong>Dr</strong>. <strong>Eick</strong> & <strong>Partner</strong> GbR Arndtstr. 26 44787 Bochum<br />
� 0234/ 325-940 � 0234/ 325-9429 E-Mail: Bochum@dr-eick.de<br />
Mai 2002 SCHADEN AKTUELL Sonderheft <strong>Seite</strong> 1
SCHADEN AKTUELL<br />
Informationsdienst der Sozietät <strong>Dr</strong>. <strong>Eick</strong> im Haftpflicht– und Versicherungsrecht<br />
1. Kommunale Betriebe und<br />
Konkurrentenklagen<br />
– BGH Urteil vom 25.04.2002<br />
– I ZR 250/00 – setzt neue Maßstäbe<br />
Die wirtschaftliche Betätigung von Gemeinden<br />
und Gemeindeverbänden, insbesondere<br />
in Gestalt kommunaler GmbH´s,<br />
hat in den letzten Jahren verstärkt Konkurrentenklagen<br />
rein privater Firmen auf den<br />
Plan gerufen. Zwar hat das BVerwG –<br />
Beschluß vom 21.03.1995 – 1 B 211/94 –<br />
NJW 1995, 2938 – im Fall eines Unternehmensberaters<br />
und Immobilienmaklers,<br />
der sich gegen die Maklertätigkeit einer<br />
Firma FWT wandte, deren Alleingesellschafter<br />
eine Kommune war und deren<br />
Gesellschaftszweck in der Förderung des<br />
Tourismus sowie des Messe– und Kongreßwesens<br />
lag, gegen den privaten Konkurrenten<br />
entschieden. Der Leitsatz der<br />
Entscheidung des BVerwG lautet:<br />
„Grundrechte eines privaten Anbieters<br />
schützen grundsätzlich nicht vor dem Hinzutreten<br />
des Staates oder von Gemeinden<br />
als Konkurrenten, solange die private wirtschaftliche<br />
Betätigung nicht unmöglich<br />
oder unzumutbar eingeschränkt wird oder<br />
eine unerlaubte Monopolstellung entsteht.“<br />
Die Rechtsprechung der Oberlandesgerichte<br />
folgte dieser Leitlinie allerdings<br />
nicht.<br />
Die Oberlandesgerichte Düsseldorf,<br />
Hamm und München vertraten die Auffassung,<br />
daß die Vorschriften der nordrhein–<br />
westfälischen bzw. bayerischen Gemein-<br />
deordnung, mit denen der wirtschaftlichen<br />
Betätigung der Gemeinden Schranken<br />
auferlegt werden, auch den Schutz privater<br />
Wettbewerber bezweckten (vgl. §§ 107,<br />
108 GO NW / Art. 87 – 89 Bay GO). Zu<br />
verweisen ist hier insbesondere auf die<br />
sogenannte Awista–Entscheidung des<br />
OLG Düsseldorf vom 12.01.2000 (NVwZ<br />
2000, 714), das Gelsen–Grün–Urteil des<br />
OLG Hamm vom 23.09.1997 (NJW 1998,<br />
3504), auf das Gebäudemanagement–<br />
Urteil des OLG Düsseldorf vom<br />
29.05.2001 (NVwZ 2002, 248) sowie das<br />
„Elektro–Oktoberfest“–Urteil des OLG<br />
München vom 20.04.2000 (NVwZ 2000,<br />
835 ff). Auch der RhPf VGH hat im Urteil<br />
vom 28.03.2000 (NVwZ 2000, 801) die<br />
Auffassung vertreten, daß die Vorschrift<br />
des § 85 Abs. 1 Nr. 3 RhPf GO<br />
drittschützenden Charakter hat; anders für<br />
Hessen: VGH Kassel, DÖD 1998, 39, 40;<br />
und für Baden–Württemberg OLG<br />
Karlsruhe, NVwZ 2001, 712.<br />
Die Oberlandesgerichte Düsseldorf,<br />
Hamm und München kommen in den erwähnten<br />
Urteilen zu dem Ergebnis, daß<br />
sich aus dem Verstoß gegen die Vorschriften<br />
der Gemeindeordnung über die<br />
Einschränkung der wirtschaftlichen Betätigung<br />
der öffentlichen Hand auch ein Unterlassungsanspruch<br />
des privaten Konkurrenten<br />
aus § 1 UWG ergeben könne.<br />
Das jetzt ergangene Urteil des BGH vom<br />
25.04.2002 im Elektro–Oktoberfest–Fall<br />
dürfte zu einer Korrektur der Rechtsprechung<br />
der Oberlandesgerichte führen:<br />
Mai 2002 SCHADEN AKTUELL Sonderheft <strong>Seite</strong> 2
SCHADEN AKTUELL<br />
Informationsdienst der Sozietät <strong>Dr</strong>. <strong>Eick</strong> im Haftpflicht– und Versicherungsrecht<br />
Der Fall:<br />
Die Parteien stritten darüber, ob der in<br />
eine GmbH umgewandelte frühere Eigenbetrieb<br />
der Stadt München in deren Stadtgebiet<br />
Arbeiten ausführen darf, die früher<br />
ausschließlich private Betriebe des Elektro–Handwerks<br />
ausführten und die nicht<br />
zur Daseinsvorsorge gehörten. Die Klägerin<br />
war seit vielen Jahren auf Messen,<br />
Märkten und Festveranstaltungen im<br />
Raum der Landeshauptstadt München, so<br />
natürlich auch auf dem Oktoberfest, als<br />
Elektro–Betrieb tätig und erstellte die von<br />
den jeweiligen Marktkaufleuten für ihre<br />
fliegenden Bauten benötigten Elektroinstallationen.<br />
Nach Umfirmierung in die<br />
GmbH war die städtische Tochtergesellschaft<br />
dazu übergegangen, derartige<br />
Dienstleistungen selbst zu übernehmen<br />
und auch für Private auszuführen. Sie<br />
wurde daraufhin von den Marktbeschikkern<br />
bevorzugt beauftragt, was die Klage<br />
auslöste. Das Landgericht hat der Unterlassungsklage<br />
stattgegeben, das OLG die<br />
Berufung zurückgewiesen (NVwZ 2000,<br />
835). Es hat die Auffassung vertreten, daß<br />
die Vorschriften der Artikel 87 und 89 der<br />
Bay GO über die wirtschaftliche Betätigung<br />
den Privaten kein subjektiv öffentliches<br />
Abwehrrecht gäben, wohl aber diese<br />
Vorschriften auch seinen Schutz bezweckten,<br />
so daß ein Unterlassungsanspruch<br />
nach § 1 UWG zu bejahen sei.<br />
Die Revision der Beklagten hatte Erfolg. In<br />
der Pressemitteilung des BGH zu dem<br />
noch nicht vollständig vorliegenden Urteil<br />
heißt es:<br />
„Der BGH hat die Ansicht vertreten, daß<br />
eine erwerbswirtschaftliche Tätigkeit einer<br />
Kommune nicht schon deshalb als unlauterer<br />
Wettbewerb gegenüber privaten<br />
Konkurrenten angesehen werden könne,<br />
weil sie der Gemeinde nach Kommunalrecht<br />
untersagt sei. Ansprüche aus dem<br />
UWG richteten sich gegen unlauteres<br />
Wettbewerbsverhalten auf dem Markt. Sie<br />
hätten nicht den Sinn, Wettbewerbern zu<br />
ermöglichen, andere unter Berufung darauf,<br />
daß ein Gesetz ihren Marktzutritt verbiete,<br />
vom Markt fernzuhalten, wenn das<br />
betreffende Gesetz den Marktzutritt nur<br />
aus Gründen verhindern wolle, die den<br />
Schutz des lauteren Wettbewerbs nicht<br />
berührten. Unter dem Gesichtspunkt des<br />
Wettbewerbsrechts, das auch die Freiheit<br />
des Wettbewerbs schütze, sei vielmehr<br />
jede Belebung des Wettbewerbs, wie sie<br />
unter Umständen auch vom Marktzutritt<br />
der öffentlichen Hand ausgehen könne,<br />
grundsätzlich erwünscht. Erwerbswirtschaftliche<br />
Tätigkeiten, die einer Gemeinde<br />
nach Art. 87 Bay GO untersagt sein<br />
könnten, seien als solche nicht unlauter,<br />
und zwar auch dann nicht, wenn sie von<br />
einer Gemeinde ausgeübt würden. Die<br />
Unlauterkeit einer erwerbswirtschaftlichen<br />
Tätigkeit einer Gemeinde könne sich zwar<br />
gerade auch aus ihrer Eigenschaft als öffentlich–rechtlicher<br />
Gebietskörperschaft<br />
und der damit verbundenen besonderen<br />
Stellung gegenüber den anderen Marktteilnehmern,<br />
insbesondere den Verbrauchern,<br />
ergeben – etwa wenn öffentlich–<br />
rechtliche Aufgaben mit der erwerbswirt–<br />
schaftlichen Tätigkeit verquickt würden –<br />
die amtliche Autorität oder das Vertrauen<br />
in die Objektivität und Neutralität der Amts-<br />
Mai 2002 SCHADEN AKTUELL Sonderheft <strong>Seite</strong> 2
SCHADEN AKTUELL<br />
Informationsdienst der Sozietät <strong>Dr</strong>. <strong>Eick</strong> im Haftpflicht– und Versicherungsrecht<br />
führung mißbraucht werde oder der Bestand<br />
des Wettbewerbs auf dem einschlägigen<br />
Markt gefährdet werden. Auf derartige<br />
Umstände stelle die Gemeindeordnung<br />
aber nicht ab. Die wettbewerbsrechtliche<br />
Beurteilung könne sich nur auf die<br />
Art und Weise der Beteiligung der öffentlichen<br />
Hand am Wettbewerb beziehen. Davon<br />
sei die allgemeinpolitische und wirtschaftspolitische<br />
Frage zu unterscheiden,<br />
ob sich die öffentliche Hand überhaupt<br />
erwerbswirtschaftlich betätigen dürfe und<br />
welche Grenzen ihr insoweit gesetzt seien<br />
oder gesetzt werden sollten. Die Lösung<br />
dieser Frage sei Aufgabe der Gesetzgebung<br />
und Verwaltung sowie der parlamentarischen<br />
Kontrolle und für die Gemeinden<br />
und Landkreise gegebenenfalls<br />
der Kommunalaufsicht, nicht aber der ordentlichen<br />
Gerichte bei der ihnen zustehenden<br />
Beurteilung von Wettbewerbshandlungen<br />
nach dem UWG. Dies gelte<br />
auch dann, wenn besondere Vorschriften<br />
zur Einschränkung der erwerbswirtschaftlichen<br />
Betätigung der öffentlichen Hand<br />
erlassen worden seien. Denn auch diese<br />
regelten nur den Zugang zum Wettbewerb<br />
und sagten nichts darüber aus, wie er<br />
auszuüben sei.“<br />
Fazit:<br />
Mit dieser Entscheidung des BGH werden<br />
die Chancen privater Konkurrentenklagen<br />
deutlich herabgesetzt. Allein mit dem Argument,<br />
der kommunale Betrieb verletze<br />
mit seiner wirtschaftlichen Betätigung die<br />
Zulässigkeitsschranken der Gemeindeordnungen,<br />
kann eine Konkurrentenklage<br />
nicht erfolgreich betrieben werden. Andererseits<br />
stellt das BGH–Urteil aber auch<br />
keinen Freifahrtschein für wettbewerbswidriges<br />
Verhalten der öffentlichen Hand<br />
aus. Insbesondere bei folgenden Fallkonstellationen<br />
(vgl. insoweit insbesondere<br />
auch Schink, Wirtschaftliche Betätigung<br />
kommunaler Unternehmen, NVwZ 2002,<br />
129, 139) wird sich auch das privatisierte<br />
Unternehmen der öffentlichen Hand Unterlassungsklagen<br />
nach § 1 UWG ausgesetzt<br />
sehen:<br />
♦ wirtschaftliches Ausnutzen von amtlich<br />
erhaltenen Informationsvorsprüngen<br />
♦ Verquickung hoheitlicher Zulassungen<br />
mit kommerziellen kommunalen Verkaufstätigkeiten<br />
ohne Hinweis auf andere<br />
Bezugsquellen<br />
♦ Ausnutzung enger räumlicher Verbindungen<br />
zwischen Amt und kommunalen<br />
Unternehmen<br />
♦ Werbung durch den Hoheitsträger für<br />
das kommunale Unternehmen<br />
♦ Auftragsvergabe zugunsten kommunaler<br />
Unternehmen ohne Ausschreibung<br />
oder Bevorteilung durch vergaberelevante<br />
Informationen<br />
♦ einseitige Ausübung hoheitlicher Befugnisse<br />
und Gewährung von Serviceleistungen<br />
zugunsten kommunaler<br />
Unternehmen<br />
♦ Ermessensbeeinflussung bei Verwaltungsentscheidungen<br />
♦ Preisdumping zu Lasten der privaten<br />
Konkurrenz durch Zweckentfremdung<br />
öffentlicher Mittel und unfaire Preisgestaltung<br />
♦ Verdrängung privater Konkurrenten<br />
durch Marktmacht öffentlicher Unternehmen<br />
Mai 2002 SCHADEN AKTUELL Sonderheft <strong>Seite</strong> 3
SCHADEN AKTUELL<br />
Informationsdienst der Sozietät <strong>Dr</strong>. <strong>Eick</strong> im Haftpflicht– und Versicherungsrecht<br />
Das oben erwähnte Gebäudemanagement–Urteil<br />
des OLG Düsseldorf vom<br />
29.05.2001 ist noch nicht rechtskräftig.<br />
Über die beim BGH unter dem Aktenzeichen<br />
I ZR 183/01 anhängige Revision ist<br />
noch nicht entschieden.<br />
2. Privatisierung und Vergaberecht<br />
– Auschreibungspflichtigkeit für<br />
Gesellschafterstellung?<br />
Die Auftragsvergabe an eine 100%–ige<br />
Tochtergesellschaft der Gemeinde ist als<br />
sogenanntes inhouse–Geschäft grundsätzlich<br />
nicht ausschreibungspflichtig (vgl.<br />
–insoweit EuGH, Urteil vom 18.11.1999,<br />
EuZW 2000, 246); eine Ausschreibungspflicht<br />
besteht danach nicht, wenn die beauftragte<br />
Gesellschaft von der Kommune<br />
„wie eine eigene Dienststelle“ beherrscht<br />
wird und ihre Tätigkeit im wesentlichen für<br />
diese verrichtet.<br />
Auch die Veräußerung eines Gesellschaftsanteils<br />
an einem privatisierten<br />
kommunalen Unternehmen, etwa einer<br />
Entsorgungs–GmbH, ist als solche nicht<br />
ausschreibungspflichtig, weil es sich nicht<br />
um ein Beschaffungsgeschäft handelt.<br />
Mit Rücksicht darauf, daß durch die Kombination<br />
von – zunächst – Auftragsvergabe<br />
an die kommunale GmbH und anschließender<br />
Anteilsveräußerung das Vergaberecht<br />
umgangen werden kann, neigt die<br />
neuere Rechtsprechung der Vergabekammern<br />
dazu, die Veräußerung einer<br />
Gesellschafterstellung und die vorangehende<br />
oder anschließende Vergabe eines<br />
Dienstleistungsauftrags an die neu entstehende<br />
Gesellschaft als einen einheitlichen<br />
Vorgang zu bewerten und eine Ausschreibungspflicht<br />
zu bejahen (vgl. Vergabekammer<br />
Baden–Württemberg, Beschluß<br />
vom 24.01.2001 – 1 VK 34/00 – NZBau<br />
2001, 340; Vergabekammer Düsseldorf,<br />
Beschluß vom 07.07.2000 – VK 12/2000 –<br />
NZBau 2001, 46). Diese Entscheidungen<br />
betreffen Fallkonstellationen, bei denen für<br />
die Absicht, die Bindungen des Vergaberechts<br />
zu umgehen, der enge zeitliche und<br />
sachliche Zusammenhang zwischen Auftragsvergabe<br />
und Anteilsveräußerung<br />
sprach.<br />
Auch ohne Anhaltspunkte für einen solchen<br />
Umgehungstatbestand hat die Vergabekammer<br />
Brandenburg (Beschluß vom<br />
09.04.2001 – 2 VK 18/01) die Auffassung<br />
vertreten, die Veräußerung eines 51%–<br />
igen Geschäftsanteils an einer<br />
kommunalen Gesellschaft für<br />
Telekommunikationsdienstleistungen sei<br />
ausschreibungspflichtig (im gleichen Sinne<br />
auch Vergabekammer Lüneburg,<br />
Beschluß vom 10.08.1999 – 203 VgK 6/99<br />
– NZBau 2001, 51, 52). Das OLG<br />
Brandenburg hat allerdings die<br />
Entscheidung der Vergabekammer aufgehoben:<br />
Die gesellschaftsrechtliche Bindung,<br />
die durch die Anteilsveräußerung<br />
geschaffen werde, habe gerade keinen<br />
beschaffungsrechtlichen Bezug. Durch die<br />
Einräumung der Gesellschafterstellung sei<br />
der neu eintretenden Gesellschafterin weder<br />
direkt noch indirekt ein öffentlicher<br />
Auftrag zugewendet worden (OLG Brandenburg,<br />
Beschluß vom 03.08.2001 –<br />
Verg 3/01 – VergabeR 2002, 45).<br />
Mai 2002 SCHADEN AKTUELL Sonderheft <strong>Seite</strong> 4
SCHADEN AKTUELL<br />
Informationsdienst der Sozietät <strong>Dr</strong>. <strong>Eick</strong> im Haftpflicht– und Versicherungsrecht<br />
In der Literatur (vgl. etwa Otting, Privatisierung<br />
und Vergaberecht, VergabeR 2002,<br />
11 ff) wird eine Ausschreibungspflicht<br />
dann bejaht, wenn die veräußernde öffentliche<br />
Stelle den Erwerber weiterhin für die<br />
Erbringung öffentlicher Leistungen in<br />
Dienst nimmt, wenn die ganz oder teilweise<br />
veräußerte Gesellschaft auch nach der<br />
Privatisierung bestimmte Dienstleistungen<br />
für die Kommune erbringt.<br />
Fazit:<br />
Die Rechtslage ist noch nicht abschließend<br />
durch die höchstrichterliche Rechtsprechung<br />
geklärt. Im Zweifel wird, um auf<br />
der sicheren <strong>Seite</strong> zu sein, ganz abgesehen<br />
mit den damit in aller Regel verbundenen<br />
wirtschaftlichen Vorteilen, eine<br />
Ausschreibung durchzuführen sein.<br />
3. Neuaufschließung von Baugebieten<br />
und Sicherungsmaßnahmen gegen<br />
Überschwemmungsschäden<br />
Mit dieser Problematik beschäftigt sich das<br />
Urteil des BGH vom 04.04.2002 – III ZR<br />
70/01 – mit dem der BGH ein Urteil des<br />
OLG <strong>Dr</strong>esden aufhob und die Sache zur<br />
erneuten Verhandlung und Entscheidung<br />
an das Landgericht zurückverwies.<br />
Der Fall:<br />
Die Kläger waren Eigentümer eines Einfamilienhauses,<br />
das oberhalb ihres Hauses<br />
liegende Gelände wurde bis zum Jahr<br />
1992 landwirtschaftlich genutzt. Zwischen<br />
den Grundstücken der Kläger und ihren<br />
seitlichen Nachbarn einerseits sowie den<br />
bergseits angrenzenden, damals im Ei-<br />
gentum der beklagten Gemeinde stehenden<br />
Parzellen andererseits befanden sich<br />
ursprünglich ein Erdwall und ein kleiner<br />
Graben, die Niederschlagswasser von den<br />
Unterliegern abhalten sollten. 1992 beschloß<br />
die Gemeinde die Aufstellung eines<br />
Bebauungsplans, der die höher gelegenen<br />
Felder als Baugebiet auswies. Im Zuge<br />
der Bebauung ließ die Gemeinde Erdwall<br />
und Graben beseitigen. Im Sommer 1994<br />
kam es zu heftigen Niederschlägen, wie<br />
sie nur alle 5, wenn nicht alle 50 Jahre<br />
einmal auftreten, die zu einer Überschwemmung<br />
des Kellers des Wohnhauses<br />
der Kläger führten.<br />
Die Entscheidung:<br />
Der BGH betont, daß der beklagten Gemeinde<br />
gemäß § 123 BauGB nach Maßgabe<br />
der Vorschriften des Landesrechts<br />
die Erschließung des Baugebiets, insbesondere<br />
die Herstellung der Erschließungsanlagen<br />
sowie der öffentlichen<br />
Straßen und der Einrichtungen zur<br />
Sammlung und Beseitigung des Abwassers<br />
obliegt. Für Fehler bei der Planung<br />
oder Errichtung derartiger Anlagen haftet<br />
die Gemeinde nach Amtshaftungsgrundsätzen<br />
(BGH NVwZ 1982, 700, 701; NJW<br />
1996, 3208, 3209 jeweils betreffend den<br />
Straßenbau; für Entwässerungsanlagen:<br />
BGHZ 140, 380, 384). Darüber hinaus<br />
besteht nach der Rechtsprechung des<br />
BGH eine allgemeine Amtspflicht der Gemeinden<br />
– auch gegenüber den betroffenen<br />
Wohnungseigentümern – die Wohngrundstücke<br />
eines Baugebiets im Rahmen<br />
des Zumutbaren auch vor den Gefahren<br />
zu schützen, die durch Überschwemmungen<br />
auftreten können (BGHZ 140, 380,<br />
Mai 2002 SCHADEN AKTUELL Sonderheft <strong>Seite</strong> 5
SCHADEN AKTUELL<br />
Informationsdienst der Sozietät <strong>Dr</strong>. <strong>Eick</strong> im Haftpflicht– und Versicherungsrecht<br />
388). Insoweit besteht im Rahmen des<br />
Zumutbaren auch eine Pflicht, vorläufige<br />
Sicherungsmaßnahmen gegen Überschwemmungen<br />
zu treffen, solange die<br />
Erschließungsanlagen noch nicht vorhanden<br />
oder nicht funktionstüchtig sind. Der<br />
BGH beanstandet insbesondere, daß die<br />
zugunsten der Kläger existierenden<br />
Schutzvorkehrungen in Gestalt von Damm<br />
und Graben vor einem Anschluß der höher<br />
gelegenen Flächen an die Kanalisation<br />
beseitigt worden waren. Soweit das<br />
Oberlandesgericht die Kausalität der Beseitigung<br />
dieser Schutzvorrichtungen für<br />
den Schadenseintritt verneint hat, hat der<br />
BGH eine weitere Aufklärung des Sachverhaltes<br />
für erforderlich gehalten.<br />
4. Sicherungspflichten des Wasserversorgungsunternehmens<br />
vor endgültiger<br />
Herstellung der Hausanschlüsse<br />
BGH, Urteil vom 04.12.2001 – VI ZR<br />
447/00 – VersR 2002, 247<br />
Der Fall:<br />
Die Kläger nahmen das kommunale Wasserversorgungsunternehmen<br />
sowie den<br />
von diesem beauftragten Installateurbetrieb<br />
auf Schadensersatz in Anspruch wegen<br />
Eintritts von Wasser aus der örtlichen<br />
Versorgungsleitung in die Kellerräume des<br />
Hauses der Kläger. Es wurde eine neue<br />
Hausanschlußleitung verlegt, die an der<br />
Abzweigstelle von der örtlichen Wasserversorgungsleitung<br />
beginnt, dort durch<br />
einen Schieber verschlossen werden kann<br />
und im Kellerraum des Hauses der Kläger<br />
mit einem Ventil, der sogenannten<br />
Hauptabsperrvorrichtung, endet. Eine<br />
Verbindung zwischen der Hauptabsperrvorrichtung<br />
und dem Wasserverteilungsnetz<br />
des Hauses war noch nicht hergestellt,<br />
insbesondere noch kein Wasserzähler<br />
installiert. Auch ein Wasserversorgungsvertrag<br />
war noch nicht abgeschlossen.<br />
Es drangen 600 m³ Wasser durch die<br />
Hausanschlußleitung in der Kellerräume<br />
des Gebäudes ein, weil weder der Schieber<br />
an der Abzweigstelle noch die<br />
Hauptabsperrvorrichtung im Keller des<br />
Hauses geschlossen worden waren. Die<br />
Kläger machten geltend, das Wasserversorgungsunternehmen<br />
und der Installationsbetrieb<br />
hätten die Verkehrssicherungspflicht<br />
verletzt, weil sie den Schieber<br />
an der Abzweigstelle der Hausanschlußleitung<br />
von der Wasserversorgungsleitung<br />
nicht geschlossen gehalten hätten. Das<br />
Landgericht hat die Klage abgewiesen, die<br />
Berufung wurde zurückgewiesen. Die Revision<br />
der Kläger führte zur Aufhebung<br />
und Zurückverweisung. Die Leitsätze der<br />
Entscheidung lauten:<br />
1. Die Ersatzpflicht nach § 2 Abs. 1 Satz 1<br />
HaftPflG ist gem. § 2 Abs. 3 Nr. 1<br />
HaftPflG auch dann ausgeschlossen,<br />
wenn neben einem Fehler der Außenanlage<br />
einer Wasserversorgungsleitung<br />
ein fehlerhafter Zustand des im<br />
Gebäude befindlichen Teils der Anlage<br />
den Schaden gleichrangig mit verursacht<br />
hat.<br />
2. Der Betreiber einer Wasserversorgungsleitung<br />
ist aufgrund der allgemeinen<br />
Verkehrssicherungspflicht im<br />
Rahmen des § 823 Abs. 1 BGB gehalten,<br />
einen Schieber an der Ab-<br />
Mai 2002 SCHADEN AKTUELL Sonderheft <strong>Seite</strong> 6
SCHADEN AKTUELL<br />
Informationsdienst der Sozietät <strong>Dr</strong>. <strong>Eick</strong> im Haftpflicht– und Versicherungsrecht<br />
zweigstelle einer Hausanschlußleitung<br />
vom örtlichen Versorgungsnetz solan-<br />
ge geschlossen zu halten, bis eine<br />
ordnungsgemäße Verbindung der<br />
Hausanschlußleitung mit dem Lei-<br />
tungsnetz des Hauses hergestellt ist.<br />
3. Dem Geschädigten kann es zum Mit-<br />
verschulden im Sinne des § 254 Abs. 1<br />
BGB gereichen, wenn er nicht im<br />
Rahmen des Möglichen und Zumutba-<br />
ren Sorge dafür trägt, daß die im Keller<br />
seines Hauses befindliche Hauptab-<br />
sperrvorrichtung am Ende der<br />
Hauptanschlußleitung ebenfalls ge-<br />
schlossen bleibt.<br />
Praxishinweis:<br />
Auch das Haftpflichtgesetz ist von den<br />
Neuregelungen betroffen, die mit dem<br />
zweiten Schadensersatzrechtsänderungsgesetz<br />
geplant sind, insbesondere ist eine<br />
ganz erhebliche Anhebung der Haftungshöchstgrenzen<br />
vorgesehen. Der Gesetzentwurf<br />
wird am 31.05.2002 in zweiter<br />
Lesung im Bundesrat behandelt, voraussichtlich<br />
wird das Gesetz zum 01.08.2002<br />
in Kraft treten. Den vom Bundestag bereits<br />
beschlossenen Gesetzentwurf mit den<br />
Beschlußempfehlungen des Rechtsausschusses<br />
übermitteln wir auf Anfrage gerne<br />
per e–mail. Die Sozietät <strong>Dr</strong>. <strong>Eick</strong> &<br />
<strong>Partner</strong> hat über die KomConsult GmbH<br />
Hamm unter Federführung des KSA Bochum<br />
bereits eine Reihe von Seminaren<br />
zu dem geplanten Gesetzentwurf sowie<br />
auch zum Schuldrechtsmodernisierungsgesetz<br />
und zur ZPO–Novelle mitgestaltet.<br />
5. Anspruch auf Aufstellung eines Vorhaben–<br />
und Erschließungsplans oder<br />
wenigstens Ansprüche aus cic bei<br />
Scheitern der Vertragsverhandlungen?<br />
Sächs. OVG, Beschl. v. 09.11.2000<br />
– 1 B 437/00 –<br />
LG Chemnitz, Urt. v. 14.12.2001<br />
– 3 O 1674/01 –<br />
In den zitierten Beschluß hat das Sächs.<br />
OVG in Bautzen klargestellt, daß der Vorhabenträger<br />
bei einem Vorhaben– und<br />
Erschließungsplan lediglich einen Anspruch<br />
darauf hat, daß über seinen Antrag<br />
auf Einleitung eines Satzungsverfahrens<br />
fehlerfrei entschieden wird und sich dieser<br />
Anspruch in aller Regel nicht zu einem<br />
Anspruch auf Einleitung eines Satzungsverfahrens<br />
verdichten kann. Das OVG<br />
führt in diesem Zusammenhang auch aus,<br />
daß sich weder aus einer langen Verfahrensdauer<br />
noch aus der Aufwendung erheblicher<br />
Planungskosten durch den Vorhabenträger<br />
eine Ermessensreduzierung<br />
ergibt. Der Beschluß des OVG betrifft<br />
noch die Regelungen des § 7 Abs. 3<br />
Satz 1 2. Halbsatz BauGB–MaßnG. Für<br />
die jetzt geltende Regelung des § 12<br />
Abs. 2 BauGB gilt im Ergebnis nichts anderes<br />
(vgl. auch VGH Bad.–Württ., Beschl.<br />
v. 22.03.2000, NVwZ 2000, 1060).<br />
Daß bei Scheitern eines Vorhaben– und<br />
Erschließungsplans nur in eng umgrenzten<br />
Ausnahmefällen Schadensersatzansprüche<br />
des Vorhabenträgers in Betracht<br />
kommen, begründet das LG Chemnitz im<br />
Urteil vom 14.12.2001 zutreffend wie folgt:<br />
Mai 2002 SCHADEN AKTUELL Sonderheft <strong>Seite</strong> 7
SCHADEN AKTUELL<br />
Informationsdienst der Sozietät <strong>Dr</strong>. <strong>Eick</strong> im Haftpflicht– und Versicherungsrecht<br />
„1.<br />
Die im Bereich des bürgerlichen Rechts<br />
entwickelten Grundsätze über die Haftung<br />
wegen Verschuldens bei Vertragsschluss<br />
sind grundsätzlich auch im Bereich des<br />
öffentlichen Rechts (Vereinbarungen zwischen<br />
Bürger und Staat) anwendbar. Der<br />
Anspruch wegen Verschuldens bei Vertragsschluss<br />
gründet sich auf das besondere<br />
Vertrauen desjenigen, der sich zum<br />
Zwecke von Vertragsverhandlungen in<br />
den Einflussbereich eines anderen begibt<br />
und auf die Verhaltenspflichten, die dem<br />
anderen Teil daraus und aus dem Gebot<br />
von Treu und Glauben erwachsen. Der<br />
Anspruch beruht also auf dem Erfordernis<br />
des Vertrauensschutzes (BGH DVBl.<br />
1978, 798, 800).<br />
Im Rahmen der Haftung wegen Verschuldens<br />
bei Vertragsschluss ist anerkannt,<br />
dass die Haftung nur unter engen Voraussetzungen<br />
gegeben ist, da sich schon aus<br />
der gesetzlichen Wertung des § 154 BGB<br />
und der Abschlussfreiheit im Rahmen der<br />
Privatautonomie der Grundsatz ergibt,<br />
dass die Parteien bis zu dem Zeitpunkt<br />
nicht gebunden sind, indem sie sich über<br />
sämtliche Punkte geeinigt haben. Daran<br />
ändern grundsätzlich auch bereits getätigte<br />
Aufwendungen oder länger andauernde<br />
Verhandlungen (BGH ZIP 2001,<br />
655) nichts. Etwas anderes ergibt sich nur<br />
dann, wenn eine Partei die Verhandlungen<br />
ohne triftigen Grund abbricht, nachdem sie<br />
in zurechenbarer Weise Vertrauen auf das<br />
Zustandekommen des Vertrages erweckt<br />
hat.<br />
b) Wenn auch eine Gemeinde sich<br />
nicht dahingehend binden kann, eine Satzung<br />
als Ortsgesetz zu erlassen (§ 2 Abs.<br />
3 BauGB) so kann sie doch im Einzelfall<br />
durch ihr Verhalten einen Vertrauenstatbestand<br />
setzen, der sie zwar nicht verpflichtet,<br />
die Planung überhaupt oder in<br />
einer bestimmten Richtung zu betreiben,<br />
der aber bei Enttäuschung des dem anderen<br />
Teil gewährten und von ihm in Anspruch<br />
genommenen Vertrauens zu einem<br />
Schadenersatzanspruch führen kann.<br />
c) Im vorliegenden Fall sind die oben<br />
genannten Voraussetzungen jedoch nicht<br />
gegeben, da die Bekl. dem Kl. zu keiner<br />
Zeit Anlass zu dem Vertrauen gab, dass<br />
der Vorhaben- und Erschließungsplan auf<br />
jeden Fall zustande kommen würde und<br />
der Vorhabenträger auf der Grundlage des<br />
von ihm vorgelegten und mit der Gemeinde<br />
abgestimmten Vorhaben- und Erschließungsplanes<br />
bereit und in der Lage<br />
ist, sich zur Durchführung innerhalb einer<br />
bestimmten Frist und zur Tragung der<br />
Planungs- und Erschließungskosten ganz<br />
oder teilweise verpflichtet (Durchführungsvertrag),<br />
vgl. § 7 Abs. 1 Nr. 2 BauGB-<br />
MaßnG.<br />
aa) Die Bekl. hat aufgrund der Verhandlungen<br />
mit dem Kl. sich nicht so verhalten,<br />
dass dem Verhandlungspartner<br />
unrichtige Eindrücke über den Stand der<br />
Bauleitplanung vermittelt oder Tatsachen<br />
verschwiegen worden wären, und dieser<br />
dadurch zu nachteiligen Vermögensdispositionen<br />
veranlaßt worden wäre. So war es<br />
zwischen den Parteien über einen Zeitraum<br />
von mehreren Jahren klar, dass hin-<br />
Mai 2002 SCHADEN AKTUELL Sonderheft <strong>Seite</strong> 8
SCHADEN AKTUELL<br />
Informationsdienst der Sozietät <strong>Dr</strong>. <strong>Eick</strong> im Haftpflicht– und Versicherungsrecht<br />
sichtlich der Verkaufsfläche des Verbrauchermarktes<br />
noch keine Einigkeit erzielt<br />
und die Entscheidung der Bekl. hiervon<br />
wesentlich abhängig gemacht wurde.<br />
Auch fanden zwischen den Parteien regelmäßige<br />
Besprechungen bzw. schriftliche<br />
Kontakte statt.<br />
bb) Selbst der Umstand, dass zwischen<br />
dem Kl. und der Bekl. über mehrere Jahre<br />
Verhandlungen bzw. Abstimmungen stattgefunden<br />
haben, begründet keine ausreichende<br />
Vertrauensgrundlage für die klägerseits<br />
geltend gemachten Schadensersatzansprüche.<br />
Diesbezüglich ist insbesondere die Stellung<br />
des Vorhabenträgers i.S.d. § 12<br />
BauGB zu beachten. Die Stellung des<br />
Vorhabenträgers ist in rechtlicher Hinsicht<br />
"schwach“, da ihm in der Phase der Erarbeitung<br />
des Vorhaben- und Erschließungsplanes<br />
und dessen Abstimmung mit<br />
der Gemeinde bereits Kosten in größerem<br />
Umfang entstehen können, die als Vorleistungen<br />
grundsätzlich in die Risikosphäre<br />
des Vorhabenträgers fallen (vgl. Krautzberger<br />
in: Ernst/Zinkahn/Bielenberg,<br />
BauGB, § 12, Rn. 114).<br />
Schadensersatzansprüche können deshalb<br />
nicht auf die Änderung der Planungskonzeption<br />
und eine Nichtfortführung früherer<br />
Planaufstellungsverfahren (vgl.<br />
Krautzberger in: Ernst/Zinkahn/Bielenberg,<br />
BauGB, § 2 Rn. 83), sondern ausschließlich<br />
auf die Verhandlungen über den<br />
Durchführungsvertrag (vgl. Bielenberg in:<br />
Ernst/Zinkahn/Bielenberg, BauGB, § 12<br />
Rn. 115) gestützt werden. Vorliegend be-<br />
fanden sich die Verhandlungen zwischen<br />
den Parteien noch in einem Stadium, in<br />
dem die Änderung der Planungskonzeption<br />
für die Beklagte - ohne Entstehung eines<br />
Schadenersatzanspruches - möglich<br />
und die Verhandlungen über den Durchführungsvertrag<br />
noch nicht erreicht waren.<br />
cc) Aufgrund der in rechtlicher Hinsicht<br />
"schwachen" Stellung des Vorhabenträgers<br />
in der Phase der Erarbeitung des<br />
Vorhaben- und Erschließungsplanes kann<br />
sich der Vorhabenträger gegebenenfalls<br />
über eine vertragliche Risikovereinbarung<br />
absichern. Dass eine solche bestand, ist<br />
weder ersichtlich, noch wurde hierzu vorgetragen.<br />
d) Auch ist ein Verschulden der Bekl.<br />
nicht darin zu sehen, dass sie den Kl.<br />
fehlerhaft oder irreführend über den Verfahrensstand<br />
unterrichtet hätte.<br />
Bei Vertragsverhandlungen besteht<br />
grundsätzlich die Verpflichtung, den Vertragspartner<br />
zu unterrichten, wenn der<br />
Vertragszweck gefährdet ist und dies von<br />
wesentlicher Bedeutung für den anderen<br />
Teil sein kann, z.B. weil dieser dann weitere<br />
Aufwendungen unterläßt (BGH, DVBl.<br />
1978, 798, 801).<br />
Im vorliegenden Fall ist die Bekl. ihrer<br />
Unterrichtungspflicht jedoch sachgemäß<br />
nachgekommen. Mit Schreiben vom<br />
07.02.1996 wurde dem Kl. mitgeteilt, dass<br />
ein Überhang von 4500 qm Verkaufsfläche<br />
in dem Wohngebiet "F. Heckert" vorhanden<br />
sei, der anderweitig ausgeglichen<br />
werden müsse. Dies hat zur Entscheidung<br />
Mai 2002 SCHADEN AKTUELL Sonderheft <strong>Seite</strong> 9
SCHADEN AKTUELL<br />
Informationsdienst der Sozietät <strong>Dr</strong>. <strong>Eick</strong> im Haftpflicht– und Versicherungsrecht<br />
der Beklagten geführt, das verfahrensgegenständliche<br />
Projekt.nicht weiter zu betreiben.<br />
Auch der Umstand, dass noch im<br />
November 1995 dem Antrag zur Aufstellung<br />
des Vorhaben- und Erschließungsplanes<br />
durch den Planungs- und Verkehrsausschuss<br />
der Bekl. zugestimmt wurde,<br />
ändert hieran nichts. Bei diesem Beschluss<br />
handelt es sich um einen innerorganisatorischen<br />
Akt der Bekl., aus dem<br />
keine Rechtsansprüche des Klägers erwachsen<br />
können (Urteil des Verwaltungsgerichtes<br />
Chemnitz, Az.: 3 K 2540/96,<br />
<strong>Seite</strong> 10).<br />
e) Schließlich führt eine fehlerhafte<br />
Ermessensausübung der Bekl. anläßlich<br />
der Entscheidung über die Ablehnung des<br />
Antrages des Kl. auf Einleitung eines Satzungsverfahrens<br />
zum Erlass eines Vorhaben-<br />
und Erschließungsplanes nicht zu<br />
einem Schadensersatzanspruch. Denn<br />
insoweit fehlt die erforderliche Kausalität<br />
zwischen der Pflichtverletzung (fehlerhafte<br />
Ermessensausübung) und dem Schaden<br />
(Aufwendungen des Kl. für den Vorhabenund<br />
Erschließungsplan).<br />
Zwar war die Entscheidung der Bekl. vom<br />
15.10.1996, wie das VG Chemnitz (Az.: 3<br />
K 2540/96) in seinem Urteil vom<br />
11.04.2000 festgestellt hat, rechtswidrig,<br />
da sie ermessensfehlerhaft war. Die Bekl.<br />
hat hierbei weder die Belange des Kl. in<br />
ihre Erwägungen mit eingestellt, noch diese<br />
gewichtet und mit abgewogen. Dies<br />
wäre insbesondere im Hinblick auf die<br />
jahrelangen Vorverhandlungen des Kl. mit<br />
der Bekl. und vor allem nach der Beschlussfassung<br />
über die Aufstellung eines<br />
Vorhaben- und Erschließungsplanes zugunsten<br />
des Kl. erforderlich gewesen. Insoweit<br />
ist jedoch auch zu berücksichtigen,<br />
dass allein aus den jahrelangen Vorverhandlungen<br />
und Planungsleistungen durch<br />
den Kl. noch keine Bindung des Ermessens<br />
eintritt, denn diese Vorleistungen<br />
dienen der Vorbereitung der Entscheidung<br />
der Bekl.. Auch aus dem Beschluss über<br />
die Aufstellung des Vorhaben- und Erschließungsplanes<br />
folgt nichts anderes. Im<br />
übrigen bleibt es der Gemeinde unbenommen,<br />
von der Planung im Laufe des<br />
Verfahrens aufgrund neuer Erkenntnisse<br />
Abstand zu nehmen.“<br />
6. Die Öffentliche Hand als Vermieter:<br />
Kfz–Schilderprägestelle im Kreishaus<br />
OLG Düsseldorf, Urt. v. 12.12.2001<br />
– U (Kart.) 4/01 – und Urt. v. 21.11.2001<br />
– U (Kart.) 1/01 –<br />
Die rechtliche Zulässigkeit der Vermietung<br />
von Räumen in Rat– oder Kreishäusern<br />
zum Betrieb von Schilderprägestellen ist in<br />
der Rechtsprechung des BGH geklärt<br />
(BGH NJW 1998, 3778). Klar ist auch, daß<br />
die Dauer der Mietverträge 5 Jahre nicht<br />
überschreiten sollte, um in angemessenen<br />
Zeiträumen auch andere Wettbewerber<br />
zum Zuge kommen zu lassen. Nach der<br />
Rechtsprechung des OLG Düsseldorf<br />
(Urt. v. 26.01.2000 – U (Kart.) 6/99 – ist<br />
eine förmliche Ausschreibung nicht erforderlich,<br />
wohl aber eine vorherige öffentliche<br />
Bekanntgabe der Vermietungsabsicht,<br />
um damit den Wettbewerb zu ermöglichen.<br />
Mai 2002 SCHADEN AKTUELL Sonderheft <strong>Seite</strong> 10
SCHADEN AKTUELL<br />
Informationsdienst der Sozietät <strong>Dr</strong>. <strong>Eick</strong> im Haftpflicht– und Versicherungsrecht<br />
Nach dem Urteil des OLG Düsseldorf vom<br />
12.12.2001 ist eine Ausschreibung, mit der<br />
angekündigt wird, „im Rahmen einer aktiven<br />
Förderung der regionalen Wirtschaft,<br />
einen Raum als Schilderstelle für Kraftfahrzeug–Schilderprägeunternehmen<br />
zu<br />
vermieten“ unzulässig. Das OLG sieht in<br />
einer derartigen Ausschreibung, in der auf<br />
den Gesichtspunkt der „Förderung der<br />
regionalen Wirtschaft“ abgestellt wird, eine<br />
Behinderung im Sinne des § 20 Abs. 1<br />
GWB. Das OLG folgt damit dem Urteil des<br />
BGH (NJW 2000, 809, 811) und gibt seine<br />
frühere gegenteilige Rechtsprechung (Urt.<br />
v. 19.03.1996 – NJW–RR 1997, 294) auf.<br />
In dem zweiten Urteil vom 21.11.2001 hat<br />
das OLG Düsseldorf die Öffentliche Hand<br />
als Vermieterin verpflichtet, in ihrer Kfz–<br />
Zulassungsstelle die Anbringung eines Hinweisschildes<br />
in einer Größe von mindestens<br />
0,5 m² zu gestatten, in der der<br />
Schilderprägebetrieb, der außerhalb des<br />
Kreishauses seinen Betrieb unterhält, auf<br />
seine Niederlassung hinweisen darf. Das<br />
OLG hat die Auffassung vertreten, dies sei<br />
zur Vermeidung einer kartellrechtswidrigen<br />
Diskriminierung (§ 20 Abs. 1 GWB) erforderlich,<br />
um Wettbewerbsnachteile, des<br />
außerhalb des Kreishauses ansässigen<br />
Präge–Betriebs gegenüber dem Mitbewerber,<br />
der im Kreishaus über angemietete<br />
Räume verfüge, auszugleichen.<br />
7. Probleme bei der Namensfindung:<br />
Fritz Winter als Person der Zeit–<br />
geschichte<br />
OLG Hamm, Urt. v. 05.10.2001<br />
– 9 U 149/01 – NJW 2002, 609<br />
Der Streit um die Benennung einer städtischen<br />
Gesamtschule in „Fritz–Winter–Gesamtschule“<br />
wurde im Rahmen eines<br />
einstweiligen Verfügungsverfahrens vor<br />
dem OLG Hamm ausgetragen. Fritz Winter,<br />
geb. am 22.09.1905 in Altenbögge<br />
(Westfalen), verst. am 01.10.1976 in Herrsching<br />
am Ammersee, war Elektriker,<br />
dann Bergmann und studierte von 1927<br />
bis 1930 am Bauhaus. Zusammen mit<br />
Paul Klee und Ernst Ludwig Kirchner wird<br />
er als Pionier der modernen Malerei bezeichnet.<br />
Seine Werke wurden 1937 auf<br />
Betreiben der NSDAP aus den Museen<br />
entfernt. Die Nichte des Malers, die seinen<br />
künstlerischen Nachlaß verwaltet, wandte<br />
sich vor allem wegen des von ihr als unwürdig<br />
empfundenen Verfahrens der Namensgebung<br />
gegen die beabsichtigte Benennung<br />
der Schule nach Fritz Winter. Der<br />
Antrag hatte keinen Erfolg.<br />
Die Leitsätze der Entscheidung des OLG<br />
lauten:<br />
1. Das post mortale Persönlichkeitsrecht<br />
steht der Verwendung des Namens einer<br />
verstorbenen Person der Zeitgeschichte<br />
bei der Benennung einer<br />
Schule, Straße oder einer ähnlichen<br />
Mai 2002 SCHADEN AKTUELL Sonderheft <strong>Seite</strong> 11
SCHADEN AKTUELL<br />
Informationsdienst der Sozietät <strong>Dr</strong>. <strong>Eick</strong> im Haftpflicht– und Versicherungsrecht<br />
neutralen, nicht kommerziellen Einrichtung<br />
regelmäßig nicht entgegen.<br />
2. Eine Zustimmung der engsten Angehörigen<br />
oder der Erben zur Namensgebung<br />
ist in derartigen Fällen nicht<br />
erforderlich.<br />
Ausstellungshinweis<br />
Vom 18. Mai 2002 (19.00 Uhr Eröffnung)<br />
bis zum 31. August 2002 findet im Fritz-<br />
Winter-Haus (Helga Gausling, Südberg<br />
72-74, 59229 Ahlen/Westfalen, Tel.:<br />
(0 23 82) 6 15 82 – Fax: 6 55 28) die Ausstellung<br />
„Fritz Winter – Formwerdend,<br />
Malerei und Zeichnung“ statt. Öffnungszeiten:<br />
Dienstag, Mittwoch, Samstag,<br />
15.00 – 18.00 Uhr, Sonntag 11.00 – 18.00<br />
Uhr, oder nach Vereinbarung.<br />
8. <strong>Eick</strong> intern<br />
Neuer Stern:<br />
♦ Seit dem 18.03.2002 ist der 7. Standort<br />
der Kanzlei <strong>Dr</strong>. <strong>Eick</strong> & <strong>Partner</strong> in<br />
Bochum eröffnet. Die Leitung der Niederlassung<br />
liegt bei <strong>Dr</strong>. Rainer Heß.<br />
Das Anwaltsteam wird durch die<br />
Rechtsanwälte Hermann Lemcke, Helga<br />
Arendt, <strong>Dr</strong>. Alexander Fritze und<br />
Christoph Hugemann verstärkt. Die<br />
Rechtsanwälte <strong>Dr</strong>. Heß, Lemcke und<br />
Arendt haben ihren Tätigkeitsschwerpunkt<br />
im Haftpflicht– und Versicherungsrecht,<br />
<strong>Dr</strong>. Fritze im Baurecht und<br />
Rechtsanwalt Hugemann im Medizinrecht.<br />
<strong>Dr</strong>. <strong>Eick</strong> & <strong>Partner</strong> GbR, Arndtstr. 26,<br />
44787 Bochum<br />
Und noch ein neuer Stern:<br />
♦ Am 01.06.2002 wird die neue, und<br />
damit die 8., Niederlassung der Sozietät<br />
<strong>Dr</strong>. <strong>Eick</strong> & <strong>Partner</strong> in Schwerin,<br />
der Hauptstadt des Landes Mecklenburg–Vorpommern<br />
eröffnet werden.<br />
Unser Team für Sie vor Ort: Rechtsanwälte<br />
Holger Saubert (zugleich Mediator),<br />
Jörn Gaebell (auch Fachanwalt<br />
für Strafrecht) und Dirk Door.<br />
<strong>Dr</strong>. <strong>Eick</strong> & <strong>Partner</strong> GbR,<br />
Mozartstr. 1, 19053 Schwerin<br />
Tel.: (03 85) 7 60 73–0<br />
Fax: (03 85) 7 60 73–21<br />
Neuzulassung:<br />
Ab dem 01.07.2002 ist Frau Rechtsanwältin<br />
Iris Karthaus am OLG Hamm zugelassen.<br />
Frau Rechtsanwältin Karthaus ist<br />
damit außer an allen Landgerichten auch<br />
beim OLG Hamm postulationsfähig.<br />
Veranstaltungen<br />
♦ Rechtsanwalt <strong>Dr</strong>. Heß wird im Rahmen<br />
des Deutschen Anwaltstages am<br />
10.05.2002 zur Neuregelung des Verjährungsrechts<br />
durch das Schuldrechtsmodernisierungsgesetzren.referie-<br />
♦ Rechtsanwalt Schumacher referiert am<br />
24.05.2002 bei der Gemeinde Verl zur<br />
Schuldrechtsmodernisierung.<br />
♦ Rechtsanwalt <strong>Dr</strong>. Bergmann referiert<br />
am 10.06.2002 an der Universitätsklinik<br />
Münster zu aktuellen Problemen<br />
des Arztrechts.<br />
Mai 2002 SCHADEN AKTUELL Sonderheft <strong>Seite</strong> 12
SCHADEN AKTUELL<br />
Informationsdienst der Sozietät <strong>Dr</strong>. <strong>Eick</strong> im Haftpflicht– und Versicherungsrecht<br />
Neues aus gutem Hause:<br />
♦ Ende Mai / Anfang Juni 2002 erscheint<br />
die 3. Auflage von „Bergmann / Schumacher,<br />
Die Kommunalhaftung – Ein<br />
Praxishandbuch des Staatshaftungsrechts<br />
– (Carl-Heymanns-Verlag) „Die<br />
Autoren hoffen nach harter Arbeit an<br />
der Neubearbeitung und Erweiterung<br />
des Werkes auf freundliche Aufnahme<br />
und kritische Anmerkungen.“<br />
Auch aus gutem Hause<br />
♦ Stegers/Hansis/Alberts/Scheuch<br />
Der Sachverständigenbeweis im<br />
Arzthaftungsrecht<br />
C.F. Müller–Verlag, Heidelberg 2002<br />
♦ Bergmann/Schumacher (Herausgeber)<br />
Handbuch der Kommunalen Vertragsgestaltung<br />
Band 1 bis Band 4, Karl–<br />
Heymanns–Verlag Köln, 1998 ff<br />
Bergmann/Schwarz-Schilling,<br />
Krankheit und Recht. 1995<br />
Bergmann/Kienzle, Krankenhaushaftung,<br />
Organisation, Schadensverhütung<br />
und Versicherung, 1996<br />
Bergmann, Die Arzthaftung, 1999<br />
Müller/Bergmann, Risk-Management<br />
in Orthopädie und Chirurgie, 2000<br />
Bergmann, Die Arzthaftpflichtversiche<br />
rung in Handbuch des Versicherungsrechts,<br />
2001<br />
♦ <strong>Dr</strong>. Mennemeyer, Arbeitsrecht in: Das<br />
Prozeßhandbuch, 6. Auflage 2000,<br />
<strong>Dr</strong>. Otto Schmidt Verlag<br />
♦ Berz/Burmann, Handbuch des Straßenverkehrsrechts,<br />
Verlag C.H. Beck,<br />
München (Loseblatt-Sammlung)<br />
♦ Janiszewski/Burmann,<br />
Straßenverkehrsordnung, 16. neubearbeitete<br />
Auflage, Verlag C. H. Beck,<br />
München, 2000<br />
♦ Bisher in Schaden Aktuell erschienen:<br />
Heft 1/2001 Die Unfallversicherung<br />
Heft 2/2001 SGB VII – §§ 104 ff<br />
Heft 3/2001 Neue Rechtsprechung<br />
zum Kinderunfall<br />
Heft 4/2001 Neue Rechtsprechung des<br />
BGH und der Oberlandes–<br />
gerichte zur Bauhaftpflicht<br />
Heft 5/2001 Neue Rechtsprechung zur<br />
Unfallmanipulation<br />
Heft 1/2002 Die Unfallversicherung<br />
♦ Bislang in MED–INFO Aktuell erschienen:<br />
Heft 1/2001 Patientenaufklärung in<br />
Routinefällen und Grundauf–<br />
klärung<br />
Heft 2/2002 Standard und Leitlinien<br />
Heft 3/2001 Die Schulterdystokie<br />
Heft 4/2001 Die drei Reformen<br />
Heft 1/2002 Die Reformgesetze<br />
2. Schadensersatzrechts–<br />
änderungsgesetz<br />
Schuldrechtsmodernisierungs–<br />
gesetz<br />
Mai 2002 SCHADEN AKTUELL Sonderheft <strong>Seite</strong> 13