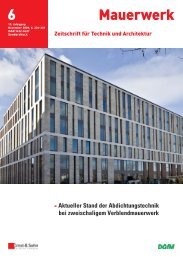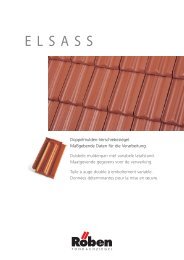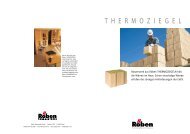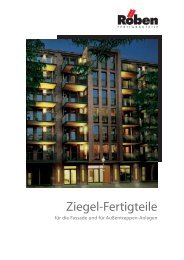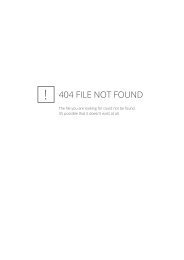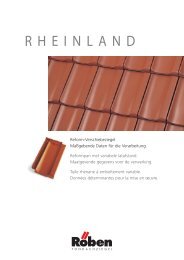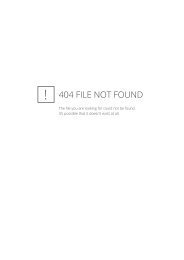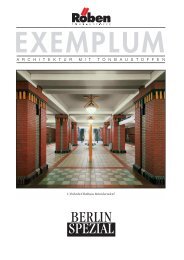I N D I E S E R A U S G A B E : N O. 10 ... - Röben Tonbaustoffe GmbH
I N D I E S E R A U S G A B E : N O. 10 ... - Röben Tonbaustoffe GmbH
I N D I E S E R A U S G A B E : N O. 10 ... - Röben Tonbaustoffe GmbH
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
EXEMPLUM<br />
IN DIESER AUSGABE: NO. <strong>10</strong><br />
DACHZIEGEL, BODENKERAMIK,<br />
ZIEGELARCHITEKTUR.<br />
„Wilhelmina“, „Juliana“ und „Beatrix“:<br />
die nach den letzten drei niederländischen<br />
Regentinnen benannten majestätischen<br />
Türme des „Queens Towers“ Gebäudes<br />
in Amsterdam.
2<br />
Inhalt<br />
Zu diesem Heft 3<br />
Mit majestätischer Würde –<br />
das Amsterdamer Bürogebäude „Queens Towers“ 4<br />
„West End City Center“ in Budapest 8<br />
Farbige Akzente im „neuen Berlin“ –<br />
Fassadengestaltung mit glasierten Klinker-Riemchen <strong>10</strong><br />
Tempel der gebrannten Erde –<br />
Porzellanfabrik in Herend/Ungarn 12<br />
Rot und Schwarz – ein Fußballstadion im niederländischen Assen 14<br />
Ein repräsentatives Gesicht –<br />
Neubau für die Landessparkasse zu Oldenburg 16<br />
Gelungenes Zusammenspiel:<br />
Klinker-Riemchen auf Wärmedämm-Verbundsystem –<br />
das Kreiswehrersatzamt in Wittenberg 18<br />
<strong>Röben</strong> Klinkerplatten – ideal für den Kfz-Bereich<br />
bei Audi, Ferrari, Porsche und Mercedes-Benz 20<br />
Ein Dach für die Ewigkeit –<br />
Renovierung des Klosters Antonigartzem 24<br />
Impressum<br />
Herausgeber:<br />
<strong>Röben</strong> <strong>Tonbaustoffe</strong> <strong>GmbH</strong><br />
D-26330 Zetel<br />
Konzept und Realisation:<br />
Werbeagentur EDDIKS & ONKEN, Oldenburg<br />
Text: Robert Uhde, Oldenburg<br />
Bellmann, Gröning & Partner, Hamburg<br />
Druck und Verarbeitung: Prull-Druck, Oldenburg<br />
© Copyright by <strong>Röben</strong> <strong>Tonbaustoffe</strong> <strong>GmbH</strong>
Zu diesem Heft<br />
Eine runde Sache! Mit der neuesten<br />
Ausgabe unseres „Exemplum“<br />
präsentieren wir Ihnen zum mittlerweile<br />
zehnten Mal die unterschiedlichsten<br />
Objekte aus dem In- und<br />
Ausland, bei denen durch die Verwendung<br />
von <strong>Röben</strong>-Produkten<br />
interessante und beispielhafte Gestaltungen<br />
realisiert worden sind.<br />
Ton ist ein wahrer Bodenschatz,<br />
aus dem sich einer der hochwertigsten<br />
Baustoffe zur Realisierung<br />
dauerhafter Architektur gewinnen<br />
lässt. Abgesehen von ökologischen<br />
sind es dabei vor allem bauphysikalische<br />
und wirtschaftliche Vorteile,<br />
die den Planer zum Klinker,<br />
Verblender oder Tondachziegel<br />
greifen lassen. Neben zahlreichen<br />
gelungenen Beispielen klassischer<br />
Ziegelarchitektur entstehen jedoch<br />
immer häufiger auch Gebäude, die<br />
vor allem durch die Kombination<br />
von keramischen Baustoffen mit<br />
Stahl, Zink, Glas oder Naturstein<br />
überzeugen, wie das Beispiel der<br />
durch das renommierte niederländische<br />
Büro de Architekten Cie.<br />
entwickelten „Queens Towers“<br />
in Amsterdam zeigt. Durch die<br />
Zusammenstellung von Glas,<br />
kupferfarbenen Metallpaneelen,<br />
Granit und rotbraunen <strong>Röben</strong><br />
Klinkern gelang den Planern eine<br />
elegante und farbenfrohe Ästhetik,<br />
die sich wohltuend von der ansonsten<br />
eher farblosen Umgebung<br />
abhebt.<br />
Die sonst so gepflegte Konkurrenz<br />
zwischen Keramik auf der einen,<br />
und Stahl und Glas auf der anderen<br />
Seite ist hier einer intelligenten<br />
Gleichberechtigung gewichen,<br />
die ihren Reiz gerade aus dem<br />
Kontrast der verschiedenen Baustoffe<br />
gewinnt.<br />
Zwei weitere Beispiele für die<br />
Gestaltung moderner Bürogebäude<br />
sind die mit zahlreichen Elementen<br />
aus verzinktem Stahl errichtete<br />
Filiale der Landessparkasse zu<br />
Oldenburg und das Kreiswehrersatzamt<br />
in Wittenberg, bei dem<br />
die Architekten ein hocheffektives<br />
Wärmedämm-Verbundsystem mit<br />
orangefarbenen Klinkerrriemchen<br />
abschlossen. Noch mehr Mut zur<br />
Farbe beweist das Stadion für<br />
Achilles 1894 in Assen, das vor<br />
allem durch den auffälligen Kontrast<br />
zwischen schwarzen Keramik-<br />
Klinkern und roten Kunststoff-<br />
Paneelen bestimmt wird. Beim<br />
Bau der Porzellanfabrik im ungarischen<br />
Herend setzten die Architekten<br />
dagegen vor allem auf die<br />
farblichen Nuancen und die robuste<br />
Individualität von Handform-<br />
Verblendern. Ganz in der Nähe<br />
befindet sich auch das West End<br />
City Center Budapest, eines der<br />
größten Bauvorhaben in Ungarn.<br />
Für die insgesamt 20.000 m 2 großen<br />
Fassadenflächen verwendeten die<br />
Architekten rotbunte Keramik-<br />
Klinker von <strong>Röben</strong>.<br />
Eine beispielhafte Eindeckung mit<br />
<strong>Röben</strong> Tondachziegeln zeigt die<br />
umfangreiche Sanierung des Klosters<br />
Antonigartzem im rheinländischen<br />
Zülpich, wo durch die Verwendung<br />
von schwarzen Hohlfalz-Ziegeln<br />
ein gelungener Kompromiss zwischen<br />
historischer Anmutung und<br />
Wirtschaftlichkeit erzielt wurde.<br />
Aber nicht nur für Wand und<br />
Dach, auch am Boden ist der Baustoff<br />
Ton unschlagbar, wie die<br />
Reportage über die verschiedenen<br />
Autohäuser von Mercedes, Audi,<br />
Ferrari oder Porsche beweist, in<br />
denen hoch belastbare <strong>Röben</strong><br />
Klinkerplatten eine sichere und<br />
wirtschaftliche Arbeitsgrundlage<br />
bilden.<br />
Wie in den vorangegangenen<br />
Ausgaben möchten wir uns auch<br />
diesmal für die kooperative Zusammenarbeit<br />
mit den beteiligten<br />
Architekten bedanken und Ihnen<br />
viel Spaß beim Lesen wünschen.<br />
Wilhelm-Renke <strong>Röben</strong><br />
3
Mit majestätischer Würde – das Amsterdamer Bürogebäude „Queens Towers“<br />
Architekten: de Architekten Cie., Carel Weeber, Amsterdam<br />
Projekt-Team: W. Benschop, S.S. van Balen, R. Alberda<br />
Fotos: Jan Derweg, Amsterdam<br />
Trotz, oder gerade wegen der voranschreitenden<br />
Vereinigung Europas<br />
– die konstitutionelle Monarchie der<br />
Niederlande erfreut sich nach wie<br />
vor großer Beliebtheit. Jüngster<br />
Beleg der anhaltenden Sympathie<br />
für das Haus Oranje ist das im Südwesten<br />
von Amsterdam fertiggestellte<br />
Bürogebäude „Queens Towers“:<br />
Das postmodern verspielte, direkt<br />
neben dem „World Fashion Center“<br />
gelegene Bauwerk besteht aus<br />
einem lang gestreckten doppelgeschossigen<br />
Sockel und drei hoch<br />
aufragenden, rotbraun gemauerten<br />
und mit kupfergrünen Dächern<br />
bedeckten Türmen, die aufgrund<br />
ihrer majestätischen Erscheinung<br />
nach den letzten drei niederländischen<br />
Regentinnen „Wilhelmina“,<br />
„Juliana“ sowie der noch amtierenden<br />
Königin „Beatrix“ benannt<br />
wurden. Die beiden höheren Türme<br />
weisen eine Höhe von 62 Metern<br />
auf, Turm „Beatrix“, ragt immerhin<br />
noch 45 Meter in den Amsterdamer<br />
Himmel.<br />
Für die Planung der „Queens Towers“<br />
zeichnet Carel Weeber vom Amsterdamer<br />
Büro de Architekten Cie.<br />
verantwortlich, das maßgeblich am<br />
gegenwärtigen Aufschwung der<br />
niederländischen Architekturszene<br />
beteiligt ist: in Rotterdam entwickelte<br />
eines der Mitglieder, Frits van Dongen,<br />
Mitte der 90er Jahre das vielbeachtete<br />
Wohngebäude „De Landtong“ –<br />
einen aus Backstein errichteten<br />
Großblock mit insgesamt 623<br />
Wohneinheiten, der geschickt auf<br />
verschiedene, teilweise terrassierte<br />
Wohnblöcke aufgeteilt und damit in<br />
lesbare Einheiten gegliedert wurde.<br />
Eher maritim präsentiert sich dagegen<br />
das vor kurzem im ehemaligen<br />
östlichen Amsterdamer Hafengebiet<br />
fertiggestellte Wohngebäude „The<br />
Whale“, dessen schillernde Zinkfassade<br />
eine spielerische, fast ironische<br />
Lust im Erfinden von gebauter<br />
Umwelt zeigt.<br />
Mit dem am Schnittpunkt zwischen<br />
der Stadtautobahn A<strong>10</strong> und der<br />
breiten Cornelis Lelylaan gelegenen<br />
Bürogebäude „Queens Towers“ ist<br />
den Architekten jetzt ein weiterer<br />
großer Wurf gelungen. „Wir wollten<br />
ein klassisch anmutendes Gebäude<br />
mit einer stark vertikalen Ausrichtung<br />
schaffen, das innerhalb des<br />
überwiegend durch großflächige<br />
Bauten aus den 60er Jahren geprägten<br />
Stadtteils Slotervaart/Overtoomse<br />
Veld einen deutlichen architektonischen<br />
Akzent setzt“, beschreibt<br />
Projektleiter Willem Benschop den<br />
zentralen Planungsgedanken.<br />
Und in der Tat: Durch die kupfergrünen<br />
Satteldächer, die auf den<br />
drei rotbraunen, aus jeweils zwei<br />
aneinander gefügten Quadern<br />
bestehenden Türmen thronen,<br />
hat der bislang eher gesichtslose<br />
Stadtteil ein weithin sichtbares,<br />
identitätsstiftendes Zeichen erhalten,<br />
das sich trotz seiner imposanten<br />
Höhe nahtlos an die relativ großen<br />
Bürogebäude in der Umgebung<br />
anschließt. Alle drei Türme verfügen<br />
über einen eigenen, 3,6 Meter<br />
hohen repräsentativen Eingangsbereich,<br />
der jeweils durch identische<br />
Vordächer überdeckt wird.<br />
Die vertikale Erschließung des bis<br />
zu 14-geschossigen Gebäudes erfolgt<br />
über Lifte und Treppenhäuser, die<br />
auf allen Ebenen durch eine zentrale<br />
Halle verbunden werden, von der<br />
aus die einzelnen Büros zu<br />
erreichen sind.
Über den repräsentativen<br />
Eingangsbereichen aus<br />
hellem und dunklem<br />
Granit erhebt sich die<br />
schlanke Ziegelarchitektur<br />
aus roten <strong>Röben</strong> Klinkern<br />
WESTERWALD.
Ziegelarchitektur setzt deutliche Akzente<br />
im Stadtbild von Amsterdam<br />
Nicht nur beim architektonischen<br />
Konzept, auch bei den Fassadenmaterialien<br />
haben de Architekten<br />
Cie. auf Qualität gesetzt: Die<br />
beiden Sockelgeschosse wurden<br />
abwechselnd mit hellgrauem und<br />
anthrazitgrauem Granit sowie mit<br />
dem <strong>Röben</strong> Keramik-Klinker<br />
FARO schwarz nuanciert, glatt<br />
verkleidet. Die Fassaden der drei<br />
Türme zeichnen sich dem gegenüber<br />
durch das lebhafte und rhythmisch<br />
gut gegliederte Zusammenspiel<br />
von großen Fensterflächen,<br />
schwarz getönten Glaspaneelen<br />
und lang gestreckten vertikalen<br />
Streifen aus rotbraunen Klinkern<br />
aus. Nach längerer Suche verwendeten<br />
die Architekten 500.000<br />
<strong>Röben</strong> Klinker WESTERWALD rot,<br />
glatt im Waalformat. „Wir wollten<br />
einen festen, robusten Klinker<br />
mit guten bauphysikalischen Eigenschaften<br />
haben“, begründet Willem<br />
Benschop die Materialwahl seines<br />
Büros. Großen Wert legten die<br />
Architekten dabei auf die Wahl<br />
der Fugenfarbe: „Um ein möglichst<br />
einheitliches Erscheinungsbild zu<br />
erreichen und die im Läufer-<br />
6<br />
Außergewöhnlich ist die geschlossene<br />
Farbwirkung im Sockel- und Fassadenbereich:<br />
die Farben der Mauerwerksfugen<br />
wurden exakt den schwarzen<br />
und roten Klinkerfarben angepasst.<br />
verband gemauerten Fassadenabschnitte<br />
als homogene Flächen<br />
ausbilden zu können, haben wir<br />
eine Fugung gewählt, die exakt der<br />
Farbe der Klinker entspricht.“<br />
Für die mit schwarz-weißen Bändern<br />
ausgebildeten oberen Geschosse der<br />
drei Türme, deren Gestaltung eine<br />
deutliche Zäsur zu den aufliegenden<br />
Satteldächern schafft, wurden abwechselnd<br />
<strong>Röben</strong> Keramik-Klinker<br />
FARO schwarz-nuanciert, glatt und<br />
<strong>Röben</strong> Keramik-Klinker OSLO perlweiß,<br />
glatt verwendet. Die um rund<br />
1,8 Meter überstehenden Dächer<br />
selbst, hinter denen sich die gesamte<br />
Haustechnik des Gebäudes<br />
verbirgt, wurden demgegenüber<br />
mit kupferfarbenen Metallpaneelen<br />
abgedeckt – eine überaus gelungene<br />
Maßnahme, denn durch den leuchtend<br />
bunten Komplementär-Kontrast<br />
zwischen dem kupfergrünen Dach<br />
und den rotbraunen Klinkern bilden<br />
die „Queens Towers“ nicht nur den<br />
gewünschten auffälligen Kontrast<br />
zu der eher farblosen Umgebung,<br />
sondern werden auch ihrem königlichen<br />
Anspruch gerecht.
Schwarz-weiße Zierbänder aus<br />
<strong>Röben</strong> Keramik-Klinkern tragen<br />
die kupferfarbenen Dächer.<br />
7
West End City Center, Budapest<br />
Architekten: Finta és Társai Építész Stúdió/Finta & Co., Budapest<br />
Fotos: Janos Szentivani, Pilisszentiván, Ungarn<br />
Es ist eines der größten Bauvorhaben<br />
Ungarns. In seiner riesigen<br />
Dimension von rund 190.000 m 2<br />
bebauter Fläche, von der kurzen<br />
Zeit von der Planung bis zur Realisierung<br />
und von seiner städteplanerischen<br />
Bedeutung für die Stadt<br />
Budapest. Nicht die Größe hat die<br />
Architekten gereizt, sondern die<br />
urbanistischen Auswirkungen<br />
des Projektes. Noch Anfang des<br />
19. Jahrhunderts gehörte das Gelände,<br />
auf dem das neue West End<br />
8<br />
City Center steht, zu den Randgebieten<br />
Budapests. Heute zählt<br />
das dreieckige Grundstück durch<br />
die dynamische Expansion der<br />
ungarischen Hauptstadt zum Innenstadt-Bereich.<br />
An der einen Seite<br />
grenzt es an die Bahngleise des<br />
Westbahnhofes, auf der anderen<br />
Seite an die Vaci Straße, die wichtigste<br />
Verkehrsader der Pester Seite.<br />
Diese Lage spielt eine wichtige<br />
Rolle, denn der Komplex muss<br />
„Brücken schlagen“ zwischen<br />
den durch die Gleise getrennten<br />
Stadtteilen. Außerdem muss er in<br />
Achsenrichtung den verkehrsreichen<br />
Großring mit dem parkartigen Stadtwäldchen<br />
verbinden.<br />
Konzeptionell soll das Gebäude<br />
quasi selbst die Funktion einer<br />
„Straße“ erfüllen. Von außen als<br />
organischer Teil der Vaci Straße,<br />
innen als breite überdachte Fußgängerzone.<br />
18.000 m 2 angelegte<br />
Dachgärten und Promenaden<br />
gliedern das Gebäude und schaffen<br />
Anbindungen nach außen. 1.700<br />
Parkplätze sind entstanden, davon<br />
die Hälfte über dem Bahntunnel.<br />
Bei der Planung des riesigen Einkaufkomplexes,<br />
der aus den drei<br />
Bereichen Einkaufszentrum, Hotel<br />
und Bürogebäude besteht, haben<br />
sich die Architekten nicht an amerikanischen<br />
Vorbildern orientiert.<br />
Schließlich gab es schon Anfang<br />
1900 in Budapest eine Einkaufspassage,<br />
den „Pariser Hof“. Aber
es sollte ein europäisches Gebäude<br />
werden, vorbildlich in seiner<br />
komplexen Funktion ins Stadtbild<br />
passend und in seiner Materialverwendung<br />
auf höchstem Niveau.<br />
Die Umgebung des West End City<br />
Centers wird vom wunderschönen<br />
Bahnhofsgebäude mit seiner markanten<br />
Eisen-, Glas- und Ziegelfassade,<br />
das von Eiffel gebaut wurde,<br />
geprägt und vom gegenüberliegenden<br />
alten Zollhaus, das zum Teil<br />
ebenfalls aus einer Ziegelfassade<br />
besteht. Dadurch war die Wahl<br />
einer Klinkerfassade auch für das<br />
neue Zentrum eine logische Konsequenz,<br />
die sich auch mit den<br />
Vorstellungen der Genehmigungsbehörde<br />
und dem Hauptarchitekten<br />
der Stadt deckte. Der Gebäudekomplex<br />
ist in seinem Design, seinen<br />
Strukturen, dem Raumerlebnis und<br />
der Fassadengestaltung ganz bewusst<br />
auf die heutige Zeit ausgerichtet.<br />
Es wurden die modernsten Bau-<br />
und Konstruktionstechniken und<br />
Materialien angewendet, aber so,<br />
dass die „Bahn-Vergangenheit“<br />
des Gebietes, die Eiffel-Halle<br />
des Westbahnhofs, nicht vergessen<br />
wird. Auch deshalb wurde das<br />
Material Ziegel verwendet.<br />
Mit den Ziegeln hatte der Architekt<br />
auch die Möglichkeit, die verschiedenen<br />
Funktionen des Gebäudes<br />
durch feine Details optisch zu<br />
trennen. So wurde zum Beispiel<br />
die Fassade des Hotels mit einfarbigen<br />
<strong>Röben</strong> Klinkern WESTER-<br />
WALD rot eingerichtet, während<br />
für die Fassaden des Bürogebäudes<br />
und des Einkaufzentrums das lebendigere<br />
Farbspiel des WESTERWALD<br />
bunt gewählt wurde.<br />
Als besonderes Gestaltungselement,<br />
das auf die Ziegelbauten des<br />
Jugendstils und des Art-Deco der<br />
Monarchie zurückgreift, wurden<br />
die Fassaden durch blaubraune<br />
Ziegeleinlagen aus dem <strong>Röben</strong><br />
Werk Neumarkt unterbrochen.<br />
Sie sind wenige Zentimeter in die<br />
Fassade eingelassen und lockern<br />
sie so optisch auf.<br />
Insgesamt haben die Außenfassaden<br />
eine Fläche von 20.000 m 2 . Aber<br />
auch im Innenbereich setzen sich<br />
die Klinker fort. Hier haben die<br />
Inhaber der Geschäfte und Boutiquen<br />
völlig unabhängig von den<br />
Architekten und Investoren das<br />
warme Bild der Außenfassade aufgegriffen<br />
und für die Gestaltung<br />
ihrer Geschäfte genutzt.<br />
Dass die Konzeption der Architekten<br />
aufgegangen ist, zeigt nicht nur der<br />
geschäftliche Erfolg des Zentrums,<br />
das von den Bürgern Budapests<br />
sehr gut angenommen wird. Auch<br />
Fachleute loben dessen Gestaltung<br />
und Urbanität. So erhielt es jeweils<br />
den ersten Preis sowohl der Landesals<br />
auch der internationalen Ausschreibung<br />
des Niveaupreises für<br />
Immobilienentwicklung der FIABCI.<br />
Das West End Hilton errang den<br />
Die Ziegelarchitektur des<br />
West End City Centers in<br />
Budapest mit seinen Einkaufszentren,<br />
Promenaden und<br />
Dachgärten, Büro- und<br />
Hotelgebäuden ist mit vielen<br />
internationalen Preisen<br />
ausgezeichnet worden.<br />
ersten Platz für „Best Architectural<br />
Design“ der „Hotelspec“.<br />
Architekten und Investoren haben<br />
das warme Bild der Außenfassade<br />
aufgegriffen und für die Gestaltung<br />
ihrer Geschäfte genutzt.<br />
9
Farbige Akzente im „neuen Berlin“ –<br />
Fassadengestaltung mit glasierten Klinker-Riemchen<br />
Architekturbüro Spiegel, Berlin<br />
Fotos: Wolfgang Schumann, Hamburg<br />
Berlin – Stadt mit langer Tradition<br />
und Geschichte, aber auch Stadt<br />
der Extreme, der neuen Trends<br />
und Entwicklungen. Das Gesicht<br />
der neuen deutschen Metropole<br />
hat sich in den Jahren seit der<br />
Wiedervereinigung in vielen Bereichen<br />
grundlegend gewandelt.<br />
Früher getrennte Stadtteile sind<br />
zusammen gewachsen und haben<br />
eine gemeinsame Identität gefunden.<br />
Andere wiederum sind ganz<br />
neu entstanden oder immer noch<br />
im Entstehen. So auch der Bereich<br />
um den „berühmt-berüchtigten“<br />
Checkpoint Charly, dem ehemaligen<br />
Grenzübergang zwischen Ost- und<br />
Westteil. Hier im neuen Berliner<br />
Kern hat sich eine Geschäfts- und<br />
<strong>10</strong><br />
Wohngegend entwickelt, die von<br />
modernen Neubauten geprägt ist.<br />
Mit dem Charlotten-Carrée –<br />
einem großen, siebenstöckigen<br />
Wohn- und Geschäftshaus an der<br />
belebten Zimmerstraße in Berlin<br />
Mitte – ist dem für die Planung<br />
zuständigen Architekturbüro<br />
Spiegel eine gelungene Synthese<br />
von Alt und Neu gelungen: die<br />
Gestaltung einer modernen<br />
Fassade mit glasierten Klinker-<br />
Riemchen. Glasierte Klinker aus<br />
gebranntem Ton sind ein Baustoff<br />
mit Jahrhunderte alter Tradition.<br />
Schon die alten Baumeister in<br />
Babylon, Assur und Susa setzten<br />
bei der Gestaltung ihrer Bauten<br />
auf den Effekt farbig glasierter<br />
Ziegel und kombinierten mit<br />
Formziegeln eindrucksvolle<br />
Reliefs, deren Farbschönheit bis<br />
heute eindrucksvoll erhalten ist.<br />
Auch heute sind farbig glasierte<br />
Keramik-Klinker die „Kreativ-<br />
Bausteine“ im Mauerwerk. Sie<br />
setzen Akzente, umrahmen Fenster<br />
und Türen oder betonen Grenadierschichten<br />
und dekorativ abgesetzte<br />
Füllungen. Das Architekturbüro<br />
Spiegel hat die glasierten Klinker-<br />
Riemchen von <strong>Röben</strong> eingesetzt,<br />
um die Fassade in ihrer Gesamtheit<br />
zu gestalten. Die praktisch<br />
ganztägig vom direkten Sonnenlicht<br />
nicht erreichbare Nordfassade<br />
des streng gegliederten Gebäudes<br />
gewinnt durch den Wechsel großzügiger<br />
Fensterflächen mit vorstehenden<br />
Erkern und in hellen Tönen<br />
glasierten Riemchen Transparenz<br />
und Leichtigkeit. Hierfür wurde der<br />
<strong>Röben</strong> Glasur-Farbton „Hellgrau“<br />
gewählt und die Fassade durch den<br />
Einsatz zweier unterschiedlicher<br />
Fugenfarben optisch noch einmal<br />
untergliedert.<br />
Die Mauerwerksflächen im dunkleren<br />
Innenhof sind mit den<br />
glasierten Keramik-Riemchen im<br />
sehr frisch und freundlich anmutenden<br />
Farbton „Türkis-blau matt“<br />
gestaltet, wobei die hellgrauen<br />
Riemchen die horizontalen Linien<br />
der darüber liegenden Geschosse<br />
aufnehmen. Sie laufen in schmalen<br />
Streifen auf der Höhe der oberen<br />
und unteren Abschlüsse von<br />
Fenstern und Türen rundum und<br />
betonen den leichten, aufgelockerten<br />
Charakter der Bauweise.<br />
Bei <strong>Röben</strong> werden die Glasuren<br />
doppelt auf den noch ungebrannten<br />
Scherben aufgetragen. Die<br />
Besonderheit: Es handelt sich um<br />
eine Scharffeuer-Glasur, die bei<br />
Temperaturen von ca. 1.280°C<br />
gebrannt wird. Mit diesem technischen<br />
Verfahren kann <strong>Röben</strong> den<br />
sehr guten Sitz der Glasur auf dem<br />
Klinker garantieren, da durch die<br />
hohe Brandtemperatur der sinternde<br />
Ziegel und die schmelzende<br />
Glasur eine homogene, unlösliche<br />
Verbindung eingehen. Sie werden<br />
also nicht nachträglich auf das<br />
gebrannte Riemchen – wie etwa<br />
eine Lackschicht – aufgetragen.
In Berlin rehabilitierte Schinkel<br />
Anfang des 19. Jh. das in Vergessenheit<br />
geratene Ziegel-Sichtmauerwerk,<br />
in das er als Schmuck erstmals<br />
blaue Glasurbänder einfügte –<br />
wie zum Beispiel am Gebäude der<br />
Bauakademie am Stadtschloss.<br />
In der Gründerzeit, seit dem Ende<br />
des Jahrhunderts, wurden die<br />
Vorteile der Glasur vor allem im<br />
gewerblichen Hofbereich Berlins<br />
genutzt: der Regen wusch den sich<br />
absetzenden Schmutz wieder von<br />
der meist vollständig mit glasierten<br />
Ziegeln vermauerten Fassade<br />
und die glatte Oberfläche reflektierte<br />
Licht in die ansonsten eher<br />
finsteren Höfe. Ein schönes Beispiel<br />
für die Weiterentwicklung<br />
dieses rein pragmatischen Ansatzes<br />
sind die 1906/07 erbauten, mit<br />
farbig glasierten Klinkern aufwendig<br />
verzierten Hackeschen Höfe<br />
in Berlin Mitte.<br />
Apropos Farben: Die <strong>Röben</strong>-<br />
Palette enthält neben „Türkisblau<br />
matt“ und „Hellgrau“ weitere<br />
20 Standardglasuren, die absolut<br />
frei von giftigen Stoffen sind.<br />
Glänzende Opakglasuren wechseln<br />
sich mit matten Oberflächen ab,<br />
kräftige Buntfarben mit feinen<br />
Pastelltönen. <strong>Röben</strong> hat ein spezielles<br />
Verfahren entwickelt, mit<br />
dem sich nahezu jeder gewünschte<br />
Farbton erzielen lässt. So sind<br />
auch ganz individuelle, objektbezogene<br />
Farbgebungen möglich, die<br />
nach Wunsch angefertigt werden<br />
können.<br />
Die „Hof-Architektur“ hat Tradition<br />
in Berlin. Als typische Kulisse für’s<br />
„Milljöh“ wird sie heute mit modernen<br />
architektonischen Gestaltungsmitteln<br />
weitergeführt.
Tempel der gebrannten Erde –<br />
Porzellanfabrik Herend, Ungarn<br />
Architekt: Gabór Turányi, Kadakut<br />
Fotos: Janos Szentivani, Pilisszentiván, Ungarn<br />
Es ist nicht so bekannt wie Meißner<br />
Porzellan oder Rosenthal, aber<br />
das Porzellan aus dem ungarischen<br />
Herend erntete internationale<br />
Anerkennung auf den Weltausstellungen<br />
in Paris, London und<br />
New York.<br />
Die Geschichte der Manufaktur<br />
lässt sich bis in das Jahr 1826<br />
zurückverfolgen und es gibt kaum<br />
eine Familie in dem kleinen Ort<br />
nahe des Bakonywaldes, in dem<br />
nicht mindestens ein Vorfahre ein<br />
Leben lang in dieser Manufaktur<br />
gearbeitet hätte.<br />
1993 erwarben die Mitarbeiter<br />
75% der Unternehmensanteile.<br />
Mit vereinten Kräften machten sie<br />
daraus nicht nur ein florierendes<br />
Unternehmen. Sie gründeten gleichzeitig<br />
eine Gemeinschaftsvertretung<br />
zum Schutz ihrer Interessen und<br />
einigten sich darauf, aus dem<br />
Gewinn und privaten Spenden ein<br />
Gemeinde- und Touristikzentrum<br />
zu errichten. Den ausgeschriebenen<br />
Architektur-Wettbewerb gewann<br />
Gabór Turányi. Er schuf einen<br />
Gebäudekomplex in einer asymetrischen<br />
U-Form, der zwar ein<br />
industrielles, aber ausgesprochen<br />
urbanes Zentrum darstellt. In seiner<br />
kosmopolitisch ästhetischen Anmutung<br />
ist er für eine Kleinstadt recht<br />
ungewöhnlich. Gegenüber dem Haupttor<br />
der Manufaktur entstand eine –<br />
von Arkaden gesäumte Piazza als<br />
öffentlicher Raum. Treppen führen<br />
von der einen zu der anderen<br />
Seite. Es gibt kleinere, separate<br />
Räume für Veranstaltungen und<br />
Feste.<br />
Insgesamt umfasst das Gebäude drei<br />
unterschiedliche Einheiten: einen<br />
zweistöckigen Ausstellungsraum, ein<br />
Restaurant und – als Besonderheit –<br />
eine Minimanufaktur, die auch für<br />
Besuchervorführungen genutzt wird.<br />
Die verschiedenen Bereiche sind<br />
architektonisch klar voneinander<br />
abgesetzt, um auch große Besucheranstürme<br />
verkraften zu können.<br />
Die Manufaktur besteht aus außergewöhnlich<br />
schönen Räumen, die<br />
sich kreisförmig von den Kellern<br />
aus in die oberen Stockwerke fortsetzen.<br />
Die in die Mauer eingebette-<br />
ten gläsernen „Ziegelsteine“ tauchen<br />
die Treppen auf der Rückseite des<br />
Gebäudes in ein zauberhaftes Licht.<br />
Turányi wollte der örtlichen Gemeinde<br />
ein „Heiligtum“ errichten,<br />
für ihn ist allein ihre Existenz ein<br />
Grund zum feiern. Das Gebäude<br />
hat vage und doch erkennbare Ähnlichkeit<br />
mit chinesischen Pagoden<br />
und sumerischen Tempelbauten.<br />
Als geeignetes Material für die<br />
Fassade erschienen dem Architekten<br />
Ziegelsteine, er wählte den Handform-Verblender<br />
KLEIBRAND<br />
von <strong>Röben</strong>, weil das hellrot-buntgeflammte<br />
Material in seinen vielfältigen<br />
farblichen Abstufungen<br />
einem Herbstwald nachempfunden<br />
zu sein scheint. Die Mauern wirken,
Drachenähnliche Skulpturen an den<br />
Ecken des Turmes unterstützen den<br />
pagodenähnlichen Baustil.<br />
als seien sie ohne Mörtel errichtet<br />
und die einzelnen Steine durch<br />
magische Kräfte gehalten. Die<br />
rauhe, unebene Oberfläche des<br />
Handformziegels wird durch<br />
die Schieferbedachung, deren<br />
Färbung sich mit den Lichtverhältnissen<br />
verändert, ideal<br />
ergänzt. Gabór Turányi „spielt“<br />
mit den Ziegeln, nutzt die schier<br />
unerschöpflichen Gestaltungsmöglichkeiten,<br />
die das Material<br />
bietet. Er schichtet Ziegelstein auf<br />
Ziegelstein und lässt zum Beispiel<br />
den Rauchabzug über dem Korridor<br />
der Manufaktur förmlich „in<br />
den Himmel wachsen“. Am Fuße<br />
des Turms sieht der Besucher unwillkürlich<br />
hinauf, entdeckt die<br />
feine Geometrie der Mauern und<br />
Öffnungen im Ziegelmauerwerk<br />
des Rauchabzuges ziehen den Blick<br />
förmlich nach oben.<br />
die geschickte Anordnung der<br />
Ziegelsteine, durch die sich in der<br />
Spitze des Rauchabzuges das Licht<br />
seinen Weg sucht.<br />
Auch Porzellan besteht letztendlich<br />
aus sorgfältig ausgesuchter, gebrannter<br />
Erde. Alle für den Baukomplex<br />
verwendeten Materialien erinnern<br />
daran. Roher, poröser Stein mit<br />
unregelmäßiger Färbung, der unverputzte<br />
Backstein, die natürlichen<br />
Schieferdächer und die große chinesische<br />
Treppe aus grobem Schiefer.<br />
Dunkle Erdfarben beherrschen das<br />
Bild, ohne eine düstere Atmosphäre<br />
zu vermitteln. Einheimische Jugendliche<br />
haben in einer Werkstatt Backsteine<br />
hergestellt, deren Reliefs<br />
den funktionalen Bereichen eine<br />
besondere Note geben und einen<br />
persönlichen Bezug schaffen. An<br />
den Ecken des Turmes finden sich<br />
Drachenskulpturen, die „all ihr<br />
Feuer in die Ziegel gebrannt<br />
haben“ und den pagodenähnlichen<br />
Stil optisch unterstützen. Nicht<br />
zuletzt gilt der Drache im asiatischen<br />
Raum als Beschützer und<br />
Glücksbringer. Dass solch spannende<br />
Architektur in Herend umgesetzt<br />
werden konnte, ist selbstredend<br />
ein wahrer Glücksfall. Das Konzept<br />
und die Bauausführung sind das<br />
eindrucksvolle Ergebnis einer außergewöhnlichen<br />
Zusammenarbeit<br />
zwischen Kunden und Architekten.<br />
Hier wurde ein klares Konzept ohne<br />
Beeinträchtigung der Funktionalität<br />
konsequent umgesetzt.<br />
Zierstreifen aus handgefertigten<br />
Backsteinen im Mauerwerk geben<br />
dem Gebäude eine persönliche Note.
Rot und Schwarz – ein Fußballstadion im niederländischen Assen<br />
Architekten: Promeij bv Bouwadvies Buro, Henk Meijering, Assen<br />
Fotos: Jan Derweg, Amsterdam<br />
Die rund 30 km südlich von Groningen<br />
gelegene niederländische<br />
Kleinstadt Assen ist unter Sportfans<br />
vor allem als Austragungsort<br />
internationaler Motorradrennen<br />
ein Begriff. Die Fußballfans der<br />
Region zieht es dagegen in erster<br />
Linie zu den Heimspielen des in<br />
der ersten Hoofdklasse C spielenden<br />
Amateurvereins Achilles 1894.<br />
Bis vor kurzem spielte der<br />
inzwischen <strong>10</strong>7 Jahre alte Club<br />
noch im Sportzentrum „Houtlaan“.<br />
Weil die 1966 errichtete<br />
Anlage jedoch mittlerweile nicht<br />
mehr den Anforderungen an eine<br />
moderne Fußball-Arena entsprach,<br />
fiel 1997 nach langjährigen und<br />
schwierigen Verhandlungen mit<br />
der Stadt der Startschuss für den<br />
Neubau eines reinen Fußballstadions<br />
am Martin Luther Kingweg im<br />
Norden von Assen.<br />
Nach dem Umzug in die Ende<br />
1999 fertiggestellte neue Arena<br />
haben sich völlig neue sportliche<br />
und finanzielle Möglichkeiten für<br />
den Verein ergeben, denn das<br />
Stadion bietet Platz für mehr als<br />
6.000 Zuschauer – 620 von ihnen<br />
können dem Spielgeschehen auf<br />
dem Rasen von überdachten<br />
Sitzplätzen aus folgen. „Seitdem<br />
unser Team im Sportpark Marsdijk<br />
spielt, sind die Einnahmen<br />
durch Zuschauer und Werbeverträge<br />
sprunghaft angestiegen“,<br />
berichtet Henk Krans, der Pressesprecher<br />
von Achilles 1894.<br />
„Außerdem ist es uns gleich<br />
im ersten Jahr gelungen, niederländischer<br />
Amateurmeister zu<br />
werden!“ Zentrales architektonisches<br />
Element des Sportparks<br />
Marsdijk ist ein 48 Meter langer,<br />
zweigeschossiger Gebäuderiegel,<br />
der aus einem massiven Sockelgeschoss<br />
und einem zu den<br />
beiden Außenkanten hin schräg<br />
nach oben aufragenden und<br />
mit lang gestreckten horizontalen<br />
Fensterbändern ausgestatteten<br />
Obergeschoss besteht. Zum<br />
Spielfeld hin nimmt der Bau die<br />
überdachte Nordtribüne auf, in<br />
gegenüber liegender Richtung<br />
fungiert er als repräsentative<br />
Eingangsfront. Im Inneren des<br />
Gebäudes stehen Umkleidekabinen,<br />
ein Massageraum und<br />
Besprechungsräume im Sockelgeschoss<br />
sowie ein Sprecherraum,<br />
ein Verwaltungsraum und<br />
eine vereinseigene Mini-Druckerei<br />
im Obergeschoss zur Verfügung.<br />
Direkt neben dem Stadion bietet<br />
der Sportpark zwei Trainingsplätze<br />
sowie einen Parkplatz mit rund<br />
1.000 Stellplätzen.
Ungewöhnlich zeigt sich nicht<br />
nur die Form, sondern auch die<br />
Farbgebung des Neubaus: „Einer<br />
der wichtigsten Planungsgedanken<br />
war die betont plakative Verwendung<br />
der beiden Vereinsfarben<br />
Rot und Schwarz“, berichtet<br />
Architekt Henk Meijering vom<br />
vor Ort ansässigen Architekturbüro<br />
Promeij Bouwadvies Buro.<br />
Für den unteren Bereich wurden<br />
schwarze Keramik-Klinker gewählt,<br />
die Fassaden des Obergeschosses<br />
wurden zum überwiegenden Teil<br />
mit roten Kunststoff-Paneelen verschalt.<br />
Ebenso kontrastreich<br />
zeigen sich die Fenster- und<br />
Türrahmen, die ebenfalls Schwarz<br />
und Rot lackiert wurden.<br />
Bei der Suche nach einem geeigneten<br />
Klinker für die Außenfassade<br />
des Sockels fiel die Wahl schließlich<br />
auf den <strong>Röben</strong> Keramik-Klinker<br />
FARO schwarz-nuanciert, glatt im<br />
Waalformat, einer vor allem in den<br />
Niederlanden sehr gebräuchlichen<br />
Ziegelgröße: „Die Klinker von<br />
<strong>Röben</strong> bieten eine hervorragende<br />
und dauerhafte Materialqualität“,<br />
begründet Henk Meijering die<br />
in enger Zusammenarbeit mit den<br />
Verantwortlichen von Achilles 1894<br />
getroffene Entscheidung. Neben<br />
den insgesamt 80.000 schwarzen<br />
Keramik-Klinkern wurden in<br />
regelmäßigen Abständen auch<br />
1.500 <strong>Röben</strong> Keramik-Klinker<br />
WESTERWALD rot, glatt in<br />
die im Läuferverband gemauerte<br />
Fassade integriert. Die eingefügten<br />
Klinker geben dem lang gestreckten<br />
Gebäude eine Struktur und<br />
verstärken den Kontrast der beiden<br />
Farben Rot und Schwarz zusätzlich:<br />
„Die Mauerwerksfassade korrespondiert<br />
auf diese Weise nicht<br />
nur mit den darüber liegenden<br />
roten Kunststoff-Paneelen sowie<br />
den Fenster- und Türrahmen,<br />
sondern auch mit dem Vereinswappen<br />
des Clubs“, berichtet<br />
Henk Meijering und verweist<br />
dabei auf die Darstellung des<br />
tapferen griechischen Kriegers<br />
Achilles, die weithin sichtbar in<br />
die Frontfassade des Neubaus<br />
integriert wurde.<br />
15
Ein repräsentatives Gesicht –<br />
Neubau für die Landessparkasse zu Oldenburg<br />
Architekten: Kulla, Herr & Partner, Oldenburg, Wilhelmshaven<br />
Fotos: Gundula Steinbrenner, Oldenburg<br />
Mit weit über 130 Filialen ist die<br />
Landessparkasse zu Oldenburg<br />
(LzO) die größte Sparkasse der<br />
Weser-Ems-Region. Alleine in der<br />
Stadt Oldenburg ist das Unternehmen<br />
mit insgesamt 23 Niederlassungen<br />
vertreten. Einer dieser<br />
Standorte ist die Filiale an der<br />
Bloherfelder Straße, einer vielbefahrenen<br />
Ausfallstraße im Westen<br />
der Stadt, wo ein vor kurzem<br />
fertiggestellter Neubau einen ehemals<br />
an gleicher Stelle stehenden<br />
und inzwischen längst zu klein<br />
gewordenen Altbau ersetzt. Um die<br />
bislang eher gesichtlose städtebauliche<br />
Situation an der Kreuzung zur<br />
Theodor-Heuss Straße aufzuwerten<br />
und einen sichtbaren Bezug zu<br />
einem schräg gegenüber gelegenen<br />
Bürogebäude zu schaffen, konzipierte<br />
das Oldenburger Architekturbüro<br />
Kulla, Herr & Partner das<br />
neue LzO-Gebäude als L-förmig<br />
geschnittenen dreistöckigen Baukörper<br />
mit einer turmartig ausgebildeten<br />
Eingangsfront zur Kreuzungsmitte.<br />
Den horizontalen<br />
Gegenpol bilden drei jeweils um<br />
einen Meter aus der Fassade hervor<br />
tretende und dabei lediglich zweigeschossige<br />
Klinkervolumen, die<br />
das Gebäude harmonisch in die<br />
regional verwurzelte Ziegelarchitektur<br />
einfügen. Die übrige Fassade<br />
wurde im Kontrast dazu überwiegend<br />
in Glas und verzinktem Stahl<br />
ausgebildet.<br />
Besonders auffällig zeigt sich dabei<br />
das mit gewelltem Aluminiumblech<br />
verkleidete Staffelgeschoss, das nach<br />
oben hin durch ein flachgeneigtes<br />
16<br />
Zink-Satteldach mit weit auskragenden<br />
Sonnenschutzlamellen abgeschlossen<br />
wird. Für zusätzliche<br />
Blickfänge sorgen vier kreisförmige<br />
Fenster im unteren Bereich der<br />
Mauerwerksfassade.<br />
Der Neubau bietet eine Nettofläche<br />
von insgesamt 1.800 m 2 , wobei die<br />
LzO lediglich das nach Südosten<br />
hin erweiterte Erdgeschoss nutzt.<br />
In der darüber liegenden Ebene<br />
befinden sich drei frei vermietbare<br />
Büros, im Dachgeschoss wurden<br />
drei großzügig geschnittene<br />
Appartements mit eigenem Balkon<br />
eingerichtet. Die beiden oberen<br />
Ebenen werden durch zwei giebeldachbedeckte<br />
Glastreppenhäuser in<br />
den beiden Flügeln des Gebäudes<br />
erschlossen, so dass der durch vier<br />
Stahlträger und ein aufliegendes<br />
Glasdach repräsentativ gestaltete<br />
Haupteingang ausschließlich den<br />
Kunden der LzO vorbehalten<br />
bleibt. Das Innere der Sparkasse<br />
bietet neben mehreren Beratungsräumen<br />
eine zentrale Kundenhalle,<br />
in der ein verglastes Pultdach für<br />
ausreichend Tageslichteinfall sorgt.<br />
Aufgrund des Wunsches des Auftraggebers<br />
nach einem dauerhaften<br />
Objekt mit möglichst niedrigen<br />
Wartungs- und Unterhaltskosten<br />
wurde die Fassade des neuen LzO-<br />
Gebäudes in zweischaliger Bauweise<br />
errichtet, die aus einem 240 mm<br />
starken Hintermauerwerk, einer<br />
Zwischenschicht aus <strong>10</strong>0 mm<br />
Mineralfaserdämmung mit Luftschicht<br />
und einem davor liegenden<br />
Sichtmauerwerk aus Verblendern<br />
besteht. Bei der Wahl nach einem<br />
geeigneten Vormauerziegel hat sich<br />
das Büro Kulla, Herr & Partner<br />
gemeinsam mit Peter Forst, dem<br />
Hausarchitekten der LzO, für den<br />
<strong>Röben</strong> Verblender GREETSIEL 2 DF,<br />
friesisch-bunt entschieden – „ein<br />
großformatiger Verblender (Höhe:<br />
113 mm) mit einem überaus lebendigen<br />
Farbspiel, der neben Massivität<br />
und Beständigkeit gleichzeitig<br />
auch Offenheit und Dynamik ausdrückt“,<br />
wie die Architektin Sabine<br />
Hozak berichtet. „Ein idealer Verblender<br />
also, um die Philosophie<br />
der LzO nach außen zu tragen.“<br />
Um den massiven Eindruck des<br />
Gebäudes noch zu unterstützen,<br />
wurden die Fenster innerhalb der<br />
Mauerwerksfassade mit einer 24 cm<br />
tiefen Laibung versehen.<br />
Mit ihrem leuchtend bunten Farbspiel<br />
schaffen die im sogenannten<br />
„wilden Verband“ gemauerten<br />
<strong>Röben</strong> Verblender einen gelungenen<br />
Kontrast zu den zahlreichen<br />
Elementen aus verzinktem Stahl<br />
sowie der funkelnden Aluminiumblech-Fassade<br />
im Staffelgeschoss.
Einen zusätzlichen farblichen<br />
Akzent bilden die von innen dunkelblau<br />
lackierten und mit Aluminium<br />
beschichteten Glaspaneele,<br />
die vor den lediglich einschalig<br />
gemauerten Brüstungsbereichen<br />
den Eindruck einer durchgängigen<br />
Glasfassade erzeugen.<br />
Auch bei zahlreichen anderen<br />
Projekten hat die LzO auf<br />
Produkte aus dem Hause <strong>Röben</strong><br />
gesetzt: „Die Steine sind sehr<br />
robust, das kommt unserem<br />
Anspruch nach hochwertiger<br />
Architektur entgegen“, begründet<br />
Peter Forst die über Jahre hinweg<br />
gewachsene Kundenverbundenheit.<br />
„Durch ihre äußerst geringe<br />
Wasseraufnahme sind sie außerdem<br />
extrem unanfällig gegen jegliche<br />
Art von Verschmutzung“ – genau<br />
das richtige Material für einen so<br />
verkehrsreichen Standort wie die<br />
Bloherfelder Straße also.<br />
Das Beispiel dieses Bankgebäudes<br />
zeigt, dass sich in der modernen<br />
Ziegelarchitektur keramische und<br />
andere Baustoffe gut miteinander<br />
kombinieren lassen.<br />
17
Gelungenes Zusammenspiel: Klinker-Riemchen auf Wärmedämm-Verbundsystem –<br />
das Kreiswehrersatzamt in Wittenberg<br />
Architekt: Jan-Holger Kahl, Wörlitz<br />
Fotos: Wolfgang Schumann, Berlin<br />
In der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts<br />
galt die Lutherstadt Wittenberg<br />
als eines der bedeutendsten<br />
geistigen und kulturellen Zentren<br />
Europas: Neben Martin Luther selbst,<br />
der hier 1517 seine berühmten 95<br />
Thesen an die Schlosskirche schlug,<br />
war es vor allem der Maler Lucas<br />
Cranach d. Ä., der seinerzeit den<br />
Ruf der Stadt begründete. 500 Jahre<br />
später sind es in erster Linie die<br />
zahllosen historischen Gebäude,<br />
die von der bewegten Geschichte<br />
der inzwischen 50.000 Einwohner<br />
zählenden Elbstadt zeugen.<br />
Ein ganz anderer Eindruck bietet<br />
sich zwei Kilometer weiter westlich<br />
der Innenstadt, wo das Straßenbild<br />
durch einen städtebaulichen Mix<br />
aus alten und dringend renovierungsbedürftigen<br />
Industriebauten<br />
und verschiedenen Wohnbauten<br />
unterschiedlichen Stils geprägt<br />
wird. Auf einem lang gestreckten<br />
Grundstück in unmittelbarer Nähe<br />
zur Bundesstraße 187 wurde hier<br />
im letzten Jahr ein neues Kreiswehrersatzamt<br />
errichtet. Der winkelförmig<br />
angelegte, dreigeschossige<br />
Bau bietet entsprechend seinen<br />
unterschiedlichen Funktionen einen<br />
zentralen Bereich mit Eingang und<br />
vertikaler Erschließung sowie zwei<br />
angrenzende Mittelflurtrakte mit<br />
Musterungs- und Beratungsräumen<br />
im Erdgeschoss und Verwaltungsräumen<br />
in den beiden Obergeschossen.<br />
Die flach geneigte Walmdachkonstruktion<br />
wurde mit einer Titan-<br />
18<br />
Zink-Strangfalzdeckung versehen.<br />
Entsprechend den Anforderungen<br />
hinsichtlich einer robusten, pflegeleichten<br />
und dauerhaft haltbaren<br />
Fassadenoberfläche war zunächst<br />
geplant, den überwiegend aus<br />
Kalksandstein errichteten Bau mit<br />
einem hinterlüfteten wärmegedämmten<br />
Klinkermauerwerk zu<br />
verblenden. „Aufgrund der beabsichtigten<br />
Sockelausbildung hätten<br />
wir dabei jedoch eine aufwändige<br />
Unterkonstruktion aus Ankerschienen<br />
errichten müssen, um die<br />
gesamte Last der Verblendklinker<br />
auffangen zu können“, berichtet<br />
Architekt Jan-Holger Kahl. Eine<br />
geeignete Alternative ergab sich<br />
dann beim Besuch der Baumesse<br />
in Leipzig: „Dort wurden wir auf<br />
Wärmedämm-Verbundsysteme aufmerksam,<br />
die nach außen hin mit<br />
einer nur wenige Millimeter starken<br />
Oberfläche aus aufgeklebten<br />
Klinkerriemchen abschließen. Zur<br />
Vermeidung von winterlichem<br />
Wärmeverlust bzw. sommerlicher<br />
Überhitzung kann dabei wahlweise<br />
Styropor oder, wie im Fall des<br />
Kreiswehrersatzamtes, Mineralwolle<br />
eingesetzt werden.“<br />
Nach intensivem Vergleich zwischen<br />
Klinkerriemchen verschiedener<br />
Hersteller entschied sich der<br />
Architekt schließlich, die Fassade<br />
des neuen Kreiswehrersatzamtes<br />
mit 14 mm starken Klinkerriemchen<br />
von <strong>Röben</strong> auszuführen: „Die<br />
<strong>Röben</strong>-Riemchen erwiesen sich<br />
sowohl hinsichtlich der Wasseraufnahme<br />
als auch hinsichtlich des<br />
Preises als beste Lösung.“ Kaum<br />
verwunderlich, denn die von ganzen<br />
Steinen geschnittenen Riemchen<br />
werden bei ihrer Produktion eben<br />
so hart gebrannt wie herkömmliche<br />
Keramik-Klinker. Damit schützen<br />
sie die Fassade dauerhaft und zuverlässig<br />
vor Wind und Wetter. „Ein<br />
weiterer Vorteil der <strong>Röben</strong>-Klinkerriemchen<br />
ist die große Farbauswahl“,<br />
berichtet Jan-Holger Kahl: Für das<br />
Kreiswehrersatzamt in Wittenberg<br />
wählte er orange-nuancierte, glatte<br />
Riemchen im Normalformat: „Der<br />
Farbton verleiht dem Gebäude eine<br />
helle und freundliche Ausstrahlung<br />
und bildet gleichzeitig einen schönen<br />
Kontrast zum Blau des Himmels<br />
und dem Grün der Landschaft.“
Um aufwendige Schneide-Arbeiten<br />
an den Riemchen zu vermeiden,<br />
wurde der gesamte Fassadenentwurf<br />
hinsichtlich Lage und Größe von<br />
Fenster- und Türöffnungen auf das<br />
oktametrische Ziegelmaß abgestimmt.<br />
„Sowohl hier, als auch bei<br />
der Ausführung wurden wir optimal<br />
von <strong>Röben</strong> unterstützt, so dass<br />
weder bei der Planung, noch auf<br />
der Baustelle irgendwelche Probleme<br />
auftraten“, berichtet Architekt Jan-<br />
Holger Kahl. Eine weitere Erleichterung<br />
bedeutete die Verwendung<br />
von speziellen Winkel-Riemchen<br />
für die Außenecken des Gebäudes<br />
und der Einsatz von Fertigbauteilen:<br />
„Neben den als Rollschicht<br />
vorgesehenen, äußeren Fensterbänken<br />
haben wir auch die oberen<br />
Abschlüsse der Verblendbereiche<br />
als Fertigteile montiert. Die dazu<br />
notwendige Detailentwicklung<br />
wurde ebenfalls durch den <strong>Röben</strong><br />
Planungs-Service übernommen und<br />
später dann vor Ort mit uns abge-<br />
stimmt. Der Einsatz der Fertigteile<br />
trug nicht nur entscheidend zur<br />
Verkürzung der Bauzeit bei, sondern<br />
ermöglichte durch die geringeren<br />
Lohnkosten gleichzeitig auch<br />
eine erhebliche Kostenreduzierung.<br />
Und optisch ist die Riemchen-<br />
Fassade von einer konventionell<br />
gemauerten Fassade nicht zu unterscheiden.“<br />
<strong>Röben</strong> Klinker-Riemchen<br />
Armierungsschicht<br />
Dämmung<br />
aus Mineralwolle<br />
Schraubdübel<br />
Geputzter Sockel<br />
Armierungsschicht<br />
Der Aufbau eines Wärmedämm-<br />
Verbundsystems mit Riemchen:<br />
Da bleibt die Wärme im Haus und<br />
die Fassade ist praktisch auf Dauer<br />
wartungsfrei.<br />
19
<strong>Röben</strong> Klinkerplatten – ideal für den Kfz-Bereich<br />
bei Audi, Ferrari, Porsche und Mercedes-Benz<br />
Fotos: Armin Wenzel, Adelzhausen (Audi, Ferrari)<br />
Helmut Kloth, Gelsenkirchen (Porsche)<br />
Gundula Steinbrenner, Oldenburg (Mercedes-Benz)<br />
„Fließende Übergänge“<br />
„Ganz in Rot“ sollte eigentlich<br />
der Boden im Audi-Zentrum in<br />
der Scharnhorststraße in Kassel<br />
„erstrahlen“. Erst im allerletzten<br />
Augenblick entschied sich der<br />
Bauherr Glinicke für die <strong>Röben</strong><br />
Klinkerplatte VIGRANIT ®<br />
20 x 20 cm in hellgrau. Das neue<br />
Konzept für die Audi-Autohäuser,<br />
das fließende Übergänge von der<br />
Direktannahme und den Showroom<br />
bis in die Werkstatt vorsieht,<br />
sieht Glinicke mit der <strong>Röben</strong><br />
Klinkerplatte am besten gelöst.<br />
„Das ist einfach ein schicker<br />
Bodenbelag, der seine Funktion in<br />
unserer eleganten Ausstellung, wie<br />
im Bereich der Werkstatt gleichermaßen<br />
gut erfüllt.“ Glinicke hat<br />
die praktische Erfahrung mit dem<br />
Boden so überzeugt, dass in seinem<br />
neuen Autohaus in Erfurt nun ebenfalls<br />
die Symbiose aus „Glanz und<br />
Funktionalität“ Einzug hält.<br />
Pole Position<br />
Ferrari setzt auf <strong>Röben</strong>, wenn es<br />
um die Sicherheit in der Werkstatt<br />
geht. Für das neue Autohaus im<br />
Gewerbepark Main „Frankenpark“<br />
in Dettelbach wählte der bekannte<br />
Hersteller der (meist) roten<br />
Sportwagen die hellgraue <strong>Röben</strong><br />
VIGRANIT ® -Platte im Format<br />
20 x <strong>10</strong> cm. Neben der „normalen“<br />
Oberfläche kamen auch rutschhemmende<br />
Oberflächen mit<br />
den Werten R 11 sowie R 11/V 4<br />
zum Einsatz. Weiteres wichtiges<br />
Kriterium für die „<strong>Röben</strong> Pole<br />
Position“ bei Ferrari war neben<br />
der Rutschfestigkeit auch die<br />
Möglichkeit des wirtschaftlichen<br />
Rüttelverfahrens, da insgesamt<br />
1.145 m 2 Klinkerplatten verlegt<br />
wurden.<br />
21
<strong>Röben</strong> Klinkerplatten halten jeder Belastung stand.<br />
Sie sind resistent gegen Säuren, Öle und Arbeitsschmutz<br />
und immer leicht zu reinigen.<br />
Eine gläserne Bühne<br />
für Porsche<br />
Wie eine gläserne Bühne wirkt das<br />
neue Porsche-Zentrum Wiesbaden.<br />
Service- und Ausstellungsflächen<br />
verteilen sich hier in einem quadratischen<br />
Kubus auf drei Ebenen.<br />
Der Blick in die Werkstatt ist<br />
erwünscht, hier wird sie zur<br />
Bühne. Die hellgraue VIGRANIT ®<br />
Klinkerplatte unterstützt die<br />
Leichtigkeit des Gebäudes, ist<br />
eine ideale Kombination zum<br />
Stahl der Regale und Hebebühnen.<br />
22<br />
Die leichte Reinigungsmöglichkeit<br />
durch die Dichte, feuerversiegelte<br />
Oberfläche war mit entscheidend<br />
für die Auswahl der Platte. Hier,<br />
wo 911er, Carreras und Boxter<br />
gewartet und getunt werden, hat<br />
man das hellgraue Material im<br />
Format 20 x <strong>10</strong> cm verlegt. Die<br />
Oberflächenstruktur R11 sorgt in<br />
der rund 800 m 2 großen Wartungshalle<br />
für die notwendige „Bodenhaftung“.<br />
Das Kraftpaket unterm<br />
Nordstern: <strong>Röben</strong> Klinkerplatten<br />
im neuen Mercedes-<br />
Benz Nutzfahrzeug-Zentrum<br />
Über 33.000 Besucher konnte<br />
Geschäftsführer Thomas Rosier<br />
beim Tag der offenen Tür zur<br />
Eröffnung des neuen Mercedes-<br />
Benz Nutzfahrzeug-Zentrums<br />
begrüßen – ein Zeichen dafür,<br />
dass an Oldenburgs Automeile,<br />
der Bremer Heerstraße, etwas<br />
ganz besonderes in nur neun<br />
Monaten Bauzeit entstanden ist:<br />
Deutschlands größtes und eindrucksvollstes<br />
Nutzfahrzeug-<br />
Zentrum, Branchenkenner sprechen<br />
sogar vom modernsten in<br />
Europa.<br />
„Da unser alter Standort nicht<br />
mehr den Kunden- und Platzanforderungen<br />
entsprach, dachten<br />
wir ab Mitte 1999 über eine Alternative<br />
nach. Es bot sich an der<br />
Oldenburger Automeile ein<br />
Grundstück von rund 55.000 m 2<br />
an – dies war der Startschuss für<br />
unseren Neubau und der Schritt<br />
in eine neue Dienstleistungsära,“<br />
erläutert Thomas Rosier. Ziel war<br />
es, das umfangreiche Raumprogramm<br />
in Hinsicht auf effiziente<br />
Arbeitsabläufe wirtschaftlich und<br />
funktionell zu gestalten und in<br />
Architektur umzusetzen. Dabei<br />
lassen sich drei Service-Schwerpunkte<br />
klar erkennen: Zum einen<br />
der 900 m 2 große Ausstellungsbereich<br />
mit Verwaltung und dem<br />
Restaurant „Paddocks“, daran<br />
anschließend die Werkstätten mit<br />
Teilelager, Prüfstraßen, Faktura<br />
und Karosserie. Separat errichtet<br />
sind die Waschstraßen mit Reifencenter<br />
und Betankung. Das einmalige<br />
Dienstleistungsspektrum,<br />
das Rosier und 16 angesiedelte<br />
Partnerbetriebe anbieten, reicht<br />
vom Mercedes Getriebeservicestützpunkt<br />
über eine Autovermietung<br />
für Transporter bis zum<br />
LKW-Reifenservice. Rund 120<br />
Mitarbeiter sind von 6.00 bis<br />
24.00 Uhr für den Kunden da.<br />
Strapazierfähig und sicher –<br />
genau das Richtige für Rosier<br />
Im gewerblichen Bereich sind<br />
Böden härtesten Belastungen<br />
ausgesetzt. Dies gilt besonders<br />
für Werkstätten, Wartungs- und<br />
Waschhallen. Auslaufendes Öl<br />
führt zu erhöhter Rutschgefahr,<br />
es wird mit Säuren gearbeitet,<br />
Werkzeug fällt zu Boden und<br />
schwere Geräte werden auf<br />
kleinen, harten Rädern bewegt.<br />
„Deshalb haben wir uns beim<br />
Boden im Werkstattbereich für<br />
<strong>Röben</strong> entschieden. Die Klinkerplatten<br />
werden „knirsch“, also<br />
praktisch fugenlos verlegt, und<br />
dann planeben eingerüttelt. Der<br />
Boden bietet so keinerlei Angriffspunkte<br />
für Beschädigungen. Wir<br />
brauchten einen Boden, der hart<br />
im Nehmen ist“, so Thomas Rosier.<br />
Das Klinkerplatten-Sortiment enthält<br />
geeignete Produkte für alle<br />
Werkstattbereiche, die sicherheitstechnischen<br />
Anforderungen, wie<br />
Rutschsicherheit und Belastbarkeit,
vollkommen erfüllen. Diese Bodenplatten<br />
sind so hart und dicht<br />
gebrannt, dass ihnen auch extreme<br />
Beanspruchung auf Dauer nichts<br />
anhaben kann. <strong>Röben</strong> Klinkerplatten<br />
zeichnen sich durch eine<br />
hohe Wirtschaftlichkeit aus, denn<br />
sie sind nahezu unverwüstlich,<br />
praktisch wartungsfrei und damit<br />
resistent gegen den „Zahn der<br />
Zeit.“ Sie werden trocken gepresst<br />
und einzeln gebrannt. Dieses aufwendige<br />
Herstellungsverfahren<br />
zahlt sich durch hervorragende<br />
Eigenschaften aus. So liegen ihre<br />
Biegezug- und Druckfestigkeitswerte<br />
weit über der Europa-Norm.<br />
Neben der Strapazierfähigkeit<br />
der Klinkerplatten ist gerade im<br />
Kfz-Bereich die Trittsicherheit<br />
immens wichtig. Für Räume mit<br />
erhöhter Rutschgefahr bietet<br />
<strong>Röben</strong> deshalb unterschiedliche<br />
Oberflächen an. Ihre „R“- und<br />
„V“-Werte (geprüfte Rutschhemmung<br />
und Flüssigkeitsverdrängungsraum)<br />
nach DIN 51130 entsprechen<br />
in jedem Fall den hohen<br />
Anforderungen der Berufsgenossenschaften.<br />
Rosier hat die <strong>Röben</strong><br />
Klinkerplatte VERRUM ® rot im<br />
Format 20 x <strong>10</strong> cm ausgewählt.<br />
Im Werkstattbereich mit den 18<br />
Werkstattspuren und beim Bremsenprüfstand<br />
ist die rutschhemmende<br />
Oberfläche R11 zum Einsatz<br />
gekommen, im Bereich der LKW-<br />
Waschanlage die VERRUM Klinkerplatte<br />
R12/V6, die mit ihrer<br />
Profilierung im Nassbereich für<br />
einen „sicheren Tritt“ sorgt.<br />
Rationelle und wirtschaftliche<br />
Verlegung im Rüttelverfahren<br />
<strong>Röben</strong> Klinkerplatten haben eine<br />
exzellente Maßhaltigkeit. Dadurch<br />
sind sie für die Verlegung im<br />
rationellen und wirtschaftlichen<br />
Rüttelverfahren bestens geeignet.<br />
Dabei werden die Platten „knirsch“,<br />
das heißt nahezu fugenlos verlegt.<br />
Damit es dabei nicht zu Abplatzungen<br />
an den Kanten kommen<br />
kann, haben sie den patentierten<br />
<strong>Röben</strong> V-Spacer ® . Durch den<br />
konischen Zulauf der Flanken<br />
berühren sie sich nur im nicht<br />
sichtbaren, unteren Bereich. Die<br />
Scheinfuge im Bereich der Fase<br />
sorgt beim Einschlämmen für eine<br />
optimale Haftung an den Kanten.<br />
„Die Möglichkeit, im Rüttelverfahren<br />
und damit praktisch fugenlos<br />
zu verlegen, war für uns ein<br />
weiteres wichtiges Kriterium“,<br />
betont Geschäftsführer Thomas<br />
Rosier. „Denn so erhalten wir<br />
einen ebenmäßigen Boden und<br />
haben keine Probleme die großen<br />
Flächen – rund 4.500 m 2 <strong>Röben</strong><br />
VERRUM ® wurden verlegt – sauber<br />
zu halten. Durch die Resistenz<br />
gegen Öle ist die Reinhaltung<br />
und Pflege des Bodens sehr einfach.<br />
Alles in allem machen die<br />
extreme Belastbarkeit, die technische<br />
Perfektion, die Wirtschaftlichkeit,<br />
die Pflegeleichtigkeit und natürlich<br />
die Schönheit des <strong>Röben</strong><br />
Materials zu einem für uns idealen<br />
Bodenbelag. „Wir sind absolut<br />
zufrieden!“<br />
23
Ein Dach für die Ewigkeit –<br />
Renovierung des Klosters Antonigartzem<br />
Architekt: Amandus Pesch, Euskirchen<br />
Fotos: Cornelia Suhan, Dortmund<br />
Octavia Zanger, Rheinisches Amt für Denkmalpflege<br />
Die Ursprünge des im rheinländischen<br />
Zülpich-Enzen gelegenen<br />
Klosters Antonigartzem, ehemals<br />
als kleine Kapelle mit einer angegliederten<br />
Nonnenklausnerei<br />
konzipiert, gehen zurück bis ins<br />
Jahr 1352. Ein Jahrhundert später<br />
wurde das Kloster durch Franziskaner-Mönche,<br />
seit dem 16. Jahrhundert<br />
durch Augustiner-Nonnen<br />
genutzt. Nach ihrer zweimaligen<br />
Zerstörung und dem bis 1681<br />
erfolgten Wiederaufbau wurde<br />
die kleine Anlage im Verlauf des<br />
18. Jahrhunderts nach und nach<br />
zu einem vierflügelig um einen<br />
Innenhof gelegenen und teilweise<br />
von einem Wassergraben umgebenen<br />
Quadrum erweitert.<br />
24<br />
Anfang des 19. Jahrhunderts ging<br />
die inzwischen säkularisierte Anlage<br />
schließlich in Privatbesitz<br />
über und wurde danach bis in<br />
die 1960er Jahre hinein ausschließlich<br />
landwirtschaftlich genutzt.<br />
Als die inzwischen denkmalgeschützten<br />
Gebäude 1998 nach<br />
langer Investorensuche durch die<br />
Zülpicher Wohnungsbau-Gesellschaft<br />
GVV Liegenschaften um<br />
Wolfgang Husten erworben<br />
wurden, um dort mehrere Privatwohnungen<br />
zu schaffen, deuteten<br />
außer der Kapelle und dem alten<br />
Herrenhaus kaum noch etwas<br />
auf die ehemals sakrale Nutzung<br />
hin. 80 bis 90 % der historischen<br />
Bausubstanz waren vollständig<br />
zerstört – vor allem die südöstlich<br />
gelegene, teils gewölbte, teils<br />
flachgedeckte Saalkirche, deren<br />
Chor seit langem durch eine<br />
Pferdetränke und andere Stalleinbauten<br />
ersetzt worden war. Ähnlich<br />
schlecht stand es um die vollständig<br />
verfallene Westfassade<br />
und das in großen Teilen abgängige<br />
Dach der Kapelle.<br />
Direkt neben der Kirche schließt<br />
sich im Südflügel der Anlage das<br />
ehemalige Herrenhaus an – ein in<br />
Bruchstein errichtetes und mit<br />
stichbogigen, teilweise vermauerten<br />
Fenstern ausgestattetes Gebäude,<br />
das vor kurzem ebenfalls noch<br />
einer Ruine glich: Nachdem die<br />
Traufzone bereits seit längerem<br />
größtenteils zerstört war, wurden<br />
1985 auch die Hofseite, sämtliche<br />
Innenwände und weite Teile<br />
des maroden Daches abgebrochen.<br />
Nach der jetzt erfolgten Restaurierung<br />
wurde hier eine Wohnung<br />
für die Familie Husten eingerichtet.
Die dunkle Farbe des Tondachziegels<br />
steht im wohltuenden Kontrast zur<br />
weißen Fassade mit ihren braun-rot<br />
abgesetzten Fenster- und Türeinfassungen.<br />
Die glänzende Oberfläche<br />
des Ziegels spielt mit dem Blau des<br />
Himmels und gibt so dem historischen<br />
Gebäude eine freundliche Ausstrahlung.<br />
25
Harmonisiert mit der historischen Bausubstanz –<br />
der <strong>Röben</strong> Hohlfalzziegel LIMBURGplus<br />
Zwei weitere neue Privatwohnungen<br />
befinden sich im ehemaligen<br />
Wirtschaftsgebäude (Westflügel)<br />
und im ehemaligen Gesindehaus<br />
(Ostflügel). Die übrigen Gebäude<br />
der Klosteranlage wurden erst<br />
zum Teil saniert, insgesamt soll<br />
das Projekt aber bis zum Jahr<br />
2003 abgeschlossen sein.<br />
Neben der Neuverputzung sämtlicher<br />
Innenwände und Mauern<br />
sowie dem Einsetzen neuer Türen<br />
und Fenster stand bei den umfangreichen<br />
und in enger Abstim-<br />
mung mit der Denkmalpflege<br />
erfolgten Sanierungsmaßnahmen<br />
vor allem die Neueindeckung<br />
sämtlicher Dächer mit einer Fläche<br />
von insgesamt 2.<strong>10</strong>0 m 2 im Mittelpunkt.<br />
Die Verwendung eines<br />
schwarzen Tondachziegels, der<br />
von seiner Optik her die Anmutung<br />
der ehemals verwendeten<br />
Schüttel- und Hohlpfannen aufgreift,<br />
stand dabei aus Gründen<br />
des Denkmalschutzes von Anfang<br />
an fest. Architekt Amandus Pesch<br />
wählte schließlich den <strong>Röben</strong><br />
Hohlfalzziegel LIMBURGplus,<br />
schwarz-matt glasiert, der durch<br />
seine ausgewogene Form perfekt<br />
mit der historischen Bausubstanz<br />
harmoniert.<br />
Die historisch überlieferten und<br />
etwas kleineren Schüttel- und<br />
Hohlpfannen werden zwar auch<br />
heute noch hergestellt, durch die<br />
extrem kleinen Produktionsmengen<br />
sind sie aber entsprechend<br />
teuer. „Bei einem Projekt dieser<br />
Größenordnung wäre ein solcher<br />
Luxus daher überhaupt nicht zu<br />
bezahlen gewesen“, begründet<br />
Amandus Pesch die gemeinsam<br />
mit dem Denkmalschutz und dem<br />
Bauherrn getroffene Entscheidung<br />
zur Abweichung vom Original.<br />
Der großformatige <strong>Röben</strong> Hohlfalzziegel<br />
LIMBURGplus stellte<br />
dagegen einen überzeugenden<br />
Kompromiss zwischen Denkmalschutz<br />
und Wirtschaftlichkeit<br />
dar: „Durch seine Größe konnten<br />
wir das Projekt mit einem Stückbedarf<br />
von lediglich 12 Ziegeln<br />
je m 2 Dachfläche realisieren.“<br />
Auch in puncto Materialqualität<br />
und Wirtschaftlichkeit entsprechen<br />
die <strong>Röben</strong> Tondachziegel<br />
höchsten Ansprüchen – oft<br />
vergehen mehr als 50 Jahre,<br />
bis die Bewohner das erste Mal<br />
über Reparatur oder Wartung<br />
nachdenken müssen. Meist sind<br />
die Schäden dann durch den<br />
Austausch einzelner Ziegel zu<br />
beheben. Daneben steht die<br />
absolute Resistenz gegen<br />
Umwelteinflüsse wie UV-Strahlung,<br />
„Sauren Regen“, Autoabgase<br />
oder ätzenden Vogelkot –<br />
„alles in allem ein Dach für die<br />
Ewigkeit“, wie Amandus Pesch<br />
zufrieden feststellt.
<strong>Röben</strong> <strong>Tonbaustoffe</strong> <strong>GmbH</strong> · Postfach 12 09 · D-26330 Zetel · Telefon (04452) 880 · Fax (04452) 88245 · www.roeben.com · eMail: roeben@roeben.com