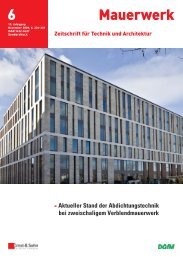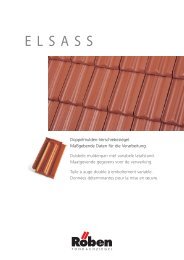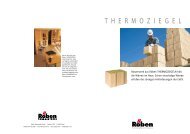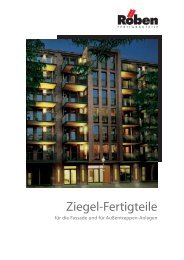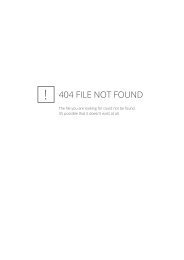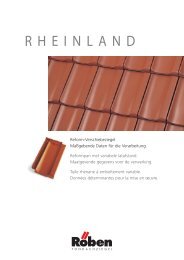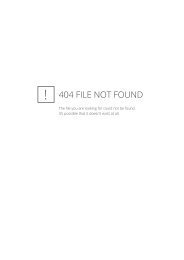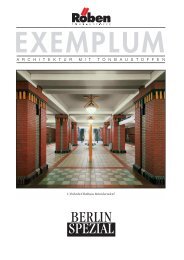971719 Exemplum 7 - Röben Tonbaustoffe GmbH
971719 Exemplum 7 - Röben Tonbaustoffe GmbH
971719 Exemplum 7 - Röben Tonbaustoffe GmbH
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Nr. 7<br />
EXEMPLUM<br />
A R C H I T E K T U R M I T T O N B A U S T O F F E N<br />
Haagse Hogeschool, Den Haag, Niederlande
Liebe Leserin, lieber Leser,<br />
das Denkbare Realität werden lassen – das ist die<br />
Aufgabe, die wir uns bei <strong>Röben</strong> täglich neu stellen.<br />
Mit Produkten, die nicht nur höchsten qualitativen<br />
Anforderungen entsprechen, sondern auch der<br />
Kreativität der Planenden möglichst viel Raum<br />
lassen.<br />
Dort, wo der Phantasie technische Grenzen gesetzt<br />
sind, versuchen die Ingenieure unseres Planungs-<br />
Service gemeinsam mit den Keramikern und<br />
Technikern aus den 12 <strong>Röben</strong>-Werken Ihren Vorstellungen<br />
Gestalt zu geben.<br />
So entstehen oft Lösungen als Fertig- und Sonderbauteile,<br />
die auf der Baustelle konventionell nicht<br />
herzustellen wären.<br />
Obwohl wir über 1.500 Produkte in unserem Sortiment<br />
führen, haben wir für Ihre Sonderwünsche<br />
immer ein offenes Ohr. Spezielle Formteile, Glanzpunkte<br />
bei der Fassadengestaltung werden dann<br />
auch schon ’mal von Hand gefertigt, ausgefallene<br />
Farben und Oberflächen extra produziert.<br />
Einige Beispiele dieser Arbeit zeigt unser neuestes<br />
‘<strong>Exemplum</strong>’ mit einer Auswahl repräsentativer<br />
Objekte, die mit unserem Material im In- und<br />
Ausland entstanden sind.<br />
Aus der Vielzahl der unterschiedlichsten Objekte<br />
versuchen wir immer, für Sie eine interessante<br />
und anregende Mischung zusammenzustellen. Wir<br />
hoffen, dies ist uns gelungen und wir freuen uns<br />
auf Ihre Anregungen.<br />
(Wilhelm-Renke <strong>Röben</strong>)<br />
2<br />
Polizeiwache Wolfheze.<br />
Architekten:<br />
Steigenga Smit Architekten,<br />
Amsterdam.<br />
Mitarbeiter:<br />
Madeleine Steigenga, Martin Kuitert<br />
Seite 4<br />
Jahrtausendbrücke in Brandenburg.<br />
Architekten:<br />
Strecker & Partner,<br />
Berlin<br />
Seite 12<br />
Kepler-Gymnasium Freiburg.<br />
Architekt:<br />
Ernst Spycher<br />
Dipl.-Architekt HBK/SIA<br />
Basel,<br />
Seite 6<br />
EX<br />
PL<br />
Casa Alle Orsoline,<br />
Mendrisio, Tessin.<br />
Architekt:<br />
Ivano Gianola<br />
Architetto FAS,<br />
Mendrisio<br />
Seite 16
Grammophon-Büropark,<br />
Hannover.<br />
Architekten:<br />
Bahlo, Köhnke, Stosberg & Partner<br />
<strong>GmbH</strong>, Hannover<br />
Mitarbeiter:<br />
Jan Grabau, Werner Klautke<br />
Seite 8<br />
EM<br />
UM<br />
Rundbau Freundallee,<br />
Hannover.<br />
Architekten:<br />
Bahlo, Köhnke, Stosberg & Partner<br />
<strong>GmbH</strong>.<br />
Mitarbeiter:<br />
Jan Grabau, Edeltraut Zielasko<br />
Seite 18<br />
Kirchsteigfeld, Potsdam.<br />
Architekten:<br />
Rob Krier/Christoph Kohl,<br />
Berlin<br />
Seite 20<br />
3<br />
Inhalt<br />
Haagse Hogeschool, Den Haag.<br />
Architekten:<br />
Atelier PRO<br />
Leon Thier/Hans van Beek,<br />
Den Haag<br />
Seite 10<br />
Fotostudio Ilona Voss,<br />
Datteln.<br />
Architekten:<br />
Dipl.-Ing. Günther Stegemann<br />
Ulrich Stegemann jun., Datteln<br />
Seite 22
Eine „runde Sache“<br />
in Hannover.<br />
Architekten:<br />
Bahlo, Köhnke, Stosberg & Partner<br />
<strong>GmbH</strong>, Hannover<br />
Mitarbeiter:<br />
Jan Grabau, Edeltraut Zielasko<br />
Große moderne Bürokomplexe<br />
wirken in ihrer rein funktionellen<br />
Ausrichtung oft langweilig und fade.<br />
Im hannoverschen Stadtteil Bult<br />
aber - nur rund 100 m entfernt von<br />
der Eilenriede, der grünen Lunge<br />
der City - sticht ein rundes Gebäude<br />
aus der „Masse“ heraus.<br />
Baukörper unterschiedlicher Höhe,<br />
Bauart und Nutzung prägen den<br />
Gebäudekomplex Freundallee 17 - 23.<br />
Im wahrsten Sinne des Wortes im<br />
Mittelpunkt steht das Gebäude Nr. 21.<br />
Früher stand an dieser Stelle ein<br />
eingeschossiger Bau. Heute zieht ein<br />
fast futuristisch anmutender Neubau<br />
mit 25 m Durchmesser und vier<br />
Geschossen in der Höhe alle Blicke<br />
auf sich. Seine Form ist kreisrund,<br />
und mit diesem außergewöhnlichen<br />
Grundriß konnte das Hannoveraner<br />
Architekturbüro Bahlo, Köhnke, Stosberg<br />
und Partner zwei Ziele gleichzeitig<br />
erreichen. Zum einen sollte die<br />
Anlage durch eine Kombination von<br />
Umbau und Erweiterung eine in sich<br />
geschlossenere Form erhalten. Auf<br />
der anderen Seite sollte aber auch<br />
durch den Neubau eine Eigenständigkeit<br />
erreicht werden, die einen<br />
gewissen Abschluß zu den Nachbarbauten<br />
bildet. Beide Aufgaben, die<br />
sich den Architekten stellten, wurden<br />
mit dem neuen Rundbau zur vollen<br />
Zufriedenheit des Bauherrn gelöst.<br />
„Der Rundbau schließt direkt an den<br />
Gebäudeteil Freundalle Nr. 23 an: Für<br />
den Nutzer war deshalb eine niveaugleiche<br />
Anbindung in allen Geschossen<br />
zwingende Voraussetzung. Eingang<br />
und Treppenhaus befinden sich<br />
günstig an der Nahtstelle der beiden<br />
Gebäudeteile und lassen so auch eine<br />
Vermietung in kleinen Einheiten zu.<br />
18
19<br />
Die innenliegenden galerieartigen<br />
Flure des Rundbaus werden durch ein<br />
kreisförmiges Atrium im Zentrum<br />
belichtet und können so als zusätzliche<br />
Arbeits- und Besprechungszone<br />
genutzt werden,“ erläutert Architekt<br />
Jan Grabau Konzept und Aufbau.<br />
Die Bedeutung von Licht und Helligkeit<br />
zeigt sich auch im Äußeren des<br />
kreisrunden Gebäudes. Bewußt wurde<br />
für das Verblendmauerwerk der <strong>Röben</strong><br />
Keramik-Klinker creme-weiß „brilliant“<br />
glatt gewählt. Sein Farbton läßt die<br />
kompakte Architektur des Rundbaus<br />
leicht wirken und strahlt eine freundliche<br />
und einladende Atmosphäre aus.<br />
Zudem paßt sich die Klinker-Fassade<br />
den vorhandenen Farben und Materialien<br />
der Nachbarschaft an. Auch mit<br />
der Metallkonstruktion des leicht<br />
zurückgesetzten vierten Geschosses<br />
wird ein Motiv der Nachbarbebauung<br />
aufgenommen. Der Gegensatz in Form<br />
und Design wird so gemildert, und<br />
der Neubau paßt sich harmonisch in<br />
die bestehende Baustruktur ein.<br />
Die 24.000 Keramik-Klinker wurden<br />
von <strong>Röben</strong> zur Hälfte mit einer<br />
mittigen Kerbung als Scheinfuge<br />
geliefert. Damit war es möglich, den<br />
gewünschten Kreuzverband schnell<br />
und rationell herzustellen. Da der<br />
ganze Stein mit der Scheinfuge nicht<br />
von zwei halben Steinen zu unterscheiden<br />
ist, entfiel das zeitintensive<br />
Mauern der Köpfe, die die Struktur des<br />
Kreuzverbandes prägen.<br />
Eine wirklich „runde Sache“ also,<br />
die mit <strong>Röben</strong> Keramik-Klinkern in<br />
Niedersachsens Landeshauptstadt entstanden<br />
ist.
Kirchsteigfeld -<br />
ein Stadtteil zum Wohlfühlen<br />
Architekten:<br />
Rob Krier/Christoph Kohl<br />
Berlin<br />
„Wir wollten keine Siedlung schaffen,<br />
keine Schlafstadt, keine Wohnanlage,<br />
kein Massenquartier, sondern eine<br />
Ortschaft, die ihren Bewohnern und<br />
nachwachsenden Generationen das<br />
Bewußtsein des ‘Zu-Hause’-Seins<br />
wieder vermitteln kann.“ So charakterisiert<br />
der international anerkannte<br />
Architekt und Städtebauer Rob Krier<br />
seine Vision eines städtebaulichen<br />
Konzeptes, das als Modellbauvorhaben<br />
des Bundes gilt.<br />
Zwanzig Architekturbüros aus<br />
Deutschland, Italien und den USA<br />
haben unter der Leitung von Rob Krier<br />
und Christoph Kohl (Wien/Berlin) in<br />
einem Planungszeitraum von fünf<br />
Jahren diese Vision Wirklichkeit werden<br />
lassen. Entstanden ist mit dem<br />
Stadtteil Kirchsteigfeld in Potsdam das<br />
größte Wohnungsbau vorhaben in<br />
den neuen Bundesländern und - vor<br />
allem - ein bunter, lebensfroher Stadtteil<br />
zum Wohlfühlen.<br />
Kirchsteigfeld liegt im Südosten<br />
von Potsdam auf einer Fläche von<br />
875.000 m 2, die bis vor wenigen<br />
Jahren noch als Ackerland genutzt<br />
wurden. Heute wohnen dort 7.500<br />
Menschen. Neben 248.000 m 2 Wohnfläche<br />
werden rund 150.000 m 2<br />
Gewerbefläche und 33.700 m 2 öffentliche<br />
Grünflächen geschaffen.<br />
Leitmotiv für die Planung des Stadtteils<br />
war, daß dieser beispielhaft für<br />
die künftige städtebauliche Entwicklung<br />
Potsdams sein sollte. In Kombination<br />
mit einer Dienstleistungszone<br />
ist ein multifunktionales Siedlungsgebiet<br />
entstanden, das alle Einzelfunktionen<br />
städtebaulichen Lebens und<br />
eine ausgereifte soziale Infrastruktur<br />
aufweist.<br />
Stark prägende Elemente in Kirchsteigfeld<br />
sind die individuelle<br />
Architektur und das ansprechende<br />
Farbkonzept. Die Farbgebung ist auf<br />
die Verdeutlichung unterschiedlicher<br />
Stadträume ausgerichtet. Sinnvolle<br />
farbliche Zusammenfassungen von<br />
städteräumlichen Zonen (z.B. zentraler<br />
Stadtraum, Dienstleistungszone) durch<br />
sechs Farbfamilien - rötliche, gelbliche,<br />
weißliche, weiße, graue und blaue<br />
Farbfamilie - machen die Hauptstruktur<br />
des neuen Stadtteils verständlich<br />
und wirken wie ein visuell erfahrbarer<br />
Stadtplan.<br />
Wohl integriert in dieses Farbkonzept<br />
sind die beiden Baukomplexe, die<br />
mit <strong>Röben</strong> Keramikklinker-Riemchen<br />
gestaltet wurden. „Sowohl das<br />
‘Torhaus’ am Eingangsbereich von<br />
Kirchsteigfeld als auch der ‘Palazzo’<br />
am zentralen Markt- und Kirchplatz<br />
sind stark frequentierte Wohn- und<br />
Geschäftshäuser. Im Gegensatz zur<br />
Mehrheit der von uns geplanten<br />
20<br />
Häuser mit Putzfassade, haben wir<br />
uns bei diesen beiden Objekten in<br />
der Sockelzone für den Baustoff Ton<br />
entschieden,“ erläutert Architekt<br />
Christoph Kohl. „Putzfassaden sind zu<br />
empfindlich und verletzbar, Fassaden<br />
aus Tonziegeln dagegen widerstandsfähig<br />
gegenüber mechanischen Einflüssen<br />
durch den regen Publikumsverkehr.<br />
Für Riemchen sprach der<br />
Preisvorteil. Bedingung war für mich<br />
aber, daß man nicht auf den ersten<br />
Blick sieht, daß es sich „nur“ um eine<br />
geklebte Riemchen-Verkleidung handelt.<br />
Deshalb kamen allein Winkel-<br />
Riemchen in Frage, mit denen die<br />
optisch störenden „Kompromiß-Fugen“<br />
an den Wandecken vermieden werden.<br />
Und auf der Suche nach Herstellern<br />
bin ich nur bei <strong>Röben</strong> fündig geworden,“<br />
so Christoph Kohl.<br />
Das „Torhaus“ bildet den Eingangsbereich<br />
des neuen Stadtteils. Durch das<br />
Portal in der Mitte des Gebäudes<br />
gelangen Fußgänger und Radfahrer in<br />
das Zentrum. Um einen einladenden<br />
und eleganten Eindruck zu erzielen,<br />
wählte Kohl für die 315 m 2 Fläche des<br />
Sockels die <strong>Röben</strong> Keramikklinker-<br />
Riemchen schwarz-nuanciert glatt im<br />
DF-Format.<br />
Als Auflockerung wirken Zierstreifen<br />
aus nachtblau glasierten Keramikklinker-Riemchen,<br />
ebenfalls im<br />
DF-Format. Der „Palazzo“ liegt dagegen<br />
im Zentrum von Kirchsteigfeld am<br />
Marktplatz. Das übergeordnete Farbkonzept<br />
sieht für die Bauten direkt<br />
am Platz weiße Töne vor. Die Häuser,<br />
die wie der „Palazzo“ den Rahmen für<br />
den Platz bilden, sind in Rottönen<br />
gehalten. Die <strong>Röben</strong> Klinker-Riemchen<br />
im Farbton Westerwald-rot glatt bilden<br />
hier die Hauptkomponente für den<br />
Sockel. Farbliche Akzente setzen die<br />
glatten Keramikklinker-Riemchen in<br />
schwarz-nuanciert und perlweiß, die<br />
- analog zum „Torhaus“ - in Streifen<br />
um den Sockel laufen.
Italienisches Ambiente<br />
im Ruhrpott<br />
Architekten:<br />
Architekturbüro<br />
Dipl.-Ing. Günther Stegemann<br />
Ulrich Stegemann jun., Datteln<br />
In Datteln nahe Recklinghausen steht<br />
seit April dieses Jahres ein Haus, das<br />
so gar nicht der ortsüblichen Bebauung<br />
entspricht, sondern von seiner<br />
Bauart her eher an eine kleine Villa<br />
im italienischen Stil erinnert. Und wer<br />
die gewundene Außentreppe hinaufsteigt<br />
und die Tür zum Fotostudio<br />
von Ilona Voss öffnet, der fühlt sich<br />
durch die Wirkung von Licht und<br />
Farben wie in die Toscana versetzt.<br />
Das, was den Blick sofort auf sich<br />
zieht, ist ist ein kleines „Kunstwerk“ -<br />
allerdings nicht ein fotografisches,<br />
sondern ein gemauertes. Die Innenwände<br />
des Fotostudios sind aus<br />
Poroton. An sich nichts Ungewöhnliches.<br />
Normalerweise jedoch „verstecken“<br />
Poroton-Innenwände sich<br />
unter Putz und Tapeten, Hier aber<br />
zeigen sich die Poroton-Steine von<br />
<strong>Röben</strong> ganz unverdeckt. Spricht man<br />
im Zusammenhang mit Poroton sonst<br />
von Eigenschaften wie Energieersparnis<br />
und guter Wärmedämmung, so<br />
steht in Datteln eine bisher unbekannte<br />
und ungenutzte Komponente<br />
im Vordergrund - die kreative,<br />
gestalterische Dimension dieses<br />
<strong>Tonbaustoffe</strong>s.<br />
Die Idee, im rund 120 m 2 großen<br />
Fotostudio Poroton als Sichtmauerwerk<br />
zu gestalten, stammt von Bauunternehmer<br />
Johannes Rehr aus<br />
Recklinghausen. „Das war ein ganz<br />
spontaner Einfall. Ich habe mir<br />
gedacht, aus diesem ‘einfachen’<br />
Hintermauerstein läßt sich etwas<br />
Tolles machen,“ meint Rehr. Rund<br />
80 Stunden Arbeit hat er in die<br />
Poroton-Wände investiert. Stein für<br />
Stein wurde sauber und exakt aufeinandergesetzt.<br />
„Mit einem Holzspachtel<br />
und einem kleinen Besen habe ich<br />
den vollfugig gemauerten Wänden<br />
den letzten Schliff gegeben. Durch<br />
den Fugenglattstrich bleibt die Struktur<br />
optimal bewahrt,“ erläutert der Bauunternehmer<br />
seine Vorgehensweise.<br />
22<br />
„Der Poroton von <strong>Röben</strong> ist der beste<br />
Stein für das Hintermauerwerk, der<br />
mir in mehr als 30 Jahren begegnet<br />
ist. Er ist sehr gut zu verarbeiten, da<br />
er absolut maßhaltig ist. Und in Farbe,<br />
Form und Gleichmäßigkeit übertrifft<br />
er alle anderen,“ so Johannes Rehr.<br />
Ein knapp achteinhalb Meter langer<br />
Segmentbogen duchläuft das Fotoatelier.<br />
Ein weiterer Akzent wird durch<br />
den Erker im Eingangsbereich gesetzt,<br />
der mit 45 Grad Winkeln gemauert<br />
ist. Anstatt eines Putzes kam auf<br />
die Poroton-Wände nur eine Silikon-<br />
Schicht, die sogenannte „Sto Prim<br />
Micro“-Versiegelung. Dadurch bleibt<br />
die ursprüngliche Struktur des Steines<br />
erhalten, und der sandige, naturfarbene<br />
Ton wird zusätzlich hervorgehoben.<br />
„Die warme italienische Atmosphäre<br />
begeistert unsere Kunden. Die Poroton-<br />
Wände sind eine richtige Attraktion.<br />
Um die Wirkung optimal zu nutzen,<br />
arbeiten wir mit offenen Regalen.<br />
So bildet das Poroton einen idealen,<br />
ruhigen Hintergrund für die Präsentation<br />
unserer Fotografien,“ erzählt<br />
die Fotografin Ilona Voss. „Das war<br />
eine pfiffige, kreative Idee, die genau<br />
zu uns paßt.“
„Casa Alle Orsoline“ -<br />
Stilsichere Architektur im Tessiner Ambiente<br />
Architekt:<br />
Ivano Gianola<br />
Architetto FAS<br />
Mendrisio/Schweiz<br />
Wer kennt sie nicht, die weltberühmte<br />
Gotthard-Route, die durch die Schweiz<br />
in Richtung Italien führt. Kurz vor<br />
Chiasso, an der Schweizer Grenze,<br />
liegt Mendrisio. Ein typischer kleiner<br />
Tessiner Ort, an dem eine Verschnaufpause<br />
auf dem Weg an die italienische<br />
Küste oder ins Landesinnere durchaus<br />
lohnt. Auf einem Spaziergang durch<br />
die von Palmen und anderen südländischen<br />
Gewächsen gesäumten Straßen<br />
und Gassen kann man eine wunderschön<br />
erhaltene Altstadt bewundern.<br />
Aber auch der modernen Architektur<br />
steht man in Mendrisio sehr aufgeschlossen<br />
gegenüber. Seit gut zehn<br />
Jahren steht dort an zentraler Stelle<br />
auf einem historischen Platz ein<br />
imposanter und zugleich doch eleganter<br />
Bau - das Haus des Architekten<br />
Ivano Gianola. Vor zwei Jahren wurde<br />
der ursprüngliche Komplex erweitert<br />
und umfaßt heute Wohnung und<br />
Atelier des Architekten sowie weitere<br />
Wohneinheiten.<br />
Dem Architekten ist es hier gelungen,<br />
einen harmonischen Ausgleich<br />
zwischen Schönheit und Funktionalität<br />
zu finden. Dazu tragen nicht zuletzt<br />
die ausgewogene Geometrie und die<br />
Farbwahl der Fassade bei. Hohe rechteckige<br />
Fenster strecken das kompakte<br />
Gebäude optisch und unterbrechen in<br />
symmetrischer Anordnung die großen<br />
Fassadenflächen. Verbindendes Element<br />
zwischen den älteren und neuen<br />
Bereichen ist das stilvolle und edle<br />
Sichtmauerwerk aus glatten perlweißen<br />
<strong>Röben</strong> Keramik-Klinkern im DF-Format.<br />
Auflockernde und gleichzeitig gliedernde<br />
Akzente setzen glatte schwarznuancierte<br />
Keramik-Klinker, die in<br />
Form von sehr engen und an anderer<br />
Stelle weit auseinanderliegenden<br />
Streifen das Gebäude umziehen.<br />
16<br />
„Aus ästhetischen Gründen wurde für<br />
die „Casa Alle Orsoline“ ein Sichtmauerwerk<br />
mit vorherrschend weißer<br />
Farbe bestimmt. Damit wird einerseits<br />
ein Kontrast und andererseits eine<br />
Verbindung zur bestehenden uneinheitlichen<br />
Bausubstanz der Umgebung<br />
mit ihren mehrheitlich hellen Farbtönen<br />
erreicht,“ erläutert Gianola.<br />
„Die Verwendung zweier Farben - von<br />
weißen und schwarzen Sichtsteinen -<br />
dient dem Umgang mit dem Faktor<br />
Licht und der Kontrastbildung. Das<br />
Weiß als Ausdruck des Tages und das<br />
Schwarz als Ausdruck der Nacht finden<br />
sich im Spiel von strahlendem Licht<br />
und Schatten wieder,“ so der Architekt.<br />
Neben den ästhetischen Argumenten,<br />
die für die eleganten Klinker sprachen,<br />
stand für Ivano Gianola natürlich die<br />
Qualität im Vordergrund. Die Wahl<br />
der glatten Keramik-Klinker gewähleistet<br />
- bedingt durch die äußerst<br />
geringe Wasseraufnahme - einen<br />
optimalen Schutz gegenüber jeglicher<br />
Art von Witterungseinflüssen. Schmutz,<br />
der sich oberflächlich auf dem Klinker<br />
absetzt, wird vom Regen einfach<br />
wieder abgewaschen. Die Fassade der<br />
„Casa Alle Orsoline“ wird so über<br />
Jahrzente im ursprünglichen und<br />
unverfälschten Perlweiß strahlen.
Haagse Hogeschool -<br />
die „Stadt in der Stadt“<br />
Architekten:<br />
Atelier PRO<br />
Leon Thier/Hans van Beek<br />
Den Haag<br />
1986 entschloß sich die Stadt Den<br />
Haag, die bisher recht trostlose Rückseite<br />
des Bahnhofs Hollands Spoor<br />
und das angrenzende Umschlaggebiet<br />
zwischen Schiene und Wasser, das<br />
sogenannte Laakhavengebiet, städtebaulich<br />
umzugestalten. Der Bau der<br />
neuen Haagse Hochschule, die nach<br />
einer großangelegten Fusion vierzehn<br />
Fachhochschulen mit 13.000 Studierenden<br />
und 1.300 Mitarbeitern vereint,<br />
war der ideale Anlaß, das 13,5 Hektar<br />
große, veraltete und isoliert gelegene<br />
Industriegebiet in einen modernen<br />
Stadtteil zu transformieren.<br />
Entworfen wurde dieses 1996 fertiggestellte<br />
Megaprojekt vom Architekturbüro<br />
Atelier PRO aus Den Haag,<br />
das schon einige solcher Großprojekte<br />
verwirklicht hat. Aus der Erfahrung<br />
mit diesen Objekten wußten die<br />
Architekten Hans van Beek und Leon<br />
Thier, daß große Hochschulen nicht<br />
mehr in einem Einzelgebäude untergebracht<br />
werden können. Sie erfordern<br />
„Gebäudeensembles“ in Symbiose mit<br />
der Umgebung. „Entscheidend beim<br />
Entwurf der Haagse Hogeschool ist,<br />
daß sie nicht als ein isoliertes Objekt,<br />
sondern als ein integratives Element<br />
einer neuen Stadtentwicklung konzipiert<br />
ist. Sie bildet eine ‘Stadt in der<br />
Stadt’,“ erläutert Leon Thier.<br />
Es hat sich ein typischer „Atelier PRO-<br />
Stil“ mit viel Backstein in verschiedenen<br />
Grautönen in Kombination mit<br />
hochwertigem Beton, Stuck und Glas<br />
entwickelt. Auch die Haagse Hogeschool<br />
ist eine „PRO-Welt“, in der<br />
bestimmte architektonische Formen,<br />
die das Gebiet strukturieren sollen,<br />
immer wiederkehren. Es sind sogenannte<br />
„sprechende Formen“ wie die<br />
riesige „Schlangenlinie“, die mit acht<br />
Stockwerken den Weg vom Bahnhof<br />
Hollands Spoor zum Herz des<br />
Geländes begleitet, der niedrigere<br />
schräge „Streifen“ am Laakhaven,<br />
der quer durch die „Schlangenlinie“,<br />
geht, und das zentral gelegene<br />
„Oval“.<br />
„Man kann sich die Haagse Hogeschool<br />
als einen großen Platz vorstellen, der<br />
von Wänden in hellen Farbtönen<br />
umgeben ist. Die verschiedenen<br />
Gebäudeelemente auf dem Platz sind<br />
in kontrastierenden Farben gestaltet,“<br />
erläutert Thier. So ist die Ostfassade<br />
der „Schlangenlinie“ mit <strong>Röben</strong><br />
Keramik-Klinkern perlweiss glatt<br />
10<br />
versehen worden, um ihre Funktion<br />
als Außenschale zu dokumentieren.<br />
Für die Westfassade der „Schlangenlinie“,<br />
das „Oval“ und das Bahnhofsgebäude<br />
wurde als Kontrast der<br />
<strong>Röben</strong> Keramik-Klinker grau-nuanciert<br />
glatt gewählt, eine dunklere Sonderanfertigung.<br />
Ein weiteres „architek-<br />
tonisches Juwel“ auf dem Hochschulgelände<br />
ist der sogenannte „Bungalow“,<br />
in dem die Verwaltung untergebracht<br />
ist. Die strenge Formgebung dieses<br />
Gebäudes wird durch die Verklinkerung<br />
mit blau glasierten Keramik-<br />
Klinkern von <strong>Röben</strong> betont.
Neben insgesamt rund 680.000<br />
Keramik-Klinkern hat das <strong>Röben</strong>-Werk<br />
Bannberscheid für die Haagse<br />
Hogeschool auch ca. 1.500 Formsteine<br />
und rund 2.200 m Fertigteilstürze<br />
geliefert. Die individuell geformten<br />
Keramik-Klinker für die „Schlangenlinie“<br />
wurden teilweise von Hand<br />
hergestellt. Der stirnseitige Außen-<br />
giebel des Gebäudes ist nach außen<br />
hin geneigt ausgeführt, so daß das<br />
achte Stockwerk ca. 3,5 m länger als<br />
das Erdgeschoß ist. Für diese Ecksituation<br />
entwickelte man im Werk<br />
Bannberscheid spezielle Formsteine,<br />
die an ihrer Kopfseite der Neigung<br />
des Außengiebels entsprechen. Die<br />
großen Öffnungen im Mauerwerk der<br />
11<br />
Fassade wurden mit Fertigteilstürzen<br />
von 3,60 m Länge ausgeführt. Bedingt<br />
durch die Innen- und Außenradien<br />
des Gebäudes mußten natürlich auch<br />
die Stürze von <strong>Röben</strong> entsprechend<br />
nach innen bzw. nach außen gebogen<br />
produziert werden.<br />
„Wir haben die <strong>Röben</strong> Keramik-Klinker<br />
schon bei anderen Projekten eingesetzt.<br />
Sie sind von sehr guter Qualität,<br />
sehr robust und widerstandsfähig. Für<br />
uns ist <strong>Röben</strong> immer wieder eine<br />
gute Entscheidung,“ meint Leon Thier.
„Grammophon-Büropark“ -<br />
eine alte Industrieanlage erstrahlt in neuem Glanz<br />
Architekten:<br />
Bahlo, Köhnke, Stosberg & Partner<br />
<strong>GmbH</strong>, Hannover<br />
Mitarbeiter:<br />
Jan Grabau, Werner Klautke<br />
In den letzten Jahren hat in Hannover<br />
- ganz im Zeichen des Wandels von<br />
der Industriegesellschaft zur modernen<br />
Dienstleistungsgesellschaft - ein Wandel<br />
in der städtebaulichen Nutzung stattgefunden.<br />
Ältere Industrieproduktionsstätten<br />
im Stadtbereich wurden aufgegeben<br />
und teilweise in Randgebiete<br />
ausgesiedelt. Die „verlassenen“ Gebäude<br />
wurden allerdings nicht abgerissen,<br />
sondern in Dienstleistungszentren<br />
umgewandelt. Allein an der Podbielskistraße<br />
- benannt nach einem preußischen<br />
Minister und eine der längsten<br />
Straßen in Hannover - sind drei solcher<br />
Anlagen entstanden: der „Podbi-<br />
Büropark“ auf dem Bahlsen-Gelände,<br />
ein Hotel-Komplex auf dem Pelikan-<br />
Gelände und der „Grammophon-<br />
Büropark“ auf dem Gelände der<br />
ehemaligen deutschen Grammophon<br />
(heutige Polygramm).<br />
Nachdem die Schallplattenproduktion<br />
direkt an die Autobahn A 2 Hannover -<br />
Berlin verlegt worden war, stellte<br />
sich für das Architekturbüro Bahlo,<br />
Köhnke, Stosberg & Partner die<br />
Aufgabe, den alten Grammophon-<br />
Gebäudekomplex neu zu gestalten.<br />
„Wunsch des Bauherrn war eine<br />
Anlage ‘wie aus einem Guß’. Ein Teil<br />
des Komplexes mußte dabei aus<br />
Denkmalschutzgründen erhalten werden.<br />
Notwendig waren auch Neubauten,<br />
um zusätzlichen Büroraum zu schaffen.<br />
Dabei kam es vor allem darauf an,<br />
die unterschiedlichen Baustile der<br />
vorhandenen und neuen Bauten in<br />
einem einheitlichen Komplex zu verbinden,“<br />
erläutert Projektarchitekt<br />
Jan Grabau.<br />
Der heutige Grammophon-Büropark<br />
besteht aus sieben drei- bis fünfgeschossigen<br />
Einzelgebäuden mit<br />
25.000 m 2 Bürofläche, die in einer<br />
U-förmigen Blockrandbebauung angeordnet<br />
sind. Neben dem ursprünglichen<br />
Produktionsgebäude ist ein<br />
8<br />
weiterer Altbau aus rotem Backstein<br />
original erhalten worden. Alle<br />
anderen - neuen und sanierten -<br />
Gebäude wurden in den oberen Stockwerken<br />
mit einem hellen Sichtmauerwerk<br />
aus <strong>Röben</strong> Klinkern einheitlich<br />
gestaltet. „Der Sockel der gesamten<br />
Anlage ist in einem Naturstein ausgeführt<br />
worden und dient als verbindendes<br />
Element der einzelnen Gebäude.<br />
Dabei wurden Farbnuancen der denkmalgeschützten<br />
Gebäude aufgenommen,“<br />
erläutert Grabau.<br />
„Für die Fassaden der Obergeschosse<br />
haben wir den <strong>Röben</strong> Keramik-Klinker<br />
creme-weiß „brilliant“ glatt gewählt,<br />
der bewußt zu dem roten Mainsandsteinsockel<br />
einen starken Kontrast bildet.“<br />
Die creme-weiße Fassade korrespondiert<br />
wiederum farblich mit den<br />
Putzbauten der Nachbarschaft. Hier<br />
wurde der Klinker als Kontrast zum<br />
Putz eingesetzt. Gliedernde Akzente in<br />
den großen hellen Fassadenflächen<br />
werden von den quadratischen<br />
schwarzblauen Fensterrahmen mit<br />
Kreuzsprossen gesetzt. Ihr Format<br />
findet sich in den denkmalgeschützten<br />
Bauten der Anlage wieder.<br />
Wie für den Grammophon-Büropark<br />
gemacht scheint das Modulformat von<br />
190/90/90 mm der <strong>Röben</strong> Keramik-<br />
Klinker. Gerade das Achsmaß von<br />
1,40 m für die Büros und die im Altbau<br />
vorhandenen Achsmaße sprachen<br />
für diese Größe des Klinkers. Mit<br />
einem Fugenglattstrich konnte der<br />
Klinker genau auf 100 bzw. 200 mm<br />
im Läuferverband vermauert werden,<br />
was für die Fassadenflächen der<br />
Gebäude exakt paßte.<br />
„Uns hat die Farbe - das leuchtende<br />
Weiß - des Klinkers sehr gut gefallen.<br />
Außerdem hat uns die keramische<br />
Qualität absolut überzeugt. Was will<br />
man mehr?“ so Grabau.
„Gepflegte Nüchternheit“<br />
Architekt:<br />
Ernst Spycher<br />
Dipl.-Architekt HBK/SIA<br />
Basel<br />
Kepler-Gymnasium Freiburg -<br />
Einfachheit und Nüchternheit als<br />
architektonischer Reichtum.<br />
„Ein Schulhaus ist ein Lehrgebäude,<br />
hier herrscht die gepflegte Nüchternheit<br />
und eine kultivierte Einfachheit.“<br />
Mit diesen Worten beschreibt der<br />
Baseler Architekt Ernst Spycher seine<br />
Vorstellung von einem modernen<br />
Schulbetrieb.<br />
Genau diese Gedanken waren dann<br />
auch Leitmotiv des Planungsprozesses<br />
für den Neubau des Kepler-Gymnasiums<br />
in Freiburg im Breisgau. Das<br />
gestalterische Konzept des viergeschossigen<br />
Schulgebäudes mit angrenzender<br />
Sporthalle lebt von einer klaren,<br />
nüchternen Formgebung, die auf<br />
beliebte, vordergründig funktionelle,<br />
eigentlich aber überflüssige Details<br />
verzichtet.<br />
„Manchmal versucht man Einfachheit<br />
mit Armut gleichzusetzen, in Wahrheit<br />
jedoch haben beide sozusagen nichts<br />
gemein. Tatsächlich kann die Einfachheit,<br />
die wir anstreben, größten<br />
Reichtum bedeuten, so wie die formale<br />
Vielfalt, über die wir verfügen,<br />
sich als größte Armut erweisen kann.“<br />
Getreu diesem Zitat von Heinrich<br />
Tessenow hat Architekt Spycher beim<br />
Kepler-Gymnasium die Reduktion<br />
zum Prinzip erhoben und ein Bild der<br />
Einfachheit gezeichnet.<br />
Besonders deutlich zeigt sich dieses<br />
Gesamtkonzept der „gepflegten Nüchternheit“,<br />
wie Spycher es nennt, bei<br />
der Außenfassade. Die Wahl des<br />
Materials fiel auf glasierter Keramik-<br />
Klinker von <strong>Röben</strong>. Um die Plastizität<br />
des Baukörpers zu betonen, schwebte<br />
dem Architekten eine besondere Art<br />
der Glasur vor, die das sandfarbene<br />
Rohmaterial des Klinkers durchscheinen<br />
läßt. Geplant war ursprünglich<br />
ein heller Blauton. „Nach verschiedenen<br />
Bemusterungen zeigte sich<br />
aber, daß hellere Blautöne in dieser<br />
Technik zu keinem befriedigenden<br />
Resultat führen, so daß wir auch<br />
andere Farbtöne in die Überlegungen<br />
einbezogen haben. Die Entscheidung<br />
fiel auf ‘Anröchter Grün’, die Farbe<br />
eines Sandsteins aus Westfalen-Lippe,<br />
dessen Spektrum von grün, grau-grün<br />
bis grün-blau reicht,“ erläutert<br />
Spycher.<br />
6<br />
Die Farbigkeit dieses Natursteines<br />
diente den Keramik-Klinker-Spezialisten<br />
aus dem <strong>Röben</strong>-Werk Bannberscheid<br />
als Vorlage, um einen völlig neuen,<br />
bisher nicht dagewesenen Farbton zu<br />
kreieren. In einem mehrstufigen<br />
Entwicklungsprozeß entstand, speziell<br />
nach den Wünschen des Architekten,<br />
ein einmaliger, grün-blau glasierter<br />
Keramik-Klinker, der „Spycher-Stein“<br />
getauft wurde.<br />
Durch die Einbindung von Eisen-,<br />
Kupfer- und Kobaltpigmenten in die<br />
Glasphase der transparenten Glasur<br />
schimmert der Stein je nach Lichteinfall<br />
in verschiedenen Farbnuancen<br />
und spiegelt das Wechselspiel von<br />
Licht und Schatten, heller Farbigkeit<br />
und dezenter Gedämpftheit wider.<br />
290.000 <strong>Röben</strong> Keramik-Klinker im<br />
DF-Format als Läufer, Kopfläufer mit<br />
einem und zwei Köpfen und als<br />
L-Schalen sowie 48.000 dazu<br />
passende Riemchen in dieser einzigartigen<br />
Glasur wurden in Freiburg<br />
vermauert.<br />
Aber nicht nur die <strong>Röben</strong> Keramik-<br />
Klinker-Spezialisten aus Bannberscheid,<br />
auch der Planungsservice aus Zetel<br />
konnte bei diesem Projekt zeigen, was<br />
in ihm steckt. Fast 700 m aufgelegte<br />
und abgehängte Fertigteilstürze -<br />
natürlich passend im „Spycher-Stein“<br />
gefertigt - wurden für das Kepler<br />
Gymnasium geliefert. Die Besonderheit<br />
dieser als Läuferstürze ausgebildeten<br />
Elemente liegt darin, daß die unterste<br />
Schicht aus speziellen L-Schalen besteht,<br />
die auch an der Unterseite (Lagerfläche)<br />
glasiert sind. Nach zwei<br />
Geschossen mußte das Mauerwerk<br />
abgefangen werden, der Sturz kam<br />
so als Abfangkonstruktion zum Tragen.<br />
Da das gesamte Gebäude im Halbsteinverband<br />
ausgeführt wurde, war<br />
es erforderlich, eine exakt ausgearbeitete<br />
Planung zu erstellen. So konnte<br />
gewährleistet werden, daß der Verband<br />
der eingesetzten Fertigteil-Stürze<br />
und die konventionell vor Ort<br />
gemauerte Fassade bis ins kleinste<br />
Detail harmonisieren.<br />
Die Fassade des Kepler-Gymnasiums<br />
verschmilzt so in Farbe und Form zu<br />
einer Einheit und läßt eine neue<br />
städtebauliche Dimension in Freiburg<br />
entstehen.
Polizeiwache Wolfheze -<br />
das Chinesische Puzzle<br />
Architekten:<br />
Steigenga Smit Architekten<br />
Amsterdam<br />
Mitarbeiter:<br />
Madeleine Steigenga, Martin Kuitert<br />
„Das Gebäude ist keine Zusammenstellung<br />
von programmatischen und<br />
architektonischen Einzelteilen. Es ist<br />
eine Einheit, ein Chinesisches Puzzle,<br />
alles hängt miteinander zusammen -<br />
die Lage, das Programm, der Raum,<br />
die Bewegung, das Material und die<br />
Farbe,“ so charakterisiert die Amsterdamer<br />
Architektin das Konzept der<br />
Polizeiwache Wolfheze im Osten der<br />
Niederlande.<br />
Der neue Stützpunkt der Autobahnpolizei<br />
soll nicht, wie viele andere<br />
Polizeiwachen, Autorität ausstrahlen.<br />
Er präsentiert sich vielmehr in<br />
„robuster Eleganz“, mit einer stabilen,<br />
erdverbundenen, beinahe skandinavisch<br />
kargen Architektur. Die Form<br />
des T-förmigen Gebäudes ist zeitlos<br />
und fügt sich harmonisch in die<br />
Umgebung ein.<br />
Trotz ihrer Schlichtheit hat die Polizeistation<br />
stark prägende Elemente. So<br />
fällt die ansteigende Form des Daches<br />
sofort ins Auge. Die Zink-Stehfalzeindeckung<br />
der schrägen Dächer ist<br />
mikadoartig angeordnet und vermittelt<br />
ein asiatisch-poetisches Bild. Ebenso<br />
auffällig und prägend sind die hohen,<br />
an die Epoche der Neoklassik erinnernden<br />
Fenster und der wie ein roter<br />
Fächer angeordnete mobile Sonnenschutz<br />
an der Südwest-Seite. Zusammen<br />
mit der langen, konisch zulaufenden<br />
Ziegelfassade bilden sie eine harmonische<br />
Allianz, eine ausgeklügelte<br />
Kombination von Form und Farbe.<br />
Bei der Wahl des Fassadenmaterials<br />
haben sich die Architekten für den<br />
Kohlebrand von <strong>Röben</strong> entschieden.<br />
Die Wahl dieses sehr spezifischen Tonziegels<br />
ist vom Format (NF-Format),<br />
und der Verarbeitung her eher unüblich<br />
in den Niederlanden. Madeleine<br />
Steigenga begründet die Wahl: „Das<br />
Farbenspiel dieses Steines, die Größe<br />
und die „Eckigkeit“ der Strangpresse<br />
4<br />
paßten gut in das grobe Konzept, das<br />
wir vor Augen hatten“.<br />
Der Klinker wurde aber nicht, wie<br />
sonst üblich, vermauert, sondern<br />
- nach den Richtlinien der KNB -<br />
geklebt. Der Unterschied zum herkömmlichen<br />
Mörtelverfahren besteht<br />
darin, daß die Fugen sehr viel dünner<br />
sind. Machen sie in der gemauerten<br />
Fassade etwa 20% aus, beträgt ihr<br />
Anteil hier nur noch ca. 8%.<br />
Dementsprechend steigt natürlich der<br />
Ziegelanteil der Fassade.<br />
Basis der neuen Technik ist ein feinkörniger<br />
Zementleim mit außergewöhnlich<br />
starker Klebkraft. Er verbindet<br />
sich intensiv mit dem Ziegel<br />
und gibt dem Mauerwerk eine bisher<br />
nicht erreichte statische Festigkeit.<br />
Für den Architekten ergeben sich<br />
damit konstruktive Ziegel-Lösungen,<br />
die mit Mörtel nicht möglich sind,<br />
z. B. schlankere Säulenformen oder<br />
auskragende Fassadenelemente. Und<br />
aufgrund ihrer hohen Maßhaltigkeit<br />
sind Ziegel von <strong>Röben</strong> wie gemacht<br />
für die Klebetechnik.<br />
Aber nicht nur konstruktive, auch<br />
gestalterische Aspekte sprechen für<br />
das Kleben. Durch die besonders<br />
dünnen Fugen wirkt die Fassade<br />
geschlossener, und der Charakter des<br />
Ziegels kommt noch besser zur Geltung.<br />
„Mit der schwarzen Klebearbeit<br />
behält der Stein seine Einzigartigkeit<br />
in Form und Farbenspiel am besten.“<br />
so Madeleine Steigenga. Bei jedem<br />
Wetter zeigt der großformatige<br />
„Kohlebrand“ von <strong>Röben</strong> durch sein<br />
intensives blau-rotes Farbspiel und<br />
den eingebrannten Kohleschmolz ein<br />
anderes Gesicht und gleicht so den<br />
Baukörper seiner landschaftlichen<br />
Umgebung an. Ganz so wie es<br />
Madeleine Steigenga sich mit ihrem<br />
Konzept von Einheit und Gleichgewicht<br />
vorgestellt hat.
Jahrtausendbrücke in Brandenburg:<br />
47.355 Formsteine für eine „Brücke wie aus Porzellan“<br />
Architekten:<br />
Strecker & Partner<br />
Berlin<br />
Eine Brücke, die viele Superlative<br />
in Technik und Geschichte auf sich<br />
vereinigt. Vor rund tausend Jahren,<br />
das haben Funde bei den aktuellen<br />
Arbeiten ergeben, stand am jetzigen<br />
Standort schon eine hölzerne Havelquerung<br />
und verband Alt- und Neustadt.<br />
Mehr als fünf Jahrhunderte lang<br />
führte sie den Namen „Lange Brücke“.<br />
1928, zum tausendjährigen Bestehen<br />
Brandenburgs, wurde eine neue, dreifeldrige<br />
Eisenbetonbrücke fertiggestellt,<br />
die „Jahrtausendbrücke“. Im Krieg<br />
zerstört und wieder aufgebaut, mußte<br />
sie 1994/95 wegen der schlechten<br />
Bausubstanz abgerissen werden.<br />
Anfang Dezember 1996 wurde nun<br />
die neue Brücke eingeweiht, ein<br />
„Glanzstück“ in jeder Beziehung. Eine<br />
vorgespannte Durchlaufkonstruktion<br />
mit geschwungener Unterkante erinnert<br />
in Ansicht und Pfeilerform an<br />
das alte Bauwerk. In das städtebaulich<br />
anspruchsvolle Ensemble Altstadt -<br />
Neustadt fügt sich die Brücke dadurch<br />
wieder harmonisch ein.<br />
Liebevolle Details in der<br />
Oberflächengestaltung.<br />
Um den hohen architektonischen<br />
Anspruch zusätzlich zu unterstreichen,<br />
legt der Architekt, Prof. Strecker aus<br />
Berlin, besonderen Wert auf die<br />
Oberflächengestaltung. „Eine Brücke,<br />
die wie aus Porzellan wirkt“, wollte er<br />
schaffen. „Die Brücke soll sich nicht<br />
nur im Wasser spiegeln, sondern das<br />
Wasser auch in der Brücke. Es muß<br />
blitzen und reflektieren, das Material<br />
muß mit dem Betrachter sprechen<br />
und den richtigen Ton finden.“ Für<br />
Prof. Strecker überträgt sich die<br />
Qualität des Materials auf das Gemüt<br />
des Menschen. Wer die neue Jahrtausendbrücke<br />
sieht, der müßte eigentlich<br />
strahlen. Alle Flächen, Pfeiler und<br />
Widerlager wurden mit glasierten<br />
Klinkern verblendet - mit vielen liebevollen<br />
Details.<br />
12
47.355 Formsteine mußten zum Teil<br />
in Handarbeit gefertigt werden, in 50<br />
verschiedenen Varianten. Und noch<br />
einen Wunsch hatte der Architekt: sie<br />
sollten alle glasiert sein. Um die verschiedenen<br />
Formate pressen und<br />
modellieren zu können, wurden 26<br />
neue Formen in der <strong>Röben</strong>-Formenwerkstatt<br />
gebaut.<br />
Spitz zulaufende Flußpfeiler, farbig<br />
abgesetzte Reliefbänder, Widerlager<br />
mit speziellen Übergängen von der<br />
Senkrechten in die Schräge und<br />
speziell geformte Pfeilerabschlüsse<br />
mit drei glasierten Seiten - das sind<br />
einige der gestalterischen „Leckerbissen“,<br />
die bei <strong>Röben</strong> aus gebranntem<br />
Ton realisiert wurden. Hier gleicht<br />
kaum ein Stein dem anderen. Länge,<br />
Breite, Höhe, Winkeligkeit und die<br />
Sichtseiten sind fast alle unterschiedlich.<br />
Hergestellt wurden die Klinker aus<br />
einer weiß brennenden Tonmasse mit<br />
einer Wasseraufnahme von weniger<br />
als 2%. Aus dem Farbkatalog von<br />
22 Glasurfarben, die <strong>Röben</strong> anbietet,<br />
wurden „weiß“ für die Reliefbänder<br />
und „creme“ für die Flächen ausgewählt.<br />
Glasiert wurden die Klinker mit speziellen<br />
Scharffeuerglasuren, die bei<br />
1.280 Grad C gebrannt wurden.<br />
Dadurch ist die Glasur extrem ritzhart,<br />
hat eine hohe Frostbeständigkeit und<br />
ist beständig gegen Säuren und Laugen.<br />
Auch extreme Lichtverhältnisse<br />
werden die Farbe nicht verändern.<br />
Das Wärmeausdehnungsverhalten von<br />
Glasur und Stein ist exakt aufeinander<br />
abgestimmt, auch bei großen Temperaturschwankungen<br />
entstehen keine<br />
Risse.<br />
Im Februar 1996 gab es die erste<br />
technische Besprechung mit den<br />
<strong>Röben</strong>-Keramikingenieuren in Brandenburg.<br />
Muster wurden gefertigt und<br />
diskutiert, die technischen Möglichkeiten<br />
der Fertigung mit den Bedürfnissen<br />
von Architekt und Ingenieuren<br />
aufeinander abgestimmt. Ende Mai<br />
fiel die Entscheidung für die Farben.<br />
Im Klinkerwerk wurden spezielle<br />
Mundstücke und Formen hergestellt.<br />
Vorversuche wurden gefahren, um<br />
die Schwindung zwischen Naß - und<br />
Nennmaß zu testen.<br />
14
15<br />
Anfang Juli wurden die endgültigen<br />
Formen gebaut, Mitte Juli wurde mit<br />
der Produktion, Anfang September<br />
1996 mit der Auslieferung begonnen.<br />
Jeder Stein zum richtigen Zeitpunkt<br />
an der richtigen Stelle.<br />
Aber nicht nur technische Probleme<br />
wurden gelöst, sondern auch logistische.<br />
Jeder einzelne der 47.335 Steine<br />
mußte zum richtigen Zeitpunkt an der<br />
richtigen Stelle vermauert werden.<br />
Dafür wurde entsprechend dem Baufortschritt<br />
ein Lieferschema erarbeitet,<br />
das garantierte, daß auch jeder Stein<br />
zuverlässig „vor Ort“ zur Verfügung<br />
stand. Dafür war es notwendig, jeden<br />
Sonderstein mit der Typenbezeichnung<br />
und seiner Position am Bauwerk zu<br />
kennzeichnen.<br />
Die Auslieferung erfolgte in zehn<br />
Teillieferungen. Rund 100 Tonnen<br />
Keramik-Klinker wurden nach<br />
Brandenburg gefahren. Das entspricht<br />
fünf vollen LKW-Zügen. Der letzte<br />
Stein kam Ende November auf die<br />
Baustelle.<br />
Das Ergebnis ist ein Kleinod moderner<br />
Ingenieurstechnik, verbunden mit<br />
traditionellen Formen und handwerklicher<br />
Fertigungskunst. Auch bei der<br />
Jahrtausendbrücke präsentiert sich der<br />
alte Baustoff Ton einmal wieder<br />
hochmodern.
<strong>Röben</strong> <strong>Tonbaustoffe</strong> <strong>GmbH</strong><br />
Postfach 209 · D-26330 Zetel<br />
Telefon (0 44 52) 8 80<br />
Fax (0 44 52) 8 82 45