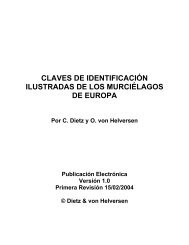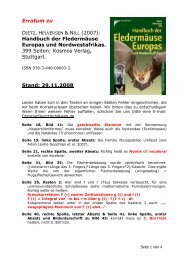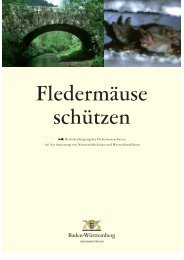Download - pdf - Fledermaus-dietz.de
Download - pdf - Fledermaus-dietz.de
Download - pdf - Fledermaus-dietz.de
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
kopf üü<br />
ber<br />
Editorial<br />
Guten Tag!<br />
Im Jahre 2000 starteten wir unser<br />
erstes kleines <strong>Fle<strong>de</strong>rmaus</strong>-Heft mit<br />
<strong>de</strong>m Titel „KOPFÜBER“. Es war mehr<br />
als ungewiss, ob dieses Heft jemals<br />
eine „periodische Druckschrift“ wer<strong>de</strong>n<br />
wür<strong>de</strong>. Aber es war uns damals<br />
und ist uns auch heute noch wichtig,<br />
in einer angemessenen Form über<br />
die Geschehnisse in <strong>Fle<strong>de</strong>rmaus</strong>schutz<br />
und –forschung in Österreich und<br />
an<strong>de</strong>rswo zu berichten. So versuchen<br />
wir auch in dieser Ausgabe, eine breite<br />
Palette an Themen zu beleuchten:<br />
neue <strong>Fle<strong>de</strong>rmaus</strong>arten in Europa o<strong>de</strong>r<br />
auch allerlei Neuigkeiten aus <strong>de</strong>n<br />
Bun<strong>de</strong>slän<strong>de</strong>rn.<br />
Nach mancherlei Diskussionen<br />
haben wir uns dazu entschlossen,<br />
<strong>de</strong>m Heft eine Grun<strong>de</strong>rneuerung zu<br />
gönnen, und dazu Farbe ins Spiel zu<br />
bringen … Wir hoffen, dass Ihnen das<br />
neu gestaltete KOPFÜBER gefällt!<br />
Viel Spaß beim Lesen wünscht - für<br />
das ganze <strong>Fle<strong>de</strong>rmaus</strong>-Team<br />
Ulrich Hüttmeir<br />
Plecotus macrobullaris: Mit <strong>de</strong>r Ent<strong>de</strong>ckung dieser für Hochgebirge charakteristischen<br />
Art konnten viele Wi<strong>de</strong>rsprüche in <strong>de</strong>r Ökologie <strong>de</strong>r Langohrfle<strong>de</strong>rmäuse gelöst wer<strong>de</strong>n,<br />
so bspw. die zuvor nicht verständliche Höhenverbreitung. Foto: Christian Dietz<br />
bart sich aber auch schon <strong>de</strong>r große<br />
Nachteil dieses Artkonzeptes: Was ist,<br />
wenn auf einem Artenpaar gleichgerichtete<br />
Selektionsdrücke ruhen o<strong>de</strong>r es ausgehend<br />
von einem zugrun<strong>de</strong> liegen<strong>de</strong>n<br />
Bauplan keine Selektionsdrücke gibt, die<br />
eine Anpassung begünstigen wür<strong>de</strong>n<br />
Dann könnte es sich zwar um verschie<strong>de</strong>ne<br />
Arten han<strong>de</strong>ln, diese wären aber<br />
nach Merkmalen kaum o<strong>de</strong>r gar nicht zu<br />
unterschei<strong>de</strong>n. Ein solches Paar bezeichnet<br />
man als kryptisches Artenpaar.<br />
Seit <strong>de</strong>n 1990er Jahren stellt die<br />
Molekulargenetik ein geeignetes Verfahren<br />
dar, um kryptische Arten zu erkennen.<br />
Da man davon ausgehen kann, dass<br />
getrennte Arten über eine artspezifische<br />
genetische Ausstattung verfügen, kann<br />
man Sequenzunterschie<strong>de</strong> im Erbgut zwischen<br />
verschie<strong>de</strong>nen Arten als Merkmale<br />
verwen<strong>de</strong>n. Verschie<strong>de</strong>ne Ausprägungen<br />
<strong>de</strong>s Erbgutes eines bestimmten Gens wer<strong>de</strong>n<br />
dabei als Haplotypen bezeichnet.<br />
Innerhalb einer Art sollten die Haplotypen<br />
nur relativ gering variieren, da es ja<br />
zu einem genetischen Austausch innerhalb<br />
<strong>de</strong>r Art kommt. Zwischen verschie<strong>de</strong>nen<br />
Arten sollten sich die Haplotypen<br />
dagegen <strong>de</strong>utlich unterschei<strong>de</strong>n, da die<br />
zufällig durch Mutationen entstehen<strong>de</strong>n<br />
Sequenzunterschie<strong>de</strong> nicht mehr ausgetauscht<br />
wer<strong>de</strong>n. Aufgrund <strong>de</strong>s Fokus<br />
auf einer genetischen Isolation zwischen<br />
Arten wird das zugrun<strong>de</strong> liegen<strong>de</strong>n<br />
Artkonzept als genetisches Artkonzept<br />
bezeichnet.<br />
Das genetische Artkonzept<br />
Für molekulargenetische Studien müssen<br />
zunächst Gene ausgewählt wer<strong>de</strong>n, die<br />
man relativ leicht fassen, d.h. mit Hilfe<br />
<strong>de</strong>r PCR (Polymerase-Kettenreaktion) vervielfältigen<br />
kann. Für die Untersuchung<br />
benötigt man eine Gewebeprobe <strong>de</strong>r<br />
<strong>Fle<strong>de</strong>rmaus</strong>, je nach zu untersuchen<strong>de</strong>m<br />
Genabschnitt können auch Kotproben verwen<strong>de</strong>t<br />
wer<strong>de</strong>n. Bei einer Gewebeprobe<br />
stammen die genetischen Informationen<br />
direkt aus <strong>de</strong>n Gewebezellen, bei einer<br />
Kotprobe aus <strong>de</strong>n im Kot enthaltenen<br />
Darm zellen. In sehr vielen Untersuchungen<br />
wer<strong>de</strong>n mitochondrielle Gene gewählt<br />
(also Gene aus <strong>de</strong>n Mitochondrien <strong>de</strong>r<br />
Zellen). Die Sequenzunterschie<strong>de</strong> zwischen<br />
<strong>de</strong>n Haplotypen solcher Gene stellen<br />
die zu analysieren<strong>de</strong>n Informationen<br />
dar. Neben <strong>de</strong>n bislang vor allem untersuchten<br />
mitochondriellen Genen wer<strong>de</strong>n<br />
zunehmend auch Abschnitte aus <strong>de</strong>r<br />
Kern-DNA o<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>re Abschnitte analysiert.<br />
Damit erweitert sich auch das<br />
Verständnis über die Rate, mit <strong>de</strong>r sich<br />
verschie<strong>de</strong>ne Genabschnitte entwickeln.<br />
In absehbarer Zeit wird es damit möglich<br />
sein, viel gezielter die passen<strong>de</strong>n<br />
Gene für die jeweilige Studie auszuwählen.<br />
Derzeit sind die Ergebnisse von<br />
Studien verschie<strong>de</strong>ner DNA-Abschnitte<br />
kaum vergleichbar. Ein weitaus größeres<br />
Problem stellt allerdings die Frage dar,<br />
ab welchen Sequenzunterschie<strong>de</strong>n man<br />
von getrennten Arten sprechen kann. Seit<br />
<strong>de</strong>r Aufspaltung zweier Arten, ausgehend<br />
vom letzten gemeinsamen Vorfahren, ist<br />
eine in aller Regel unbekannte Zeitspanne<br />
vergangen und die Anhäufung von<br />
Sequenzunterschie<strong>de</strong>n stellt weitgehend<br />
eine Funktion <strong>de</strong>r Zeit dar. Entsprechend<br />
weist ein junges Artenpaar nur geringe,<br />
ein seit langem getrenntes Artenpaar<br />
<strong>de</strong>utliche Sequenzunterschie<strong>de</strong> auf,<br />
selbst wenn bei<strong>de</strong> über <strong>de</strong>n gesamten<br />
Zeitraum reproduktiv isoliert sind.<br />
Da die Zeitdauer, die notwendig ist,<br />
um Sequenzunterschie<strong>de</strong> in einem spezifischen<br />
DNA-Abschnitt ausbil<strong>de</strong>n zu lassen,<br />
bislang noch zu wenig verstan<strong>de</strong>n<br />
wird, ist die Abschätzung <strong>de</strong>s minimalen<br />
Sequenzunterschieds für die Begründung<br />
einer Art weitestgehend spekulativ. Für<br />
Säugetiere spiegelt ein Cytochrom-b-<br />
Sequenzunterschied von über 5% die<br />
anhand morphologischer Merkmale<br />
beschriebene Artaufteilung wi<strong>de</strong>r (Baker<br />
& Bradley 2006). Die innerartlichen<br />
Cytochrom-b-Sequenzunterschie<strong>de</strong> liegen<br />
dagegen bei gut untersuchten Arten<br />
meist bei unter 2% und nur selten bei<br />
Seite 2 | Bat Journal Austria – <strong>Fle<strong>de</strong>rmaus</strong>schutz in Österreich | Juni 2008