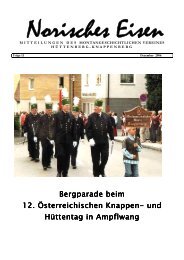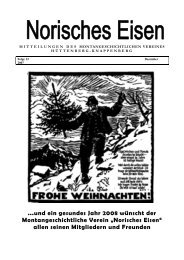Mundloch des Unterfahrungsstollens am Röstplateau in Hüttenberg
Mundloch des Unterfahrungsstollens am Röstplateau in Hüttenberg
Mundloch des Unterfahrungsstollens am Röstplateau in Hüttenberg
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
„Norisches Eisen“ Mitteilungen <strong>des</strong> Montangeschichtlichen Vere<strong>in</strong>es Folge 7 – Oktober 2004, Seite 10<br />
sche Kohlenverbrauch (ungefähr 4,5 % <strong>des</strong> Rösterzgewichtes)<br />
<strong>in</strong> Anbetracht der ungünstigen Verkehrslage<br />
Hüttenbergs vorteilhaft aus.<br />
Nach Wiederaufnahme <strong>des</strong> von 1932 bis 1935<br />
ruhenden Röstbetriebes lief nur noch der Apold-<br />
Fleißner-Ofen an, während die mischbegichteten<br />
Schachtöfen für immer kalt blieben. Angeblich aus<br />
Kostengründen wurde 1942 auch der Apold-<br />
Fleißner-Ofen stillgelegt, obwohl die Donawitzer<br />
Hochöfen das ges<strong>am</strong>te Hüttenberger Rösterz<br />
abgenommen hätten. Den sodann teilweise demontierten<br />
Ofen verwendete man nun als „Durchsatzanlage“<br />
für den Erztransport zum Hüttenberger<br />
Bahnhof, und 1961 wurden auch die Reste<br />
<strong>des</strong> Apold-Fleißner-Röstofens nach Sprengung<br />
beseitigt.<br />
Günther Biermann, Juni 2004<br />
Sagenhafte Edelmetallfundorte<br />
im unteren Görtschitztal<br />
Im Heft 3 (Juli 2002) der Mitteilungen <strong>des</strong> montangeschichtlichen<br />
Vere<strong>in</strong>es NORISCHES EISEN<br />
wurden unter dem Titel „Sagenhafte Fundorte <strong>in</strong><br />
der Hüttenberger Umgebung“ vier Texte wiedergegeben,<br />
die von angeblich vorhandenen Edelmetallvorkommen<br />
im Geme<strong>in</strong>degebiet von Hüttenberg<br />
zu berichten wissen. Die Texte entst<strong>am</strong>men<br />
e<strong>in</strong>er Beilage zur Beschreibung <strong>des</strong> Werbbezirks<br />
Reichenfels und wurden vom Lehrer Michael<br />
Schuttnig und dem Pfarrer Johann Liegl 1812 an<br />
Erzherzog Johann geschickt. Die beiden Verfasser<br />
berufen sich dabei auf „mehrere alte Schriften<br />
..., welche reichlichen Stoff darbieten und nicht so<br />
viel Kosten Aufwand, als jener so verschriynen<br />
Klien<strong>in</strong>g zur Nachforschung erfordern ....“ 10 Es<br />
lagen ihnen demnach ältere, seither verschollene<br />
Lagebeschreibungen vor, denen sie ihre Angaben<br />
über angeblich reiche Fundorte im oberen Lavanttal<br />
und oberen Görtschitztal entnahmen.<br />
In der montanistischen Literatur nehmen solche als Walenbücher<br />
bezeichnete Schriftstücke e<strong>in</strong>e Sonderstellung e<strong>in</strong>. Gerhart HEIL-<br />
FURTH beurteilt sie <strong>in</strong> se<strong>in</strong>er umfassenden Übersicht über<br />
die bergmännische Erzählüberlieferung im deutschsprachigen<br />
Mitteleuropa als <strong>in</strong>teressante zwielichtige Dokumentationen<br />
zwischen Wissen und Sage, die als Wegweiser zu<br />
Fundorten Angaben über fiktive, manchmal auch tatsäch-<br />
10 Steiermärkisches Lan<strong>des</strong>archiv, Joannea 4396: Beantwortungen<br />
der im Jahr 1811 ausgeschriebenen Fragen über den<br />
Werbbezirk Reichenfels, Beilage A.<br />
lich vorhandene Bodenschätze enthalten 11 . In der Fachliteratur<br />
s<strong>in</strong>d solche handschriftlichen „Walenbücher“ bisher<br />
aus Bergbaugebieten Mitteldeutschlands (Erzgebirge, Harz)<br />
und <strong>des</strong> ehemaligen Oberungarn (heute Slowakei) bekannt<br />
(und publiziert), von den <strong>in</strong> österreichischen Archiven<br />
liegenden Handschriften ist bislang jedoch nur die im<br />
Besitz <strong>des</strong> Steiermärkischen Lan<strong>des</strong>archiv bef<strong>in</strong>dliche HS<br />
1256 durch den Montanisten Franz KIRNBAUER und den<br />
Germanisten R. ALTMÜLLER übertragen und kommentiert<br />
als „Steirisches Walenbüchle<strong>in</strong>“ veröffentlicht worden 12 . In<br />
der als Abschrift aus weit älteren Quellen beurteilten<br />
S<strong>am</strong>mlung von H<strong>in</strong>weisen auf Fundstellen im Alpenraum<br />
der heutigen Bun<strong>des</strong>länder Steiermark, Kärnten, Salzburg<br />
und Oberösterreich f<strong>in</strong>den sich im Abschnitt „Im Land<br />
Kärnten. Die Ärtz zu F<strong>in</strong>den“ sechzehn Angaben über<br />
Fundstellen <strong>in</strong> der Umgebung von Gmünd und <strong>in</strong> den<br />
Nockbergen, wobei die größte Häufigkeit der Nennungen<br />
sich auf das Gebiet um den Königstuhl bzw. zwischen<br />
Heiligenbach und Stangalm bezieht. Fundstellen im Görtschitztal<br />
werden nicht erwähnt.<br />
Zwei weitere Handschriften, die dieser Art von historischer<br />
Montanliteratur zuzurechnen s<strong>in</strong>d, liegen – bislang unbearbeitet<br />
– <strong>in</strong> der Handschriftens<strong>am</strong>mlung <strong>des</strong> Geschichtsvere<strong>in</strong>s<br />
im Kärntner Lan<strong>des</strong>archiv 13 , und schließlich enthält<br />
auch e<strong>in</strong> <strong>in</strong> Stadl an der Mur aufgefundenes und 1931<br />
dem Volkskundemuseum <strong>in</strong> Graz übergebenes Notizbüchle<strong>in</strong><br />
e<strong>in</strong>es obersteirischen Maurergesellen 14 im Abschnitt „Wegweiser<br />
im Lande Kärnten“ neun Angaben über angebliche<br />
Fundstellen <strong>in</strong> der Gegend um den Königstuhl. Die <strong>in</strong><br />
diesem Notizbüchle<strong>in</strong> aus dem ausgehenden 18. Jahrhundert<br />
e<strong>in</strong>getragenen Lagebeschreibungen wurden vom Verfasser<br />
übertragen und zur Veröffentlichung vorbereitet 15 .<br />
Nennungen von Fundplätzen im Görtschitztal weist freilich<br />
nur e<strong>in</strong>e der genannten Kärntner Handschriften auf: das im<br />
Kärntner Lan<strong>des</strong>archiv aufbewahrte und aus der zweiten<br />
11 Gerhard Heilfurth und Ina-Maria Greverus: Bergbau und<br />
Bergmann <strong>in</strong> der deutschsprachigen Sagenüberlieferung<br />
Mitteleuropas. Marburg 1967<br />
12 Altmüller und Kirnbauer: E<strong>in</strong> steirisches Walenbüchle<strong>in</strong>.<br />
Leobner Grüne Hefte 125.<br />
13 KLA, Kat. 61/2 , HS 7/2 und 10/49.<br />
14 Bibliothek <strong>des</strong> Steirischen Volkskundemuseums Graz, Inv.<br />
Nr. 7654.<br />
15 In Vorbereitung Car<strong>in</strong>thia I, 2004.