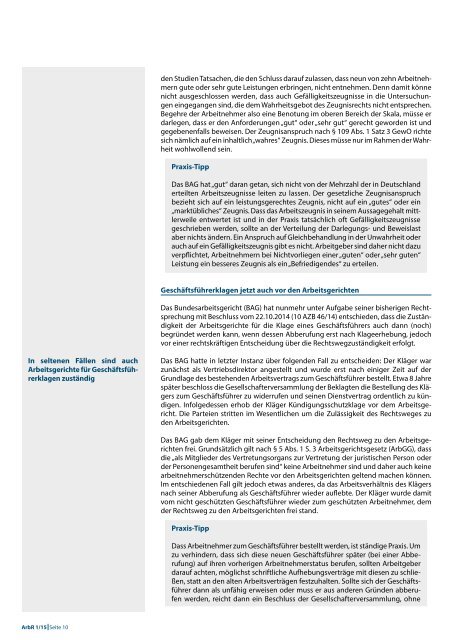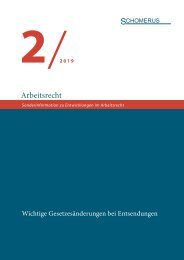Arbeitsrecht 1/15
Newsletter zu Entwicklungen im Arbeitsrecht
Newsletter zu Entwicklungen im Arbeitsrecht
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
den Studien Tatsachen, die den Schluss darauf zulassen, dass neun von zehn Arbeitnehmern<br />
gute oder sehr gute Leistungen erbringen, nicht entnehmen. Denn damit könne<br />
nicht ausgeschlossen werden, dass auch Gefälligkeitszeugnisse in die Untersuchungen<br />
eingegangen sind, die dem Wahrheitsgebot des Zeugnisrechts nicht entsprechen.<br />
Begehre der Arbeitnehmer also eine Benotung im oberen Bereich der Skala, müsse er<br />
darlegen, dass er den Anforderungen „gut“ oder „sehr gut“ gerecht geworden ist und<br />
gegebenenfalls beweisen. Der Zeugnisanspruch nach § 109 Abs. 1 Satz 3 GewO richte<br />
sich nämlich auf ein inhaltlich „wahres“ Zeugnis. Dieses müsse nur im Rahmen der Wahrheit<br />
wohlwollend sein.<br />
Praxis-Tipp<br />
Das BAG hat „gut“ daran getan, sich nicht von der Mehrzahl der in Deutschland<br />
erteilten Arbeitszeugnisse leiten zu lassen. Der gesetzliche Zeugnisanspruch<br />
bezieht sich auf ein leistungsgerechtes Zeugnis, nicht auf ein „gutes“ oder ein<br />
„marktübliches“ Zeugnis. Dass das Arbeitszeugnis in seinem Aussagegehalt mittlerweile<br />
entwertet ist und in der Praxis tatsächlich oft Gefälligkeitszeugnisse<br />
geschrieben werden, sollte an der Verteilung der Darlegungs- und Beweislast<br />
aber nichts ändern. Ein Anspruch auf Gleichbehandlung in der Unwahrheit oder<br />
auch auf ein Gefälligkeitszeugnis gibt es nicht. Arbeitgeber sind daher nicht dazu<br />
verpflichtet, Arbeitnehmern bei Nichtvorliegen einer „guten“ oder „sehr guten“<br />
Leistung ein besseres Zeugnis als ein „Befriedigendes“ zu erteilen.<br />
Geschäftsführerklagen jetzt auch vor den Arbeitsgerichten<br />
Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hat nunmehr unter Aufgabe seiner bisherigen Rechtsprechung<br />
mit Beschluss vom 22.10.2014 (10 AZB 46/14) entschieden, dass die Zuständigkeit<br />
der Arbeitsgerichte für die Klage eines Geschäftsführers auch dann (noch)<br />
begründet werden kann, wenn dessen Abberufung erst nach Klageerhebung, jedoch<br />
vor einer rechtskräftigen Entscheidung über die Rechtswegzuständigkeit erfolgt.<br />
In seltenen Fällen sind auch<br />
Arbeitsgerichte für Geschäftsführerklagen<br />
zuständig<br />
Das BAG hatte in letzter Instanz über folgenden Fall zu entscheiden: Der Kläger war<br />
zunächst als Vertriebsdirektor angestellt und wurde erst nach einiger Zeit auf der<br />
Grundlage des bestehenden Arbeitsvertrags zum Geschäftsführer bestellt. Etwa 8 Jahre<br />
später beschloss die Gesellschafterversammlung der Beklagten die Bestellung des Klägers<br />
zum Geschäftsführer zu widerrufen und seinen Dienstvertrag ordentlich zu kündigen.<br />
Infolgedessen erhob der Kläger Kündigungsschutzklage vor dem Arbeitsgericht.<br />
Die Parteien stritten im Wesentlichen um die Zulässigkeit des Rechtsweges zu<br />
den Arbeitsgerichten.<br />
Das BAG gab dem Kläger mit seiner Entscheidung den Rechtsweg zu den Arbeitsgerichten<br />
frei. Grundsätzlich gilt nach § 5 Abs. 1 S. 3 Arbeitsgerichtsgesetz (ArbGG), dass<br />
die „als Mitglieder des Vertretungsorgans zur Vertretung der juristischen Person oder<br />
der Personengesamtheit berufen sind“ keine Arbeitnehmer sind und daher auch keine<br />
arbeitnehmerschützenden Rechte vor den Arbeitsgerichten geltend machen können.<br />
Im entschiedenen Fall gilt jedoch etwas anderes, da das Arbeitsverhältnis des Klägers<br />
nach seiner Abberufung als Geschäftsführer wieder auflebte. Der Kläger wurde damit<br />
vom nicht geschützten Geschäftsführer wieder zum geschützten Arbeitnehmer, dem<br />
der Rechtsweg zu den Arbeitsgerichten frei stand.<br />
Praxis-Tipp<br />
Dass Arbeitnehmer zum Geschäftsführer bestellt werden, ist ständige Praxis. Um<br />
zu verhindern, dass sich diese neuen Geschäftsführer später (bei einer Abberufung)<br />
auf ihren vorherigen Arbeitnehmerstatus berufen, sollten Arbeitgeber<br />
darauf achten, möglichst schriftliche Aufhebungsverträge mit diesen zu schließen,<br />
statt an den alten Arbeitsverträgen festzuhalten. Sollte sich der Geschäftsführer<br />
dann als unfähig erweisen oder muss er aus anderen Gründen abberufen<br />
werden, reicht dann ein Beschluss der Gesellschafterversammlung, ohne<br />
ArbR 1/<strong>15</strong> Seite 10