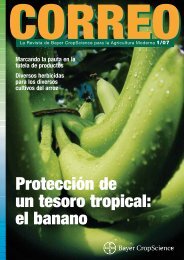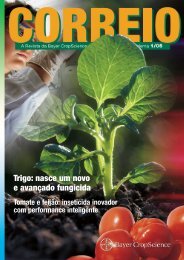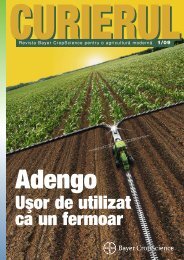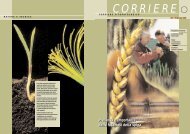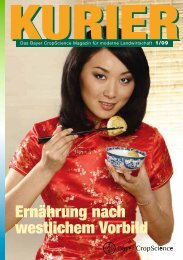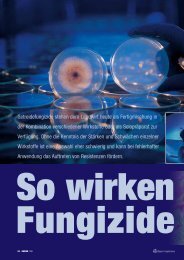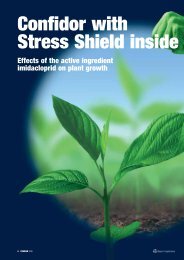Genau auf Kurs!
Genau auf Kurs!
Genau auf Kurs!
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
KURIER<br />
Das Bayer CropScience Magazin für moderne Landwirtschaft 2/05<br />
<strong>Genau</strong><br />
<strong>auf</strong> <strong>Kurs</strong>!<br />
Automatische Lenksysteme<br />
in der Landwirtschaft
Forschung & Praxis<br />
Der BayerAgrar-Shop<br />
im Internet<br />
Der interaktive<br />
Pflanzenschutzberater<br />
von Bayer CropScience<br />
Bequem von zu Hause eink<strong>auf</strong>en, diesen Service bietet Bayer<br />
CropScience den Mitgliedern des Agrarclubs (www.agrarclub.de).<br />
Im BayerAgrar-Shop können interessante Markenartikel und attraktive<br />
Sonderangebote bestellt werden. Neben einer Reihe von praktischen<br />
Artikeln für den Landwirt aus der „Bayer-Kollektion“, wie<br />
Beinlinge, wetterfeste Anoraks, Handschuhe oder Regenmesser, finden<br />
sich in der „Bibliothek“ die bewährten Bestimmungsfächer.<br />
Sechs Ausgaben sind derzeit lieferbar: Schädlinge und Nützlinge im<br />
Ackerbau, Unkräuter und Ungräser im Ackerbau, Getreidekrankheiten<br />
sowie Krankheiten, Unkräuter und Schädlinge in Kartoffeln,<br />
Mais und Weinbau. Die CD „Pflanzenschutz Kompendium 2005“ ist<br />
auch im Shop erhältlich. Sie enthält alle Informationen rund um das<br />
aktuelle Produktportfolio inklusive Ansprechpartner, Leistungsprofile<br />
und Broschüren.<br />
Das weitere Sortiment umfasst neben Spielzeug für die Kleinen<br />
auch Küchenartikel und Freizeitbedarf wie Reisekoffer und Rucksäcke.<br />
Hochwertiges Werkzeug rundet das Angebot ab: Taschenlampen,<br />
Akku-Schlagbohrer und Elektro-Heckenscheren. Unter der<br />
Rubrik Elektronik können unter anderem auch Digital-Kameras<br />
bestellt werden.<br />
Die Anmeldung für den Agrar-Shop ist denkbar einfach: Name,<br />
Anschrift und E-Mail-Adresse eingeben, Benutzername und Kennwort<br />
festlegen, und der Agrar-Shop hat 24 Stunden am Tag geöffnet. ■<br />
Mit Beginn der Frühjahrssaison hat Bayer<br />
CropScience das Beratungsangebot um<br />
einen weiteren Internet-Service erweitert.<br />
Unter www.pflanzenschutzberater.de führt<br />
ein interaktiver Berater den Landwirt<br />
schnell, einfach und komfortabel zu seiner<br />
regionalen Pflanzenschutz-Problemlösung.<br />
Eine kürzlich gestartete Befragung von<br />
Nutzern ergab: Das neue Programm kommt<br />
hinsichtlich Benutzerführung, Geschwindigkeit<br />
und Informationsgehalt seht gut an.<br />
Und um den Nutzen noch weiter zu steigern,<br />
wurden auch die Herbstempfehlungen eingestellt.<br />
Nach Abfrage der Region gelangt der<br />
Nutzer automatisch in das Menü, das ihn<br />
nach der Auswahl „Ackerbau“, „Saison“,<br />
„Kultur“ und „Schaderreger“ schnell zur<br />
Einsatzempfehlung führt. Aus einer Vielzahl<br />
möglicher Krankheiten, Schädlinge, Unkräuter<br />
oder Ungräser kann der Schaderreger<br />
ausgewählt werden. Ergebnis der<br />
virtuellen Beratung ist eine maßgeschneiderte<br />
Produktempfehlung inkl. der notwendigen<br />
Aufwandmenge und dem optimalen<br />
Anwendungszeitraum.<br />
Zusätzlich werden weitere Informationen<br />
angeboten: eine Kurzbeschreibung des einzusetzenden<br />
Pflanzenschutzmittels, ein<br />
Produktdatenblatt, die behördlich vorgeschriebenen<br />
Abstands<strong>auf</strong>lagen sowie das<br />
Sicherheitsdatenblatt. Darüber hinaus erhält<br />
der Landwirt über die „Schaderreger-<br />
Diagnose“ eine Übersicht aller mit einer<br />
Empfehlung erfassten Schaderreger inklusive<br />
Bildmaterial. ■<br />
2 KURIER 2/05
Liebe Leserinnen und Leser,<br />
neben der Vermarktung einer breiten Palette<br />
bewährter Produkte und der Einführung<br />
neuer, innovativer Mittel konzentrieren wir<br />
uns zunehmend <strong>auf</strong> unser zweites erfolgreiches<br />
Standbein: Das Entwickeln von<br />
Serviceleistungen für die deutsche Landwirtschaft.<br />
Zwei neue Angebote stellen wir<br />
Ihnen in dieser Ausgabe kurz vor. Dem interaktiven<br />
Pflanzenschutzberater, eingeführt zur<br />
Frühjahrssaison 2005, wurde von vielen<br />
online befragten Landwirten ein gutes<br />
Zeugnis ausgestellt. Des Weiteren erfreut<br />
sich auch der BayerAgrar-Shop mit seinen vielen<br />
interessanten Markenartikeln und attraktiven<br />
Sonderangeboten steigender Beliebtheit.<br />
In einem weiteren Beitrag schauen wir hinter<br />
die Kulissen unseres Feldversuchswesens.<br />
Hoch qualifizierte Bayer-Mitarbeiter nutzen<br />
modernste Technologien, um für Sie die optimalen<br />
und vor allem wirtschaftlichsten Problemlösungen<br />
für den Pflanzenschutz zu entwickeln.<br />
Es ist vermehrt zu beobachten, dass Pflanzenschutzmittel<br />
aus anderen Ländern nach<br />
Deutschland eingeführt werden. Dabei ist<br />
vielen Landwirten nicht bewusst, wo die<br />
Risiken beim Einsatz dieser Produkte liegen<br />
können. Das gilt vor allem bei Auftreten von<br />
Minderwirkungen oder gar Schäden. Antworten<br />
<strong>auf</strong> Fragen zur Haftung und zur aktuellen<br />
Rechtslage erhalten Sie in dieser Ausgabe.<br />
Große Schäden kann die Kleine Kohlfliege<br />
im Raps anrichten. Wir stellen Ihnen die<br />
Problemlösung von Bayer CropScience vor:<br />
Mit Poncho ® und Contur ® Plus behandeltes<br />
Saatgut bietet verlängerten Schutz gegen die<br />
Kleine Kohlfliege und den Rapserdfloh. Die<br />
neue Wirkstoffkombination vermindert<br />
außerdem sekundären Pilzbefall.<br />
Ein hohes Maß an Sicherheit kann in der<br />
anstehenden Herbstsaison mit dem Einsatz<br />
von Atlantis ® WG erreicht werden. Gegen<br />
Ackerfuchsschwanz hat dieses Produkt neue<br />
Maßstäbe gesetzt und ermöglicht in Kombinationen<br />
mit Fenikan ® oder Bacara ® eine<br />
breite Wirkung gegen dikotyle Unkräuter.<br />
Eine sehr gute Resonanz erzielt die Initiative<br />
„Food for Life! Die Früchte der Erde“ des<br />
IVA. Mehr als 25.000 Verbraucher haben bis<br />
heute die mobile Ausstellung besucht und<br />
sich über gesunde Ernährung informiert.<br />
Mitverantwortlich für unser reichhaltiges<br />
Angebot an Obst und Gemüse: Moderne<br />
Pflanzenschutzmittel, die unsere Nahrungspflanzen<br />
vor Krankheiten, Schädlingen oder<br />
Unkräutern bewahren und eingelagertes<br />
Getreide vor Schadinsekten schützen.<br />
Wir wünschen Ihnen eine gute Ernte und<br />
einen erfolgreichen Start in die Herbstsaison.<br />
Ihr<br />
Tobias Marchand<br />
Geschäftsführer der Bayer CropScience<br />
Deutschland GmbH, Langenfeld<br />
Inhalt<br />
4 <strong>Genau</strong> <strong>auf</strong> <strong>Kurs</strong>!<br />
8 Das Klemmbrett hat ausgedient<br />
10 Reimport, EU-Parallelimport,<br />
Drittlandimport von Pflanzenschutzmitteln<br />
– Was ist erlaubt<br />
13 Teil 2: Vom Spritztank<br />
in die Pflanze – die<br />
Formulierung macht’s<br />
16 Eine Maßnahme, die<br />
sich immer lohnt –<br />
Getreideherbizide im Herbst<br />
19 Mit Poncho und Contur Plus<br />
gegen die<br />
Kleine Kohlfliege im Raps<br />
20 „Food for Life!<br />
Die Früchte der Erde“<br />
22 Weizenstandort Deutschland<br />
– Profil der Erzeugung<br />
und Verarbeitung<br />
26 Der Nebel und seine Entstehung<br />
30 Aus aller Welt<br />
Hinweis: Der Kurier ist eine Zeitschrift für den europäischen<br />
Landwirt. Sie bietet somit auch Informationen über<br />
Produkte anderer Länder. Wir bitten deshalb unsere Leser,<br />
unbedingt die nationalen Zulassungen sowie die jeweiligen<br />
Gebrauchsanleitungen zu beachten.<br />
49. Jahrgang / Herausgeber: Bayer CropScience AG,<br />
Monheim / Redaktion: Bernhard Grupp, Birgit Wunstorf /<br />
Verantwortlich für den Inhalt: Bernhard Grupp, Dr. Jörg<br />
Weinmann (nationale Themen) / Inhalt unter Mitwirkung<br />
von: AgroConcept GmbH, Prof. Dr. Peter Baur, Dr. Katharina<br />
Seuser (freie Journalistin), Dr. Manfred Kern, Utz Klages,<br />
Dr. Markus Safferling / Layout: Xpertise, Langenfeld / Litho:<br />
LSD GmbH & Co. KG, Düsseldorf / Druck: Broermann,<br />
Troisdorf / Nachdruck mit Quellenangabe erlaubt. Um<br />
Belegexemplare wird gebeten. Redaktionsanschrift:<br />
BayerCropScience AG, Corporate Communications, Alfred-<br />
Nobel-Straße 50, D-40789 Monheim am Rhein, Fax:<br />
02173-383454, Website: www.bayercropscience.com<br />
Diese Druckschrift enthält bestimmte in die Zukunft<br />
gerichtete Aussagen, die <strong>auf</strong> den gegenwärtigen Annahmen<br />
und Prognosen der Unternehmensleitung der Bayer<br />
CropScience AG beruhen. Verschiedene bekannte wie auch<br />
unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren<br />
können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse,<br />
die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance<br />
unserer Dachgesellschaft Bayer AG wesentlich von den<br />
hier gegebenen Einschätzungen abweichen. Diese Faktoren<br />
schließen diejenigen ein, die in Berichten der Bayer<br />
AG an die Frankfurter Wertpapierbörse sowie die amerikanische<br />
Wertpapier<strong>auf</strong>sichtsbehörde (inkl. Form 20-F)<br />
beschrieben worden sind. Weder die Bayer AG noch die<br />
Bayer CropScience AG übernehmen die Verpflichtung, solche<br />
zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben und an<br />
zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.<br />
2/05 KURIER 3
<strong>Genau</strong> <strong>auf</strong> <strong>Kurs</strong>!<br />
Automatische Lenksysteme in der Landwirtschaft<br />
Patrick Ole Noack, Geo-Konzept, Adelschlag<br />
Automatische Lenksysteme sind kein Werbegag und<br />
nicht nur Spielzeug für Technikverliebte. Mit diesen<br />
Systemen können bei entsprechenden betrieblichen<br />
Voraussetzungen erhebliche Einsparungen erzielt werden.<br />
Dank Parallelführungssystem fährt die Maschine immer mit der optimalen Arbeitsbreite<br />
4 KURIER 2/05
Durch GPS (Globales Positionierungssystem)<br />
gestützte automatische Lenksysteme<br />
werden seit mehreren Jahren von verschiedenen<br />
Herstellern angeboten. Die<br />
Entwicklung begann Mitte der 90er Jahre,<br />
als die ersten manuellen Parallelführungssysteme<br />
<strong>auf</strong> den Markt kamen. Diese<br />
„Lenkhilfen“ zeigten dem Fahrer <strong>auf</strong><br />
Grundlage der Satellitenortung <strong>auf</strong> einem<br />
Lichtbalken die Abweichung von der Sollfahrspur<br />
an. So genannte Autopiloten für<br />
Traktoren oder andere selbst fahrende<br />
Landmaschinen wie Pflanzenschutzspritzen<br />
oder Mähdrescher gibt es seit dem Jahr<br />
2000. Dabei greift das automatische Lenksystem<br />
über ein elektro-hydraulisches<br />
Ventil in den Lenkkreisl<strong>auf</strong> ein und hält<br />
das Fahrzeug automatisch <strong>auf</strong> <strong>Kurs</strong> – der<br />
Fahrer braucht also nicht mehr selbst zu<br />
lenken und kann sich <strong>auf</strong> die Kontrolle des<br />
Arbeitsgerätes konzentrieren.<br />
Wie alles begann<br />
In den 60er Jahren wurde GPS als militärisches<br />
System zur Verbesserung der Navigationsmöglichkeiten<br />
der US-amerikanischen<br />
Streitkräfte entwickelt. Die zivile<br />
Nutzung des Systems wurde in der Entstehungsphase<br />
noch gar nicht in Betracht<br />
gezogen. Erst deutlich später wurde neben<br />
einem hoch präzisen Dienst für den militärischen<br />
Anwendungsbereich ein künstlich<br />
verschlechterter Satellitendienst etabliert,<br />
der für zivile Zwecke nutzbar sein sollte.<br />
Mit einer Abweichung von rund 100<br />
Metern war dieser Dienst zunächst noch<br />
sehr ungenau. Vor fünf Jahren wurde die<br />
künstlich erzeugte Verzerrung abgeschaltet<br />
und der Weg frei für die zivile Nutzung.<br />
Seit dieser Zeit entstehen in der Landwirtschaft<br />
stetig neue, interessante Anwendungsbereiche<br />
für dieses System.<br />
Daneben existiert ein Kontrollsegment im<br />
GPS, das aus fünf Kontrollstationen – mit<br />
bekannter Position – <strong>auf</strong> der Erde besteht.<br />
Hier werden die Daten, die von den Satelliten<br />
ausgesendet werden, permanent <strong>auf</strong><br />
Richtigkeit und Präzision hin überprüft<br />
und ggf. korrigiert.<br />
Das Nutzersegment ist letztlich der<br />
GPS-Empfänger, der Informationen wie<br />
Position, Höhe und auch Geschwindigkeit<br />
bei Bedarf errechnen kann. Dabei errechnet<br />
der GPS-Empfänger die Geschwindigkeit<br />
aus dem Quotienten der Distanz zwischen<br />
zwei ermittelten Messpositionen und<br />
der zwischen diesen Messungen liegenden<br />
Zeit. Die Ermittlung der eigenen Position<br />
basiert – vereinfacht dargestellt – <strong>auf</strong> der<br />
Bestimmung der Zeit, die vom gleichzeitigen<br />
Versand mindestens dreier unterschiedlicher<br />
Satellitensignale bis zum<br />
Empfang dieser Signale am GPS-Empfänger<br />
vergeht. Hierzu ist in jedem der 24<br />
Satelliten eine Atomuhr eingebaut, die<br />
eine hochgenaue Zeitmessung ermöglicht.<br />
Stellt man sich den Bereich, in dem das<br />
GPS-Signal eines bekannten Satelliten<br />
empfangen werden kann, als einen Kreis<br />
<strong>auf</strong> der Erdkugel vor (Abbildung 1), so<br />
kann man im Falle des Empfangs dieses<br />
Signals mit einem GPS-Empfänger davon<br />
ausgehen, dass die gesuchte eigene Position<br />
an irgendeiner Stelle <strong>auf</strong> dem Rand<br />
dieses Kreises liegt. Werden gleichzeitig<br />
zwei Satellitensignale empfangen, ist klar,<br />
dass die eigene Position an einer der<br />
Schnittstellen dieser zwei Kreise liegt. Erst<br />
bei zeitgleichem Empfang eines dritten<br />
Satellitensignals kann dann eine exakte<br />
Positionsangabe gemacht werden.<br />
Qualität mindernd ist allerdings die<br />
Präzision der Zeitmessung im GPS-<br />
Empfänger. Da man hier üblicherweise aus<br />
Kostengründen <strong>auf</strong> eine Atomuhr verzichtet,<br />
kann es zu gravierenden Fehlern kommen.<br />
Beispielsweise kann ein Fehler in der<br />
Zeitmessung von bereits einer Millionstel<br />
Sekunde zu einem Fehler von 300 Metern<br />
<strong>auf</strong> der Erdoberfläche führen. Um dieses<br />
Problem zu lösen, wird das gleichzeitig<br />
empfangene Signal eines weiteren, vierten<br />
Satelliten benötigt.<br />
<strong>Genau</strong>igkeit und Fehlerquellen<br />
Die <strong>Genau</strong>igkeit der Positionsbestimmung<br />
spielt für die landwirtschaftliche Praxis<br />
eine wichtige Rolle. Mit einem handelsüblichen<br />
GPS-Empfänger können unter idealen<br />
Bedingungen <strong>Genau</strong>igkeiten von rund<br />
zehn Metern erreicht werden. Mit Hilfe<br />
statistischer Methoden ist sogar eine<br />
<strong>Genau</strong>igkeit von etwa fünf Metern möglich,<br />
wobei hier mehrere Positionsbestimmungen<br />
am gleichen Ort durchgeführt<br />
werden müssen.<br />
Fehlerquellen bei der Messung entstehen<br />
an mehreren Stellen. Unter anderem<br />
sind dies Fehler bei der Signalübermittlung<br />
durch die Atmosphäre, durch Ungenauigkeiten<br />
der Empfängeruhr, durch Positionsfehler<br />
der Satelliten in ihrer Uml<strong>auf</strong>bahn<br />
oder durch die Reflektion des GPS-Signals<br />
an Geländeobjekten oder Gebäuden, was<br />
zu einer gewissen Verzögerung an den<br />
Empfängern führt.<br />
Für einige landwirtschaftliche Anwendungen<br />
sind so erreichbare <strong>Genau</strong>igkeiten<br />
der Positionsbestimmung bereits ausrei-<br />
Gesteuert von Geisterhand –<br />
wie funktioniert das<br />
Das Prinzip der Satellitennavigation mit<br />
GPS beruht <strong>auf</strong> drei wesentlichen Grundkomponenten:<br />
Wichtigster Bestandteil ist<br />
das Raumsegment. Es besteht aus insgesamt<br />
24 geostationären Satelliten, die sich<br />
in einer Höhe von ca. 20.200 Kilometern<br />
über der Erdoberfläche befinden. Da sich<br />
diese Satelliten mit einer Geschwindigkeit<br />
von etwa 11.000 Kilometern pro Stunde<br />
<strong>auf</strong> ihrer Uml<strong>auf</strong>bahn bewegen, dauert ein<br />
kompletter Uml<strong>auf</strong> um die Erdkugel rund<br />
12 Stunden. Diese bis zu 2 Tonnen schweren,<br />
solarbetriebenen Satelliten sind so<br />
angeordnet, dass von jedem beliebigen<br />
Punkt der Erde mindestens fünf, maximal<br />
jedoch 11 Satelliten sichtbar sein können.<br />
Abbildung 1: Prinzip der Positionsbestimmung mit dem Global Positionierungssystem (GPS). Darstellung stark<br />
vereinfacht, Erläuterungen im Text.<br />
2/05 KURIER 5
chend, während jedoch insbesondere im<br />
Zusammenhang mit der automatischen<br />
Parallelführung von landwirtschaftlichen<br />
Maschinen und der teilflächenspezifischen<br />
Bewirtschaftung von Ackerflächen zunehmend<br />
präzisere Daten benötigt werden.<br />
Für die präzise Anwendung wird differenzielles<br />
GPS (DGPS) eingesetzt, mit dem<br />
man – je nach Anbieter des Korrektursignals<br />
– <strong>Genau</strong>igkeiten bis in den Millimeterbereich<br />
erzielt. DGPS basiert <strong>auf</strong><br />
dem zusätzlichen Empfang eines <strong>auf</strong> einer<br />
bestimmten Frequenz übertragenen<br />
Korrektursignals. Dieses Korrektursignal<br />
wird an einer Basisstation errechnet und<br />
kann in einem bestimmten Radius um die<br />
Basisstation empfangen werden. An der<br />
Basisstation mit bekannter, hochgenau<br />
berechneter Position wird eine Positionsbestimmung<br />
mittels GPS durchgeführt. Da<br />
eine Reihe unterschiedlicher Fehlerquellen<br />
die Positionsbestimmung stören können,<br />
entsteht im Vergleich zur bekannten<br />
Position eine Differenz. Auf der Grundlage<br />
dieser Differenz werden dann, vereinfacht<br />
beschrieben, entsprechende Korrekturdaten<br />
errechnet und via Funk übertragen.<br />
Hierbei sind frei verfügbare oder kostenpflichtige<br />
– meist auch deutlich präzisere –<br />
Korrektursignale unterschiedlicher Anbieter<br />
verfügbar.<br />
Die Landesvermessungsämter bieten<br />
zum Beispiel einen eigenen kommerziellen<br />
Satellitenpositionierungsdienst (SAPOS)<br />
an, der unterschiedlich präzise Korrektursignale<br />
– flächendeckend für die Bundesrepublik<br />
– zur Verfügung stellt. In vielen<br />
einfachen GPS-Empfängern ist optional<br />
bereits der Empfang des Wide Area Augmentation<br />
System (WAAS) vorhanden, welches<br />
allerdings nur in den USA zur<br />
Verfügung steht. Das Prinzip des Korrektursignals<br />
wird hier ebenfalls verwendet,<br />
wobei die Übertragung des Signals jedoch<br />
via Satellit erfolgt. Ein vergleichbares<br />
satellitengestütztes System der Europäischen<br />
Raumfahrt Organisation (ESA) soll<br />
in diesem Jahr den Betrieb <strong>auf</strong>nehmen und<br />
unter dem Namen European Geostationary<br />
Navigation Overlay Service (EGNOS)<br />
arbeiten.<br />
GPS und Precision Farming<br />
Viele landwirtschaftliche Fahrzeuge sind<br />
inzwischen mit einem Empfangsgerät zur<br />
Positionsbestimmung ausgerüstet oder<br />
können mit einem solchen nachgerüstet<br />
werden. Von der präzisen Ertragskartierung<br />
bis zur teilflächenspezifischen Ausbringung<br />
von Düngemitteln, Wachstumsregulatoren<br />
oder Herbiziden sowie dem Anschlussfahren<br />
in Parallelfahrsystemen ist eine Reihe<br />
wichtiger Anwendungen in der Praxis etabliert<br />
und ohne GPS nicht mehr denkbar.<br />
GPS gestützte automatische Lenksysteme<br />
haben für die Wirtschaftlichkeit mehrere<br />
Vorteile:<br />
• Verminderung von Arbeitszeit und Lohnkosten,<br />
• Verminderung von Maschineneinsatzzeit<br />
und Maschinenkosten,<br />
• Einsparung von Betriebsmitteln (Dünger,<br />
Herbizide, Fungizide),<br />
• Ausweitung der Einsatzzeiten (Arbeiten<br />
bei Dunkelheit und Nebel),<br />
• Verminderte Bodenverdichtung,<br />
• Steigerung der Arbeitsqualität durch<br />
Fahrerentlastung.<br />
Von diesen Vorteilen haben sich bereits<br />
etliche Landwirte selbst überzeugt und<br />
sich nicht von den <strong>auf</strong> den ersten Blick<br />
hohen Investitionskosten abschrecken lassen.<br />
Die Betriebe setzen je nach Anwendung<br />
Autopilot-Systeme mit verschiedenen<br />
Ausbaustufen <strong>auf</strong> ihren Maschinen ein.<br />
Die Erfolge dieser Entscheidung zeigen<br />
sich sowohl in Gemüsebau- und Marktfruchtbetrieben<br />
als auch bei Lohnunternehmen.<br />
Weniger<br />
Maschineneinsatzzeiten und<br />
erhebliche Kraftstoffeinsparung<br />
Die Herzogliche Gutsverwaltung Grünholz<br />
bei Rendsburg (1.400 Hektar Getreide, 200<br />
Hektar Zuckerrüben) entschied sich im<br />
Jahr 2004 für die Anschaffung von drei Autopilotsystemen<br />
mit lokaler Referenzstation<br />
(2 Radschlepper, 1 Raupenschlepper). Mit<br />
diesem System können die Fahrzeuge mit<br />
einer <strong>Genau</strong>igkeit von 2 cm automatisch<br />
gelenkt werden. Betriebsleiter Hans-<br />
Jürgen Hess verspricht sich vor allem von<br />
der Erhöhung der Schlagkraft durch die<br />
Ausweitung der Einsatzzeiten bis in die<br />
Nacht erhebliche Einsparungen bei gleich<br />
bleibend hoher Arbeitsqualität. Auch unter<br />
schwierigen Witterungsbedingungen kann<br />
die Arbeit effizient erledigt werden.<br />
Der Betriebsleiter erwartet durch die<br />
Verringerung der Maschineneinsatzzeiten<br />
erhebliche Kraftstoffeinsparungen. Zukünftig<br />
sollen die Fahrspuren <strong>auf</strong> dem<br />
Betrieb jedes Jahr wieder befahren<br />
werden. So entfällt einerseits die Spurlockerung,<br />
andererseits wird der Boden<br />
zwischen den Fahrgassen dauerhaft<br />
geschont, was mittelfristig zu höheren<br />
Erträgen und gleichmäßigerer Bestandesentwicklung<br />
führt. Die Fahrgassen selbst<br />
sind wegen der vermehrten Verdichtung<br />
auch bei schlechten Witterungsbedingungen<br />
länger befahrbar. Aufgrund der guten<br />
Zum Empfang von Korrektursignalen für den Einsatz von DGPS<br />
werden spezielle Empfangsgeräte benötigt.<br />
Exaktes Anschlussfahren mit dem Autopiloten<br />
6 KURIER 2/05
Erfahrungen hat der Betriebsleiter im<br />
Frühjahr 2005 einen weiteren Radschlepper<br />
mit einem Autopilotsystem ausrüsten<br />
lassen.<br />
Mietmaschinen mit Autopilot<br />
Die Firma AH Agrarmaschinenvermietung<br />
in Wardenburg nahe Oldenburg vermietet<br />
landwirtschaftliche Nutzmaschinen und<br />
Anhänger. Geschäftsführer Abel ließ seit<br />
Anfang 2004 insgesamt 5 Traktoren mit<br />
Autopilot-Systemen ausrüsten. Die Kunden<br />
können diese Maschinen mit oder<br />
ohne Autopilot einsetzen. Die Höhe der<br />
Mietkosten richtet sich nach der <strong>Genau</strong>igkeit<br />
des automatischen Lenksystems. Bei<br />
den Autopiloten der Firma AH Agrarmaschinenvermietung<br />
handelt es sich um<br />
die höchste Ausbaustufe (<strong>Genau</strong>igkeit 2 cm).<br />
Die Systeme können jedoch <strong>auf</strong> Wunsch<br />
zu einem geringeren Mietpreis mit 10 bis<br />
30 cm oder mit 5 bis 10 cm <strong>Genau</strong>igkeit<br />
gemietet werden. Die Kunden sind bereit,<br />
den Aufpreis zu bezahlen, weil sie die<br />
hochwertigen Traktoren mit Autopilot<br />
wesentlich effektiver einsetzen können.<br />
Die Maschinen können bei pauschalierter<br />
Monatsmiete auch in der Nacht eingesetzt<br />
werden. So können die Maschinenkosten<br />
pro Hektar deutlich gesenkt werden.<br />
Außerdem kann mit dem automatischen<br />
Lenksystem auch weniger qualifiziertes<br />
Personal die Maschinen bedienen.<br />
Mit dem Autopilot Spargel<br />
pflanzen<br />
Die Firma Thiermann in Kirchdorf (Landkreis<br />
Diepholz) bewirtschaftet verschiedene<br />
Betriebe in ganz Deutschland. Unter<br />
anderem werden 650 ha Spargel angebaut.<br />
Foto: Galileo Industries<br />
Betriebsleiter Karsten Freyer entschied<br />
sich im Frühjahr 2005 für einen<br />
Miettraktor der Firma AH Agrarmaschinenvermietung,<br />
der ausgerüstet war<br />
mit einem Autopilot, um damit Spargel zu<br />
pflanzen. Freyer und seine Mitarbeiter<br />
zeigten sich zunächst überrascht, wie einfach<br />
das Autopilot-System zu bedienen ist.<br />
Schon nach Abschluss der ersten Kampagne<br />
zeigte sich, dass die Produktivität<br />
um 30% gesteigert werden konnte. Dank<br />
des automatischen Lenksystems konnte<br />
die Vorfahrtsgeschwindigkeit gesteigert<br />
werden. Außerdem konnte der Spargel<br />
über 24 Stunden in drei Schichten<br />
gepflanzt werden. Die Arbeitsqualität<br />
wurde gegenüber vorherigen Kampagnen<br />
stark verbessert, da alle Spargelpflanzen<br />
exakt mittig in den Damm gesetzt werden.<br />
Dies erleichtert den später erforderlichen<br />
Damm<strong>auf</strong>bau erheblich. Auch das<br />
Aufdämmen kann mit dem Autopilot in der<br />
Nacht und in den frühen Morgenstunden –<br />
selbst bei Nebel – durchgeführt werden.<br />
Freyer schätzt, dass er für diese Arbeiten<br />
statt bisher fünf künftig nur noch drei<br />
Traktoren benötigt. Für Freyer besteht<br />
daher kein Zweifel, dass sich für seinen<br />
Betrieb der Einsatz des automatischen<br />
Lenksystems schon im ersten Jahr voll<br />
ausgezahlt hat. Dass der nächste betriebseigene<br />
Schlepper mit einem automatischen<br />
Lenksystem ausgerüstet wird, steht für die<br />
Firma Thiermann außer Frage. ■<br />
Spargel pflanzen mit dem Autopiloten<br />
Pflanzenschutzspritze mit automatischer Parallelführung<br />
2/05 KURIER 7
Das Klemmbrett<br />
Bayer CropScience übernimmt Vorreiterrolle bei<br />
der digitalen Bonitierung im Feldversuchswesen<br />
Erwin Hüfner, Versuchsingenieur der<br />
Bayer CropScience Deutschland GmbH,<br />
hat viel mit Zahlen zu tun. Bei jedem seiner<br />
Kontrollgänge über die Versuchsparzellen<br />
muss er unterschiedlichste Daten sammeln,<br />
erfassen und auswerten. <strong>Genau</strong>igkeit<br />
ist dabei oberstes Gebot. Gehörten bislang<br />
das Klemmbrett, Papier und Bleistift zum<br />
typischen Bild eines Versuchstechnikers,<br />
kommt Erwin Hüfner heute anders daher.<br />
An einem Gurt trägt er einen kleinen<br />
Computer, ein sogenanntes Handheldgerät.<br />
„Meine Beobachtungen gebe ich direkt vor<br />
Ort in das Gerät ein,“ erläutert Hüfner,<br />
„und die Bonitierungen werden <strong>auf</strong> einem<br />
Chip abgespeichert. Dieser Chip passt<br />
auch in den Bürocomputer. Nach der<br />
Feldbegehung überspiele ich die Daten <strong>auf</strong><br />
den PC, überprüfe noch einmal meine<br />
Eintragungen und leite sie dann noch am<br />
selben Tag an die Abteilung Versuchsauswertung<br />
und Datenmanagement (VDM) in<br />
der Zentrale in Langenfeld weiter. Der<br />
große Vorteil dieser Vorgehensweise liegt<br />
darin, dass die handschriftlichen Notizen<br />
nicht mehr zeit<strong>auf</strong>wendig und fehleranfällig<br />
in den PC eingetippt werden müssen.<br />
Mit der digitalen Datenerfassung <strong>auf</strong> dem<br />
Feld entfällt auch ein Arbeitsschritt, der in<br />
der Vergangenheit immer wieder zu zeitlichen<br />
Engpässen geführt hat.“<br />
Inzwischen arbeiten alle Techniker des<br />
Versuchswesens von Bayer CropScience<br />
mit diesem System. Spezielle Computerkenntnisse<br />
sind dafür nicht erforderlich,<br />
weil die Bonitierungen in einfachen Excel-<br />
Dateien erfasst werden. Wesentlich mehr<br />
Probleme bereitete die Suche nach einer<br />
geeigneten Hardware. Der nun eingesetzte<br />
Panasonic Toughbook CF-P1 erfüllt alle<br />
Voraussetzungen und ist praxistauglich.<br />
„Das Gerät muss leicht, einhändig zu<br />
bedienen und übersichtlich sein“, zählt<br />
Hüfner die von ihm gemachten Vorgaben<br />
<strong>auf</strong>, “deshalb haben wir uns für eine<br />
Zahlentastatur, ähnlich wie beim Handy,<br />
entschieden. Darüber hinaus muss das<br />
Gerät wasserdicht und stoßfest sein.<br />
Besonders wichtig aber ist, dass man die<br />
Angaben <strong>auf</strong> dem Display auch im Freien<br />
und vor allem bei direkter Sonneneinstrahlung<br />
einwandfrei erkennen kann.“<br />
Wie funktioniert eigentlich das<br />
Versuchswesen<br />
„Der Datenfluss von der Erfassung über<br />
die Kontrolle und den Versand bis hin zur<br />
Auswertung läuft seit Einführung der<br />
„Taschencomputer“ wesentlich zeitnäher<br />
als früher“, meint auch Versuchsleiter<br />
Burkhardt Toews. „Der Versuchstechniker<br />
ist ja kein Einzelkämpfer, sondern er ist<br />
8 KURIER 2/05
hat ausgedient<br />
Die Daten fließen zurück<br />
Versuchstechniker Erwin Hüfner im Einsatz mit einem Parzellenspritzgerät <strong>auf</strong> dem Versuchsstsandort Büdinger<br />
Hof (Hessen).<br />
eingebunden in ein Netzwerk, das nur dann<br />
zu guten Ergebnissen kommt, wenn alle<br />
Beteiligten schnell und fehlerfrei miteinander<br />
kommunizieren können.“<br />
Zu diesem Netzwerk gehört auch der<br />
Erbacher Hof in Büdingen, ein wichtiger<br />
Standort für das Versuchswesen bei Bayer<br />
CropScience und das Demonstrationszentrum<br />
für den Raum Hessen. Dort betreut<br />
Erwin Hüfner rund sieben Hektar mit rund<br />
2.500 Einzelparzellen, <strong>auf</strong> denen zirka 50<br />
verschiedene Herbizid- und Fungizidversuche<br />
angelegt sind. Es sind die Ackerbaukulturen<br />
Getreide, Raps, Mais, Rüben und<br />
Kartoffeln im Anbau, wobei das Getreide<br />
eindeutig im Mittelpunkt des Interesses<br />
steht.<br />
Landwirte profitieren von den<br />
Feldversuchen<br />
Die Vorgaben für seine Versuchsanstellungen<br />
erhält Hüfner von der Entwicklungsabteilung<br />
der Zentrale in Langenfeld. Nach diesen<br />
Vorgaben entwickeln die Versuchsleiter<br />
gemeinsam mit der VDM sowie den<br />
Versuchsingenieuren die Versuchspläne<br />
und legen den inhaltlichen und zeitlichen<br />
Rahmen fest. In rund 50 Prozent der<br />
Versuche geht es darum, das Wirkungsspektrum<br />
und die Verträglichkeit von<br />
neuen, noch nicht zugelassenen Produkten<br />
zu testen. Die übrigen Versuche richten<br />
sich direkt an die landwirtschaftliche<br />
Praxis. Die Ergebnisse der Versuchsanstellungen<br />
werden z. B. im Rahmen von<br />
Feldbesichtigungen, Fachgesprächen oder<br />
großen Feldtagen vorgestellt.<br />
Gezielter Einsatz von<br />
Spezialtechnik<br />
Für die praktische Umsetzung und ordnungsgemäße<br />
Abwicklung ist der Versuchsingenieur<br />
verantwortlich, der jedoch<br />
auch <strong>auf</strong> die aktive Unterstützung durch<br />
den Betriebsleiter des landwirtschaftlichen<br />
Unternehmens, <strong>auf</strong> dessen Flächen die<br />
Versuche angelegt werden, angewiesen ist.<br />
„In Franz-Paul Karpf habe ich solch einen<br />
engagierten Partner gefunden“, so Hüfner.<br />
Mit ihm spricht Hüfner ab, welche Maßnahmen<br />
im Rahmen einer üblichen Feldbestellung<br />
vom Landwirt und dessen<br />
Technik durchgeführt werden können.<br />
Dazu gehören beispielsweise die Entnahme<br />
von Bodenproben, die komplette<br />
Düngung der Kleinparzellen oder die Ausbringung<br />
von Wachstumsreglern. Spezielle<br />
Herbizid- und Fungizideinsätze, die das<br />
Versuchsprogramm vorschreibt, erledigt<br />
Hüfner persönlich, dafür steht auch eine<br />
eigene Versuchstechnik zur Verfügung.<br />
„Zu den Spezialeinsätzen gehört z. B.<br />
die Parzellenspritze im Mai zur Getreideährenbehandlung“,<br />
erläutert Hüfner,<br />
„Fusarium oder andere Pilzinfektionen<br />
sowie die Entwicklung effektiver Bekämpfungsmaßnahmen<br />
werden zukünftig noch<br />
an Bedeutung gewinnen.“ Die Durchführung<br />
aller Versuche erfolgt grundsätzlich<br />
nach den Vorgaben der Europäischen<br />
Richtlinie für Versuchswesen. Auf dieser<br />
Basis erzielte Ergebnisse werden international<br />
anerkannt und können auch bei späteren<br />
Zulassungsverfahren herangezogen<br />
werden.<br />
Im L<strong>auf</strong>e eines Versuchsjahres kommen so<br />
eine Vielzahl von Daten zusammen, denn<br />
wie Erwin Hüfner sind noch weitere 23<br />
Versuchstechniker <strong>auf</strong> 35 Standorten in<br />
ganz Deutschland täglich unterwegs und<br />
dokumentieren mit ihren Handhelds akribisch<br />
Schädlingsbefall, Pilzinfektionen<br />
oder Unkrautdruck. Das interne Auswertungsprogramm<br />
„Scout“, mit dem die<br />
VDM-Gruppe arbeitet, hilft dabei den<br />
Überblick in diesem „Datendschungel“ zu<br />
behalten. Die Experten in der Zentrale<br />
werten die Informationen aus und bereiten<br />
sie für die Abteilungen Entwicklung und<br />
Beratung, Marketing und Vertrieb <strong>auf</strong>. Der<br />
Kreis schließt sich dann, wenn der<br />
Landwirt – vielleicht schon im nächsten<br />
Anbaujahr – ein neues Produkt von Bayer<br />
CropScience oder aktualisierte Anwendungsempfehlungen<br />
des Unternehmens<br />
nutzen kann, um seine pflanzenbaulichen<br />
Probleme in den Griff zu bekommen. ■<br />
2/05 KURIER 9
Reimport, EU-Parallelimport,<br />
Drittlandimport von<br />
Pflanzenschutzmitteln –<br />
Was ist erlaubt<br />
Rechtsanwalt Dr. Peter E. Ouart, Freiburg,<br />
beantwortet Fragen zur aktuellen Rechtslage<br />
Wann ist ein Import legal und wann ist<br />
er illegal<br />
Dr. Peter E. Ouart: Legal ist jeder Reimport,<br />
wenn es sich dabei um das in<br />
Deutschland zugelassene Originalmittel<br />
handelt. Es darf also kein Produkt als<br />
Reimport eingeführt werden, das<br />
umgefüllt oder neu etikettiert<br />
wurde. Drittlandimporte sind<br />
generell illegal, wenn kein<br />
Nachweis vorliegt, dass das<br />
Importprodukt in Deutschland<br />
über eine eigene Zulassung des BVL<br />
(= Bundesamt für Verbraucherschutz und<br />
Lebensmittelsicherheit) verfügt.<br />
EU-Parallelimporte sind nur<br />
zulässig, wenn die dargelegten<br />
Identitätskriterien<br />
vorliegen (siehe Kasten<br />
rechts, unter c) und<br />
sowohl eine gültige<br />
EU-Zulassung des Importproduktes<br />
als auch<br />
eine gültige deutsche<br />
Zulassung für ein<br />
stofflich identisches<br />
Parallelprodukt nach § 15<br />
PflSchG vorliegt.<br />
Erwarten Sie vom neuen<br />
Pflanzenschutzgesetz dazu<br />
Klarstellungen, und wann<br />
wird es Ihrer Meinung nach<br />
dazu kommen<br />
Dr. Peter E. Ouart: Eine<br />
Neufassung des Pflanzenschutzgesetzes<br />
wird die Frage<br />
von Importen – anders als bisher<br />
– sicherlich behandeln. Auch<br />
die derzeit im Entwurf befindliche<br />
Novelle sieht hierzu Regelungen vor;<br />
insbesondere ist eine amtliche Prüfung von<br />
Importprodukten in der Diskussion. Die<br />
10 KURIER 2/05
derzeit bereits im Gesetzgebungsverfahren<br />
befindliche Novelle des Pflanzenschutzgesetzes<br />
wird allerdings nicht wie vorgesehen<br />
vor dem Herbst 2005 verabschiedet<br />
werden. Es ist deshalb nicht damit zu rechnen,<br />
dass eine Novellierung des Pflanzenschutzgesetzes<br />
noch vor den vorgezogenen<br />
Bundestagswahlen erfolgen wird. Ob und<br />
mit welchem Inhalt die Novellierung nach<br />
den Neuwahlen erfolgen wird, erscheint<br />
derzeit offen.<br />
Wer haftet bei Importmitteln, z. B.<br />
wegen Minderwirkung oder Schäden,<br />
besonders dann, wenn sie in Mischungen<br />
mit in Deutschland zugelassenen Pflanzenschutzmitteln<br />
ausgebracht werden<br />
Dr. Peter E. Ouart: Für eine schlechte<br />
Wirkung oder sogar Schäden, die durch<br />
Importprodukte beim Landwirt eintreten,<br />
haftet grundsätzlich der Lieferant des<br />
Importproduktes. Häufig wird es sich<br />
dabei allerdings um eine GmbH, also eine<br />
Gesellschaft mit beschränkter Haftung,<br />
handeln, deren Kapitalausstattung zum<br />
Ersatz möglicher großflächiger Schäden<br />
beim Landwirt oder Ernteausfällen nicht<br />
ausreicht. Grundsätzlich sollte der Landwirt<br />
deshalb vorsichtig sein, von wem er<br />
Pflanzenschutzmittel erwirbt. In den letzten<br />
Jahren hat es diverse Schäden (z. B.<br />
Minderwirkung, Phytotox u. a.) bei der<br />
Anwendung von Importprodukten gegeben.<br />
Häufig können Händler und<br />
Landwirte dann beim Lieferanten keinen<br />
Rückgriff nehmen, weil dieser entweder<br />
Insolvenz anmeldet oder das Produkt aus<br />
dem Ausland geliefert hat und dort nur<br />
unter schwierigen rechtlichen Voraussetzungen<br />
haftbar gemacht werden kann.<br />
Eine Haftung des deutschen Originalherstellers<br />
ist beim Einsatz von Importprodukten<br />
grundsätzlich ausgeschlossen und<br />
zwar auch dann, wenn der Importeur <strong>auf</strong> dem<br />
Etikett des Importproduktes damit wirbt,<br />
dass das Importprodukt mit einem in<br />
Deutschland zugelassenen Originalprodukt<br />
identisch sei. Die Verantwortung für diese<br />
Aussage liegt allein beim Importeur oder<br />
seinem deutschen Vertriebsunternehmer.<br />
Mischungen mit in Deutschland zugelassenen<br />
Pflanzenschutzmitteln erfolgen<br />
ebenfalls <strong>auf</strong> eigenes Risiko, weil derartige<br />
Mischungen in aller Regel vom BVL nicht<br />
zugelassen sind und auch der Hersteller<br />
des Originalproduktes die Mischung mit<br />
Importprodukten nicht gestattet. Infolgedessen<br />
trifft die Haftung auch hier ausschließlich<br />
den Importeur bzw. Vertriebsunternehmer<br />
oder am Ende der Kette den<br />
Landwirt.<br />
Reimport, EU-Parallelimport und<br />
Drittlandimport – Was ist was<br />
a) Drittlandimport<br />
Von Drittlandimporten spricht man, wenn ein<br />
Pflanzenschutzmittel aus einem Staat nach<br />
Deutschland eingeführt wird, der nicht Mitgliedstaat<br />
der Europäischen Union oder<br />
Vertragsstaat des Abkommens über den<br />
Europäischen Wirtschaftsraum ist (Nicht<br />
EU/EWR-Staat). Solche Importprodukte sind in<br />
Deutschland nur dann verkehrsfähig, wenn Sie eine<br />
Zulassung des BVL gemäß § 15 PflSchG besitzen.<br />
Auf die Identität eines solchen Importproduktes mit<br />
einem in Deutschland bereits zugelassenen Parallelprodukt<br />
kommt es nicht an. Ein nationales Zulassungsverfahren entsprechend<br />
der EU-Richtlinie 91/414/EWG ist bei Drittlandimporten zwingend,<br />
da der Grundsatz des freien Warenverkehrs gemäß Art. 28<br />
Europäisches Gesetz <strong>auf</strong> die EU/EWR-Mitgliedstaaten<br />
beschränkt ist und nicht in Drittstaaten gilt.<br />
b) Reimport<br />
Handelt es sich bei dem eingeführten Mittel um dasselbe<br />
Mittel, welches im EU/EWR-Einfuhrmitgliedstaat bereits zugelassen<br />
ist und das zunächst exportiert und anschließend wieder<br />
in den Einfuhrmitgliedstaat (zurück) importiert wird, so liegt begrifflich ein sog. "Reimport"<br />
vor. Das Mittel muss bei seiner Wiedereinfuhr nicht erneut zugelassen werden, es ist frei<br />
verkehrsfähig.<br />
c) EU-Parallelimport<br />
Bei EU-Parallelimporten entstehen die meisten Fragen. Das liegt daran, dass der EU-<br />
Parallelimport weder vom deutschen Pflanzenschutzgesetz noch von der maßgeblichen EU-<br />
Richtlinie 91/414/EWG normativ geregelt wird. Zulässigkeit und Voraussetzungen von EU-<br />
Parallelimporten sind deshalb ausschließlich von der Rechtsprechung, insbesondere dem<br />
Europäischen Gerichtshof (EuGH) entwickelt worden. Die Rechtsprechung ist jedoch nicht einheitlich,<br />
insbesondere weicht die in Deutschland ergangene Rechtsprechung – anders als in<br />
anderen EU-Staaten – von der Rechtsprechung des EuGH teilweise ab.<br />
Von einem EU-Parallelimport spricht man, wenn ein Pflanzenschutzmittel aus einem<br />
EU/EWR-Staat nach Deutschland eingeführt wird, das stofflich identisch mit einem in<br />
Deutschland bereits zugelassenen Mittel ist. Voraussetzung für einen zulässigen EU-Parallelimport<br />
ist dabei, dass das Importprodukt selbst über eine eigene nationale Zulassung in einem<br />
anderen EU/EWR-Staat verfügt. Der EuGH hat folgende Voraussetzungen an einen zulässigen<br />
EU-Parallelimport geknüpft:<br />
(1) gültige Zulassung des Importproduktes in einem EU/EWR-Mitgliedstaat,<br />
(2) gültige Zulassung eines stofflich identischen Parallelproduktes im Einfuhrmitgliedstaat<br />
(Deutschland),<br />
(3) Herstelleridentität: Importprodukt muss insoweit den gleichen Ursprung wie das in<br />
Deutschland zugelassene Pflanzenschutzmittel haben, als es vom gleichen Unternehmen,<br />
einem verbundenen Unternehmen oder in Lizenz hergestellt wurde,<br />
(4) Formulierungsidentität: Importprodukt muss nach der gleichen Formel hergestellt<br />
worden sein wie das in Deutschland zugelassene Originalprodukt,<br />
(5) Wirkstoffidentität,<br />
(6) Wirkungsidentität: wobei etwaige Unterschiede bei den für die Anwendung des Mittels<br />
relevanten Bedingungen in Bezug <strong>auf</strong> Landwirtschaft, Pflanzenschutz und Umwelt einschließlich<br />
der Witterungsverhältnisse zu berücksichtigen sind.<br />
Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes (BGH-"Zulassungsnummer III") kann<br />
<strong>auf</strong> das Merkmal der Herstelleridentität bei Importen nach Deutschland verzichtet werden.<br />
Diese Rechtsansicht ist allerdings vom EuGH noch nicht bestätigt und in Literatur und Rechtsprechung<br />
überdies scharf kritisiert worden. Sicherheitshalber sollten deshalb alle vorgenannten<br />
Kriterien bei einem EU-Parallelimport nach Deutschland vorliegen. ■<br />
2/05 KURIER 11
Gibt es auch Patentverletzungen, also<br />
Diebstahl des geistigen Eigentums oder<br />
Markenpiraterie<br />
Dr. Peter E. Ouart: In den letzten Jahren<br />
sind bei Pflanzenschutzmittelimporten<br />
vereinzelt Patentverletzungen <strong>auf</strong>getreten.<br />
Sofern ein Importprodukt ein Patent verletzt,<br />
ist der Vertrieb eines solchen Pflanzenschutzmittels<br />
nicht nur eine Ordnungswidrigkeit<br />
nach dem Pflanzenschutzgesetz,<br />
die im Einzelfall mit einer Geldbuße<br />
bis zu 50.000,- Euro belegt ist; vielmehr<br />
handelt es sich dabei auch um strafbare<br />
Handlungen, die mit Geldstrafe oder Freiheitsstrafe<br />
geahndet werden können.<br />
Schließlich ist ein patentverletzender Import<br />
auch eine zum Schadensersatz verpflichtende<br />
Handlung, die regelmäßig sehr<br />
hohe Schadensersatzzahlungen zur Folge<br />
hat.<br />
Neben vereinzelten Patentverletzungen<br />
sind in den letzten Jahren, besonders im<br />
Zuge der EU-Erweiterung, häufig Fälschungen<br />
von Pflanzenschutzmitteln <strong>auf</strong>getaucht,<br />
die unter dem Stichwort<br />
„Markenpiraterie“ verfolgt werden. Auch<br />
dabei handelt es sich um strafbare, also kriminelle<br />
Handlungen. Die Anwendung gefälschter<br />
Importprodukte ist für Händler<br />
und Landwirte besonders gefährlich. Denn<br />
anders als bei EU-Parallelimporten handelt<br />
es sich dabei nicht um Produkte, die<br />
bereits von einer staatlichen Zulassungsbehörde<br />
in der EU <strong>auf</strong> ihre Unbedenklichkeit<br />
geprüft wurden. Vielmehr gibt es<br />
zwischenzeitlich einige Importeure und<br />
Importgesellschaften <strong>auf</strong> dem deutschen<br />
Markt, die systematisch nachgeahmte, also<br />
gefälschte Pflanzenschutzmittel in Deutschland<br />
in Verkehr bringen und diese als reguläre<br />
EU-Parallelimporte <strong>auf</strong> dem Etikett<br />
ausweisen. Das Schadensrisiko bei gefälschten<br />
Pflanzenschutzmitteln, deren<br />
Wirkung und Umweltverträglichkeit regelmäßig<br />
völlig unklar ist, ist erheblich.<br />
Welche Risiken geht der Landwirt ein,<br />
wenn er ein Importmittel einsetzt<br />
Dr. Peter E. Ouart: Seit der Novellierung<br />
des deutschen Pflanzenschutzgesetzes im<br />
Jahre 1998 geht auch der Landwirt, der ein<br />
Importmittel einsetzt, erhebliche Risiken<br />
ein. Denn die Anwendung eines nicht verkehrsfähigen<br />
Importmittels ist seit der<br />
Novellierung des Pflanzenschutzgesetzes<br />
von 1998 eine bußgeldbewehrte Ordnungswidrigkeit,<br />
die im Einzelfall mit<br />
einer Geldbuße bis zu 50.000,- Euro<br />
geahndet werden kann. Abgesehen davon,<br />
dass ein Landwirt Schäden, die durch ein<br />
unzulässiges Importprodukt entstehen,<br />
regelmäßig nicht ersetzt erhält, setzt er<br />
sich somit auch der Gefahr eines erheblichen<br />
Bußgeldes aus. Dies gilt bei<br />
jeder Einfuhr, die der Landwirt<br />
selbst vornimmt, auch für pauschalierende<br />
Landwirte, die das<br />
Produkt entweder selbst einführen<br />
oder bei einem Bezug aus<br />
dem Ausland in den Frachtunterlagen<br />
als Einführer vermerkt<br />
werden. Bereits die<br />
Einfuhr von Pflanzenschutzmitteln<br />
mit einem nicht deutschsprachigen<br />
Etikett oder ohne gültige<br />
deutsche Zulassung stellen eine<br />
solche bußgeldbewehrte Handlung dar.<br />
Handelt es sich darüber hinaus um patentverletzende<br />
oder gefälschte Produkte, so<br />
können diese eingezogen werden, ohne<br />
dass der Landwirt hierfür finanziell entschädigt<br />
wird. Aus diesem Grund ist es<br />
empfehlenswert, nur solche Pflanzenschutzmittel<br />
einzusetzen, deren Herkunft<br />
eindeutig ist und bei denen<br />
keine Zweifel im Hinblick <strong>auf</strong> ihre<br />
Zulassung bestehen. ■<br />
12 KURIER 2/05
Die Pflanze soll möglichst systemisch geschützt<br />
werden. Dazu muss der Wirkstoff in die Pflanze<br />
eindringen, um über die Transportsysteme der Pflanze<br />
an alle wichtigen Stellen zu gelangen. Mit Hilfe<br />
schwacher Radioaktivität gelingt es, den Weg des<br />
Wirkstoffs in der Pflanze zu verfolgen. Die Verteilung<br />
des Wirkstoffes in der Pflanze ist wirkstoffspezifisch.<br />
Dagegen wird der Wirkstofftransfer vom Spritztank bis<br />
zur Aufnahme in die Pflanze wesentlich von der<br />
Formulierung beeinflusst.<br />
Spritzkabine zur Messung von Sprühnebelhaftung und<br />
Verteilung von Spritzflüssigkeit als Funktion von Formulierung,<br />
Pflanze, Düsentechnik, Wasser<strong>auf</strong>wand usw.<br />
Dabei ergibt sich die große Zahl der<br />
Formuliertypen aus der Vielfalt der Wirkstoffe<br />
und der technischen, biologischen,<br />
toxikologischen und ökotoxikologischen<br />
Anforderungen an Pflanzenschutzmittel.<br />
Im Folgenden werden die heute<br />
üblichen Bedingungen bei Spritzapplikationen<br />
und die vielfältigen Einflüsse der<br />
Formulierungen <strong>auf</strong> den Wirkstofftransfer<br />
vom Spritztank <strong>auf</strong> und in die Pflanze<br />
beschrieben.<br />
Die gängigen<br />
Formuliertypen sind:<br />
• Emulgierbare Konzentrate (EC),<br />
• Emulsionen in Wasser (EW),<br />
• Wasserlösliche Konzentrate (SL),<br />
• Suspensionskonzentrate (SC),<br />
• Wasserdispergierbare Granulate (WG),<br />
• Kapselsuspensionen (CS),<br />
• Suspoemulsionen (SE),<br />
• Öldispersionen (OD)<br />
Spritzen mit einem Minimum an<br />
Wasser<br />
Teil 2: Vom Spritztank<br />
in die Pflanze – die<br />
Formulierung macht’s<br />
In der letzten Ausgabe des Kurier haben wir Ihnen die wichtigsten<br />
Formulierungen vorgestellt. Die Aufgabe der Formulierungen ist es, einen<br />
optimalen Transfer des Wirkstoffes von der Verdünnung des Produktes mit<br />
Wasser bis zur Aufnahme am Zielort zu erreichen.<br />
Die Spritzapplikation ist heute die gebräuchlichste<br />
Ausbringungsform von<br />
Pflanzenschutzmitteln. Die Anwendung<br />
der Wirkstoffe umfasst die Verdünnung des<br />
Produktes, die Applikation und Verteilung,<br />
und schließlich die Aufnahme und Verlagerung<br />
des Wirkstoffes am Zielort Pflanze.<br />
Für die Spritzapplikation wird das Produkt<br />
in Wasser oder seltener auch in Öl verdünnt<br />
und in Mengen von wenigen Litern bis zu<br />
einigen tausend Litern ausgebracht. In<br />
Mitteleuropa liegt für Getreide eine Wassermenge<br />
von 200 Liter pro Hektar im mittleren<br />
Bereich. Dies entspricht einer Wassersäule<br />
von 0,02 mm und damit einer<br />
Wassermenge, bei der man noch nicht einmal<br />
von einem echten Niederschlag sprechen<br />
kann.<br />
2/05 KURIER 13
Geringste Wirkstoffmengen im<br />
Einsatz<br />
Abhängig vom Entwicklungsstadium ist<br />
die von den Blättern gebildete Fläche häufig<br />
um ein Vielfaches größer als die Ausbringungsfläche,<br />
nach der die Spritzmenge bemessen<br />
wird. Das oben erwähnte Wasservolumen<br />
von 200 Liter pro Hektar muss<br />
deshalb oft eine zwei- bis fünfmal so große<br />
Fläche abdecken. Bei Annahme einer optimalen,<br />
gleichmäßigen Ausbringung würde<br />
das einen Wasserfilm mit einer Dicke von<br />
viel weniger als einem Hundertstelmillimeter<br />
bedeuten. Die Aufwandmengen von<br />
Wirkstoffen liegen heute im Bereich von<br />
nur wenigen bis zu mehreren hundert<br />
Gramm pro Hektar. Rein theoretisch<br />
würde ein optimal verteilter Wirkstoff bei<br />
einer Aufwandmenge von 5 g <strong>auf</strong> 3 Hektar<br />
in einer Schicht mit dem Durchmesser von<br />
einem Molekül vorliegen. Das ist natürlich<br />
nicht realisierbar, da die Spritzflüssigkeit<br />
in Tröpfchen zerlegt wird und daher nicht<br />
absolut gleichmäßig verteilt werden kann.<br />
Ein anderes Rechenbeispiel kommt der<br />
Praxis näher: Wenn alle Spritztröpfchen<br />
einen Durchmesser von 160 µm haben,<br />
wird die sehr hohe Zahl von 100 Milliarden<br />
Tropfen pro Hektar ausgebracht.<br />
Wirksamer Pflanzenschutz ist somit<br />
auch eine Frage der richtigen Verteilung.<br />
Geringe Wirkstoffmengen gleichmäßig <strong>auf</strong><br />
die zu behandelnde Fläche zu verteilen<br />
bedeutet eine extreme Herausforderung<br />
auch für die Formuliertechnik. Gleichzeitig<br />
ist der Substanzverlust zwischen<br />
Spritzdüse und Pflanze so gering wie möglich<br />
zu halten. Dabei wird die Formuliertechnik<br />
unterstützt durch die Entwicklung<br />
immer wirksamerer Substanzen und besserer<br />
Applikationstechniken.<br />
Getreide schlecht benetzbar<br />
Gut benetzbare Pflanzen wie etwa unsere<br />
Waldbäume können Niederschlagsmengen<br />
von einigen Millimetern <strong>auf</strong>nehmen, bevor<br />
es zum Abtropfen von Wasser kommt. Bei<br />
Nutzpflanzen handelt es sich dagegen oft<br />
um extrem schlecht benetzbare Pflanzen,<br />
bei denen die Anlagerung selbst kleinster<br />
Wassermengen schwierig ist. Dies gilt insbesondere<br />
für unsere Getreidearten, deren<br />
Blätter und Halme dicht mit Wachskristallen<br />
bedeckt sind. Den <strong>auf</strong>treffenden<br />
Wassertropfen wird dadurch nur wenig<br />
Kontaktfläche geboten. Die Tropfen bleiben<br />
schlecht haften und rollen leicht wieder<br />
ab. Dem selbst reinigenden Charakter<br />
mancher Pflanzen, auch Lotus-Effekt genannt,<br />
liegt eine vergleichbare Oberflächenstruktur<br />
zugrunde. Sie führt dazu,<br />
dass an den oberen Blättern der Getreidepflanzen<br />
Tropfen leicht abprallen oder abl<strong>auf</strong>en<br />
und Wasser erst an den unteren<br />
Blättern haften bleibt. Gerade bei Fungiziden<br />
ist es aber wichtig, dass die exponierten<br />
oberen Blätter wirksam behandelt werden.<br />
Denn für die Ertragsleistung ist die<br />
Gesunderhaltung der oberen drei Blattetagen<br />
von überdurchschnittlicher Bedeutung.<br />
Darüber hinaus ist das Fahnenblatt<br />
entscheidend an der Kornfüllung beteiligt.<br />
Das Abl<strong>auf</strong>en von relativ kleinen<br />
Spritztröpfchen <strong>auf</strong> der Blattoberfläche ist<br />
jedoch im höchsten Maße unerwünscht.<br />
Abhilfe schafft z. B. der Zusatz geeigneter<br />
oberflächenaktiver Stoffe, die während des<br />
kurzen Zeitraumes von der Tröpfchenbildung<br />
an der Düse bis zum Auftreffen<br />
<strong>auf</strong> das Blatt die Tropfenoberfläche mit<br />
einem dünnen fettartigen Film überziehen.<br />
Ein mit solchen oberflächenaktiven Substanzen<br />
angereicherter Tropfen benetzt das<br />
Blatt augenblicklich, und die vergrößerte<br />
Kontaktfläche verhindert das Abprallen<br />
der Tröpfchen. Es bildet sich ein Belag<br />
feinster Tröpfchen und durch weiteres<br />
Fließen (‘Spreiten’) der Tröpfchen wird der<br />
Wirkstoff zusätzlich über die Blattoberfläche<br />
verteilt und kann seine Wirkung voll<br />
entfalten.<br />
Mehr Wachs als Wirkstoff<br />
Schon die Wachsmenge <strong>auf</strong> der Oberfläche<br />
der Getreideblätter kann bis zu tausend<br />
Mal größer als die durchschnittliche Wirkstoffmenge<br />
bei einer gängigen Pflanzenschutzmaßnahme<br />
sein. Bei Weizen kann<br />
man dieses Wachs im Sommer gut als<br />
bläulichen Reif erkennen. Pro Hektar<br />
macht das Oberflächenwachs unserer<br />
Kulturpflanzen schon einige Kilogramm<br />
aus. Nach der Verdunstung des Spritzwassers<br />
ist der Wirkstoff häufig zwischen<br />
den Oberflächenwachsen eingebettet oder<br />
die Wirkstoffpartikel haften an der Wachsschicht.<br />
Ein Beispiel hierfür ist der Wirkstoff<br />
Trifloxystrobin. Er liegt bei den gängigen<br />
Formulierungen im Belag zwischen<br />
den Oberflächenwachsen vor, haftet aber<br />
auch sehr gut <strong>auf</strong> den Wachsen. Bei einigen<br />
Mitteln wie zum Beispiel bei Herbiziden<br />
mit Sulfonylharnstoffen ist schon der<br />
Mineraliengehalt des Wassers höher als die<br />
Wirkstoffmenge. Dies kann manchmal zu<br />
unerwünschten Wechselwirkungen führen.<br />
So bilden manche Herbizide mit Erdalkalimetallen<br />
(z. B. Kalzium) schwer lösliche<br />
Salze, die nur sehr schlecht <strong>auf</strong>genommen<br />
werden. Ein hoher Mineraliengehalt kann<br />
den Spritzbelag auch unspezifisch verfestigen<br />
und dadurch die Verfügbarkeit des<br />
Wirkstoffes nachteilig beeinflussen. Auch<br />
diese Faktoren müssen bei der Formulierentwicklung<br />
berücksichtigt werden.<br />
Gerste gehört zu den schwer benetzbaren Pflanzen. Rechts ein Wassertropfen, der sehr schnell abrollt und links ein Tropfen Proline mit sehr guten „spreitenden“<br />
Eigenschaften.<br />
14 KURIER 2/05
Die Formulierung macht’s<br />
möglich<br />
Das hochwirksame Fungizid Proline ®<br />
EC250 ist ein Beispiel dafür, wie mittels<br />
Formulierung eine gute Haftung des Wirkstoffes<br />
erreicht werden kann. Proline<br />
gehört der neuen Wirkstoffklasse der Triazolinthione<br />
an und wird erfolgreich gegen<br />
pilzliche Krankheitserreger in Winterraps<br />
und Getreide eingesetzt. Hier ist die<br />
Sprühnebelhaftung (Retention) wie auch<br />
das Spreiten des anhaftenden Tropfens<br />
optimal und es wird eine sehr gleichmäßige<br />
Anlagerung der Spritzflüssigkeit<br />
erreicht. Dies ergaben Messungen der<br />
Retention und Bedeckung nach Applikation<br />
mit einer Standard-Flachstrahldüse.<br />
Eine optimierte Formulierung wie Proline<br />
EC250 ergibt aber auch bei einer grobtropfigen<br />
Applikation, wie zum Beispiel bei<br />
Luftinjektordüsen, ein vergleichbares Ergebnis.<br />
Ausschlaggebend ist hierbei, dass<br />
die durch die Formulierung definierten<br />
Eigenschaften der Spritztröpfchen nahezu<br />
unabhängig von der Tropfengröße sind.<br />
Der Weg in die Pflanze<br />
Sprühnebelhaftung von Wasser und Proline<br />
Penetration (rel.)<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
<strong>auf</strong> Zuckerrübe<br />
Bei vielen Pflanzenschutzwirkstoffen handelt<br />
es sich um systemische Mittel, die aus<br />
den Spritztröpfchen, aber auch aus dem<br />
Spritzbelag in die Pflanze <strong>auf</strong>genommen<br />
werden müssen, um ihre Wirkung bestmöglich<br />
zu entfalten. Je nach den physikalisch-chemischen<br />
Eigenschaften des Wirkstoffes<br />
und der Indikation ist eine ganz<br />
bestimmte Aufnahmegeschwindigkeit<br />
optimal, die wiederum mit Hilfe der<br />
Formulierung eingestellt werden kann. So<br />
kann die Formulierung Zusatzstoffe enthalten,<br />
die eine ausreichende Wirkstoff<strong>auf</strong>nahme<br />
innerhalb weniger Stunden ermöglicht.<br />
Dies ist vorteilhaft für eine verbesserte<br />
Regenfestigkeit, optimale kurative<br />
Wirkung oder auch zum Schutz vor<br />
photochemischem Abbau von Wirkstoffen.<br />
Wird ein Wirkstoff jedoch schnell in der<br />
Pflanze abgebaut und damit inaktiv, oder<br />
handelt es sich um ein reines Belagsmittel,<br />
gilt es durch Wahl des geeigneten Formuliertyps<br />
sowie neutraler Formulierbestandteile<br />
die Aufnahme des Wirkstoffes<br />
in die Pflanze zu unterdrücken.<br />
Formulierung für systemische<br />
Wirkung<br />
Bei Produkten mit mehreren systemischen<br />
Wirkstoffen muss die Formulierung die<br />
Aufnahme beider Substanzen in die Pflanze<br />
ermöglichen. Ein gutes Beispiel hierfür ist<br />
das Fungizid Fandango ® , das erfolgreich<br />
in Gerste, Roggen und Triticale eingesetzt<br />
wird. In Fandango sind die beiden Wirkstoffe<br />
Prothioconazole und Fluoxastrobin<br />
kombiniert. Die Formulierung ist dabei so<br />
optimiert, dass Unterschiede bei der verwendeten<br />
Wassermenge, der Applikationstechnik,<br />
der Temperatur oder Luftfeuchte<br />
das Aufnahmeergebnis vernachlässigbar<br />
gering beeinflussen.<br />
<strong>auf</strong> Gerste<br />
0<br />
Wasser Wasser Proline EC250<br />
Sprühnebelhaftung von Wasser <strong>auf</strong> gut benetzbaren Pflanzen wie Zuckerrübe oder Apfel sowie von Proline EC250 <strong>auf</strong><br />
Gerste. Auf Gerste haftet nur ein optimiertes Produkt gut.<br />
Die dargestellten Beispiele zeigen, dass<br />
die Formulierungen gerade auch bei<br />
Spritzapplikationen einen wesentlichen<br />
Einfluss <strong>auf</strong> den Behandlungserfolg haben.<br />
Das Ziel der Formuliertechnik ist es dabei,<br />
den Gesamtprozess im Zusammenspiel mit<br />
der Applikationstechnik und den praxisüblichen<br />
Bedingungen zu optimieren.<br />
Ausblick<br />
Unter den sich ständig erhöhenden Anforderungen<br />
des modernen Pflanzenschutzes<br />
werden immer neue und weiter optimierte<br />
Varianten bekannter Formuliertypen sowie<br />
neue Konzepte erforderlich sein. Diesen<br />
Aufgaben stellt sich die Formuliertechnik<br />
von Bayer CropScience, die sich zu einer<br />
interdisziplinären, naturwissenschaftlichen<br />
Disziplin mit den Fächern Kolloidchemie<br />
und Grenzflächenphysik entwickelt hat, in<br />
der auch die Technische Chemie eine wesentliche<br />
Rolle spielt. Eine optimale Formulierung<br />
der Wirkstoffe wird für den Erfolg<br />
eines Präparates im Markt von entscheidender<br />
Bedeutung bleiben. ■<br />
In der letzten Ausgabe 1/05 des Kurier wurden die<br />
Formuliertypen ausführlich vorgestellt. Der Artikel<br />
kann nachgelesen werden im Internet unter<br />
www.agrokurier.com.<br />
Blattwachs<br />
(unbehandelt)<br />
Belag der<br />
Formulierung<br />
Trifloxystrobinkristalle<br />
Zeitverl<strong>auf</strong> der Blattpenetration von Prothioconazole<br />
und Fluoxastrobin<br />
40<br />
30<br />
25 ºC, 60 % relative Luftfeuchtigkeit<br />
Prothioconazole<br />
in Fandango<br />
Penetration (%)<br />
20<br />
10<br />
Prothioconazole<br />
nicht formuliert<br />
Fluoxastrobin<br />
in Fandango<br />
Fluoxastrobin<br />
nicht formuliert<br />
0 12 24 36 48 60 72<br />
Zeit (Stunden)<br />
Belag einer EC-Formulierung von Trifloxystrobin und einem Azol <strong>auf</strong> der Unterseite<br />
von Weizenblättern. Bei starker Vergrößerung im Rasterelektronenmikroskop<br />
erkennt man den guten Kontakt zur Blattoberfläche und einzelne Trifloxystrobinkristalle.<br />
Das Insert zeigt den homogenen Belag innerhalb eines Tröpfchens.<br />
Zeitverl<strong>auf</strong> bis drei Tage nach Applikation (t = 0) aus einer Fandango EC Formulierung<br />
im Vergleich zu nicht formulierten Wirkstoffen. Beide Wirkstoffe penetrieren<br />
auch aus dem Spritzbelag mit Fandango über einen Zeitraum von Tagen mit nahezu<br />
konstanter Geschwindigkeit um ein Vielfaches schneller.<br />
2/05 KURIER 15
Eine Maßnahme, die sich<br />
Getreideherbizide im<br />
Die Konkurrenz durch Ungräser<br />
und Unkräuter sollte<br />
möglichst frühzeitig beseitigt<br />
werden. Dieser Grundsatz hat<br />
weiterhin Bedeutung. Daher<br />
werden im Herbst bereits potente<br />
Herbizidpräparate eingesetzt,<br />
in der Hoffnung, keine<br />
Behandlungen im Frühjahr<br />
nachlegen zu müssen.<br />
Auf den ertragreichen Standorten<br />
bleibt eine gezielte frühe<br />
Nach<strong>auf</strong>l<strong>auf</strong>anwendung in den<br />
beginnenden Aufl<strong>auf</strong> der Unkräuter<br />
nach wie vor das beste<br />
Verfahren zur Unkrautbekämpfung.<br />
Besonders die gezielten<br />
Herbstbehandlungen bei Saatterminen<br />
bis Mitte Oktober<br />
sind meist wirkungssicherer als<br />
vergleichbare Frühjahrsbehandlungen.<br />
Die Wirkungssicherheit<br />
steigt, je stärker die Bodenfeuchtigkeit<br />
ausgenutzt werden<br />
kann. Die Anwendung sollte<br />
daher so früh wie möglich<br />
(BBCH 11) erfolgen, also<br />
sobald die Fahrgassen zu erkennen<br />
sind. Neben arbeitswirtschaftlichen<br />
Vorteilen (Arbeitsspitzen<br />
verteilt) sind auch<br />
weitere Vorteile zu nennen.<br />
Behandlungen im Herbst ermöglichen<br />
meist eine bessere<br />
Verträglichkeit. Auch kann gegenüber<br />
dem Frühjahr, neben<br />
einer geringeren Nachtfrostgefahr,<br />
auch eine meistens höhere<br />
Boden- und Luftfeuchtigkeit<br />
ausgenutzt werden.<br />
Gewässerabstandsregelungen<br />
beachten<br />
Entlang von Feldrändern<br />
mit „ständig oder periodisch“<br />
wasserführenden Gewässern<br />
gelten besondere Abstandsregelungen.<br />
Periodisch wasserführende<br />
Gewässer sind daran zu<br />
erkennen, dass auch bei trockengefallenen<br />
Gräben eine unbewachsene<br />
oder mit Wasser-<br />
16 KURIER 2/05
immer lohnt –<br />
Herbst Dr. Dirk M. Wolber, Landwirtschaftskammer Hannover<br />
pflanzen bewachsene Grabensohle<br />
vorhanden ist. Wachsen<br />
dagegen z. B. Gras oder Brennnesseln,<br />
greift die Abstands<strong>auf</strong>lage<br />
nicht. Die in den letzten<br />
Jahren vorgestellten reduzierten<br />
Abstände bei abtriftmindernder<br />
Technik finden<br />
sich bei Zulassung von<br />
Atlantis ® WG, Boxer ® , Ciral ® ,<br />
Lexus ® , Pointer ® und neuerdings<br />
auch bei Tolkan ® Flo,<br />
Herbaflex ® und Fenikan ® Anwendung.<br />
Andere Getreideherbizide<br />
haben noch keine variablen<br />
Abstands<strong>auf</strong>lagen: Hier<br />
gelten die bisherigen Regelabstands<strong>auf</strong>lagen.<br />
Eine spezielle<br />
Gewässerrandvariante muss<br />
daher in der kommenden Saison<br />
sicherlich kaum noch explizit<br />
beschrieben werden, da die<br />
meisten Anwendungen auch<br />
nahe den Gewässern empfohlen<br />
werden können. Allerdings<br />
nur bei Anwendung der abtriftmindernden<br />
Technik und unter<br />
Beachtung der länderspezifischen<br />
Bestimmungen.<br />
Eine Ackerfuchsschwanzbekämpfung<br />
muss bereits durch<br />
Behandlungen im Herbst sicher<br />
sein. Wirkungsgrade von 85-<br />
90 % sind nicht befriedigend<br />
und erhöhen nur unnötig die<br />
Resistenzneigung des Standortes,<br />
vor allem wenn <strong>auf</strong>grund<br />
unzureichender Herbstbehandlungen<br />
mit den gleichen<br />
Wirkstoffgruppen im Frühjahr<br />
wiederholt behandelt wird.<br />
Empfehlungen gegen<br />
Windhalm<br />
IPU-Neuzulassungen haben im<br />
letzten Jahr deutlich verbesserte<br />
Abstand<strong>auf</strong>lagen zu Gewässern<br />
erhalten, jedoch sind die ausgesprochenen<br />
Anwendungsbestimmungen<br />
weiterhin so gravierend<br />
und entsprechend bußgeldbewährt,<br />
dass IPU-haltige<br />
Präparate nur noch <strong>auf</strong> einem<br />
Teil der Flächen im Frühjahr<br />
eingesetzt werden dürfen.<br />
Ausgeschlossen ist eine<br />
Anwendung von IPU <strong>auf</strong>:<br />
• drainierten Flächen vom<br />
31. Mai – 1. März,<br />
• <strong>auf</strong> Sandböden mit weniger<br />
als 1,75 % Humus und<br />
• <strong>auf</strong> Standorten mit einem<br />
Tonanteil von mehr als 30 %.<br />
Kombinationen von Fenikan<br />
solo oder Fenikan plus IPU<br />
oder plus Cadou ® 0,2 kg/ha erreichen<br />
bei einer ausreichenden<br />
Bodenfeuchtigkeit eine breite<br />
Wirkung gegen z. B. Windhalm,<br />
Jährige Rispe, Kamille,<br />
Vergissmeinnicht, Ausfallraps,<br />
Stiefmütterchen, Hohlzahn,<br />
Mohn, Taubnessel und Vogelmiere.<br />
IPU ist recht sicher<br />
gegen Kamille und schließt<br />
auch bei Kombinationspräparaten<br />
wie Fenikan mögliche<br />
Wirkungslücken. Fenikan ermöglicht<br />
sogar eine Bekämpfung<br />
der schwer erfassbaren<br />
Kornblume.<br />
Wenn IPU-freie Behandlungen<br />
gefordert sind, können<br />
in allen Wintergetreidearten<br />
gegen Windhalm gleichermaßen<br />
Cadou 0,15-0,2 kg/ha plus<br />
Bacara ® 0,5-0,6 l/ha oder auch<br />
Bacara alleine, dann aber mit<br />
0,8-1,0 l/ha oder Malibu ® EC<br />
sowie Herold ® zum Einsatz<br />
kommen. Bacara ermöglicht<br />
aber gegenüber Herold oder<br />
Malibu meist eine etwas bessere<br />
Wirkung gegen Kamille.<br />
Abb. 1: Bekämpfung von Windhalm & Unkräutern im Herbst<br />
Leistungsvergleich von Bacara und Herold<br />
% Wirkung<br />
100<br />
90<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
Vogelmiere (8)<br />
A.-Stiefmütterchen (9)<br />
K.-Mohn (1)<br />
E.-Ehrenpreis (6)<br />
R.-Taubnessel (3)<br />
A.-Raps (4)<br />
E.-Kamille (9)<br />
Abb. 2: Bekämpfung von Windhalm & Unkräutern im Herbst<br />
Leistungsvergleich von Fenikan und Herold<br />
% Wirkung<br />
100<br />
90<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
Vogelmiere (8)<br />
A.-Stiefmütterchen (9)<br />
E.-Ehrenpreis (6)<br />
R.-Taubnessel (3)<br />
E.-Kamille (9)<br />
Kornblume (1)<br />
A.-Raps (4)<br />
K.-Mohn (1)<br />
Klettenlabkraut (8)<br />
Klettenlabkraut (8)<br />
Das Wirkungsprofil gegen<br />
dikotyle Unkräuter wird in den<br />
Abbildungen 1 und 2 anschaulich<br />
dargestellt.<br />
Empfehlungen gegen<br />
Ackerfuchsschwanz<br />
Bundesweite Vergleiche der<br />
Firma Bayer CropScience zeigten<br />
im Herbst 2003 für Atlantis<br />
WG gute bis sehr gute Wirkungen<br />
gegen Ackerfuchsschwanz.<br />
Die Wirkungen schwankten bei<br />
300 g/ha plus 0,6 l/ha FHS nur<br />
minimal.<br />
Auch der bundesweite Vergleich<br />
praxisüblicher Mischungen<br />
im Herbst 2003 zeigte,<br />
dass Atlantis WG plus Bacara<br />
oder auch Atlantis WG plus<br />
Einsatz zu BBCH 10-11<br />
des Winterweizens,<br />
14 Versuche,<br />
Deutschland Herbst 2003,<br />
Endbonitur<br />
Bacara 1 l/ha<br />
Herold 0,3 kg/ha<br />
Einsatz zu BBCH 10-11<br />
des Winterweizens,<br />
14 Versuche,<br />
Deutschland Herbst 2003,<br />
Endbonitur<br />
Fenikan 2 l/ha<br />
Herold 0,3 kg/ha<br />
2/05 KURIER 17
Abb. 3: Bekämpfung gegen Ackerfuchsschwanz – Atlantis WG + Partner im Herbst<br />
% Wirkung<br />
100<br />
90<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
Fenikan 2,0 l/ha Herold 06 kg/ha Lexus 20 g/ha Bacara 0,75 l/ha Fenikan 2,0 l/ha<br />
+ Tolkan Flo 0,5 l/ha + Stomp 2,0 l/ha Atlantis 0,3 kg/ha Atlantis 0,3 kg/ha<br />
+ 0,6 l/ha FHS + 0,6 l/ha FHS<br />
Abb. 4: Bekämpfung von Tauber Trespe – Empfehlungen im Vergleich<br />
% Wirkung<br />
100<br />
90<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
Fenikan dem Standard zur<br />
Ackerfuchsschwanzbekämpfung<br />
(Lexus plus Stomp ® )<br />
nicht nachstehen. Auf den<br />
Standorten, die aber bereits<br />
Resistenzen gegen Lexus zeigen,<br />
ist die Behandlung mit<br />
Atlantis WG plus Partner und<br />
FHS zukünftig eine „Pflichtübung“.<br />
(Abb. 3)<br />
Blattwirksame Präparate wie<br />
Ralon ® Super, Topik ® oder<br />
Atlantis WG benötigen allerdings<br />
einen ausreichend <strong>auf</strong>gel<strong>auf</strong>enen<br />
Ackerfuchsschwanz<br />
und mindestens 14 Tage Restvegetation,<br />
um eine Wirkungsentfaltung<br />
vor Vegetationsende<br />
zu ermöglichen.<br />
Atlantis WG wird mit einem<br />
Zusatzstoff angeboten. Damit<br />
die Wirkung auch gegen breitblättrige<br />
Unkräuter ausreicht,<br />
wird ein Zusatz von Bacara<br />
0,6-0,7 l/ha notwendig.<br />
Diese Kombination ist etwas<br />
teurer als z. B. Lexus plus<br />
Stomp, allerdings ermöglicht<br />
Bacara im Vergleich zu Stomp<br />
eine etwas breitere Wirkung,<br />
z. B. gegen Ehrenpreis und Kamille<br />
oder im Vergleich zu<br />
Herold gegenüber z. B. Kamille.<br />
Der letztere Vergleich<br />
war im Herbst 2004 <strong>auf</strong> Praxisflächen<br />
häufiger anzutreffen.<br />
Bei einem stärkeren Ackerfuchsschwanzbesatz<br />
kann zunächst<br />
eine Vorlage von z. B.<br />
Cadou 0,4 kg/ha plus Bacara<br />
0,7 l/ha zur Anwendung kommen.<br />
Nach Aufl<strong>auf</strong>en des<br />
Ackerfuchsschwanzes wird<br />
Atlantis WG mit 0,3 kg/ha plus<br />
FHS 0,6 l/ha verwendet. Diese<br />
Nachlage kann bei Saatterminen<br />
nach Mitte Oktober auch<br />
im Frühjahr erfolgen. Auch<br />
sollten Anwendungen von<br />
Atlantis WG im Herbst unterbleiben,<br />
wenn das Vegetationsende<br />
bereits naht oder noch<br />
nicht genügend Blattmasse des<br />
Ackerfuchsschwanzes zu finden<br />
ist.<br />
Gerste wird durch Ackerfuchsschwanz<br />
meistens nicht<br />
so stark geschädigt wie Winterweizen.<br />
Wenn Ackerfuchsschwanz<br />
in Gerste mit maximal<br />
einer mittleren Dichte <strong>auf</strong>tritt,<br />
können Cadou 0,4 kg/ha plus<br />
Bacara 0,6-0,8 l/ha oder Malibu,<br />
Herold bzw. Fenikan 2,5 l/ha<br />
Einsatz zu<br />
BBCH 12-13<br />
des Weizens,<br />
A.-Fuchsschwanz<br />
ist <strong>auf</strong>gel<strong>auf</strong>en,<br />
7 Versuche,<br />
Deutschland<br />
Herbst 2003,<br />
Bonitur<br />
Ährenzählung<br />
Einsatz zu BBCH 12-13<br />
(A = NAH),<br />
zu BBCH 25-27 (B = NAF)<br />
bzw. 7 (-10) Tage<br />
nach Termin B (C = NAF)<br />
des Winterweizens,<br />
7 Versuche,<br />
Deutschland 2003/2004,<br />
Bonitur nach dem<br />
Rispenschieben<br />
A A+B B B+C Termin<br />
Atlantis WG 0,3 kg/ha NAH: Atlantis WG 0,3 kg/ha Attribut 0,1 kg/ha B: Attribut 0,06 kg/ha<br />
+ AHL 50 l/ha + AHL 50 l/ha + Frigate 0,5 l/ha + Frigate 0,5 l/ha<br />
NAF: Attribut 0,06 kg/ha<br />
C: Attribut 0,04 kg/ha NAH = Nach<strong>auf</strong>l<strong>auf</strong> Herbst<br />
+ Frigate 0,5 l/ha + Frigate 0,5 l/ha NAF = Nach<strong>auf</strong>l<strong>auf</strong> Frühjahr<br />
plus IPU eine ausreichende<br />
Ackerfuchsschwanzbekämpfung<br />
ermöglichen.<br />
Empfehlungen gegen<br />
Trespe<br />
Auf mehrjährig pfluglos bewirtschafteten<br />
Flächen werden<br />
oft Trespenarten, vor allem die<br />
Taube Trespe selektiert. Für<br />
einen erfolgreichen Winterweizenanbau<br />
ist daher auch<br />
eine sichere Bekämpfung der<br />
Trespe erforderlich. Neben den<br />
ackerbaulichen Möglichkeiten<br />
bei der Stoppelbearbeitung und<br />
dem Einsatz von Glyphosaten<br />
zur Aussaat gibt es mittlerweile<br />
drei Herbizide mit einer<br />
Zulassung zur Trespenbekämpfung.<br />
Die Trespe reagiert<br />
am empfindlichsten bis zum<br />
Beginn der Bestockung<br />
und zu Beginn<br />
des Schossens.<br />
In den Versuchen<br />
der LWK Hannover<br />
war der Bekämpfungserfolg<br />
bei Attribut ® und<br />
Monitor ® im Frühjahr<br />
tendenziell am sicher-<br />
Ihr Ansprechpartner:<br />
Achim Zöllkau,<br />
Produktmanager<br />
Getreideherbizide,<br />
Bayer CropScience<br />
Deutschland GmbH<br />
www.bayercropscience.de<br />
achim.zoellkau@<br />
bayercropscience.com<br />
Telefon: 02173/2076-273<br />
sten, aber auch Atlantis WG<br />
zeigten zufrieden stellende<br />
Erfolge. Die Kombination von<br />
Atlantis WG im Herbst und<br />
Attribut im Frühjahr präsentierte<br />
sich in sieben bundesweit<br />
angelegten Versuchen in 2003<br />
als sehr wirkungssicher. (Abb. 4)<br />
Bei dem Einsatz der genannten<br />
Herbizide ist zu berücksichtigen,<br />
dass Atlantis WG und<br />
Monitor vorwiegend über das<br />
Blatt und Attribut über den<br />
Boden wirkt.<br />
Auf Standorten mit zusätzlichem<br />
Ackerfuchsschwanzbesatz<br />
ist Attribut oder Atlantis<br />
WG zu bevorzugen. In Triticale<br />
besitzen Attribut und Monitor<br />
eine Zulassung zur Trespenbekämpfung.<br />
Zusammenfassung<br />
Die frühe Nach<strong>auf</strong>l<strong>auf</strong>behandlung<br />
hat gegenüber Frühjahrsbehandlungen<br />
von Ackerfuchsschwanz<br />
und Windhalm deutliche<br />
Vorteile. Spät bestellte<br />
Weizensaaten mit einem nur<br />
geringen Ungrasbesatz können<br />
allerdings auch im Frühjahr wirkungssicher<br />
behandelt werden.<br />
Atlantis WG setzt zur<br />
Bekämpfung des Ackerfuchsschwanzes<br />
neue Maßstäbe und<br />
darf in keinem Pflanzenschutzmittellager<br />
fehlen.<br />
Kombinationen von Atlantis<br />
WG plus Bacara oder Fenikan<br />
ermöglichen zusätzlich eine<br />
breite Wirkung gegen dikotyle<br />
Unkräuter.<br />
Netzmittel bewirken beim<br />
Herbizideinsatz einen Zusatzeffekt<br />
besonders unter trockeneren<br />
Bedingungen, Schädigungen<br />
der Kultur sind dagegen<br />
unter feuchten Bedingungen<br />
möglich. ■<br />
® = Registrierte Marken der Hersteller<br />
18 KURIER 2/05
Mit Poncho und Contur Plus gegen<br />
die Kleine Kohlfliege im Raps<br />
Durch Fraß geschädigte<br />
Wurzeln<br />
Dr. Wenzel Gehlen, Entwicklungs- und Beratungsmanager<br />
Bayer CropScience Deutschland<br />
Ist die Kleine Kohlfliege (Delia radicum) bekämpfbar<br />
Bislang galt der Rapserdfloh (Psylliodes chrysocephala)<br />
als der dominierende Rapsschädling, der sich<br />
im Herbst an den noch jungen Pflanzen zu schaffen<br />
macht. Ihn mussten die Landwirte beachten, um Frühschäden<br />
zu vermeiden. Doch nun schickt sich die<br />
Kleine Kohlfliege an, dem Rapserdfloh Konkurrenz<br />
zu machen. In Nord- und Ostdeutschland ist bereits<br />
Wirkung der Beizen Chinook und Poncho + Contur Plus<br />
gegen die Kleine Kohlfliege an Winterraps – 2004/2005 – Sorte: Talent<br />
% stark befallene Wurzel<br />
50<br />
45<br />
40<br />
35<br />
30<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
39<br />
30<br />
Unbehandelt Chinook Poncho + Contur Plus<br />
6<br />
Wurzelschaden,<br />
verursacht<br />
durch die<br />
Made der<br />
Kleinen<br />
Kohlfliege,<br />
5 Standorte<br />
in Deutschland,<br />
Boniturtermin:<br />
Oktober/<br />
November<br />
ein solch starkes Auftreten beobachtet<br />
worden, dass eine Bekämpfung<br />
anzuraten ist. Im west- und süddeutschen<br />
Raum ist der Befall<br />
zur Zeit weniger stark.<br />
Die Kleine Kohlfliege<br />
bildet drei Generationen im<br />
Jahr. Die dritte Generation<br />
erscheint im September/Oktober.<br />
Wenige Tage nach der Eiablage,<br />
am Wurzelhals der jungen Rapspflanze,<br />
schlüpfen die Maden und<br />
beginnen mit dem Fraß an der Wurzel.<br />
Dieser Fraß kann im Extremfall bis zum vollständigen<br />
Verlust der Wurzeln führen.<br />
In zahlreichen Versuchen der letzten Jahre hat sich<br />
die Saatgutbehandlung aus einer Kombination der<br />
Wirkstoffe Clothianidin (Poncho ® ) und Betacyfluthrin<br />
(Contur ® Plus) als sehr gut wirksam gegen die Kleine<br />
Kohlfliege gezeigt. Erstmals werden nun in diesem<br />
Jahr zur Aussaat auch Rapssorten angeboten, die mit<br />
diesen Produkten behandelt worden sind.<br />
Die Grafik zeigt die Wirkung von Poncho und<br />
Contur Plus <strong>auf</strong> die befallenen Wurzeln. Der Anteil<br />
stark befallener und somit stark geschädigter Wurzeln<br />
geht deutlich zurück: von 39 % in der unbehandelten<br />
Kontrolle <strong>auf</strong> 6 % durch die Saatgutbehandlung mit<br />
Poncho + Contur Plus.<br />
Im Vergleich zum bisherigen Standard bietet der<br />
Einsatz von Poncho und Contur Plus folgende<br />
Vorteile:<br />
• Wirkung gegen die Kleine Kohlfliege,<br />
• Verstärkter und verlängerter Schutz gegen den<br />
Rapserdfloh,<br />
• Gute Blattlauswirkung und reduzierter Virusbefall,<br />
• Wirkung gegen andere beißende und saugende<br />
Vorwinterschädlinge,<br />
• Erweiterung des Aussaatfensters,<br />
• Gesteigerte Vitalität und verbesserte Überwinterungsleistung,<br />
• Verminderter sekundärer Pilzbefall durch einen<br />
geringeren Schädlingsbefall. ■<br />
Ihre Ansprechpartnerin:<br />
Dr. Susanne Kretschmann,<br />
Produktmanagerin<br />
Insektizide Beizen und Insektizide<br />
Ackerbau,<br />
Bayer CropScience<br />
Deutschland GmbH<br />
www.bayercropscience.de<br />
susanne.kretschmann@<br />
bayercropscience.com<br />
Telefon: 02173/2076-280<br />
2/05 KURIER 19
Dem Kornkäfer beim Fressen zusehen und zuhören.<br />
„Food for Life! Die<br />
Erlebniswelt <strong>auf</strong> Rädern unterwegs in Nordrhein-<br />
Westfalen – bereits jetzt mehr als 25.000 Besucher<br />
Wie gesund sind unsere Lebensmittel<br />
Diese Frage bewegt viele Verbraucher.<br />
Besonders kritisch hinterfragt werden<br />
moderne Agrartechniken, vor allem der<br />
Einsatz von Pflanzenschutzmitteln in der<br />
konventionellen Landwirtschaft. Das hat<br />
die im Industrieverband Agrar e.V. (IVA)<br />
zusammengeschlossenen Hersteller von<br />
Pflanzenschutzmitteln veranlasst, nach<br />
einem Weg zu suchen, mit Verbrauchern<br />
ins Gespräch zu kommen. Entstanden ist<br />
daraus die mobile Erlebniswelt „Food for<br />
Life! Die Früchte der Erde“ (www.foodfor-life-nrw.de).<br />
Der 20 Meter lange Truck tourt noch bis<br />
Ende September durch 13 Städte in<br />
Nordrhein-Westfalen. In seinem Inneren<br />
kann sich der Besucher über die Geschichte<br />
unserer Ernährung informieren,<br />
über die Gefährdung der Nahrungspflanzen<br />
durch Krankheiten, Schädlinge und<br />
Unkrautkonkurrenz sowie über unliebsame<br />
„Mitesser“ in Getreidelagern.<br />
20 KURIER 2/05
Der „Esstisch über die Jahrhunderte“<br />
zeigt die Geschichte der Ernährung.<br />
Frisches Obst und Gemüse stehen uns heute in Hülle und Fülle zur Verfügung.<br />
Früchte der Erde“<br />
Denn sichere Ernten sind keine Selbstverständlichkeit<br />
und kein Geschenk der<br />
Natur. Früher war es mühsame Handarbeit,<br />
Schädlingen und Unkraut Paroli zu bieten.<br />
Missernten und Hungersnöte waren eine<br />
ständige Bedrohung. Erst vor 100<br />
Jahren hat die Wissenschaft begonnen,<br />
die Ursachen von Pflanzenkrankheiten<br />
und Schädlingsbefall zu<br />
erforschen und nach wirksamen<br />
Gegenmitteln zu suchen. Heute hilft<br />
moderner Pflanzenschutz Ernteverluste<br />
zu vermeiden und preiswerte<br />
Lebensmittel in hoher Qualität zu erzeugen.<br />
Die gute Versorgung hat verschiedene<br />
Gründe. Es sind dies vor allem moderne<br />
Produktionsverfahren, die die Leistung der<br />
deutschen Landwirtschaft enorm gesteigert<br />
haben. Dazu gehören neben Pflanzenzüchtung<br />
und moderner Maschinentechnik<br />
eben auch Düngung und Pflanzenschutz.<br />
Heute sind wir es gewöhnt, dass Obst und<br />
Gemüse frei von Schädlingen und Krankheiten<br />
und damit ansprechend und appetitlich<br />
ist. Gesunde Früchte von gesunden<br />
Pflanzen können außerdem wichtige Inhaltsstoffe<br />
besser ausbilden. Zudem sind sie<br />
haltbarer und besser transportfähig, können<br />
also über große Entfernungen gehandelt<br />
werden.<br />
Die Wissenschaft ist sich heute einig,<br />
dass Obst und Gemüse eine herausragende<br />
Rolle <strong>auf</strong> dem Speisezettel spielen sollen.<br />
400 Gramm pro Tag empfiehlt die Welternährungsorganisation,<br />
650 Gramm, d.h.<br />
fünf Portionen Obst und Gemüse über den<br />
Tag verteilt, die Deutsche Gesellschaft für<br />
Ernährung (DGE). Dann erhält der Körper<br />
ausreichend Ballaststoffe, Vitamine,<br />
Mineralstoffe und vor allem sekundäre<br />
Pflanzenstoffe, deren Bedeutung erst in<br />
den letzten Jahren erkannt wurde. ■<br />
Kulturpflanzen brauchen Pflege<br />
und Schutz<br />
Derzeit geben die Deutschen durchschnittlich<br />
zwölf Prozent ihres Einkommens für<br />
Lebensmittel aus. Preiswerte Grundnahrungsmittel,<br />
hochwertige Spezialitäten,<br />
schmackhafte Fertigprodukte für die<br />
schnelle Küche und insbesondere frisches<br />
Obst und Gemüse rund ums Jahr – alles<br />
gibt es in enormer Vielfalt und für jeden<br />
Geldbeutel. Jeder kann sich hierzulande<br />
gesund ernähren, wenn er es möchte.<br />
Die „Food for Life“-Aktion des Industrieverband Agrar e.V. stößt <strong>auf</strong> großes Interesse bei den Verbrauchern.<br />
Überall, wo der Truck Station macht, bilden sich lange Schlangen. Beeindruckt vom Informationsangebot<br />
zeigen sich Kinder wie Erwachsene gleichermaßen.<br />
2/05 KURIER 21
Weizenstandort<br />
Deutschland<br />
Profil der Erzeugung und Verarbeitung<br />
Mechthilde Becker-Weigel, wirtschaftsdienst agrar, Köln<br />
Die stärkste Frucht im deutschen<br />
Getreideanbau ist der Weizen. Im<br />
nachgelagerten Bereich des<br />
Weizenanbaus stehen starke<br />
Erfasser und Verarbeiter. Regionale<br />
Unterschiede und Konzentrationen<br />
bestimmen das Bild der Branche.<br />
Die Europäische Gemeinschaft ist weltweit<br />
der größte Weizenerzeuger. Auf 126,8<br />
Mio. t wird die diesjährige Weizenernte<br />
geschätzt – ein Fünftel der gesamten Weltweizenernte<br />
von erwarteten 612,4 Mio. t.<br />
Innerhalb der EU steht Deutschland an<br />
zweiter Stelle der großen Weizenanbauer<br />
hinter Frankreich und vor dem Vereinigten<br />
Königreich und Polen.<br />
Stellung des Weizens im<br />
Getreideanbau<br />
Der Getreideanbau nimmt in Deutschland<br />
mehr als die Hälfte der Ackerfläche ein.<br />
2004 waren es 6,9 Mio. ha, also 58,38 %<br />
der gesamten Ackerfläche von 11,9 Mio.<br />
ha. Beim Getreideanbau steht der Weizen<br />
an erster Stelle – vor Gerste, Mais, Roggen<br />
und Triticale. Im vergangenen Jahr erlebte<br />
der Weizenanbau in Deutschland mit einer<br />
Fläche von 3,1 Mio. ha einen Rekord und<br />
baute seine Stellung als führende Marktfrucht<br />
weiter aus. Damit waren gut ein<br />
Viertel, nämlich 26,15 % der Ackerflächen,<br />
mit Weizen bestellt. Mitentscheidend<br />
für die Ausdehnung des Winterweizenanbaus<br />
im vergangenen Jahr war<br />
auch die Reduzierung der obligatorischen<br />
Flächenstilllegung von 10 <strong>auf</strong> 5 %.<br />
22 KURIER 2/05
Die 6 großen Weizenerzeuger Ernte 2005/06 Weltweizenerzeugung; Schätzung Ernte 2005/06<br />
China 22 %<br />
Indien 18 %<br />
USA 14 %<br />
Russland 11 %<br />
Australien 5 %<br />
Europäische Union 30 %<br />
Weizenerzeugung weltweit 612,4 Mio. t<br />
Europäische Union 126,8<br />
China 93,0<br />
Indien 73,5<br />
USA 58,2<br />
Russland 47,0<br />
Australien 21,5<br />
Rund 70 % der Weltweizenernte (420 Mio. t) teilen die 6 großen Erzeugernationen unter sich <strong>auf</strong>. Die EU belegt mit einem Anteil von 30 % unangefochten die Spitzenposition.<br />
Die „Big Five“ im deutschen<br />
Weizenanbau<br />
Das größte Weizenareal unter den Bundesländern<br />
weist Bayern mit 481.240 ha <strong>auf</strong>.<br />
Es folgen Niedersachsen (415.807 ha),<br />
Mecklenburg-Vorpommern (337.134 ha),<br />
Sachsen-Anhalt (335.243 ha) und Nordrhein-Westfalen<br />
(266.028 ha).<br />
Die Weizenanb<strong>auf</strong>lächen stiegen in den<br />
vergangenen fünf Jahren in nahezu allen<br />
Bundesländern um rund 20 %. Niedersachsen<br />
verzeichnete dabei den größten<br />
Zuwachs mit einem Plus von gut 27 %,<br />
was einem Flächenzuwachs von 115.567 ha<br />
entspricht. Das Ertragsniveau bei Getreide<br />
weist in Deutschland standort- und anbaustrukturbedingt<br />
ein Nord-Süd-Gefälle <strong>auf</strong>.<br />
Schleswig-Holstein steht an der Spitze mit<br />
einem Durchschnittsertrag von 84,5 dt/ha.<br />
Rund 50 %<br />
Qualitätsweizenanbau<br />
Im Winterweizen nimmt der Qualitätsweizenanbau<br />
einen festen Platz ein. Der<br />
Anteil der Qualitätsklassen E und A an der<br />
Winterweizenernte lag im vergangenen<br />
Jahr bei 10,5 % bzw. 37,4 %. E-Weizen<br />
konzentriert sich in Deutschland vor allem<br />
<strong>auf</strong> die östlichen Bundesländer: Thüringen<br />
mit 39,2 % und Mecklenburg-Vorpommern<br />
mit 8,5 % Produktionsanteil. Die beiden<br />
großen Anbau- und Verarbeitungsstandorte<br />
Niedersachsen und Nordrhein-<br />
Westfalen bauten nach den aktuellen statistischen<br />
Angaben im vergangenen Jahr<br />
keine E-Sorten an. Der Anteil an A-Weizen<br />
liegt in Nordrhein-Westfalen dafür mit<br />
66,7 % sehr hoch. Im Vergleich dazu werden<br />
in Baden-Württemberg 38,5 % angebaut.<br />
Bundesweit zeigt sich zudem eine<br />
Zunahme ertragreicher B-Weizensorten.<br />
Verk<strong>auf</strong>szeiträume<br />
Die landwirtschaftlichen Betriebe verk<strong>auf</strong>en<br />
rund 80 % ihrer Weizenernte. Das Gros<br />
der Verkäufe im Verl<strong>auf</strong> eines Wirtschaftsjahres<br />
entfällt <strong>auf</strong> den Ex-Erntetermin. Die<br />
Verkäufe im Erntequartal Juni-September<br />
lagen im vergangenen Jahr bei 54,5 %. Im<br />
Vermarktungszeitraum Oktober-Dezember<br />
wurden weitere 21,3 % Weizen aus der<br />
Landwirtschaft verk<strong>auf</strong>t, Januar-März<br />
waren es 13,3 % und April-Juni noch<br />
10,6 %.<br />
Die Gründe für diese Verteilung liegen<br />
zuerst im verfügbaren Lagerraum und der<br />
Ausstattung mit Trocknungs- und Aufbereitungsanlagen,<br />
dem Feuchtegehalt des<br />
Erntegutes und damit dessen Lagerfähigkeit.<br />
Die Höhe der Marktanlieferungen<br />
hingegen ist abhängig von der Höhe der<br />
Getreideernte, vom Umfang der betriebseigenen<br />
Verwertung, also von Umfang und<br />
Struktur des Viehbestandes und vom<br />
Getreidepreis im Vergleich zu anderen<br />
Futtermitteln.<br />
In den einzelnen Bundesländern fallen<br />
die Marktanlieferungen von Getreide unterschiedlich<br />
aus. So lag die Marktanlieferung<br />
der größten Erzeuger im Jahr 2003/04<br />
in Niedersachsen bei 5,2 Mio. t, in<br />
Schleswig-Holstein bei 4,6 Mio. t und in<br />
Bayern bei 2,9 Mio. t.<br />
Getreideerfassung und<br />
-verarbeitung<br />
Die physische Erfassung des Erntegutes<br />
übernimmt traditionell der genossenschaftliche<br />
und privatwirtschaftlich organisierte<br />
Getreideerfassungshandel. Bundesweit<br />
werden rund 50 % des gesamten<br />
Verk<strong>auf</strong>sgetreides vom genossenschaftlich<br />
organisierten Erfassungshandel <strong>auf</strong>genommen.<br />
Die BayWa ist hierbei der größte<br />
Getreideerfasser in Deutschland. Gut 30 %<br />
liegt beim privaten Landhandel. Der Rest<br />
2/05 KURIER 23
des Verk<strong>auf</strong>sgetreides wird von den<br />
Erzeugern direkt mit den Verarbeitern<br />
gehandelt. In den letzten Jahren nahm aber<br />
auch die Getreideerfassung der Mühlen<br />
und Mischfutterhersteller direkt aus der<br />
Landwirtschaft etwas zu. Erzeugergemeinschaften<br />
sind dem Erfassungshandel<br />
oder den Verarbeitern zum Teil<br />
noch vorgelagert.<br />
Konzentration in der Erfassung<br />
und Vermarktung<br />
Im deutschen Agrarhandel zeichnet sich<br />
ein fortschreitender Konzentrationsprozess<br />
ab. Der anhaltende Strukturwandel in der<br />
Landwirtschaft und die Liberalisierung der<br />
Agrarmärkte erhöhen den Wettbewerbsdruck<br />
auch <strong>auf</strong> die der Erzeugung nachgelagerte<br />
Ebene. Die Entwicklung der vergangenen<br />
Jahre und die Prognosen für die<br />
Zukunft zeigen deutliche Veränderungen<br />
in allen Handelsstufen. Gerade der Genossenschaftsbereich<br />
ist enger zusammengerückt.<br />
Die Zahl der Raiffeisen-Genossenschaften<br />
beispielsweise ist allein zwischen<br />
1995 und 2003 um 33% <strong>auf</strong> 3.286 zurückgegangen.<br />
Von den privaten Agrarhandelspartnern<br />
findet sich nahezu ein Viertel in<br />
Bayern, ein weiteres Viertel teilt sich <strong>auf</strong><br />
Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen<br />
<strong>auf</strong>.<br />
Die Größenunterschiede innerhalb des<br />
deutschen Landhandels sind sehr groß. Im<br />
nord- und nordostdeutschen Raum sind die<br />
meisten großen Landhandelsunternehmen<br />
ansässig. Regional werden die Betriebe<br />
nach Westen und Süden hinsichtlich ihrer<br />
Umsätze kleiner. Prognosen gehen für die<br />
nächsten 15 Jahre von einer weiteren<br />
Reduzierung <strong>auf</strong> ca. 1.500 Handelspartner<br />
aus. Der rechnerische Durchschnitt der<br />
landwirtschaftlichen Betriebe pro Handelspartner<br />
<strong>auf</strong> der Primärstufe lag vor drei<br />
Jahren bei etwa 200 Betrieben und wird<br />
sich nicht zuletzt wegen des Verfalls der<br />
Handelsspannen weiter erhöhen.<br />
Im Bereich der Hauptgenossenschaften<br />
gab es in den vergangenen Jahren einige<br />
spektakuläre regionsübergreifende Konzentrationsprozesse.<br />
Dazu zählen die<br />
Übernahme der RHG Frankfurt durch die<br />
RWZ Rheinland im Jahr 1999, die Verschmelzung<br />
der RHG Nord AG, Hannover,<br />
und der RCG Nordwest eG, Münster, zur<br />
AGRAVIS Raiffeisen AG im Jahr 2004<br />
und die Verschmelzung der WLZ Raiffeisen<br />
AG, Stuttgart, mit der BayWa AG,<br />
München, 2003. Der letzte große Zusammenschluss<br />
<strong>auf</strong> genossenschaftlicher<br />
Ebene fand im Mai 2005 im Norden statt.<br />
Die Raiffeisen Hauptgenossenschaft Nord<br />
AG (HaGe), Kiel, ging mit der Team AG,<br />
Süderbrarup, sowie der dänischen Dansk<br />
Landbrugs Grovvareselskab a.m.b.a. (DLG),<br />
Kopenhagen, eine Kooperation ein.<br />
In der Getreideverarbeitung<br />
dominieren einzelne Unternehmen<br />
Etwa ein Drittel der Weizenernte und ein<br />
Viertel der Roggenernte werden von deutschen<br />
Mühlen zu Mehl veredelt. Die jährliche<br />
Vermahlung beträgt insgesamt rund<br />
7,45 Mio. t Getreide. Von den Mahlerzeugnissen<br />
deutscher Mühlen gehen 90 % an<br />
Backbetriebe. Der Rest verteilt sich zu<br />
gleichen Teilen <strong>auf</strong> Stärke- und Teigwarenhersteller<br />
sowie private Endverbraucher.<br />
Heute gibt es in Deutschland noch rund<br />
750 Mühlen, von denen 345 jährlich mindestens<br />
500 t Getreide vermahlen. Die<br />
durchschnittliche Vermahlung dieser<br />
Betriebe liegt bei 21.500 t. Die 61 großen<br />
Mühlen mit einer Jahresvermahlung über<br />
25.000 t stellen einen Anteil von 83 % an<br />
der Gesamtvermarktung.<br />
Der deutsche Markt wird dominiert von<br />
den großen Mühlenkonzernen VK Mühlen<br />
AG und der Werhahn Gruppe. Die VK<br />
Mühlen ist mit einem Mehlabsatz von<br />
1,77 Mio. t das größte Mühlenunternehmen<br />
Europas mit Verarbeitungsstandorten<br />
in Norddeutschland, Niedersachsen und<br />
entlang des Rheins. In der Werhahngruppe<br />
sind sechs Mühlenbetriebe in Neuss,<br />
Hamburg, Frankfurt, Landshut, Ergolding<br />
und Dresden in vier Unternehmen zusammengefasst,<br />
die mit einer Vermahlung von<br />
ca. 1,1 Mio. t Getreide zweitgrößter Anbieter<br />
von Mahlerzeugnissen in Deutschland sind.<br />
Auf diese Unternehmensgruppen entfallen<br />
rund 65 % des Marktanteils. Bis zu jeweils<br />
5 % Marktanteil teilen sich sechs weitere<br />
private Unternehmen, zu denen auch das<br />
klassische Landhandelsunternehmen Getreide<br />
AG in Rendsburg mit zwei Mühlenwerken<br />
in Berlin und Wurzen zählt.<br />
Die Konzentration <strong>auf</strong> der Abnehmerseite,<br />
insbesondere bei der Brotindustrie<br />
und im Lebensmitteleinzelhandel, hat die<br />
Mühlenbranche in den letzten Jahren einem<br />
erheblichen Wettbewerbsdruck ausgesetzt.<br />
Der Strukturwandel in der deutschen Mühlenbranche<br />
ist vornehmlich von Fusionen<br />
und Betriebs<strong>auf</strong>gaben gekennzeichnet.<br />
Mehr Mischfutter, weniger<br />
Hersteller<br />
Auch die Mischfutterbranche rückte in den<br />
vergangenen Jahren dichter zusammen.<br />
Die Produktion nahm zu und die Zahl der<br />
Verarbeitungsbetriebe ab. Die Zahl der<br />
Mischfutterhersteller wurde im Juni 2003<br />
noch amtlich mit 408 meldepflichtigen<br />
Unternehmen erfasst. Das waren bereits 12<br />
weniger als im Jahr zuvor und 20 % weniger<br />
als vor fünf Jahren. Am stärksten reduzierte<br />
sich die Anzahl der Mischfutterhersteller<br />
in Niedersachsen/Bremen von 167<br />
<strong>auf</strong> 125 Hersteller. Im Jahr 2003 wurden<br />
170 Hersteller mit einer Jahresproduktion<br />
bis 1.000 t (Vorjahr 181) und 238 mit einer<br />
Jahresproduktion über 10.000 t registriert<br />
(Vorjahr 239).<br />
Die zehn größten Mischfutterunternehmen<br />
vereinen rund die Hälfte der deutschen<br />
Mischfutterproduktion in sich. Die<br />
Genossenschaften halten nach eigenen<br />
Angaben einen Anteil von 40 % am deutschen<br />
Mischfuttermarkt. Der Deutsche Verband<br />
Tiernahrung e. V. (DVT) stellt die<br />
Struktur der deutschen Mischfutterherstellung<br />
hinsichtlich Produktionsschwerpunkten<br />
und Größenordnungen als heterogen<br />
dar.<br />
Weichweizenerzeugung in der EU-15 (2004) in Mio. t<br />
Frankreich 37,577<br />
Deutschland 25,377<br />
Vereinigtes Königreich 15,473<br />
Dänemark 4,890<br />
Spanien 4,393<br />
Italien 2,958<br />
Schweden 2,397<br />
Belgien 1,886<br />
Niederlande 1,747<br />
Österreich 1,607<br />
Irland 1,026<br />
Finnland 0,790<br />
Griechenland 0,429<br />
Portugal 0,060<br />
Weichweizenerzeugung neue EU-Mitglieder (2004) in Mio. t<br />
Polen 9,914<br />
Ungarn 5,958<br />
Tschechien 5,077<br />
Slowakei 1,228<br />
Litauen 1,186<br />
Lettland 0,472<br />
Estland 0,175<br />
Slowenien 0,142<br />
Malta 0,009<br />
Zypern 0,002<br />
Quelle Statistik: ZMP Marktbilanz 2005<br />
24 KURIER 2/05
In den vergangenen Jahren hat sich die<br />
Konzentration in der Mischfutterbranche<br />
in unverändertem Tempo fortgesetzt. Im<br />
Wirtschaftsjahr 2002/2003 produzierten in<br />
der Größenklasse bis 10.000 Jahrestonnen<br />
42 % aller Hersteller rund 3 % des Mischfutters.<br />
Den Hauptanteil der Produktion<br />
erbrachten in der Größenklasse 100.000-<br />
200.000 Jahrestonnen 9 % der Hersteller<br />
mit einem Viertel der Menge.<br />
Entsprechend den Hauptveredlungsgebieten<br />
in Deutschland findet man auch<br />
eine ähnliche Verteilung der Mischfutterhersteller.<br />
Der Schwerpunkt der Mischfutterindustrie<br />
liegt zum einen in<br />
Niedersachsen, Bremen, Hamburg und<br />
Nordrhein-Westfalen. Knapp 70 % des<br />
Mischfutters werden im nordwestlichen<br />
Hauptveredlungsgebiet produziert und<br />
verfüttert. Die verbleibenden 30 % sind zu<br />
etwa gleichen Teilen in Bayern und<br />
Sachsen angesiedelt. ■<br />
Rangliste Bundesländer in Weizenanbau 2004 in Hektar<br />
Saarland<br />
Rheinland-Pfalz<br />
Brandenburg<br />
Hessen<br />
Sachsen<br />
Schleswig-Holstein<br />
Thüringen<br />
Baden-Württemberg<br />
Nordrhein-Westfalen<br />
Sachsen-Anhalt<br />
Mecklenburg-Vorpommern<br />
Niedersachsen<br />
Bayern<br />
in 1.000 ha 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500<br />
Winterweizenernte 2004 in Tonnen<br />
Saarland<br />
Rheinland-Pfalz<br />
Brandenburg<br />
Hessen<br />
Sachsen<br />
Baden-Württemberg<br />
Thüringen<br />
Schleswig-Holstein<br />
Nordrhein-Westfalen<br />
Mecklenburg-Vorpommern<br />
Sachsen-Anhalt<br />
Niedersachsen<br />
Bayern<br />
in 1.000 t 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000<br />
2/05 KURIER 25
Der Nebel und seine<br />
Entstehung<br />
Prof. Dr. Hans Häckel,<br />
Weihenstephan
Der November gilt von Alters her als der nebelreichste<br />
Monat. „Nebelmond" oder „Nebelung" hat man ihn<br />
deshalb früher genannt. Dabei tut man dem November<br />
ganz und gar unrecht.<br />
Blättert man die Aufzeichnungen der<br />
Wetterstationen in Deutschland durch, so<br />
wird man feststellen, dass nicht der<br />
November, sondern der „Goldene Oktober“<br />
die meisten Nebeltage <strong>auf</strong>weist. Allerdings<br />
sind die Oktobernebel normalerweise<br />
längst nicht so zäh und ausdauernd wie die<br />
oft tage- oder sogar wochenlang anhaltenden<br />
Nebel im November. Und eine andere<br />
Ursache haben die Novembernebel in den<br />
meisten Fällen auch.<br />
Nebelbildung<br />
Die Luft enthält immer eine mehr oder<br />
weniger große Menge an Wasserdampf –<br />
auch wenn sich der Himmel wolkenlos und<br />
strahlend dunkelblau über uns wölbt. Das<br />
kann man mit einem kleinen Experiment<br />
schnell beweisen: Gießen Sie eine Flasche<br />
Bier – frisch aus dem Kühlschrank – in ein<br />
Glas. Noch beim Einschenken können Sie<br />
beobachten, wie das Glas rundum<br />
beschlägt (bei sehr trockener Luft oder in<br />
einem geheizten Raum kann der Versuch<br />
allerdings misslingen!). Das kalte Bier hat<br />
das Glas und das wiederum die an ihm vorbei<br />
streichende Luft abgekühlt. Der<br />
Wasserdampf kondensiert. Verantwortlich<br />
ist die Physik, wonach kalte Luft weniger<br />
Wasserdampf mit sich führen kann als<br />
warme. Die Konsequenz: Wird wasserdampfhaltige<br />
Luft immer weiter abgekühlt,<br />
erreicht man irgendwann die<br />
Temperatur, unterhalb derer sich die Luft<br />
eines Teils des in ihr enthaltenen Wasserdampfes<br />
entledigen muss. Das erreicht sie,<br />
indem sie ihn in Form von winzigen<br />
Tröpfchen ausscheidet. Man braucht also<br />
Luft nur tief genug abzukühlen, um eine<br />
Kondensation des Wasserdampfes zu<br />
erzwingen. Die Temperatur, ab der<br />
Wasserdampf zu kondensieren beginnt,<br />
heißt „Taupunktstemperatur" oder kurz<br />
„Taupunkt", da mit ihr die Taubildung einsetzt.<br />
In der Natur kühlen sich nachts insbesondere<br />
die Pflanzenoberflächen sehr<br />
stark ab, so dass sie bis zum Morgen oft<br />
mit Tau bedeckt sind.<br />
Enthält die Luft sehr viel Wasserdampf<br />
und/oder dauert die nächtliche Abkühlung<br />
sehr lang an, wie das besonders in den Spätherbstmonaten<br />
der Fall ist, dann bleiben<br />
viele der entstehenden Tröpfchen in der<br />
Luft schweben und verringern die Sichtweite.<br />
Zunächst spricht man lediglich von<br />
„Dunst“, bei einer Sichtweite unter 1.000<br />
Metern dann von „Nebel“.<br />
In der Natur gibt es viele Vorgänge, die<br />
zur Abkühlung der Luft unter den Taupunkt<br />
und damit zur Nebelbildung führen.<br />
Zunächst ist dabei an die ganz normale<br />
nächtliche Abkühlung zu denken. Sie<br />
beginnt am Erdboden und setzt sich mit<br />
fortschreitender Nacht in die Höhe fort.<br />
Deshalb bilden sich in vielen Fällen<br />
zunächst flache Nebelbänke, die während<br />
der Nacht höher und höher werden und<br />
gegen Sonnen<strong>auf</strong>gang ihre größte Mächtigkeit<br />
erreichen. Normalerweise reichen sie<br />
kaum höher als einige hundert Meter. Ist<br />
die Luft nur mäßig feucht, dann entstehen<br />
flache Nebelbänke, die kaum über die<br />
Höhe von Sträuchern und Bäumen hinauswachsen.<br />
Und darüber spannt sich der klare,<br />
blaue Himmel. Im Licht der Morgensonne<br />
können solche flache Nebelschichten in<br />
prächtigem Gold und Rot erstrahlen.<br />
Wenn vorhin gesagt wurde, dass Nebel<br />
besonders dann entsteht, wenn die Luftfeuchtigkeit<br />
hoch ist oder die nächtliche<br />
Abkühlung besonders lang dauert, müsste<br />
man eigentlich erwarten, dass die meisten<br />
Nebel im Winter um die Zeit der Sonnenwende<br />
(21. Dezember) <strong>auf</strong>treten, wenn die<br />
Flache Wiesennebel in einer Auenlandschaft.<br />
Nächte am längsten sind. Das ist überraschenderweise<br />
nicht der Fall. Vielmehr ist<br />
um diese Jahreszeit die Luft schon so weit<br />
abgekühlt, dass sie kaum noch Wasserdampf<br />
enthält, der zu Nebel führen könnte.<br />
Damit ergibt sich zwangsläufig, dass nicht<br />
der Winter, sondern der Spätherbst die<br />
besten Voraussetzungen für die Entstehung<br />
von Nebel bietet: Einerseits ist die Luft<br />
vom Sommer her noch warm genug, um<br />
entsprechend viel Wasserdampf mit sich<br />
zu führen, andererseits sind die Nächte<br />
schon lang genug, um die erforderliche<br />
Abkühlung zu ermöglichen.<br />
Moor- und Wiesennebel<br />
Moore sind bekannt für ihren Nebelreichtum.<br />
Der Grund dafür ist aber nicht etwa<br />
der nasse Boden – die tagsüber mit Wasserdampf<br />
angereicherte Luft hat der Wind bis<br />
zum Abend längst fort geblasen und durch<br />
trockenere Luft aus der Umgebung ersetzt.<br />
Ausschlaggebend ist, dass Moorböden aus<br />
bodenphysikalischen Gründen nachts<br />
besonders kalt werden und deshalb die<br />
Temperaturen häufig unter den Taupunkt<br />
sinken. Auch über Wiesen bilden sich oft<br />
zähe Nebel aus. Sie verdanken ihre Entstehung<br />
dem dichten Wurzelgestrüpp des<br />
Grases, das – ähnlich wie der lockere,<br />
torfige Moorboden – nachts besonders kalt<br />
wird. Auch alle Stellen im Gelände, an denen<br />
2/05 KURIER 27
Kaltluft aus der Umgebung zusammenfließt,<br />
sind besonders nebelreich. Dazu<br />
gehören Täler, Senken, Gräben, Mulden<br />
und jede andere Art von Geländevertiefungen<br />
wie z. B. Dolinen. Die Nebelhäufigkeit<br />
wird <strong>auf</strong> diese Weise zu einem wichtigen<br />
Kriterium bei der Beurteilung des<br />
Geländeklimas. Wo es viel Nebel gibt, gibt<br />
es auch viel Frost! Solche Geländelagen sind<br />
naturgemäß für den Anbau frostempfindlicher<br />
Kulturen nicht oder nur bedingt geeignet.<br />
Auch als Hobbygärtner sollte man<br />
deshalb sorgsam <strong>auf</strong> Häufigkeit und Dichte<br />
des Nebels in seiner Umgebung achten.<br />
Berührungsnebel<br />
"Seerauchen" über dem St. Moritzer See an einem kühlen Spätherbstmorgen.<br />
Im Winter kann man nach dem Einbruch<br />
feuchter, milder Meeresluft häufig beobachten,<br />
dass sich über noch vorhandenen<br />
Schneeresten Nebel bildet, die schneefreien<br />
Flächen dagegen nebelfrei bleiben.<br />
In solchen Fällen liegt der Taupunkt der<br />
Luft nur wenige Grad über Null. Die Temperaturen<br />
sowohl der Luft als auch schneefreier<br />
Bodenflächen sind dann zwar höher<br />
als der Taupunkt, die schmelzende Schneefläche<br />
hat mit 0 °C jedoch eine Temperatur<br />
unter dem Taupunkt. Nur dort, wo die Luft<br />
über die Schneereste streicht, wird sie<br />
demnach unter die Taupunktstemperatur<br />
abgekühlt, und es kommt zur Nebelbildung.<br />
Aus nahe liegenden Gründen bezeichnet<br />
man Nebel, der <strong>auf</strong> diese Weise<br />
entsteht, als „Berührungsnebel".<br />
Er ist aber kein ausschließlich kleinräumiges<br />
Phänomen. Großflächiger Berührungsnebel,<br />
dessen wissenschaftlicher<br />
Name „Advektionsnebel“ lautet, ist sehr<br />
verbreitet. Er entsteht bevorzugt im Winterhalbjahr,<br />
wenn warme, vom Atlantik oder<br />
aus dem Mittelmeerraum zuströmende<br />
Meeresluft <strong>auf</strong> dem Festland <strong>auf</strong> eine zähe,<br />
flache, bodennahe Kaltluftschicht <strong>auf</strong>gleitet.<br />
Durch Kontakt mit der Kaltluft entstehen<br />
dabei Nebelschichten mit mehreren<br />
hundert Metern Mächtigkeit. Im Frühling<br />
sind die Meere und die großen Binnenseen<br />
meist deutlich kühler als das Festland.<br />
Strömt Luft von dort <strong>auf</strong> das Wasser, wird<br />
sie abgekühlt, und es bildet sich Nebel.<br />
Bekannte Beispiele sind die im Spätfrühling<br />
häufigen Küstennebel an der Ostsee.<br />
Mischungsnebel<br />
Wenn im Herbst die ersten kühlen Nächte<br />
<strong>auf</strong> den bevorstehenden Winter <strong>auf</strong>merksam<br />
machen, ist die Zeit der „rauchenden"<br />
Flüsse und Seen gekommen. In den -<br />
Wenn die Sonne <strong>auf</strong> einen feuchten<br />
Bildung von Mischungsnebel.<br />
Morgenstunden sieht man dann eine riesige<br />
Zahl von winzigen Nebelschwaden<br />
oder Nebelsäulchen scheinbar regungslos<br />
dicht über der Oberfläche der Gewässer<br />
schweben. Man nennt dieses Phänomen<br />
„Seerauchen“ oder „Flussrauchen“, obwohl<br />
es mit Rauch nicht das Geringste zu<br />
tun hat. Diese Nebelart entsteht dadurch,<br />
dass sich feuchte, warme Luft beim<br />
Vermischen mit kalter Luft unter die<br />
Taupunktstemperatur abkühlt.<br />
Stark vereinfacht ausgedrückt passiert<br />
folgendes: Das Wasser ist vom Sommer her<br />
bis in den Herbst und den frühen Winter<br />
hinein noch relativ warm. Damit bleibt<br />
auch die unmittelbar <strong>auf</strong> dem Wasser <strong>auf</strong>liegende<br />
Luft wärmer als die der<br />
Umgebung. Da sie mit dem Gewässer in<br />
Kontakt ist, reichert sie sich zunehmend<br />
mit Wasserdampf an. Im L<strong>auf</strong>e der Nacht
Acker scheint, kommt es zur<br />
schiebt sich nun vom Ufer her kältere Luft<br />
aus der Umgebung über das Gewässer und<br />
vermischt sich mit der dort liegenden wärmeren<br />
Luft. Die Temperatur der Mischluft<br />
ist jetzt tiefer als die der vorher über dem<br />
Gewässer gelegenen. Ist sie tiefer als ihr<br />
Taupunkt, dann bilden sich flache Nebelschwaden,<br />
die man aus nahe liegenden<br />
Gründen als „Mischungsnebel" bezeichnet.<br />
Mischungsnebel bildet sich auch, wenn<br />
die Sonne nach einem Regenschauer wieder<br />
aus dem Gewölk hervorbricht und nasse<br />
Straßen sowie Haus- oder Autodächer erwärmt.<br />
Auch über taunassen Wiesen oder<br />
Äckern entsteht Mischungsnebel, wenn die<br />
Sonne den Morgennebel <strong>auf</strong>gelöst hat und<br />
ihre wärmenden Strahlen den Boden erreichen.<br />
Selbst der Dampf, der aus der Kaffeetasse<br />
oder dem Kochtopf <strong>auf</strong>steigt, und das<br />
Eine Inversion erkennt man an den darin enthaltenen Luftverunreinigungen.<br />
Wölkchen, das sich an kalten Wintertagen<br />
vor den Nüstern eines angestrengt l<strong>auf</strong>enden<br />
Pferdes oder vor unserer eigenen Nase<br />
bildet, ist nichts anderes als Mischungsnebel.<br />
Inversionsnebel<br />
Im Spätherbst, ab Ende Oktober, den ganzen<br />
November hindurch und oft noch bis<br />
weit in den Dezember hinein, stellt sich<br />
häufig eine Wetterlage ein, die die Bildung<br />
so genannter Inversionen ermöglicht.<br />
Solche Herbstinversionen sind am Boden<br />
<strong>auf</strong>liegende Kaltluftschichten, die von milder<br />
Luft überlagert werden. Zu den wichtigen<br />
Eigenschaften einer Inversion gehört,<br />
dass sie keine vertikalen Luftbewegungen<br />
zulässt. Das bedeutet, dass sämtliche Luftverunreinigungen<br />
wie Abgase, Rauch,<br />
Staub, hoch gewirbelte Bodenpartikel,<br />
aber auch der gesamte durch Verdunstung<br />
am Boden entstehende Wasserdampf<br />
innerhalb der Inversion festgehalten werden.<br />
Im L<strong>auf</strong>e der Zeit kann sich diese<br />
Kaltluftschicht so stark mit Wasserdampf<br />
anreichern, dass es zur Kondensation und<br />
damit zur Bildung von Nebel kommt.<br />
Unser Bild zeigt, wie sich eine Inversion<br />
von einem über sie hinausragenden<br />
Berggipfel aus präsentiert. Während die in<br />
der Inversion angereicherten Luftverunreinigungen<br />
wie eine schmutzige Brühe im<br />
Tal liegen, spannt sich über ihr ein kristallklarer<br />
Himmel. In wenigen Tagen wird<br />
sich in der Inversion soviel Wasserdampf<br />
angesammelt haben, dass sich daraus eine<br />
mächtige Nebelschicht bilden kann.<br />
Inversionen sind sehr zähe Gebilde. Sie<br />
können sich oft tage-, ja wochenlang halten<br />
und damit entsprechend lang anhaltende<br />
Nebelperioden mit sich bringen. Oft<br />
schafft es erst ein Herbststurm sie wieder<br />
wegzuräumen. Diese Dauernebel sind es,<br />
die dem November seinen schlechten Ruf<br />
als Nebelmonat eingebracht haben.<br />
Dabei sind aber häufig nur die Bewohner<br />
der Tiefländer vom Novembernebel betroffen.<br />
Meist reichen die Inversionen nur etliche<br />
hundert Meter hoch – über 1.500<br />
Meter mächtige Inversionen sind schon die<br />
Ausnahme – und füllen damit lediglich die<br />
Beckenlandschaften und Flusstäler, während<br />
die Hochländer, das Alpenvorland und natürlich<br />
erst recht die Alpengipfel die trüben<br />
Nebel überragen, so dass man dort bei milden<br />
Temperaturen herrlichsten Sonnenschein<br />
genießen kann. ■
Warum<br />
werden<br />
die Blätter<br />
im Herbst<br />
bunt<br />
Einkommen<br />
steigen<br />
weltweit –<br />
1,1 Milliarden<br />
neue<br />
Verbraucher<br />
Von grün über gelb, ocker, rot bis braun<br />
– im Herbst werden die Blätter der Bäume<br />
richtig bunt. Viele Menschen lieben den<br />
Herbst gerade wegen dieser Farbenpracht.<br />
Kinder basteln Blättermännchen mit<br />
Akribie und Leidenschaft. Die vielen<br />
Farbtöne scheinen die Fantasie anzuregen.<br />
Wie kommt diese Farbenpracht zustande<br />
Die grüne Farbe der Blätter wird<br />
durch zwei Blattfarbstoffe verursacht: gelbes<br />
und blau-grünes Chlorophyll. Im Herbst<br />
wandert der blau-grüne Anteil des Farbstoffes<br />
zurück durch die Blattadern und<br />
Zweige in den Stamm des Baumes. Dort<br />
wird er gespeichert. Der gelbe Farbstoff<br />
bleibt zurück und gibt den Blättern ihre<br />
Farbe. Damit nicht genug: Die absterbenden<br />
Blätter können im Herbst den Sauerstoff<br />
nicht mehr verarbeiten. Dieser färbt<br />
nun durch einen chemischen Umwandlungsprozess<br />
den im Zellsaft noch vorhandenen<br />
gelben Farbstoff rot.<br />
Zusammen mit den noch grünen<br />
Blättern und den vielen Übergängen zwischen<br />
gelb und rot bietet sich dem Auge im<br />
herbstlichen Wald ein wahres Feuerwerk<br />
an Farben.<br />
Niedrige Nacht- und hohe Tagestemperaturen<br />
bei intensiver Sonneneinstrahlung<br />
führen zu der Farbenpracht, die<br />
in Kanada und Nordamerika den „Indian<br />
Summer“ mit der Gelbfärbung der Ahorne<br />
und Pappeln einläuten. Denn kürzere Tage<br />
und tiefere Temperaturen führen in den<br />
Gehölzen zur Umwandlung von Stärke in<br />
Zucker. Dadurch wird die Frosthärte der<br />
Gehölze erhöht. Dieser Prozess wird durch<br />
kurze Trockenperioden verstärkt.<br />
Vor allem die Tageslänge ist als äußerer<br />
Faktor für den Blattfall wichtig. Weitere<br />
bedeutsame Auslöser sind Feuchtigkeit<br />
und Kälte. Starke Trockenheit kann den<br />
Fall der Blätter um mehrere Wochen vorverlegen.<br />
■<br />
Im Rahmen der Globalisierung und<br />
ökonomischen Entwicklung in 17 Entwicklungs-<br />
und drei Schwellenländern<br />
hat sich eine neue Gruppe von Verbrauchern<br />
mit einem Einkommen über<br />
7 Euro pro Tag herausgebildet, das sie<br />
in die Lage versetzt, Fernsehgeräte,<br />
Kühlschränke, Waschmaschinen und<br />
sonstige Elektrogeräte zu k<strong>auf</strong>en. Über<br />
300 Millionen dieser ‚Neuen Konsumenten’<br />
leben in China, 130 Millionen<br />
in Indien, der Rest in Ländern wie z. B.<br />
Russland, Brasilien, Indonesien, Thailand<br />
oder Mexiko. 2010 werden es aller<br />
Voraussicht nach über 1,5 Milliarden<br />
Menschen sein, die eine solche K<strong>auf</strong>kraft<br />
besitzen. Dies bedeutet, dass die<br />
Nachfrage nach höherwertigen Nahrungsmitteln,<br />
wie z. B. Gemüse und<br />
Fleisch und veredelten Produkten steigen<br />
wird. Viele internationale Supermarktketten<br />
reagieren bereits <strong>auf</strong> diese<br />
neue Zielgruppe und eröffnen moderne<br />
Eink<strong>auf</strong>szentren in diesen Ländern. ■<br />
30 KURIER 2/05
Brasilien erhöht<br />
Fleischproduktion<br />
Asiatischer<br />
Rostpilz in<br />
den USA<br />
angekommen<br />
Sojabauern stehen vor einer neuen<br />
Herausforderung<br />
In Südamerika, besonders in Brasilien,<br />
wird derzeit die Fleischproduktion deutlich<br />
ausgebaut. Zuwachsraten in der<br />
Schweineexportrate liegen zur Zeit bei<br />
über 15 Prozent. Eine Hightech-<br />
Landwirtschaft in Brasilien erzeugt<br />
kostengünstig Futtermittel und legt damit<br />
die Basis für eine effiziente Schweinemast<br />
bzw. Fleischveredelung und<br />
Lebensmittelindustrie. Vorbild sind die<br />
großen Fleischproduktions- und Verarbeitungszentren<br />
in Iowa (USA).<br />
Fleischexport – Brasilien, 1990-2002<br />
Tausend Tonnen<br />
1600<br />
1400<br />
1200<br />
1000<br />
800<br />
600<br />
400<br />
200<br />
Der asiatische Rostpilz (Phakospora<br />
pachyrizi), ein zerstörerischer Schadpilz<br />
in Sojapflanzen, der sich über Asien,<br />
Afrika und in den letzten Jahren sehr<br />
schnell auch in Südamerika verbreitet hat<br />
(über 7 Millionen ha waren 2004 befallen<br />
und mussten mit Fungiziden behandelt<br />
werden), ist nun auch im Süden der<br />
Vereinigten Staaten angekommen.<br />
Die bisherigen Untersuchungen zeigen,<br />
dass die Sporen dieses Rostpilzes über die<br />
Luft, besonders durch die Wirbelstürme<br />
(Hurricanes) von Süd- nach Nordamerika<br />
transportiert wurden. Ende 2004 konnte<br />
der Rostpilz in Louisiana, Mississippi,<br />
Alabama, Georgia, Florida, Arkansas,<br />
South Carolina, Missouri und Tennessee<br />
nachgewiesen werden. Die USA setzen<br />
alles daran, eine Verbreitung dieses Soja-<br />
Rostpilzes weiter nach Norden in die<br />
Hauptanbaugebiete für Soja in Ohio,<br />
Indiana, Illinois, Nebraska, Iowa, Minnesota<br />
und Süd-Dakota zu verhindern und<br />
eine Verbreitung einzudämmen.<br />
Schon die ersten Meldungen über das<br />
Auftreten des Soja-Rostpilzes in den USA<br />
haben weltweit zu Preisturbulenzen im<br />
Sojamarkt geführt. Eine genaue Beobachtung<br />
der weiteren Entwicklung dieses<br />
wichtigen Schaderregers in Brasilien und<br />
in den USA ist weltweit von hoher Wichtigkeit,<br />
nicht nur für Landwirte, Futter-<br />
Bedingt durch die weltweite Zunahme der<br />
Fleischproduktion steigt die Nachfrage<br />
nach hochwertigen und proteinreichen<br />
Futtermitteln. Schon heute werden 75 %<br />
der globalen Fleischproduktion durch<br />
Futtermittel erzielt (25 % Weidehaltung);<br />
der Anteil wird sich bis 2025 noch erhöhen.<br />
Die Nachfrage nach Futtermitteln wird sich<br />
speziell in Asien weit mehr als verdoppeln.<br />
Stärke- und proteinreiche Futtermittel, hergestellt<br />
aus Mais, Sojabohnen und Raps,<br />
werden die Grundlage zur Sicherung der<br />
zukünftigen Fleischproduktion bilden. ■<br />
0<br />
1990 1994 1998 2002<br />
Quelle: De Sousa, E. L. et al., Brazilian Livestock Competitiveness, 2003<br />
jährliches<br />
Wachstum (1999-2003)<br />
Hühnerfleisch<br />
12,6%<br />
Rindfleisch<br />
8,1%<br />
Schweinefleisch<br />
24,3%<br />
mittelhersteller, Futtermittelhandel und<br />
Fleischproduzenten, sondern letztlich auch<br />
im Bereich der globalen Versorgung mit<br />
pflanzlichen Ölen und Proteinen.<br />
Mit Stratego ® und Folicur ® verfügt<br />
Bayer CropScience in den USA über zwei<br />
ausgezeichnete Produkte für die Bekämpfung<br />
des Soja-Rostes, die sich in Brasilien<br />
bereits hervorragend bewährt haben. ■<br />
Wirbelsturm-Simulationsstudie 2005 Sojabohnen-Produktion in den USA, 2002<br />
Nachweis von<br />
Soja-Rostsporen<br />
in Bezirken,<br />
12. Januar 2005<br />
Sojabohne –<br />
Anb<strong>auf</strong>läche in Hektar<br />
Quelle: https://netfiles.uiuc.edu/ariatti/www/SBR/index.htm, 2005<br />
50-3.999<br />
4.000-9.999<br />
10.000-19.999<br />
20.000-39.999<br />
40.000-200.000<br />
nicht erfasst<br />
Quelle: https://netfiles.uiuc.edu/ariatti/www/SBR/index.htm, 2005<br />
2/05 KURIER 31
Gebühr bezahlt<br />
beim Postamt<br />
51373 Leverkusen<br />
Natur und Technik<br />
Verpackungen sind ein besonderes Merkmal<br />
des Lebens. Ohne sie können Lebewesen nicht<br />
existieren: Denn als Barrieren zur Umgebung<br />
regeln sie den Stoffaustausch und schützen ihren<br />
Inhalt gegen die Einflüsse der Außenwelt. Dabei<br />
soll sich die ideale Verpackung aber auch zum<br />
richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle öffnen.<br />
Der Fruchtstand der Drachenwurz (Calla palustris)<br />
ist ein Beispiel für einen ausgefeilten natürlichen<br />
Öffnungsmechanismus. Die ausdauernde<br />
Pflanze wächst an moorigen Stellen und Tümpeln<br />
in Nord- und Mitteleuropa. Sie zählt zu den Aronstabgewächsen<br />
und erreicht eine Höhe von bis zu<br />
30 cm. Der Fruchtstand besteht aus vielen Einzelfrüchten.<br />
Sobald alle reif genug sind, platzt die<br />
Sammelfrucht an genau dafür vorgesehenen Sollbruchstellen<br />
auseinander.<br />
Eine Glasampulle ist die ideale Verpackung für<br />
medizinische Injektionslösungen: klein, leicht,<br />
handlich und stabil. Allerdings muss sich die<br />
Glasampulle auch splitterfrei öffnen können. Dank<br />
einer Sollbruchstelle, an der die Wand besonders<br />
dünn ist, lässt sich der Ampullenhals einfach und<br />
gefahrlos brechen. ■<br />
www.bayercropscience.de