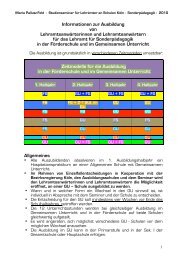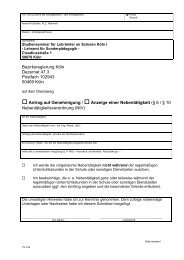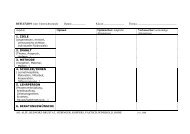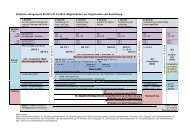Titelblatt Entflechtung
Titelblatt Entflechtung
Titelblatt Entflechtung
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Ziele<br />
Hinweise zur schriftlichen<br />
Unterrichtsplanung<br />
im Kölner Studienseminar<br />
- Sonderpädagogik -<br />
Reihe/<br />
Kontext<br />
Version: „<strong>Entflechtung</strong>“<br />
Didaktische<br />
Begründung<br />
<strong>Titelblatt</strong><br />
Lernvoraussetzungen<br />
„<strong>Entflechtung</strong>“<br />
Literatur
Vorwort<br />
Verehrte Lehramtanwärterinnen und Lehramtanwärter,<br />
in den folgenden „Hinweisen“ erläutert das Kollegium des Seminars Sonderpädagogik Köln fünf<br />
Planungselemente, die sich als Fundament eines sonderpädagogisch akzentuierten Unterrichts<br />
bewährt haben. Diese Elemente stehen in engster Interdependenz mit den Qualitätsstandards<br />
individueller Förderung, die in den Rahmenplänen für den Vorbereitungsdienst in<br />
Studienseminar und Schule festgelegt worden sind. Sie besitzen damit in unserem Seminar den<br />
Status einer allgemeinen Verbindlichkeit.<br />
Diskussionsbedarf besteht jedoch nach wie vor in der wissenschaftlichen Herangehensweise und<br />
der entsprechenden schriftlichen Darstellungsform.<br />
Im Sinne des selbstständigen Lernens widerstrebt es uns, Ihnen eine allgemein gültige<br />
Planungsanleitung zu verfassen. Alternativ dazu haben wir Ihnen das Spektrum der<br />
Darstellungsmöglichkeiten aufgezeigt, ohne den Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben.<br />
Wenn Sie sich auf den weiteren Seiten in die Planungsbausteine „einlesen“, lassen Sie sich bitte<br />
nicht von deren hohen Komplexität abschrecken. Allein durch learning by doing wird der Kontext<br />
klarer und konkreter.<br />
In Zusammenarbeit mit Ihnen werden wir noch einmal die unterschiedlichen wissenschaftlichen<br />
Ansätze beleuchten und entsprechende Darstellungsweisen erörtern.<br />
Als Ergebnis sollte dann Ihre individuelle Planung entstehen, die Ihrem eigenen Förderkonzept<br />
(abgestimmt auf die individuellen Lernausgangslagen Ihrer Schüler) entspricht. Fragen Sie also<br />
nie „Wie hätten Sie es denn gerne“ !!!<br />
Der Erwerb Ihrer Planungskompetenz ist von Seminarseite aus in folgenden Schritten grob<br />
vorstrukturiert:<br />
1. Zweitätige Kompaktphase „Unterrichtsplanung“ im Hauptseminar<br />
2. Kompakttag „<strong>Entflechtung</strong>“ in Studiengruppen<br />
3. Erprobung der Planungsbausteine (max. 3 Seiten) anlässlich des 1. Unterrichtsbesuches<br />
• Ziele<br />
• Kontext- / Reihenplanung<br />
• Verlaufsskizze<br />
4. Sukzessive Hinzufügung weiterer Planungsbausteine in Absprache mit den<br />
Fachseminarleitungen<br />
Am Ende Ihrer Ausbildung legen Sie den „Mitgliedern des Prüfungsausschusses eine knappe<br />
schriftliche Planung des Unterrichts oder gegebenenfalls eine kurzgefasste schriftliche Planung des<br />
Vorhabens vor“ (vergl. OVP, § 34 , 2006);<br />
d.h. 5 – 7 Textseiten zuzüglich <strong>Titelblatt</strong> und Literaturverzeichnis.<br />
Zur Vereinheitlichung der Terminologie haben wir abschließend ein Glossar verfasst.<br />
Viel Erfolg für Ihre Ausbildung wünscht im Namen des Kölner Kollegiums<br />
- 1 -<br />
Ihr<br />
Chr. Riegel
Zielkomplex<br />
Begriffsbestimmung und –erläuterung<br />
Umfang: ca. 1 Seite<br />
In der Literatur finden sich verschiedene Begriffe für das "Ziel" einer Unterrichtsstunde oder<br />
Unterrichtsreihe. Hierzu gehören die Begriffe Anliegen (* s. Glossar) oder Lernchance*. Wir<br />
haben uns für den Begriff „Ziel“ entschieden, um die Zielorientierung von Unterricht<br />
hervorzuheben.<br />
Ziel: „Ein Ziel ist die Beschreibung des gewünschten Ergebnisses eines Lehr-, Lernprozesses“:<br />
(Meyer, Hilbert: Didaktische Modelle, Berlin 2002, S. 51)<br />
Das „gewünschte Ergebnis“ muss an den Unterrichtsinhalten und an den Lernvoraussetzungen<br />
der Schülerinnen und Schüler orientiert sein.<br />
⋅<br />
Das „gewünschte Ergebnis“ konkretisiert sich in Lernangeboten und beinhaltet:<br />
a) Ziele, die vom Lehrer gesetzt werden<br />
b) Ziele, die vom Schüler selbst gesetzt werden (z.B. in offenen Unterrichtsformen)<br />
⋅<br />
Für den sonderpädagogischen Unterricht wird auf der Zielebene i.d.R. zwischen<br />
a) Fach- und<br />
b) Entwicklungszielen<br />
unterschieden, die aus den Unterrichtsfächern und den Entwicklungsbereichen abgeleitet<br />
werden.<br />
⋅<br />
⋅<br />
⋅<br />
⋅<br />
⋅<br />
⋅<br />
⋅<br />
Die Ableitung im Unterrichtsfach erfolgt über einen Lernbereich*/Fachaspekt und<br />
führt zu einem konkreten fachlichen Ziel.<br />
Die Ableitung im Entwicklungsbereich* erfolgt über einen Entwicklungsaspekt* und<br />
führt zu einem konkreten entwicklungsbezogenen Ziel.<br />
Die Wahl der Begriffe ist abhängig von der zugrunde liegenden Didaktik (Lernziel →<br />
Lernzielorientierter* Unterricht; Anliegen → Humanistische Pädagogik*; Lernchance* →<br />
Konstruktivismus*)<br />
Im Rahmen der schriftlichen Unterrichtsplanung werden Ziele für die Unterrichtsreihe<br />
(auch Kontext oder Gesamtkontext genannt) und für die einzelne Unterrichtseinheit*<br />
formuliert.<br />
Ziele können für die Gesamtgruppe, für Teilgruppen oder als Individualziele formuliert<br />
werden.<br />
Für Lerngruppen, in denen Schülerinnen und Schüler mit unterschiedlichen<br />
Bildungsgängen* (HS, LE etc.) unterrichtet werden, müssen in jedem Fall die<br />
unterschiedlichen Bildungsgänge Berücksichtigung finden.<br />
Dabei können Ziele exemplarisch für einzelne Schüler dargestellt werden.<br />
- 2 -
Im sonderpädagogischen Unterricht stehen manchmal die Fachziele im Vordergrund (es werden<br />
z.B. in einer Unterrichtseinheit vor allem biologische Inhalte erarbeitet), manchmal die<br />
Entwicklungsziele (z.B. wird vorrangig an der Einführung von Gruppenarbeit gearbeitet).<br />
Resultierend aus den Lern- und Förderbedürfnissen der Schülergruppe gibt es sechs<br />
Möglichkeiten der Gewichtung von Zielen (s. auch S. 12/13):<br />
1. Fach- und Entwicklungsaspekt sind unterschiedlich.<br />
2. Fach- und Entwicklungsaspekt liegen eng zusammen.<br />
3. Es gibt einen Inhaltsaspekt, der nicht zwingend einem Fach zugeordnet ist und einen<br />
Entwicklungsaspekt.<br />
4. Zu einem Fachaspekt gibt es mehrere Entwicklungsaspekte.<br />
5. Zu einem Entwicklungsaspekt gibt es mehrere Fachsaspekte.<br />
6. Es gibt mehrere Entwicklungsaspekte und mehrere Fachaspekte.<br />
Gütekriterien<br />
⋅ Die Zielsetzung muss den angestrebten und/oder erwünschten Lern-/Kompetenzzuwachs<br />
beschreiben.<br />
⋅<br />
⋅<br />
⋅<br />
⋅<br />
Zielformulierungen sind eindeutig, präzise, nachvollziehbar.<br />
Ziele sind an curricularen Erfordernissen orientiert.<br />
Ziele stehen in engem sachlogischen Zusammenhang mit den fokussierten Fachinhalten<br />
und Entwicklungsaspekten.<br />
Zielformulierungen sind an den gewählten didaktischen Konzepten und Förderkonzepten<br />
orientiert (z.B. „Die Schüler/innen sollen...“ → Lernzielorientierte Didaktik; „Die<br />
Schüler/innen haben die Chance...“ → Konstruktivismus).<br />
- 3 -
Kontext/Reihe<br />
1. Ziel dieses Planungsbausteins:<br />
Umfang: ca. 1 Seite<br />
In dem Planungsbaustein Kontext*/Reihe* wird der unterrichtliche Zusammenhang der gezeigten<br />
Unterrichtseinheit/ Unterrichtsstunde dargestellt.<br />
Vorgehen: Ordnen Sie Ihre Unterrichtseinheit/Unterrichtsstunde in einen für die Schülerinnen<br />
und Schüler sinnvollen thematischen Zusammenhang ein, der sowohl einer fachlichen als auch<br />
entwicklungsbezogenen Perspektive und Struktur folgt (vgl. Kölner 2-Säulen-Model).<br />
2. Unverzichtbare Teilaspekte der Darstellung:<br />
⋅ schülerorientierte Themenformulierung des Inhaltes („keine Slogans“)<br />
⋅<br />
⋅<br />
fachlich begründete Strukturierung und fachlich begründeter Aufbau („roter Faden“)<br />
entwicklungsbezogene Struktur („Entwicklungslogik“)<br />
3. Mögliche Darstellungsformen<br />
⋅ Flächige Darstellung (hierin spiegeln sich eher offene Formen wie Projekte,<br />
Werkstattarbeit oder Stationenlernen wieder)<br />
⋅<br />
tabellarische Darstellung (hierin spiegelt sich die gewählte zeitliche, oft auch inhaltliche<br />
Struktur der Unterrichtsreihe wieder). …<br />
Flächige Darstellung:<br />
Thema:<br />
Fachziel:<br />
Entwicklungsziel:<br />
Schülerideen<br />
Situative Bedingungen<br />
Thema:<br />
Fachziel:<br />
Entwicklungsziel:<br />
Thema:<br />
Fachziel:<br />
Entwicklungsziel:<br />
Thema:<br />
Fachziel:<br />
Entwicklungsziel:<br />
Thema:<br />
Fachziel:<br />
Entwicklungsziel:<br />
- 4 -
Tabellenform:<br />
Thema/<br />
Inhalt<br />
Fachziel der<br />
Unterrichtseinheit/-stunde<br />
Entwicklungsziel der<br />
Unterrichtseinheit/-stunde<br />
Für beide Darstellungsformen gilt: Jeder Unterricht ist prozessorientiert angelegt. Machen Sie<br />
deutlich, was Sie geplant haben und was sich im Unterrichtsprozess verändert hat.<br />
4. Darstellungen möglicher Umsetzungsformen<br />
Die Grundlage für Ihre Planungen ist das 2 Säulen Modell. Dabei lernen Sie in der Praxis viele<br />
unterschiedliche Formen kennen, in denen fachliche und entwicklungsbezogene Ziele<br />
zusammenfließen. Die hier vorgestellten Modelle sollen helfen, diese unterschiedlichen Formen<br />
in eine Struktur einzuordnen<br />
4.1 Fachziel und Entwicklungsziele liegen eng zusammen<br />
Fachziel und Entwicklungsziele liegen weit auseinander<br />
Fachliche Inhalte und Ziele sowie Entwicklungsaspekt und Ziele entwickeln sich in einer Reihe<br />
oder in einem Projekt miteinander oder parallel.<br />
Dabei kann es sein, dass Fachziele und Entwicklungsziele eng zusammenliegen (hier handelt es<br />
sich manchmal nur um unterschiedliche Perspektiven) oder Fachziele und Entwicklungsziele<br />
liegen weit auseinander und wurden von der Lehrperson zugeordnet.<br />
Fachziel<br />
Fachziel<br />
Fachziel<br />
Fachziel<br />
Fachziel<br />
Entwicklungsziele<br />
Entwicklungsziele<br />
Entwicklungsziele<br />
Entwicklungsziele<br />
Entwicklungsziele<br />
Zum Beispiel liegen im Fach Evangelische Religionslehre das Grundschullehrplanthema Ich und<br />
die Anderen eng mit dem Entwicklungsbereich Soziabilität und den Entwicklungsaspekten<br />
Teamfähigkeit, Regelbewusstheit u.ä. zusammen; im Fach Geographie beim Thema Orientierung<br />
mit Karten mit dem Entwicklungsbereich Wahrnehmung und dem Entwicklungsaspekt<br />
Räumliches Vorstellungsvermögen.<br />
Andererseits kann im Fach Mathematik im Entwicklungsbereich Soziabilität der<br />
Entwicklungsaspekt Kooperation gefördert werden.<br />
- 5 -
Nachstehend folgt ein Beispiel aus dem Sachunterricht, bei dem Fach- und<br />
Entwicklungsaspekt eng zusammenliegen:<br />
Thema der Reihe: Wir beobachten das Wetter und dokumentieren wichtige<br />
Wettererscheinungen mit Hilfe unserer Wetterstation.<br />
Fachziel der Reihe:<br />
Die SuS erhalten die Möglichkeit ausgewählte wetterkonstituierende Aspekte kennen zu lernen.<br />
Entwicklungsbereich:<br />
Lern-/Arbeitsverhalten<br />
Entwicklungsaspekt: Methodenkompetenz<br />
Entwicklungsziel der Reihe:<br />
Die SuS erhalten die Möglichkeit ihre Kompetenzen innerhalb der fachspezifischen Arbeitsweisen<br />
des Messens (Ablesen, Einschätzen) und der Dokumentation (Eintragen in Tabellen, Nutzung<br />
von Symbolen) zu erweitern.<br />
Thema<br />
So ein Wetter....<br />
Für Wettererscheinungen<br />
gibt es Zeichen<br />
Verschiedene<br />
Wolkenarten –<br />
anderes Wetter<br />
Es tröpfelt und<br />
es gießt ...<br />
Warm und kalt<br />
Wie stark ist der<br />
Wind und<br />
woher kommt<br />
er<br />
Fachziel<br />
Die SUS erhalten die Möglichkeit...<br />
...ausgewählte Wettergeräusche in<br />
Kombination mit Bildern zu klassifizieren<br />
(Niederschlag, Bewölkung, Wind,<br />
Temperatur) sowie ihr Vorwissen zu<br />
aktivieren.<br />
...eine Wettertafel zur Darstellung der<br />
Wettererscheinungen (s.o.) als<br />
Dokumentationsgrundlage zu erstellen.<br />
... verschiedene Wolkenarten<br />
(Schleier-, Schäfchen-, Regen-,<br />
Gewitterwolken) als Hinweise auf das Wetter<br />
kennen zu lernen.<br />
... zwischen Niesel-, Platz- und Dauerregen zu<br />
unterscheiden.<br />
.... unterschiedliche Bildsequenzen hinsichtlich<br />
der angenommenen Temperatur zu ordnen<br />
und das Thermometer als<br />
Bestimmungsinstrument kennen zu lernen.<br />
...die Komponenten Windrichtung und -<br />
stärke nach dem Bau eines Windmessers als<br />
Wettermerkmale zu bestimmen.<br />
Entwicklungsziel<br />
Die SUS erhalten die Möglichkeit...<br />
...Symbole zur Darstellung von<br />
Wettererscheinungen als Protokollgrundlage<br />
kennen zu lernen<br />
...verschiedene Symbole zum Bewölkungsgrad<br />
als erste Wettererscheinung zur<br />
Wetterbeobachtung und –dokumentation<br />
(Eintrag in Wettertafel) zu nutzen.<br />
... ein Regenmessgerät zur Bestimmung und<br />
Dokumentation der Niederschlagsmenge<br />
(ablesen Skala, einzeichnen in Messskala auf<br />
Wettertafel) zu nutzen.<br />
....die Temperatur an der Celsius-Skala des<br />
Thermometers abzulesen u. gemessene Werte<br />
in das Wetterprotokoll einzutragen.<br />
... die am Windmessgerät abzulesenden<br />
Komponenten „genau“ zu bestimmen und in<br />
das Wetterprotokoll einzuordnen und zu<br />
übertragen.<br />
In der verbleibenden Zeit bis zu den Winterferien werden die täglichen Messungen fortgesetzt. Anhand der aktuellen<br />
Wettertafel werden täglich Wetterberichte in Kurzform vorgetragen.<br />
- 6 -
4.2 Es gibt keinen Fachaspekt – nur einen Entwicklungsaspekt<br />
Beispiel:<br />
Eine Spielgruppe einer Förderschule E/S lässt sich im Alltag nur schwer nachvollziehbar an einen<br />
fachlichen Aspekt angliedern<br />
Fach entfällt<br />
Entwicklungsziel<br />
⋅<br />
⋅<br />
⋅<br />
⋅<br />
Spielgruppe<br />
Soziales Lernen<br />
Basale Förderung<br />
Unterstützte<br />
Kommunikation<br />
Bei Unterrichtsbesuchen kann diese Form höchstens einmal und dann auch nur in der<br />
Fachrichtung gezeigt werden. Diese Form ist für Prüfungen nicht geeignet, da sie nicht der OVP<br />
entspricht.<br />
4.3 Zu einem Fachaspekt gibt es mehrere Entwicklungsbereiche<br />
Fachziel Entwicklungsziel für<br />
Schüler x<br />
Fachziel<br />
Entwicklungsziel<br />
Schüler y<br />
für<br />
Entwicklungsziel für...<br />
Entwicklungsziel für...<br />
Entwicklungsziel für...<br />
Entwicklungsziel für...<br />
Hierbei ist auf der Fachseite auf einen strukturellen Aufbau zu achten; die individuellen<br />
Entwicklungsziele für einzelne Schülerinnen und Schüler bzw. Teilgruppen sollen eine<br />
Entwicklungslogik erkennbar werden lassen.<br />
4.4 Zu einem Entwicklungsaspekt gibt es mehrere Fachaspekte<br />
Fachliche Inhalte und Ziele entwickeln sich aufeinanderbauend in einer zeitlichen Struktur,<br />
während entwicklungsbezogene Inhalte und Anliegen innerhalb eines bestimmten Zeitraumes in<br />
unterschiedlichen Kontexten und/oder Fächern bearbeitet können.<br />
In der gezeigten Deutschstunde, die in eine mehrwöchige Reihe eingeordnet ist, wird ein<br />
Entwicklungsaspekt bearbeitet, der in dieser Woche insgesamt im Unterricht der Klasse fokussiert<br />
ist; z.B. Umgang mit Regeln. Im Wocheneingangsgespräch wurden das Grundproblem<br />
- 7 -
thematisiert und erste Regeln vereinbart, in anderen Stunden wurden Regeln angewandt,<br />
ausprobiert und reflektiert.<br />
Deutsch<br />
Fachziel<br />
Wocheneingangsgespräch<br />
EA Umgang mit<br />
Regeln<br />
Biologie<br />
EA Umgang mit<br />
Regeln<br />
Deutsch<br />
Fachziel<br />
EA Umgang mit Regeln<br />
Erdkunde<br />
EA Umgang mit Regeln<br />
Deutsch<br />
Fachziel<br />
4.5 Verschiedene Fachaspekte und verschiedene Entwicklungsaspekte<br />
Wochenthema<br />
Werkstattlernen<br />
Projektarbeit fächerübergr. Arbeiten<br />
Fachimmanente unterschiedliche<br />
Perspektiven bzw. Teilbereiche<br />
verschiedene Entwicklungsaspekte<br />
Hier bietet sich vorrangig die flächige Darstellungsform an (s.o.)<br />
5. Nachbemerkung<br />
Grundsätzlich bleibt Ihnen die Form der schriftlichen Darstellung überlassen.<br />
Die Kontext- oder reihenbezogene Planung hängt vom zugrundeliegenden Denkmodell oder den<br />
jeweiligen Zielen ab.<br />
- 8 -
Didaktischer Begründungszusammenhang<br />
Umfang: ca. 1 Seite<br />
Zielsetzung: Der Inhalt der Reihe/des Kontextes wird begründet.<br />
Sie begründen mithilfe des didaktischen Begründungszusammenhangs ihre fachlichen<br />
Schwerpunktsetzungen, indem Sie Ihre eigene theoriegeleitete Auseinandersetzung mit dem<br />
Inhalt darstellen. Sie können als Ergänzung an dieser Stelle auch ihr methodisches Vorgehen<br />
theoriegeleitet begründen.<br />
Fachliche Begründungsebene:<br />
⋅ Unter Bezugnahme auf die Schülergruppe und/oder aktuelle Lernanlässe<br />
⋅ Unter Bezugnahme auf die entsprechende Fachdidaktik bzw. theoretische Konzepte und<br />
Ansätze, die sich auf das spezielle Thema beziehen (z.B. im Fach Biologie: Fachdidaktik<br />
Biologie plus Themenheft/Basisartikel in der Zeitschrift „Unterricht Biologie“)<br />
⋅ Unter Bezugnahme auf die Richtlinien bzw. schulinterne Curricula<br />
Entwicklungsbezogene Begründungsebene:<br />
⋅ Unter Bezugnahme auf die Lern- und Entwicklungsbedürfnisse der Lerngruppe (im<br />
Einzelfall auch einzelner Schülerinnen und Schüler)<br />
⋅ Unter Bezugnahme auf die Didaktik der Fachrichtung<br />
⋅ Unter Bezugnahme auf Förderkonzepte, bzw. –ansätze im gewählten<br />
Entwicklungsbereich<br />
⋅<br />
Unter Bezugnahme auf die „Allgemeinen Empfehlungen zum Förderschwerpunkt“ (LE,<br />
KM, EZ etc.) sowie schulinterne Curricula<br />
- 9 -
Lernvoraussetzungen<br />
Umfang: ca. 1-2 Seiten<br />
Die Kenntnis der Lernausgangslage* der Schülerinnen und Schüler ist notwendige Voraussetzung<br />
für die Individualisierung der Planung und Durchführung von Unterricht.<br />
Kriterien für die Erhebung<br />
⋅<br />
⋅<br />
⋅<br />
⋅<br />
⋅<br />
Die Lernausgangsauslage der gesamten Gruppe bezogen auf den inhaltlichen und<br />
entwicklungsbezogenen Kontext sollte vor der individualisierten Darstellung für alle<br />
Schüler kurz skizziert werden.<br />
Die schriftliche Darstellung der Lernvoraussetzungen bezieht sich auf die gewählten<br />
fach-und entwicklungsbezogenen Ziele der Unterrichtsstunde<br />
Schriftlich werden exemplarisch für mindestens zwei Schülerinnen und Schüler die<br />
Lernvoraussetzungen dokumentiert.<br />
Die Auswahl dieser SuS wird kurz begründet<br />
Werden mehrere Ziele verfolgt (zieldifferent), müssen für jedes dieser Ziele die<br />
Lernvoraussetzungen erhoben werden.<br />
Kriterien für Formulierungen<br />
1. schülerbezogene Versprachlichung<br />
2. konkret beschreibende und situationsbezogene Formulierungen<br />
3. nicht etikettierend, nicht festschreibend, nicht stigmatisierend<br />
4. Adjektive und Verben sind Substantiven vorzuziehen<br />
Beispiel: „Peter kann neben der Lehrerin / dem Lehrer im Stuhlkreis einige Minuten einem<br />
Unterrichtsvortrag folgen.“ Und nicht: „Peter hat ADS.“<br />
5. theoriebezogene „Wissenschaftssprache“<br />
6. ressourcen- und entwicklungsorientiert<br />
7. konkret formulierte Konsequenzen mit evtl. Hilfen - diese Maßnahmen können medialer,<br />
inhaltlicher, methodischer oder personaler Art sein.<br />
- 10 -
Mögliche schriftliche Darstellungsformen in Anlehnung an unterschiedliche Konzepte:<br />
1. Möglichkeit:<br />
Phasen/Prozess<br />
Handlungs-schritte<br />
1. Einstieg<br />
- fachliche<br />
Anforderungen<br />
...<br />
entwicklungsbezogene<br />
Herausforderungen<br />
...<br />
Gruppe Schüler 1 Schüler 2 ...<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
Konsequen- Konsequenz- Konsequenzen/Hilfen/<br />
en/Hilfen/ zen/Hilfen/<br />
Alternativen Alternativen Alternativen<br />
2. Möglichkeit:<br />
Lernvoraussetzungen für ......, bezogen auf das Entwicklungsziel (entsprechend auch für die<br />
fachlichen Intentionen/Absichten)<br />
Teilkompetenzen<br />
Aktuelle<br />
Entwicklungs<br />
Zone der nächsten<br />
Entwicklung<br />
Konsequenzen,<br />
Hilfen, Alternativen<br />
3. Möglichkeit:<br />
Name<br />
Lernvoraus-<br />
setzungen<br />
Hypothesen über<br />
die Kompetenzen<br />
der SuS<br />
Mögliche<br />
Erweiterung der<br />
Kompetenzen<br />
Aus den<br />
Hypothesen<br />
abgeleitete<br />
inhaltliche<br />
Angebote<br />
Bezogen auf das Ziel....<br />
- 11 -
<strong>Entflechtung</strong> und Vernetzung der didaktischen<br />
Schwerpunkte (Entwicklungs- und Fachaspekt)<br />
Umfang: ca. 1-2 Seiten<br />
1. Ziel:<br />
Ziel des Planungselements ist es, die fachdidaktischen und förderkonzeptionellen Entscheidungen<br />
des Unterrichtskontextes wissenschaftlich zu begründen und unterrichtsbezogen differenziert<br />
darzustellen.<br />
2. Erläuterung der Begriffe:<br />
<strong>Entflechtung</strong> bedeutet eine wissenschaftlich begründete Analyse des Entwicklungsaspektes sowie<br />
des Fachaspektes in Teilaspekte. Dabei werden drei Ebenen beleuchtet:<br />
⋅<br />
⋅<br />
⋅<br />
fachwissenschaftlich einordnen<br />
fachdidaktisch und förderkonzeptionell legitimieren<br />
auf die Lerngruppe hin elementarisieren.<br />
Vernetzung bedeutet, die vielfältigen Beziehungen zwischen den, aus der <strong>Entflechtung</strong><br />
gewonnenen, Teilaspekten deutlich zu machen.<br />
3. Darstellungsformen:<br />
⋅ Graphik oder<br />
⋅ Fließtext (s.u.)<br />
4. Qualitäts- und Beurteilungskriterien<br />
⋅ Entwicklungs- und Inhaltsaspekte fundiert und differenziert darstellen<br />
⋅ Literaturbezug herstellen<br />
⋅ eine begründete Auswahl und Elementarisierung der Inhalte bezogen auf die Lerngruppe<br />
herausstellen<br />
⋅ Kontext entwicklungs- und fachbezogen verdeutlichen<br />
⋅ Teilkompetenzen für die Lernvoraussetzungen aufzeigen<br />
⋅ Exemplarisch die gezeigte Stunde entwicklungs- und/oder fachbezogen verknüpfen<br />
⋅ Optional: Ausgewählte Methoden und Medien integrieren<br />
5. Es gibt folgende Möglichkeiten der Schwerpunktsetzung:<br />
a) Entwicklungs- und Fachaspekt liegen eng zusammen.<br />
Beispiel:<br />
Fach: Erdkunde / Sachunterricht<br />
Entwicklungsbereich: Wahrnehmung<br />
Fachaspekt: Raumorientierung<br />
Entwicklungsaspekt: räumliche Orientierung<br />
- 12 -
) Entwicklungs- und Fachaspekt sind unterschiedlich.<br />
Beispiel:<br />
Fach: Mathematik<br />
Entwicklungsbereich: Soziabilität<br />
Fachaspekt: Geometrische Grundformen<br />
Entwicklungsaspekt: Umgang mit Regeln<br />
c) Zu einem Fachaspekt gibt es mehrere Entwicklungsaspekte.<br />
Beispiel:<br />
Fach: Deutsch<br />
Entwicklungsbereiche:<br />
Emotionalität<br />
Wahrnehmung<br />
Kognition<br />
Fachaspekt: Phonem-Graphem-Korrespondenz<br />
Entwicklungsaspekt: Lesemotivation<br />
Entwicklungsaspekt: Figur-Grund-<br />
Wahrnehmung<br />
Entwicklungsaspekt: Kategorienbildung<br />
d) Zu einem Entwicklungsaspekt gibt es mehrere Fachaspekte.<br />
Beispiel:<br />
Fächer:<br />
Sachunterricht<br />
Kunst<br />
fächerübergreifender Unterricht<br />
Entwicklungsbereich: Kognition<br />
Fachaspekt: Tulpe<br />
Fachaspekt: Drucktechniken<br />
Entwicklungsaspekt: Zusammenhänge<br />
erkennen<br />
e) Es gibt einen Inhaltsaspekt und einen Entwicklungsaspekt, die eng miteinander<br />
verbunden sind. (Geeignete Schwerpunktsetzung für die Förderung von Schülerinnen und<br />
Schülern mit Schwerhinderung)<br />
Beispiel:<br />
Inhalt: Spiel<br />
Entwicklungsbereich: Soziabilität<br />
Entwicklungsaspekt: Regeln einhalten<br />
- 13 -
Darstellung in Textform<br />
Entwicklungsanliegen<br />
⋅ Es wird deutlich gemacht, aus welchem Entwicklungsbereich oder welchen<br />
Entwicklungsbereichen das Entwicklungsanliegen abgeleitet wird.<br />
⋅<br />
⋅<br />
⋅<br />
⋅<br />
Die Ableitung des Entwicklungsanliegens erfolgt nicht unbedacht anhand eines<br />
vorgegebenen Schemas (zum Beispiel kann das Lern- und Arbeitsverhalten nicht immer<br />
aus dem Bereich Kognition abgeleitet werden).<br />
Die theoretischen und konzeptionellen Grundlagen des Entwicklungsanliegens werden<br />
dargestellt und durch Literaturangaben belegt.<br />
Das Entwicklungsziel wird auf Basis des Entwicklungsanliegens begründet dargestellt.<br />
Die konkreten Maßnahmen zur Umsetzung des Entwicklungsziels werden erläutert.<br />
Fachanliegen<br />
⋅ Es wird erläutert wie der Inhalt der Unterrichtsreihe in die Fachstruktur des Faches<br />
eingebunden ist.<br />
⋅<br />
⋅<br />
⋅<br />
⋅<br />
Der gewählte Inhalt der Unterrichtsreihe wird in seiner Sachstruktur dargestellt.<br />
Wenn es Konzepte zur Vermittlung des gewählten Inhalts gibt, werden diese dargestellt.<br />
Es wird erläutert, welches Teilthema in der gezeigten Unterrichtsstunde umgesetzt wird.<br />
Die Umsetzung wird kurz begründet, Maßnahmen dargestellt.<br />
Die Verknüpfung<br />
⋅<br />
Die Verknüpfung der Umsetzung des Fach- und Entwicklungsziels wird dargestellt.<br />
- 14 -
Glossar<br />
Anliegen<br />
Der Begriff „Anliegen“ hat den didaktischen Bezug zur Themenzentrierten Interaktion (TZI)<br />
mit dem wissenschaftlichen Bezug zur humanistischen Psychologie und Pädagogik.<br />
Annahme: „Erst die bewusste und akzeptierte Möglichkeit, dass das Lernen der Schüler anderen<br />
Zielen folgt als meinen Wünschen und Vorgaben, schafft Freiraum für Lebendiges<br />
Lernen.“(Reiser)<br />
Literatur: Reiser, H./ Lotz, W.: Themenzentrierte Interaktion als Pädagogik. Mainz 1995<br />
Cohn, Ruth C, Terfurth , Christina: Lebendiges Lehren und Lernen. TZI macht<br />
Schule. Stuttgart 1993<br />
Bildungsgang<br />
Ein Bildungsgang ist die schulische Laufbahn zu dem jeweiligen Abschluss (Beispiele:<br />
Bildungsgang Gymnasium, Bildungsgang Realschule, Bildungsgang Hauptschule)<br />
Entwicklungsbereiche, Entwicklungsaspekte<br />
Entwicklung vollzieht sich im Verlauf des gesamten Lebens eines jeden Menschen, insbesondere<br />
auch in der Kindheit und Jugend. Die Entwicklungspsychologie nennt in diesem Zusammenhang<br />
Bereiche wie Motorik, Sensorik, Kognition, Sprache, Emotion und Sozialverhalten. Aus diesen<br />
Entwicklungsbereichen lassen sich Entwicklungsaspekte ableiten wie Praxie, Visuelle<br />
Wahrnehmung, Problemlösendes Denken, Kommunikation, Selbstkonzept, Konfliktverhalten.<br />
Diese Entwicklungsaspekte sind für eine erste Aufgabenbestimmung und Strukturierung<br />
geeignet. Um als effektive Grundlage für die Unterrichtsplanung dienen zu können, sollten sie -<br />
je nach Voraussetzungen der Lerngruppe – in weitere Teilaspekte differenziert werden. Eine<br />
Übersicht über die Entwicklungsaspekte und deren Teilaspekte findet sich z.B. in: SCHMISCHKE,<br />
J./BRAUN, D.: Entwicklungsaufgaben im Förderschwerpunkt Lernen. In: Zeitschrift für<br />
Heilpädagogik 9 (2006) 344-350.<br />
Förderschwerpunkt<br />
Beschreibt den vorrangigen Förderbedarf von Schülerinnen und Schülern (zum Beispiel Lernen,<br />
geistige Entwicklung). Mithilfe der Förderschwerpunkte werden die nordrhein-westfälischen<br />
Förderschulen untergliedert.<br />
Humanistische Pädagogik<br />
Humanistische Pädagogik ist eine Einstellung und Praxis in der Erziehung und<br />
Erwachsenenpädagogik, die den Aspekten der Freiheit, der Wertschätzung, der Würde und der<br />
Integrität von Personen ein großes Gewicht beimisst. Ihre philosophischen Wurzeln hat sie in<br />
den Ideen des Humanismus und des Existenzialismus.<br />
- 15 -
Konstruktivismus<br />
Philosophisch, naturwissenschaftlich oder soziologisch begründete Theorie, die im wesentlichen<br />
davon ausgeht, dass Lebewesen oder soziale Systeme zu Veränderungsprozessen angeregt, aber<br />
nicht determiniert werden können.<br />
Kontext<br />
Der Begriff „Kontext“ entspricht im Vergleich zur „Reihe“ eher einer offenen Zugangsweise zu<br />
einem Inhalt. Die Teilinhalte müssen nicht zwingend aufeinander aufbauen (Beispiel:<br />
Projektunterricht).<br />
Lernausgangslage<br />
Beschreibt die aktuellen Kompetenzen der gesamten Lerngruppe bezogen auf die fachlichen und<br />
entwicklungsbezogenen Ziele.<br />
Lernbereich<br />
Fachdidaktische Schwerpunktsetzung; z.B. Deutsch → mündliches Sprachhandeln.<br />
Lernchance<br />
Der Begriff „Lernchance“ ist der konstruktivistischen Didaktik zuzuordnen mit dem<br />
wissenschaftlichen Bezug zu Systemtheorien und Konstruktivismus.<br />
Annahme: „Da sich jedes lebende System nur entsprechend seiner Struktur verhalten kann, ist es<br />
zwar durch externe Bedingungen beeinflussbar, aber nicht steuerbar. Interaktion mit der Umwelt<br />
können keine Veränderungen vorschreiben, instuieren, sondern nur Anstöße zu strukturellen<br />
Veränderungen geben, die das System gemäß seiner inneren Struktur vollzieht.“(Kösel)<br />
Literatur:<br />
Kösel, Edmund: Die Modellierung von Lernwelten. Ein Handbuch zur<br />
subjektiven Didaktik. Elztal -Dallau 1997 – 3. Auflage<br />
Reich, Kersten: Systemisch-konstruktivistische Pädagogik. Neuwied 1997, 2.<br />
Auflage<br />
Lernziel<br />
Der Begriff „Lernziel“ ist der lernzielorientierten Didaktik zuzuordnen mit dem Theoriebezug zur<br />
Lernpsychologie (Behaviorismus, Reiz-Reaktionslernen).<br />
Annahme: Lernziele als beabsichtigte Verhaltensänderungen:<br />
sprachlich fassbar<br />
taxonomieren<br />
hierarchisieren<br />
→ operationalisieren<br />
→ in Dimensionen einordnen (sozial, emotional, kognitiv)<br />
→ Richtziele, Grobziele, Feinziele<br />
- 16 -
Literatur: Blankertz, Herwig: Theorien und Modelle der Didaktik. München 1975 – 2.<br />
Auflage<br />
Lernzielorientierter Unterricht<br />
Lernzielorientierter Unterricht beschreibt ein Konzept, bei dem zuerst die Lernziele ausgewählt<br />
und danach Inhalte, Methoden und Medien festgelegt werden, wobei Transparenz und Präzision<br />
angestrebt werden. Dieses Modell orientiert sich an der wissenschaftstheoretischen Position des<br />
Behaviorismus, der die Bedeutung von beobachtbarem Verhalten betont.<br />
Unterrichtsreihe<br />
Der Begriff „Reihe“ entspricht, im Vergleich zum „Kontext“ eher einer gewissen Sachlogik, mit<br />
der die einzelnen Teilinhalte in einer bestimmten Abfolge aufeinander aufbauen.<br />
Unterrichtseinheit<br />
Unterteilung einer Unterrichtsreihe, eines Kontextes, die länger als ein Unterrichtsstunde sein<br />
kann, wie zum Beispiel eine Doppelstunde.<br />
- 17 -