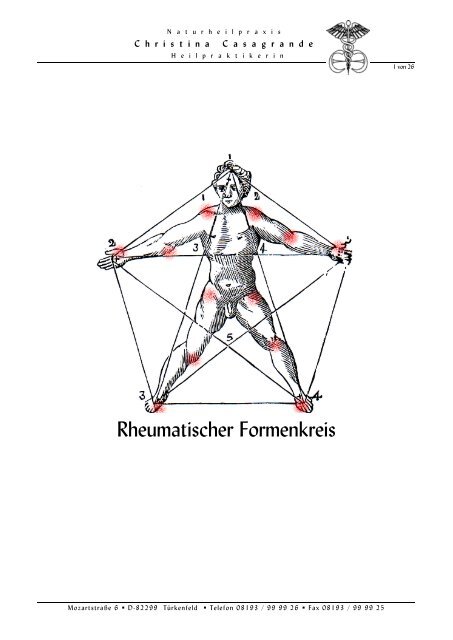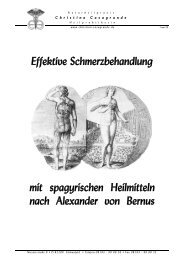Rheumatischer Formenkreis - Naturheilpraxis Christina Casagrande
Rheumatischer Formenkreis - Naturheilpraxis Christina Casagrande
Rheumatischer Formenkreis - Naturheilpraxis Christina Casagrande
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
N a t u r h e i l p r a x i s<br />
C h r i s t i n a C a s a g r a n d e<br />
H e i l p r a k t i k e r i n<br />
<strong>Rheumatischer</strong> <strong>Formenkreis</strong><br />
Mozartstraße 6 � D -82299 Türkenfeld � Telefon 08193 / 99 99 26 � Fax 08193 / 99 99 25<br />
1 von 26
N a t u r h e i l p r a x i s<br />
C h r i s t i n a C a s a g r a n d e<br />
H e i l p r a k t i k e r i n<br />
Mozartstraße 6 � D -82299 Türkenfeld � Telefon 08193 / 99 99 26 � Fax 08193 / 99 99 25<br />
2 von 26<br />
1 Arthrose ............................................................................................................................... 4<br />
1.1 Überblick ....................................................................................................................... 4<br />
1.1.1 Definition/Allgemeines ............................................................................................ 4<br />
1.1.2 Symptome .............................................................................................................. 4<br />
1.1.3 Diagnose ................................................................................................................ 4<br />
1.1.4 Verlauf .................................................................................................................... 5<br />
1.1.5 Ursachen ................................................................................................................ 5<br />
1.1.6 Prophylaxe ............................................................................................................. 5<br />
1.2 Therapie ........................................................................................................................ 6<br />
1.2.1 Naturheilkunde: ...................................................................................................... 6<br />
1.2.2 Schulmedizin .......................................................................................................... 6<br />
2 Rheumatoide Arthritis .......................................................................................................... 7<br />
2.1 Überblick ....................................................................................................................... 7<br />
2.1.1 Definition/Allgemeines ............................................................................................ 8<br />
2.1.2 Symptome .............................................................................................................. 8<br />
2.1.3 Diagnose ................................................................................................................ 9<br />
2.1.4 Verlauf .................................................................................................................... 9<br />
2.1.5 Ursachen .............................................................................................................. 10<br />
2.1.6 Prophylaxe ........................................................................................................... 10<br />
2.2 Therapie ...................................................................................................................... 10<br />
2.2.1 Naturheilkunde ..................................................................................................... 10<br />
2.2.2 Schulmedizin ........................................................................................................ 10<br />
3 Fibromyalgie ...................................................................................................................... 12<br />
3.1 Überblick ..................................................................................................................... 12<br />
3.1.1 Definition/Allgemeines .......................................................................................... 12<br />
3.1.2 Symptome ............................................................................................................ 12<br />
3.1.3 Diagnose .............................................................................................................. 13<br />
3.1.4 Entstehung ........................................................................................................... 13<br />
3.2 Therapie ...................................................................................................................... 14<br />
3.2.1 Naturheilkunde ..................................................................................................... 14<br />
3.2.2 Schulmedizin ........................................................................................................ 14<br />
4 Gicht .................................................................................................................................. 15<br />
4.1 Überblick ..................................................................................................................... 15<br />
4.1.1 Definition/Allgemeines .......................................................................................... 15<br />
4.1.2 Symptome ............................................................................................................ 16<br />
4.1.3 Diagnose .............................................................................................................. 17<br />
4.1.4 Verlauf .................................................................................................................. 17<br />
4.1.5 Ursachen .............................................................................................................. 17<br />
4.1.6 Prophylaxe ........................................................................................................... 18
N a t u r h e i l p r a x i s<br />
C h r i s t i n a C a s a g r a n d e<br />
H e i l p r a k t i k e r i n<br />
Mozartstraße 6 � D -82299 Türkenfeld � Telefon 08193 / 99 99 26 � Fax 08193 / 99 99 25<br />
3 von 26<br />
4.2 Therapie ...................................................................................................................... 18<br />
4.2.1 Naturheilkunde ..................................................................................................... 18<br />
4.2.2 Schulmedizin ........................................................................................................ 18<br />
5 Morbus Bechterew ............................................................................................................. 20<br />
5.1 Überblick ..................................................................................................................... 20<br />
5.1.1 Definition/Allgemeines .......................................................................................... 20<br />
5.1.2 Symptome ............................................................................................................ 20<br />
5.1.3 Diagnose .............................................................................................................. 21<br />
5.1.4 Entstehung ........................................................................................................... 22<br />
5.2 Therapie ...................................................................................................................... 23<br />
5.2.1 Naturheilkunde ..................................................................................................... 23<br />
5.2.2 Schulmedizin ........................................................................................................ 23<br />
6 Reiter Syndrom .................................................................................................................. 24<br />
6.1 Überblick ..................................................................................................................... 24<br />
6.1.1 Definition/Allgemeines .......................................................................................... 24<br />
6.1.2 Entstehung ........................................................................................................... 24<br />
6.1.3 Symptome ............................................................................................................ 25<br />
6.2 Therapie ...................................................................................................................... 25<br />
6.2.1 Naturheilkunde ..................................................................................................... 25<br />
6.2.2 Schulmedizin ........................................................................................................ 26<br />
7 Quellenangabe und Literaturhinweise ............................................................................... 26
1 Arthrose<br />
N a t u r h e i l p r a x i s<br />
C h r i s t i n a C a s a g r a n d e<br />
H e i l p r a k t i k e r i n<br />
1.1 Überblick<br />
Unter Arthrose ("Gelenkverschleiß") versteht man einen Gelenkschaden, der häufig durch<br />
Fehlbelastungen verursacht ist. Auch nach Verletzungen oder bei angeborenen<br />
Knorpeldefekten kann es dazu kommen. Die Arthrose beginnt mit einem Abbau des<br />
Gelenkknorpels, im Anschluss kommt es zu Umbauprozessen im angrenzenden Knochen<br />
mit Zerstörung der Gelenkfläche.<br />
Folgen sind Schmerzen und Steifigkeit des Gelenks, zunehmende Verformung, und im<br />
Endstadium kann das Gelenk ganz verknöchern. Der Prozess kann durch verschiedene<br />
Maßnahmen verzögert werden, die endgültige Therapie ist der operative Gelenkersatz.<br />
1.1.1 Definition/Allgemeines<br />
Unter einer Arthrose versteht man eine Erkrankung des Gelenkknorpels, welcher zu einem<br />
Abbau des knorpelnahen Knochens führt und Schmerzen, Schwellungen,<br />
Bewegungseinschränkungen und eine Deformierung der Gelenke verursacht. Die Arthrose<br />
zählt man daher zu den degenerativen Gelenkerkrankungen. Im Volksmund spricht man<br />
auch von "Gelenkverschleiß".<br />
Mozartstraße 6 � D -82299 Türkenfeld � Telefon 08193 / 99 99 26 � Fax 08193 / 99 99 25<br />
4 von 26<br />
Grundsätzlich kann eine Arthrose an jedem Gelenk entstehen. Am häufigsten sind die durch<br />
das Körpergewicht belasteten Knie- (Gonarthrose) und Hüftgelenke (Koxarthrose) betroffen.<br />
Weitere häufig betroffene Gelenke sind die kleinen Wirbelsäulengelenke (Spondylarthrose),<br />
Fingerendgelenke (Heberden-Arthrose), Mittelgelenke (Bouchard-Arthrose) und das<br />
Daumensattelgelenk (Rhizarthrose).<br />
1.1.2 Symptome<br />
Typische Symptome einer Arthrose sind Schmerzen und Steifigkeit der Gelenke. Diese<br />
Schmerzen werden durch kalte und feuchte Witterung und durch Belastungen verstärkt. Vor<br />
allem stoßartige Belastungen wie treppab steigen bei der Kniegelenksarthrose sind<br />
schmerzhaft. Dagegen ist Fahrrad fahren meist ohne Probleme möglich.<br />
Charakteristisch für eine Arthrose ist auch der so genannte Anlaufschmerz. Nach längerem<br />
Ruhen sind die ersten Bewegungen schmerzhaft und erst nach einigen Metern werden sie<br />
besser. Die Arthrose unterscheidet sich daher von den entzündlichen Erkrankungen der<br />
Gelenke, welche meist vor allem morgendliche Schmerzen zeigen. Auch die<br />
Morgensteifigkeit der Gelenke, welche bei entzündlichen Erkrankungen wie der<br />
rheumatoiden Arthritis oft über Stunden auftritt, kommt bei der Arthrose nur für wenige<br />
Momente, bis sich die Gelenke "eingelaufen" haben, vor.<br />
Im weiteren Verlauf der Arthrose kommt es durch den Knorpelabrieb zu Reizungen des<br />
Gelenks mit Schwellungen und Ergüssen und später auch zu Verformungen der Gelenke.<br />
1.1.3 Diagnose<br />
Die Diagnose einer Arthrose ist meist schon anhand der typischen Krankengeschichte und<br />
äußerlichen Eigenschaften der Gelenke zu stellen. Dabei werden der Bewegungsumfang<br />
und -schmerz, die Bandstabilität, Schwellungen, Hautveränderungen und druckschmerzhafte
N a t u r h e i l p r a x i s<br />
C h r i s t i n a C a s a g r a n d e<br />
H e i l p r a k t i k e r i n<br />
Punkte beurteilt. Vor allem bei Schäden der Knie- und Hüftgelenke sind Auffälligkeiten im<br />
Gangbild zu erkennen.<br />
1.1.4 Verlauf<br />
Da die Verläufe einer Arthrose individuell unterschiedlich und die Ursachen vielfältig und<br />
nicht immer eindeutig definierbar sind, lässt sich über den natürlichen Verlauf ohne<br />
Behandlung keine exakte Prognose geben. Grundsätzlich nimmt die Intensität der<br />
Beschwerden mit Dauer der Erkrankung zu.<br />
Mit Hilfe arthroskopischer oder offener Gelenkeingriffe kann eine vorübergehende<br />
Schmerzlinderung erreicht werden. Das Fortschreiten der Krankheit lässt sich auf diese<br />
Weise aber nicht verhindern. Durch eine Osteotomie kann der natürliche Verlauf der<br />
Arthrose in Abhängigkeit vom Krankheitsstadium, der Instabilität der Bänder und dem Alter<br />
verzögert werden.<br />
Mozartstraße 6 � D -82299 Türkenfeld � Telefon 08193 / 99 99 26 � Fax 08193 / 99 99 25<br />
5 von 26<br />
Für Gelenkprothesen liegen nur teilweise Langzeitstudien vor. So müssen beispielsweise 2,5<br />
Prozent der künstlichen Kniegelenke nach sieben Jahren ausgetauscht werden, bei<br />
künstlichen Hüftgelenken ca. 0,5 Prozent pro Jahr. Generell steigt nach 10 bis 15 Jahren die<br />
jährliche Wechselrate an.<br />
1.1.5 Ursachen<br />
Eine Arthrose entsteht durch ein Missverhältnis von Belastung und Belastbarkeit des<br />
Gelenkknorpels, wodurch sich dieser zurückbildet. Dieses Missverhältnis kann durch eine<br />
erblich bedingte Störung des Knorpels oder durch eine Fehlbelastung entstehen. So kann<br />
z.b. eine X-Bein-Stellung (Valgusfehlstellung) der Knie oder eine leichte<br />
Hüftgelenksfehlstellung zu einer ungleichmäßigen Belastung und damit zu einer Arthrose der<br />
entsprechenden Gelenke führen.<br />
Auch zurückliegende Verletzungen wie Knochenbrüche oder Kapsel-Band-Verletzungen, die<br />
zu einer Instabilität des Gelenks führen, können eine Arthrose verursachen. In den<br />
Gelenken, welche das Körpergewicht tragen müssen (Knie, Hüften, Wirbelsäule) spielt auch<br />
Übergewicht eine wichtige Rolle. Weitere Ursachen für eine Arthrose können<br />
Gelenkentzündungen oder Stoffwechselstörungen wie Gicht, Diabetes mellitus, Pseudogicht<br />
(Chrondokalzinose) oder Bluterkrankheit (Hämophilie) sein.<br />
Auslöser einer Arthrose ist die Verletzung bzw. Abnutzung des schützenden Knorpels, bis<br />
der Knochen teilweise oder sogar ganz freiliegt. Da der defekte Knorpel den Knochen nicht<br />
mehr vor Stößen und großer Belastung schützen kann, versucht der Knochen die<br />
Überlastung auszugleichen, indem er verstärkt Knochensubstanz bildet. Dadurch kommt es<br />
zu Deformierungen und knotigen Verdickungen der betroffenen Gelenke. Knochenausläufer,<br />
die um das kranke Gelenk herum entstehen, werden Osteophyten genannt.<br />
Gleichzeitig kann abgeriebenes Knorpel- und Knochenmaterial eine Entzündung der<br />
umgebenden Gelenkhaut (Detritussynovitis) verursachen. Dadurch können die Gelenke<br />
immer wieder überwärmt und gerötet sein. Außerdem kann ein Gelenkerguss entstehen.<br />
Man nennt dies auch aktivierte Arthrose.<br />
1.1.6 Prophylaxe<br />
Durch gezieltes Muskeltraining, viel Bewegung und Vermeiden von Überlastungen kann<br />
einer Arthrose vorgebeugt werden. Schon bei Neugeborenen lässt sich durch eine
N a t u r h e i l p r a x i s<br />
C h r i s t i n a C a s a g r a n d e<br />
H e i l p r a k t i k e r i n<br />
Ultraschalluntersuchung eine Gelenkdeformation, die zu einer Arthrose führen kann,<br />
erkennen und frühzeitig behandeln.<br />
1.2 Therapie<br />
1.2.1 Naturheilkunde:<br />
Behandlung mit Solunaten:<br />
Solunat Nr 3 (Azinat) 2x15 Tr. morgens und abends<br />
Solunat Nr.18 (Splenetik) 2x15 Tr. morgens und abends<br />
Solunat Nr.16 (Renalin) 1x10 Tr. morgens<br />
Solunat Nr.6 (Dyscrasin) 2x10 Tr. morgens und abends<br />
Solunat Nr.28 (Ätherische Essenz Nr. I) 2-3 x täglich auf die schmerzenden Stellen<br />
auftragen<br />
zusätzlich Einreibungen mit der Sportsalbe von der Rosenapotheke in Friedberg<br />
Zusatztherapien:<br />
Homöopathie: denke z.b. an Rhus tox.<br />
Yoga. spezifische einfache Übungen bei Erkrankungen des rheumatischen <strong>Formenkreis</strong>es -<br />
siehe Literaturangabe<br />
Mozartstraße 6 � D -82299 Türkenfeld � Telefon 08193 / 99 99 26 � Fax 08193 / 99 99 25<br />
6 von 26<br />
1.2.2 Schulmedizin<br />
Ziele einer Therapie bei Arthrose sind die Verminderung von Schmerz, die Verbesserung der<br />
Lebensqualität, der Beweglichkeit und der Gehleistung sowie die Verzögerung des<br />
Fortschreitens der Krankheit.<br />
Konservative Therapie<br />
Beratung<br />
Erster Schritt der Arthrosetherapie ist eine ausführliche Beratung über den natürlichen<br />
Verlauf der Krankheit und dessen Beeinflussbarkeit durch Verhalten im Alltag, körperliche<br />
Belastung in Beruf und Sport, Übergewicht, Bewegungsmangel, regelmäßige Übungen zur<br />
Beseitigung von Muskeldefiziten und gezielte Gelenk schonende Maßnahmen wie z.b. eine<br />
Knieschule.<br />
Medikamente<br />
Eine Therapie mit Medikamenten dient der Verminderung von Schmerzen und der<br />
Hemmung von Entzündungen. Hierfür stehen unterschiedliche Substanzgruppen zur<br />
Verfügung:<br />
� Schmerzmittel (Analgetika)<br />
� Kortisonfreie Entzündungshemmer (Nichtsteroidale Antirheumatika, NSAR)<br />
� Gelenkinjektionen und Spülung des Gelenks mit Gabe von Kortisonpräparaten in<br />
entzündlichen Phasen oder von lokalen Betäubungsmitteln als Schmerztherapie<br />
� Knorpelaufbaupräparate
N a t u r h e i l p r a x i s<br />
C h r i s t i n a C a s a g r a n d e<br />
H e i l p r a k t i k e r i n<br />
� SYSADOA (Symptomatic Slow Acting Drugs in Osteoarthritis): Medikamente, deren<br />
Wirkstoffe Chrondroitin, Hyaluronsäue und Glucisamin als "Gelenkschmiere" wirken und<br />
daher die Symptome bei Arthrose lindern<br />
Physikalische Therapie<br />
Verschiedene Arten der physikalischen Therapie können Symptome der Arthrose lindern.<br />
Dazu gehören:<br />
� Krankengymnastik (Physiotherapie)<br />
� Wärmebehandlung (nicht im akuten Stadium) und Kältebehandlung (im akuten Stadium)<br />
� Muskelkräftigung und -dehnung, Sportarten wie Schwimmen und Radfahren<br />
� Wasser- und Bädertherapie<br />
� Elektrotherapie und Ultraschall<br />
Orthopädische Therapie<br />
Bei Arthrosen der Knie- und Hüftgelenke können mehrere orthopädische<br />
Therapiemöglichkeiten angewendet werden:<br />
� Pufferabsätze, Schuhaußen- bzw. -innenranderhöhung<br />
� Handstock oder Unterarmgehstützen<br />
� Fersenkissen<br />
� Bandagen<br />
� Keilkissen, Sitzerhöhungen<br />
2 Rheumatoide Arthritis<br />
Mozartstraße 6 � D -82299 Türkenfeld � Telefon 08193 / 99 99 26 � Fax 08193 / 99 99 25<br />
7 von 26<br />
2.1 Überblick<br />
Millionen Menschen in Deutschland leiden an rheumatischen Erkrankungen, im Volksmund<br />
kurz als "Rheuma" bezeichnet. Man unterscheidet degenerative und entzündliche<br />
rheumatische Erkrankungen. Die häufigste entzündliche Form ist die rheumatoide Arthritis<br />
(kurz RA). Das Immunsystem, die körpereigene Abwehr, greift fälschlicherweise die eigenen<br />
Gelenke und verschiedene Gewebe an und zerstört sie. Frauen sind häufiger betroffen als<br />
Männer.<br />
Die Ursache der rheumatoiden Arthritis ist noch nicht vollständig geklärt, es bestehen jedoch<br />
Zusammenhänge mit genetischen Faktoren und autoimmunologischen (gegen körpereigene<br />
Gewebe gerichtete) Prozessen. Typische Symptome sind nächtliche und morgendliche<br />
Schmerzen der Fingergelenke, meist symmetrisch, und Morgensteifigkeit dieser Gelenke,<br />
die über 15 Minuten anhält. In der Folge kommt es zum Befall weiterer Gelenke, zu<br />
Gelenksverformungen und seltener zu Organbeteiligungen (Augen, Speichel- und<br />
Tränendrüsen, Haut, Herz, Lunge).<br />
Die Diagnose wird anhand der Krankengeschichte, Röntgenaufnahmen von Händen und<br />
Füßen sowie Blutuntersuchungen gestellt. Um Folgeschäden zu verhindern bzw. zu<br />
verzögern, ist der frühzeitige Beginn einer adäquaten Therapie entscheidend. Diese besteht<br />
aus den sog. Basismedikamenten, evtl. in Kombination mit anderen
N a t u r h e i l p r a x i s<br />
C h r i s t i n a C a s a g r a n d e<br />
H e i l p r a k t i k e r i n<br />
entzündungshemmenden Medikamenten. Ergänzend helfen physikalische Therapie,<br />
Ergotherapie, Krankengymnastik und chirurgische Therapie.<br />
2.1.1 Definition/Allgemeines<br />
Unter dem Begriff "Rheuma" wird eine Vielzahl verschiedener rheumatischer Erkrankungen<br />
zusammengefasst. Die rheumatoide Arthritis, auch chronische Polyarthritis oder kurz RA<br />
genannt, ist die häufigste entzündliche Form. Sie befällt überwiegend die Gelenke und<br />
seltener auch innere Organe wie die Augen und die Haut.<br />
2.1.2 Symptome<br />
Typische Symptome der rheumatoiden Arthritis sind:<br />
� nächtliche und morgendliche Gelenkschmerzen<br />
� Morgensteifigkeit der Gelenke von mehr als 15 Minuten<br />
� Schwellung der Gelenke, typischerweise in den Fingergrund- (MCP-Gelenke) und den<br />
Fingermittelgelenken (PIP-Gelenke)<br />
� Allgemeines Krankheitsgefühl mit Müdigkeit und Erschöpfung<br />
Obwohl im Frühstadium manchmal nur wenige Gelenke betroffen sind, entwickelt sich fast<br />
immer nach einer gewissen Zeit eine so genannte Polyarthritis, d.h. eine Entzündung vieler<br />
großer und kleiner Gelenke des Körpers. Häufig sind die Hand- und Fingergelenke befallen.<br />
Ausnahme ist lediglich die Wirbelsäule, die außer dem Kopf-Hals-Gelenk (Atlanto-Axial-<br />
Gelenk) fast nie betroffen ist.<br />
Im weiteren Krankheitsverlauf können sich die folgenden typischen Veränderungen der<br />
Gelenke entwickeln:<br />
� Ulnardeviation = Abrutschen der Finger nach außen<br />
� Schwanenhalsdeformität = Abknicken des letzten Fingerglieds nach unten<br />
� Knopflochdeformität = Nachobentreten des Fingerknöchels<br />
� Rheumaknoten = Wachsen von gummiartigen Knoten an den Streckseiten der Gelenke<br />
Aber nicht nur die Gelenke, sondern auch andere Organe können betroffen sein:<br />
� Lunge: Bindegewebsvermehrung der Lunge (Lungenfibrose) oder eine<br />
Rippenfellentzündung (Pleuritis)<br />
� Herz: Herzbeutelentzündung (Perikarditis)<br />
� Augen: Entzündung von verschiedenen Schichten der Augenwand (Skleritis und<br />
Episkleritis)<br />
� Haut: Rheumaknoten oder Kleingefäßentzündung (Vaskulitis) mit teilweise großen<br />
Hautdefekten vor allem an Unterschenkeln und Fußrücken<br />
� Speichel und Tränendrüsen: Chronische Entzündung mit Trockenheit von Mund und<br />
Augen (Sicca-Syndrom)<br />
Mozartstraße 6 � D -82299 Türkenfeld � Telefon 08193 / 99 99 26 � Fax 08193 / 99 99 25<br />
8 von 26
N a t u r h e i l p r a x i s<br />
C h r i s t i n a C a s a g r a n d e<br />
H e i l p r a k t i k e r i n<br />
Mozartstraße 6 � D -82299 Türkenfeld � Telefon 08193 / 99 99 26 � Fax 08193 / 99 99 25<br />
9 von 26<br />
2.1.3 Diagnose<br />
Die Diagnose der rheumatoiden Arthritis wird immer aufgrund mehrerer Befunde gestellt: der<br />
Symptome, der körperlichen Untersuchung, der Laborbefunde und der<br />
Röntgenuntersuchung.<br />
� Typische Veränderungen der Blutwerte sind:<br />
� Anstieg der Entzündungswerte, wie Blutsenkungsgeschwindigkeit (BSG) und C-<br />
Reaktives- Protein (CRP)<br />
� Entzündungsbedingte Blutarmut (Anämie) mit Abfall des Hämoglobinwerts<br />
� Nachweis des sog. Rheumafaktors (verschiedene Autoantikörper): Er ist allerdings nur<br />
bei ca. 80% der Patienten mit rheumatoider Arthritis nachweisbar, und kann auch bei<br />
einigen anderen Krankheiten und sogar bei Gesunden vorliegen. Er ist daher nicht allzu<br />
spezifisch.<br />
Entsprechend dem Gelenk zerstörenden Verlauf der rheumatoiden Arthritis finden sich meist<br />
nach einigen Jahren typische Veränderungen im Röntgenbild der Gelenke:<br />
� gelenknahe Osteoporose = gelenknaher Kalksalzmangel im Knochen (Frühzeichen)<br />
� Erosionen = mäusebissartige Knochendefekte am äußeren Rand der Gelenkfläche<br />
� eine Verschiebung der Wirbelkörper der Halswirbelsäule bei Mitbefall des Kopf-<br />
Halsgelenks<br />
Röntgenaufnahmen der Hände und Füße sind besonders gut geeignet, um frühzeitig<br />
typische Veränderungen zu erkennen.<br />
Um die Diagnose zu vereinheitlichen, hat das American College of Rheumatology (ACR) im<br />
Jahr 1987 die folgenden ACR- Diagnosekriterien der rheumatoiden Arthritis aufgestellt. Von<br />
diesen sieben Kriterien müssen mindestens vier für die Diagnose einer rheumatoiden<br />
Arthritis erfüllt sein:<br />
� Morgensteifigkeit der Gelenke (mind. 1 Stunde Dauer) länger als sechs Wochen<br />
� Arthritis mit tastbarer Schwellung in drei oder mehr Gelenkregionen länger als sechs<br />
Wochen<br />
� Arthritis an Hand- oder Fingergelenken länger als sechs Wochen<br />
� Symmetrische Arthritis (gleichzeitig, beidseits dieselbe Gelenkregion) länger als sechs<br />
Wochen<br />
� Rheumaknoten<br />
� Rheumafaktornachweis im Blut<br />
� Typische Röntgenveränderungen (gelenknahe Osteoporose und/oder Erosionen)<br />
2.1.4 Verlauf<br />
Obwohl auch gutartige Verläufe vorkommen, schreitet die rheumatoide Arthritis meistens<br />
allmählich fort. Gelenkzerstörungen sind fast immer nach einigen Jahren im Röntgenbild zu<br />
sehen. Mit (schulmedizinischen) Medikamenten kann man zwar bei der Mehrzahl der<br />
Patienten den Verlauf bremsen und häufig die Entzündung und die Schmerzen über lange
N a t u r h e i l p r a x i s<br />
C h r i s t i n a C a s a g r a n d e<br />
H e i l p r a k t i k e r i n<br />
Zeit gut kontrollieren, trotzdem besteht ein gewisses Risiko für eine dauerhafte Invalidität.<br />
Patienten mit schweren Verläufen haben außerdem eine verkürzte Lebenserwartung.<br />
Mozartstraße 6 � D -82299 Türkenfeld � Telefon 08193 / 99 99 26 � Fax 08193 / 99 99 25<br />
10 von 26<br />
2.1.5 Ursachen<br />
Die Ursachen der rheumatoiden Arthritis sind noch immer nicht endgültig geklärt. Es handelt<br />
sich wahrscheinlich um einen sog. Autoimmunprozess, bei dem sich Zellen des<br />
Immunsystems gegen den eigenen Körper richten. An der zerstörerischen<br />
Entzündungsreaktion im Körper sind verschiedene Stoffe beteiligt.<br />
Auch eine genetische Veranlagung für die rheumatoide Arthritis ist wahrscheinlich.<br />
2.1.6 Prophylaxe<br />
Vorbeugende Maßnahmen, um eine rheumatoide Arthritis zu verhindern oder aufzuhalten,<br />
gibt es nicht. Sinnvoll und gelenkfreundlich ist allerdings regelmäßige Bewegung, bei der alle<br />
Gelenke gleichmäßig belastet werden, z.B. tägliches Spazieren gehen, Schwimmen,<br />
Radfahren und Gymnastik.<br />
2.2 Therapie<br />
2.2.1 Naturheilkunde<br />
Behandlung mit Solunaten:<br />
Solunat Nr.3 (Azinat) 3 - 4x15 Tr. über den Tage verteilt<br />
Solunat Nr.18 (Splenetik) 2x10 Tr.<br />
Solunat Nr.16 (Renalin) 1-2x10 Tr. morgens und mittags<br />
Solunat Nr.6 (Dyscrasin) A 2x10 Tr. morgens und abends<br />
Spagyrische Eigenbluttherapie<br />
Solunat Nr.28 (Ätherische Essenz Nr. I) morgens und abends auf die schmerzenden Stellen<br />
auftragen, sowie mit Sportsalbe mehrmals täglich einreiben.<br />
Weitere Therapieansätze:<br />
Homöopathie: Konstitutionsbehandlung<br />
Alcea: Fraxinus Urtinktur 2-3x3-5 Tr. täglich<br />
Schwarzkümmelöl immerfit plus Vitamin E 2-3x1 Kps. Täglich<br />
Weihrauchöl, z.B. H15 Ayurmed von Firma Gofic (Schweiz)<br />
2.2.2 Schulmedizin<br />
Therapie Übersicht<br />
Die Therapie der rheumatoiden Arthritis erfordert große Erfahrung sowie eine<br />
interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen internistischen Rheumatologen, Orthopäden,<br />
Krankengymnasten und Ergotherapeuten. Folgende Therapieformen stehen zur Verfügung:<br />
� Medikamentöse Therapie<br />
� Injektionen von Kortisonpräparaten in die Gelenke<br />
� Krankengymnastik und Physikalische Therapie
� Ergotherapie und Rehabilitation<br />
N a t u r h e i l p r a x i s<br />
C h r i s t i n a C a s a g r a n d e<br />
H e i l p r a k t i k e r i n<br />
� Operative Therapie: Entfernung der Gelenkschleimhaut (Synovektomie) und<br />
rekonstruktive Chirurgie<br />
Mozartstraße 6 � D -82299 Türkenfeld � Telefon 08193 / 99 99 26 � Fax 08193 / 99 99 25<br />
11 von 26<br />
Es ist bislang nicht möglich, die rheumatoide Arthritis ursächlich zu heilen. Bis in die 1990er<br />
Jahre wurde rheumatoide Arthritis medikamentös praktisch ausschließlich mit schmerz- und<br />
entzündungshemmenden Mitteln sowie mit Arzneimitteln behandelt, die die Vermehrung von<br />
Immunzellen dämpfen. Zerstörte Gelenke konnten teilweise durch Gelenkprothesen ersetzt<br />
werden.<br />
NSAR und Kortison<br />
Zu den Schmerzmitteln, die bei der rheumatoiden Arthritis angewandt werden, zählen unter<br />
anderem Acetylsalicylsäure (ASS), Diclofenac, Paracetamol, Celecoxib und Ibuprofen. Da<br />
sie kein Kortison (ein sog. Steroid) enthalten, nennt man sie auch nichtsteroidale<br />
Antirheumatika (kurz: NSAR). Kortison wirkt stark entzündungshemmend und wird in akuten<br />
Krankheitsphasen gegeben, wenn kortisonfreie Entzündungshemmer nicht ausreichend<br />
wirksam sind. Der Vorteil dieser Arzneimittel ist, dass ihre Wirkung schnell einsetzt. Die<br />
Schmerzen lassen rasch nach und die Betroffenen können sich wieder besser bewegen. Auf<br />
den Verlauf der Erkrankung haben die NSAR und Kortison jedoch meist keinen Einfluss.<br />
Basistherapeutika<br />
In den letzten Jahren haben sich grundlegende Veränderungen in der Therapie der<br />
rheumatoiden Arthritis ergeben. Sobald die Diagnose gesichert ist, werden so genannte<br />
"Basistherapeutika" eingesetzt. Sie greifen direkt in den Krankheitsverlauf ein. Zu ihnen<br />
zählen unter anderem Arzneimittel mit den Wirkstoffen Methotrexat, Sulfasalazin und<br />
Chloroquin. Die Wirkung der Basistherapeutika tritt nicht sofort, sondern je nach Substanz<br />
erst nach einigen Wochen bis zu mehreren Monaten, ein. Mit den Basistherapeutika gelingt<br />
es jedoch, entzündliche Schübe zu verhindern und die Beschwerden vorübergehend<br />
verschwinden zu lassen.<br />
Krankengymnastik und andere<br />
Moderne Konzepte der Rheumabehandlung zeichnen sich dadurch aus, dass verschiedene<br />
Methoden miteinander kombiniert werden. Dazu gehören neben den Arzneimitteln auch<br />
Krankengymnastik, physikalische Therapie und Ergotherapie (z.b. Gelenkschutzberatung)<br />
sowie, falls erforderlich, auch soziale und psychologische Maßnahmen. Bei starken<br />
Gelenkzerstörungen können Operationen und gegebenenfalls auch der Ersatz des<br />
zerstörten Gelenks durch ein künstliches Gelenk nötig werden.<br />
TNF-alpha und Anakinra<br />
Leider sprechen nicht alle Patienten gut auf die Standardtherapie und die verfügbaren<br />
Arzneimittel an. Deshalb arbeiten Forscher intensiv daran, ganz gezielt neue Präparate zu<br />
finden, um die Krankheit aufzuhalten und die Schmerzen zu lindern. Eine neue viel<br />
versprechende Entwicklung sind Wirkstoffe, die in die Kommunikation zwischen<br />
Immunzellen eingreifen, die den Entzündungsprozess bei der rheumatoiden Arthritis<br />
vorantreiben. Von zentraler Bedeutung ist dabei der Botenstoff TNF-alpha, mit dem an<br />
Entzündungen beteiligte weiße Blutkörperchen andere Immunzellen zur Mitwirkung<br />
auffordern.<br />
Ein anderer Wirkstoff, das Anakinra, ist ein sog. Interleukin-1- Rezeptorantagonist (IL-1Ra)<br />
oder kurz IL-1-Blocker bzw. IL-1- Hemmer. Interleukin-1 ist eine körpereigene Substanz und
N a t u r h e i l p r a x i s<br />
C h r i s t i n a C a s a g r a n d e<br />
H e i l p r a k t i k e r i n<br />
Mozartstraße 6 � D -82299 Türkenfeld � Telefon 08193 / 99 99 26 � Fax 08193 / 99 99 25<br />
12 von 26<br />
spielt eine wichtige Rolle bei der Entstehung von rheumatischen Entzündungen und<br />
Gelenkschädigungen. Anakinra blockiert die entzündungsauslösende Wirkung von IL- 1 und<br />
greift wie die TNF-alpha-Blocker gezielt in zentrale Mechanismen bei der Entstehung und<br />
Ausbreitung der Erkrankung ein.<br />
3 Fibromyalgie<br />
3.1 Überblick<br />
Unter Fibromyalgie versteht man eine Erkrankung, die durch langanhaltende Schmerzen im<br />
Bereich des Bewegungsapparates (Sehnen, Muskeln) charakterisiert ist. Daneben sind<br />
allgemeine Krankheitssymptome, Schlafstörungen und Depressionen nicht selten. Meist sind<br />
Frauen ab dem 35. Lebensjahr betroffen. Die Ursache ist noch unbekannt, es kommt jedoch<br />
zu keiner krankhaften Veränderung in Muskeln und Sehnen. Eine zentrale, d.h. vom Gehirn<br />
ausgehende Schmerzentstehung wird diskutiert. Zur Diagnose werden die<br />
Krankengeschichte und die Fibromyalgie- Druckpunkte herangezogen. Die Behandlung<br />
besteht aus einer Kombination von psychosomatischer Betreuung, physikalischer Therapie<br />
und Medikamenten. Die Erfolge sind umso besser, je früher damit begonnen wird, da die<br />
Fibromyalgie bei längerem Bestehen dazu neigt, chronisch zu werden. Seit kurzem gibt es<br />
auch chirurgische Therapieansätze.<br />
3.1.1 Definition/Allgemeines<br />
Die Fibromyalgie ist eine nicht-entzündliche, weichteilrheumatische Erkrankung, welche mit<br />
generalisierten Schmerzen des Bewegungssystems und Allgemeinsymptomen, wie<br />
Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Depressionen, Schlafstörungen u.v.m. einhergeht und durch<br />
schmerzhafte Druckpunkte an den Sehnenansätzen charakterisiert ist.<br />
Häufigkeit<br />
An der Fibromyalgie leiden ca. 2% der Bevölkerung und dabei überwiegend Frauen. Das<br />
Verhältnis von Frauen zu Männern beträgt dabei ca. 9:1. Die Erkrankung beginnt meist um<br />
das 35. Lebensjahr und hat einen Häufigkeitshöhepunkt im und nach dem Klimakterium. In<br />
manchen Familien kommt sie gehäuft vor.<br />
3.1.2 Symptome<br />
Im Vordergrund stehen starke Schmerzen vor allem der Muskulatur und der Sehnenansätze.<br />
Dabei sind nicht nur die Extremitäten sondern auch der Rumpf betroffen. Häufig wird der<br />
Schmerz als großflächig und fließend beschrieben. Die Patienten haben oft das Gefühl, die<br />
schmerzhaften Weichteile seien diffus geschwollen und kleine Verdichtungen des<br />
Unterhautfettgewebes werden als schmerzhafte Knötchen empfunden. Die Schmerzen<br />
halten über lange Zeit, meist über Jahre an und können bei manchen Patienten durch<br />
körperliche Aktivitäten oder auch Krankengymnastik bzw. Massage verstärkt werden.<br />
Darüber hinaus leiden die Patienten unter Allgemeinsymptomen wie Müdigkeit,<br />
Abgeschlagenheit, Schlafstörungen und Depressionen. Da die Fibromyalgie immer noch<br />
vielen Ärzten unbekannt ist, haben die Patienten bis zur Diagnosestellung oft eine Vielzahl<br />
von Ärzten besucht und viele verschiedene, teilweise überflüssige diagnostische<br />
Maßnahmen hinter sich. Dies wird sich hoffentlich ändern, wenn das Krankheitsbild, welches<br />
aufgrund der typischen Symptome und Untersuchungsbefunde eigentlich leicht zu<br />
diagnostizieren ist, auch bei Allgemeinärzten und Orthopäden zunehmend bekannter wird.
N a t u r h e i l p r a x i s<br />
C h r i s t i n a C a s a g r a n d e<br />
H e i l p r a k t i k e r i n<br />
Mozartstraße 6 � D -82299 Türkenfeld � Telefon 08193 / 99 99 26 � Fax 08193 / 99 99 25<br />
13 von 26<br />
3.1.3 Diagnose<br />
Die Diagnose wird durch die typische Krankengeschichte und die körperliche Untersuchung<br />
gestellt. Hierbei finden sich die charakteristischen, sehr schmerzhaften Fibromyalgie-<br />
Druckpunkte (tender points) welche vor allem an den Sehnenansätzen, also in der Nähe der<br />
Gelenke und am Rumpf, lokalisiert sind. Die Muskeln selber, wie z.b. die Waden oder<br />
Oberschenkel, sind oft kaum druckschmerzhaft.<br />
Fibromyalgiedruckpunkte<br />
(tender points). Die Kriterien für eine Fibromyalgie sind erfüllt, wenn mind. 11 der<br />
dargestellten 18 Druckpunkte schmerzhaft sind und die typischen Symptome länger als 3<br />
Monate bestehen.<br />
Bei der Fibromyalgie finden sich keine typischen Laborwerte oder Veränderungen im<br />
Röntgenbild. Selten können Hormonstörungen, wie z.b. eine Schilddrüsenunterfunktion,<br />
jedoch eine Fibromyalgie verstärken. Diese kann durch eine Untersuchung der<br />
Schilddrüsenhormone festgestellt werden. Um eine sekundäre Fibromyalgie, also eine<br />
Fibromyalgie, die begleitend zu anderen rheumatischen Erkrankungen auftritt, festzustellen,<br />
sollten außerdem Laboruntersuchungen wie z.b. Entzündungswerte im Blut veranlasst<br />
werden.<br />
3.1.4 Entstehung<br />
Patienten mit Fibromyalgie haben meist bereits in der Vorgeschichte chronische Schmerzen<br />
des Bewegungssystems, z.b. durch einen Bandscheibenvorfall oder ein Schleudertrauma.<br />
Zur Fibromyalgie kommt es dann, wenn sich der Schmerz gewissermaßen verselbstständigt<br />
und nicht mehr nur lokal an den ursprünglich schmerzhaften Stellen, z.b. der<br />
Halswirbelsäule, sondern am ganzen Körper verspürt wird. Zu diesem Zeitpunkt hilft auch
N a t u r h e i l p r a x i s<br />
C h r i s t i n a C a s a g r a n d e<br />
H e i l p r a k t i k e r i n<br />
Mozartstraße 6 � D -82299 Türkenfeld � Telefon 08193 / 99 99 26 � Fax 08193 / 99 99 25<br />
14 von 26<br />
die Beseitigung der ursprünglichen Ursache des Schmerzes nicht mehr, um eine Besserung<br />
zu erreichen. Dies kann auch bei Patienten mit entzündlich rheumatischen Erkrankungen,<br />
wie z.b. der rheumatoiden Arthritis passieren, man nennt dies dann sekundäre Fibromyalgie.<br />
Gleichzeitig bestehen oft psychische Symptome, wie z.b. Depressionen und der Patient fühlt<br />
sich ausgesprochen krank. Es ist bekannt, dass es bei Patienten mit Fibromyalgie zu<br />
Änderungen der Regelsysteme der Schmerzempfindung im Gehirn kommt. Manche<br />
Botenstoffe des Gehirns, wie z.b. Serotonin und Tryptophan werden "herunterreguliert",<br />
während andere, wie die Substanz P - eine bestimmte Schmerztransmittersubstanz -<br />
vermehrt gefunden werden. Trotz dieser "organischen", d.h. körperlichen Veränderungen<br />
des Gehirns, ist aber immer noch nicht klar, ob die Fibromyalgie letztendlich eine<br />
psychosomatische Erkrankung ist, bei der die Veränderungen der Botenstoffe des Gehirns<br />
erst sekundär entstehen oder ob es sich wirklich gewissermaßen um eine<br />
Stoffwechselerkrankung des Gehirns mit der Folge von Schmerzen und psychosomatischen<br />
Störungen handelt. Sicher ist aber, dass die schmerzhaften Stellen des Bewegungssystems<br />
selber nicht verändert oder gar entzündet sind, sondern erst die veränderte<br />
Schmerzempfindung im Gehirn dazu führt, dass der Schmerz des Bewegungssystems<br />
empfunden wird. Trotzdem handelt es sich aber um echte und nicht etwa eingebildete<br />
Schmerzen.<br />
Eine immer wieder zu beobachtende Beziehung besteht zwischen dem Nachtschlaf und der<br />
Fibromyalgie. Patienten mit Fibromyalgie schlafen meist schlecht oder aber sie wachen<br />
morgens auf und fühlen sich wie "gerädert". Darüber hinaus kann man umgekehrt eine<br />
Fibromyalgie bei Probanden durch Schlafentzug geradezu hervorrufen. Eine noch<br />
weitgehend unerforschte Funktion des Schlafes bei der Entspannung der Muskulatur und<br />
dem psychischen Schmerzerleben scheint daher vor einer Fibromyalgie zu schützen.<br />
3.2 Therapie<br />
3.2.1 Naturheilkunde<br />
Behandlung mit Solunaten:<br />
Solunat Nr.3 (Azinat) 2x10 Tr. morgens und abends<br />
Solunat Nr.16 (Renalin) 1-2x10 Tr. morgens (und mittags)<br />
Solunat Nr.6 (Dyscrasin) A 2x10 Tr. morgens und abends<br />
Solunat Nr.4 (Cerebretik) 3x5 Tr. über den Tag verteilt und 1x10 Tr. zur Nachtruhe<br />
Spagyrische Eigenbluttherapie<br />
Weitere Therapieansätze:<br />
Homöopathie: eventuell Arnica C30 oder C200, sowie eine Konstitutionsbehandlung<br />
Alcea: Fraxinus Urtinktur zusammen mit Hypericum Urtinktur<br />
Yoga: Sonnengebet<br />
Entspannungsübungen<br />
3.2.2 Schulmedizin<br />
Therapie
N a t u r h e i l p r a x i s<br />
C h r i s t i n a C a s a g r a n d e<br />
H e i l p r a k t i k e r i n<br />
Mozartstraße 6 � D -82299 Türkenfeld � Telefon 08193 / 99 99 26 � Fax 08193 / 99 99 25<br />
15 von 26<br />
Häufig sind Schmerzmittel und Antirheumatika komplett unwirksam. Auch Krankengymnastik<br />
und Massage können zwar bei manchen Patienten helfen, bei anderen Patienten aber das<br />
Krankheitsbild sogar noch verschlimmern. Am erfolgreichsten sind wohl kombinierte<br />
Therapieansätze mit psychosomatischer Therapie, physikalischen Anwendungen und einer<br />
intensiven Patientenschulung. Dafür haben sich stationäre Heilmaßnahmen in auf diese<br />
Erkrankung spezialisierten Kliniken bewährt. Medikamentös können Antidepressiva wie z.b.<br />
Amitriptylin 10-50 mg/Tag eine Besserung bringen. Dabei ist vor allem eine Einnahme als<br />
einmalige Einzeldosis vor dem Schlafengehen, möglicherweise durch die Verbesserung des<br />
Nachtschlafs, wirkungsvoll und nebenwirkungsarm.<br />
Seit kurzem gibt es Erfolge bei der chirurgischen Entfernung von Verdickungen und<br />
Verklebungen an den 18 Fibromyalgie- Druckpunkten. Dieser Behandlung liegt die Annahme<br />
zugrunde, dass diese Druckpunkte identisch mit bestimmten Akupunkturpunkten sind und<br />
daher bei Schädigungen Schmerzen in den Organismus ausstrahlen. Bei dem Eingriff<br />
werden mit Hilfe von ca. 6 cm langen Schnitten diese Verklebungen bzw. Verknotungen<br />
entfernt. Es sei aber erwähnt, dass der Berufsverband der Rheumatologen von einem<br />
Placeboeffekt spricht.<br />
Prognose<br />
Obwohl die Fibromyalgie niemals, wie andere rheumatische Erkrankungen, zur Zerstörung<br />
oder Funktionseinschränkungen von Gelenken oder anderen Strukturen des<br />
Bewegungssystems führt, hat sie, was die Besserung der Symptome angeht, keine gute<br />
Prognose. Ist die Erkrankung erst einmal chronisch geworden, haben nach 10-15 Jahren<br />
noch 2/3 der Patienten die gleiche Schmerzsymptomatik wie zu Beginn. Deshalb sollte man<br />
unbedingt versuchen, eine Chronifizierung zu verhindern.<br />
4 Gicht<br />
4.1 Überblick<br />
Die Gicht ist eine Stoffwechselerkrankung mit erhöhten Harnsäurewerten im Blut, von der<br />
vorzugsweise Männer betroffen sind. Ursachen sind genetische Defekte, purinreiche<br />
Ernährung (Innereien, manche Fischsorten), Nierenfunktionsstörungen und Krankheiten mit<br />
gesteigertem Zellzerfall. Man unterscheidet den akuten Gichtanfall und die chronische Gicht.<br />
Der akute Gichtanfall ist eine hochakute Entzündung eines Gelenkes, typischerweise ist das<br />
Großzehengrundgelenk betroffen. Es kommt zu heftigen Schmerzen, Rötung, Schwellung<br />
und Überwärmung des Gelenkes. Bei einer unbehandelten Harnsäurespiegelerhöhung über<br />
lange Zeit werden die Kristalle der Säure in anderen Organen, meist der Niere, abgelagert<br />
und führen zu Folgeschäden, der chronischen Gicht. Durch Einführung von Medikamenten,<br />
die den Harnsäurespiegel senken, kommt diese heutzutage kaum noch vor. Im akuten<br />
Gichtanfall sind Colchicin, nichtsteroidale Antirheumatika und Cortisontabletten hilfreich.<br />
4.1.1 Definition/Allgemeines<br />
Die Gicht, die früher im Volksmund als Zipperlein bezeichnet wurde, ist eine<br />
Stoffwechselstörung, bei der aufgrund eines Anstiegs des Harnsäurespiegels im Blut<br />
harnsaure Salze im Organismus abgelagert werden. Bevorzugt sind dabei die Gelenke,<br />
typischerweise eine hochakute Entzündung des Großzehengrundgelenks, aber auch<br />
verschiedene innere Organe betroffen.
N a t u r h e i l p r a x i s<br />
C h r i s t i n a C a s a g r a n d e<br />
H e i l p r a k t i k e r i n<br />
Mozartstraße 6 � D -82299 Türkenfeld � Telefon 08193 / 99 99 26 � Fax 08193 / 99 99 25<br />
16 von 26<br />
In früheren Jahrhunderten galt die Gicht als eine Erkrankung, die vorwiegend bei<br />
Wohlhabenden auftrat. Erst gegen Ende des 17. Jahrhunderts fand eine Unterscheidung<br />
zwischen Gicht und Rheuma statt. Ein Jahrhundert später, im Jahr 1797, entdeckte William<br />
Hyde Wollaston erstmals harnsaure Salze in Gicht- Knoten. Aber erst 50 Jahre später wurde<br />
erkannt, dass es sich um eine Stoffwechselstörung handelt. Bis zu diesem Zeitpunkt nahm<br />
man eine Störung der "Körpersäfte" an. Schon früh wurde jedoch ein Zusammenhang<br />
zwischen der Erkrankung und erhöhtem Fleisch- und Alkoholgenuss gesehen.<br />
Bei der Gicht werden zwei Formen unterschieden: den primären, akuten Gichtanfall und die<br />
sekundäre, chronische Gicht.<br />
4.1.2 Symptome<br />
Die Gicht verläuft ohne Behandlung in vier Phasen:<br />
Asymptomatische Phase<br />
Die asymptomatische Phase ist durch die Akkumulation der Harnsäure im Organismus<br />
gekennzeichnet und kann Jahre bis Jahrzehnte umfassen. Sie verläuft völlig symptomlos.<br />
Die Wahrscheinlichkeit, einen Gichtanfall zu erleiden, nimmt mit steigender<br />
Harnsäurekonzentration im Blut zu. Bei Werten zwischen 6,5 und 7 mg/dl ist in weniger als 2<br />
Prozent mit einem Anfall zu rechnen, bei Werten um 8 mg/dl steigt das Risiko auf 40 Prozent<br />
und bei Werten größer 9 mg/dl liegt die Wahrscheinlichkeit innerhalb der nächsten 1 bis 1,5<br />
Jahre einen Gichtanfall zu erleiden bei nahezu 100 Prozent.<br />
Akuter Gichtanfall<br />
Der Harnsäurerückstau hat ein Ausmaß erreicht, das zum ersten Gichtanfall führt. Eine<br />
erhöhte Harnsäurekonzentration im Blut ist in über 90 Prozent der Fälle nachweisbar. Der<br />
Gichtanfall betrifft typischerweise das Großzehengrundgelenk, man spricht von einem<br />
Podagra. Das Gelenk verfärbt sich rot und schwillt an. Jede Berührung ist äußerst<br />
schmerzhaft. Die Betroffenen können nur noch auf der Ferse auftreten und zeigen einen<br />
charakteristischen humpelnd-hüpfenden Gang. Nach dem Abklingen des Anfalls folgt meist<br />
die interkritische Phase.<br />
Interkritische Phase<br />
Die interkritische Phase bezeichnet die Zeitspanne bis zum nächsten Gichtanfall und verläuft<br />
wiederum symptomfrei. Sie kann Monate bis Jahre andauern, bis ein erneuter Gichtanfall<br />
folgt. Im Laufe der Zeit verkürzt sich die symptomfreie Zeit jedoch immer mehr, bis<br />
schließlich das letzte Krankheitsstadium erreicht ist. Kurz davor sind die Zwischenintervalle<br />
nicht mehr komplett schmerzfrei.<br />
Chronische Gicht<br />
Die chronische Gicht ist heutzutage sehr selten und tritt nur auf, wenn die Diagnose nicht<br />
frühzeitig gestellt werden konnte oder die Therapie unzureichend erfolgte. In dieser Phase<br />
treten praktische ständig Schmerzen auf. Auf Röntgenbildern können bleibende<br />
Gelenkveränderungen erkannt werden, die zu einer zunehmenden<br />
Funktionsbeeinträchtigung führen.<br />
An den gelenknahen Sehnenansätzen finden sich häufig so genannte Gichttophi<br />
(Gichtknoten). Dabei handelt es sich um schmerzlose, derbe Knötchen von maximal einem<br />
Zentimeter Größe, die unmittelbar unter der Haut liegen. Brechen diese Knötchen auf,<br />
entleert sich eine weiße Masse, die vorwiegend aus Harnsäure besteht. Häufig treten die
N a t u r h e i l p r a x i s<br />
C h r i s t i n a C a s a g r a n d e<br />
H e i l p r a k t i k e r i n<br />
Gichttophi am Rand des Ohrknorpels auf, kommen aber auch am Ellenbogen, Händen und<br />
Füßen vor.<br />
Mozartstraße 6 � D -82299 Türkenfeld � Telefon 08193 / 99 99 26 � Fax 08193 / 99 99 25<br />
17 von 26<br />
Bleibt die Harnsäurekonzentration sehr lange auf einem hohen Niveau, können auch<br />
Uratablagerungen in anderen Organen auftreten, die u.a. zu einer akuten Niereninsuffizienz<br />
führen können.<br />
4.1.3 Diagnose<br />
Die Diagnose des akuten Gichtanfalls ergibt sich aus dem charakteristischen Bild der<br />
Beschwerden, welches unverwechselbar ist. Bereits vorher können Erhöhungen der<br />
Harnsäurekonzentration im Blut auf eine Gicht hindeuten.<br />
Röntgenuntersuchungen sind im Frühstadium unauffällig. Im späteren Verlauf treten<br />
zunehmend erkennbare Gelenkveränderungen und Gichttophi auf.<br />
4.1.4 Verlauf<br />
Komplikationen<br />
Neben möglichen stark ausgeprägten Gelenkveränderungen kann es bei der Gicht auch in<br />
der Niere zu Harnsäureablagerungen kommen. Diese Ablagerungen, sowie die dadurch<br />
bedingten Entzündungsreaktionen, können zu einem bleibenden völligen Funktionsverlust<br />
der Niere, also einer Niereninsuffizienz, führen. Man spricht dann von einer chronischen<br />
Gichtniere.<br />
Davon abzugrenzen ist die akute Schädigung der Niere durch Harnsäure, also die akute<br />
Uratnephropathie. Hier kommt es plötzlich durch massive Ausfällung der Harnsäure im<br />
Nierengewebe, wie z.b. bei der Bildung eines hochkonzentrierten, sauren Urins bei<br />
mangelhafter Flüssigkeitszufuhr, zu einer Niereninsuffizienz. Über einen ähnlichen<br />
Mechanismus kann es zur Bildung von Nierensteinen kommen. Diese Komplikationen sind<br />
durch eine entsprechende Therapie, wie z.b. die Steigerung der Trinkmenge sowie die<br />
Alkalisierung des Urins, reversibel.<br />
Prognose<br />
Die Prognose der Gicht hängt entscheidend von der Therapie und dem Krankheitsverlauf ab.<br />
Wenn die Erkrankung einen chronischen Verlauf mit Gelenkveränderungen oder<br />
Nierenschäden nimmt, kann es zur Invalidität und Dialysepflicht kommen.<br />
4.1.5 Ursachen<br />
Die Ursache für die Gicht ist in den meisten der Erkrankungsfälle ein genetischer Defekt, der<br />
zu einer Verminderung der Harnsäureausscheidung führt. Häufig wird die Krankheit durch<br />
purinreiche Ernährung (Innereien, manche Fischsorten, Fleisch, Spinat, Erbsen, Tomaten,<br />
Gurken), übermäßigen Alkoholkonsum und Übergewicht manifestiert. Selten liegt eine<br />
Überproduktion von Harnsäure, z.b. beim Lesch-Nyhan-Syndrom (Primäre kindliche Gicht)<br />
zu Grunde.<br />
Harnsäure ist ein Endprodukt des Purinstoffwechsels. Purine, wie z.b. Adenin und Guanin,<br />
sind Bestandteile der Nukleinsäuren und damit der DNA bzw. RNA und kommen in allen<br />
menschlichen und tierischen Zellen vor.<br />
Der Harnsäuregehalt im menschlichen Organismus setzt sich aus zwei Anteilen zusammen:
N a t u r h e i l p r a x i s<br />
C h r i s t i n a C a s a g r a n d e<br />
H e i l p r a k t i k e r i n<br />
Mozartstraße 6 � D -82299 Türkenfeld � Telefon 08193 / 99 99 26 � Fax 08193 / 99 99 25<br />
18 von 26<br />
� Endogene Harnsäureproduktion die Harnsäure als Endprodukt des körpereigenen, also<br />
endogenen, Zellstoffwechsels im Rahmen der ständigen Zellerneuerung.<br />
� Exogene Harnsäureproduktion die Harnsäure als End- bzw. Abbauprodukt der mit der<br />
Nahrung aufgenommenen, also exogenen, purinhaltigen Stoffe.<br />
Bei der primären Gicht liegt eine so genannte "positive Harnsäurebilanz" vor. In diesem<br />
Zusammenhang bedeutet "positiv", dass die Harnsäureproduktion, egal ob endogen oder<br />
exogen, die Harnsäureausscheidung übertrifft. Die Folge davon ist ein Harnsäurerückstau im<br />
Organismus.<br />
Die sekundäre Gicht entsteht als Folge anderer Erkrankungen. Dies sind einerseits<br />
Erkrankungen, die mit einem erhöhten Zelluntergang einhergehen (z.b. Leukämie), in deren<br />
Folge es zu einer extensiv gesteigerten endogenen Harnsäureproduktion kommt.<br />
Andererseits können Nierenfunktionsstörungen, wie z.b. bei Schrumpfnieren oder<br />
Niereninsuffizienz, über eine Ausscheidungsverminderung der Harnsäure zu einem<br />
Rückstau der Harnsäure führen und damit die Gicht auslösen.<br />
4.1.6 Prophylaxe<br />
Eine Prophylaxe zielt auf die Vermeidung einer chronischen Gicht ab und erfolgt durch die<br />
konsequente Einnahme der Dauertherapie. Davon unabhängig dürfen die diätetischen<br />
Maßnahmen nicht vergessen werden. Der Verzehr purinreicher Nahrungsmittel sollte<br />
eingeschränkt werden und der Alkoholgenuss mäßig erfolgen, d.h. keine Exzesse aber auch<br />
kein chronischer Alkoholkonsum.<br />
4.2 Therapie<br />
4.2.1 Naturheilkunde<br />
Behandlung mit Solunaten:<br />
Solunat Nr.3 (Azinat) 2x20 Tr. morgens und abends<br />
Solunat Nr.18 (Splenetik) 2x15 Tr. morgens und abends<br />
Solunat Nr.16 (Renalin) 2x10 Tr. morgens und mittags<br />
Solunat Nr.14 (Polypathik) 2-3x5-10 Tr. über den Tag verteilt<br />
Solunat Nr.6 (Dyscrasin) 2x10 Tr. morgens und abends<br />
Solunat Nr.28 (Ätherische Essenz Nr. I) 2 -3x täglich auf die schmerzende Stelle auftragen<br />
Spagyrische Eigenbluttherapie<br />
Zusatztherapien:<br />
Alcea: Colchicum D8, D12 2-5x täglich 5 Tropfen<br />
Ernährungsberatung<br />
4.2.2 Schulmedizin<br />
Bei der Therapie der Gicht wird zwischen einer initialen Therapie zur Behandlung des akuten<br />
Gichtanfalls und einer Dauertherapie zur Vermeidung der Entwicklung einer chronischen<br />
Gicht unterschieden.<br />
Initiale Therapie
N a t u r h e i l p r a x i s<br />
C h r i s t i n a C a s a g r a n d e<br />
H e i l p r a k t i k e r i n<br />
Mozartstraße 6 � D -82299 Türkenfeld � Telefon 08193 / 99 99 26 � Fax 08193 / 99 99 25<br />
19 von 26<br />
Im akuten Gichtanfall hat sich Colchicin als wirksamstes Medikament erwiesen. Da dieser<br />
Stoff ein Zellgift ist, sind strenge Dosierungsvorschriften zu befolgen. Dabei werden<br />
zunächst in stündlichen Abständen für einen Zeitraum von vier Stunden höheren Dosen des<br />
Medikaments gegeben, danach in zweistündlichem Abstand eine geringere Dosis bis die<br />
Schmerzen abklingen bzw. Nebenwirkungen, wie Übelkeit oder Durchfall auftreten. Nur<br />
selten ist am zweiten Tag eine Fortsetzung dieser Behandlung, z.b. in Übergangsphasen zur<br />
chronischen Gicht, erforderlich.<br />
Bei einem schweren Verlauf der Gicht können alternativ nicht- steroidale Antirheumatika<br />
(NSAR), z.b. Indomethazin, oder bei einem länger andauernden Anfall Glukokortikoide, z.b.<br />
Prednisolon, eingesetzt werden.<br />
Gleichzeitig sollten die betroffenen Gelenke mit Alkohol- Umschlägen gekühlt werden und<br />
die Extremität ruhig gelagert werden. Außerdem sollte viel Flüssigkeit aufgenommen und auf<br />
Alkohol absolut verzichtet werden.<br />
Dauertherapie<br />
Eine Dauertherapie sollte unmittelbar im Anschluss an den akuten Gichtanfall mit Eintritt in<br />
die interkritische Phase begonnen werden, um weitere Anfälle sowie eine Chronifizierung zu<br />
vermeiden. Bei extremen Gelenkdeformierungen bzw. ausgeprägten<br />
Funktionseinschränkungen kann eine operative Therapie nötig sein, um die volle<br />
Funktionsfähigkeit des Gelenks wieder herzustellen.<br />
Diätetische Maßnahmen<br />
Hierbei sollte trotz der zur Verfügung stehenden Medikamente als erstes die Beeinflussung<br />
des Krankheitsverlaufs durch diätetische Maßnahmen nicht vernachlässigt werden.<br />
Purinreiche Nahrungsmittel, wie Innereien (Herz, Leber, Niere) sowie bestimmte Fischsorten<br />
(Ölsardinen, Sprotten) sollten möglichst vermieden werden. Da Alkohol zu einem Anstieg der<br />
Harnsäurekonzentration im Blut führt, sind sowohl einmalige Alkoholexzesse als auch<br />
chronischer Alkoholkonsum zu vermeiden. Typischerweise werden Gichtanfälle nach<br />
üppigen Mahlzeiten mit reichlichem Alkoholgenuss beobachtet. Auch Kaffee sollte<br />
vermieden, ansonsten aber viel Flüssigkeit zu sich genommen werden.<br />
Medikamentöse Behandlung<br />
Zur medikamentösen Behandlung stehen Urikosurika und Urikostatika zur Verfügung. Zu<br />
Beginn einer Dauertherapie empfiehl sich die Kombination aus beiden Wirkstoffklassen,<br />
nach mehreren Monaten kann dann zu einer alleinigen Therapie mit Urikostatika gewechselt<br />
werden. Ziel ist es, die Harnsäure im Blut zu senken, wobei derzeit der Nutzen der Langzeit-<br />
Prophylaxe umstritten ist.<br />
Urikosurika, z.b. Benzbromaron, bewirken durch eine Hemmung der Rückresorption der<br />
Harnsäure in der Niere eine vermehrte Ausscheidung dieser Substanz. Sie sind Harnsäure<br />
treibende Medikamente. Zusätzlich ist auf eine reichliche Flüssigkeitszufuhr und eine<br />
Alkalisierung des Urins zu achten, z.b. durch das Trinken alkalischer Mineralwasser oder die<br />
Gabe alkalischer Medikamente.<br />
Urikostatika, z.b. Allopurinol, hemmen die Bildung der Harnsäure. Die dadurch vermehrt<br />
anfallenden Vorstufen der Harnsäure sind wesentlich besser wasserlöslich und können<br />
daher einfacher über die Nieren ausgeschieden werden. Bei der Anwendung von Allopurinol<br />
kann es zu Nebenwirkungen wie Übelkeit, Durchfall, Muskelschmerzen, Schwindel,
N a t u r h e i l p r a x i s<br />
C h r i s t i n a C a s a g r a n d e<br />
H e i l p r a k t i k e r i n<br />
Kopfschmerzen und in Einzelfällen zu Blutbildveränderungen und Leberfunktionsstörungen<br />
kommen.<br />
5 Morbus Bechterew<br />
Mozartstraße 6 � D -82299 Türkenfeld � Telefon 08193 / 99 99 26 � Fax 08193 / 99 99 25<br />
20 von 26<br />
5.1 Überblick<br />
Der Morbus Bechterew ist eine chronische, entzündlich- rheumatische Erkrankung, die<br />
hauptsächlich die Wirbelsäule betrifft. Sie beginnt meist im jungen Erwachsenenalter und tritt<br />
häufiger bei Männern auf. In der Regel ist ein typisches genetisches Merkmal zu finden<br />
(HLA-B27). Das Leitsymptom ist der tief sitzende, chronisch-entzündliche Rückenschmerz<br />
mit Morgensteifigkeit. In der Folge kommt es zu zunehmender Versteifung der gesamten<br />
Wirbelsäule. Das Vollbild, die so genannte Bambusstabwirbelsäule, ist eher selten. Daneben<br />
treten entzündliche Veränderungen in den großen Gelenke, Sehnen, Augen und im<br />
Herzmuskel auf. In der Regel "brennt die Entzündung nach einer gewissen Zeit aus" und der<br />
Krankheitsprozess schreitet nicht weiter fort. Die Diagnose erfolgt durch Röntgen und MRT.<br />
Die Behandlung besteht aus Krankengymnastik und entzündungshemmenden<br />
Medikamenten (nichtsteroidale Antirheumatika, Glukukortikoide, Immunsuppressiva). In<br />
manchen Fällen kann bei Hüftgelenksbeteiligung ein operativer Gelenksersatz notwendig<br />
sein.<br />
5.1.1 Definition/Allgemeines<br />
Definition<br />
Der Morbus Bechterew, auch als ankylosierende Spondylitis bezeichnet, ist eine chronische,<br />
entzündlich-rheumatische Erkrankung, welche vor allem die Wirbelsäule aber auch die<br />
peripheren Gelenke, die Sehnen und Sehnenansätze, die Regenbogenhaut der Augen und,<br />
wenn auch seltener, innere Organe betreffen kann. Man zählt den Morbus Bechterew zu der<br />
Krankheitsgruppe der HLA-B27-assoziierten Spondylarthropathien oder seronegativen<br />
Spondarthritiden.<br />
Häufigkeit<br />
Der Morbus Bechterew kommt in Mitteleuropa bei ca. 0,2 - 0,3 % der Bevölkerung vor. Am<br />
häufigsten beginnt die Erkrankung zwischen dem 16. und 45. Lebensjahr, mit einem<br />
Maximum im 26. Lebensjahr. Männer sind etwa 3 mal häufiger betroffen als Frauen.<br />
5.1.2 Symptome<br />
Das Leitsymptom des M. Bechterew ist der entzündliche Rückenschmerz:<br />
� Beginn vor dem 45. Lebensjahr<br />
� langsamer Beginn<br />
� Dauer länger als drei Monate<br />
� morgendliches Schmerzmaximum verbunden mit einer Morgensteifigkeit der Wirbelsäule<br />
� Besserung durch Bewegung<br />
Vier von diesen fünf Kriterien sollten beim Vorliegen eines M. Bechterew erfüllt sein. Diese<br />
Kriterien sollen helfen, andere, häufigere Ursachen für Rückenschmerzen, wie z.b.<br />
Bandscheibenleiden, vom M. Bechterew zu unterscheiden.
N a t u r h e i l p r a x i s<br />
C h r i s t i n a C a s a g r a n d e<br />
H e i l p r a k t i k e r i n<br />
Mozartstraße 6 � D -82299 Türkenfeld � Telefon 08193 / 99 99 26 � Fax 08193 / 99 99 25<br />
21 von 26<br />
Fast immer beginnt der Morbus Bechterew als Sakroiliitis, also im Iliosacral-Gelenk, welches<br />
das Kreuzbein mit dem Becken verbindet. Deshalb sind die Rückenschmerzen zu Beginn<br />
fast immer tiefsitzend.<br />
Im weiteren Verlauf der Erkrankung kommt es zu einer Mitbeteiligung der restlichen<br />
Wirbelsäule mit Schmerzen und deren allmählicher Einsteifung.<br />
Der M. Bechterew kann neben der Wirbelsäule noch andere Gelenke und Organe befallen:<br />
� Periphere Arthritis (ca. 40%): häufig sind vor allem die großen Gelenke wie Knie, Hüften<br />
und Schultern betroffen. Vor allem die Hüften können durch die Entzündung schon in<br />
jungen Jahren zerstört werden.<br />
� Enthesiopathien (ca. 20-30%): Damit sind Schmerzen und Entzündungen der Sehnen,<br />
des Sehnengleitgewebes und der Schleimbeutel gemeint. Typisch ist z.b. die<br />
Achillodynie, also die Druckschmerzhaftigkeit der Achillesferse oder die Entwicklung<br />
eines Fersensporns.<br />
� Iridozyklitis (ca. 30-50%): diese wiederkehrende Entzündung der vorderen<br />
Augenkammer und der Regenbogenhaut (vordere Uveitis) kann durch Verklebungen zu<br />
Einschränkungen der Sehkraft führen. Die Leitsymptome sind Rötung der Augen,<br />
Schmerzen und Lichtempfindlichkeit. Patienten mit positivem HLA-B27 haben manchmal<br />
immer wiederkehrende Iridozyklitiden ohne andere Zeichen eines M. Bechterew.<br />
� Herzbeteiligung: selten sind Entzündungen der Hauptschlagader (Aortitis) mit der<br />
Entstehung von Klappenfehlern der Aortenklappe (Aorteninsuffizienz). Häufiger treten<br />
Herzrhythmusstörungen, vor allem der Vorhöfe, mit anfallsartigem Herzrasen<br />
(supraventrikuläre Tachykardien) und Störungen der Reizleitung (AV-Block) auf.<br />
Gefährliche Rhythmusstörungen sind jedoch sehr selten.<br />
Sehr selten wird eine milde Lungenfibrose, vor allem in den Lungenoberfeldern gefunden.<br />
Auch Durchfälle als Ausdruck einer milden Dickdarmbeteiligung (Kolitis) sind möglich.<br />
5.1.3 Diagnose<br />
Anamnese und klinische Untersuchung<br />
Der entzündliche Rückenschmerz ist nur ein erster Anhalt für einen M. Bechterew.<br />
Zusätzliche Symptome, wie z.b. Iridozyklitiden, unterstützen den Verdacht. Bei der klinischen<br />
Untersuchung ist vor allem der Nachweis einer Sakroiliitis wichtig. Dafür sollte der Arzt das<br />
so genannte Menell'sche Zeichen testen, welches auf eine Sakroiliitis hinweist.
N a t u r h e i l p r a x i s<br />
C h r i s t i n a C a s a g r a n d e<br />
H e i l p r a k t i k e r i n<br />
Menell'sches Zeichen: Durch Festhalten des Kreuzbeins mit der Handfläche und<br />
Überstreckung des Beines wird das Becken gegenüber dem Kreuzbein im Iliosacralgelenk<br />
bewegt . Das Zeichen ist positiv, wenn die Bewegung im Iliosacralgelenk schmerzhaft ist.<br />
Mozartstraße 6 � D -82299 Türkenfeld � Telefon 08193 / 99 99 26 � Fax 08193 / 99 99 25<br />
22 von 26<br />
Eine Einsteifung der Wirbelsäule oder sogar die Verkrümmung nach vorne sind Spätzeichen<br />
und können auch bei anderen Wirbelsäulenerkrankungen vorkommen.<br />
Röntgen<br />
Da der M. Bechterew fast immer im Iliosacralgelenk beginnt, können hier die ersten<br />
Veränderungen im Röntgenbild gefunden werden. Typisch ist das so genannte bunte Bild<br />
mit dem Nebeneinander einer unscharfen Gelenkkontur, perlschnurartig angeordneter<br />
Knochendefekte (Erosionen) und gelenknaher Knochenverdichtungen (Sklerosierung). Im<br />
späteren Verlauf kommt es zu einer knöchernen Überbrückung des Gelenks<br />
(Ankylosierung). Diese Veränderungen des Iliosacralgelenks können auch bei den anderen,<br />
mit dem M. Bechterew verwandten Spondylarthropathien vorkommen.<br />
Laboruntersuchungen<br />
Eine erhöhte Blutsenkung (BSG) und eine Erhöhung des C- reaktiven Proteins (CRP),<br />
welches beides typische Zeichen einer Entzündung im Blut sind, können meist auch beim M.<br />
Bechterew gefunden werden. Allerdings sind die Werte oft gerade bei eher milden<br />
Erkrankungen nur sehr gering oder auch gar nicht erhöht.<br />
Die Bestimmung des HLA-B27 hilft bei der Diagnosestellung nur, wenn man schon deutliche<br />
andere Hinweise auf einen M. Bechterew hat. Das liegt daran, dass zwar 95 % der Patienten<br />
mit M. Bechterew, aber auch 7-8 % der Gesunden HLA-B27 positiv sind. Da der M.<br />
Bechterew bei etwa 0,2-0,3 % der Bevölkerung vorliegt, bekommen von den vielen HLA-B27<br />
positiven Menschen nur weniger als jeder 20ste einen M. Bechterew. Dagegen sind andere<br />
Ursachen für Rückenschmerzen auch bei diesen Menschen sehr häufig.<br />
5.1.4 Entstehung<br />
Entstehung<br />
Beim Morbus Bechterew führt ein gestörtes Wechselspiel zwischen genetischen Anlagen<br />
und Umwelteinflüssen zu einer krankhaften Immunreaktion des Organismus mit der Folge<br />
einer chronischen Entzündung, vor allem der Wirbelsäule:<br />
95% der Patienten mit M. Bechterew haben den Gewebemarker HLA-B27, ein HLA Klasse I-<br />
Molekül, welches nur bei etwa 7-8% der Gesunden vorkommt. Die HLA-Klasse I-Moleküle<br />
sind Oberflächenmoleküle, welche auf fast allen Körperzellen vorhanden sind und eine<br />
wichtige Rolle bei der Infektionsabwehr und der Unterscheidung des Immunsystems<br />
zwischen "fremd und eigen" spielen. Ähnlich wie die Blutgruppen bleiben sie bei jedem<br />
Menschen das ganze Leben gleich, sind aber von Individuum zu Individuum unterschiedlich.<br />
HLA-B27 kommt in manchen Familien gehäuft vor.<br />
Das HLA-B27-Molekül hat eine dreidimensionale Form, in der es, anders als andere HLA-<br />
Moleküle, bestimmte Bakterien, insbesondere die Erreger von Durchfall und<br />
Harnröhrenentzündungen (Yersinien, Salmonellen, Clamydien u.a.) einschließt und sie damit<br />
für die T-Lymphozyten erkennbar macht. Die T-Lymphozyten sind spezielle Zellen, die bei<br />
der Immunabwehr eine wichtige Rolle spielen. Dem medizinischen Laien sind sie sicherlich<br />
im Zusammenhang mit Aids bzw. einer HIV-Infektion bekannt geworden.<br />
Prognose
N a t u r h e i l p r a x i s<br />
C h r i s t i n a C a s a g r a n d e<br />
H e i l p r a k t i k e r i n<br />
Die Erkrankung verläuft sehr verschieden. Der schwere M. Bechterew mit kompletter<br />
Einsteifung der Wirbelsäule und evtl. Invalidität kommt nur in etwa 10-20% der<br />
Spondylarthropathien vor. Die allermeisten Patienten können, trotz<br />
Bewegungseinschränkungen der Wirbelsäule, noch ihrem Beruf nachgehen und werden<br />
nicht erwerbsunfähig.<br />
Ein Problem ist die Arthritis in den Hüftgelenken, welche zu einer raschen Zerstörung der<br />
Gelenke führen und damit schon bei jungen Leuten einen Hüftgelenksersatz nötig machen<br />
kann.<br />
5.2 Therapie<br />
5.2.1 Naturheilkunde<br />
Behandlung mit Solunaten:<br />
Solunat Nr.17 (Sanguisol) 1x10 Tr. morgens<br />
Solunat Nr.10 (Matrigen I) 2x10 Tr. morgens und abends<br />
Solunat Nr.18 (Splenetik) 2x15 Tr. morgens und abends<br />
Solunat Nr.14 (Polypathik) 3x8-10 Tr. über den Tag verteilt<br />
bei Herzbeteiligung: Solunat Nr.5 (Cordiak) 1x5-10 Tr. mittags<br />
bei Augenbeteiligung: Solunat Nr.12 (Ophthalmik) 1x5 - 10 Tr. mittags<br />
Spagyrische Eigenbluttherapie<br />
Sportsalbe auf schmerzende Stellen auftragen und einmassieren.<br />
Zusatztherapien:<br />
Homöopathie: Konstitutionsbehandlung<br />
Yoga: alle die Rückenmuskulatur stärkenden Maßnahmen, wie z.b. Kobra, Heuschrecke,<br />
Sonnengebet<br />
5.2.2 Schulmedizin<br />
Therapie<br />
Die wichtigste Therapie zur Schmerzbekämpfung und Erhaltung der Beweglichkeit der<br />
Wirbelsäule ist eine regelmäßige Krankengymnastik. Der Patient sollte dabei mehrmals die<br />
Woche angeleitet werden und täglich zu Hause Übungen durchführen. Eventuell sind<br />
stationäre Behandlungen in Rheumakliniken sehr hilfreich.<br />
An zweiter Stelle kommt die medikamentöse Therapie. Neben einer Schmerztherapie mit<br />
nicht-steroidalen Antirheumatika (NSAR wie z.b. Diclofenac, Indometacin u.v.a.) und den<br />
Kortisonpräparaten (Glukokortikoide wie z.b. Prednison u.a.) werden so genannte<br />
Basismedikamente, welche den Krankheitsverlauf beeinflussen, eingesetzt.<br />
Mozartstraße 6 � D -82299 Türkenfeld � Telefon 08193 / 99 99 26 � Fax 08193 / 99 99 25<br />
23 von 26
6 Reiter Syndrom<br />
N a t u r h e i l p r a x i s<br />
C h r i s t i n a C a s a g r a n d e<br />
H e i l p r a k t i k e r i n<br />
Mozartstraße 6 � D -82299 Türkenfeld � Telefon 08193 / 99 99 26 � Fax 08193 / 99 99 25<br />
24 von 26<br />
6.1 Überblick<br />
Das Reiter-Syndrom ist eine Erkrankung, bei der ein bestimmter Symptomenkomplex (siehe<br />
unter Definition) auftritt. Besonders häufig betroffen sind junge Männer. Die Diagnose kann<br />
auf Grund des typischen Beschwerdebildes gestellt werden. Die Therapie erfolgt<br />
schulmedizinisch durch die Gabe entzündungshemmender Medikamente sowie durch<br />
Maßnahmen der physikalischen Therapie. Die Erkrankung kann chronisch verlaufen.<br />
6.1.1 Definition/Allgemeines<br />
Das Reiter-Syndrom ist eine Erkrankung, die durch das gemeinsame Auftreten von<br />
Gelenkentzündungen, Bindehautentzündungen des Auges, einer Harnröhrenentzündung<br />
sowie Hautveränderungen gekennzeichnet ist. Die Bezeichnung geht auf den Berliner<br />
Bakteriologen und Hygieniker Hans Reiter (1881-1969) zurück.<br />
6.1.2 Entstehung<br />
Das Reiter-Syndrom entwickelt sich nach Ablauf bestimmter bakterieller Infektionen des<br />
Darmes, z.b. mit Salmonellen, Yersinien oder Shigellen, oder der Harnwege, z.b. mit<br />
Clamydien, Gonokokken oder Ureaplasma. Es stellt eine Folgeerkrankung nach bakteriellen<br />
Infektionen dar und wird nicht selbst durch bestimmte Erreger verursacht. Im weitesten<br />
Sinne könnte man es daher den allergischen Reaktionen zuordnen. Besonders gefährdet<br />
sind Menschen, die das Histokompatibilitäts-Antigen HLA-B27 aufweisen. Unter einem<br />
Histokompatibilitäts-Antigen versteht man ein genetisch festgelegtes, immunologisch aktives<br />
Areal auf der Zelloberfläche. Ca. 80 % der Patienten mit einem Reiter- Syndrom weisen das<br />
Antigen HLA-B27 auf. Das Antigen HLA- B27 ist bei einer Vielzahl von Patienten mit<br />
entzündlichen Gelenkerkrankungen, wie z.b. dem Morbus Bechterew, vorhanden.<br />
Häufigkeit<br />
Man geht davon aus, dass ca. 3 % der Patienten mit bestimmten Infektionen des Darmes<br />
und der Harnwege ein Reiter-Syndrom entwickeln. Junge Männer sind besonders häufig<br />
betroffen.<br />
Komplikationen<br />
Komplikationen ergeben sich, wenn es auf Grund der Gelenkentzündung zu einer<br />
bleibenden Beeinträchtigung der Gelenkfunktion bis hin zu Zerstörung des Gelenkes kommt.<br />
Am Auge kann es infolge eines Übergriffes der Entzündung von der Bindehaut auf die Iris<br />
sowie die angrenzenden Augenstrukturen zu einer dauerhaften Beeinträchtigung des<br />
Sehens und zur Entwicklung eines Glaukoms kommen.<br />
Prognose<br />
Mehr als die Hälfte der Patienten ist nach einem halben Jahr beschwerdefrei. Je<br />
ausgeprägter die Erkrankung ist, dass heißt, je mehr Gelenke betroffen sind und je mehr<br />
andere Beschwerden vorliegen, umso langwieriger gestaltet sich der Verlauf. Chronische<br />
Verlaufsformen sind möglich.<br />
Die mittlere Verlaufsdauer der Erkrankung beträgt 3 Jahre. In seltenen Ausnahmefällen sind<br />
Krankheitsverläufe von 10-15 Jahren möglich.
N a t u r h e i l p r a x i s<br />
C h r i s t i n a C a s a g r a n d e<br />
H e i l p r a k t i k e r i n<br />
6.1.3 Symptome<br />
Typisch für Patienten mit Reiter-Syndrom ist das gleichzeitige Auftreten von Fieber,<br />
Gelenkentzündungen, Entzündungen der Bindehaut, der Harnröhre sowie von<br />
Hautveränderungen.<br />
Mozartstraße 6 � D -82299 Türkenfeld � Telefon 08193 / 99 99 26 � Fax 08193 / 99 99 25<br />
25 von 26<br />
Nach Ablauf der Infektion des Darmes oder der Harnwege kommt es zu Schmerzen,<br />
Schwellungen und Bewegungseinschränkungen in den großen Gelenken, vorwiegend der<br />
Beine. In den entzündlichen Prozess können die Sehnenansatzpunkte der Muskeln an den<br />
Knochen einbezogen sein. Schmerzen beim Auftreten im Bereich der Ferse, weisen auf eine<br />
Entzündung am Ansatz der Achillessehne am Fersenbein hin.<br />
Die Hautveränderungen können vielgestaltig sein. Typisch ist die Balanitis circinata.<br />
Darunter versteht man Hautveränderungen an der Vorhaut, die in kleinen rundlichen<br />
Rötungen besteht, die von einem weißlichen Randsaum umgeben sind. Andere häufig<br />
befallenen Hautstellen sind die Hand- und Fußsohlen sowie die Nägel. Die<br />
Hautveränderungen können einer Schuppenflechte ähneln, als gerötete Knoten auftreten<br />
oder zu einer Verhornung der Haut führen. Die Mundschleimhaut kann ebenfalls betroffen<br />
sein.<br />
Gleichzeitig klagen viele Patienten über brennende Schmerzen der Augen sowie über<br />
Lichtscheu als Ausdruck einer Bindehautentzündung. Auf eine Harnröhrenentzündung<br />
weisen brennende Schmerzen beim Wasserlassen hin.<br />
6.2 Therapie<br />
6.2.1 Naturheilkunde<br />
Behandlung mit Solunaten:<br />
während der Fieberphase:<br />
Solunat Nr.7 (Epidemik) 3-4x10 Tr. über den Tag verteilt<br />
danach:<br />
Solunat Nr.3 (Azinat) 2x15 Tr. morgens und abends<br />
zusätzlich, auch schon während der Fieberphase und im Anschluss daran:<br />
Solunat Nr.16 (Renalin) 2x10 Tr. morgens und mittags<br />
Solunat Nr.9 (Lymphatik) 2x15 Tr. morgens und abends<br />
Solunat Nr.12 (Ophthalmik) 2x5-10 Tr. morgens und mittags<br />
Im Anschluss an die Behandlung der akuten Phase könnte eine spagyrische<br />
Eigenbluttherapie angezeigt sein.<br />
Zusatztherapie:<br />
Homöopathie: Konstitutionsbehandlung<br />
Yoga: alle Übungen, die die Gelenkbeweglichkeit sanft fördern<br />
Osteopathie und andere physikalischen Maßnahmen
6.2.2 Schulmedizin<br />
Therapie<br />
N a t u r h e i l p r a x i s<br />
C h r i s t i n a C a s a g r a n d e<br />
H e i l p r a k t i k e r i n<br />
Mozartstraße 6 � D -82299 Türkenfeld � Telefon 08193 / 99 99 26 � Fax 08193 / 99 99 25<br />
26 von 26<br />
Die Behandlung der Patienten erfolgt mit entzündungshemmenden Medikamenten, wie z.b.<br />
nicht- steroidalen Antiphlogistika (NSAR), deren bekanntester Vertreter wohl das Aspirin ist.<br />
Antibiotika werden im Allgemeinen nicht eingesetzt, da aktuell meist keine Erreger<br />
nachweisbar sind.<br />
Bei einem besonders schweren Krankheitsverlauf mit Beteiligung mehrerer Gelenke und<br />
einem Übergreifen der Bindehautentzündung auf die Regenbogenhaut (Iridozyklitis) müssen<br />
Kortikosteroide eingesetzt werden, um bleibende Veränderungen zu vermeiden. Die<br />
Gelenkentzündungen werden zusätzlich durch Maßnahmen der physikalischen Therapie<br />
behandelt, wie z.b. Kälteanwendungen sowie Übungen zum Erhalt der Gelenkbeweglichkeit<br />
und Vermeidung von Muskelschwund.<br />
7 Quellenangabe und Literaturhinweise<br />
Quellen:<br />
Texte, Grafiken und Bilder der allgemeinen Krankheitsbeschreibungen wurden von<br />
folgenden frei zugänglichen Quellen adaptiert:<br />
www.onmeda.de<br />
www.wikipedia.de<br />
Die Naturheilkundlichen Behandlungsvorschläge stammen von der Referentin.<br />
Diese Unterlagen dienen ausschließlich der Hintergrundinformation im Rahmen eines<br />
Fachvortrages.<br />
Obwohl diese Informationen mit Sorgfalt zusammengetragen wurden, kann keinerlei Haftung<br />
für Vollständigkeit oder Richtigkeit übernommen werden.<br />
Literatur:<br />
„Praxis Spagyrik nach Alexander von Bernus“ <strong>Christina</strong> <strong>Casagrande</strong>, Haug Verlag,2. Auflage<br />
2011<br />
„Das Therapiehandbuch der Solunate“, Hannes Proeller, Insole Verlag, 3. Auflage 2011<br />
“Yoga: Asana, Pranayama, Mudra, Bandha”, Swami Satyananda Saraswati<br />
Satyananda Yoga Zentrum e.V. Germany, ISBN 3-928831-17-8<br />
„Wesen und Signatur der Heilpflanzen“, Roger Kalbermatten, AT-Verlag