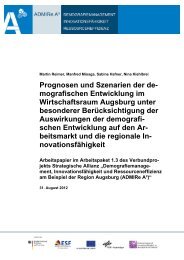Wertschöpfung durch Wertschätzung - Universität Bamberg
Wertschöpfung durch Wertschätzung - Universität Bamberg
Wertschöpfung durch Wertschätzung - Universität Bamberg
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Innovationspotential im<br />
demografischen Wandel<br />
Innovationspotential im<br />
demografischen Wandel Rubrik<br />
Es ist gerade diese dritte Innovatorengruppe, die für den Erfolg<br />
oder Misserfolg unternehmensgetriebener, strategischer<br />
Open Innovation entscheidend ist. Periphere Mitarbeiter-<br />
Innovatoren bilden die Brücke zwischen den externen Innovationsakteuren<br />
und den internen F&E-Akteuren. Mit ihrem<br />
Engagement, ihrer Offenheit und Innovationsorientierung<br />
können sie externen Innovationsideen im Unternehmen<br />
zum Erfolg verhelfen. Mit einer Mentalität des „Not-Invented-Here“,<br />
mit Ablehnung oder Ignoranz aber können diese<br />
peripheren Akteure auch zu destruktiven Innovations-Opponenten<br />
(Reichwald et al., 2010) werden. Gelingt es jedoch,<br />
periphere Akteure im Unternehmen als Innovatoren für offene<br />
Innovationsaktivitäten zu gewinnen, so lassen sich im<br />
Zusammenspiel der drei Typen von Innovatoren nicht nur<br />
Innovationsprozesse öffnen, sondern insbesondere unterschiedliche<br />
Kompetenzen, Wissensdomänen und Ressourcen<br />
integrieren und so die Innovationsfähigkeit eines Unternehmens<br />
nachhaltig fördern.<br />
Zur Realisierung und Unterstützung von Open Innovation-Initiativen<br />
hat sich heute bereits eine breite Palette unterschiedlicher<br />
Werkzeugtypen etabliert. Fünf zentrale Werkzeugklassen<br />
lassen sich unterscheiden (Möslein und Neyer, 2009):<br />
Innovationswettbewerbe (siehe innovationcontest.de), Innovationsmarktplätze<br />
(z.B. innocentive.com), Innovations-Communities<br />
(z.B. unseraller.de), Innovations-Toolkits (z.B. selve.<br />
de) oder Innovationstechnologien (vgl. ponoko.com).<br />
Open Innovation im Unternehmen<br />
Traditionelle Innovationsprozesse in weitgehend geschlossenen<br />
F&E-Abteilungen sind in vielen Unternehmen bereits<br />
bestens in die Prozesslandschaft integriert, typischerweise<br />
<strong>durch</strong> sogenannte Stage-Gate-Prozesse. Auch ist es inzwischen<br />
weithin akzeptiert und vielfach implementiert, bereichsübergreifend<br />
verschiedene Abteilungen und Funktionsbereiche<br />
gemeinsam in die Innovationsarbeit einzubinden<br />
(Page, 1993). Eine neuere Entwicklung zeigt sich mit der<br />
Übernahme von ursprünglich unternehmensexternen Open<br />
Innovation-Werkzeugen, wie z.B. Innovations-Communities,<br />
zur Einbindung von Mitarbeitern innerhalb von Unternehmen<br />
und Unternehmensnetzwerken.<br />
Ziel der internen Anwendung von Open Innovation-Instrumenten<br />
ist ein aktiver Einbezug von Mitarbeitern in der Breite<br />
des Unternehmens – der sog. peripheren Innovatoren – sowie<br />
eine bewusste, innovationsorientierte Vernetzung von Mitarbeitern<br />
über unterschiedliche Unternehmensteile hinweg. Im<br />
Rahmen des BMBF- und ESF-geförderten Projekts „Open-I“<br />
(FKZ: 01FM07053/54/55) konnte bereits erfolgreich gezeigt<br />
werden, wie Mitarbeiter gezielt in interne Innovations-Communities<br />
eingebunden werden können.<br />
Grenzinnovatoren: Innovationspotenzial im<br />
demografischen Wandel<br />
Die Gesamtheit der peripheren Innovatoren, also die Belegschaft<br />
in der Breite eines Unternehmens, wird sich in den<br />
nächsten Jahren drastisch verändern. So erwarten Unternehmen<br />
beispielsweise eine Verknappung der verfügbaren<br />
Humanressourcen. Zudem führt der demografische Wandel<br />
zu einer Verschiebung der Altersstruktur von Unternehmen.<br />
Es wird also erwartet, dass weniger junge Mitarbeiter in Unternehmen<br />
eintreten, gleichzeitig aber eine immer größere<br />
Zahl von älteren Mitarbeitern das Unternehmen verlässt.<br />
Dies erfordert eine Organisation der Innovationsprozesse, die<br />
die Nutzung der vorhandenen Humanressourcen bei gleichzeitigem<br />
Ermöglichen von intergenerationalem Austausch<br />
sicherstellt. Dabei rücken in natürlicher Weise die Grenzbereiche<br />
eines Unternehmens in den Fokus des Interesses. Akteure,<br />
die an der Unternehmensgrenze agieren, treten plötzlich<br />
aus dem Schatten.<br />
Diese Entwicklung trifft sich mit einer Notwendigkeit der<br />
erfolgreichen Gestaltung von Open Innovation: Zur erfolgreichen<br />
Überbrückung der Unternehmensgrenze zwischen<br />
„Innen“ und „Außen“ kommt Akteuren an der Unternehmensgrenze<br />
eine besondere Rolle zu: Als sogenannte<br />
„Grenzinnovatoren“ können Unternehmesmitglieder an der<br />
Unternehmensgrenze zu wichtigen Brückenbauern in Open<br />
Innovation-Initiativen werden.<br />
Als Grenzinnovatoren bezeichnen wir dabei insbesondere die<br />
folgenden Personengruppen:<br />
n Personen, die in ein Unternehmen gerade neu als Mitarbeiter<br />
eingetreten sind. Sie sind formal dem Unternehmen<br />
zugehörig, haben aber noch den „unverstellten“<br />
Blick des Externen. Insbesondere Auszubildende, Praktikanten<br />
oder auch Werkstudenten bilden mit der ihnen<br />
typischen „Außensicht“ einen hervorragenden Pool an<br />
Grenzinnovatoren.<br />
n Personen, die – beispielsweise aus Altersgründen – aus<br />
dem Unternehmen ausscheiden, bilden einen weiteren<br />
wichtigen Potenzialpool als Grenzinnovatoren. Diese Akteure<br />
sind oftmals mit ihrem Kopf noch vollständig im<br />
Unternehmen, auch wenn sie formal bereits ausgeschieden<br />
sind. Sie weisen somit hervorragende Eigenschaften<br />
als loyale Grenzgänger und potentielle Grenzinnovatoren<br />
auf.<br />
n Auch Personen, die nur temporär das Unternehmen verlassen,<br />
beispielsweise Mütter oder Väter in Eltern(teil-)<br />
zeit, können den Pool potentieller Grenzinnovatoren gezielt<br />
ergänzen. Häufig ist es ihnen ein Anliegen im Geschehen<br />
des Unternehmens eingebunden zu bleiben,<br />
wenngleich andere Aufgaben temporär ihren Alltag bestimmen.<br />
Heute „leisten“ wir es uns üblicherweise auf<br />
diese Personengruppe weitgehend zu verzichten. Aufgrund<br />
ihrer Position als Grenzgänger sind aber auch sie<br />
ideale Kandidaten für eine Mitwirkung im Innovationsgeschehen<br />
als Grenzinnovatoren.<br />
Es zeigt sich: Mitarbeiter, die temporär oder dauerhaft die<br />
Grenze des Unternehmens überschreiten, fallen heute oft<br />
<strong>durch</strong> das Raster oder finden keine Infrastruktur (Ansprechpartner,<br />
Prozesse, Tools) vor, um ihre Ideen und ihr Wissen<br />
einzubringen. Als Grenzinnovatoren aber können gerade sie in<br />
offenen Innovationsprojekten eine zentrale Rolle einnehmen.<br />
Die Öffnung von Innovationsprozessen<br />
ermöglicht es Unternehmen, ihre<br />
Innovationsfähigkeit zu erhalten und<br />
auszubauen.<br />
Grenzinnovatoren vereinen Lösungs- und Anwendungswissen<br />
sowie unterschiedliche Wissensdomänen. Damit bieten<br />
sie aus Sicht der Innovations- und Kreativitätsforschung ideale<br />
Voraussetzungen für die gemeinschaftliche offene Generierung<br />
von Innovationen. Gerade im Zuge des demografischen<br />
Wandels liegt die Nutzung dieses Innovationspotenzials auf<br />
der Hand. Es gilt, Strukturen, Prozesse und entsprechende<br />
Tools zu entwickeln, damit diese Innovationsquelle effektiv<br />
genutzt werden kann. Ihre besonderen Merkmale (z.B.<br />
Wegfall der direkten Belegschaftszugehörigkeit bei ausgeschiedenen<br />
Mitarbeitern) erfordern spezielle Maßnahmen<br />
zur Erschließung ihres Innovationspotenzials. Zu erwarten ist<br />
beispielsweise, dass sich die Motivationssituation von Grenzinnovatoren<br />
anders gestaltet und klassische Incentivierungsmaßnahmen<br />
hier fehlgeleitet sind.<br />
Insgesamt ist die Öffnung von Innovationsprozessen mittels<br />
Grenzinnovatoren eine logische Weiterentwicklung des Open<br />
Innovation-Gedankens und ermöglicht die Erhaltung und den<br />
Ausbau der organisationalen Innovationsfähigkeit im Kontext<br />
des demografischen Wandels.<br />
Literatur:<br />
Möslein, K./Neyer, A.-K. (2009). Open Innovation – Grundlagen, Herausforderungen,<br />
Spannungsfelder. In Zerfaß, A./ Möslein, K. (Hrsg.): Kommunikation als<br />
Erfolgsfaktor im Innovationsmanagement. Gabler.<br />
Neyer, A.-K./Bullinger, A./Möslein, K. (2009). Integrating Inside and Outside Innovators:<br />
A Sociotechnical Systems Perspective. R&D Management 39(4). S. 410–419.<br />
Page, A. (1993). Assessing New Product Development Practices and Performance:<br />
Establishing crucial norms. Journal of Product Innovation Management 10. S.<br />
273-290.<br />
Reichwald, R./ Möslein, K.M./ Neyer, A.K./ Scheler, J. (2010). Open Innovation:<br />
Methodologische Präzisierung und praktische Umsetzung im Projekt Open-I: Open<br />
Innovation im Unternehmen, in Jacobsen, H. & Schallock, B. (Hrsg.). Innovationsstrategien<br />
jenseits traditionellen Managements, Stuttgart: Fraunhofer Verlag, S.<br />
243-250.<br />
Von Hippel, E. (2005). Democratizing Innovation. Cambridge. MIT Press.<br />
12<br />
13