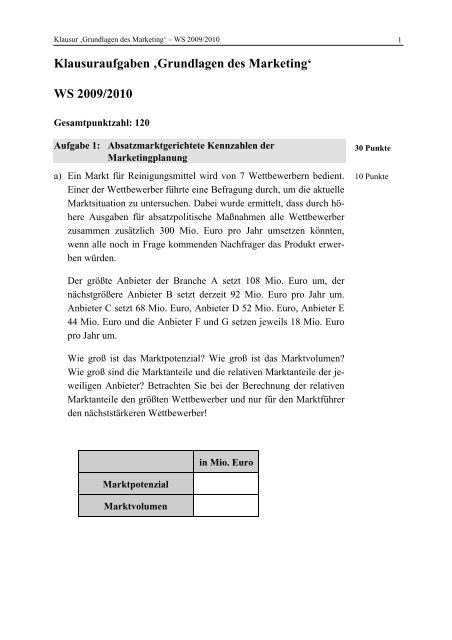Klausuraufgaben âGrundlagen des Marketing' WS 2009/2010
Klausuraufgaben âGrundlagen des Marketing' WS 2009/2010
Klausuraufgaben âGrundlagen des Marketing' WS 2009/2010
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Klausur ‚Grundlagen <strong>des</strong> Marketing‘ – <strong>WS</strong> <strong>2009</strong>/<strong>2010</strong> 1<br />
<strong>Klausuraufgaben</strong> ‚Grundlagen <strong>des</strong> Marketing‘<br />
<strong>WS</strong> <strong>2009</strong>/<strong>2010</strong><br />
Gesamtpunktzahl: 120<br />
Aufgabe 1: Absatzmarktgerichtete Kennzahlen der<br />
Marketingplanung<br />
a) Ein Markt für Reinigungsmittel wird von 7 Wettbewerbern bedient.<br />
Einer der Wettbewerber führte eine Befragung durch, um die aktuelle<br />
Marktsituation zu untersuchen. Dabei wurde ermittelt, dass durch höhere<br />
Ausgaben für absatzpolitische Maßnahmen alle Wettbewerber<br />
zusammen zusätzlich 300 Mio. Euro pro Jahr umsetzen könnten,<br />
wenn alle noch in Frage kommenden Nachfrager das Produkt erwerben<br />
würden.<br />
30 Punkte<br />
10 Punkte<br />
Der größte Anbieter der Branche A setzt 108 Mio. Euro um, der<br />
nächstgrößere Anbieter B setzt derzeit 92 Mio. Euro pro Jahr um.<br />
Anbieter C setzt 68 Mio. Euro, Anbieter D 52 Mio. Euro, Anbieter E<br />
44 Mio. Euro und die Anbieter F und G setzen jeweils 18 Mio. Euro<br />
pro Jahr um.<br />
Wie groß ist das Marktpotenzial? Wie groß ist das Marktvolumen?<br />
Wie groß sind die Marktanteile und die relativen Marktanteile der jeweiligen<br />
Anbieter? Betrachten Sie bei der Berechnung der relativen<br />
Marktanteile den größten Wettbewerber und nur für den Marktführer<br />
den nächststärkeren Wettbewerber!<br />
Marktpotenzial<br />
Marktvolumen<br />
in Mio. Euro
Klausur ‚Grundlagen <strong>des</strong> Marketing‘ – <strong>WS</strong> <strong>2009</strong>/<strong>2010</strong> 2<br />
Anbieter<br />
A<br />
Anbieter<br />
B<br />
Anbieter<br />
C<br />
Anbieter<br />
D<br />
Anbieter<br />
E<br />
Anbieter<br />
F<br />
Anbieter<br />
G<br />
Umsätze<br />
in Mio.<br />
Euro<br />
Marktanteile<br />
(in %)<br />
Rel. Marktanteile<br />
b) Die Marktforschungsabteilung <strong>des</strong> Anbieters C findet heraus, dass<br />
sich der Markt in drei Marktsegmente (X, Y und Z) unterteilen lässt.<br />
Bei dieser Marktsegmentierung stellt die Abteilung fest, dass das<br />
Marktsegment X ein Potenzial von 400 Mio. Euro aufweist. Zusätzlich<br />
fällt den Marktforschern auf, dass die Anbieter A, B und D ihre<br />
Produkte nur im Marktsegment X absetzen und dass die Nachfrager<br />
dieses Segmentes bisher ihren Bedarf ausschließlich bei diesen Anbietern<br />
decken.<br />
20 Punkte<br />
Der Anbieter C beschließt daraufhin, sich im Markt zu repositionieren.<br />
Er geht davon aus, dass durch diese Repositionierung das gesamte<br />
Potenzial <strong>des</strong> Segmentes X ausgeschöpft werden kann und dass<br />
die Kunden dieses Segmentes, die bisher keine Güter in diesem<br />
Markt nachgefragt haben, bei ihm kaufen. Gleichzeitig nimmt er an,<br />
dass er in dem Marktsegment Y einen Umsatz von 20 Mio. Euro verlieren<br />
wird und dass dieser Umsatz zu gleichen Teilen von den Anbietern<br />
F und G abgeschöpft wird.<br />
Wie groß sind die Umsätze, Marktanteile und relativen Marktanteile<br />
der Anbieter nach dieser Repositionierung, wenn sich die Annahmen<br />
von Anbieter C als richtig erweisen? Betrachten Sie bei der Berech-
Klausur ‚Grundlagen <strong>des</strong> Marketing‘ – <strong>WS</strong> <strong>2009</strong>/<strong>2010</strong> 3<br />
nung der relativen Marktanteile den größten Wettbewerber und nur<br />
für den Marktführer den nächststärkeren Wettbewerber!<br />
Anbieter A<br />
Anbieter B<br />
Anbieter C<br />
Anbieter D<br />
Anbieter E<br />
Anbieter F<br />
Anbieter G<br />
Umsätze<br />
in Mio. Euro<br />
Marktanteile<br />
(in %)<br />
Rel. Marktanteile<br />
Aufgabe 2: Produktinnovationsprozess<br />
Durch die Entwicklung und Einführung eines neuen Produktes soll sehr<br />
häufig eine ‚Marktneuheit‘ geschaffen werden.<br />
a) Erläutern Sie zunächst den Begriff der Produktinnovation und grenzen<br />
Sie vor diesem Hintergrund ‚Marktneuheiten‘ von ‚Unternehmensneuheiten‘<br />
ab! Um ein neues Produkt zu generieren, wird ein Innovationsprozess<br />
durchlaufen. Stellen Sie beispielhaft mögliche Phasen eines<br />
solchen Innovationsprozesses dar! Studien haben jedoch gezeigt,<br />
dass die Misserfolgsquote von Produktinnovationen bis zu 99 % beträgt.<br />
Wie beurteilen Sie angesichts dieses Risikos aus der Perspektive<br />
eines Unternehmens die Notwendigkeit zur Entwicklung von Marktneuheiten?<br />
b) Es bieten sich im Rahmen der Entscheidungsfindung über die Entwicklung<br />
und Vermarktung von Produktinnovationen zwei Vorgehensweisen<br />
an: Bei einem ‚Top down-Ansatz‘ werden alle mit der<br />
Produktentwicklung einhergehenden Entscheidungen von der Unternehmensleitung<br />
getroffen und in Form von Vorgaben an die unteren<br />
Hierarchieebenen zur Umsetzung weitergeleitet. Bei einem ‚Bottom<br />
30 Punkte<br />
15 Punkte<br />
10 Punkte
Klausur ‚Grundlagen <strong>des</strong> Marketing‘ – <strong>WS</strong> <strong>2009</strong>/<strong>2010</strong> 4<br />
up-Ansatz‘ erfolgen auf allen organisatorischen Ebenen <strong>des</strong> Unternehmens<br />
Abstimmungsprozesse (ausgehend von der Unternehmensbasis)<br />
mit dem Ziel einer konsensualen Entscheidungsfindung. Die<br />
zeitliche Inanspruchnahme für die ‚Entscheidungsfindung‘ und die<br />
‚Entscheidungsdurchsetzung‘ kann der nachstehenden Abbildung beispielhaft<br />
entnommen werden.<br />
Zeitliche Inanspruchnahme der Prozesse<br />
‚Entscheidungsfindung‘ und ‚Entscheidungsdurchsetzung‘<br />
Entscheidungsfindung<br />
(Top down-<br />
Ansatz)<br />
Entscheidungsfindung<br />
(Bottom up-<br />
Ansatz)<br />
Entscheidungsdurchsetzung<br />
(Top down-<br />
Ansatz)<br />
Entscheidungsdurchsetzung<br />
(Bottom up-<br />
Ansatz)<br />
Reifegrad der<br />
Entscheidungsfindung<br />
t 1 t 2 t 2 * t 1 *<br />
Zeitbedarf<br />
Diskutieren Sie vor diesem Hintergrund die möglichen Ursachen für<br />
die unterschiedlichen Zeitbedarfe! Welche Vor- und Nachteile ergeben<br />
sich aus beiden Ansätzen? Verdeutlichen Sie Ihre Ausführungen<br />
exemplarisch anhand eines Innovationsprozesses!<br />
c) Angenommen, die Unternehmensleitung entscheidet sich für den<br />
Bottom up-Ansatz, um z. B. alle Unternehmensebenen bereits in die<br />
Ideengenerierung mit einzubeziehen. Welchen zusätzlichen Beitrag<br />
könnte die Integration von potenziellen Kunden in diesem Stadium<br />
<strong>des</strong> Innovationsprozesses leisten? Ist eine Integration von potenziellen<br />
Kunden auch in späteren Phasen <strong>des</strong> Innovationsprozesses sinnvoll?<br />
Begründen Sie Ihre Antwort und verdeutlichen Sie Ihre Ausführungen<br />
anhand eines selbst gewählten Beispiels!<br />
5 Punkte
Klausur ‚Grundlagen <strong>des</strong> Marketing‘ – <strong>WS</strong> <strong>2009</strong>/<strong>2010</strong> 5<br />
Aufgabe 3: Ziele der Kommunikationspolitik<br />
Die Ziele der Kommunikationspolitik lassen sich grob in ökonomische<br />
Ziele (z. B. Marktanteil, Umsatz, Gewinn) und vorökonomische Ziele<br />
(z. B. Einstellungen, Images) einteilen.<br />
a) Inwiefern hängen vorökonomische und ökonomische Ziele zusammen?<br />
Belegen Sie Ihre Ausführungen anhand eines aussagekräftigen<br />
Beispiels!<br />
b) Welche Schwierigkeiten können auftreten, wenn man die Wirkung der<br />
Kommunikationspolitik ausschließlich anhand vorökonomischer oder<br />
ökonomischer Größen misst?<br />
c) Wie kann man die Schwierigkeiten, die in Aufgabe b) offenbar wurden,<br />
durch einen geeigneten Messansatz vermeiden?<br />
30 Punkte<br />
15 Punkte<br />
10 Punkte<br />
5 Punkte<br />
Aufgabe 4: Distributionspolitik<br />
Im Rahmen der Distributionspolitik sind Grundsatzentscheidungen über<br />
die Art der Distribution und über die Gestaltung der Vertriebssysteme zu<br />
treffen.<br />
a) Welche Arten der Distribution können mit Blick auf die Absatzkanalbreite<br />
(Anzahl der Verkaufsstellen) unterschieden werden? Erläutern<br />
Sie diese ausführlich und zeigen Sie den Zusammenhang zu ausgewählten<br />
Produkteigenschaften auf!<br />
b) Zeigen Sie, welchen Einfluss Electronic Commerce auf die Struktur<br />
von Vertriebssystemen hat!<br />
c) Diskutieren Sie, welchen Einfluss das Internet im Bereich Businessto-Business<br />
auf die Machtverhältnisse zwischen Hersteller und Handel<br />
hat!<br />
30 Punkte<br />
15 Punkte<br />
10 Punkte<br />
5 Punkte