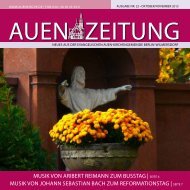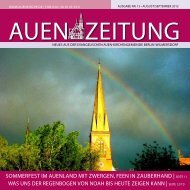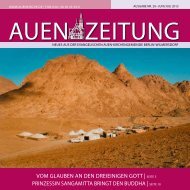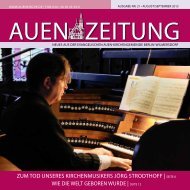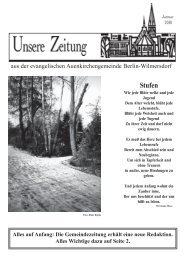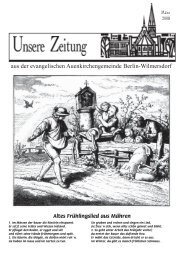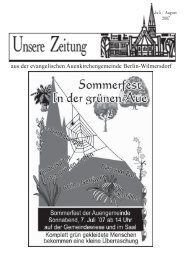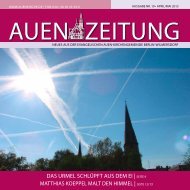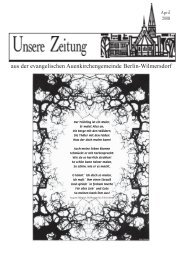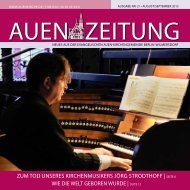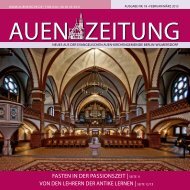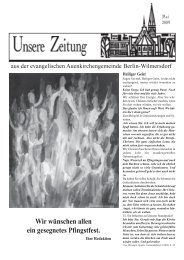aus der evangelischen Auenkirchengemeinde Berlin-Wilmersdorf
aus der evangelischen Auenkirchengemeinde Berlin-Wilmersdorf
aus der evangelischen Auenkirchengemeinde Berlin-Wilmersdorf
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
4 Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus<br />
27. Januar - Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus<br />
Am 27. Januar 1945 wurde das KZ Auschwitz befreit. 1996 erklärte <strong>der</strong> damalige Bundespräsident<br />
Roman Herzog diesen Tag zu einem beson<strong>der</strong>en Gedenktag. Herzog sagte in <strong>der</strong><br />
Proklamation: "Die Erinnerung darf nicht enden; sie muss auch künftige Generationen zur<br />
Wachsamkeit mahnen. Es ist deshalb wichtig, nun eine Form des Erinnerns zu finden, die<br />
in die Zukunft wirkt. Sie soll Trauer über Leid und Verlust <strong>aus</strong>drücken, dem Gedenken an<br />
die Opfer gewidmet sein und je<strong>der</strong> Gefahr <strong>der</strong> Wie<strong>der</strong>holung entgegenwirken." Die Auen-<br />
Gemeinde nimmt diesen Gedenktag zum Anlass, nachfolgend die Rede von Monika<br />
Thiemen, Bezirksbürgermeisterin von <strong>Wilmersdorf</strong>-Charlottenburg, abzudrucken, die Frau<br />
Thiemen im Gedenkgottesdienst am 9. November 2008 in <strong>der</strong> Auenkirche hielt. In ihrer<br />
Rede spricht sie auch die ehemalige Synagoge in <strong>der</strong> Prinzregentenstraße an. Der Geschichte<br />
dieser Synagoge spürt Elisabeth Gründler in ihrem Beitrag nach.<br />
Pfarrerin Katharina Plehn-Martins<br />
Rede <strong>der</strong> Bezirksbürgermeisterin Monika Thiemen im Gedenkgottesdienst<br />
zum 9. November am 9. November 2008<br />
Sehr geehrte Frau Plehn-Martins! Sehr geehrte<br />
Gemeindemitglie<strong>der</strong>!<br />
Sehr geehrte Damen und Herren!<br />
Der 9. November 1938 scheint Lichtjahre<br />
von uns entfernt zu sein. Wir empfinden den<br />
Abstand zu diesem Datum größer als den<br />
zum finstersten Mittelalter. Bis heute können<br />
wir es letztlich nicht verstehen, wie es<br />
geschehen konnte, wie so viele mitmachen<br />
und wie so viele tatenlos zusehen konnten.<br />
Und es ist eben nicht Lichtjahre her, son<strong>der</strong>n<br />
erst 70 Jahre. Es leben noch Zeitzeugen,<br />
<strong>der</strong>en Berichte uns fassungslos machen.<br />
Vor 20 Jahren haben wir uns zum 50. Jahrestag<br />
<strong>der</strong> Pogromnacht intensiv mit den<br />
ehemaligen <strong>Wilmersdorf</strong>er Synagogen beschäftigt,<br />
und wir mussten feststellen, dass<br />
die Synagogen in <strong>der</strong> Prinzregentenstraße,<br />
in <strong>der</strong> Markgraf-Albrecht-Straße und in <strong>der</strong><br />
Franzensba<strong>der</strong> Straße nicht nur am 9. November<br />
1938 angezündet und stark beschädigt<br />
wurden, son<strong>der</strong>n dass danach die Bauaufsicht<br />
des Bezirksamtes <strong>Wilmersdorf</strong> kam<br />
und feststellte, dass die Sicherheit <strong>der</strong> Passanten<br />
nicht mehr gewährleistet war, weil<br />
Teile <strong>der</strong> beschädigten Synagogen baufällig<br />
geworden waren. Die Jüdische Gemeinde<br />
wurde dazu verpflichtet, die Schäden zu<br />
beseitigen, und <strong>der</strong> Architekt Alexan<strong>der</strong><br />
Beer, <strong>der</strong> knapp 10 Jahre zuvor, von 1928<br />
bis 1930 die große Synagoge <strong>Wilmersdorf</strong><br />
an <strong>der</strong> Prinzregentenstraße 70 gebaut hatte,<br />
musste jetzt nach den Anweisungen <strong>der</strong><br />
bezirklichen Bauaufsicht ihren Teilabriss<br />
organisieren.<br />
Dieses Vorgehen war keine <strong>Wilmersdorf</strong>er<br />
Beson<strong>der</strong>heit. Im Gegenteil: Es war allgemein<br />
üblich, dass die verfolgten und angegriffenen<br />
Juden damals von den Behörden<br />
noch weiter schikaniert wurden, dass sie für<br />
das Unrecht verantwortlich gemacht wurden,<br />
dass sie erlitten.<br />
Für uns war diese Entdeckung Anlass, einmal<br />
genauer hinzuschauen und das Verhalten<br />
<strong>der</strong> Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des<br />
Bezirksamtes <strong>Wilmersdorf</strong> während <strong>der</strong> Zeit<br />
des Nationalsozialismus zu erforschen.<br />
Die Ergebnisse haben wir 1992 in dem Buch<br />
"Kommunalverwaltung unterm Hakenkreuz"<br />
veröffentlicht. Lei<strong>der</strong> mussten wir<br />
feststellen, dass es in diesem Bezirksamt von<br />
sehr wenigen Ausnahmen abgesehen keinen<br />
Wi<strong>der</strong>stand gab. Im Gegenteil: Der Begriff<br />
"Willige Vollstrecker", <strong>der</strong> einige Jahre später<br />
geprägt wurde, trifft sowohl auf die politische<br />
Führung als auch auf die meisten<br />
Beschäftigen im Rath<strong>aus</strong> <strong>Wilmersdorf</strong> zu.<br />
<strong>Wilmersdorf</strong> war in den 1920er und 30er<br />
Jahren <strong>der</strong> <strong>Berlin</strong>er Bezirk mit dem höchsten<br />
Anteil jüdischer Bevölkerung. Damals<br />
lebten hier etwa 30.000 Juden, was einem<br />
Gesamtbevölkerungsanteil von etwa 13%<br />
entsprach, während er in ganz <strong>Berlin</strong> nur<br />
3,8% betrug. Die Bezirksverwaltung tat seit<br />
1933 alles, um die nationalsozialistischen<br />
Vorgaben zur Ausgrenzung und Diskriminierung<br />
<strong>der</strong> Juden umzusetzen, zum Teil<br />
sogar in vor<strong>aus</strong>eilendem Gehorsam schon<br />
bevor entsprechende Verordnungen für ganz<br />
<strong>Berlin</strong> erlassen wurden. Bereits 1937 wurden<br />
beispielsweise in den öffentlichen Parks<br />
gelbe Bänke "nur für Juden" aufgestellt.<br />
Allerdings hat <strong>der</strong> Amtmann Riedler im<br />
Gartenbauamt <strong>Wilmersdorf</strong> diese Maßnahme<br />
ad absurdum geführt, indem er auf dem<br />
Prager Platz eine gelbe und eine normale<br />
Bank direkt einan<strong>der</strong> gegenüber aufgestellt<br />
hat, so dass Juden und Nichtjuden sich di-<br />
rekt in die Augen sehen mussten. Er wurde<br />
dafür vom Nazi-Bürgermeister Petzke gerügt<br />
und in die Steuerkasse strafversetzt.<br />
Nach und nach führten alle Ämter getrennte<br />
Bereiche für Juden und Nichtjuden ein,<br />
und schließlich wurden fast überall Juden<br />
von den öffentlichen Leistungen <strong>aus</strong>geschlossen,<br />
an<strong>der</strong>erseits aber verstärkt überwacht<br />
und schikaniert.<br />
Die Historiker sprechen heute von einer<br />
"Zustimmungsdiktatur", wenn sie die Beziehung<br />
zwischen dem nationalsozialistischen<br />
Machtapparat und <strong>der</strong> Bevölkerungsmehrheit<br />
beschreiben wollen. Inzwischen<br />
gibt es Studien über fast alle Berufsgruppen<br />
und gesellschaftlichen Institutionen, die<br />
immer zum gleichen Ergebnis kommen: Die<br />
meisten Menschen haben nicht protestiert<br />
o<strong>der</strong> gar Wi<strong>der</strong>stand geleistet, son<strong>der</strong>n sie<br />
haben mehr o<strong>der</strong> weniger begeistert mitgemacht<br />
- zumindest solange, bis <strong>der</strong> Krieg<br />
sich 1942/43 gegen die Deutschen richtete.<br />
Auch die Kirchen haben sich in den letzten<br />
Jahren aktiv mit ihrer Rolle und mit dem<br />
Verhalten ihrer Mitglie<strong>der</strong> im Nationalsozialismus<br />
<strong>aus</strong>einan<strong>der</strong>gesetzt. Beson<strong>der</strong>s<br />
beeindruckend finde ich das immer, wenn<br />
es vor Ort geschieht, wenn eine Gemeinde<br />
sich ihrer eigenen Geschichte stellt, so wie<br />
die Auengemeinde es seit Jahren tut. ...<br />
Diese Erinnerung sind wir nicht nur den<br />
Opfern schuldig. dass wir sie nicht vergessen,<br />
son<strong>der</strong>n es ist auch für uns selbst wichtig,<br />
dass wir unsere Verantwortung vor unserer<br />
Geschichte wahrnehmen: Um <strong>aus</strong> <strong>der</strong><br />
Geschichte lernen zu können und zu verhin<strong>der</strong>n,<br />
dass etwas Ähnliches jemals wie<strong>der</strong><br />
geschieht, müssen wir unsere Geschichte<br />
kennen. Es gibt noch einen weiteren Grund,<br />
weshalb wir zur Erinnerung verpflichtet<br />
sind: Es ist ein großes Glück, dass wie<strong>der</strong><br />
jüdische Bürgerinnen und Bürger bei uns<br />
und mit uns zusammen leben und sich für<br />
unsere Gesellschaft engagieren. Der Umgang<br />
miteinan<strong>der</strong> ist noch immer nicht unbefangen.<br />
Aber eine Verständigung ist nicht<br />
möglich, wenn wir die gemeinsame Geschichte<br />
ignorieren, son<strong>der</strong>n nur wenn wir<br />
uns ihrer bewusst sind und offen damit umgehen.<br />
Wir wissen, dass die Erinnerung nie<br />
abgeschlossen sein wird. Erinnerung bedeutet<br />
ständiges Forschen, und jede neue Generation<br />
wird sich die Erinnerung neu erarbeiten<br />
müssen. Deshalb wird es noch viele<br />
Stolpersteine und viele Publikationen geben,<br />
die unsere Erinnerung wach halten. ...